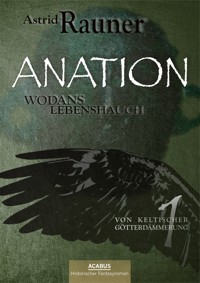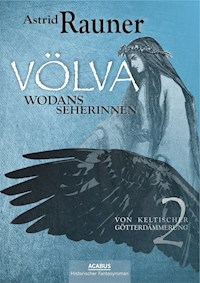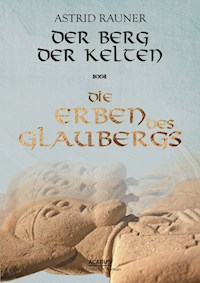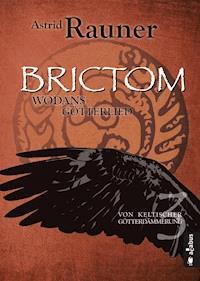
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Von keltischer Götterdämmerung
- Sprache: Deutsch
Geschriebene Worte tragen eine Macht in sich, die über das Schicksal Tausender entscheiden kann: Auf ihrer Flucht aus dem Norden haben Aigonn und Tiuhild den Zorn des Sturms geweckt. Eine Sturmflut verwüstet die Länder der Kimbern und zwingt sie, ihre angestammte Heimat zu verlassen. Aigonn wird dabei als Seher zu einer nützlichen Geisel. Sie ahnen nicht, dass der Sturmgeist Wode Aigonn und Tiuhild verfolgt. Immer größeren Einfluss gewinnt er über den Geist der jungen Frau und Aigonn fürchtet um ihr Leben. In seiner Heimat droht Fürst Rowilan den Rückhalt seiner letzten Verbündeten zu verlieren. Dann ereilt ihn unerwartete Hilfe, doch wird sie ihm zum Sieg gegen den übermächtigen Gegner verhelfen? Und welches Geheimnis hütet Aigonns totgeglaubter Vater, der überraschend zu seinem Stamm zurückkehrt? Eine uralte Beschwörung soll die Macht der Götter entfalten. Aber der Preis dafür ist hoch und Aigonn begreift, dass Geister zu Göttern werden können, Vertraute zu Verrätern und manche Geschichten erst mit dem Tod beginnen … Der letzte Teil der Trilogie "Von keltischer Götterdämmerung" bringt die Lösung des Rätsels – und die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die sich niemals vollständig erklären lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 855
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Rauner
Brictom
– Wodans Götterlied –
Von keltischer Götterdämmerung 3
Rauner, Astrid: Brictom – Wodans Götterlied. Hamburg, acabus Verlag 2017
1. Auflage
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-507-3
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-508-0
Print: ISBN 978-3-86282-506-6
Lektorat: Laura Künstler, acabus Verlag
Satz: Laura Künstler, acabus Verlag
Cover: © Marta Czerwinski, acabus Verlag
Covermotiv: © rubyfox - Fotolia.com, © Eky Chan - Fotolia.com,Nauheimer Quinar: © Harro Junk, Oberursel
Die Originalfunde stammen aus dem Heidetränk-Oppidum bei Oberursel/Taunus. Sie sind im Vortaunusmuseum in der Keltenausstellung zu besichtigen.
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© acabus Verlag, Hamburg 2017
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Den Göttern und meinen Vorfahren.
Was bisher geschah
In den hügeligen Ländern, die hinter den Ufern des Flusses Rur liegen, herrschen um das Jahr 120 v. Chr. die Stämme der Eichenleute und Bärenjäger. Eigentlich verbindet diese Leute über Jahre eine enge Freundschaft, gemeinsame Familienbanden wurden geknüpft und die jeweils anderen Herrscher bei wichtigen Fragen zu Rate gezogen. Dann jedoch kommt es zum Bruch zwischen dem Bärenfürsten Behlenos und dem Anführer der Eichenleute, Khomal. Grund sind Anschuldigungen der Eichenleute, die Bärenjäger seien dafür verantwortlich, dass Schamanenschüler der Eichenleute ums Leben kommen, oder sich teilweise selbst wie wahnsinnig in den Freitod stürzen.
Die Schlacht, die daraus erwächst, hätte Behlenos und seinen Bärenjägern beinahe den Untergang gebracht. Im letzten Moment wird den Göttern von ihnen das wertvollste aller Geschenke, ein Menschenleben, als Opfer dargebracht. Doch dieses junge Mädchen, das man Lhenia nannte, erwacht noch in derselben Nacht von den Toten und wendet das Schlachtenglück. Der Einzige, der diesen Augenblick beobachtet, ist ein junger Bärenjäger namens Aigonn. Dieser verdingt sich eigentlich zusammen mit seinem jüngeren Bruder Efoh als Schäfer und ist in der Obhut seines Stiefonkels Aehrel aufgewachsen. Jahre zuvor nämlich hat eine Tragödie seine Familie auseinandergerissen.
Aigonns ältere Schwester Derona wurde mit einer übermenschlichen Gabe geboren. Sie war eine Seherin, die mit den Geistern der Toten sprechen und in die jenseitige Welt, die Andere Welt, sehen konnte. Als Schülerin des höchsten Schamanen der Bärenjäger, Rowilan, hätte ihr eine große Zukunft bevorstehen können. Kurz nach Beginn ihrer Ausbildung verlor Derona jedoch den Verstand und stürzte sich von einem Felsen in den Tod.
Aigonn ist zu jener Zeit ebenso wie der Rest seiner Familie überzeugt, Rowilan sei der Schuldige an ihrem Schicksal. Aigonns Vater war vor Jahren weit genug gegangen, Rowilan zu bedrohen und wurde wegen des Mordversuches an dem Schamanen aus der Siedlung verbannt. Aigonn blieb mit seinem Bruder und seiner Mutter zurück, deren Geist sich über die Trauer und den Verlust immer weiter von den Menschen zurückzog.
Nun, da Aigonn einziger Zeuge ist, als das Menschenopfer von den Toten erwacht, zieht er die Aufmerksamkeit Rowilans auf sich. Dieser vermutet schon lange, dass Aigonn die gleichen Talente wie seine Schwester in sich trägt. Wovon er nichts weiß, ist die Existenz einer Nebelfrau, eines Naturgeistes, der Aigonn seit seinen Kindertagen beschützt und ihm auch jetzt zur Seite steht, da Aigonn immer häufiger mit seiner Sehergabe konfrontiert wird. Letztlich findet er heraus, dass jene wiedergekehrte Tote nicht das geopferte Mädchen selbst ist. Stattdessen hat sich ein fremder Geist, eine wiedergekehrte Seele aus der Vergangenheit, dem toten Körper bemächtigt.
Erst nach und nach klärt sich ihre Identität: Die Wiedergekehrte war einst die Tochter eines mächtigen Sehers und Schamanen der Eichenleute, den man den Moorsänger nannte. Der Moorsänger stammte ursprünglich aus dem fernen Norden, von einer Insel, die man Skandia nennt. Seinen wahren Namen, Alregard, kennt in Aigonns Heimat nahezu niemand. Als mächtigster unter den Schamanen wurde er letztlich von den Eichenleuten sogar zum Fürsten bestimmt und hinterließ der Nachwelt zwei Söhne und eine Tochter, Haelinon, die nach seinem Tod als mächtigste Schamanin ihrer Zeit galt.
Haelinon ist im Körper der Toten wiedererwacht. Sie wurde von ihrem eigenen Sohn aus dem Totenreich gerufen, von Aehrel, der sich letztlich auch als Schuldiger am Tod von Derona und den anderen Schamanenschülern herausstellt. Aehrel, ihr spätes und verstoßenes Kind, war besessen von dem Gedanken, ihren Geist aus dem Totenreich zu beschwören, damit sie die Schuld an ihm begleichen könne, die er ihr nach ihrem damaligen Ableben zugesprochen hatte.
Aehrel, der darüber verzweifelte, keine der Gaben seiner Vorfahren geerbt zu haben, benutzte die Schamanenschüler, um Zugang zur Anderen Welt zu erhalten, ohne jedoch kontrollieren zu können, was dabei geschah. Zuletzt zwingt er sogar Aigonns Geist zum Übergang in die Andere Welt. Dieser begegnet dort seiner bis dahin verstorbenen Mutter und steht schließlich den Göttern gegenüber, darunter dem Herrn des Lebens, Lugus selbst, der ihn schließlich über seine Geistersehergabe hinaus mit der Fähigkeit beschenkt, auch in die Zukunft sehen zu können.
Die Vorahnungen, mit welchen der Gott Aigonn zurück in die Welt der Menschen sendet, sind jedoch düster. Der zu Unrecht beschuldigte Rowilan kann Aehrel gefangennehmen. In einem letzten Kampf mit den Eichenleuten wird dann aber der Bärenfürst Behlenos getötet, bevor die Verbrechen durch Rowilan und Aehrel kurz vor der Sommersonnenwende aufgeklärt werden.
Rowilan ist danach vom Hass auf Aehrel zerfressen. Er hat Derona, Aigonns Schwester, geliebt. Sein Zögern, Aehrel zu töten, bietet allerdings Haelinon die Gelegenheit, ihren Sohn zu befreien und mit ihm in die Wälder zu fliehen. In den Monaten danach versucht Rowilan, Aigonn als seinen Schüler zum Schamanen auszubilden. Bereits im Herbst jedoch verlässt Aigonn die Bärenjäger auf eine Reise in Richtung Norden. Sein Ziel ist Skandia, die Heimat des Moorsängers, wo Aigonn hofft, andere Seher zu treffen und sich dort einen neuen Lehrmeister zu suchen. Den Stämmen seiner Heimat wurde nämlich, außer ihm und seiner Schwester, seit Generation kein Seher mehr geboren. Das vorbelastete Verhältnis zu Rowilan macht ihm den Abschied leicht.
Mit dem Segen der Götter erreicht Aigonn die Küsten des Nordmeeres und findet dort Unterschlupf bei einer Fischerfamilie vom Stamm der Kimbern. Er beobachtet dort eines Tages durch Zufall, wie das Familienoberhaupt Lorn eine Sklavin misshandelt, eine ihm unheimliche, junge Frau, die auf den Namen Tiuhild hört. In dem Fischerdorf sagt man ihr dämonische Kräfte nach, sie sei eine Hazusa, eine Hexe. Als Lorn wenig später einen Herzanfall erleidet, glauben alle, Tiuhild hätte einen Fluch über ihn gelegt. Die junge Frau soll zur Rechenschaft gezogen werden, Aigonn aber, entsetzt von der Engstirnigkeit der Dorfbewohner, verhilft ihr zur Flucht unter der Bedingung, von ihr nach Skandia gebracht zu werden. Tiuhilds Sippe selbst lebt nicht weit entfernt von den Leuten des Moorsängers.
Bald jedoch bereut Aigonn seine Entscheidung. Tatsächlich ist Tiuhild in Besitz einer dunklen Kraft, über die sie kaum Kontrolle hat. Im Gegensatz zu anderen Schamanen ist sie in der Lage, den Geistern, die im Meer, den Wäldern oder der Luft leben, für kurze Zeit ihren Willen aufzuzwingen und diese zu manipulieren. Dadurch ist ihr die ewige Rache der Geister gewiss.
Tatsächlich gelingt es Tiuhild jedoch, Aigonn trotz eines Schiffbruchs auf der Überfahrt, nach Skandia zu bringen. Kaum dort angekommen, drängt Aigonn darauf, seinen Weg von dem der jungen Frau zu trennen. In der Heimat des Moorsängers empfängt man ihn aber mit Ablehnung. Er wird davongejagt und ist letztlich wieder auf Tiuhilds Hilfe angewiesen. Es stellt sich heraus, dass Alregard, der Moorsänger, seiner Zeit von seiner Sippe auf Grund eines Vergehens an den Göttern verstoßen wurde. Alregard hat ein Heiligtum des Donnergottes entweiht und dabei den Zorn dessen Dieners, des Sturmgeistes Wode, auf sich gezogen.
Nachdem Aigonn eine dunkle Vision über die Geschehen in seiner Heimat empfängt, reist er mit Tiuhild in jenes Heiligtum, um festzustellen, dass Alregard dort ein uraltes Wandbild beschädigt und scheinbar ein Stück Fels daraus entfernt hat. Wode fühlt sich durch die Kühnheit der Eindringlinge herausgefordert. Er verfolgt die Gefährten fortan, die überstürzt beschließen, zurück in Aigonns Heimat aufzubrechen. In einer Vision ereilt Aigonn nämlich der Hilferuf Rowilans.
Dieser ist in der Zwischenzeit überraschenderweise durch ein Gottesurteil zum Fürsten der Bärenjäger erwählt worden. Sein Widersacher Fewiros, der Vetter des verstorbenen Fürsten Behlenos, erkennt ihn als solchen jedoch nicht an. Obendrein paktiert Fewiros mit einem Schamanen der Eichenleute, einem alten Götterdiener mit Namen Germos. Rowilan, der einen neuen Krieg fürchtet, als drei seiner Späher, darunter ein guter Freund von ihm, verschwinden, findet heraus, dass der Eichenfürst Barnas selbst scheinbar nichts von den Geschehen weiß. Germos handelt in eigenem Ermessen.
Haelinon lüftet für Rowilan schließlich das Geheimnis, dass Germos offenbar auf der Suche nach jenem Schatz, jener Reliquie, dem Stück des Wandbildes ist, das Alregard aus Skandia gestohlen hat. Weder Haelinon, noch Rowilan oder Germos wissen jedoch, worum genau es sich bei dieser Reliquie handelt. Haelinon offenbart lediglich, dass sie große, unheilvolle Macht besitzen soll. Die Tochter des Moorsängers versucht alles zu tun, um die Reliquie in ihren Besitz zu bringen und vor dem Zugriff der Fremden zu schützen – auch vor dem Rowilans. Sie erfährt, dass es in ihrem alten Leben Germos war, der sie tötete. Sie verstümmelt den Schamanen, lässt ihn allerdings am Leben.
Gemeinsam mit Rowilan finden sie das Versteck des Wandbildes, das jedoch bereits ausgeraubt wurde. Kein Hinweis ist auf denjenigen vorhanden, der die Reliquie genommen haben könnte. Rowilan entdeckt lediglich einen dort verlorenen Ring, den er verheimlicht und versteckt.
Die Rolle des Fürsten lastet schwer auf ihm. Fewiros hat ihm in der Zwischenzeit offen den Krieg erklärt, die Treue seiner Verbündeten ist wankelmütig. Gerade so gelingt es ihm unter großen Verlusten, Fewiros zurückzuschlagen. Dann aber muss er erfahren, dass eine seiner engsten Vertrauten, seine Freundin Maelina, ihn ebenfalls verraten hat und mit Fewiros paktiert. Ohnmächtig über diese Enthüllung nimmt er Haelinon und Aehrel gefangen und erwartet nun mit Schrecken die nahe Zukunft und einen weiteren Angriff des Fewiros, von welchem er nicht weiß, wie er ihn noch abwehren soll.
Prolog
Die Glut im Herdfeuer des Bärenfürsten war erloschen. Der Regen, der durch den Rauchabzug hineingefallen war, hatte das restliche Holz zu stark durchnässt, um es wieder zum Brennen zu bringen. Rowilan lag fröstelnd in seiner ausgekühlten Bettstatt. Zwar hatten die Schaffelle ihn noch gewärmt, als er unter sie gekrochen war, nur die Kälte in seinem Innersten, die mochten sie nicht zu vertreiben.
Im Schwindel des Einschlafens drehte er sich auf die Seite und starrte mit halboffenen Augen zur Wand. Seine Gedanken waren schon fern, als er ohne zu denken eine Hand unter den Fellen und seiner Decke hervor schälte, über den freien Platz neben sich in der Bettstatt tastete, suchend, bis ihm gewahr wurde, dass es nichts zu finden gab. So lang schon nicht mehr.
Augenblicklich legte sich über Rowilan eine uralte Traurigkeit. Der Schmerz hatte in den Jahren an Heftigkeit verloren. Nur die verkrustete Wunde, die er tief in ihm zurückgelassen hatte, vermochte noch immer zu bluten. Es genügten diese alten Gesten, seit acht Jahren leer und zwecklos, die er doch nicht hatte ablegen können. Ein Name hing plötzlich im Raum, der Rowilan eine stumme Träne aus dem Auge lockte.
Derona.
Der Gedanke an diesen Verlust, den bis heute niemand hatte aufwiegen können, verwandelte die Stille des Hauses in eine Einsamkeit, die Rowilan kaum noch ertragen konnte. Acht Jahre. Deronas Tod hatte eine Lücke in sein Leben gerissen. Mit ihr war ein Teil seiner Zukunft gestorben, die so ganz anders hätte verlaufen können. Im Grunde war ihr Tod der Anfang gewesen – der Beginn all dieses Unheils, das von Jahr zu Jahr angewachsen war.
Seine Gedanken waren bei ihr, als sich über ihn die Ruhe des Schlafes legte.
Es war eine Sommernacht gewesen. Der Duft blühenden Lebens hing über der Siedlung, von einer lauen Brise getragen, die Blütensamen über die Wiesen wehte. Und alle Menschen, die sich dem Schlaf noch nicht hingegeben hatten, waren hinaus auf die Rurauen gekommen, um gemeinsam zu feiern.
Rowilan umgab eine Flut aus Stimmen. Drei Lagerfeuer waren entzündet worden, deren Flammen Funken wie leuchtende Sterne in die Nacht hinaus schleuderten. Von allen Seiten kamen die Menschen auf ihn zu, überhäuften ihn mit Glückwünschen und Ehrbekundungen, die sein Geist noch gar nicht aufzunehmen in der Lage war, so sehr benebelte ihn noch die Wirkung des heiligen Trankes. Nur eines hatte er sich begreiflich machen können: Sie alle waren wegen ihm hier versammelt. Dies war sein Festtag.
„Ich wusste, dass es für dich eine Leichtigkeit sein würde.“ Eine Hand legte sich auf Rowilans Schulter und ließ ihn zur Seite sehen. Der Mann, der neben ihm stand, hatte die Vierzig lange überschritten. Graues Haar fiel ihm in lichten Strähnen bis zu den Schultern hinab und war mit einem Band aus Birkenrinde nach hinten gebunden. Im Gegensatz zu seinen Standesgenossen schmückte er sich nicht mehr mit den unzähligen Würdezeichen, die ihm als höchstem Schamanen seines Stammes zugestanden hätten, sondern hatte einzig eine knöcherne Schnitzerei an einem Lederband um den Hals gelegt. Es war eine Triade aus drei Vögeln, Symbol des Lugus, des Herrn des Lichtes, des Himmels und Schutzherr der Schamanen. Für einen Unwissenden kein kostbares Schmuckstück, doch für einen Eingeweihten von unschätzbarem Wert.
Segastes. Rowilans Lehrmeister. Höchster Schamane der Eichenleute.
Für sie beide war es ein besonderer Tag. Und Rowilan wollte diesem gerecht werden. Er hatte den Eindruck, dass er etwas entgegnen musste. Doch die Heftigkeit des gerade verstrichenen Rituals hatte ihm noch die Sprache geraubt. Die frische Tätowierung auf seiner bloßen Brust brannte wie Feuer. Sie war der reelle Beweis, dass all dies kein Traum sein konnte.
Segastes lächelte gütig, als könne er die Gedanken seines Schülers lesen. Dies war die Nacht ihres Abschiedes. Das Ende von Rowilans Ausbildung. Noch immer konnte er es nicht fassen.
Ich habe das heilige Ritual vollführt. Im Rausch des Trankes der Götter habe ich mich den Geistern des Waldes gestellt und einen Boten der Götter beschworen. Mein Leben und meine Dienste habe ich den Unsterblichengeweiht – ein gerechter Tausch für die Fähigkeiten, die sie mir verliehen haben. Mit meinem eigenen Blut habe ich den Pakt besiegelt und bin von einem Gott gezeichnet worden. Nein … einer Göttin. Artio. Herrin der Tiere. Gemahlin des Waldesherrn. Mutter des Artos. Beschützerin des Stammes, dem ich geboren wurde.
Wie in Trance hielt Rowilan sich jedes dieser Worte noch einmal vor Augen, bevor er begriff, dass sich um ihn eine gewaltige Menschenmenge versammelt hatte, die ihn erwartungsvoll anblickte. In ihr erkannte er unzählige Bewohner der Eichenfeste, die im Schatten des Hügelhanges über ihnen thronte. Aber mindestens ebenso viele Bärenjäger waren gekommen.
Das Ritual ist noch nicht zu Ende, musste er sich erinnern. Du musst den Menschen berichten, welche Botschaft dir die Götter verkündet haben.
Doch bevor Rowilan noch ein Wort herausbrachte, huschte sein Blick hilfesuchend zu seinem Lehrmeister, der lächelnd neben ihm stand. Noch ein letztes Mal, schienen seine Augen sagen zu wollen, zusammen. Dann fasste Segastes Rowilans rechtes Handgelenk und hob den Arm in die Höhe, als wolle er einen Sieger ehren. Was er der Menge jedoch präsentierte, war ein gerader, noch immer blutender Schnitt, der sich vom Handballen bis zu Rowilans kleinem Finger erstreckte. Mit schallender Stimme verkündete der Schamane: „Es ist mit Blut besiegelt worden! Die Götter haben das Opfer angenommen!“
Jubelschreie. Sein Jubel. Nur für Rowilan. Er hatte es geschafft, hatte bestanden, wo andere Schamanenschüler schon mit ihrem Leben gezahlt hatten. Hinter ihm lag die Prüfung, die jeder zu überwinden hatte, der den Göttern sein Leben weihte. Zu gewinnen gab es nur die Schamanenwürde, Schande oder den Tod.
Nun lag es an Rowilan. Als der junge Mann noch immer kein Wort über die Lippen brachte, flüsterte Segastes ihm zu, diesmal drängender: „Welcher Gott hat zu dir gesprochen? Du musst es ihnen sagen!“
Rowilan schloss die Augen und holte Luft. Dann rief er über die Menge: „ARTIO!“ Augenblicklich verstummten die Rufe. „Artio hat mein Opfer angenommen und mich gezeichnet!“
Erst erstauntes, dann verwirrtes Murmeln. Die ersten freudigen Rufe erschollen aus den hinteren Reihen der Menschenmenge, während die vorne Stehenden sich noch bewusst zu machen schienen, was diese Nachricht bedeutete. Artio hatte Rowilan gezeichnet. Jeder Schamane wurde im Ritus seiner Initiation von einem Gott anerkannt, unter dessen Schutz er von da an wirken sollte. Dass der hoffnungsvollste, erfolgreichste Schamanenschüler der Eichenfeste ausgerechnet von der Schutzherrin seines Herkunftsstammes, den Bärenjägern, erwählt worden war, verlieh diesem Festtag eine ungeahnte Wendung.
Auch Segastes zog nun erstaunt die Augenbrauen in die Höhe. Es war ein offenes Geheimnis gewesen, dass Rowilan als sein Nachfolger gehandelt wurde. Dass nun aber ausgerechnet die Göttin des Bärentotems ihn als Diener zu sich rief, war ein Zeichen der Götter, das nicht ignoriert werden durfte.
Artio ruft mich nach Hause. Rowilan begann allmählich zu begreifen. Ich werde nicht bei den Eichenleuten bleiben, sondern zu meinen Leuten zurückkehren.
Der erste aus der Menge, der dies zu begreifen schien, war ein in die Jahre gekommener Mann, dem das Alter aber die Würde und den Respekt seines Standes nicht hatte nehmen können. Gefolgt von einem noch jungen Krieger, der sein Glück kaum zu fassen schien, bahnte er sich einen Weg durch die Menge. Der goldene Fürstentorques an seinem Hals leuchtete im Feuerschein, als hätten die Götter das Metall entzündet. Strahlend trat er auf Rowilan zu, der sich das Ausmaß seiner Worte noch immer begreiflich zu machen versuchte, stellte sich an seine Seite und verkündete den nun irritiert diskutierenden Eichenleuten: „Die Götter haben entschieden und Rowilan die Würde des Schamanen zuerkannt! Er wird fortan im Dienste des Stammes wirken, dem er geboren wurde!“
„Rowilan!“ Dem jungen Krieger, der dem Bärenfürsten gefolgt war, war es endlich gelungen, für kurze Zeit die Aufmerksamkeit des neu ernannten Schamanen zu gewinnen. Aufgekratzt zupfte er immer wieder an Rowilans Gürtel, da er sich nicht zu trauen schien, den noch mit heiligem Ocker bemalten, bloßen Oberkörper zu berühren, und bedeutete diesem strahlend: „Rowilan, die Götter haben entschieden! Du kommst nach Hause! Wenn der Rat und die Schamanen des Hohen Göttersitzes erfahren, dass Artio selbst dich erwählt hat, obwohl die Eichenleute alle Ansprüche auf dich und deine Fähigkeiten erhoben haben, werden sie dich zu unserem höchsten Schamanen ernennen! Wenn Vater sein Wort für dich einlegt, wird es beschlossene Sache sein!“
Die kindliche Freude lockte Rowilan endlich ein Lächeln auf die Lippen und begann in seinem Geist die unerwartete Wendung der Ereignisse in freudige Leichtigkeit zu hüllen. Der junge Krieger, der mit seinen zwanzig Jahren kaum älter war als Rowilan selbst, war nun um die nötige Würde seines Standes bemüht. Sein Vater, der Fürst der Bärenjäger, hatte sich die Ehre herausgenommen – bestärkt durch Segastes – eine Lobrede auf Rowilans Können anzustimmen, von welcher der Geehrte jedoch nur die Hälfte zu fassen bekam.
Danach trat der Eichenfürst aus der Menge hervor, gefolgt von seinen eigenen Schamanen, um Rowilan zum Bestehen jener schweren Prüfung zu beglückwünschen. Die Enttäuschung über den Umbruch all seiner Pläne mit jenem talentierten Eingeweihten stand ihm jedoch ins Gesicht geschrieben. An der Seite von Segastes, dem Bärenfürsten und dessen Sohn ließ Rowilan alle Glückwünsche und Ehrbekundungen über sich ergehen wie einen Regenschauer, bevor man endlich von ihm abließ, und er im Schatten eines Weidengebüschs alles sacken lassen konnte, was am vergangenen Abend und der begonnen Nacht auf ihn eingeströmt war. Der Fürstensohn war dabei nicht von seiner Seite gewichen. Wie ein Kind, dem man soeben das schönste Geschenk seines Lebens gemacht hatte, tollte der Krieger um ihn herum, nutzte die erste Gelegenheit, um zwei Hörner mit bestem Met zu füllen, und wiederholte immer wieder: „Sie werden dich zu unserem höchsten Schamanen machen, ich weiß es! Wir werden eines Tages gemeinsam unseren Stamm anführen – so, wie wir es früher immer zusammengesponnen haben! Ich kann es immer noch nicht fassen!“
Behlenos. Der Name allein löste ein Stück der Anspannung von Rowilan, die Gewissheit, dass er heute Abend an seiner Seite war – der beste Freund seiner Kindertage. Lächelnd beobachtete der Schamane, wie dieser überschwänglich fast die Hälfte seines Mets auf die Wiese schüttete, begleitet von den Worten: „Alle Ehre der großen Artio, die unseren Rowilan nach Hause führt!“ Den nächsten tiefen Schluck nahm er selbst, bevor er unablässig weiterredete: „Oh, so viele Leute wirst du kennenlernen! Vater hat unsere Heimstatt ja in die neue Siedlung ganz im Westen verlegt. Von dort reitet man keinen ganzen Tag, um die Eichenleute zu erreichen. Du wirst es mögen! Warte!“
Damit rannte er johlend davon, um nur kurze Zeit später mit einer Gruppe junger Frauen zurückzukehren. Im Laufen noch tadelte er sie: „Warum ziert ihr euch so? Wollt ihr Rowilan nicht zu seiner großen Würde beglückwünschen? Ich sage euch, stellt euch gut mit ihm. Wer weiß, ob er nicht bald eine noch größere Ehre verliehen bekommt!“
„Bremse dich bitte, Behlenos!“, fand Rowilan endlich seine Sprache wieder. Der ganze Trubel wuchs ihm über den Kopf. Die Kritik, die in seinen Worten mitschwang, war jedoch keineswegs böse gemeint und trübte Behlenos’ Frohmut nicht im Geringsten. Stattdessen schob er die drei sich nun leicht beschwerenden, jungen Frauen wie ein Gastgeschenk vor seinen Freund, drängte sich zwischen sie und erklärte: „Das hier ist der bildschöne Spross zweier Berater meines Vaters.“ Er legte beide Arme anzüglich um so viele Taillen, wie er fassen konnte und gewährte zweien von ihnen, sich freundlich meckernd wieder aus seinem Griff zu befreien.
Diejenige, die in seinem Arm zurückblieb, war die einzige, die Rowilan kannte. Es war das Mädchen, das man Behlenos im vergangenen Sommer bereits versprochen hatte und nun bald seine Ehefrau werden würde. Von den anderen beiden trat eine hochgewachsene Dunkelhaarige auf Rowilan zu, verneigte sich ehrfürchtig und bekundete nun mit deutlich respektvollerer Distanz: „Ich beglückwünsche Euch zu der Ehre, die die Götter Euch erwiesen haben, mein Herr Rowilan. Es ist ein großes Glück für die Bärenjäger, dass Ihr heimkehren werdet!“
Was er darauf geantwortet hatte, war kaum der Rede wert gewesen. Es irritierte Rowilan zutiefst, dass Gleichaltrige ihm denselben Respekt entgegenbrachten, mit dem sie auch ihren Fürsten ansprachen. Das sindsie mir ab jetzt schuldig. Ich bin ein Diener der Götter, ein Schamane.
Endlich begann sich in Rowilan der Triumph über diesen Gedanken auszubreiten. Die Last, der Druck der vergangenen Monate fiel von ihm ab wie eine zerschlagene Rüstung und erfüllten den jungen Mann mit einer so beflügelnden Leichtigkeit, dass sich das Lächeln auf seinen Lippen mehr und mehr in ein Lachen verwandelte. Heimkehren. Nach so vielen Jahren.
Rowilan begann mit dem dunkelhaarigen Mädchen zu sprechen. Die Erinnerung daran, worüber sie geredet hatten, war schon lange verblasst. Irgendwann jedoch, nachdem Behlenos seine Aufmerksamkeit für kurze Zeit seiner Verlobten vergönnt hatte, stellte dieser fest: „Hier fehlt doch noch jemand! Renari!“ Er tippte der Dunkelhaarigen auf die Schulter. „Wo ist deine Freundin? Utilains Tochter ist mit hergekommen! Wo ist sie hin?“
„Da steht sie doch!“
Im selben Moment warf eine junge Frau mit gerunzelter Stirn den Kopf herum, die eben noch mit einem Händlerpaar aus der Eichenfeste gesprochen hatte.
Viel von diesem Abend war im Dunkel der Erinnerungen verschwunden, aber sie sah Rowilan auch nach so vielen Jahren noch vor sich wie an jenem Abend.
Das Mädchen war jünger als er gewesen, sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Das Alter hatte an ihrer knabenhaften Figur kaum Spuren hinterlassen. Es war Nacht. Im roten Schein des Feuers schimmerten alle Augen gleich. Nur ihre, ihre warmen, grünen Augen, waren anders als alle anderen. Wie von einem inneren Strahlen erfüllt, schienen sie aus der Dunkelheit zu leuchten, ein spöttisches Lächeln darin gefangen, das sich über alle Ergebenheit und Respektsbekundungen erhob.
Von einem Moment auf den anderen wurde Rowilan aus seiner Trance über ihren Anblick befreit. Wie ein störendes Element drängte Behlenos sich auf einmal in das Bild, während er auf die junge Frau zuging und mit großer Geste aufforderte: „Derona! Du zierst dich so! Wozu bist du hergekommen, wenn du es nicht einmal für nötig hältst, Rowilan deine Aufwartung zu machen!“
Der Fürstensohn wollte die junge Frau bereits am Arm fassen, um sie mit sich zu ziehen, doch diese entwischte seinem Griff mit vogelgleicher Leichtigkeit. Auf seinen Kommentar hin, zog sie unbeeindruckt die Augenbraue in die Höhe und setzte dem entgegen: „Ich wollte sehen, ob es nötig ist. Nur wie es scheint, befindet sich unser frisch ernannter Schamane in ausreichender Gesellschaft.“
„Du brauchst dich in dieser Runde nicht ausgeschlossen zu fühlen!“ Woher Rowilan auf einmal die Worte nahm, wusste er selbst nicht zu sagen. Ohne seine beiden Begleiterinnen noch eines Blickes zu würdigen, trat er auf Derona zu, die ihm jedoch nur noch widerwillig Aufmerksamkeit zollte. Immer wieder huschte ihr Blick zu ihren vorherigen Gesprächspartnern, die die Diskussion scheinbar ohne sie fortsetzten, und machte keinen Hehl daraus, dass sie an dieser neuen Unterhaltung ganz und gar kein Interesse hatte.
„Macht Euch keine Sorgen, Herr Rowilan. Wenn ich in dieser Hinsicht Bedenken hätte, würde ich mich zu Wort melden. Ihr solltet Euren Abend genießen und die Zeit nicht mit solchen Banalitäten vergeuden, außer denen ich zu Eurer Unterhaltung nichts beitragen kann. Wenn Ihr mich nun entschuldigen würdet?“
Damit hatte Derona sich bereits von ihm wegdrehen wollen, Rowilan aber reagierte schneller. Bevor die junge Frau seinem Griff entkommen konnte, hatte er sie an der rechten Schulter gefasst – ohne Gewalt, doch vehement genug, dass sie sich dem nicht entziehen konnte. Unmut machte sich nun in ihrer Miene breit, als der Schamane sie gegen ihren Willen zu sich zog und damit zwang, ihm in die Augen zu sehen. Ihre abweisende Art allein war eine Unhöflichkeit, die sich nur wenige an ihrer Stelle erlaubt hätten. Als Diener der Götter standen die Schamanen direkt unter den Fürsten – ja in mancher Weise sogar mit ihnen auf selber Höhe. Dass Derona ausgerechnet Rowilan, zu dessen Ehre diese Feier überhaupt abgehalten wurde, nun die angebrachten Höflichkeiten schuldig blieb, erboste diesen zu seinem eigenen Erstaunen keineswegs. Stattdessen war eine belustigte Neugierde in ihm erwacht, die dem Schamanen in dieser Art bisher fremd gewesen war.
Nachdrücklicher diesmal betonte er: „Du scheinst nicht verstanden zu haben, dass mir deine Anwesenheit ganz und gar nicht missfällt, Derona. Ich frage mich nur, warum es dir mit mir nicht genauso geht. Mir scheint fast, als hielte dich ein rechter Groll gegen mich davon ab, eine eigene Meinung einzuholen.“ Rowilan hatte amüsiert und souverän klingen wollen, um Derona für sich zu gewinnen. Diese schien sich aber nun verspottet zu fühlen. Mit funkensprühendem Blick sah sie zu ihm auf, versuchte, sich mit Gewalt seines Griffs zu entziehen, bevor sie zischte: „Nun, ich schätze das Wort meines Vaters. Und dieser nennt Euch einen aufgeblasenen Wichtigtuer. Einen, der die eben gleichen leeren Worte spricht wie die nordischen Schamanen, die früher von unseren Opfern zehrten, ohne je den wahren Willen der Götter zu vollführen.“
Für einen Herzschlag erstarrten sie beide. Der Nachhall ihrer Worte echote in Rowilans Ohren, dass ihm in seiner Fassungslosigkeit jede Entgegnung entfiel. Es war Derona, die sich als erste gewahr wurde, in welche Gefahr sie ihre Familie nun durch ihre Gedankenlosigkeit gebracht hatte. Doch obwohl eine Stimme in Rowilans Kopf aufschrie vor heillosem Zorn, nahm dieser nicht von ihm Besitz. Stattdessen entkam seiner Kehle ein so ungläubiges Lachen ob dieser Dreistigkeit, dass selbst die Umstehenden sich zu ihnen umblickten – ohne jedoch, dass Rowilan sich ihrer bewusst wurde.
Derona war in Erwartung seiner Wut in seinem Griff erstarrt. Was der Schamane dann jedoch tat, schien keiner von ihnen erwartet zu haben. Behutsam, ja beinahe liebevoll, griff Rowilan die rechte Hand der jungen Frau und legte deren Handfläche flach unterhalb seiner rechten Brust ab. Die frische Tätowierung, die man ihm dort nach Beendigung des Rituals gestochen hatte, schmerzte erbärmlich unter ihrer Berührung. Dieses Gefühl jedoch verflog in der Intensität des Moments.
Rowilan fühlte sie noch, die Berührung der Göttin, an eben jener Stelle, wo nun Deronas Hand lag. Ganz langsam legte er nun die eigene darüber. Er hatte keine Worte dafür, was in seinem Innersten geschah. Eine unbeschreibliche Wärme flutete seinen Körper, während er der jungen Frau in die Augen blickte. Und sie seinem Blick standhielt. Ganz leise nur, dass niemand der Umstehenden ihn hätte verstehen können, raunte Rowilan: „Ich bin kein Lügner. Die Götter haben zu mir gesprochen und eine von ihnen hat mich in ihren Dienst berufen. Es ist mir gleich, welche Geschichten andere Menschen zusammenspinnen, seien es Fremde, ein Fürst oder dein Vater. Ich selbst kenne die Wahrheit. Und ich kann sehen, du spürst sie auch, genau hier.“
Derona schwieg. Rowilan zählte die Herzschläge nicht, da sie ihm so zwiegespalten in die Augen sah. Einen anderen Menschen hätte der Schamane für seine Dreistigkeit bitter bestrafen können. Doch wusste er, dass sie es nicht getan hatte, um ihn zu demütigen. Sie war eine Jägerin, die den Gewinn ihrer Beute abwog. Und soeben hatte es den Eindruck, als erwache in ihr die Neugierde an dieser Jagd.
Rowilans Worte hatten sie nicht beunruhigt. Der Schamane war im Selben fasziniert und beängstigt ob dieser inneren Kraft, die in ihren Augen verborgen lag. Sie sah ihn nicht an, wie andere Menschen es taten. In jenem Augenblick, da es nur die Sterne, die Flammen und der Funkenregen der Lagerfeuer waren, die die Nacht erhellten, blickte sie durch alle Panzer, mit welchen der Schamane sich gegen die Außenwelt wappnete, und sah hinein in seine Seele. Und noch tiefer. Überrascht beobachtete Rowilan, wie, gleich von einer fremden Macht beschworen, die Erinnerung an das Ritual vor sein inneres Auge zurückkehrte. Die Emotionen schwemmten wie eine Wasserflut über ihn hinweg, seiner eigenen Kontrolle entzogen, für einen Herzschlag nur, bis sie sich ebenso schnell zurückzogen und er verstand, was geschehen war. Was Derona getan hatte.
Sie liest aus meinen Erinnerungen.
In diesem Moment verschwamm das Bild mit den Gefühlen der Gegenwart. Rowilan glaubte, die Emotionen würden ihn ertränken, die über ihm zusammenschlugen. Derona, ihre Wärme, die Wärme ihrer Gegenwart, ihrer Seele, die der seinen so nah gewesen war wie keine je vor ihr. Er spürte es noch. Spürte, wie sie binnen eines Herzschlages einen Teil seines Wesens erweckt hatte, von dem er selbst nicht gewusst hatte, dass es ihn gab.
Rowilan fühlte sie, er fühlte den Moment, da sie in seine Seele gegriffen hatte. Eine Berührung im Geiste, die Raum geschaffen hatte, um ein ganzes Leben darin zu gebären. Ein Leben, das es nie gegeben hatte. Ein auslaugender Durst, den sie nicht mehr hatte stillen können. Die Leere in Rowilan brannte schlimmer als jede Wunde. Sie hatte ihn zurückgerufen, den Schmerz, der ihn zu zerreißen drohte. Rowilan hatte sich ihm in jenem Moment ausgeliefert, da Traum mit kalter Wirklichkeit verschmolz, und die Realität die Wärme aller Erinnerungen in ein Glühen verwandelte, das ihn langsam von innen heraus verbrannte.
Der Schamane kämpfte sich aus seinen Decken, sprang aus dem Bett. Rowilan verlor die Kontrolle, er wusste es. Das qualvolle Stechen, das seinen Arm entlang jagte, als er mit aller Gewalt gegen den Türbalken schlug, versiegte in der Macht seiner Gefühle. Mit einem Mal schien die Enge seines Hauses den Fürsten zu ersticken, sodass er barfuß durch die Tür in die regennasse Nacht hinausjagte. Rowilan sah nicht, wohin er rannte. Es gab nichts, an das er denken konnte, außer den Schmerz. Und die Gewissheit, dass er ihn zerreißen würde, wenn er ihm nicht endlich ein Ende setzen konnte.
Er musste atmen, ganz langsam. Rowilan hatte kein Gefühl, wie viel Zeit seit dem Abend vergangen war. Doch dieser Traum, die Erinnerung und der Kummer hatten ihn so ausgelaugt, als ob er nie geschlafen hätte.
Atmen. Nur atmen.
Einen kurzen Moment schloss Rowilan die Augen, um sich zu sammeln. Nachdem er schließlich in sein Haus zurückgekehrt war, versuchte er in seiner Bettstatt neuen Schlaf zu finden, doch die Ruhe kehrte nicht wieder. Dutzende Male wälzte er sich sinnlos von einer Seite zur anderen, bevor er den Kampf aufgab, über seine Schlafkleider Füßlinge, Gürtel und Mantel streifte und erneut hinaus in die Dunkelheit floh.
Der Regen war stärker geworden. Über dem Horizont schien als erste Ahnung die Morgendämmerung zu hängen. Je mehr Rowilan jedoch versuchte, einen genauen Zeitpunkt abzuschätzen, desto mehr schien es ihm eine Täuschung des Wetterleuchtens.
Ziellos streifte der Fürst durch seine schlafende Siedlung, die Wälle entlang, die mit Palisaden so verstärkt waren, dass sie einem Angriff ebenso gut standhalten würden wie die Verteidigungsanlagen ihres alten Dorfes. Die Wachposten, die selbst zu dieser Nachtzeit noch ihren Dienst verrichteten, machte er nur als schwarze Silhouetten vor dem Himmel aus. Sie verrieten sich einzig durch ihre langsamen Bewegungen und ließen Rowilan genug Raum, ihren Weg zu meiden.
Der Fürst wollte mit niemandem sprechen. Seine Gedanken kreisten wie vom Sturm getragen zwischen Bildern der Gegenwart und der Vergangenheit, auf der Flucht vor dem Schmerz, der ihn abermals einholen wollte. Ein trauriges Lächeln huschte über Rowilans Gesicht, als er sich die letzten Worte ins Gedächtnis rief, die seine Verlobte ihm damals bei ihrer ersten Begegnung an den Kopf geworfen hatte. Ihre Eltern hatten niemals eine hohe Meinung von ihm gehabt. Ihr Vater Utilain noch weniger als ihre Mutter Moribe.
Rowilan war dabei gewesen, als Deronas Mutter im vergangenen Jahr verstorben war. Über viele Jahre hatte sie dahinvegetiert, die Gedanken der Wirklichkeit entrückt, die ihr so viel Kummer bereitet hatte. Als Aigonn Rowilan dazugerufen hatte, um ihr Leben zu retten, war ihm klar gewesen, dass die Götter Moribe endlich hatten erlösen wollen. Nichts hatte er für sie tun können, jene Frau, die seine Schwiegermutter hätte werden sollen. Selbst im Augenblick ihres Todes hatte sie nur ihren Sohn Aigonn erkannt, nicht aber ihn, Rowilan, den einstigen Auserwählten ihrer Tochter. Dabei hatten ihre letzten Worte sogar Derona gegolten …
„Derona hat es gewusst. Sie wusste, wer die Tochter des Sängers ermordet hat. Sie selber hat es ihr gezeigt, aber Derona wollte es mir nicht sagen. Sie hat gesagt, dass es niemand wissen darf.“
Plötzlich hielt Rowilan inne. Jene Worte, die Moribe ihrem Sohn im Sterben noch anvertraut hatte, echoten leise in seinem Hinterkopf, während sich ihm erst jetzt ihre wahre Bedeutung erschloss.
Derona, seine Derona, hatte zu ihren Lebzeiten erfahren, wer Haelinon, die Tochter des Moorsängers, ermordet hatte. Sie hatte es gewusst, weil Haelinons Geist zu ihr gesprochen hatte.
Der Zorn des Gottes
Aigonn war von Stimmen umgeben. Das leise Flüstern kam von allen Seiten, ein beständiges Rauschen, dem er lauschte, während sich sein Geist wider Willen in die Gegenwart vorwagte. Ein kühnes Unterfangen. Und er wurde sofort dafür bestraft.
Der Lärm war kaum zu ertragen. Schreie, Rauschen, ein bedrohliches Tosen, das ihm alle Nackenhaare in die Höhe trieb, fuhren direkt unter seine Haut. Sobald er die Augen aufschlug und die Schwärze des Schlafes trübem Flammenlicht wich, wusste er, dass er einen Fehler begangen hatte. Nächte wie diese waren nur zu ertragen, wenn man sie schlafend verbrachte. Dann war das Chaos am nächsten Morgen entweder vorbei oder man selbst tot.
Schlaftrunken richtete sich Aigonn von seinem Schlaflager auf. Das Stimmengewirr deutet darauf hin, dass außer ihm in dem kleinen Langhaus niemand geschlafen hatte. Ein Wimpernschlag genügte, damit er vier Gestalten ausmachte: zwei Männer, ein Kind, eine Frau. Sie schleuderten Worte einer fremden Sprache durch den Raum, deren Silben zum Teil im Tosen des Sturmes erstickten. Das Lied des Sturms erfüllte jeden Winkel des Hauses. Aigonn hörte die Geister des Meeres singen und johlen, ein Lied grenzenlosen Übermutes auf dem Weg der Verwandlung in die Raserei.
Aigonn musste sich einfach nur zurückfallen lassen. Er konnte die Augen schließen und Erschöpfung simulieren. Vielleicht dauerte es die halbe Nacht, wieder Schlaf zu finden, doch der Schatten des Hausdaches und sein Felllager würden ihn fernhalten von dem Chaos, in das Wode dieses Land am Ufer des großen Gottes gestürzt hatte. Niemand würde bemerken, dass er erwacht war und ihn zu sich rufen, damit er sich dem sinnlosen Kampf gegen den Sturm anschloss. Zu nah waren die Bilder noch, die er an der Felswand im Land der Daukionen zurückgelassen hatte, als dass er es wagen würde, dem zornigen Herren des Sturms noch einmal die Stirn zu bieten.
Schlafen. Das Wort allein erschwerte seine Lider. Ihr Glühen war ein Echo des Fiebers, das ihn seit der Sonnenwende verfolgte. Ja, schlafen. Ein guter Gedanke. Wenn morgen der Himmel einstürzte, konnte er es doch nicht aufhalten.
Plötzlich ein Krachen. Einen Herzschlag innehalten. Dann fuhr der heulende Sturm in das Langhaus. Aigonn riss die Hände an die Ohren, wobei er sich die Fingernägel in die Kopfhaut bohrte. Das Singen der Windgeister wurde laut bis zur Unerträglichkeit. Ihre spitzen Stimmen gruben sich durch den Knochen in seinen Kopf, zermarterten seine Nerven. Ein Schreien, irgendjemand schrie. Was, bei Lugus, war überhaupt geschehen? Es spielte keine Rolle, wenn es nur aufhörte, das Lied der Geister. War Aigonn es selbst, der so brüllte? Seine Stimmbänder schmerzten. Ja, er selbst musste es sein. Aufhören, echote eine Stimme in seinem Kopf die sinnlose Bitte an das Heer des Wode, das darauf nur zu lachen schien.
„Fremder!“, wehte es irgendwann an seine Ohren. „Fremder!“ Die Bewohner des Langhauses gebrauchten skandische Worte, um sich mit Aigonn zu unterhalten. Dieser beging den Fehler, die Hände von den Ohren zu nehmen. Sofort wurden sie mit starkem Griff gepackt. Als man ihn in die Höhe zog, wurde Aigonn schwindelig. Die Bilder drehten sich noch nach zweimaligem Blinzeln, dann machte er im Dämmerlicht des Hauses endlich das Gesicht eines Mannes vor sich aus.
„Fremder, wie kannst du schlafen? Die Götter sind rasend!“ Blondes Haar, von grauen Strähnen durchsetzt, wirbelte ihm vor die Augen. Viel älter als Rowilan konnte dieser Mann nicht sein, dessen Namen er sich immer wieder aufs Neue sagen lassen musste. Das Leben hatte ihn nur mit einer Härte gezeichnet, die ihn im Schattenwurf der Flammen zum Greis zu verwandeln schienen.
Keinen Augenblick später fuhr Aigonn erschrocken zusammen. Das nächste Krachen, das unzweifelhaft von brechendem Holz ausgelöst wurde, verschuf noch weiteren Sturmgeistern Einlass in das Langhaus. Für wenige Herzschläge war den dort Unterschlupf Suchenden noch Schutz vergönnt, dann sah Aigonn die Silhouette eines Stücks grasgedeckten Dachs davonfliegen, bevor prasselnder Regen auf sie niederging.
Was der Mann, der seinen jungen Gast noch immer am Handgelenk hielt, gegen den Regen brüllte, verstand Aigonn auch ohne Kenntnis ihrer Sprache als Fluch. Und sein Ton machte deutlich, dass er kein weiteres Zögern dulden würde. Bis Aigonn die Situation richtig erfassen konnte, hielt er ein starkes Nesselseil in den Händen. Die anderen Männer hatten es bereits an der Verbundstelle zweier Deckenbalken verknotet, um seine Enden an Pflöcke zu binden. Auf geflochtene Grasmatten und Felle am Boden wurde keine Rücksicht genommen. Aigonn stand einer Salzsäule gleich da, sah zu, wie die Männer die Pflöcke durch den Bodenbelag trieben und wenig später die Stärke des Seils auf eine harte Probe gestellt wurde.
Der Ruck, mit dem der Wind am Dach riss, brachte Aigonn ins Stolpern. Ein weiteres Paar Hände, das sich vor ihm an das Stück Seil klammerte, verhinderte, dass er der Länge nach zu Boden stürzte. Sobald der Sturm jedoch eine Böe lang Atem fasste, brüllte der blonde Mann seinen Gast an: „WORAUF, BEI DEN GÖTTERN, WARTEST DU DENN?“
Ja, worauf? Endlich wurde sich Aigonn dem Ernst seiner Lage bewusst. Es war Nacht, es war Winter. Die Luft im Haus, die der Sturm hinein trieb, war so erbärmlich kalt, dass sich der Atem des jungen Mannes in Nebel verwandelte. Und bis zum Sonnenaufgang würde es womöglich kein Dach mehr geben, das sie vor der tödlichen Witterung schützen konnte.
Diese Gewissheit rettete Aigonns Gedanken endlich aus der Trägheit des Schlafes. Das Adrenalin, das durch seine Adern jagte, weckte ungeahnte Kräfte. Kaum, dass er sein eigenes Seil um einen Pflock geschlungen und in die Erde getrieben hatte, lag das nächste Nesseltau in seinem Griff. Wie im Rausch jagte er durch das Langhaus, erklärte mit seinen Bewohnern dem Sturm den Kampf, der diesen mit johlendem Übermut erwidern wollte. Das nächste Stück Grasdach wurde davongetragen. Je länger Aigonn rannte, desto mehr schien es ihm, als schlafe er noch.
Die Müdigkeit, die sein linkes Auge niedersacken lassen wollte, weckte den sehenden Sinn. Mit flackerndem Blick erfasste er die Gestalten der Sturmgeister vor sich. Einen Wimpernschlag lang schien das Bild zu gefrieren, machte verschwommene Gesichter sichtbar, deren Augen sich in seine Richtung drehten.
„Würdig wolltest du sein!“, glitt eine tonlose Stimme durch das Zwielicht. „Kühner Aigonn, hast du deinen Mut verloren, als meine Diener dich aus Skandia trieben?“
Wode. Der Name des Sturmgeistes glich einer Beschwörung. Kein anderer als er lenkte das Chaos, das die ganze Welt einzureißen schien. Schritt um Schritt hatte er Aigonn auf seiner Heimreise von Skandia verfolgt. Einem Alptraum gleich hatte sein Sturm immer die Angst davor mitgetragen, was die Gegenleistung für Aigonns Kühnheit sein würde. Für die Kühnheit, einen Götterdiener herausgefordert zu haben, dessen Name „der Zornige“ bedeutete.
„Fremder“, riss eine Stimme Aigonns Gedanken in die Wirklichkeit zurück. Verwirrt blinzelte er gegen die aufkommende Erschöpfung, um festzustellen, dass der blonde Mann wieder an seine Seite geeilt war. Dessen schwielige Hand ruhte auf seiner Schulter, beschwörend plötzlich und von einer angstvollen Ruhe umgeben. „Fremder“, murmelte er. „Wenn du zu lange den Worten des Sturms lauschst, wirst du den Verstand verlieren. Höre auf mich!“
Aigonn nickte, weil irgendetwas in ihm sagte, dass es gut war. Nicht, weil sein Geist aufnahm, was man ihm sagen wollte.
„Die Sturmgeister pflanzen den Wahnsinn in deinen Kopf, wenn du zu sehr auf ihre Stimmen hörst. Kein Mensch ist ihnen gewachsen. Sei klüger als deine Freundin und ergib dich nicht ihrem Rufen!“
Freundin. Dieses Wort weckte Aigonns Bewusstsein auf einmal mit unerwarteter Heftigkeit. Ein Gesicht schoss vor sein Inneres Auge, eine junge Frau, mager, mit braunen, verfilzten Haaren und dunklen, unergründlichen Augen. Für einen Wimpernschlag schien die Erinnerung sie direkt neben ihm im Raum zu beschwören, bis Aigonn sich klarmachte, dass das, was er sah, nicht die Wirklichkeit war.
Erschrocken überflog er die Schlaflager. Sie war nicht hier im Haus! Der Blonde hatte Aigonn bereits stehengelassen, um einem der anderen Männer zu Hilfe zu eilen. Wo war sie? Draußen herrschte nichts als Verwüstung. Die Menschen schienen alle Macht verloren zu haben in einer solchen Nacht, hilflos den Elementen ausgeliefert, während nichts sonst Schutz versprach, als ein Gebäude, das mit einem Windstoß weggeblasen sein konnte. Niemand, der bei Sinnen war, verließ zu einer solchen Zeit seine einzige Zuflucht.
Außer Tiuhild.
Mit einem Herzschlag war Aigonn hellwach. Bevor er wusste, was er tat, rannte er durch das Langhaus. Im Rennen rief er dem Blonden, der sich verwirrt zu ihm umdrehte, zu: „Wo ist sie? Wo ist die junge Frau, die mit mir reist?“
„Du solltest nicht fragen, wo sie ist, Fremder, sondern was mit ihr geschehen ist! Die Geister haben sie auserwählt. Manche Menschen machen sich aus freiem Willen zum Opfer des Sturms. Du kannst nicht zu ihr hinaus!“
Der Mann hatte nicht ausgesprochen, als sich zwei Hände bereits in seinem Hemdkragen verkrallten. Erschrocken wollten seine Freunde dazwischen gehen, Aigonn jedoch riss seinen Oberkörper so nah an sich heran, dass er dem Blonden seinen Atem ins Gesicht spie. Woher er die Wut nahm? Er hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Der Sturm, die Gefahr, alles um ihn herum hatte an Bedeutung verloren, da Aigonn mit einer Bedrohlichkeit zischte, die ihn selbst in Erstaunen versetzte: „Wohin sie gegangen ist, will ich wissen!“
„Nach draußen, an den Strand.“ Die Miene des blonden Mannes war undeutbar. Womöglich wäre es sinnvoll gewesen, an die Sorge, die durch sie schimmerte, einen Gedanken zu verschwenden. Bevor Aigonn darüber jedoch nachdenken konnte, hielt er die Tür schon geöffnet und kämpfte im selben Moment mit seinem Gleichgewicht. Wie ein Kampfschrei heulte der Sturm in seinen Ohren, warf sich gegen seinen Körper, dass er taumelnd nach hinten stolperte. Die Proteste der Hausbesitzer befahlen ihm, augenblicklich zurück in den Innenraum zu kommen, doch sie kümmerten ihn nicht. Nur ein Schritt genügte und das Loslassen der Tür, dann befand Aigonn sich im Reich der Stürme.
Im ersten Augenblick war der junge Mann zu nichts im Stande außer sich den Anblick einzuverleiben. Es war tiefste Nacht. Mitternacht, oder vielleicht schon Morgengrauen? Hinter den schwarzen Wolken, die den Himmel verdunkelten, war kein Rückschluss auf die genaue Nachtzeit zu ziehen. Das gewöhnliche Auge hielt Aigonn bereits geschlossen, da er wusste, dass es ihm hier nicht von Nutzen sein würde. Das Auge des Sehers jedoch zu benutzen, erleichterte ihm die Orientierung zunächst ebenso wenig.
Der Sturm war überall, ein tosender Wirbel aus gestaltlosen Erscheinungen, Geistern, deren Antlitze zu einem Rauschen verschwammen. Die Gewalt, mit der die Natur Aigonn begegnete, machte den Drang übermenschlich, die Flucht zurück ins Haus anzutreten. Zuvor aber erfassten seine Sinne eine fremde, viel vertrautere Kraft. Wie die Gischt ließ sie sich mittragen, kaum auszumachen zwischen dem Regen, der Aigonn von der Seite gegen den Körper prasselte. Bis er sich aus dem Schatten der Hauswand gelöst hatte, war seine Kleidung vollständig durchnässt. Das Entsetzen aber, das ihn vorwärts trieb, machte diesen Umstand nebensächlich.
Die Welt schien aus dem Gleichgewicht geraten. In der Dunkelheit der Nacht waren weder Gebäude, noch Zäune, noch Wege vernünftig auszumachen. Küste und Meer schienen eins geworden. Zwischen den ohrenbetäubenden Liedern der Sturmgeister hörte der junge Mann die donnernde Stimme des Meeresgottes. Wie der sein wellenschäumendes Maul ins Landinnere reckte, erblickte Aigonn mit Leichtigkeit über den kleinen Deich hinweg. Die Kräfte des Landes, des Bodens, des Waldes, des Wassers und des Windes – alles schien seine Grenzen gesprengt, seine Gestalten vermengt zu haben. Jeder Mensch, der glaubte, dieser Gewalt trotzen zu können, musste wahnsinnig sein. Und doch spürte er Tiuhild, ihre Kräfte, die Teil dieses Stroms geworden waren, als hätte sie sich selbst in einen Sturmgeist verwandelt.
Den Arm schützend an die Stirn gezogen, lief Aigonn gegen den Wind an. Wode machte jeden Schritt zum Gewaltakt, doch er musste zu ihr. Eine Ahnung beschleunigte seinen Herzschlag. Eine Erinnerung, die Aigonn seit Tagen mit Sorgen erfüllte, verlieh ihm die Kraft, gegen das Tosen der Elemente anzukämpfen. Die Gewalt ihres Spiels jedoch war beängstigend.
Knöcheltief versank Aigonn im Matsch. Fast wäre er hingefallen, als er halb blind gegen ein Gatter stolperte, dessen eine Hälfte vom Wind Richtung Birkenwald geweht wurde. Je näher er dem Ufer kam, den Dünen, deren sandiger Grund unter jedem seiner Schritte wegsackte, desto mehr zog es ihn zurück zu den Häusern. Irgendwo in dem Lärm des Unwetters hörte er Wode lachen. Ob Bösartigkeit darin lag, Vergnügen oder beides, das konnte Aigonn nicht einschätzen. Doch seine Macht, die das ganze Land umarmte, war einschüchternd genug, um die Wahrheit gleichgültig werden zu lassen.
Dann auf einmal stutzte der junge Mann. Es brauchte einen Augenblick, damit sein Geist begriff, was sein sehender Sinn längst erfasst hatte. Die bedrohliche, einschüchternde Kraft, die einem Nebel gleich über der Küste lag, war anderer Natur als Wodes Macht, die Aigonn seit Skandia verfolgte. Nein, kaum da der junge Mann die Kuppe der ersten Düne erreicht hatte, schien es, als verharre die Zeit für einen Moment. Der Wind und der Regen waren überall. Kein Tropfen ihrer Kraft war verloren gegangen, und doch schien Aigonn im Auge des Sturmes zu stehen. Für einen Herzschlag vergaß er zu atmen, als er begriff, was der Grund dafür war. Und dass er direkt daneben stand.
Wie Nebeldunst sickerte eine Kraft über die Küste. Sie war alt wie das Land selbst. Obgleich ihr eine Bedrohlichkeit anhaftete, die Herrschaft über Leben und Tod versprach, lag ihr doch eine sonderbare Vertrautheit inne. Vor allem die Gewissheit, dass sie genau hier her gehörte, an diesen Ort.
Fast hätte Aigonn sagen können, die Erscheinung ähnelte einem Mann. Er wusste, dass der Eindruck einer menschlichen Gestalt im Grunde eine Täuschung seiner Sinne war. Das, was er erblickte, war viel mehr als das kümmerliche Leben eines Sterblichen, der in diesem Chaos einfach davon geweht werden konnte. Nein, die Präsenz, die das Leuchten des Unvergänglichen umgab, war nicht die Zerstörung. Sie war der Sturm selbst, das Wasser, seine Bewegung.
In der Bewegung erstarrt, erinnerte Aigonn eine Stimme in seinem Kopf, dass er auf die Knie fallen, irgendein Zeichen der Demut geben musste. Was dort auf den Dünen stand und zu den Wellen hinaus blickte, war nicht weniger als ein Gott.
Der Donnerer. Wodes Herr, Wächter über das Wetter, über die Stürme und den Regen. Unwillkürlich schoss Aigonn ein Bild vor Augen, das er niemals vergessen würde. Nicht das erste Mal sah er einen der Herren der Welt leibhaftig vor sich stehen.
Diesmal jedoch war es anders. Aigonn erschreckte nicht seine Gegenwart, sondern die Tatsache, dass er ihm hier begegnete, außerhalb der Anderen Welt, an der Küste. Aigonn glaubte unter seiner Kraft zu vergehen, als diese sich für einen Augenblick in seine Richtung wandte und ihm zu verstehen gab, dass seine Anwesenheit bemerkt worden war. Bevor der junge Mann aber Gedanken daran verlieren konnte, was er tun sollte, hatte der Gott sich schon wieder von ihm abgewandt. Seine Aufmerksamkeit richtete sich der Küste zu. Der Donnerer schien das Schauspiel zu beobachten, wie Menschen dem Lied eines Flötenspielers lauschten, ginge nicht der Eindruck erwartungsvollen Abwartens von ihm aus, erwachsen aus dem beunruhigenden Wissen, dass sich die Welt längst veränderte, anders, als die Menschen es erwarteten.
Aigonns Herz setzte einen Schlag aus, als er endlich erkannte, was der Gott beobachtete. Mitten in den Dünen trotzte ein Mensch dem Sturm. Obgleich der Wind sie mit jeder neuen Böe in die Knie zu zwingen drohte, stand eine junge Frau mit ausgebreiteten Armen dem Meer zugerichtet. Die Wellen, die über den Küstenstreifen krachten, leckten an der sandigen Bastion der Sterblichen. Die Gischt und der Regen hatten sie soweit durchnässt, dass ihre Haare und Kleidung wie eine zweite Haut an ihrem Körper klebten. Doch statt ängstlich wie die anderen Bewohner der Siedlung in die Häuser zu flüchten, befreite die junge Frau ihre eigene Kraft. Aigonn wusste, wie angsteinflößend sie sein konnte. In diesem Augenblick, da sie jedoch Teil des Sturmes geworden schien, wirkte sie befremdend wie nie.
Tiuhild schien wie in Trance. Ob sie Aigonn bemerkt hatte, konnte dieser nicht sagen. Ihre Augen jedoch, die entrückt auf die See starrten, sprachen dagegen. Den jungen Mann schauerte es, als er hörte, dass sie gegen den Sturm anschrie. Und welches Vergnügen ihr dies zu bereiten schien.
„WODE!“, brüllte die Fennin immer wieder. „HERZ DER STÜRME! SIEHST DU, DASS ICH KEINE ANGST VOR DIR HABE? ICH BIN DEINER WÜRDIG, WODE!“
Aigonn wollte das Blut in den Adern gefrieren. In nur einem Augenblick schossen ihm unzählige Szenarien durch den Kopf, die diesen Worten folgen konnten. Er erwartete schon mit Schrecken, dass der Sturmgeist Wode Tiuhild mit der nächsten Böe in die Fluten reißen würde. Zu seiner Verwunderung aber geschah nichts dergleichen. Wode ließ sie gewähren und verschonte sie mit seinem Zorn. Die Arme von sich gestreckt, sandte sie ihre Kraft in den Wind. Aigonn wusste, dass sie im Stande war, die Geister, die ihre Gestalt umgaben, für kurze Zeit zu allem zu zwingen, was sie im Sinn hatte. Nur ähnelte die Art, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzte dieses Mal fast einem Spiel. Keine Feindseligkeit schlug ihr von den Geistern im Sturm entgegen, keine Angriffslust – nur ein Lachen, das Aigonn selbst im Delirium wiedererkennen würde.
„TIUHILD!“, startete er den kläglichen Versuch, mit seiner Gefährtin Kontakt aufzunehmen. „TIUHILD, KOMM DA WEG!“
Eine Woge krachte gegen den Küstenstreifen. Das aufspritzende Wasser erreichte selbst Aigonn, der noch dreißig Fuß von der Fennin entfernt stand. Das Gesicht schützend vor einer zweiten Gischtwelle weggedreht, sah er im Aufblicken nur noch schäumendes Wasser.
„HILDA!“ Panisch stürzte der junge Mann auf die Dünen zu. Wie nahe er dabei den entfesselten Fluten kam, wurde plötzlich zur Nebensache. „HILDA!“ Keine Antwort. Wo war sie? Wenn das Meer sie davon gespült hatte, würde es keine Rettung mehr geben. Wieder eine Welle. Dann plötzlich durchbrach ein übermütiges Lachen das Tosen und diesmal allzu menschlich.
„ICH BESTEHE DEINE PRÜFUNG, WODE!“
Aigonn konnte es nicht fassen. Die Erleichterung ließ nicht genug Platz, um sich der Befremdlichkeit des Anblickes bewusst zu werden. Von Wellen umspült, tauchte ihr Kopf zwischen dem sturmgepeitschten Strandhafer auf. Das Wasser hatte sie von den Füßen gerissen, doch ihrem Übermut schien das keinen Dämpfer zu versetzen. Kopfschüttelnd sah Aigonn zu, wie sie sich erhob, vom Sturm gleich getragen, um wieder die Stimme an Wode zu richten. Diesmal aber schluckte das Lärmen jedes ihrer Worte.
Wie ohnmächtig stand der Seher da und beobachtete die unheimliche Szenerie. Tiuhild gab kein Anzeichen dafür, ihn überhaupt wahrzunehmen. Er würde sie schon zum Dorf zurückzerren müssen – falls es ihm gelang, in ihre Nähe zu kommen. „Wenn sie den Sturm nicht fürchtet, braucht sie auch deine Hilfe nicht“, höhnte es in seinem Kopf. „Wenn sie sich den Göttern anvertraut, liegt es nicht mehr in Menschenhand, sie zu retten.“
Widerwillig wandte Aigonn sich ab. Nachdem er sich bereits ein paar Schritte vorgekämpft hatte, warf der Seher noch einen Blick in die Dünen. Der Donnerer war nicht von der Stelle gewichen. Der junge Mann schauerte, als sich der Blick des Gottes abermals auf ihn richtete, von keinem Menschen zu ergründen. Für einen Pulsschlag nur schien eine tonlose Stimme in seinem Kopf zu flüstern: „Wir wissen beide, dass geschieht, was geschehen muss, Aigonn.“
Die Kälte, die Aigonn plötzlich empfand, rührte weder von seinen durchnässten Kleidern noch den eisigen Seeböen her. Beklommen wurde er sich gewahr, dass eine Ahnung der Zukunft an ihm vorüber gezogen war. Und er nicht wusste, ob er sie wahrhaben wollte.
„Es macht keinen Sinn, das Unvermeidliche zu fürchten, Aigonn. Du solltest dich nur fragen, warum du nicht auf es vorbereitet warst.“
Als Aigonn am nächsten Morgen erwachte, glaubte er, die ganze Nacht nicht geschlafen zu haben. Wann er wirklich am frühen Morgen Ruhe gefunden hatte, das konnte er nicht mehr sagen. Viel Zeit durfte seitdem jedoch nicht vergangen sein. Dafür war das Morgenlicht, das durch die angelehnte Haustür herein fiel, noch zu trüb.
Die Hände an die schmerzenden Schläfen gedrückt, schälte Aigonn sich aus seinen Fellen. Sein Gastgeber, der blonde Krieger, war bereits auf – oder hatte erst gar nicht geschlafen. Die tiefen Schatten unter seinen Augen gaben Aigonn eine Ahnung davon, welchen Eindruck er selbst bieten musste. Im Gegensatz zu dem Einheimischen, der ihn freundlich begrüßte, konnte er sich zu keinem Lächeln durchringen.
„Der Donnerer hatte Erbarmen mit uns“, eröffnete ihm der Krieger erleichtert und lud ihn ungefragt zu einem Becher Tee ein. „Er hat Wode zurückgerufen!“
Die Gelöstheit seines Gastgebers wollte noch nicht auf Aigonn übergreifen. Erschöpft von der ruhelosen Nacht trank er den Tonbecher erst zur Hälfte aus, bevor er sich umsah und vor seiner eigenen heiseren Stimme erschrak: „Es bleibt zu hoffen, dass er es sich nicht anders überlegt.“ Aigonn hustete. Wie zur Antwort auf seine Worte fuhr eine kalte Böe durch das Dach herein und offenbarte mehrere, gut vier Fuß lange Löcher im Reet, die man den Geräuschen nach wohl schon zu stopfen versuchte. Was den blonden Einheimischen dabei noch immer so fröhlich stimmte, wollte Aigonn nicht recht in den Sinn. Er ärgerte sich darüber, dass ihm der Name des freundlichen Kriegers schon wieder entfallen war, obwohl er ihn bereits zweimal danach gefragt hatte. Bisher war es ihm zum Glück gelungen, diesen Umstand geschickt zu überspielen.
Zu viele Menschen waren Aigonn seit dem Winter begegnet. Obgleich seit der Sonnenwende noch keine drei Monate vergangen waren, lag Skandia schon hinter ihm wie ein ferner Traum. Für die Demonstration seines Zornes hatte der Sturmgeist Wode, der Wilde Jäger, sich Zeit gelassen. Vanadottirs Häschern geschuldet hatten Aigonn und Tiuhild von einem abgelegenen Strand aus die Überfahrt zum Festland gewagt. Sie war so schnell und so ruhig verlaufen, dass Aigonn bereits misstrauisch geworden war – und das zu Recht. Kaum, da sie die Küste erreicht hatten, war der erste Sturm gekommen. Einen ganzen Monat hatten die beiden Gefährten bei den ansässigen Stämmen Unterschlupf suchen müssen, verdient mit viel harter Arbeit. Dennoch war Aigonn diesen Menschen unendlich dankbar in Anbetracht dessen, dass ihre Gastgeber selber hatten Hunger leiden müssen und zwei weitere Mäuler kaum stopfen konnten. Die wenigsten waren ihnen so freundlich begegnet wie der namenlose Blonde.
Aigonn hatte befürchtet, Tiuhild würde allein dieser körperlichen Belastungen nicht standhalten. Doch er hatte lernen müssen, dass sie zäher war, als er je würde sein können. Gleich wie mager und drahtig sie wirkte, konnte sie dem Seher aus dem Süden immer einen Schritt voraus sein, immer einen Vorsprung höher erklommen haben. Es war Aigonn, den die Nachwirkungen seiner Lungenentzündung zu längeren Pausen zwangen – und damit eine Unruhe in ihm nährten, die er nie für real gehalten hätte.
Alles in ihm trieb Aigonn nach Hause. Nach Hause – zurück an die Rur, in ein Land, das ihm vor einem dreiviertel Jahr noch so fremd gewesen war wie Skandia, die gewaltige Insel im Norden, auf der er im vergangenen Winter Unterschlupf gefunden hatte. Aigonn wusste nicht recht, wie ihm geschah. Die Welt um ihn herum veränderte sich schneller, als sein Geist es zu fassen vermochte. Oder vielleicht war auch er es, der sich veränderte. All das kümmerte ihn nicht, solange er wusste, was er zu tun hatte. Und seit jener Überfahrt zum Festland war er sich dessen bewusst. Er musste heimkehren, schneller als möglich. Aus einem einzigen Grund.
Rowilan. Der Schamane lebte. Nicht, wie jene Vision durch Vanadottir es ihm vorgegaukelt hatte. Es war ein allzu kurzer Moment gewesen, da er die Stimme des Schamanen gehört – nein, eigentlich nur gespürt – hatte. So wenige Worte Aigonn doch erhalten hatte, allen voran präsent war ein Gefühl gewesen, eine Emotion, für die er keinen Namen hatte.
Verzweiflung war der falsche Ausdruck. Vielmehr schien es die Akzeptanz einer Gewissheit gegenüber, die zu machtvoll war, um sich ihr zu erwehren. Die Gewissheit, dass es vielleicht längst zu spät war. Dass zu viel geschehen war, damit die Geschichte ein gutes Ende nehmen konnte. Rowilan schien bereits vor der Wahl zwischen Siechtum und Seuche zu stehen, um die Katastrophe so milde wie möglich zu gestalten. Eine Aufgabe, an der ein Einzelner zerbrechen konnte.
Es ist dein treuster Freund, der seinen Weg schon viel zu lange alleine geht. Lugus’ Worte brannten schmerzhafter als ein Brandeisen. Nie zuvor war Aigonn sich ihrer Bedeutung so bewusst geworden wie in jenem Moment, als Rowilans Hilferuf ihn ereilt hatte. Und er fürchtete bereits, dass die Situation in seiner Heimat noch weitaus schlimmer war, als er es sich jetzt ausmalen konnte.
Die fremden Worte, die draußen hin- und hergeworfen wurden, erinnerten Aigonn daran, dass ihn aber zunächst ganz andere Sorgen kümmern mussten. Vor wenigen Tagen erst hatten sie hier, an einer kleinen Küstensiedlung des Festlandes, Unterschlupf gefunden. In dem Irrglauben, dem Sturm, der sie vom Norden her verfolgt hatte, entkommen zu sein, waren sie eingekehrt. Und Aigonn plagte ein schlechtes Gewissen deswegen.
Der blonde Krieger war so freundlich zu ihnen gewesen. Ob der Einheimische wusste, dass sie, Aigonn und Tiuhild, das schreckliche Unwetter zu ihnen gebracht hatten?
Woher sollte er denn?
Trotzdem ertappte Aigonn sich dabei, die Miene seines Gastgebers zu erforschen, während dieser den Versuch gestartet hatte, sich den Sicherungsmaßnahmen des Hausgebälks und der daraus entstehenden Unordnung anzunehmen. Noch bevor Aigonn Gelegenheit gefunden hatte, seine eigene Hilfe anzubieten, eröffnete der Einheimische auf einmal ohne aufzusehen: „Du solltest einen Gang zum Strand wagen, Fremder!“
„Braucht man dort Hilfe?“
„Es gibt keinen Fleck im Dorf, wo nicht etwas getan werden müsste“, lachte der Blonde. „Aber das ist jeden Winter so. Alle Opfer, die das Meer gefordert hat, haben bereits ihr Leben gelassen. Du wirst keinen weiteren Tod verschulden, wenn du zunächst einmal nach deiner Freundin siehst!“
Sich über den Galgenhumor seines Gastgebers zu wundern, erlaubte Aigonn sich nur einen Pulsschlag lang. Aufgeregt schoss sein Kopf in die Höhe. Für einen Moment kam ihm der schlimmste Gedanke, den der blonde Krieger jedoch sogleich entkräftete: „Ihrer Gesundheit wegen gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Du solltest dich nur fragen, mit welchen Kräften sie paktiert, dass sie eine solche Nacht in den Dünen folgenlos übersteht!“
Der Einheimische konnte nicht wissen, wie unnötig diese Aufforderung war. Zu oft war Aigonn seit ihrer Abreise aus Tiuhilds Heimat der Gedanke gekommen, die Richtigkeit seiner Entscheidung zu überdenken. Die Entscheidung, die sonderbare junge Frau mit sich in den Süden zu nehmen, die so anders war als alle, die er kannte.
Was Aigonn und Tiuhild verband, das schien keiner von ihnen recht zu wissen. Während die Fennin in dem Bärenjäger einen seelenverwandten Gefährten erahnte, kämpfte Aigonn noch immer gegen die Beklommenheit, die er seit ihrer ersten Begegnung empfand. Tiuhild hütete tief in sich eine ungezähmte, mächtige Kraft, die sie nie wahrlich zu beherrschen gelernt hatte. Vielleicht wäre sie unter anderen Umständen eine mächtige Schamanin geworden. So aber war sie nur eine Hazusa, die selbst mehr Dienerin ihrer Fähigkeiten war, als dass diese ihr nutzten.