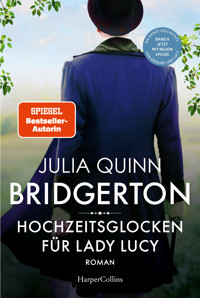
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bridgerton
- Sprache: Deutsch
Das große Hochzeitsfinale der Bridgerton-Reihe
Der Weg zur Hochzeit ist verschlungen: Erstens verliebt Gregory Bridgerton sich in die falsche Frau. Zweitens verliebt die sich in jemand anderen. Drittens beschließt Lucy Abernathy, sich einzumischen. Viertens verliebt sie sich dabei in Gregory. Fünftens ist sie so gut wie verlobt mit Lord Haselby. Sechstens verliebt Gregory sich in Lucy. Am Ende wird in jedem Fall geheiratet, aber versprechen auch die Richtigen einander ewige Treue?
»Quinn hat eine so sympathische Familie erschaffen, eine so lebendige und einnehmende Gemeinschaft, dass wir in das Buch krabbeln und sie treffen wollen.« NPR Books
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Lady Lucinda, genannt Lucy, ist daran gewöhnt, im Schatten ihrer Freundin Hermione zu stehen. Deshalb zieht sie nicht ernsthaft in Erwägung, dass Gregory Bridgerton sich für sie interessieren könnte. Dann weist Hermione ihn, wie alle anderen Anwärter vor ihm, zurück. Denn sie schwärmt für jemand absolut Unstandesgemäßen. Aber Gregory Bridgerton wäre die ideale Partie für Hermione, findet Lucy. Sie will dem Glück der beiden etwas auf die Sprünge helfen. Zu dumm, dass sie sich nach einer Weile dann selbst in Gregory verliebt. Eine Ehe mit ihm ist für Lucy undenkbar. Schon weil sie selbst seit Jahren Lord Haselby versprochen ist!»Quinn hat eine so sympathische Familie erschaffen, eine so lebendige und einnehmende Gemeinschaft, dass wir in das Buch eintauchen und sie treffen wollen.« NPR Books
Zur Autorin
Julia Quinn wird als zeitgenössische Jane Austen bezeichnet. Sie studierte zunächst Kunstgeschichte an der Harvard Universität, ehe sie die Liebe zum Schreiben entdeckte. Ihre überaus erfolgreichen historischen Romane präsentieren den Zauber einer vergangenen Epoche und begeistern durch ihre warmherzigen, humorvollen Schilderungen.
Lieferbare Titel
Bridgerton – Der Duke und ich (Bridgerton 1) Bridgerton – Wie bezaubert man einen Viscount? (Bridgerton 2) Bridgerton – Wie verführt man einen Lord? (Bridgerton 3) Bridgerton – Penelopes pikantes Geheimnis (Bridgerton 4) Bridgerton – In Liebe, Ihre Eloise (Bridgerton 5) Bridgerton – Ein hinreißend verruchter Gentleman (Bridgerton 6) Bridgerton – Mitternachtsdiamanten (Bridgerton 7)Bridgerton – Hochzeitsglocken für Lady Lucy (Bridgerton 8) Rokesby – Der Earl mit den eisblauen Augen (Rokesby 1) Rokesby – Tollkühne Lügen, sinnliche Leidenschaft (Rokesby 2)
Julia Quinn
Bridgerton
Hochzeitsglocken für Lady Lucy
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Lingsminat und Ira Panic
HarperCollins
Die Originalausgaben erschienen 2006 und 2013 unter den TitelnOn the Way to the Wedding und On the Way to the Wedding: The 2nd Epilogue in The Bridgertons: Happily Ever Afters bei AVON BOOKS, an imprint of HarperCollins Publishers, US.
© 2006 by Julie Cotler Pottinger © 2009 by Julie Cotler Pottinger Erweiterte Neuausgabe © 2022 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with HarperCollins Publishers L.L.C., New York Umschlaggestaltung von Birgit Tonn, Artwork Harlequin Umschlagabbildung von Lee Avison / Trevillion Images, GSshot / GettyImages, mentalmind / shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783365000397www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für Lyssa Keusch. Weil du meine Lektorin bist. Weil du meine Freundin bist. Und für Paul, einfach so.
PROLOG
London, nicht weit von St. George’s am Hanover Square
Sommer1827
Seine Lungen brannten.
Gregory Bridgerton rannte. Durch London. Völlig blind für die neugierigen Blicke der Passanten rannte er durch die Straßen Londons.
Seinen Bewegungen haftete ein erstaunlich kraftvoller Rhythmus an – eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier –, der ihn vorantrieb, seine Schritte beschleunigte. Im Geiste konzentrierte er sich auf eine Sache, eine einzige Sache.
Die Kirche.
Er musste zur Kirche gelangen.
Er musste die Hochzeit aufhalten.
Wie lang er wohl schon rannte? Eine Minute? Fünf? Er wusste es nicht, konnte an nichts anderes denken als sein Ziel.
Die Kirche. Er musste zur Kirche gelangen.
Um elf hatte es angefangen. Diese Sache. Diese Zeremonie. Diese Sache, die gar nicht hätte passieren dürfen. Bloß hatte sie dennoch damit angefangen. Und er musste es aufhalten. Er musste sie aufhalten. Wie, das wusste er nicht, und er wusste auch nicht, warum sie sich dazu entschlossen hatte, aber sie tat es, und es war verkehrt.
Sie musste doch wissen, dass es falsch war.
Sie gehörte zu ihm. Sie gehörten zusammen. Das wusste sie. Verdammt, sie musste es doch wissen.
Wie lang dauerte eine Trauzeremonie? Fünf Minuten? Zehn? Zwanzig? Bisher hatte er nie darauf geachtet, hatte natürlich nie daran gedacht, zu Beginn und Ende auf die Uhr zu sehen.
Er hatte nie damit gerechnet, dass er diese Information einmal brauchen könnte. Hatte nie damit gerechnet, dass es einmal so wichtig werden könnte.
Wie lang rannte er schon durch die Stadt? Zwei Minuten? Zehn?
Er schlidderte um eine Ecke in die Regent Street und knurrte etwas, was als Entschuldigung gelten sollte, als er gegen einen ehrbar gekleideten Gentleman prallte und ihm dabei die Mappe aus der Hand riss.
Normalerweise wäre Gregory stehen geblieben, um dem Herrn zu helfen, der sich nun nach seiner Mappe bückte, aber nicht an diesem Tag, nicht an diesem Morgen.
Jetzt nicht.
Die Kirche. Er musste zur Kirche. An etwas anderes konnte er nicht denken. Das durfte er nicht. Er musste …
Verdammt. Nun schnitt ihm auch noch eine Kutsche den Weg ab und brachte ihn abrupt zum Stehen. Er stützte sich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab – nicht, weil er das wollte, sondern weil ihn sein geschundener Körper dazu zwang – und sog die Luft in tiefen Zügen ein, um den höllischen Druck in der Brust zu lindern, dieses schreckliche Brennen …
Die Kutsche fuhr an ihm vorbei, und er begann wieder zu laufen. Bald wäre er dort. Er konnte es schaffen. Seit er das Haus verlassen hatte, konnten nicht viel mehr als fünf Minuten vergangen sein. Vielleicht sechs. Auch wenn es sich mehr wie dreißig anfühlte, konnten es nicht mehr als allerhöchstens sieben Minuten sein.
Er musste es aufhalten. Es war falsch. Er musste es aufhalten. Und das würde er auch.
Nun sah er die Kirche. In der Ferne erhob sich der graue Turm in den strahlend blauen Himmel. Jemand hatte die Gaslaternen mit Blumen geschmückt. Er wusste nicht, um welche Sorte es sich handelte – gelb und weiß, hauptsächlich gelb. Üppig blühend quollen sie aus den Körben. Festlich wirkten sie, fröhlich sogar, und das war völlig verkehrt. Dieser Tag bot keinerlei Anlass zu Frohsinn, und das Fest war keines, das man feiern mochte.
Er würde der Sache ein Ende bereiten.
Er verlangsamte seinen Laufschritt gerade so weit, dass er die Stufen hinaufeilen konnte, ohne zu stürzen, und dann riss er die Tür auf, ganz weit. Er hörte es kaum, als sie krachend hinter ihm ins Schloss fiel. Vielleicht hätte er erst Atem schöpfen sollen. Vielleicht hätte er ganz leise eintreten sollen, um sich Gelegenheit zu verschaffen, in aller Stille die Lage zu sondieren und festzustellen, wie weit sie schon gediehen waren mit der Zeremonie.
In der Kirche wurde es totenstill. Der Pfarrer hielt inne, und die gesamte Gemeinde wandte sich zur Tür.
Zu ihm.
»Nicht«, keuchte Gregory, doch er war so außer Atem, dass er sich selbst kaum hörte.
»Nicht«, wiederholte er lauter und trat stolpernd vor, wobei er sich auf die Kirchenbänke stützte. »Tu’s nicht.«
Sie schwieg, doch er sah sie. Vor Schreck stand ihr der Mund offen. Der Brautstrauß entglitt ihren Händen, und er wusste – Gott, er wusste es einfach –, dass ihr der Atem stockte.
Sie sah so schön aus. Ihr goldenes Haar schien das Licht einzufangen, und es glänzte so strahlend, dass er neue Kraft daraus schöpfte. Er richtete sich auf. Auch wenn er immer noch keuchte, konnte er nun wieder gehen, ohne sich festhalten zu müssen. Er ließ die Kirchenbank los.
»Tu’s nicht«, sagte er und ging entschlossen auf sie zu. Er wusste, was er wollte.
Er wusste, was richtig war.
Sie schwieg immer noch. Keiner sagte ein Wort. Das war merkwürdig. Die dreihundert größten Klatschbasen der Hauptstadt waren an einem Ort versammelt, und keine brachte einen Ton heraus. Alle Blicke waren wie gebannt auf ihn gerichtet, als er den Mittelgang hinunterschritt.
»Ich liebe dich«, sagte er, vor allen Leuten. Warum auch nicht? Er wollte kein Geheimnis daraus machen. Er würde nicht zusehen, wie sie einen anderen heiratete, ohne die Welt wissen zu lassen, dass sein Herz allein ihr gehörte.
»Ich liebe dich«, wiederholte er. Aus den Augenwinkeln sah er seine Mutter und seine Schwester, die beide wie erstarrt in einer Kirchenbank saßen und den Mund weit aufrissen.
Er ging weiter den Gang hinunter, und mit jedem Schritt wuchs seine Sicherheit, sein Selbstvertrauen.
»Tu’s nicht«, sagte er noch einmal, als er die Apsis erreicht hatte. »Heirate ihn nicht.«
»Gregory«, wisperte sie. »Warum tust du das?«
»Ich liebe dich«, sagte er. Mehr gab es nicht zu sagen. Dies war das Einzige, was zählte.
Ihre Augen wurden feucht. Sie blickte zu dem Mann auf, den sie zu heiraten versuchte. Der hob nur die Brauen und zuckte fast unmerklich mit einer Schulter, als wollte er sagen: »Das ist deine Entscheidung.«
Gregory sank auf ein Knie. »Heirate mich«, bat er aus tiefstem Herzen. »Heirate mich.«
Er hielt den Atem an. Die ganze Kirche hielt den Atem an.
Dann sah sie ihn an. Ihre Augen waren riesig und klar, voll Güte und Wahrheit.
»Heirate mich«, flüsterte er ein letztes Mal.
Ihre Lippen zitterten, doch ihre Stimme war fest, als sie sagte …
1. KAPITEL
In dem sich unser Held verliebt.
Zwei Monate zuvor
Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Bekannten glaubte Gregory Bridgerton an die Liebe.
Er wäre dumm gewesen, wenn er es nicht getan hätte.
Man denke an:
seinen ältesten Bruder Anthony,
seine älteste Schwester Daphne,
seine anderen Brüder Benedict und Colin, ganz zu schweigen von seinen Schwestern Eloise, Francesca und (ärgerlich, aber wahr) Hyacinth, die alle – alle – glücklich verliebt in ihre diversen Gatten waren.
Ein solcher Stand der Dinge hätte viele Herren gründlich angewidert, aber für Gregory, der mit einem ungewöhnlich fröhlichen, wenn auch gelegentlich enervierenden – zumindest wenn man nach seiner Schwester Hyacinth ging – Naturell gesegnet war, bedeutete es einfach nur, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb, als das Offensichtliche auch zu glauben.
Die Liebe existierte.
Sie war eben kein Hirngespinst, das nur dazu diente, die Poeten vor dem Hungertod zu bewahren. Selbst wenn man sie nicht sehen, riechen oder berühren konnte, sie existierte. Auch für ihn war es nur eine Frage der Zeit, bis er die Frau seiner Träume fand, sich zur Ruhe setzte, fruchtbar wurde und sich vermehrte und sich so merkwürdige Steckenpferde zulegte wie Pappmaschee oder das Sammeln von Muskatreiben.
Obwohl, wenn man es ganz genau nahm, was bei so abstrakten Vorstellungen vielleicht gar nicht angebracht war, rankten sich seine Träume um keine bestimmte Frau. Er hatte keine Ahnung, wie seine Traumfrau beschaffen sein sollte, die doch sein Leben umkrempeln und ihn in eine glückliche, wenn auch langweilige Stütze der Gesellschaft verwandeln würde. Er wusste nicht, ob sie groß oder klein sein würde, brünett oder blond. Er stellte sie sich gern als intelligent und humorvoll vor, aber darüber hinaus hatte er keine rechte Ahnung. Wie auch? Sie könnte schüchtern oder freimütig sein. Vielleicht sang sie gern. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war sie ein sportlicher Typ, der gern ausritt, mit gesunder Gesichtsfarbe, weil sie so viel Zeit im Freien verbrachte.
Er wusste es einfach nicht. Was diese Frau betraf, diese unglaubliche, wundervolle Frau, die es im Augenblick noch gar nicht gab, so war er sich nur in einem ganz sicher: Wenn er ihr begegnete, würde er es wissen.
Ihm war nicht klar, woher er es wissen sollte, er war sich einfach nur sicher, dass es so kommen würde. Irgendwie musste diese überwältigende, erschütternde, das Leben vollkommen verändernde … also wirklich, so etwas würde sich doch nicht in sein Leben hereinschleichen. Er würde sie sehen, und ihm würde nicht nur das sprichwörtliche Licht aufgehen, sondern ein Kronleuchter, ein ganzer Ballsaal voller Kronleuchter. Er wusste nur noch nicht, wann es passieren würde.
Und er sah keinen Grund, die Zeit bis zu ihrer Ankunft nicht zu genießen. Schließlich brauchte man nicht wie ein Mönch zu leben, während man auf die große Liebe wartete.
Gregory war ein typischer Londoner Gentleman mit komfortablem, aber keineswegs opulentem Auskommen, hatte jede Menge Freunde und genügend Vernunft, um rechtzeitig vom Spieltisch aufzustehen. Allgemein galt er als recht gute Partie – wenn auch nicht gerade als erste Wahl, das waren vierte Söhne nun mal nie –, und er war immer gefragt, wenn eine Matrone der Gesellschaft noch einen passenden Herrn für ihre Abendeinladung suchte.
Was besagtes Auskommen ein wenig länger vorhalten ließ – immer von Vorteil.
Vielleicht bräuchte er eine Aufgabe im Leben, ein Ziel, auf das er hinarbeiten könnte, oder auch nur eine sinnvolle Beschäftigung. Aber das konnte ja noch ein wenig warten, oder? Er war sich sicher, dass sein Weg bald klar vor ihm liegen würde. Er würde wissen, was er tun wollte und mit wem, und bis dahin würde er sich …
Nicht vergnügen. Zumindest nicht jetzt im Augenblick.
Es war nämlich so: Gregory saß gerade in einem Ledersessel, einem ziemlich bequemen sogar – nicht dass das viel zur Sache getan hätte, nur insofern, als gemütliche Möbelstücke mehr zum Träumen einluden als unbequeme, was wiederum dazu führte, dass er seinem Bruder nicht zuhörte, der in kurzer Entfernung vor ihm stand und irgendeine Predigt hielt. Worum es genau ging, wusste er nicht, es kamen jedenfalls die Worte Pflicht und Verantwortung darin vor.
Gregory hörte nicht recht hin. Das tat er eigentlich nie.
Also, manchmal hörte er schon zu, aber …
»Gregory? Gregory?«
Blinzelnd sah er auf. Anthony hatte die Arme vor der Brust verschränkt, was nie ein gutes Zeichen war. Anthony war der Viscount Bridgerton, und das seit über zwanzig Jahren. Und auch wenn er, wie Gregory gewiss als Erster versichern würde, ein prima Bruder war, würde er doch auch einen prächtigen Feudalherrn abgeben.
»Verzeih, wenn ich mich in deine Gedanken einmische, wenn man es denn Gedanken nennen kann, was dir so durch den Kopf geht«, bemerkte Anthony trocken, »aber hast du zufällig – rein zufällig – irgendetwas gehört von dem, was ich gesagt habe?«
»Fleiß«, sagte Gregory aufs Geratewohl und nickte mit gebührendem Ernst. »Zielstrebigkeit.«
»Allerdings«, erwiderte Anthony, und Gregory beglückwünschte sich zu seiner erstklassigen Vorstellung. »Es wird höchste Zeit, dass du dir für dein Leben irgendein Ziel setzt.«
»Natürlich«, murmelte Gregory, hauptsächlich deswegen, weil er das Abendessen verpasst hatte und ihm nun der Magen knurrte. Er hatte munkeln hören, dass seine Schwägerin im Garten leichte Erfrischungen servierte. Außerdem hatte es ohnehin keinen Zweck, Anthony zu widersprechen. Nie.
»Du musst tatsächlich etwas verändern. Einen neuen Kurs wählen.«
»Allerdings.« Vielleicht gäbe es Sandwiches. Von den kleinen Dingern könnte er jetzt ohne Weiteres vierzig Stück verdrücken.
»Gregory.«
In Anthonys Stimme war jener gewisse Ton getreten, der zwar schwer zu beschreiben, aber sofort zu erkennen war. Gregory wusste, dass er nun besser aufpasste.
»Ja«, sagte er gedehnt. Bemerkenswert, wie gut man mit einem einzigen Wort einen richtigen Satz hinauszögern konnte. »Ich werde wohl Pfarrer werden.«
Anthony erstarrte. Wie ein Eisberg. Gregory kostete diesen Moment weidlich aus. Schade nur, dass der Preis dafür ziemlich hoch war: Jetzt musste er Pfarrer werden.
»Wie bitte?«, murmelte Anthony schließlich.
»Ich habe schließlich keine große Wahl«, meinte Gregory. Diese Worte sagte er zum ersten Mal im Leben. Irgendwie verlieh ihnen das größeren Nachdruck, größere Nachhaltigkeit. »Entweder das Militär oder die Kirche«, fuhr er fort. »Und, nun ja, es muss einmal gesagt werden: Ich schieße ganz miserabel.«
Darauf erwiderte Anthony nichts. Gregorys Einschätzung entsprach der Wahrheit, das wussten sie alle.
Nach kurzem verlegenem Schweigen murmelte Anthony: »Es gibt ja auch noch den Degen.«
»Ja, aber bei meinem Glück schicken sie mich in den Sudan.« Gregory erschauerte. »Ich will ja nicht übertrieben pingelig sein, nur weißt du, die Hitze. Würdest du dorthin gehen wollen?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Und«, fügte Gregory hinzu, dem die Sache allmählich Spaß machte, »an Mutter muss ich auch denken.«
Eine Pause trat ein. Dann: »Und was genau hat Mutter nun mit dem Sudan zu tun?«
»Nun, es würde ihr nicht gefallen, wenn ich dorthin ginge, und du wärst derjenige, der ihr die Hand halten muss, wenn sie sich Sorgen macht oder irgendwelche entsetzlichen Albträume …«
»Das reicht«, unterbrach Anthony.
Gregory gestattete sich ein verstohlenes Lächeln. Seiner Mutter gegenüber war das nicht ganz fair, da sie bisher nie behauptet hatte, die Zukunft mit etwas so Schwammigem wie einem Albtraum vorherzusagen. Doch sie fände es tatsächlich schlimm, wenn er in den Sudan ginge, und Anthony würde sich tatsächlich ihre Sorgen anhören müssen.
Da Gregory allerdings nicht die Absicht hatte, Britanniens neblige Gestade zu verlassen, war die Frage ohnehin rein akademisch.
»Schön«, sagte Anthony. »Schön. Ich bin froh, dass wir endlich darüber gesprochen haben.«
Gregory linste auf die Uhr.
Anthony räusperte sich, und in seine Stimme mischte sich ein ungeduldiger Ton: »Und dass du dir endlich Gedanken über deine Zukunft machst.«
Gregory wurde die Kehle eng. »Ich bin erst sechsundzwanzig«, erinnerte er seinen Bruder. »Sicherlich noch zu jung für dieses andauernde ›endlich‹, findest du nicht?«
Anthony hob nur eine Augenbraue. »Soll ich mich mit dem Erzbischof in Verbindung setzen? Eine Pfarrei für dich finden?«
Das löste bei Gregory unvermittelt einen Hustenanfall aus. »Äh, nein«, sagte er, als er wieder sprechen konnte. »Noch nicht.«
Um Anthonys Mundwinkel zuckte es ein wenig. Nicht viel, und von einem Lächeln war es noch weit entfernt. »Du könntest ja heiraten.«
»Könnte ich«, stimmte Gregory zu. »Werde ich auch. Ich habe es sogar fest vor.«
»Wirklich?«
»Wenn ich die richtige Frau gefunden habe.« Und als er Anthonys zweifelnde Miene sah, fügte Gregory hinzu: »Gerade du würdest mir doch sicher eine Liebesheirat statt einer Vernunftehe empfehlen!«
Wie alle wussten, betete Anthony seine Frau an, die seine Gefühle unerklärlicherweise voll und ganz erwiderte. Ebenfalls wohlbekannt war die Tatsache, dass Anthony seinen sieben jüngeren Geschwistern treu ergeben war, deswegen hätte Gregory gar nicht so überrascht und gerührt sein dürfen, als Anthony leise sagte: »Ich wünsche dir von Herzen, dass du ebensolches Glück hast wie ich.«
Gregory war einer Antwort enthoben, als sein Magen laut und vernehmlich zu knurren begann. Verlegen sah er zu seinem Bruder. »Tut mir leid. Ich habe das Dinner verpasst.«
»Ich weiß. Wir haben dich früher erwartet.«
Gregory konnte es sich gerade noch verkneifen, schuldbewusst den Kopf einzuziehen.
»Kate war ein wenig verstimmt.«
Das war das Schlimmste. Wenn Anthony enttäuscht war, ging es gerade noch an. Doch wenn er behauptete, man habe seine Frau irgendwie bekümmert …
Nun, dann wusste Gregory, dass er in Schwierigkeiten steckte. »Bin erst spät in London losgekommen«, murmelte er. Auch wenn das stimmte, entschuldigte das sein schlechtes Benehmen keineswegs. Er war zum Dinner auf der Hausgesellschaft erwartet worden, und er hatte versagt. Beinahe hätte er gesagt: Ich mache es wieder gut, doch im letzten Augenblick biss er sich auf die Zunge. Irgendwie würde das die Sache nur schlimmer machen – fast als würde er damit seine Nachlässigkeit auf die leichte Schulter nehmen, indem er so tat, als bedurfte es nur eines Lächelns und einer charmanten Bemerkung, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Was ihm oft gelang, doch aus irgendeinem Grund …
Wollte er es diesmal nicht.
Daher sagte er einfach: »Es tut mir leid.« Und meinte es auch so.
»Sie ist im Garten«, brummte Anthony. »Ich glaube, sie hat auch ein wenig Tanz eingeplant – auf der Terrasse, ist das zu fassen?«
Gregory konnte sich das gut vorstellen. Es klang ganz nach seiner Schwägerin. Sie feierte die Feste gern, wie sie fielen, warum also nicht einen spontanen Tanzabend im Freien organisieren, bei diesem ungewöhnlich schönen Wetter?
»Sieh zu, dass du mit allen tanzt, die sie dir vorstellt«, wies Anthony ihn an. »Kate würde es nicht gutheißen, wenn sich eine der jungen Damen ausgeschlossen fühlte.«
»Natürlich«, murmelte Gregory.
»Ich komme in einer Viertelstunde nach«, sagte Anthony und setzte sich wieder an den Schreibtisch, an dem ihn noch mehrere Papierstapel erwarteten. »Ich habe hier noch ein paar Sachen zu erledigen.«
Gregory stand auf. »Ich werde es Kate ausrichten.« Da das Gespräch offenbar beendet war, verließ er den Raum und ging in den Garten.
Er war schon länger nicht mehr auf Aubrey Hall gewesen, dem Familiensitz der Bridgertons. Über Weihnachten versammelte sich die Familie natürlich auf ihrem Landsitz in Kent, aber für Gregory war es kein Heim, war es nie gewesen. Nach dem Tod seines Vaters hatte seine Mutter ihre Kinder genommen und war mit ihnen nach London gezogen, wo sie dann auch den größten Teil des Jahres verbrachten. Sie hatte es zwar nie gesagt, doch Gregory glaubte, dass der Familiensitz einfach zu viele Erinnerungen barg.
Daher hatte Gregory sich in der Stadt mehr daheim gefühlt als auf dem Land. Das Zuhause seiner Kindheit war Bridgerton Hall in London, nicht Aubrey Hall. Seine Besuche genoss er trotzdem, ebenso die ländlichen Vergnügungen wie Reiten und Schwimmen (wenn das Wasser im See warm genug war), und seltsamerweise freute er sich auch über die langsamere Gangart. Nach Monaten in der Stadt wusste er die saubere Luft und die ruhige Umgebung zu schätzen.
Und wenn es ihm zu ruhig und zu sauber wurde, konnte er dem Ganzen wieder den Rücken zukehren.
Die Abendgesellschaft wurde auf dem Südrasen abgehalten, wie er bei seiner Ankunft vom Butler erfahren hatte. Für eine Feier im Freien schien es der geeignete Ort – ebener Grund, Blick auf den See und eine große Terrasse mit genügend Sitzgelegenheiten für die Gäste, die nicht mehr so gut auf den Beinen waren.
Sobald er den Salon betrat, hörte er durch die offenen Fenstertüren das Stimmengewirr. Er wusste nicht, wie viele Gäste seine Schwägerin zur Hausgesellschaft eingeladen hatte, wahrscheinlich an die zwanzig, dreißig Leute. Genau die richtige Anzahl, die einen intimen Rahmen gewährleistete, es einem aber gleichzeitig ermöglichte, sich zurückzuziehen, ohne in der Gruppe eine störende Lücke zu hinterlassen.
Gregory durchquerte den Salon und überlegte, welche Speisen Kate wohl servieren ließ. Viel gäbe es natürlich nicht; wie er Kate kannte, hatte sie ihre Gäste schon mit einem üppigen Dinner versorgt.
Etwas Süßes, entschied Gregory, als er beim Betreten der Terrasse leichten Zimtduft wahrnahm. Enttäuscht stieß er die Luft aus. Er hatte einen Bärenhunger, und ein mächtiges Stück Fleisch wäre für ihn jetzt der Himmel auf Erden gewesen.
Doch er hatte sich verspätet, und daran war nur er selbst schuld, und wenn er sich nicht gleich unter die Gesellschaft mischte, würde Anthony ihm den Kopf abreißen. Er würde sich also mit Kuchen und Keksen begnügen müssen.
Eine warme Brise strich ihm über das Gesicht, als er nach draußen trat. Für Mai war es bisher erstaunlich warm gewesen, alle redeten darüber. Bei so einem Wetter schien man ganz automatisch gute Laune zu bekommen – es war so überraschend angenehm, dass man gar nicht anders konnte als lächeln. Und die Gäste auf der Terrasse wirkten auch überaus vergnügt: Ins Stimmengewirr mischten sich immer wieder tiefe Lachsalven und hohes Gekicher.
Suchend sah Gregory sich um, wobei er sowohl nach Erfrischungen als auch nach einem bekannten Gesicht Ausschau hielt, vorzugsweise dem seiner Schwägerin Kate. Der Anstand diktierte schließlich, dass er sie zuerst begrüßte. Doch während er den Blick schweifen ließ, sah er stattdessen …
Sie.
Sie.
Und da wusste er es. Er wusste, dass sie es war. Ihm blieb sprichwörtlich die Luft weg. Atemlos stand er da, erstarrt und wie gelähmt.
Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, nicht einmal im Profil. Nur ihren Rücken, den atemberaubend vollkommenen Nacken, die blonde Locke, die sich über ihre Schulter ringelte.
Und er konnte nur noch denken: Jetzt hat es mich erwischt.
Nun war er für alle anderen Frauen verloren. Diese Intensität, diese Glut, diese überwältigende Gewissheit, die Richtige gefunden zu haben – so etwas hatte er noch nie erlebt.
Es mochte albern sein, vielleicht auch verrückt. Vermutlich sowohl als auch. Aber er hatte darauf gewartet. So lange hatte er auf diesen Moment gewartet. Und plötzlich wurde ihm klar, warum er weder Priester geworden noch zum Militär gegangen war, noch eines der zahlreichen Angebote seines Bruders angenommen hatte, sich um ein kleineres Bridgerton-Gut zu kümmern.
Er hatte gewartet. Das war alles. Und bis zu diesem Augenblick war ihm nicht einmal bewusst gewesen, dass er nur auf diesen Moment gewartet hatte.
Und nun war er da.
Sie war da.
Er wusste es einfach.
Langsam überquerte er den Rasen; das Essen und seine Schwägerin waren vergessen. Es gelang ihm gerade noch, den Leuten, an denen er vorbeiging, einen Gruß zuzumurmeln, ohne innezuhalten. Er musste an ihre Seite eilen – ihr Gesicht sehen, ihren Duft einatmen, den Klang ihrer Stimme hören.
Und dann war er bei ihr, nur wenige Fuß von ihr entfernt. Atemlos, voll Ehrfurcht stand er da, irgendwie schon erfüllt davon, nur in ihrer Nähe zu weilen.
Sie unterhielt sich gerade mit einer jungen Dame, und an dem lebhaften Gespräch sah er, dass die beiden Freundinnen waren. Reglos verharrte er einen Moment, beobachtete sie, bis sie ihn bemerkten und sich zu ihm umwandten.
Er lächelte. Ganz leicht. Und sagte …
»Guten Abend.«
Lucinda Abernathy, den meisten – nun ja, allen – besser bekannt als Lucy, unterdrückte ein Stöhnen, als sie sich zu dem Gentleman umdrehte, der sich an sie herangepirscht hatte, vermutlich um Hermione anzuhimmeln, wie die meisten – nun ja, alle –, die ihre Freundin zu Gesicht bekamen.
Dieses Risiko ging man eben ein, wenn man mit Hermione Watson befreundet war. Sie sammelte gebrochene Herzen, genau wie der alte Pfarrer unten an der Abtei Schmetterlinge sammelte.
Der einzige Unterschied war natürlich, dass Hermione ihre Opfer nicht mit spitzen kleinen Nadeln durchbohrte. Um gerecht zu sein: Hermione wollte die Herzen der Gentlemen gar nicht erobern, geschweige denn brechen. Es … passierte einfach. Lucy war es inzwischen gewohnt. Hermione war eben Hermione, mit hellblondem Haar wie Butter, herzförmigem Gesicht und riesigen, weit auseinanderstehenden Augen von einem aufsehenerregenden Grün.
Lucy andererseits war … nun ja, Hermione war sie nicht, so viel stand fest. Sie war sie selbst, und meistens reichte das auch.
Lucy war auf beinahe jede ersichtliche Art etwas weniger als Hermione. Etwas weniger blond. Etwas weniger schlank. Etwas weniger groß. Ihre Augen waren etwas weniger farbintensiv – blaugrau, auch sehr attraktiv, wenn man sie mit anderen als Hermiones verglich, aber das nützte ihr wenig, denn ohne Hermione ging sie ja nirgendwohin.
Zu diesem erschütternden Schluss war sie eines Tages in Miss Moss’ Institut für Höhere Töchter gekommen, das sie und Hermione drei Jahre lang besucht hatten.
Lucy war einfach ein bisschen weniger. Oder, wenn man es netter ausdrücken wollte: nicht ganz so.
Sie fand sich ganz attraktiv, auf die gesunde, traditionelle englische Art, aber die Männer waren bei ihrem Anblick selten (also gut: nie) überwältigt.
Bei Hermione hingegen … wie gut, dass sie ein so netter Mensch war. Sonst hätte man mit ihr unmöglich befreundet sein können.
Nun ja, dies und der Umstand, dass sie einfach nicht tanzen konnte. Walzer, Quadrille, Menuett, egal was, sie konnte es nicht.
Und das war einfach herrlich.
Lucy fand nicht, dass sie übertrieben oberflächlich war, sie hätte sich für ihre liebste Freundin nötigenfalls auch vor eine Kutsche geworfen, doch irgendwie hatte es eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit an sich, dass das schönste Mädchen von ganz England zwei linke Füße hatte.
Bildlich gesprochen.
Und nun stand da schon wieder einer. Ein Mann, kein Fuß. Dazu auch noch attraktiv. Groß, allerdings nicht im Übermaß, mit braunem Haar und einem ziemlich angenehmen Lächeln. Und einem Zwinkern in den Augen, deren Farbe sie im Dunkeln nicht so genau erkennen konnte.
Ganz zu schweigen davon, dass sie ihm gar nicht richtig in die Augen sehen konnte, weil er sie nicht anschaute. Er sah Hermione an, wie alle Männer.
Lucy lächelte höflich, obwohl er das wohl kaum bemerken würde, und wartete darauf, dass er sich verbeugte und vorstellte.
Und dann tat er etwas überaus Erstaunliches. Nachdem er seinen Namen genannt hatte – sie hätte wissen müssen, dass er ein Bridgerton war, bei dem Aussehen –, beugte er sich herab und küsste ihr zuerst die Hand.
Lucy hielt den Atem an.
Gleich darauf wurde ihr natürlich klar, was er damit bezweckte.
Er war gut. Wirklich gut. Am schnellsten eroberte man Hermiones Herz, wenn man Lucy ein Kompliment machte.
Pech für ihn, dass Hermiones Herz bereits anderweitig vergeben war.
Ach, je nun. Zumindest wäre es amüsant, das Schauspiel zu verfolgen.
»Ich bin Miss Hermione Watson«, sagte Hermione soeben, und Lucy erkannte, dass sich Mr. Bridgertons Taktik als doppelt schlau erwies. Indem er Hermiones Hand als zweite küsste, konnte er länger dabei verweilen, und Hermione wäre diejenige, welche die Vorstellung übernehmen musste.
Beinah war Lucy beeindruckt. Wenn schon sonst nichts, so bewies er damit zumindest, dass er klüger war als der Durchschnitt.
»Und das«, fuhr Hermione fort, »ist meine allerliebste Freundin, Lady Lucinda Abernathy.«
Sie sagte es so, wie sie es immer sagte, voll Liebe, Bewunderung und vielleicht auch mit einer winzigen Spur Verzweiflung, als wollte sie sagen – Meine Güte, nun gönnen Sie Lucy doch auch mal einen Blick!
Allerdings taten das die Gentlemen nie. Nur wenn sie Rat suchten wegen Hermione und Hermiones Herzen und wie es zu erobern sei. Da war Lucy dann immer sehr gefragt.
Mr. Bridgerton – Mr. Gregory Bridgerton, wie Lucy sich in Gedanken korrigierte, denn soweit sie wusste, gab es drei Mr. Bridgertons, den Viscount nicht mitgerechnet – drehte sich um und überraschte sie mit einem gewinnenden Lächeln und einem warmherzigen Blick. »Guten Abend, Lady Lucinda«, murmelte er.
»Guten Abend, Mr. Bridgerton«, erwiderte sie, und dann hätte sie sich am liebsten einen Tritt versetzt, weil sie ein wenig ins Stottern geraten war, aber, gütiger Himmel, normalerweise gönnten sie ihr keinen Blick, sobald sie Hermione gesehen hatten.
War es möglich, dass er sich für sie interessierte?
Nein, unmöglich. Das taten die Herren nie.
Aber spielte das überhaupt eine Rolle? Natürlich wäre es reizend, wenn sich ein Mann zur Abwechslung einmal unsterblich in sie verlieben würde. Gegen eine solche Aufmerksamkeit hätte sie nichts einzuwenden. Doch in Wirklichkeit war Lucy praktisch mit Lord Haselby verlobt, seit vielen Jahren schon, es hätte also wenig Sinn, wenn sie von einem glühenden Verehrer umworben würde. Es würde schließlich zu nichts führen.
Und außerdem war es ja nicht Hermiones Schuld, dass sie mit dem Gesicht eines Engels geboren war.
Hermione also war die Sirene und Lucy die verlässliche Freundin, so weit war die Welt in Ordnung. Oder zumindest vorhersehbar.
»Dürfen wir Sie unseren Gastgebern zurechnen?«, erkundigte sich Lucy schließlich, nachdem keiner von ihnen nach der Begrüßung noch etwas gesagt hatte. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Ich fürchte, nicht«, erwiderte Mr. Bridgerton. »So gern ich die Lorbeeren für diese Gesellschaft ernten würde – ich wohne in London.«
»Wie schön, einen Besitz wie Aubrey Hall in der Familie zu haben«, meinte Hermione höflich, »selbst wenn er Ihrem Bruder gehört.«
Und in diesem Augenblick erkannte Lucy die Wahrheit. Mr. Bridgerton interessierte sich für Hermione. Auch wenn er ihr zuerst die Hand geküsst und sie, im Gegensatz zu anderen Männern, tatsächlich angesehen hatte, als sie etwas gesagt hatte. Doch man brauchte nur zu beobachten, wie er Hermione betrachtete, um zu wissen, dass auch er sich den Heerscharen der Verehrer angeschlossen hatte.
Seine Augen wirkten leicht glasig. Seine Lippen waren geöffnet. Und er strahlte eine Glut aus, als hätte er Hermione am liebsten auf die Arme genommen und über den Hügel davongetragen, und zum Teufel mit den anderen Gästen, Anstand und Sitte.
Sie sah er ganz anders an – höfliches Desinteresse beschrieb den Blick am besten. Oder vielleicht auch etwas wie: Warum versperren Sie mir den Weg und hindern mich daran, Hermione auf die Arme zu nehmen und über den Hügel davonzutragen, und zum Teufel mit den anderen Gästen, Anstand und Sitte?
Enttäuschend wäre nicht ganz das richtige Wort dafür gewesen. Nur … unenttäuschend war es auch nicht.
Dafür sollte es ein Wort geben. Wirklich.
»Lucy? Lucy?«
Leicht verlegen bemerkte Lucy, dass sie nicht auf die Unterhaltung geachtet hatte. Hermione betrachtete sie neugierig, den Kopf schief gelegt, was die Gentlemen immer so anziehend fanden. Lucy hatte es auch einmal versucht. Ihr war schwindelig davon geworden.
»Mr. Bridgerton hat mich um einen Tanz gebeten«, erklärte Hermione, »aber ich habe ihm gesagt, dass ich nicht kann.«
Hermione schützte immer verstauchte Knöchel oder Erkältungen vor, um nicht auf die Tanzfläche zu müssen. Was ja gut und schön war, nur dass sie ihre Verehrer immer an ihre Freundin abschob. Was ebenfalls gut und schön war, zumindest anfangs, doch inzwischen geschah es so häufig, dass Lucy den Verdacht hegte, die Herren glaubten, es geschähe aus Mitleid, und nichts war weiter von der Wahrheit entfernt.
Lucy tanzte ziemlich gut, auch wenn sie selbst das sagte. Und sie wusste hervorragend zu plaudern.
»Es wäre mir eine Ehre, mit Lady Lucinda zu tanzen«, sagte Mr. Bridgerton. Was hätte er auch sonst sagen sollen?
Daher lächelte Lucy ihn an, wenn auch nicht von Herzen, und ließ sich von ihm auf die Tanzfläche der Terrasse führen.
2. KAPITEL
In welchem unsere Heldin einen entschiedenen Mangel an Respekt vor allen romantischen Angelegenheiten offenbart.
Gregory war durch und durch Gentleman, und so verbarg er seine Enttäuschung, als er Lady Lucinda den Arm bot, um sie auf die behelfsmäßige Tanzfläche zu führen. Sicher, auch sie war eine hübsche und reizende junge Dame, aber sie war eben nicht Hermione Watson.
Dennoch könnte sich das auch als vorteilhaft erweisen. Offenbar war Lady Lucinda Miss Watsons beste Freundin – Miss Watson hatte im Lauf ihrer kurzen Unterhaltung eine wahre Lobeshymne auf Lady Lucinda angestimmt, während diese auf irgendeinen Punkt im Nichts gestarrt und anscheinend kein Wort mitbekommen hatte. Und da Gregory mit vier Schwestern gesegnet war, wusste er das eine oder andere über die Frauen – das Wichtigste davon war, dass man immer gut beraten war, sich mit der besten Freundin anzufreunden. Vorausgesetzt, die beiden mochten einander wirklich und taten nicht nur so, während sie auf den geeigneten Zeitpunkt warteten, sich ein Messer zwischen die Rippen zu stoßen – ein Verhalten, das bei Frauen öfter vorkommen sollte.
Frauen waren schon seltsam. Wenn sie nur lernen würden zu sagen, was sie dachten, dann wäre die Welt nicht so kompliziert.
Aber Miss Watson und Lady Lucinda schienen einander wirklich zugetan. Und wenn Gregory mehr über Miss Watson erfahren wollte, wäre Lady Lucinda Abernathy eindeutig die richtige Anlaufstelle.
»Weilen Sie schon lange als Gast in Aubrey Hall?«, erkundigte sich Gregory höflich, während sie darauf warteten, dass die Musik einsetzte.
»Erst seit gestern«, erwiderte sie. »Und Sie? Bisher haben wir Sie noch nicht zu sehen bekommen.«
»Ich bin erst heute Abend eingetroffen. Nach dem Essen.« Er verzog das Gesicht. Jetzt, wo er nicht länger Miss Watson vor Augen hatte, fiel ihm wieder auf, wie sehr ihm der Magen knurrte.
»Sie müssen ja halb verhungert sein«, rief Lady Lucinda aus. »Würden Sie lieber ein wenig herumschlendern, statt zu tanzen? Ich verspreche Ihnen, dass wir an einem Tisch mit Erfrischungen vorbeikommen.«
Gregory hätte sie umarmen können. »Sie, Lady Lucinda, sind eine wunderbare junge Dame!«
Sie lächelte, aber auf eine Weise, die er nicht recht einzuordnen wusste. Er war sich relativ sicher, dass ihr sein Kompliment gefiel, doch es lag mehr in diesem Lächeln, vielleicht eine Spur Resignation.
»Sie müssen einen Bruder haben«, erklärte er.
»Ja«, bestätigte sie lächelnd. »Er ist vier Jahre älter als ich und hat eigentlich immer Hunger. Ich wunderte mich wirklich darüber, dass wir noch etwas in der Speisekammer hatten, wenn er in den Ferien nach Hause kam.«
Gregory hängte sie bei sich ein, und dann gingen sie um die Terrasse herum.
»Hier entlang«, erklärte Lady Lucinda und zog ihn am Arm, als er in die Gegenrichtung lenken wollte. »Es sei denn, Sie ziehen Süßigkeiten vor.«
Gregorys Miene hellte sich auf. »Gibt es auch etwas Herzhaftes?«
»Sandwiches. Sie sind zwar klein, aber wirklich köstlich, vor allem die mit Ei.«
Er nickte, ein wenig abwesend. Aus den Augenwinkeln sah er Miss Watson, und deswegen fiel es ihm schwer, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Vor allem, da sie von Männern umzingelt war. Vermutlich hatten sie alle nur darauf gewartet, dass jemand Lady Lucinda von ihrer Seite wegführte, um sich dann auf sie zu stürzen.
»Äh, kennen Sie Miss Watson schon lange?«, fragte er, bemüht, nicht allzu durchschaubar zu sein.
Nach kurzer Pause erwiderte sie. »Drei Jahre. Wir besuchen dasselbe Pensionat. Das heißt, wir haben es besucht. Wir haben die Schule dieses Jahr abgeschlossen.«
»Demnach werden Sie nächstes Frühjahr in London in die Gesellschaft eingeführt?«
»Ja«, sagte sie und wies auf einen Tisch mit kleinen Köstlichkeiten. »Wir haben die letzten Monate damit verbracht, uns, wie Hermiones Mutter es ausdrückt, auf die große Welt vorzubereiten, durch private Gesellschaften und kleine Veranstaltungen.«
»Ah, Sie lassen sich ein wenig aufpolieren?«, meinte er lächelnd.
Sie erwiderte das Lächeln. »Genau. Mittlerweile gäbe ich schon einen fabelhaften Kerzenleuchter ab.«
Das amüsierte ihn. »Nur einen Kerzenleuchter, Lady Lucinda? Bitte unterschätzen Sie sich nicht. Sie sind mindestens eine dieser silbernen Urnen, die heutzutage in jedem Salon stehen.«
»Dann also eine Urne«, erwiderte sie und sah dabei aus, als zöge sie es ernsthaft in Betracht. »Was wäre Hermione?«
Ein Juwel. Ein Diamant. Ein goldgefasster Diamant. Ein goldgefasster Diamant, besetzt mit …
Er gebot seinen Gedanken Einhalt. Diesen poetischen Übungen konnte er auch später noch nachgehen, wenn er nicht gerade mitten im Gespräch war. In einem Gespräch mit einer anderen jungen Dame. »Ach, ich weiß nicht«, meinte er deshalb leichthin und bot ihr freundlich einen Teller dar. »Ich kenne Miss Watson doch kaum.«
Sie schwieg, nur ihre Augenbrauen hoben sich ein Stück. Und in diesem Augenblick wurde Gregory bewusst, dass er über ihre Schulter sah, um einen besseren Blick auf Miss Watson zu erhaschen.
Lady Lucinda seufzte. »Vermutlich sollte ich Ihnen sagen, dass sie in einen anderen verliebt ist.«
Gregory zwang seinen Blick zu der jungen Dame zurück, der seine Aufmerksamkeit ohnehin hätte gelten sollen. »Wie bitte?«
Anmutig zuckte sie mit den Schultern und häufte ein paar kleine Sandwiches auf ihren Teller. »Hermione. Sie liebt einen anderen. Ich dachte, Sie würden das ganz gern wissen.«
Gregory starrte sie mit offenem Mund an, und dann ließ er den Blick entgegen aller Vernunft wieder in Hermiones Richtung wandern. Es war so offensichtlich, so erbärmlich, aber er konnte sich nicht helfen. Er wollte nur … lieber Gott, er wollte sie ansehen und immer nur ansehen. Wenn das nicht Liebe war, wusste er auch nicht.
»Schinken?«
»Was?«
»Schinken.« Lady Lucinda bot ihm mit der Servierzange ein schmales Sandwich an. Ihr Gesicht war ärgerlich gelassen. »Möchten Sie eines?«, fragte sie.
Er knurrte und hielt ihr den Teller hin. Und dann, weil er die Sache nicht so stehen lassen konnte, erklärte er steif: »Es geht mich wirklich nichts an.«
»Das Sandwich?«
»Miss Watson«, stieß er hervor.
Obwohl er das natürlich keineswegs ernst meinte. Soweit es ihn betraf, ging ihn Hermione Watson sehr wohl etwas an.
Ein wenig beunruhigend fand er, dass sie anscheinend nicht ebenso vom Blitz getroffen war wie er. Nie war ihm in den Sinn gekommen, dass seine Gefühle nicht sofort erwidert werden würden, wenn er sich einmal verliebte. Aber zumindest besänftigte die Erklärung – dass sie einen anderen zu lieben glaubte – seinen Stolz. Die Vorstellung, sie liebe einen anderen, war ihm jedenfalls sehr viel angenehmer, als zu glauben, er sei ihr völlig gleichgültig.
Er musste sie jetzt nur noch irgendwie davon überzeugen, dass der andere Mann, wer es auch sein mochte, nicht der Richtige für sie war.
Gregory war nicht so eingebildet, zu glauben, er könne jede Frau bekommen, die ihm gefiel, aber Schwierigkeiten hatte er beim schönen Geschlecht sicher auch noch keine gehabt. Für ihn war es daher einfach undenkbar, dass seine starken Gefühle für Miss Watson lange unerwidert bleiben könnten. Möglich, dass er sich anstrengen musste, um ihr Herz und ihre Hand zu gewinnen, doch das würde seinen Sieg nur umso süßer machen.
Redete er sich zumindest ein. In Wirklichkeit wäre es sehr viel einfacher gewesen, wenn das mit dem Blitzschlag auf Gegenseitigkeit beruht hätte.
»Seien Sie nicht traurig«, sagte Lady Lucinda, während sie die Sandwiches beäugte, als suchte sie exotischere Kost als britischen Schinken.
»Bin ich doch gar nicht«, widersprach er energisch und wartete darauf, dass sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihn richtete. Als sie das nicht tat, wiederholte er: »Ich bin nicht traurig.«
Sie wandte sich zu ihm um, sah ihn offen an und blinzelte. »Also, das finde ich jetzt wirklich erfrischend. Meist sind die Männer am Boden zerstört.«
Seine Miene verfinsterte sich. »Was soll das heißen, meist sind die Männer am Boden zerstört?«
»Genau das, was ich sage«, erwiderte sie ungeduldig. »Und wenn sie nicht am Boden zerstört sind, werden sie aus unerfindlichem Grund zornig.« Sie ließ ein leises, damenhaftes Schnauben hören. »Als ob man ihr daraus irgendeinen Vorwurf machen könnte.«
»Vorwurf?«, wiederholte Gregory, dem es im Augenblick ein wenig schwerfiel, ihr zu folgen.
»Sie sind nicht der erste Gentleman, der sich einbildet, er hätte sich in Hermione verliebt«, erklärte sie mit ziemlich erschöpfter Miene. »Das passiert andauernd.«
»Ich bilde mir das nicht ein …«, unterbrach er sie und hoffte, sie hätte die Betonung auf dem Wort einbilden nicht gemerkt. Lieber Himmel, was war nur mit ihm los? Normalerweise verfügte er doch über einen so lebhaften Sinn für Humor. Und über Selbstironie. Vor allem Selbstironie.
»Nein?« Sie klang angenehm überrascht. »Also, das ist erfreulich.«
»Warum«, fragte er mit schmalen Augen, »ist das erfreulich?«
»Warum stellen Sie mir so viele Fragen?«
»Tue ich doch gar nicht«, protestierte er, obwohl er genau das tat.
Sie seufzte, und dann verblüffte sie ihn, indem sie sagte: »Tut mir leid.«
»Wie bitte?«
Sie blickte auf das Eiersandwich auf ihrem Teller und dann zu ihm, eine Reihenfolge, die er nicht schmeichelhaft fand. Normalerweise kam er vor Eiersandwiches. »Ich dachte, Sie wollen über Hermione reden. Wenn ich mich getäuscht habe, möchte ich mich entschuldigen.«
Damit saß Gregory in einer schönen Zwickmühle. Er könnte einräumen, dass er sich Hals über Kopf in Miss Watson verliebt hatte, was ziemlich peinlich wäre, selbst für einen so hoffnungslosen Romantiker wie ihn. Oder er konnte alles abstreiten, was sie ihm vermutlich nicht glauben würde. Oder er konnte einen Mittelweg einschlagen und zugeben, dass ihm Miss Watson recht gut gefiel, was er normalerweise für die beste Lösung gehalten hätte. Hier jedoch wäre es eine Beleidigung für Lady Lucinda.
Schließlich hatte er Lady Lucinda zur selben Zeit kennengelernt. In sie hatte er sich jedoch nicht Hals über Kopf verliebt.
Aber dann, als hätte sie seine Gedanken gelesen (was ihn wirklich beunruhigte), winkte sie ab und sagte: »Bitte machen Sie sich keine Gedanken wegen meiner Gefühle. Ich bin es mittlerweile gewohnt. Wie gesagt – es passiert andauernd.«
Die Wunde aufgerissen! Hebt das Salz! Und hineingestreut!
»Ganz zu schweigen davon«, fuhr sie munter fort, »dass ich schon so gut wie verlobt bin.« Sie nahm einen Bissen vom Eiersandwich.
Gregory fragte sich, was das wohl für ein Mann war, der sich an dieses merkwürdige Wesen binden wollte. Leid tat ihm der Kerl nicht direkt … er war einfach nur neugierig.
Doch dann stieß Lady Lucinda hervor: »Oh!«
Sein Blick folgte dem ihren, bis zu der Stelle, an der Miss Watson bis vor Kurzem gestanden hatte.
»Wo sie wohl hingegangen ist?«, fragte Lady Lucinda.
Sofort wandte Gregory sich zur Tür, in der Hoffnung, einen letzten Blick auf sie zu erhaschen, ehe sie verschwand, aber sie war schon weg. Verdammt ärgerlich. Welchen Sinn hatte eine unvernünftige, ungezügelte Neigung, wenn man nicht sofort etwas unternehmen konnte?
Und darüber ganz vergaß, dass sie einseitig war? Lieber Himmel.
Er war sich nicht sicher, wie man es bezeichnete, wenn man mit zusammengebissenen Zähnen seufzte, selbst wenn er genau das gerade tat.
»Ah, Lady Lucinda, da sind Sie ja.«
Gregory blickte auf. Seine Schwägerin kam auf sie zu.
Peinlich berührt fiel ihm wieder ein, dass er sie vollkommen vergessen hatte. Bestimmt wäre Kate nicht beleidigt, sie war ein feiner Kerl. Dennoch bemühte Gregory sich normalerweise, bei Frauen, mit denen er nicht blutsverwandt war, bessere Manieren an den Tag zu legen.
Lady Lucinda knickste. »Lady Bridgerton.«
Kate lächelte sie warmherzig an. »Miss Watson hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie sich nicht wohlfühlt und sich bereits zurückgezogen hat.«
»Ach ja? Hat sie gesagt … ach, egal.« Lady Lucinda wedelte mit der Hand – die Art Geste, mit der man Lässigkeit vortäuschen wollte –, doch Gregory konnte um ihre Mundwinkel ein winzige Spur Unmut erkennen.
»Ein Anflug von Erkältung, glaube ich«, fügte Kate hinzu.
Lady Lucinda nickte. »Ja«, sagte sie und sah dabei gar nicht so mitfühlend aus, wie Gregory unter diesen Umständen erwartet hätte. »Was sonst.«
»Und du«, wandte Kate sich an Gregory, »hast es noch nicht mal für nötig befunden, mich zu begrüßen. Und? Gibt es etwas Neues?«
Er ergriff ihre Hände und hauchte wie zur Entschuldigung einen Kuss darauf. »Ich bin spät dran.«
»Das ist ja wohl nicht gerade überraschend.« Ihre Miene war dabei nicht verärgert, nur ein wenig entnervt. »Und wie geht es dir?«
»Gut.« Er grinste. »Wie immer.«
»Wie immer«, wiederholte sie und warf ihm einen Blick zu, der eine penible Befragung für die Zukunft verhieß. »Lady Lucinda«, fuhr Kate fort und klang dabei wesentlich weniger trocken. »Da haben Sie also den Bruder meines Gatten kennengelernt, Mr. Gregory Bridgerton?«
»In der Tat«, erwiderte Lady Lucinda. »Wir haben gerade das Essen bewundert. Die Sandwiches sind köstlich.«
»Danke«, sagte Kate und fügte hinzu. »Und hat Gregory Sie zum Tanzen aufgefordert? Bei der Musik kann ich zwar nicht für professionelle Qualität garantieren, aber unter den Gästen hat sich ein Streichquartett zusammengefunden.«
»Hat er«, antwortete Lady Lucinda. »Aber ich habe ihn von seinem Versprechen entbunden, damit er seinen Hunger stillen kann.«
»Sie müssen Brüder haben«, entgegnete Kate mit einem Lächeln.
Lady Lucinda warf Gregory einen verblüfften Blick zu. »Nur einen.«
»Ich bin vorhin zu demselben Schluss gekommen«, erklärte Gregory seiner Schwägerin.
Kate lachte. »Zwei Seelen, ein Gedanke, was?« An die junge Frau gewandt, sagte sie: »Es ist immer gut, wenn man die Männer versteht, Lady Lucinda. Man sollte nie unterschätzen, welche Rolle das Essen spielt.«
Lady Lucinda sah sie mit großen Augen an. »Um eine angenehme Stimmung zu schaffen?«
»Nun, das auch«, erklärte Kate beinahe abschätzig. »Aber vor allem sollte man nicht übersehen, wie nützlich es sein kann, wenn man seinen Willen durchsetzen möchte.«
»Sie ist doch kaum dem Schulzimmer entwachsen, Kate«, schalt Gregory.
Kate ignorierte ihn und lächelte Lady Lucinda an. »Man ist nie zu jung, sich gewisse Taktiken anzueignen.«
Lady Lucinda sah zu Kate, dann zu Gregory, und schließlich begannen ihre Augen amüsiert zu funkeln. »Jetzt verstehe ich, warum so viele zu Ihnen aufsehen, Lady Bridgerton.«
Kate lachte. »Zu freundlich, Lady Lucinda.«
»Also bitte, Kate«, unterbrach Gregory sie. An Lady Lucinda gewandt fügte er hinzu: »Wenn Sie ihr weiter solche Komplimente machen, bleibt sie die ganze Nacht hier stehen.«
»Bitte beachten Sie ihn nicht«, erwiderte Kate grinsend. »Er ist jung und dumm und weiß nicht, wovon er spricht.«
Gregory wollte schon einen Kommentar abgeben – das konnte er Kate schließlich nicht durchgehen lassen –, doch Lady Lucinda kam ihm zuvor.
»Ich würde Sie sehr gern den Rest des Abends in den Himmel loben, Lady Bridgerton, aber ich glaube, es wird Zeit für mich, mich zurückzuziehen. Ich würde gern noch nach Hermione sehen. Ihr war schon den ganzen Tag nicht wohl, und ich möchte mich vergewissern, dass es ihr gut geht.«
»Natürlich«, meinte Kate. »Bitte richten Sie ihr von mir schöne Grüße aus, und wenn Sie etwas brauchen, klingeln Sie. Unsere Haushälterin hält sich für eine Kräuterkundige und rührt dauernd irgendwelche Tränke an. Manchmal helfen sie sogar.« Sie grinste, und ihre freundliche Miene verriet Gregory, dass Lady Lucinda ihre Billigung fand. Was einiges zu bedeuten hatte. Kate konnte Dummköpfe nicht ausstehen.
»Ich begleite Sie bis zur Tür«, sagte er rasch. Diese höfliche Geste war das Mindeste, was er für sie tun konnte, und außerdem ginge es nicht an, Miss Watsons beste Freundin zu beleidigen.
Sie verabschiedeten sich, und Gregory hängte sie bei sich ein. Schweigend gingen sie bis zur Tür in den Salon, und dort sagte er: »Kommen Sie ab hier zurecht?«
»Natürlich.« Sie blickte auf – ihre Augen waren bläulich, bemerkte er beinahe abwesend – und fragte: »Möchten Sie, dass ich Hermione eine Botschaft übermittle?«
Überrascht öffnete er den Mund. »Warum sollten Sie das tun?«, fragte er, ehe er es sich noch anders überlegen konnte.
Sie zuckte nur mit den Schultern. »Weil Sie das geringere von zwei Übeln sind, Mr. Bridgerton.«
Er hätte sie furchtbar gern gebeten, diese Bemerkung näher zu erläutern, doch nach so kurzer Bekanntschaft konnte er schlecht nachfragen, daher bemühte er sich, eine gleichmütige Miene aufzusetzen, und sagte nur: »Richten Sie ihr schöne Grüße aus, das ist alles.«
»Wirklich?«
Verdammt, dieser Blick war wirklich enervierend. »Wirklich.«
Sie neigte flüchtig den Knopf und ging davon.
Eine Weile starrte Gregory auf die Tür, durch die sie verschwunden war, und wandte sich dann wieder der Feier zu. Inzwischen tummelten sich eine ganze Menge Gäste auf der Tanzfläche, die Luft war erfüllt von ihrem Gelächter, und doch fühlte sich der Abend öd und leblos an.
Etwas zu essen, entschied er. Er würde noch zwanzig von diesen kleinen Sandwiches essen, und dann würde er sich ebenfalls zurückziehen.
Am nächsten Morgen würde sich alles wieder klären.
Lucy wusste, dass Hermione keine Kopf- oder sonstigen Schmerzen hatte, und war daher nicht überrascht, als sie sie auf dem Bett sitzend antraf, in die Lektüre eines Briefes von vier Seiten vertieft.
Extrem eng beschriebenen vier Seiten.
»Den hat mir ein Lakai gebracht«, sagte Hermione, ohne aufzusehen. »Er hat gesagt, er sei heute mit der Post gekommen, man hätte nur vergessen, ihn mir zu bringen.«
Lucy seufzte. »Von Mr. Edmonds, nehme ich an?«
Hermione nickte.
Lucy durchquerte das Zimmer, das sie und Hermione im Augenblick teilten, und setzte sich vor die Frisierkommode. Dies war nicht das erste Schreiben, das Hermione von Mr. Edmonds erhielt, und Lucy wusste aus Erfahrung, dass ihre Freundin den Brief zuerst zweimal lesen und dann noch einmal genau studieren und zum Abschluss noch einmal lesen müsste, und sei es auch nur, um Begrüßung und Abschiedsfloskel auf geheime Bedeutungen abzuklopfen.
Was bedeutete, dass Lucy die nächsten fünf Minuten nichts anderes zu tun blieb, als ihre Fingernägel zu betrachten.
Was sie auch tat. Nicht weil sie ihre Fingernägel so schrecklich interessant fand, auch nicht, weil sie ein besonders geduldiger Mensch war, sondern weil sie wusste, wann eine Sache aussichtslos war – es hatte keinen Sinn, Energie aufzubringen und Hermione in ein Gespräch zu verwickeln, wenn diese so offenkundig desinteressiert war.
Allerdings konnte man sich nicht ewig mit den Fingernägeln befassen, vor allem wenn sie so peinlich sauber und gepflegt waren wie ihre, daher stand Lucy auf, schlenderte zum Schrank und begutachtete abwesend ihre Besitztümer.
»Ach, verflixt«, brummte sie. »Ich kann es nicht ausstehen, wenn sie das macht.« Ihre Zofe hatte ein Paar Schuhe verkehrt herum hingestellt, den rechten Schuh auf den Platz des linken und umgekehrt, und auch wenn Lucy wusste, dass daran nichts weltbewegend Falsches war, beleidigte es doch irgendeinen merkwürdigen (und extrem ordentlichen) Teil von ihr, daher stellte sie die Slipper richtig herum hin und begutachtete ihr Werk ausgiebig. Schließlich drehte sie sich wieder um. »Bist du jetzt fertig?«
»Beinahe«, erklärte Hermione, und es klang, als hätte sie das Wort die ganze Zeit auf den Lippen getragen, wie um es parat zu haben, um Lucy abzuwimmeln.
Mit einem leisen Schnauben setzte Lucy sich wieder hin. Szenen wie diese hatten sie schon unzählige Male durchgespielt. Zumindest aber viermal.
Ja, Lucy wusste genau, wie viele Briefe Hermione von dem romantischen Mr. Edmonds erhalten hatte. Lieber wäre ihr gewesen, wenn sie es nicht gewusst hätte. Tatsächlich ärgerte es sie sogar, dass die Sache wertvollen Raum in ihrem Kopf beanspruchte, den sie mit Besserem hätte belegen können, zum Beispiel Botanik oder Musik oder, lieber Himmel, sogar noch einer Seite des Adelsverzeichnisses, doch Mr. Edmonds’ Briefe waren ein Ereignis, und wenn Hermione ein Ereignis durchlebte, war Lucy gezwungen, es mitzuerleben.
Auf Miss Moss’ Institut für Höhere Töchter hatten sie drei Jahre lang in einem Zimmer gewohnt, und da Lucy keine nahe weibliche Verwandte besaß, die ihr bei der Einführung in die Gesellschaft behilflich sein konnte, hatte Hermiones Mutter sich bereit erklärt, sie unter ihre Fittiche zu nehmen, und so waren sie immer noch zusammen.
Was wunderbar war, abgesehen vom stets (zumindest im Geiste) präsenten Mr. Edmonds. Lucy hatte ihn bisher nur einmal gesehen, aber es fühlte sich tatsächlich so an, als wäre er ihr ständiger Begleiter. Dauernd brachte er Hermione dazu, in merkwürdigen Momenten zu seufzen oder sehnsüchtig in die Ferne zu starren, als lernte sie gerade ein Liebesgedicht auswendig, das sie in ihren nächsten Brief aufzunehmen gedachte.
»Dir ist doch bewusst«, sagte Lucy, obwohl Hermione noch kein Zeichen gegeben hatte, dass sie mit ihrem Brief fertig war, »dass dir deine Eltern niemals erlauben werden, ihn zu heiraten.«
Dieser Satz genügte, um Hermione aufsehen zu lassen, wenn auch nur sehr kurz. »Ja«, entgegnete sie irritiert. »Du hast es bereits erwähnt.«
»Er ist Sekretär.«
»Dessen bin ich mir bewusst.«
»Ein Sekretär«, wiederholte Lucy, obwohl sie diese Unterhaltung schon oft geführt hatten. »Der Sekretär deines Vaters.«
In dem Versuch, Lucy zu ignorieren, hatte Hermione den Brief wieder aufgenommen, doch schließlich gab sie es auf und legte ihn endgültig hin.
»Mr. Edmonds ist ein guter, ehrenhafter Mann«, erklärte Hermione mit verkniffenen Lippen.
»Sicher«, erwiderte Lucy. »Aber heiraten kannst du ihn trotzdem nicht. Dein Vater ist ein Viscount. Glaubst du wirklich, er erlaubt seiner einzigen Tochter, einen bettelarmen Sekretär zu heiraten?«
»Mein Vater liebt mich«, murmelte Hermione, doch ihre Stimme strotzte nicht direkt vor Überzeugung.
»Ich will dich ja nicht davon abbringen, aus Liebe zu heiraten«, begann Lucy, »aber …«
»Doch, genau das tust du«, unterbrach Hermione sie.
»Nein, gar nicht. Ich kann nur nicht recht einsehen, wieso du nicht versuchst, dich in jemanden zu verlieben, den deine Eltern billigen.«
Hermione schüttelte den Kopf. »Du verstehst das nicht.«
»Was gibt es da groß zu verstehen? Meinst du nicht auch, dein Leben wäre einfacher, wenn du dich in jemand Passendes verlieben könntest?«
»Lucy, wir suchen uns nicht aus, in wen wir uns verlieben.«
Ihre Freundin verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich wüsste nicht, warum nicht.«
Hermione blieb der Mund offen stehen. »Lucy Abernathy, du verstehst überhaupt nichts.«
»Ja«, erwiderte Lucy trocken. »Das sagtest du bereits.«
»Wie kannst du nur glauben, man könnte sich aussuchen, in wen man sich verliebt?«, rief Hermione leidenschaftlich aus, allerdings nicht so leidenschaftlich, dass sie gezwungen gewesen wäre, sich vom Bett zu erheben. »Man sucht sich das nicht aus. Es passiert einfach. In einem winzigen Augenblick.«
»Also das glaube ich wirklich nicht«, erwiderte Lucy, und weil sie nicht widerstehen konnte, fügte sie hinzu: »Nicht mal einen winzigen Augenblick.«
»Aber es stimmt«, beharrte Hermione. »Ich weiß es, weil mir genau das passiert ist. Ich hatte es nicht darauf angelegt, mich zu verlieben.«
»Nein?«
»Nein.« Wütend starrte Hermione sie an. »Hatte ich nicht. Ich war ganz darauf eingestellt, in London nach einem Ehemann zu suchen. Wirklich, wer hätte denn damit rechnen können, dass ich in Fenchley jemanden finde?«
Eine solche Verachtung konnte man nur bei einem geborenen Fenchleyaner finden.
Lucy rollte mit den Augen. Den Kopf schräg gelegt, wartete sie darauf, dass Hermione endlich auf den Punkt kam.
Hermione gefiel das gar nicht. »Sieh mich nicht so an«, erklärte sie schnippisch.
»Wie denn?«
»Na, so eben.«
»Noch mal: Wie denn?«
Hermiones Miene wurde verkniffen. »Du weißt genau, was ich meine.«
Lucy schlug die Hand vor den Mund. »Ach herrje«, stieß sie hervor. »Eben hast du genau wie deine Mutter ausgesehen.«
Beleidigt richtete Hermione sich auf. »Das war jetzt wirklich gemein von dir.«
»Deine Mutter ist doch wundervoll!«
»Nicht, wenn sie das Gesicht so zusammenkneift.«
»Deine Mutter ist sogar mit verkniffenem Gesicht wunderbar«, erklärte Lucy, um das Thema abzuschließen. »Also, erzählst du mir jetzt von Mr. Edmonds oder nicht?«
»Hast du vor, dich über mich lustig zu machen?«
»Natürlich nicht.«
Hermione hob die Brauen.
»Hermione, ich verspreche, dass ich mich nicht lustig mache.«
Ihre Freundin sah immer noch ein wenig zweifelnd drein, sagte dann jedoch: »Also schön. Aber wenn du …«
»Hermione!«
»Wie gesagt«, fuhr sie fort und warf Lucy einen warnenden Blick zu, »ich habe nicht damit gerechnet, mich zu verlieben. Ich wusste nicht einmal, dass Vater einen neuen Sekretär eingestellt hatte. Ich war im Garten, um die Rosen für den Esstisch auszusuchen, und dann … sah ich ihn.«
Das wurde mit einem Pathos geäußert, das einer Bühne alle Ehre gemacht hätte.
»Oh, Hermione«, seufzte Lucy.
»Du hast versprochen, dich nicht lustig zu machen«, fuhr Hermione auf und deutete anklagend auf Lucy, was diese dann doch bewog, still zu sein.
»Sein Gesicht habe ich erst gar nicht gesehen«, fuhr Hermione fort, »nur seinen Hinterkopf und wie sich sein Haar über dem Kragen gekringelt hat.« Nun seufzte sie selbst. Und nicht nur das: Sie wandte sich Lucy seufzend und mit höchst dramatischem Ausdruck zu. »Und die Farbe. Wirklich, Lucy, hast du je ein so unglaubliches Blond gesehen?«
Wenn sie daran dachte, wie oft sie schon gezwungen war, sich seitens der Gentlemen ganz ähnliche Bemerkungen über Hermiones Haar anzuhören, fand Lucy, es spräche sehr für sie, dass sie sich jeden Kommentar verkniff.
Aber Hermione war noch nicht fertig. Noch lange nicht. »Dann drehte er sich um, und ich sah sein Profil. Ich schwöre dir, ich habe dabei Musik gehört.«
Lucy hätte ihre Freundin gern darauf hingewiesen, dass das Musikzimmer direkt auf den Rosengarten hinausging, doch sie hielt den Mund.
»Und dann drehte er sich um«, wiederholte Hermione verträumt, und in ihre Augen trat wieder der Liebesgedichtausdruck. »Und ich konnte nur noch denken: Jetzt istes um mich geschehen.«
Lucy winkte ab. »Unsinn. So schnell stirbt man nicht.«
»Du weißt genau, wie ich das meine«, erwiderte Hermione empört. »Ich wusste einfach, dass vor mir die große Liebe steht. Für mich wird es nie einen anderen Mann geben!«
»Und all das hast du an seinem Nacken erkannt?«
Hermione warf ihr einen wütenden Blick zu. »Und an seinem Profil, doch das ist nicht der Punkt.«
Geduldig wartete Lucy darauf, dass ihre Freundin auf den Punkt kam, selbst wenn sie sich ziemlich sicher war, dass sie damit nicht viel würde anfangen können.
»Der Punkt ist der«, sagte Hermione so leise, dass Lucy sich vorbeugen musste, um sie zu hören, »ohne ihn kann ich nicht glücklich sein. Das ist einfach unmöglich.«
»Nun«, begann Lucy, weil sie sich nicht ganz sicher war, wie sie dem noch etwas hinzufügen sollte, »im Moment wirkst du auf mich durchaus glücklich.«
»Aber nur, weil ich weiß, dass er auf mich wartet. Und …«, Hermione hielt den Brief hoch, »… er schreibt, dass er mich liebt.«
»Ach herrje«, sagte Lucy leise zu sich.
Anscheinend hatte ihre Freundin sie dennoch gehört, weil sie die Lippen zusammenpresste, doch sie sagte nichts. Schweigend saßen die beiden da, eine volle Minute, und dann räusperte Lucy sich und sagte: »Dieser nette Mr. Bridgerton scheint sehr angetan von dir.«
Hermione zuckte mit den Schultern.
»Auch wenn er ein jüngerer Sohn ist, ist er, glaube ich, durchaus vermögend. Und er kommt aus einer sehr guten Familie.«
»Lucy, ich habe dir doch gesagt, dass ich kein Interesse habe.«
»Also, er ist aber sehr attraktiv«, insistierte Lucy, vielleicht etwas nachdrücklicher als beabsichtigt.
»Dann angel du ihn dir doch.«
Schockiert starrte Lucy sie an. »Du weißt, dass das nicht geht. Ich bin mit Lord Haselby so gut wie verlobt.«
»So gut wie«, erinnerte Hermione sie.
»Inzwischen könnte es sogar schon offiziell sein«, meinte Lucy. Und das war durchaus richtig. Ihr Onkel hatte die Angelegenheit schon vor Jahren mit dem Earl of Davenport, Viscount Haselbys Vater, besprochen. Haselby war an die zehn Jahre älter als Lucy, und sie alle warteten schlicht ab, bis sie erwachsen war.
Was sie inzwischen wohl war. Die Hochzeit lag sicher in nicht allzu weiter Ferne.
Es war eine gute Partie, und Haselby war ein angenehmer Kerl. Er redete mit ihr nicht, als hielte er sie für eine Idiotin, er war anscheinend gut zu Tieren, und er sah ganz nett aus, auch wenn sein Haar allmählich dünner wurde. Zwar war Lucy ihrem zukünftigen Gatten bisher erst dreimal begegnet, aber schließlich war ja bekannt, dass man sich auf den ersten Eindruck meist verlassen konnte.
Außerdem war ihr Onkel seit dem Tod ihres Vaters vor zehn Jahren ihr Vormund, und auch wenn er sie und ihren Bruder mit Liebe und Zuneigung nicht gerade überschüttet hatte, war er doch seinen Pflichten nachgekommen und hatte sie gut versorgt. Lucy wusste, dass sie sich nun seinen Wünschen fügen und die Ehe schließen musste, die er für sie arrangiert hatte.
So gut wie arrangiert.
Wirklich, es machte keinen großen Unterschied. Sie würde Haselby heiraten, Punktum! Jeder wusste das.
»Ich glaube, du benutzt ihn als Ausrede«, meinte Hermione.
Lucy richtete sich auf. »Wie bitte?«
»Du benutzt Haselby als Ausrede«, wiederholte Hermione. Ihre Miene nahm einen erhabenen Ausdruck an, der Lucy kein bisschen behagte. »Damit verhinderst du, dass du dein Herz einem anderen schenkst.«
»Und an wen genau hätte ich mein Herz wohl verschenken sollen?«, erkundigte sich Lucy. »Die Saison hat ja noch nicht einmal begonnen.«





























