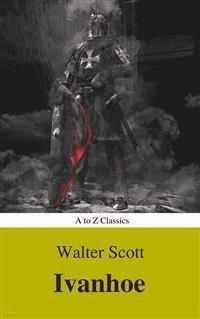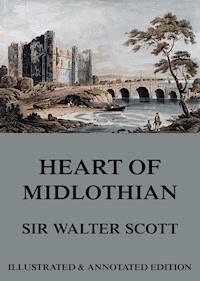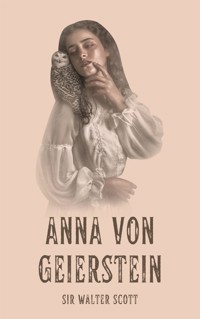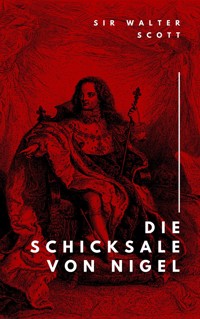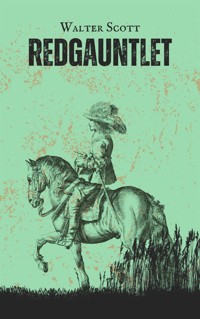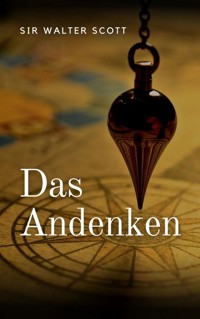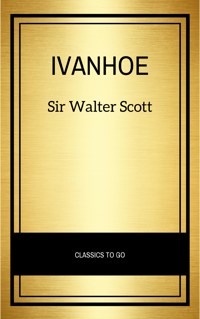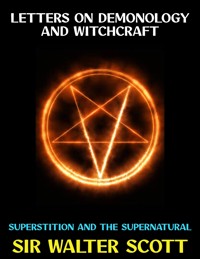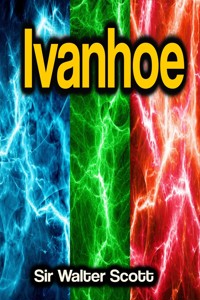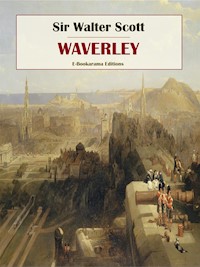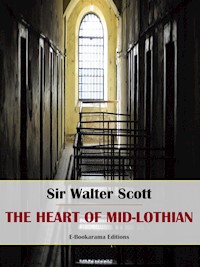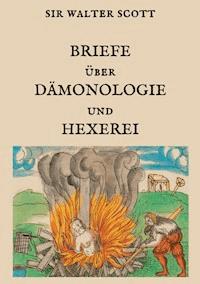
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Bibliothek der Geheimwissenschaften und Mysterien
- Sprache: Deutsch
Sir Walter Scott (1771-1832), der "Vater des Historischen Romans", Verfasser von Klassikern wie Ivanhoe, Rob Roy, Waverley, Quentin Durward und Kenilworth, schrieb als eines seiner letzten Werke die "Briefe über Dämonologie und Hexerei" an seinen Schwiegersohn, J. G. Lockhart. Nachdem das Buch 1830 erstmalig erschien, fand es seinerzeit große Zustimmung und freundliche Kritiken in der Öffentlichkeit. In den im Buch enthaltenen zehn Briefen behandelt Scott den seinerzeit noch lebendigen Glauben an Hexen, Geister und Feen auf den Britischen Inseln und zieht hierbei auch Beispiele und Erklärungsversuche aus älteren Zeiten heran. Sehr umfangreich behandelt er die großen Hexenprozesse in England, Schottland und Salem, in den amerikanischen Kolonien im 16. und 17. Jahrhundert. Auch unterlässt er es nicht, die unterschiedlichen Anschauungen über Hexen und ihre vermeintlichen Machenschaften in England und Schottland zu untersuchen, so dass er scharf zwischen dem Aberglauben der einfachen Bevölkerung und den wirklichen Verbrechen, wie. z. B. Mord durch Giftmischerei, der jedoch in den Bereich der Rechtsprechung wider Hexerei fiel, unterscheidet. Abgerundet wird das Werk durch eingestreute, eigene Erlebnisse des Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliothek der Geheimwissenschaften und Mysterien
Band 1
Inhalt.
Erster Brief.
Zweiter Brief.
Dritter Brief.
Vierter Brief.
Fünfter Brief.
Sechster Brief.
Siebenter Brief.
Achter Brief.
Neunter Brief.
Zehnter Brief.
Erster Brief.
Ursprung der allgemeinen Meinungen unter den Menschen rücksichtlich der Dämonologie – Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele leitet hauptsächlich dazu hin, das Wiedererscheinen abgeschiedener Geister zu bekräftigen – Philosophische Einwürfe gegen die Erscheinung eines abstrakten Geistes finden bei dem gemeinen Mann und bei unwissenden wenigen Eingang – Zustände aufgeregter Leidenschaft sind der Menschheit eigentümlich und regen sie an, übernatürliche Erscheinungen zu wünschen oder zu mutmaßen – Solche Erscheinungen werden oft im Zustand des Schlafes erzeugt – Geschichte, den Somnambulismus berührend – Der Einfluß der Leichtgläubigkeit ist ansteckend, so daß einzelne Menschen den Aussagen Anderer mehr Glauben beimessen, als ihren eigenen Sinnen – Beispiele aus der „Historia verdadera“ des Don Bernal Diaz del Castillo, und aus den Werken von Patrick Walker – Der scheinbare Beweis von einem Verkehr mit der übernatürlichen Welt ist bisweilen einem zerrütteten Zustand der körperlichen Sinneswerkzeuge zuzuschreiben – Unterschied zwischen dieser Krankheit und dem Wahnsinn, in welchem die Organe des Körpers ihre gehörige Tätigkeit beibehalten, während die der Seele verloren ging – Sinnesempörung eines Wahnsinnigen gegen den Ideengang seiner Einbildungen – Erzählung über eine entgegengesetzte Natur, in welcher das Zeugnis der Augen die Überzeugung des Verstandes überwältigte – Beispiel an einem Londoner Lebemann – Nicolai, der deutsche Buchhändler und Philosoph – Ein Kranker des Dr. Gregory – Beispiel an einem berühmten schottischen Staatsmann – Andere Beispiele über diese Krankheit, die aber plötzlichen Übergang hatte, oder nur von kurzer Dauer war – Erscheinung des Hrn. Maupertuis und eines jüngst verstorbenen berühmten Dichters – Die mitgeteilten Fälle erzeugten sich vorzüglich durch falsche Eindrücke der Sehorgane – Untersuchungen des Tastsinns, besonders im Schlaf wahrnehmbar Täuschungen des Geschmackes und des Geruches – Rückblick. SIE haben, teurer Freund, von mir verlangt, daß ich Familienbibliotheken mit der Geschichte eines dunklen Kapitels der menschlichen Natur versehen möge, welches durch die zunehmende Zivilisation aller wohlunterrichteten Länder jetzt fast gänzlich ausgelöscht worden ist, obwohl in älteren Zeiten der Gegenstand keinen geringen Grad von Aufmerksamkeit rege machte.
Es ist außer Zweifel, daß bei meinem vielen Lesen zur Zeit meiner Jugend ich lange in den Zwielichtregionen abergläubischer Nachforschungen umherwanderte. Viele Stunden habe ich dadurch verloren – „Wär doch geringer diese Schuld!“ – daß ich sowohl ältere wie neuere dahin gehörende Schriften durcharbeitete, ja sogar in Kriminalakten aus früherer Zeit umherstöberte, die einen Gegenstand berührten, den unsere Vorfahren mit der größten Wichtigkeit behandelten. Und die in jüngeren Tagen von Hrn. Pitcairn edierten Auszüge aus den schottischen Gerichtsprotokollen sind, außer ihrem historischen Werte betrachtet, von einer Beschaffenheit, die so sehr geeignet ist, die Leichtgläubigkeit unserer Vorfahren in Betreff von Gegenständen solcher Art zu belobpreisen, daß ich durch Überlesung jener Auszüge allerdings angeleitet ward, mich dessen wieder zu erinnern, was ich zu früherer Zeit über Dämonologie und Hexerei gelesen und gedacht habe.
Da meine Ausbeute jedoch nur miszellenartig bleibt und ich keineswegs Anspruch mache, weder die Systeme derer zu bestreiten, die vor mir über diesen Gegenstand schrieben, noch selbst ein neues System über denselben auszustellen, so geht mein Plan nur dahin, nach einer allgemeinen Abhandlung über Dämonologie und Hexerei, mich auf Erzählungen von merkwürdigen Vorfällen und dann auf diejenigen Bemerkungen zu beschränken, welche sich natürlich und ungezwungen aus denselben ergaben, indem ich das Vertrauen hege, daß solcher Plan heut zu Tage mehr für die Blätter eines Volksbuches sich eignet, als ein Versuch, den Inhalt vieler hundert Folianten und Duodezbändchen in einem Auszuge zu geben, der bei aller Kürzung dennoch des Lesers Geduld ermüden würde.
Einige allgemeine Bemerkungen über die Natur der Dämonologie und über die ursprüngliche Ursache des fast männiglich angenommenen Glaubens an eine Verbindung zwischen den sterblichen Menschen und Wesen von höherer Art, als sie selbst sind, und deren Beschaffenheit nicht durch menschliche Sinne erforscht werden kann, bieten sich als eine dem Gegenstande notwendige Einleitung dar.
Der allgemeine, oder, wie man wohl sagen mag, der universelle Glaube der Erdbewohner an das Dasein von geistigen Wesen, welche ledig der Last und der Unvollkommenheiten des Körpers sind, gründet sich auf das Bewußtsein der Göttlichkeit, die in unserem Busen spricht, und lehrt allen Menschen, ausgenommen den wenigen, die sich gegen diesen Himmelsruf im Menschen verstricken, daß in uns ein Teil jenes göttlichen Wesens lebt, welches dem Gesetze des Sterbens und Vermoderns keineswegs unterworfen, sondern welches, wann der Leib nicht länger für seine Rechnung hienieden geeignet ist, sich gleich einer von ihrem Posten abgelösten Schildwache einen besonderen Aufenthaltsort zu suchen hat. Ohne die Mithilfe der Offenbarung läßt sich nicht hoffen, daß bloße irdische Vernunft im Stande sein könnte, irgendeine verständige oder haltbare Mutmaßung hinsichtlich der Bestimmung unserer Seele aufzustellen, sobald diese von dem menschlichen Leibe getrennt sein wird; jedoch die Überzeugung, daß solch ein unvernichtbares Wesen, wie unsere Seele, vorhanden ist, und der in einem verschiedenen Sinne von dem Poeten ausgesprochene Glaube: „Non omnis moriar“, müssen das Dasein von Millionen Geistern einräumen, welche nicht vernichtet worden sind, obwohl sie den Sterblichen, die nur durch die unvollkommenen Werkzeuge der menschlichen Sinne sehen, hören und gewahren, miteinander unsichtbar wurden. Diejenigen, die am tiefsten nachdenken, mögen durch Wahrscheinlichkeit sich angeregt fühlen, einen künftigen Zustand der Belohnung und Bestrafung vorauszusetzen; etwa wie diejenigen, die sich der Erziehung von Taubstummen widmeten, wahrnehmen, daß ihre Zöglinge, selbst bei Entbehrung aller herkömmlichen Lehrmittel und alles gewöhnlichen Unterrichtes, im Stande sind, aus ihren eigenen ununterstützten Vermutungen sich Begriffe von dem Dasein einer Gottheit und von der Verschiedenheit zwischen der Seele und dem Körper zu bilden – ein Umstand, welcher dartut, wie natürlich diese Wahrheiten sich in der menschlichen Seele vernehmbar machen. Der Grundsatz nun, daß diese Wahrheiten sich sowohl durch sich selbst wie durch Anregung in der Seele festsetzen, leitet zu ferneren Folgerungen und Schlüssen.
Jene abgeschiedenen Geister, deren Dasein also nicht wohl geleugnet werden mag, sind, wie recht wohl anzunehmen steht, keineswegs gleichgültig gegen die Angelegenheiten der Sterblichen; ja sie sind vielleicht nicht unfähig, Einfluß auf dieselben in Anwendung zu bringen. Freilich ist es wahr, daß, bei vorgerückterer Bildung der menschlichen Gesellschaft, der Philosoph die Möglichkeit des Wiedererscheinens eines körperlosen Geistes bestreiten mag, sobald dies nicht durch ein Wunder geschehen soll, welches allerdings als Aufhebung der Naturgesetze, unmittelbar von dem Urheber solcher Gesetze zu irgendeinem bestimmten Zwecke bewirkt, durch keinen Zwang, oder durch kein Hindernis aufgehalten werden kann, und unter dieser notwendigen Einschränkung und Ausnahme mögen die Philosophen ziemlich einsichtlich folgern, daß, wenn die Seele von ihrem Körper geschieden ist, sie alle jene Eigenschaften verliert, durch welche sie, bekleidet mit der menschlichen Gestalt, den Organen ihrer Mitmenschen erkennbar wird; denn der abstrakte Begriff von einem Geiste setzt allerdings voraus, daß derselbe weder Substanz, noch Form, noch Gestalt, noch Stimme, oder sonst irgendetwas habe, wodurch dessen Gegenwart menschlichen Sinnen wahrnehmbar werden kann; allein diese starren Zweifel der Philosophen an dem Wiedererscheinen solcher abgeschiedenen Geister erheben sich nicht eher, als bis ein gewisser Grad von Erkenntnis sich über ein Land verbreitete, und selbst dann gelangen nur wenige denkende und besser unterrichtete Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu Zweifeln solcher Art. Der Menge scheint die unzubezweifelnde Tatsache, daß so viele Millionen von Geistern uns umgeben, ja wohl mitten unter uns sind, hinreichend, um den Glauben zu unterstützen, daß dieselben, wenigstens in gewissen Fällen, durch ein oder anderes Mittel, im Stande sind, Verkehr mit der sterblichen Welt zu haben. Der bei weitem größere Teil der Menschheit kann die Idee von der Existenz abgeschiedener Geister nicht bei sich aufkommen lassen, ohne demselben die Gewalt oder das Vermögen zuzuschreiben, die Gestalt annehmen zu können, welche sie zur Zeit ihres Erdenlebens an sich trugen; und selten gehen der Menschen Untersuchungen über diesen Gegenstand weiter als bis zu dem ebengenannten Punkte.
Schwärmerische Gefühle von tiefergreifender und feierlicher Beschaffenheit werden sowohl im Familienleben wie im öffentlichen Leben regegemacht, die nicht minder darauf hindeuten, ein sichtbares Zeugnis von einem Verkehr zwischen dieser Erde und der Geisterwelt abgeben zu wollen. So fühlt z. B. der Sohn, der jüngst seines Vaters durch den Tod beraubt ward, plötzlich eine Krisis sich nähern, in welcher er sehnsüchtiges Verlangen trägt, zu weisem väterlichen Rate seine Zuflucht zu nehmen; so verlangt dem verwitweten Gatten nach dem Wiedererblicken jener Gestalt, die er zur Lebensgefährtin einst zu sich gesellte und die das Grab ihm entriß; oder – um eines düstereren, jedoch nicht minder allgemeinen Beispiels zu gedenken: so wird der unglückliche Sterbliche, der seine Hand in das Blut seines Mitbruders tauchte, durch die Vorstellung geängstigt, daß das Phantom des Erschlagenen neben dem Bette seines Mörders stehe. Wer will bei allen oder bei einzelnen dieser Fälle es bezweifeln, daß die menschliche Einbildungskraft, durch Umstände begünstigt, das Vermögen besitzt, den Organen des Gesichtes Gespenster hervorzurufen, welche nur in der Seele derer existieren, welche wähnen, Augenzeugen solcher Erscheinungen zu sein?
Fügen wir hinzu, daß solche Vision im Verlauf eines jener lebhaften Träume stattfinden kann, in denen der Träumer – (ausgenommen in Hinsicht auf den einzigen Gegenstand eines einzigen starken Eindrucks) – der Einzelheiten der Szene, die ihn umgibt, – sich bewußt ist oder sich derselben bewußt zu sein scheint: Ein Zustand, der oft eintritt. Wenn er z. B. sich insofern seiner bewußt ist, daß er weiß, er liegt auf seinem Bette und ist umgeben von seinem Zimmergerät zur Zeit wo die mutmaßliche Erscheinung ihm sichtbar ist, so wird es beinahe unmöglich, dem Träumer die Wirklichkeit seiner Vision zu bestreiten, da das Gespenst, obgleich dasselbe bloß ein eingebildetes Wesen ist, sich inmitten derjenigen Gegenstände befindet, welche, wie er fühlt, außer dem Bereich jedes Zweifels an deren Existenz sein müssen. Dasjenige, was unleugbar gewiß ist, wird gleichsam Bürge für die Wirklichkeit der Erscheinung, an welcher man ohne jenes Gewisse hätte zweifeln mögen. Und wenn nun irgendeine Begebenheit, etwa der Tod der in der Vision erblickten Person, zufällig stattfindet und sich dabei ein Zusammenhang mit der Beschaffenheit und dem Zeitpunkte der Erscheinung wahrnehmen läßt, so erscheint das Zusammentreffen, welches eben, weil unsere Träume sich gewöhnlich auf Gegenstände beziehen, mit denen wir uns im wachen Zustande beschäftigten, vollkommen; und die Kette von Umständen, die den Erweis dabei führen, mag nicht auf unverständige Weise als vollständig angesehen werden. Und eine solche Verkettung, wir wiederholen es, mag häufig vorkommen, vollends wenn man erwägt, aus welchem Stoffe die Träume gewoben sind – wie dieselben so ganz natürlich sich aus Gedanken entspinnen, die wir in wachem Zustande hegten, oder denen wir auswichen; wie bereitwillig unsere schlafende Imagination sich zu dem Gegenstande zurückwendet, den wir wachend nicht durchdenken mochten, etwa wenn ein Krieger den Gefahren des Kampfes preisgegeben, ein Schiffer den Stürmen des Meeres überantwortet, eine geliebte Gattin oder ein teurer Verwandter von schwerer Krankheit ergriffen ist. Die Menge von Beispielen solcher lebhaften Träume, in denen geistige Mitteilungen als erkennbar wahrgenommen und behauptet wurden, ist zu allen Zeiten sehr groß gewesen; in Zeiten der Unwissenheit aber, in denen man die natürlichen Ursachen der Träume gänzlich mißverstand und mit einer Idee von Mystizismus verwebte, war sie noch bei weitem größer. Bedenkt man freilich, wie viele Tausende von Träumen Nacht nach Nacht der Imagination der Individuen vorschweben, so mag allerdings das Zusammentreffen zwischen Vision und wirklicher Begebenheit seltener und weniger bemerkenswert erscheinen, als eine getreue Auszählung von Vorfällen es uns erwarten lassen dürfte. Jedoch in Ländern, wo solche weissagende Träume Gegenstand der Aufmerksamkeit ist die Zahl derer, die mit Visionen verbunden sind, sind, groß genug, um einen ziemlich allgemeinen Glauben an einen unbestreitbaren Verkehr zwischen den Lebendigen und Toten zu verbreiten.
Somnambulismus und andere nächtliche Trugbilder leihen häufig ihren Beistand zu Bildung solcher Phantasmen her, wie sie aus dem mittleren Zustande zwischen Schlafen und Wachen erzeugt zu werden pflegen. Ein höchst achtbarer Mann, dessen tätiges Leben in Führung und Befehligung eines großen Handelsschiffes, das auf Lissabon fuhr, verfloß, überlieferte mir die Erzählung einer unter seinen Augen vorgegangenen, hierher gehörenden Begebenheit. Sein Schiff lag in Tejo vor Anker, als er durch nachfolgenden Vorfall und dessen Folgen in nicht geringe Besorgnis und Unruhe sich versetzt fühlte. Einer seiner Matrosen ward durch einen portugiesischen Meuchler ermordet, und sofort erhob sich das Gerücht, der Geist des Erschlagenen ginge um auf dem Schiffe. Seeleute sind in der Regel abergläubisch, und die Mannschaft meines Gewährsmannes wollte nicht länger am Bord bleiben, so daß zu erwarten stand, sie würde eher das Weite suchen, als auf einem Schiffe, auf welchem ein Gespenst als Passagier mitfuhr, nach England zurückzukehren. Um diesem Unheil vorzubeugen, beschloß der Kapitän, die Sache auf das genaueste zu untersuchen. Er erkannte bald, daß, obgleich alle seine Leute behaupteten, Lichter gesehen, Geräusche gehört zu haben usw. die ganze Beweiskraft der Sache doch nur auf seinem Untersteuermann beruhte, der als Irländer und Katholik wohl besonderen Hang zum Aberglauben haben mochte, jedoch sonst ein ehrlicher und wahrheitsliebender, wiewohl höchst reizbarer Mann war, von dem sich durchaus nicht voraussetzen ließ, daß er seinen Kapitän zu betrügen gedächte. Seine Aussage gegen diesen ging unter den dringendsten Bitten, Mitleiden mit ihm zu haben, dahin, daß das Gespenst des Ermordeten ihn fast allnächtlich von seiner Schlafstelle wegführe und ihm, wie er sich ausdrückte, das Leben ausmergele. Die Art seiner Mitteilung zeigte deutlich, daß der Mann wirklich krank und eben dadurch in diesen schrecklichen Wahn verfallen war. Der Kapitän widersprach vor der Hand nicht, beschloß aber bei sich selbst, während der Nacht, ob mit oder ohne Zeugen, weiß ich nicht mehr, die Bewegungen des Geistersehers zu beobachten. Als nun die Schiffsglocke Mitternacht anschlug, fuhr der Schläfer mit bangem und verstörtem Angesichte auf, zündete ein Licht an und schritt der Schiffsküche zu. Dort setzte er sich nieder und starrte mit weit geöffneten Augen vor sich hin, als betrachtete er mit Schrecken einen Gegenstand, von welchem er die Blicke nicht wegzuwenden vermochte. Nach einem Weilchen stand er auf, ergriff ein zinnernes Gefäß, füllte es mit Wasser, mischte darein etwas Salz, und sprengte es, indem er für sich murmelte, in dem Verschlage umher. Dann seufzte er tief auf, gleich einem Menschen, der sich eine schwere Last abgenommen fühlt, kehrte zu seinem Lager zurück und schlief fest. Am folgenden Morgen erzählte dieser Nachtwandler genau was ihm begegnet war, jedoch mit dem Zusatze, daß, nachdem er vom Gespenste in den Küchenraum geführt worden sei, er daselbst zu seinem Glücke, obwohl er nicht wisse wie es zugegangen, etwas Weihwasser vorgefunden hätte, durch Hilfe dessen er in den Stand gesetzt worden wäre, sich den unwillkommenen Besucher vom Halse zu schaffen. Man unterrichtete nun den Geisterseher von den wirklichen Ergebnissen in voriger Nacht, und zwar so umständlich, daß er es einsehen konnte, wie er durch seine eigene Einbildungskraft getäuscht worden war; er ging in die Vernunftgründe seines Kapitäns ein, und – wie es oft in solchen Fällen zu geschehen pflegt – der Traum kehrte nach dieser Enttäuschung niemals wieder. Dieses Beispiel zeigt uns, wie die erregte Einbildungskraft auf die halbwachen Sinne wirkte, die tätig genug waren, den Kranken merken zu lassen, wo er sich befand, jedoch nicht die Kraft besaßen , ihn in den Stand zu setzen, richtig von den Gegenständen, welche ihn umgaben, zu urteilen.
Allein nicht bloß das niedere Leben, nicht bloß jene Reihe von Gedanken, die durch düstere Ahnungen von der Zukunft in Melancholie versenkt wurden, stimmen die Seele zu mittägigen Phantasmen oder zur Wahrnehmung nächtlicher Erscheinungen. Ein Zustand ängstlicher Besorgnis oder übermäßiger Anstrengung ist ebenfalls geeignet, solchen übernatürlichen Erscheinungen Raum zu geben. Die Vorahnung einer Entscheidungsschlacht mit allem Zweifel und aller Unzuverlässigkeit ihres Ausganges und die Überzeugung, daß sie sein eigenes Schicksal und das seines Vaterlandes in sich fassen müßte, war mächtig genug, den ängstlichen Blicken des Brutus das Gespenst seines ermordeten Freundes Cäsar heraufzubeschwören, hinsichtlich dessen Todes er sich nunmehr wohl minder als am Idus des Märzmondes gerechtfertigt glaubte, nachdem der Erfolg jenes Mordes, statt die Freiheit Roms zu vollenden, nur eine Erneuerung des Bürgerkrieges herbeigeführt hatte und der Ausgang höchst wahrscheinlich eine gänzliche Vernichtung der Freiheit sein durfte. So ist es nicht zum Verwundern, daß der männliche Geist des Marcus Brutus, umringt von Dunkelheit und Einsamkeit, auch wahrscheinlich beunruhigt durch Erinnerung an die Huld und Güte des großen Mannes, den er getötet hatte, um das vom Vaterlande erlittene Unrecht durch Mord an seinem eigenen Freunde zu rächen, endlich seinen Blicken jene Erscheinung vorführte, die sich seinen bösen Genius nannte und ihm versprach, ihm zu Philippi wieder zu erscheinen. Des Brutus eigene Absichten, und seine Kenntnisse in der Kriegskunst mochten wahrscheinlich ihm längst begreiflich gemacht haben, daß die Entscheidung des Bürgerkrieges an jenem Orte oder in der Nähe desselben würde stattfinden müssen; und wenn man annimmt, daß seine eigene Imagination jenem Teile seines Gespräches mit dem Phantome zu Hilfe kam, so ist an der Sache sonst nichts, was nicht zu einem lebhaften Traume oder zu einer wachen Träumerei gestaltet werden könnte, indem es von absorbierendem und übertreibendem Charakter sich dem gewöhnlichen Stoffe nähert, aus welchem Träume bestehen. Daß Brutus, dem die Ansichten der Platoniker recht wohl kund waren, geneigt gewesen sein sollte, den Gedanken, daß er eine wirkliche Erscheinung sah, ohne allen Zweifel festzuhalten und schwerlich die vermeinte Vision höchst genau habe untersuchen mögen, läßt sich recht wohl annehmen, und ebenso natürlich ist die Ansicht, daß, obgleich außer ihm keiner jene Gestalt sah, dennoch seine Zeitgenossen wenig Anregung gefühlt haben mögen, die Aussage eines so bedeutenden Mannes wie Brutus, durch streng erwogene Querfragen und Beweisforderungen zu prüfen, welches sie überdies vielleicht kaum bei einer anderen geringeren Person und einer minder wichtigen Gelegenheit würden anwendbar geglaubt haben.
Sogar auf dem Gefilde des Todes und inmitten des Gewühles der Schlacht selbst hat ein unerschütterlicher Glaube das nämliche Wunder bewirkt, welches wir bisher als in der Dunkelheit und Einsamkeit stattfindend bezeichneten; und diejenigen, die selbst an der Grenze der Geisterwelt gestanden oder Hand geboten haben, andere in jene düsteren Regionen zu befördern, wähnten die Erscheinung derjenigen Wesen zu sehen, welche durch ihre nationale Mythologie mit solchen Szenen in Verbindung gesetzt wurden. In Augenblicken unentschiedener Schlacht, inmitten der Gewalt, der Hurtigkeit und Verworrenheit der Ideen, die sich aus der obwaltenden Lage der Dinge entwickelten, lebten die Alten des Glaubens, ihre Gottheiten, Castor und Pollux, im Vortrabe ihres Heeres zu dessen Aufmunterung fechten zu sehen; die heidnischen Skandinavier sahen die Schatten ihrer Erschlagenen, und die Katholiken waren nicht minder geneigt, den kriegerischen Sankt Georg oder heiligen Jacobus im Vordertreffen zu erblicken, um den Kämpfern den Weg zum Siege zu zeigen. Dergleichen Erscheinungen, die im Allgemeinen von einer Menge Menschen wahrgenommen wurden, haben zu allen Zeiten die lebhaftesten Zeugnisse von ihrer Wahrhaftigkeit für sich gehabt. Sobald gewöhnliche Furcht vor Gefahr und der erhebende Ausbruch von Schwärmerei zu gleicher Zeit auf die Gefühle mehrerer wirkt, findet zwischen deren Seelen eine natürliche Bewegung statt, ungefähr wie es mit besaiteten Instrumenten, die gleichgestimmt sind, der Fall ist, so daß, wenn man eines solcher Instrumente spielt, die übrigen im Unisono mit den hergebrachten Tönen vibrieren. Ruft in der Hitze eines Gefechts ein listiger oder schwärmender Streiter aus, er sehe eine Erscheinung von angedeuteter romantischer Art, so fassen seine Mitkämpfer diese Idee mit Lebhaftigkeit auf, und die meisten derselben zeigen sich bereitwillig, die Überzeugung ihrer eigenen Sinne eher aufzuopfern, als zuzugeben, daß sie jene heilverkündende Erscheinung, aus der alle miteinander Hoffnung und Vertrauen sich herleiten, nicht ebenfalls gewahren. Ein Krieger hascht sich die Vorstellung von einem anderen, allesamt sind in gleichem Maße eifrig bemüht, das eben vorwaltende Wunder anzuerkennen, und siehe da! Die Schlacht wird gewonnen, noch ehe der Irrtum sich enthüllt. In solchen Fällen werden viele Menschen, die sonst sich dem Truge keineswegs hingeben würden, das Mittel zur Beförderung desselben.
Von dieser Neigung, Übernatürliches ebenso zu sehen, wie andere umher es erblicken, oder mit anderen Worten: den Augen anderer mehr als den eigenen zu trauen, möchten wir zwei merkwürdige Beispiele hier mitzuteilen uns die Freiheit nehmen.
Das erste dieser Beispiele ist aus der „Historia Verdadera de Don Bernal Diaz del Castillo“ eines der Kriegsgefährten des berühmten Cortez in dessen mexikanischem Eroberungszuge. Nachdem Diaz einen Bericht von dem großen Siege über gewaltige Hindernisse abgegeben hat, erwähnt er der Mitteilung, welche in der derzeitigen Chronik von Gomara gemacht wird, nach der der heilige Jacob in der Vorhut des Heeres auf einem weißen Streitrosse sichtbar ward und seine geliebten Spanier zum Siege leitete. Es ist belustigend, des kastilianischen Ritters innere Überzeugung zu beobachten, daß das Gerücht von jener Erscheinung aus einem Mißverständnisse entsprang, dessen Ursache er aus seiner eigenen Wahrnehmung erläutert, während er zu gleicher Zeit es nicht wagt, das Wunder selbst abzuleugnen. Der ehrliche Miteroberer gesteht, daß er selber die belebende Erscheinung nicht sah, ja, daß er vielmehr einen gewissen Ritter namens Francisco de Morla erblickte, der auf einem kastanienbraunen Pferde ritt und gewaltig an eben derselben Stelle kämpfte, an welcher sich die Erscheinung des heiligen Jacob befinden sollte. Jedoch anstatt fortzufahren, um die nötige Folgerung aus seinen Wahrnehmungen zu ziehen, ruft der gottesfürchtige Kriegsmann aus: „Sünder der ich bin, wer bin ich, daß ich es wert sein könnte, den heiligen Apostel mit diesen meinen Augen zu sehen!“
Der zweite Beweis von dem ansteckenden Charakter des Aberglaubens bietet sich aus einem schottischen Buche dar, und es waltet wenig Zweifel ob, daß derselbe in seinem eigentlichen Ursprunge mit irgendeiner ungewöhnlichen Erscheinung des Nordlichts in Verbindung stehe, welches in Schottland so häufig gesehen worden zu sein scheint, daß es vor Anfang des achtzehnten Jahrhunderts als ein gewöhnliches und leicht zu unterscheidendes atmosphärisches Phänomenon erklärt worden wäre. Der Vorfall ist überraschend und seltsam, denn der Erzähler desselben, Peter Walker, war, obwohl ein Schwärmer, dennoch ein glaubwürdiger Mann und maßt es sich keineswegs an, wirklich die Wunder von denen er spricht, selbst gesehen zu haben, obgleich er die Wahrhaftigkeit derselben ohne Bedenken auf das Zeugnis anderer annimmt, deren Augen er lieber als seinen eigenen trauen wollte. Die Bekehrung des Zweiflers, von dem er spricht, verdeutlicht in nicht geringem Maße den Volksglauben, wenn dieser durch das Zeugnis mehrerer bis zum Schwärmereifer oder zur Betrügerei gesteigert ward, und zeigt zu gleicher Zeit die Unhaltbarkeit eines solchen Zeugnisses, sowie die Leichtigkeit, mit welcher dasselbe beigebracht wird, sobald die allgemeine Aufreizung des Augenblickes sogar die kaltblütigeren und einsichtsvolleren der anwesenden Personen zwingt, der größeren Masse Ideen aufzufassen und deren Ausrufungen widerhallen zu lassen, und das himmlische Phänomenon als einen übernatürlichen Wappenschild zu betrachten, der als ein Wahr- und Warnungszeichen bevorstehenden Bürgerkrieges hoch in Lüften aufgehangen ward.
Im Jahre 1686, in den Monaten Junius und Julius – erzählt der ehrsame Chronist – versammelten sich, wie noch mancher jetzt lebende Augenzeuge es bestätigen kann, zwei Meilen unterhalb Lanark an den Wassern des Clydeflusses mehrere und viele Leute zur Zeit der Nachmittagsstunden, wo denn zu sehen war, wie aus der Luft Mützen, Hüte, Schwerter und Gewehre herabschauerten und in die Bäume oder auf den Rasen fielen; dann stellten an der Wasserseite sich Geharnischte in Reihen auf, Rotten gesellten sich zu Rotten, wogten dann durcheinander, stürzten zu Boden und verschwanden, worauf sofort andere Scharen erschienen, die desselben Weges wieder unsichtbar wurden. Drei Nachmittage nacheinander ging ich ebenfalls dahin, wo ich denn wahrnahm, daß zwei Dritteile der Anwesenden solches sahen, ein Dritteil aber nichts sah und ich selbst auch nichts sehen konnte; doch war bei alledem unter den Sehenden solche Furcht und solches Zittern herrschend, daß alle diejenigen, die nichts sehen konnten, doch deutlich jene Furcht der übrigen wahrnahmen. Ein Mann, der dicht neben mir stand, ein Mann, der ebenso sprach wie viele andere sprachen, sagte: „Ein Rudel verdammter Hexen und Teufelskerle mögen hier Gespenster sehen, mich soll der Geier holen, wenn ich etwas der Art erblicke.“ Allein kaum hatte er diese Worte herausgestoßen, so ward eine auffallende Gesichtsveränderung an ihm sichtbar; und mit ebenso großer Furcht, als irgendein anwesendes Weib zeigte, rief er aus: „Alle, die ihr nichts seht, sagt kein Wort, denn ich versichere euch, es ist eine Tatsache und es kam sie jeder unterscheiden, der nicht stockblind ist.“ Und diejenigen, welche sahen, beschrieben nun die Schlösser der Gewehre und die Länge und Dicke derselben und die Griffe der Schwerter und ob diese platt oder dreischneidig oder von hochländischer Arbeit waren, und sagten aus, was für Klunker an den Mützen baumelten, ob blaue oder schwarze, und alle, welche dergleichen in der Luft erblickten, sahen, wohin sie beim Weggehen sich wenden mochten, eine Mütze und ein Schwert in den Weg fallen.1
Dies seltsame Phänomen, an welches eine Menge Menschen glaubten, obwohl nur zwei Dritteile von ihnen sahen, was, wenn es etwas Wirkliches gewesen wäre, alle hätten sehen müssen, läßt sich mit dem Scherze jenes Spaßmachers vergleichen, der eine Stellung des Erstaunens annahm und die Blicke auf den wohlbekannten ehernen Löwen heftete, der den Eingang zu Northumberland - House am Strande bewachte, indem er, als er die Aufmerksamkeit der auf ihn Hinblickenden erregt hatte, vor sich hinsprach: „Beim Himmel, er wedelt – er wedelt nochmals!“ – welches dann zur Folge hatte, daß in wenigen Minuten die Straße sich mit Menschen überfüllte, von denen einige des Glaubens lebten, wirklich gesehen zu haben, daß der Schweif des Löwen sich bewegte, während die übrigen in der Erwartung dastanden, daß das Wunder sich wiederhole.
In denjenigen Fällen, deren wir bis jetzt erwähnten, haben wir vorausgesetzt, daß der Geisterseher im vollen Besitze seines gewöhnlichen Wahrnehmungsvermögen stand, etwa die Fälle der Träumer ausgenommen, wo dasselbe durch vorübergehenden Schlummer gestört und die Möglichkeit, Verirrungen der Phantasie zu verbessern, dadurch umso mehr erschwert wird, daß es uns an dem Vermögen mangelt, Zuflucht zu den Beweistümern unserer körperlichen Sinne zu nehmen. Unter anderen Umständen jedoch floß das Blut solcher Geisterseher ruhig, sie besaßen die gewöhnliche Fähigkeit, sich bei äußeren Erscheinungen durch ihre Sehorgane von der Wahrheit zu überzeugen oder Irriges zu unterscheiden. Dennoch ist es leider jetzt allgemein bekannt und zugestanden, daß es zuverlässig mehr als eine Krankheit gibt, die, den Ärzten wohlbekannt, zum Symptome die Neigung haben, Erscheinungen zu erblicken.
Solche erschreckliche Krankheit ist nicht geradezu Wahnsinn oder Verrücktheit, obgleich sie sich einigermaßen jenem entsetzlichsten aller Übel nähert, und bei manchen Konstitutionen wohl ein Mittel werden mag, wirklichen Wahnsinn zu erzeugen, wiewohl dergleichen Täuschungen der Sinne in beiden Krankheitsfällen vorkommen. Was mich hinsichtlich des Unterschiedes bedünkt, so bin ich der Meinung, daß in Fällen der Verrücktheit die Seele des Leidenden vorzugsweise ergriffen ist, während die Sinne oder das System der Organe dem sogenannten Geisterseher oder Mondsüchtigen vergebens Zeugnis gegen die Phantasien einer zerstörten Imagination darbieten. Vielleicht kann die Beschaffenheit dieser Kollision zwischen einer zerrütteten Einbildungskraft und den nicht mehr Dienste tuenden Sinnenwerkzeugen, nicht besser beschrieben werden als durch die Verlegenheit, über die ein wahnsinniger Kranker im Verpflegungshause zu Edinburgh klagte. Des armen Leidenden Übel hatte einen fröhlichen Charakter angenommen. Er bildete sich ein, das Haus gehörte ihm, und nie fehlte es ihm an Gegenrede gegen das, was mit seinem eingebildeten Eigentumsrechte unverträglich zu sein schien. Es waren mehrere Kranke in dem Hause, doch befanden sie sich nur in Folge seiner Gutherzigkeit darin, welche ihm das Vergnügen verschaffte, die Heilung jener Unglücklichen bewirkt zu wissen. Er ging selten oder vielmehr niemals aus, und seine Lebensweise war häuslich, ja sitzend. Er sah nicht viele Gesellschaft bei sich, erhielt jedoch täglich Besuche von den ersten und vorzüglichsten aus der berühmten Medizinalschule von Edinburgh, so daß es ihm eigentlich nie an Umgang fehlte. Von so vielen eingebildeten Annehmlichkeiten umgeben, bei so vielen Gegenständen der Wohlhabenheit und des Glanzes, die ihm zu Diensten zu sein schienen, war nur ein einziger Umstand, der den Frieden des armen Optimisten störte, und in der Tat jeden Lebemann in Verwirrung gebracht haben würde: „Es wäre ihm sonderbar“, sagte er, „daß auf seiner Tafel, die von auserlesenen Köchen täglich mit drei regelmäßigen Gängen und einem Nachtische bedient würde, dennoch jedes Gericht auf eine oder andere Weise nach Suppe schmeckte.“ Dieser Umstand konnte diejenigen nicht in Erstaunen setzen, denen der arme Kranke denselben mitteilte, indem sie wußten, daß dieser zu keiner Mahlzeit etwas anderes als Suppe erhielt. Der Fall liegt klar vor Augen; die Krankheit gründete sich auf die außerordentliche Lebhaftigkeit der Einbildungskraft des Leidenden, die sich allewege täuschen ließ, jedoch nur nicht gegen das ehrliche Zeugnis seines Magens und Gaumens, die beide, gleich Lord Peters Genossen im Ammenmärchen, ärgerlich über den Versuch waren, ihnen gekochtes Hafermehl vorzusetzen, statt ihnen ein Bankett zuzurichten, wie Udo es veranstaltete, wenn Peers daran teilnehmen sollten. Hier waltet also ein Beispiel wirklichen Wahnwitzes ob, welches dartut, daß der Sinn des Geschmackes die einbilderischen Ansichten einer zerstörten Imagination unter Aufsicht nahm und zunichte zu machen strebte. Allein die Krankheit, auf welche ich hauptsächlich hinzudeuten habe, ist durchaus körperlicher Beschaffenheit, und besteht hauptsächlich in einer Zerrüttung der Sehorgane, so daß diese dem Leidenden eine Reihe von Gespenstern oder Erscheinungen erblicken lassen, denen die wirkliche Existenz fehlt. Eine Krankheit ähnlicher Art ist es, die manche Leute unfähig macht, die Farben zu unterscheiden; nur daß jene Leidende einen Schritt weiter gehen und die äußere Form der Gegenstände ihren Blicken anders gestalten. So ist in ihrem Falle, ganz gegen Art und Weise der Wahnsinnigen, nicht die Seele oder vielmehr die Einbildungskraft dasjenige Wesen, welches die Beweiskraft der Sinne beherrscht und überwältigt; sondern der Sinn des Sehens oder Hörens ist es, der seine Obliegenheit unerfüllt läßt und dem gesunden Verstande falsche Ideen vorführt.
Mehrere gelehrte Ärzte, die in das Vorhandensein dieser trübseligen Krankheit einstimmen, sind darüber einig, daß dieselbe wirklich vorkommt und durch verschiedene Ursachen veranlaßt wird. Die gewöhnlichste Quelle der Krankheit ist die unordentliche und unmäßige Lebensweise solcher Personen, welche durch fortgesetztes Berauschen von demjenigen Übel befallen werden, welches gemeinhin „blauer Teufel“ genannt wird, wozu es an Beweisen für diejenigen nicht fehlen kann, welche in Gesellschaft von Menschen lebten, bei denen der Trunk zum alltäglichen Laster geworden war. Die heiteren Visionen, welche durch Berauschung, sobald diese zur Gewohnheit ward, erzeugt werden, verschwinden bald, und an deren Stelle treten fürchterliche Eindrücke und Gebilde, welche die Ruhe des unglücklichen Trunkenboldes stören. Erscheinungen der widerwärtigsten Art werden ihm Begleiter in der Einsamkeit, ja, drängen sich ihm sogar auf, wenn er nicht allein ist, und wenn durch Änderung des Lebenswandels die Seele von jenen fürchterlichen Ideen befreit wird, bedarf es nur des kleinsten Rückschrittes , um die ganze Flut des Elendes über den reuigen Trunkenbold zurückzuschwemmen.
Über diesen Punkt ward dem Verfasser von einem Manne, der den Leidenden genau kannte, folgende Tatsache mitgeteilt: Ein junger Mann von Vermögen, welcher durch einen sogenannten heiteren Lebenswandel sowohl seine Gesundheit wie seine Umstände zerrüttet hatte, sah sich endlich notgedrungen, zu einem Arzte seine Zuflucht zu nehmen, um wenigstens erstere wieder herzustellen. Eine seiner vorzüglichsten Klagen war die Anwesenheit einer Reihe von Erscheinungen, die einer Schar grünbekleideter Gestalten glich, welche in seinem Gesellschaftszimmer einen seltsamen Tanz aufführten, welchem zuzusehen, er sich unwiderstehlich gezwungen fühlte, obwohl er wußte, daß zu seiner großen Bekümmernis das gestimmte Balletkorps einzig und allein in seiner Einbildung existierte. Sofort ward von seinem Arzte ihm das Gutachten, daß er zu lange und zu anhaltend in der Stadt gelebt hätte, als daß eine Veränderung des Wohnortes und der Lebensweise ihm nicht höchst notwendig wäre. Der Arzt schrieb ihm nun eine bequeme wiewohl strenge Diät vor, und befahl ihm ernstlich, sich in sein Landhaus zurückzuziehen, sich mäßig zu halten, früh aufzustehen, sich täglich Bewegung zu machen, jedoch Strapazen aller Art zu vermeiden, und versicherte ihm schließlich, daß, wenn er diesen Rat genau befolge, ihn bald alle schwarze und weiße, blaue, grüne und graue Geister mit all ihren Schnurrpfeifereien verlassen würden. Der Kranke tat nach des Arztes Vorschrift und genas. Nach einem Monate schon schrieb er seinem Helfer einen Brief, worin er ihm für die Trefflichkeit der erhaltenen Verordnungen dankte. Die grünen Kobolde waren verschwunden, mit ihnen jene widerwärtigen Gemütsbewegungen, die durch deren Erscheinen regegemacht worden waren, und der Kranke gab nunmehr Befehl, sein Haus in der Stadt auszuräumen, damit dasselbe verkauft würde, während das Mobiliar in seine Wohnung auf dem Lande gebracht werden sollte, wo er in Zukunft, ohne sich jemals wieder den städtischen Zerstreuungen hinzugeben, sein Leben zuzubringen gedachte. Man hätte diesen Plan aus keine Weise mißbilligen können; aber ach! Kaum war das Gerät aus dem Gesellschaftszimmer in der Hauptstadt in die Gemächer des Landhauses gestellt worden, so kehrte die frühere Täuschung in all ihrer Gewalt zurück. Die grünen Ballettänzer, die des Kranken zerrüttete Imagination so lange Zeit mit jenem Zimmergerät in Verbindung gebracht hatte, waren wieder da mit allen ihren Fratzen und Kapriolen, die anzusehen er sich von Neuem gezwungen fühlte, und riefen mit großer Freude, als ob der Leidende über ihren Anblick ergötzt sein sollte: „Hier sind wir – hier sind wir alle!“ Der Geisterseher war, wenn ich mich des Umstandes recht erinnere, so betroffen über diese Erscheinung, daß er in die Fremde zog, weil er daran verzweifelte, daß in irgendeiner Gegend Britanniens ihm Schutz gegen dieses Zimmerballetts tägliche Verfolgung werden könnte.
Es walten Ursachen ob, zu glauben, daß solche Fälle häufig vorkommen, und daß sie vielleicht nicht nur aus Magenschwäche entspringen, die durch übermäßigen Genuß des Weines oder sonstiger geistiger Getränke entstand, sondern auch davon herrühren, daß die Seele nach und nach von einer Reihe phantastischer Visionen endlich ganz beherrscht wird, welches eine Folge der Trunkfülligkeit ist, so daß der Verstand des Menschen gleich einem verrenkten Gliede fehltritt oder fehlgreift, selbst wenn eine ganz andere Ursache die Zerrüttung herbeiführte.
Es ist leicht zu vermuten, daß gewohnte Aufregung mittelst anderer berauschender Spezereien, als z. B, Opium u. dgl., diejenigen, welche diese gefährliche Gewohnheit annahmen, gleichen Übeln preisgeben. Häufiger Genuß von Salpeterauflösungen, welche so sehr die Sinne angreifen und einen kurze Zeit dauernden, jedoch seltsamen Zustand von Ekstase hervorbringen, erzeugt aller Wahrscheinlichkeit nach jene Art von Krankheit. Doch gibt es nach der Aussage von Ärzten noch viele andere Ursachen, die von demselben Symptome begleitet sind, so daß sie den Blicken der Leidenden eingebildete Gesichte vorführen, die außer ihnen kein anderer Mensch wahrzunehmen vermag. Diese Verfolgung von gespenstischen Täuschungen findet sich sogar bei Personen, denen man keine ausschweifende Lebensweise vorwerfen kann, und mag dann wohl einer Unordnung im Blutumlaufe oder im Nervensystem zuzuschreiben sein.
Der gelehrte und scharfsinnige Doktor Ferriar von Manchester war der erste, der das Publikum Englands mit einer in dieses Departement gehörenden Krankheitsgeschichte bekannt machte, welche den berühmten Berliner Buchhändler Hrn. Nicolai zum Gegenstande hatte. Dieser Mann war nicht bloßer Bücherwurm, sondern ein wirklicher Gelehrter und besaß den moralischen Mut, der Berliner philosophischen Sozietät einen Bericht seiner Leiden abzulegen, die darin bestanden, daß er durch Krankheit von einer Reihe gespenstiger Erscheinungen gequält ward. Die näheren Umstände dieses Vorfalles lassen sich in Kürze angeben, da sie dem Publikum ausführlich mitgeteilt und durch Doktor Ferriar, Doktor Hibbert u. a. die sich auf Dämonologie einließen, erläutert worden sind. Nicolai führt seine Krankheit bis weit zu einer Reihe unangenehmer Ereignisse zurück, welche ihm zu Anfange des Jahres 1791 begegneten. Die Geistesbedrückung, welche durch jene Widerwärtigkeiten ihm verursacht ward, erhielt noch dadurch Zuwachs, daß er es vernachlässigte, zu bestimmten Zeitfristen sich zur Ader zu lassen, wie er es sonst zu tun gewohnt gewesen war. Dieser Zustand brachte nun die Neigung hervor, Phantasmen zu sehen, welche die Zimmer des gelehrten Buchhändlers besuchten oder vielmehr bewohnten, indem sie sich als eine Menge Menschen ihm zeigten, die sich bewegten und dieses oder jenes taten, ja sogar ihn anredeten und mit ihm sprachen. Diese Phantome hatten für die Einbildungskraft des Visionärs weder in Ansehen noch Rede etwas Widriges, und der Kranke besaß zu große Standhaftigkeit des Geistes, als daß er die Gestalten anders denn mit einer Art von Neugier betrachtet hätte, indem er von Anfang bis zu Ende seiner Krankheit überzeugt blieb, daß diese seltsamen Erscheinungen nichts als Symptome seines Gesundheitszustandes waren, so daß er in keinem Betracht sie als Gegenstände der Vorahnung ansah. Nach Verlauf einer gewissen Zeit und nach Anwendung ärztlicher Hilfe wurden die Phantome undeutlicher in ihren Umrissen, minder lebhaft in ihren Farben, verbleichten gleichsam vor den Augen des Kranken und verschwanden endlich ganz und gar.
Der Vorfall mit Nicolai war ohne allen Zweifel der, welcher sich mit vielen ereignet, deren Liebe zu den Wissenschaften nicht im Stande war, ihren natürlichen Widerwillen gegen jegliche öffentliche Mitteilung der näheren Umstände zu bezwingen, die die Untersuchung einer so besonderen Krankheit erfordert. Daß dergleichen Übel aber stattfanden und oft schlimmen Ausgang hatten, ist wohl als gewiß anzunehmen; obgleich keineswegs vorauszusetzen ist, daß das Symptom, welches für unsere vorliegende Abhandlung so wichtig ist, jederzeit durch die nämliche identische Ursache erzeugt worden ist.
Doktor Hibbert, welcher auf eine so geistreiche wie philosophische Weise diesen Gegenstand beleuchtete, hat denselben auch aus dem Gesichtspunkte der Arzneikunde mit einer Gelehrsamkeit untersucht, auf welche wir keinen Anspruch machen, und hat dabei eine Genauigkeit in der ausführenden Erklärung gebraucht, zu welcher unsere oberflächliche Übersicht keinen Raum gestattet.
Die Erscheinung gespenstischer Phänomena ist von diesem gelehrten Herrn als zusammentreffend mit besonderen Körperleiden geschildert worden, und namentlich macht er darauf aufmerksam, daß das Symptom sich nicht bloß bei starker Vollblütigkeit zeigt, wie es der Fall mit dem genannten Berliner Buchhändler war, sondern daß es ebenso oft sich bei Schwindsüchtigen einstellt, häufig mit fieberischen und entzündungsartigen Krankheiten sich vergesellschaft, nicht selten bei Hirnentzündungen sich äußert, auch der Begleiter eines höchst aufgereizten Nervenzustandes ist, sich ebenfalls mit der Hypochondrie zusammenfindet und endlich sich in einigen Fällen mit der Gicht, in anderen mit den Wirkungen jener Reizbarkeit vereinigt, die durch verschiedene Gasarten erzeugt werden. In allen diesen Fällen scheint ein krankhafter Grad von Reizbarkeit, zu welchem jenes Symptom sich nur zu gern gesellt, vorzuherrschen, der – zwar nicht nach ärztlicher Definition, sondern nur obenhin beschrieben – so ziemlich den Charakter der verschiedenen Arten von Krankheiten an sich tragen dürfte, mit denen sich dies trübselige Symptom vergesellschaftet finden mag.
Eine so sonderbare wie interessante Erläuterung solcher Kombinationen, wie Doktor Hibbert zwischen phantastischen Erscheinungen unwirklicher Krankheit von gefährlicher Art ausgestellt hat, ward häufig in Gesellschaft von dem verstorbenen gelehrten und talentvollen Doktor Gregory in Edinburgh gegeben und, wie mich dünkt, bisweilen von ihm in seinen öffentlichen Vorlesungen angebracht. Nach des Verfassers bestem Erinnerungsvermögen lautete die Erzählung folgendermaßen: Ein Kranker, welchen Doktor Gregory behandelte, ein Mann von Range, wie ich glaube, der sich des berühmten Arztes Hilfe erbeten hatte, machte folgende außerordentliche Beschreibung seines Zustandes: „Ich bin gewohnt“, sagte er, „um fünf Uhr zu Mittage zu essen, und sobald es sechs schlägt, werde ich von einem peinlichen Besuche gequält. Die Tür des Gemaches öffnet sich, selbst wenn ich schwach genug gewesen war, sie zu verriegeln, welches ich wirklich einige Male getan habe; eine alte Hexe, gleich einer von denen die auf der Haide von Forres spukten, tritt mit mürrischem und erzürntem Gesichte herein, und kommt mit jeglicher Äußerung von Hohn und Unwillen, etwa so als äffte sie den Handelsmann Abudah im orientalischen Märchen, gerade auf mich zu, überfällt mich, sagt etwas, jedoch so schnell, daß ich sie nicht verstehen kann und versetzt mir dann einen heftigen Schlag mit ihrer Krücke. Ich falle von meinem Stuhle in eine Ohnmacht, die bald längere bald kürzere Zeit währt. Der Wiederkehr dieser Erscheinung bin ich täglich unterworfen.“ Der Arzt fragte sogleich den Patienten, ob er jemals jemanden eingeladen hätte, mit ihm zu essen? Die Frage ward verneinend beantwortet. Die Beschaffenheit des Übels, das ihn quäle, sagte der Kranke, sei so sonderbar und könne so leicht der Einbildung oder gar einer Geisteszerrüttung zugeschrieben werden, daß er sich gescheut habe, irgendeinem Menschen Mitteilung davon zu machen. „Nun dann“, versetzte der Arzt, „so will ich mit Ihrer Erlaubnis heute unter vier Augen mit Ihnen zu Mittage essen, und da wollen wir doch sehen, ob Ihr boshaftes altes Weib sich in unsere Gesellschaft wagt.“ Der Kranke nahm den Vorschlag mit Hoffnung und Dankbarkeit an, denn er hatte eher gefürchtet ausgelacht zu werden, als gehofft, Mitleiden zu finden. Man traf bei Tische zusammen, und Doktor Gregory, der irgendein verstecktes Nervenübel vermutete, strengte alle seine Unterhaltungsgabe an, die, wie man weiß, so vielseitig wie glänzend war, um die Aufmerksamkeit seines Gastes zu fesseln und ihn zu verhindern, der Annäherung des Glockenschlages der verhängnisvollen sechsten Stunde zu gedenken, um welche Zeit der Kranke mit so großem Schrecken vor sich hinzustarren pflegte. Sein Vorhaben schien ihm besser zu gelingen, als er es gehofft haben mochte. Die Glocke schlug, fast ohne daß es von dem Kranken bemerkt ward und der Arzt glaubte sich schon ganz sicher in seinem Unternehmen, als der Hausherr plötzlich auffuhr und mit zitternder Stimme ausrief: „Die Hexe kommt!“ Mit diesen Worten sank er, ganz wie er es beschrieben hatte, ohnmächtig in seinen Sessel zurück. Der Arzt ließ dem Kranken nun eine Ader öffnen, indem er sich überzeugt hatte, daß die periodischen Anfälle dieses Mannes von dessen Tendenz zum Schlagflusse herrührten.
Das Phantom mit der Krücke war weiter nichts als eine Art von jenen Gebilden, welche durch die Einbildungskraft derjenigen Krankheit untergeschoben werden, die man Ephialtes oder das Alpdrücken nennt und die darin besteht, daß des Kranken zerrüttete Imagination sich im Traume, bevor seine Ohnmacht eintritt, von irgendeinem ihm von außen kommenden Drucke geängstigt glaubt. Der Alpgedrückte fühlt eine ihn fast erstickende Pressung und augenblicklich beschwört seine Phantasie ein Gespenst herauf, das ihm auf der Brust hockt, Gleicherweise ist dabei zu bemerken, daß irgendein plötzliches Geräusch, welches der Schlummernde hört, auch wenn ihn dasselbe keineswegs erweckt – so auch jede zufällige Berührung seiner Person – sich augenblicklich in seinen Traum verwebt und sich seiner fortlaufenden Gedankenkette anreiht, auf welche Art diese Kette auch zusammenhangend sein möge; und nichts ist merkwürdiger als die Schnelligkeit, mit welcher die Imagination, gemäß dem von der Seele im Traume einmal eingeschlagenen Ideengange, solcher Störung durch eine verdeutlichende Erklärung zu Hilfe zu kommen weiß, selbst wenn ihr zu diesem Ende nur ein einziger Augenblick Zeit geboten wird. So gestaltet im Traume z, B. von einem Zweikampfe der äußere Lauf, welcher vielleicht nur das Blinzen eines Auges ist, zum Losgehen der Pistolen beider Duellanten; spricht ein Redner im Schlafe, so dünkt der zufällige Laut, den er etwa hört, ihn der Beifallsruf seiner vermeinten Zuhörerschaft zu sein; wandert der Träumende unter eingebildeten Ruinen umher, so verwandelt ein zufälliges Geräusch ganz anderer Art für ihn sich in das Herabfallen von einem Teile des Trümmerwerkes; kurz: während des Schlafes wird ein Erklärungssystem mit solcher Raschheit vorgenommen, daß, vorausgesetzt es rühre das dem Schläfer sich aufdringende Getöse von dem Rufe einer Person her, die ihn wecken will, sich die Erklärung, welche doch einige Voraussetzung oder Unterscheidung erfordern sollte, noch eher vollständig bildet, als ein zweiter Ruf des Weckenden im Stande ist, den Träumer der wachenden Welt und deren Wirklichkeiten zurückzugeben. So schnell und anschaulich ist im Schlafe die Ideenfolge, daß sie uns an die Vision des Propheten Mahomet erinnert, in welcher er die Wunder des Himmels und der Hölle sah, während das Gefäß mit Wasser, welches umfiel, als sein Traumgesicht begann, noch nicht seinen Inhalt hatte ausfließen lassen, als der Seher zu seinem natürlichen Bewußtsein zurückkehrte.
Ein zweiter ebenfalls merkwürdiger Beweis hiervon ward dem Autor von dem Arzte mitgeteilt, unter dessen Behandlung derselbe stattfand, weshalb denn auch gewünscht worden ist, daß der Name des Helden dieser sonderbaren Geschichte verschwiegen bleiben möchte. Von dem Freunde, der die Tatsache bestätigte, kann ich nur sagen, daß, wenn es mir frei stände, dessen Namen zu nennen, sowohl der Rang, den er unter seinen Amtsgenossen bekleidete, wie seine Gelehrsamkeit als Arzt und Philosoph zu dem unbedingtesten Glauben an dessen Mitteilung auffordern würde.
Der bezeichnete Arzt hatte das Glück, zu einem jetzt lange verstorbenen Manne gerufen zu werden, der bei seinen Lebzeiten ein bedeutendes Richteramt bekleidete, welches oft das Eigentum anderer seiner Aufsicht und Obhut überantwortete, und der, eben weil er seinen Wandel der öffentlichen Beurteilung vorzugsweise bloßgestellt sah, sich als einen Mann von ungewöhnlicher Standhaftigkeit, gesundem Verstande und strenger Redlichkeit kundzugeben gewohnt war. Zur Zeit, wo mein Freund ihn besuchte, war er größtenteils auf sein Krankenzimmer beschränkt, lag bisweilen zu Bette, besorgte jedoch auch mitunter noch Geschäfte, wobei, wie es schien, er mit aller seiner Seelenkraft tätig war; auch bemerkte der strengste Beobachter in solchen Augenblicken an dem Benehmen jenes Mannes nicht das Mindeste, das auf krankhaften Geistes- oder Gemütszustand hätte schließen lassen. Das äußere Symptom seines Übels ließ keine schwere oder beunruhigende Krankheit fürchten. Allein Mattigkeit des Pulses, Mangel an Eßlust, schwere Verdauung und beständige Niedergeschlagenheit schienen ihren Ursprung aus einer versteckten Ursache zu nehmen, die der Patient nicht kundmachen wollte. Das äußere Wesen dieses Mannes, seine Verlegenheit, die er dem Arzte nicht zu verhehlen vermochte, seine abgebrochenen Reden und der sichtliche Zwang, womit er die Fragen seines ärztlichen Ratgebers beantwortete, vermochten meinen Freund, einen anderen Weg einzuschlagen, um in seinem Erforschen des eigentlichen Übels seines Patienten vorzurücken. Er wendete sich an die Familie des Kranken, um womöglich die Quelle des geheimen Leidens zu entdecken, das am Herzen desselben nagte und dessen Lebensblut verzehrte. Die Personen, an die er sich wendete, hielten Rat miteinander, fanden jedoch kein anderes Resultat heraus, als daß sie durchaus keinen Grund für die Leiden zu erforschen vermochten, von denen sie ihren teuren Verwandten so sichtlich ergriffen sahen. So weit es ihnen kund war – und sie meinten hierin sich schwerlich täuschen zu können – waren des Kranken bürgerliche Angelegenheiten in der besten Ordnung, kein Familienverlust hatte für denselben stattgefunden, welcher dergleichen betrübende Folgen, wie an ihm wahrzunehmen waren, hätte erzeugen können; keine leidenschaftliche Verwikklungen konnten bei des Kranken vorgerücktem Alter bei ihm gemutmaßt werden, und kein Gefühl quälender Reue war im Einklange mit seinem Charakter zu denken. Der Arzt nahm nunmehr Zuflucht zu einer ernstlichen Rücksprache mit dem Kranken selbst, und stellte ihm die Torheit vor, die darin läge, sich lieber einem langsamen und traurigen Hinsterben zu überlassen, als die Ursache des Leidens, welches ihn verzehrte, offenherzig zu nennen. Besonders stellte er ihm den Nachteil vor, den er seinem moralischen Rufe dadurch zufügte, indem er der bösen Welt Anlaß gäbe, das Geheimnis von der Ursache seines Hinschwindens für so verdächtig oder gar für so schändlich zu halten, daß es nicht wohl aufgedeckt werden könnte, indem er auf diese Weise den seinigen einen verdächtigen, ja entehrten Namen hinterließe und sein Andenken mit einer Mutmaßung von Schuld, die er bei Lebzeiten nicht eingestanden hätte, vorsätzlich befleckte. Der Kranke, der durch diese Art von Aufforderung mehr als durch jede andere Vorstellung erschüttert ward, äußerte dem Arzte seinen Entschluß, demselben alles frei herauszusagen, was seinen Gesundheitszustand beträfe. Das Krankenzimmer ward nunmehr, nachdem jeder Zeuge entfernt worden war, verschlossen, und der Patient begann seine Aussage auf folgende Weise:
„Nicht fester als ich können Sie, teurer Freund, davon überzeugt sein, daß ich unter der Last einer fürchterlichen Krankheit erliege, die meine Lebenskräfte verzehrt; aber ebensowenig können Sie die Beschaffenheit meines Übels und die Art, wie dasselbe mich bedrückt, begreifen, also wohl schwerlich dasselbe bei allem Ihrem Eifer und aller Ihrer Geschicklichkeit zu heilen im Stande sein.“ –– „Es ist möglich“, versetzte der Arzt, „daß meine Geschicklichkeit nicht meinem Wunsche, Ihnen zu dienen, gleichkommen mag, doch hat die Heilkunde mancherlei Hilfsmittel, wovon diejenigen, die mit den Kräften derselben unbekannt sind, sich nimmer einen Begriff machen können. Allein bevor Sie mir offen ihren Zustand mitteilen, ist es jedem Arzte unmöglich zu sagen, was in meiner oder der Heilkunde Macht stehe oder nicht.“ – „Ich kann Ihnen hieraus erwidern“, sagte der Patient, „daß mein Übel nicht einzig in seiner Art ist, denn wir lesen von demselben in dem berühmten Roman des Le Sage. Sie erinnern sich ohne Zweifel der Krankheit, an welcher der Herzog von Olivarez gestorben sein soll?“ – „Er starb“ – war des Arztes Antwort – „an der Idee, daß ihn eine Erscheinung ängstigte, deren wirklichem Dasein er keinen Glauben beimaß; dennoch gab er darüber den Geist auf, weil jenes eingebildete Gespenst ihn bis zum Tode quälte.“ – ,,Ich, mein werter Doktor“, entgegnete der Kranke, „bin in demselben Falle, und die Gegenwart der mich verfolgenden Vision ist so erschreckend, daß ich mit aller meiner Vernunft nicht vermögend bin, die Wirkungen meiner zerrütteten Einbildungskraft zu bekämpfen, und ich fühle, daß ich als ein Opfer eingebildeten Übels hinsterben muß.“ Der Arzt hörte mit Besorgnis die Aussage des Kranken, vermied jedoch klüglich jeden Widerspruch gegen die eingenommene Phantasie des Mannes, und drang vermittelst genauer Nachfrage in die Beschaffenheit der Erscheinung, durch welche der Kranke sich geängstigt fühlte und in die Geschichte der Art und Weise, auf welche eine so sonderbare Krankheit sich zum Herrn einer Imagination gemacht hatte, die, wie es schien, durch gereifte Verstandeskräfte gegen solchen regellosen Angriff hätte gesichert sein müssen. Der Kranke erwiderte darauf durch die Aussage, daß die Fortschritte des Übels allmählich geschahen und anfänglich durchaus keinen schrecklichen, ja nicht einmal einen unangenehmen Charakter hatten. Um dies deutlicher zu machen, stattete er folgenden Bericht von der Steigerung seiner Krankheit ab:
„Meine Visionen“, sagte er, „begannen vor zwei oder drei Jahren, wo ich mich von Zeit zu Zeit durch die Gegenwart einer großen Katze belästigt fand, welche auf eine Weise kam und wieder verschwand, die ich nicht zu nennen weiß, bis mir endlich die Wahrheit aufgezwungen ward, daß ich genötigt wäre, das Geschöpf keineswegs als ein Haustier, sondern als ein Hirngespinst zu betrachten, welches in meinen erkrankten Sehorganen oder in meiner zerrütteten Phantasie seine Existenz hatte. Dabei hatte ich keineswegs jene entschiedene Abneigung gegen das Tier, die ein jüngst verstorbener hochländischer Gutsbesitzer hegte, indem sein Gesicht in all den Farben seines eigenen Plaids spielte, sobald eine Katze, selbst wenn er dieselbe gar nicht erblickte, bei ihm im Zimmer war. Im Gegenteil, ich mochte immer gern Katzen leiden und duldete daher die Gegenwart meiner eingebildeten Begleiterin mit solchem Gleichmute, daß mir die Anwesenheit des Tieres fast gleichgültig ward, als nach Verlauf weniger Monate die Katze einem Gespenste bedeutenderer Art Platz machte. Dies Gespenst war nichts anders als die Erscheinung eines Kammerdieners oder Lakaien. Diese in Livree gekleidete Person, mit Spitzhut und Degen und gestickter Weste, schlüpfte neben mir hin und her, ich mochte in meinem Hause oder in der Wohnung anderer sein, stieg vor mir die Treppen hinan, als wollte sie mich im Gesellschaftszimmer anmelden, schien auch bisweilen sich in die Gesellschaft selbst zu mischen, obwohl ich mich hinlänglich überzeugte, daß diese nichts von der Anwesenheit des gespenstischen Dieners wußte, sondern daß mir allein die eingebildeten Ehrenbezeugungen kund waren, welches dieses phantastische Wesen mir zu erweisen so bereitwillig schien. Diese Zerrüttung meiner Einbildungskraft machte noch nicht sonderlich tiefen Eindruck auf mich, obgleich sie mich zu Bedenklichkeiten über meinen Gesundheitszustand leitete und mir bisweilen den Gedanken erweckte, meine Verstandeskräfte könnten dadurch angegriffen werden. Doch diese Gestaltung meiner Krankheit hatte ebenfalls ihre ihr angewiesene Dauer. Nach Verlauf von abermals etlichen Monaten ward das Phantom des Lakaien nicht mehr von mir gesehen, allein an dessen Stelle trat ein den Augen ebenso fürchterliches wie für die Imagination vollends zerstörendes Gesicht, das in nichts anderem bestand, als in der Gestalt des Todes selbst; denn es war die Erscheinung eines Skelettes. Allein oder unter Menschen“, fuhr der unglückliche Kranke fort: „überall verfolgt mich dieses Phantom, und verläßt mich keinen Augenblick. Vergebens spreche ich mir zu hundert Malen vor, daß es nichts Wirkliches, sondern nur ein Gebilde meiner krankhaft aufgeregten Imagination und zerstörten Sehorgane ist. Was nützen auch solche Betrachtungen, so lange das Sinnbild und die Weissagung der Sterblichkeit leibhaftig vor meinen Augen steht und so lange ich, wenn auch nur in meiner Einbildung, einen Begleiter spüre, der auf gespenstische Weise einen Schrecken einflößenden Bewohner des Grabes vorstellt, während ich noch auf Erden atme? Wissenschaft, Philosophie, die Religion selbst hat nicht Heilung solchen Übels, und ich fühle es nur zu tief, daß ich als das Opfer einer so düsteren Krankheit fallen muß, obwohl ich nicht den mindesten Glauben an das wirkliche Vorhandensein des Phantomes hege, das durch solche Krankheit vor mich hingestellt wird.“
Dem Arzte war es betrübend, aus diesen Mitteilungen wahrzunehmen, wie fest diese eingebildete Erscheinung sich der Imagination seines Patienten eingeprägt hatte. Mit vielem Scharfsinn erforschte er nun von dem Kranken, der eben im Bette lag, die näheren Umstände des Erscheinens jenes Gebildes, wobei er hoffte, den Patienten als verständigen Mann, dessen Vernunft durchaus unbeteiligt zu sein schien, in solche Widersprüche und Unhaltbarkeiten zu verwickeln, daß er dadurch die phantastische Krankheit, welche so entsetzlich in ihren Wirkungen war, aus dem Felde schlagen möchte. „Dies Skelett scheint also immer vor Ihren Blicken zu stehen?“ fragte der Arzt. „Es ist mein unseliges Geschick“, erwiderte der Leidende, „es fortwährend zu sehen.“ – „So ist es also“, fuhr der Medicus fort, „auch jetzt Ihrer Imagination gegenwärtig? Und in welcher Gegend des Zimmers meinen Sie die Erscheinung wahrzunehmen?“ – „Unmittelbar zu Füßen meines Bettes“, versetzte der Kranke, „wo es den Raum zwischen Bettgestell und Vorhang einnimmt“ – „Sie sagen, Sie spüren die Täuschung“, entgegnete der Arzt: „Sind Sie standhaft genug, sich von dieser Wahrheit zu überzeugen? Besitzen Sie hinlänglichen Mut, aufzustehen, um selbst die Stelle einzunehmen, auf welcher Ihrer Meinung nach das Gespenst steht, um sich auf solche Weise von der Täuschung, in der Sie befangen sind, zu überzeugen?“ Der arme Leidende seufzte und schüttelte verneinend den Kopf. „Nun“, sagte der Arzt, „so wollen wir das Experiment auf andere Weise versuchen.“ Demzufolge stand er von seinem Stuhle neben dem Bette auf, stellte sich an den Ort, der der Beschreibung des Kranken nach von dem Skelett eingenommen war und fragte, ob das Gespenst noch sichtbar wäre? „Nicht ganz so wie vorhin“, versetzte der Patient, „weil Sie zwischen mir und ihm stehen, aber ich sehe deutlich, wie sein Schädel mir über Ihre Schulter weg entgegengrinst.“
Der Heilkünstler stutzte trotz aller Philosophie ein Weilchen, als er eine so entschiedene und genaue Antwort erhielt, durch welche er erkennen mußte, wie überaus nahe er sich dem Phantome befand. Er nahm zu anderen Heilmethoden Zuflucht, jedoch immer nur mit unerheblichem Erfolge. Der Patient versank tiefer und tiefer in Niedergeschlagenheit und starb endlich in jener Seelenbetrübnis, in welcher er die letzten Monate seines Lebens ununterbrochen zugebracht hatte; und sein Fall bleibt ein trauriges Beispiel, welche Gewalt die Imagination hat, den Leib selbst dann zu töten, wenn ihre phantastischen Schrecken nicht vermögen, die Vernunft derer zu zerstören, die unglücklich genug sind, unter solchen Eindrücken leiden zu müssen. Unser Kranker erlag ganz und gar seinem Übel, und da die näheren Umstände seiner seltsamen Krankheit nicht unenthüllt blieben, verlor er keineswegs durch sein Leiden und seinen Tod den wohlerworbenen Ruf eines verständigen und rechtschaffenen Mannes; einen Ruf, den er während seines ganzen Lebenslaufes behauptet hatte.
Nachdem wir diese beiden merkwürdigen Beispiele der Reihe von ähnlichen Tatsachen, welche Ferriar, Hibbert und andere Schriftsteller anführten, die in neuerer Zeit diesen Gegenstand behandelten, hinzugefügt haben, kann, unserer Meinung nach, wenig Zweifel an der Voraussetzung obwalten, daß aus verschiedenen Ursachen die äußeren Sinne so zerrüttet werden können, daß sie der Seele falsche Vorstellungen überliefern, und daß in solchen Fällen Leute im buchstäblichen Sinne des Wortes wirklich dergleichen nichtige und irrige Gestalten sehen, wirklich eingebildete Töne hören, die im primitiven Zustande der menschlichen Gesellschaft natürlich genug der Wirkung von Dämonen oder körperlosen Geistern zugeschrieben worden sind. In solchen unglücklichen Fällen befindet sich, geistig betrachtet, der Patient in der Lage eines Generals, dessen Emissäre von dem Feinde bestochen wurden, und der sich deshalb der schwierigen und mißlichen Aufgabe unterziehen muß, durch eigene Nachforschung die Wahrscheinlichkeit der ihm zukommenden Berichte, die zu unhaltbar sind, als daß ihnen unbedingt Glauben beigemessen werden könnte, zu prüfen und zu erwägen.
Doch ist zu dieser Voraussetzung ein bemerkenswerter Zusatz zu machen. Die nämliche Gattung von organischer Zerrüttung, welche den Gegenstand unserer eben gegebenen Erzählung von den nacheinander sich gezeigten Erscheinungen einer Katze, eines Lakaien und eines schreckenden Skelettes darstellte, mag für eine kurze Zeit, oder vielmehr nur für Augenblicke recht wohl die Sehkraft von Menschen ergreifen, die sonst keineswegs krank an den Augen sind. Vorübereilende Täuschungen bieten sich gar wohl Leuten von hellem Verstande und guter Erziehung dar, allein bei diesen führen sie zur Untersuchungsanstellung, und sobald ihre Beschaffenheit auf diesem Wege enthüllt worden ist, tritt das Wirkliche an den Platz irriger Vorstellung. Jedoch in unwissenden Zeiten mochten jene Beispiele, wo irgendein Gegenstand entweder durch eine verkehrte Tätigkeit der äußeren Sinne oder durch die Imagination oder auch durch beide gemeinschaftlich irrig dargestellt ward, es sei dieses nun während längerer oder kürzerer Zeit geschehen, gar wohl als unmittelbarer Beweis einer übernatürlichen Erscheinung angenommen werden; und solcher Beweis ist umso schwieriger zu bestreiten, wenn das Phantom wirklich von einem Manne von Geist und Bildung gesehen ward, der vielleicht, eben weil er nicht an übernatürliche Erscheinungen glaubte, sich weder Zeit nahm noch Mühe gab, den ersten Eindruck, den er erlitt, zu beseitigen. Diese Art von Täuschung ist so häufig, daß einer der größten Dichter der Jetztzeit auf die Frage einer Dame, ob er an Geister glaubte, die Antwort gab: „Nein, Madame, denn ich selbst habe ihrer zu viele gesehen.“
Ich will zwei hierher gehörende Beispiele mitteilen, an deren Zuverlässigkeit nicht der mindeste Zweifel haften kann.
Das erste wird die Erscheinung des Hrn. Maupertuis berühren, die sich einem Kollegen des genannten Gelehrten in der königlichen Sozietät zu Berlin zeigte.
Dieses außerordentliche Ereignis erschien in den Verhandlungen der Sozietät, und wird von Hrn. Thibault in dessen Erinnerungen an Friedrich den Großen und den Berliner Hof bestätigt. Es ist nötig, die Bemerkung vorauszuschicken, daß Hr. Gleditsch, dem der Vorfall begegnete, ein Botaniker von Bedeutung, dabei Professor der Naturphilosophie in Berlin und allgemein als ein ernster und schlichter Mann von besonnenem Charakter bekannt war.
Kurze Zeit nach dem Tode des Hrn. Maupertuis2, als Hr. Gleditsch genötigt war, durch den Saal zu gehen, in welchem die Akademie ihre Sitzungen hielt, indem er in dem Naturalienkabinette, welches unter seiner Aufsicht stand, einige Anordnungen zu treffen hatte, die er gern am Donnerstage vor den nächsten Sitzungen beseitigt wünschte, bemerkte er bei seinem Eintreten die aufrechtstehende Gestalt des Hrn. Maupertuis in der ersten links von ihm liegenden Zimmerecke. Die Gestalt heftete den Blick auf ihn. Es war drei Uhr Nachmittags. Der Professor der Naturphilosophie war mit der Physik zu wohl vertraut, als daß es ihm hatte einfallen können, daß sein ehemaliger Präsident, der zu Basel in den Armen der Familie Bernouillie starb, hätte in Person nach Berlin zurückkehren können. Er betrachtete die Erscheinung nicht anders als wie ein Phantom, das durch eine augenblickliche Zerrüttung seiner eigenen Sehorgane entstanden wäre. Ohne sich länger bei der Erscheinung aufzuhalten, als nötig war, sich von ihrer für ihn wirklichen Sichtbarkeit zu überzeugen, ging Hr. Gleditsch an sein Geschäft, erzählte jedoch nachher seinen Kollegen von der gehabten Vision, und versicherte dabei, daß dieselbe so erkennbar und deutlich gewesen sei, als die wirkliche Person des Hrn. Maupertuis dieselbe je hätte vorstellen können. Wenn man sich daran erinnert, daß Hr. Maupertuis fern von Berlin, dem ehemaligen Schauplatze seiner Triumphe starb, daß er durch den sprudelnden Spott Voltaires gestürzt und aus der Gunst Königs Friedrich, dem Lächerlichkeit so viel wie Unwürde galt, vertrieben ward, so können wir uns kaum über die Imagination eines Mannes von physikalischer Gelehrsamkeit wundern, wenn sie das Schattenbild des fernen Kollegen und ehemaligen Vorstandes in den Saal der ehemaligen Tätigkeit desselben hervorzaubert.
Der gelassene Professor der Naturphilosophie trieb indessen seine Nachforschung Betreffs der wahrgenommenen Erscheinung keineswegs so weit, wie jener tapfere Kriegsmann, aus dessen Munde ein vertrauter Freund des Autors die folgenden Umstände eines ähnlichen Vorfalles mitgeteilt erhielt:
Kapitän C* * * war in Britannien geboren, jedoch bei einer irischen Brigade erzogen worden. Er war ein Mann von dem entschlossensten Mute, den er bei etlichen ungewöhnlich verzweifelten Gelegenheiten in dem ersten Jahre der französischen Revolution, während welcher Zeit er von dem königlichen Hause in höchst gefährlichen Aufträgen gebraucht ward, an den Tag legte. Nach des Königs Tode ging C* * * nach England und hier war es, wo sich folgendes ereignete.
Kapitän C* * * war Katholik, und lag – mindestens in seinen Stunden der Widerwärtigkeit – den Pflichten seiner Religion getreulich ob. Sein Beichtvater war ein Geistlicher, der als Kaplan bei einem Manne von Range im westlichen Teile von England und etwa vier (engl.) Meilen von dem Orte wohnte, an welchem unser Kapitän sich aufhielt. Als C* * * eines Morgens hinüberritt, seinen Seelsorger zu besuchen, fand er diesen an einem sehr gefährlichen Übel darniederliegend. Mit großer Betrübnis und banger Sorge für das Leben seines Freundes, schied er von diesem, und sein bewegtes Gemüt erweckte ihm manche schmerzliche und unangenehme Erinnerung. Bis zur Stunde des Schlafengehens mit dergleichen Gedanken beschäftigt sah C* * *, als er zu Bette gehen wollte, zu seinem Erstaunen mitten in seinem