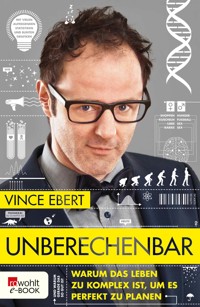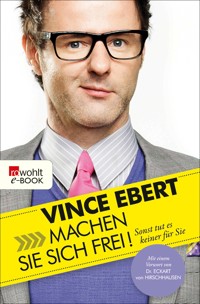10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der American Dream mit deutscher Gründlichkeit Ironie des Schicksals? In der Mitte des Lebens sehnen sich viele nach Entschleunigung, einem Sabbatical oder zumindest einer besseren Work-Life-Balance. Vince Ebert wollte es anders: Anstatt auf dem Jakobsweg einen Gang zurückzuschalten, suchte er das Abenteuer in der Stadt, die niemals schläft, auf dem Broadway. Raus aus dem Trott des Alltags, rein in den Wahnsinn von New York. Ein ganzes Jahr hatte er vor zu bleiben, durch Corona war sein amerikanischer Traum aber schon nach neun Monaten im März 2020 zu Ende. Zurück in Europa mit einem der letzten Flugzeuge, zwang ihn der Lockdown zur Entschleunigung, und die Pandemie nötigte ihn zu einem Sabbatical. Doch die Zeit im Big Apple veränderte seine Sicht sowohl auf die Neue als auch auf die Alte Welt. Warum ist eine Nation, die zum Mond flog, nicht in der Lage, eine funktionsfähige Duscharmatur herzustellen? Kann man wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär werden? Oder doch nur zum Geschirrspüler? Eine kluge und witzige Abrechnung mit dem American Dream und der deutschen Gründlichkeit – und warum die Anopheles-Mücke wichtiger ist als George Washington. Mit zahlreichen Fotos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Ironie des Schicksals? In der Mitte des Lebens sehnen sich viele nach Entschleunigung, einem Sabbatical oder zumindest einer besseren Work-Life-Balance. Vince Ebert wollte es anders: Anstatt auf dem Jakobsweg einen Gang zurückzuschalten, suchte er das Abenteuer in der Stadt, die niemals schläft, auf dem Broadway. Raus aus dem Trott des Alltags, rein in den Wahnsinn von New York. Ein ganzes Jahr hatte er vor zu bleiben, durch Corona war sein amerikanischer Traum aber schon nach neun Monaten im März 2020 zu Ende. Zurück in Europa mit einem der letzten Flugzeuge, zwang ihn der Lockdown zur Entschleunigung, und die Pandemie nötigte ihn zu einem Sabbatical. Doch die Zeit im Big Apple veränderte seine Sicht sowohl auf die Neue als auch auf die Alte Welt.
Warum ist eine Nation, die zum Mond flog, nicht in der Lage, eine funktionsfähige Duscharmatur herzustellen? Kann man wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär werden? Oder doch nur zum Geschirrspüler?
Eine kluge und witzige Abrechnung mit dem American Dream und der deutschen Gründlichkeit – und warum die Anopheles-Mücke wichtiger ist als George Washington.
PROLOG:NEW YORK IST NICHT DER ODENWALD
Das erste Mal besuchte ich New York im Jahr 2009. Genauer gesagt war es damals sogar das erste Mal überhaupt, dass ich den amerikanischen Kontinent betrat. Meine frischgebackene Ehefrau Valerie fand es eine gute Idee, unsere gesamten Flitterwochen in Manhattan zu verbringen. Sechzehn Tage in der Stadt, die niemals schläft. Ganz im Gegensatz zu mir, denn ich habe nach unserer Ankunft erst einmal sechzehn Stunden durchgepennt.
Ich gestehe, zu diesem Zeitpunkt war ich mit meinen einundvierzig Jahren noch nicht besonders weit in der Welt herumgekommen. Als Kind fuhr ich mit meinen Eltern im Auto ohne Klimaanlage nach Rimini oder an den Klopeiner See in Kärnten. Das absolute Highlight waren zwei Wochen Mallorca in einem Hotel, in dem ausschließlich deutsch gesprochen wurde.
Ich bin in Amorbach aufgewachsen, einem kleinen idyllischen Städtchen im bayerischen Odenwald. Ein aufregender Landstrich – wenn man auf Forstwirtschaft steht. Der Odenwälder Ureinwohner kommt üblicherweise mit fremden Kulturen nur durch vereinzelte Ausflüge ins hessische Michelstadt oder ins baden-württembergische Walldürn in Kontakt. »Interrail« bedeutete für mich, den Schienenbus von Amorbach nach Miltenberg zu nehmen. Einmal sogar – ganz verrückt – ohne Rückfahrtticket.
Später dann im Studium war ich ebenfalls nicht sonderlich reiselustig. Auf die Idee, ein oder zwei Semester im Ausland zu absolvieren, wäre ich damals erst recht nicht gekommen. Immerhin studierte ich ja schon in einem internationalen Hotspot: in der Megalopolis Würzburg. Für ein Landei wie mich war eine Stadt, die Straßenbahnen, eine Fußgängerzone und sechsstellige Telefonnummern hatte, lange Zeit das kosmopolitische Nonplusultra. Mit ein wenig Fantasie ist der fränggischee Zungenschlag des Wörzburchers sogar fast mit einer Fremdsprache gleichzusetzen. Aber mit einem Bocksbeutel Frankenwein im Schädel spricht man sie praktisch fließend.
Noch in meinem ersten Buch Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie habe ich über das Reisen geschrieben:
Albert Einstein wies in der allgemeinen Relativitätstheorie nach, dass die fundamentalen Wahrheiten der Natur von jedem Standpunkt aus vollkommen identisch sind. Das bedeutet, dass in einer zehn Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie die absolut gleichen physikalischen Gesetze gelten wie im Taunus. Und genau deswegen fahre ich auch so ungern weg. Weil Einstein gezeigt hat: Woanders ist es auch nicht anders.
Obwohl ich mich lange Zeit nie groß getraut habe, meine Heimat zu verlassen, brannte in mir schon immer ein unerklärliches Fernweh. Als ich fünf Jahre alt war, wurde ein paar Straßen von unserem Wohnhaus entfernt eine Fliegerbombe gefunden. Ein richtig großes Teil. Für die Räumungsaktion musste fast das gesamte Kaff evakuiert werden. Als ich in den Bus stieg, blickte mich ein Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks an und sagte: »Falls beim Entschärfen irgendetwas schiefgeht, könnt ihr wahrscheinlich nie wieder zurück.« Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so etwas wie Hoffnung gespürt. Die schönsten Erinnerungen meiner Kindheit waren die vierteljährlichen Einkaufstouren mit meinen Eltern nach Aschaffenburg. Für mich damals die deutsche Version der city that never sleeps. Zumindest waren die Geschäfte über Mittag offen.
Das absolute Highlight meiner Jugend erlebte ich mit zarten siebzehn Jahren. Ich nahm all meinen Mut zusammen und fuhr mit zwei Kumpels heimlich nach Frankfurt. Totaler Kulturschock! Wir gingen durch einen Park, als mir plötzlich unzählige gebrauchte Spritzen auffielen, die dort herumlagen. Ich weiß noch genau, wie ich bestürzt dachte: die armen Diabetiker … Im Bahnhofsviertel trauten wir uns dann sogar in einen Stripclub. Ich saß mit großen Augen in der ersten Reihe, nuckelte an meiner Cola für zehn Mark und fragte mich, ob sich wohl auf der Südhalbkugel die Stripperinnen an der Stange andersherum drehen als hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses prägende Erlebnis letztendlich der Grund war, weshalb ich Physik studiert habe.
Meine Frau Valerie ist komplett anders sozialisiert: österreichisches Bildungsbürgertum mit Sommerhaus am See und einem Abo bei den Salzburger Festspielen. Angeblich hat sogar Kaiserin Maria Theresia die Familie in den (zugegeben niedrigsten) Adelsstand erhoben. Gäbe es in Österreich noch die Monarchie, dürfte sich meine Frau »Edle von Kronstädt« nennen und wäre vermutlich befugt, den umliegenden Bauern allmonatlich den Zehnt abzupressen. Da diese Art der Einnahmequelle absurderweise aus der Mode kam, mussten die Familienmitglieder meiner Frau wohl oder übel anderen Erwerbstätigkeiten nachgehen. Ein Onkel von Valerie wanderte nach Amerika aus und wurde Ökonomie-Professor in Stanford, ihr zweiter Onkel leitete fast dreißig Jahre eine Zementfirma in Pennsylvania. Nach der Matura ging Valerie für ein Jahr als Au-pair nach New York und verbrachte seitdem immer wieder längere Aufenthalte in den Staaten.
»Du wirst die USA lieben«, sagte sie mir schon bald, nachdem wir im Jahr 2005 zusammenkamen. Und so fand ich mich also vier Jahre später, übermüdet und leicht nervös, mit ihr in einem der berühmten Yellow Cabs wieder, das uns vom JFK-Airport in unser Hotel unweit des Flat-Iron-Buildings in Midtown bringen sollte. Die vierzigminütige Taxifahrt dorthin führt durch Queens, den flächenmäßig größten Bezirk von New York City. Zum Vergleich: Queens hat die gleiche Ausdehnung wie Münster und besitzt in etwa auch den gleichen Glamourfaktor. Wenn Sie auf eine monotone Reihenhaus-Siedlung von zweihundertachtzig Quadratkilometer Größe stehen, dann ist Queens genau Ihr Ding.
»Hab ein wenig Geduld«, beruhigte mich meine Frau. Nach etwa acht Meilen auf der Interstate 495 fährt man eine leichte Anhöhe hinauf, und plötzlich – wie aus dem Nichts – taucht die Skyline von Manhattan auf. Diesen Moment werde ich wohl nie vergessen. Mit offenem Mund blickte ich vollkommen paralysiert auf diese Stadt. Ich wusste natürlich, dass New York groß ist. Aber so un-fucking-fassbar groß!!! Man stellt sich ja gern bestimmte Dinge in der Fantasie großartig vor, muss dann aber erkennen, dass sie in der Realität viel kleiner sind. Die Akropolis zum Beispiel. Oder die Liebe. Bei New York ist es genau umgekehrt. Aus zahllosen Filmen und Serien meint man diese Stadt zu kennen. Man glaubt, man wisse, wie groß die Dimensionen dort sind. Doch die Realität schlägt alles um Längen. Diese sechzehn Tage im Jahr 2009 haben buchstäblich meine Perspektive verändert. In vielerlei Hinsicht. Seitdem haben mich New York und Amerika in ihren Bann gezogen. Das Odenwälder Landei hatte Blut geleckt. Im Laufe der letzten zehn Jahre haben wir viel Zeit in den USA verbracht. Unsere Urlaube dort waren inspirierend und im wörtlichen Sinne bewusstseinserweiternd. Mehr und mehr wuchs in mir der Wunsch, dieses Land noch besser kennenzulernen.
Im Juli 2019 schließlich zogen wir nach New York. Geplant war ein ganzes Jahr. Aufgrund von Corona wurden es dann leider nur neun Monate. Von dieser Zeit handelt das Buch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
BROADWAY STATT JAKOBSWEG
Etwa ein Jahr vor unserem Abenteuer fuhr ich zu meinen Eltern in den Odenwald und erzählte ihnen von unserem Vorhaben, eine Zeit lang in New York zu leben. Fassungslos starrten sie mich an.
»Was willsch’n do?«, fragte mein Vater schließlich.
»Papa«, sagte ich, »weißt du, was Hundertjährige antworten, wenn man sie fragt, was sie im Rückblick am meisten bedauern? Fast alle sagen: Ich hätte in meinem Leben mehr riskieren sollen.«
Darauf er nur: »Wenn se mehr riskiert hätte, wär’n se aach net Hundert geworre …«
Meine ursprüngliche Motivation war, ein Jahr wegzugehen, um ein Sabbatical zu machen. Ich wollte einfach einmal raus aus dem ganzen Trott. Nach so vielen Jahren auf deutschen Bühnen wird selbst der aufregendste Job zur Routine. Pausenlos auf Tour, immer wieder dieselben Spielorte in denselben Theatern, hundertfünfzig bis zweihundert Tage im Jahr. Mittags losfahren, im Stau stehen, Ankunft auf den letzten Drücker, Soundcheck, kurz was essen, auf die Bühne, Show, Zugabe, Small Talk mit Fans, danach Einchecken im Hotel, noch ein wenig fernsehen, schlecht schlafen, gerädert aufwachen, ein wenig joggen, Mails checken, etwas essen und dann schon wieder los in den nächsten Stau. Sex, Drugs and Rock’n’Roll. Nur halt ohne Drogen, ohne Groupies und mit sehr wenig Musik.
2018 wurde ich fünfzig. Ein Lebensabschnitt, in dem man eine erste Bilanz zieht. Das Leben war gut zu mir gewesen, keine Frage. Vom Diplom-Physiker nach einem Zwischenstopp als Unternehmensberater auf die Comedy-Bühne. Als Wissenschafts-Kabarettist kann ich glücklicherweise alle Erfahrungen und erworbenen Fähigkeiten miteinander verknüpfen und letztendlich das tun, was mir am meisten Spaß macht: auf einer Bühne stehen, die Leute unterhalten und zum Nachdenken bewegen. Die Idee war, meinem Publikum wissenschaftliche Grundlagen mit den Gesetzen des Humors zu vermitteln, und das hat geklappt. Im Olympiastadion aufzutreten war nie mein Ziel, aber eine ausverkaufte Jahrhunderthalle in Frankfurt zur Premiere meines letzten Programms war ein tolles Gefühl. Seit 2012 moderiere ich das ARD-Format Wissen vor acht – Werkstatt, und es macht große Freude, sich mit Leib und Seele jeder noch so skurrilen naturwissenschaftlichen Frage zu stellen. Ich bin seit fünfzehn Jahren in einer glücklichen Beziehung, habe bewusst keine Kinder und wohnte bis zu meiner Abreise in einem schönen Haus in Frankfurt-Sachsenhausen. Alles in allem ein gutes und erfolgreiches Leben. Aber da muss doch noch was kommen …?
Klar, so denken viele Männer in meinem Alter. Unzählige Studien zeigen: In der Mitte des Lebens sinkt die Lebenszufriedenheit. Die üblichen Strategien zur Bewältigung einer männlichen Midlife-Crisis sind bekannt: Die einen lassen sich scheiden und fangen mit der achtundzwanzigjährigen Assistentin der Geschäftsleitung noch mal ganz von vorne an. »Hach, mit der Jennifer fühle ich mich zum ersten Mal richtig glücklich. Sie hat genau das, was mir die Irene nie geben konnte …«
Andere Männer bleiben bei ihrer Irene, beginnen aber, wie verrückt für einen Marathon zu trainieren. Oder noch schlimmer: für den Ironman. Ich habe die letzten fünfzehn Jahre in direkter Nähe der Laufstrecke des Frankfurter Ironman Germany gelebt. Und glauben Sie mir: Es ist definitiv nicht schön anzusehen, wie sich Männer meines Alters bei Gluthitze am Main entlangschleppen, um sich durch ein vierzehnstündiges Nahtoderlebnis endlich wieder lebendig zu fühlen.
Die dritte Gruppe der Fünfzigjährigen träumt von Entschleunigung. Ein weit gefasster Begriff, der von einem Meditationswochenende im Allgäu bis zum Beantragen der Frührente reicht. Der Wunsch nach weniger Hektik und einer besseren Work-Life-Balance ist groß. Im Frankfurter Westend legen sich gestresste Investmentbanker »Wohlfühlparkett« in ihre Penthouse-Wohnung, um zu Hause barfuß die Hektik auszuschließen. Rechtsanwälte in Hamburg-Eppendorf tragen am Wochenende Freizeitschuhe mit Masai Barefoot Technology. Ein Treter, dessen Sohle einer untergeschnallten Salatschüssel ähnelt und dazu führt, dass man sich schwappend durch die Gegend bewegt. Ein jämmerliches Bild, bei dem sich jeder stolze Massai-Krieger augenblicklich den Speer ins Herz stoßen würde.
Offenbar existiert bei vielen ein tiefes Bedürfnis, sich in einer effizienzgetriebenen Welt mit anstrengenden Sinnlosigkeiten zu beschäftigen. Nun, nach mehreren Wochen Shutdown und dem Legen eines Zwölftausend-Teile-Puzzles des ultramarinblauen Bildes von Yves Klein, haben wir eine grobe Vorstellung davon, wie sich das anfühlt.
In den letzten Jahren sprossen Bücher über Achtsamkeit, Downshifting, Slow Food und Stressreduktion aus dem Boden wie Pilze. Der Klassiker zum Thema ist zweifellos Hape Kerkelings Kriegstagebuch Ich bin dann mal weg. Ich habe es gelesen und muss zugeben: Ich war entsetzt. Die Vorstellung, mit tausend anderen mittelalten Mitteleuropäern in Multifunktionsjacken und Nordic-Walking-Stöcken durch Nordspanien zu latschen, um sich selbst zu finden, verursachte in mir Panikattacken. Oder wie Wolfgang Joop einmal meinte: »Selbstfindung ist Quatsch. Viele Menschen würden staunen, wie wenig da ist, wenn sie sich gefunden haben.«
Nach längerem Hin und Her kam ich zu der banalen Erkenntnis: Bei aller Routine und bei allem Stress der letzten zwanzig Jahre macht mir mein Job ja nach wie vor Spaß – großen Spaß sogar. Alles, was ich suchte, war ein wenig Abwechslung. Ich brauchte kein Sabbatical, sondern eine neue Herausforderung.
Und wo ist die Herausforderung als Comedian am größten? Wo muss man schneller, besser und smarter sein als alle anderen? Genau, in New York City – dem Mekka der Comedy-Szene. Raus aus der Komfortzone. Rein in den Trubel. Nach reiflicher Überlegung lautete mein Fazit mit fünfzig also nicht »Herunterfahren«, sondern »Beschleunigen«. Broadway statt Jakobsweg!
Zu meiner großen Freude war Valerie von der Idee begeistert. Wie es der Zufall wollte, las sie zu diesem Zeitpunkt gerade das Buch Magic Cleaning, ein Bestseller, geschrieben von der Japanerin Marie Kondo. Ihre Grundphilosophie lautet: Nehme jeden Gegenstand, den du besitzt, in die Hand, einen nach dem anderen, und frage dich bei jedem: Macht mich diese Bleikristallvase, dieser Suppenlöffel oder diese Puderquaste wirklich glücklich? Und wenn die Antwort »Nein« lautet: Weg damit! Als meine Frau das las, dachte sie kurz nach und sagte dann: »Lass uns unser Haus niederbrennen.«
Wir starteten unser New-York-Abenteuer tatsächlich nur mit zwei größeren Taschen. Keine Möbel, kein Übergepäck, kein unnötiger Firlefanz. Unser Haus in Frankfurt und fast unseren gesamten Hausstand haben wir vorher verkauft. Und – so viel sei schon mal verraten – wir haben während unserer gesamten Zeit in den USA nie auch nur ein einziges Stück vermisst.
Auch mein Management war von meinen Plänen angetan. »Da musst du auf jeden Fall ein Buch drüber schreiben!«, sagte meine Managerin.
»Waas?«, erwiderte ich etwas genervt. »Ich will doch nur mal ein bisschen New York genießen!«
»Aber du sagst doch gerade selbst, dass du keine Lust auf Entschleunigung hast. Broadway statt Jakobsweg und so … Übrigens: Das könnte ein guter Titel sein …«
Mit großem Aufwand und noch größerer Euphorie zogen wir nach New York. Aus einem anfangs angedachten Sabbatical entwickelte sich zunächst überraschend eine neue Chance. Vor Ort bekam ich die Gelegenheit, in Stand-up-Clubs zu spielen, zeitweise deutete sich sogar eine amerikanische Karriere an. Valerie und ich lebten uns in der Stadt ein, knüpften Netzwerke und Freundschaften, und genau in der Phase, in der unser amerikanisches Leben in vielversprechenden Bahnen lief, in der sich eine echte Perspektive abzeichnete, zerstörte das Virus unseren American Dream. Mitte März entschlossen wir uns, vorzeitig abzureisen. Mit wehenden Fahnen packten wir unsere Siebensachen und flogen kurz vor dem kompletten Shutdown zurück.
Ich wollte kein Sabbatical. Dann kam Corona und entschleunigte nicht nur mich, sondern die ganze Welt.
THE BIGGEST APPLE IN THE WORLD
Wir kamen am 10. Juli 2019 in New York an. Mitten im Sommer bei fünfundneunzig Grad Fahrenheit (was in etwa fünfunddreißig Grad Celsius entspricht) und unerträglichen neunzig Prozent Luftfeuchtigkeit. Ein paar Prozent mehr, und wir wären ertrunken – sozusagen die abgeschwächte Form von Waterboarding. Kein Wunder, dass New Yorker, die es sich leisten können, während der Sommermonate die Stadt verlassen. Die monatelange höllische Hitze und die damit verbundenen Gerüche einer Achtmillionenstadt machen das tägliche Leben dort zu einer echten Tortur. In der Subway ist es noch schwüler. Die einzigen Bewohner, die sich in diesem Chaos aus Lärm, Dreck, Gestank und Hitze wohlfühlen, sind vermutlich die Kakerlaken.
Wir stiegen am JFK-Airport in den J Train Richtung Manhattan ein und machten schon kurze Zeit später eine dieser typischen New-York-Erfahrungen: An der Station Alabama Avenue stieg ein Typ mit einer blau gefärbten Ratte auf seiner Schulter ein. Er schaute mich an, nahm das Tier in die Hand und schob es sich seelenruhig mit dem Kopf zuerst in den Mund. Nach etwa zehn Sekunden zog er die Ratte wieder heraus und setzte sie zurück auf seine Schulter. Dann nahm er sein Handy und begann – als wäre nichts gewesen –, ein Spiel zu daddeln. Während meine Frau und ich diese Szene wie paralysiert beobachteten, schien keiner der restlichen Fahrgäste auch nur Notiz davon zu nehmen. Jeder sah zwar, was da gerade vor sich ging, aber es schien, als ob alle dachten: Ach ja, da ist wieder der Typ, der sich sein blau gefärbtes Haustier in den Mund schiebt …
In der New Yorker Subway toleriert man fast jeden Irrsinn. Aber eben nur fast. Ein glatt rasierter Schimpanse mit einer Windel, der im Express Train nach Queens einen Platz beansprucht? Kein Problem. Ein glatt rasierter Schimpanse mit einer Windel, der sich im Express Train so hinsetzt, dass er dabei ZWEI Plätze beansprucht? No way. Dieser Affe würde von den Fahrgästen sofort verbal zurechtgewiesen werden. Denn in der New Yorker Subway gilt die unumstößliche Regel: nur einen Sitz pro Primat.
Wer in dieser Stadt einigermaßen schnell vorankommen möchte, kommt an der Subway nicht vorbei. Mit dreihundertachtzig Streckenkilometern und vierhundertzweiundsiebzig Stationen gehört sie zu den längsten und komplexesten Streckennetzen der Welt. Fast sechs Millionen Menschen benutzen sie täglich. Und zwar unabhängig von Einkommen, sozialer Schicht oder geistiger Gesundheit. Bei einer einzigen Fahrt bekommen Sie mehr Freaks zu Gesicht als in einem Jahr U-Bahn-Fahren in Frankfurt.
Für die ersten drei Wochen hatten wir über Airbnb ein kleines Apartment auf der Lower East Side gemietet. Wir stiegen an der Station Essex Street aus, schleppten uns ein paar Blocks weiter in die Pitt Street, holten den deponierten Wohnungsschlüssel in einem Grocery Store ab und bezogen schweißgebadet und übermüdet unser neues Reich. Die Wohnung war zu unserer großen Erleichterung sauber, komfortabel und ruhig. In der minikleinen Küche gab es sogar ein Fenster, was wir nach zwei Wochen herausfanden, als wir einen Blick hinter den Kühlschrank warfen. Dafür waren die Wände unglaublich dünn. Man konnte buchstäblich alles hören, was unsere Nachbarn so trieben. Das galt natürlich auch umgekehrt. Deswegen legten wir uns an unserem ersten Abend mucksmäuschenstill ins Bett, warteten, bis unsere Nachbarn ihr Apartment verließen, und bestellten ihnen dann drei Bücher über ihre Alexa.
In den nächsten Tagen erkundeten wir die Umgebung. Noch vor fünfzehn Jahren war die Lower East Side ein hochgefährliches Pflaster. Im Laufe der letzten Jahre entwickelte sie sich zu einer der lebenswertesten Ecken in Manhattan. Mit coolen Bars, hippen Barbershops, bezahlbaren Restaurants und den angesagtesten Tattoo-Läden der Stadt. Wer in der Lower East Side wohnt und nicht tätowiert ist, gilt als echter Freak. Tatsächlich habe ich kurz überlegt, mir die Heisenbergsche Unschärferelation auf den Oberarm stechen zu lassen. Aber das Risiko, dass der Tätowierer einen Fehler einbaut, war mir einfach zu hoch.
Überhaupt: In New York interessiert es keinen, wie, wann und mit was Sie auf der Straße herumlaufen. Meine Frau hat das sehr schnell verstanden. Bereits nach zwei, drei Tagen ist sie mit einer grässlichen neonfarbenen Trainingshose zum Einkaufen gegangen. »Du, das ist irrsinnig new-yorkisch«, erklärte sie mir. »Die ganzen Stars von der Upper East Side tragen das gerade auch.« Klar, dachte ich, aber nur jene, die gerade vom Drogenentzug kommen. Wenn du auf Cold Turkey bist, brauchst du halt was Legeres. Doch sie hatte recht. Modetechnisch gesehen ist diese Stadt tatsächlich lässig drauf. Wenn Sie frühmorgens einen verwahrlosten Bartträger vor dem Apple Store herumliegen sehen, dann wissen Sie nicht: Ist das ein Obdachloser aus der Bronx oder ein Hipster aus Brooklyn, der auf das neueste iPhone wartet?
Mich hat das am Anfang etwas überfordert. Besonders bei offiziellen Anlässen. Da ich in den letzten Jahren neben meinen Bühnentätigkeiten sehr viel als Vortragsredner für Universitäten, Verbände und Konzerne gebucht wurde, hatte ich mir bereits in Deutschland ein gutes amerikanisches Netzwerk aufgebaut. Aus diesen Kontakten ergaben sich immer wieder ein paar hochkarätige Einladungen. Gleich zu Beginn unserer Zeit in New York erhielten wir von der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer eine Einladung zu einem Charity-Ball. Dresscode »Festliche Abendgarderobe«. Jeder weiß, was das in Frankfurt, Wien, London oder Paris bedeutet: Smoking für den Herrn, Abendkleid für die Dame. In New York bedeutet es, dass man nicht im Jogginganzug erscheint. Alles andere knapp darüber ist okay. Auch auf Förmlichkeiten und Titel gibt man nichts. In Österreich ist man ja automatisch »die Frau Doktor«, wenn der Mann einen Doktortitel hat. Ich glaube, insgeheim nimmt es mir Valerie übel, dass ich nicht promoviert habe.
In den USA herrschen allgemein lockerere Umgangsformen. Auf einer New Yorker Party kann es Ihnen passieren, dass Sie von einem Typen in Jeans und Turnschuhen mit »Hi, I’m Phil« angesprochen werden – und später stellt sich heraus, dass »Phil« der Hausmeister, der Gastgeber oder der Gouverneur von New Jersey ist. Für Europäer ist das verwirrend.
Einmal war ich bei einer Museumseröffnung auf Long Island für eine Rede gebucht. Ich mietete ein Auto, und als ich am Veranstaltungsort vorfuhr, warf ich dem älteren Herrn, der dort im Eingangsbereich herumlungerte, lässig meine Schlüssel zu. Ich dachte, es wäre der valet parking guy, denn in den USA ist es durchaus üblich, dass man bei solchen Anlässen sein Auto parken lässt. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem älteren Herrn um den Presseattaché der US-Streitkräfte handelte. Und er parkte tatsächlich meinen Wagen! Wahrscheinlich dachte er, bei uns Deutschen sei das Übergeben der Autoschlüssel eine offizielle Kapitulationserklärung.
Unter Amerikanern haben die New Yorker nicht den besten Ruf. Sie gelten als hochnäsig und unfreundlich. Ich denke, das stimmt nicht. New Yorker scheren sich einfach um niemanden. Jeder lässt den anderen so sein, wie er ist. Das wird ihnen oft als Ignoranz ausgelegt. Doch in einer Stadt, in der so viele Menschen auf dichtestem Raum zusammenleben, ist Ignoranz nicht die schlechteste Strategie.
Gleichzeitig haben New Yorker ein sehr ausgeprägtes Gespür für Fairness und Gerechtigkeit. Versuchen Sie einfach mal, sich bei Dunkin’ Donuts an der Schlange vorbeizuschmuggeln … Wer sich in dieser Stadt wie ein Idiot aufführt, bekommt die verbale Härte der New Yorker gnadenlos zu spüren. In der Warteschlange sind alle gleich.
Viele Promis schätzen diesen Lifestyle. Während ihnen in Los Angeles ständig die Paparazzi an den Hacken kleben, können sie sich in Manhattan vollkommen unbehelligt bewegen. Unter New Yorkern gilt es nämlich als absolut uncool, vor Ekstase auszurasten, nur weil der Typ, der vor einem auf seinen Kaffee wartet, zufälligerweise zwei Oscars gewonnen hat. Auch das war anfangs eine neue Erfahrung. Als mir zum ersten Mal Uma Thurman in einem Bagel-Laden die Tür aufgehalten hat, habe ich sie noch wie ein verstörtes Reh im Lichtkegel angeschaut und mir wie ein naiver Teenager den Sabber vom Mund gewischt. Ein paar Wochen später traf ich bei einem Besuch in der Frick Collection, einem kleinen Museum in der Upper East Side, auf Paul McCartney und benahm mich schon etwas entspannter. Genauer gesagt, täuschte ich einen Hustenanfall vor, um mir den Sabber vom Mund zu wischen. Als ich kurz darauf im Central Park abermals Uma Thurman begegnete, schaute ich schon – ganz new-yorkisch – desinteressiert zur Seite. Kurz hatte ich sogar den Verdacht, dass sie mich stalkt.
Unser kleines Airbnb-Apartment war nur bis Ende Juli gemietet. Ab August brauchten wir folglich eine richtige Wohnung. Das erwies sich komplizierter als gedacht. Gute Wohnungen gibt es in dieser Stadt oft nur mit Beziehungen. Zwar hängen überall an den Häusern Schilder mit »Apartments for Rent«, aber wenn Sie dort anrufen, verlangen die Vermieter bis zu neun Empfehlungsschreiben. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir in der Stadt noch nicht einmal neun Leute.
Um in Manhattan zu wohnen, brauchen Sie in erster Linie Geld. Viel Geld. Im Grunde gibt es drei große soziale Schichten: wohlhabend, reich und superreich. Wenn Sie ein vierzig Quadratmeter großes Wohnklo in Midtown kaufen wollen, brauchen Sie unter einer Million gar nicht erst anzufangen. Und wenn Sie Pech haben, dann meint der Makler vierzig square feet, was in etwa der Grundfläche eines Doppelbettes entspricht. Mit dem metrischen System stehen die Amerikaner ja bekanntlich auf Kriegsfuß.
Eine Million Dollar für vierzig Quadratmeter – dafür kriegen Sie im Odenwald ein ganzes Dorf. Oder in Zürich einen sehr schönen Tiefgaragenplatz. Die Mietpreise in New York sind genauso absurd. Wir spielten mit dem Gedanken, nichts zu mieten und stattdessen alle vier Wochen eine Monatskarte für die Subway zu kaufen, um das Jahr komplett im öffentlichen Nahverkehr zu verbringen. So traurig das ist, aber genau das tun tatsächlich viele Menschen. Weil die Mietpreise und Lebenshaltungskosten in dieser Stadt so absurd hoch sind, fallen viele durch das soziale Raster. Die Obdachlosenquote ist dramatisch. Bereits vor Corona lag die offizielle (und wahrscheinlich deutlich zu niedrig angesetzte) Zahl bei etwa achtzigtausend Menschen. Die sogenannte Stay-at-home-Order klingt für sie wie blanker Hohn. Viele obdachlose Menschen liegen zusammengekauert in den U-Bahnhöfen. Besonders in der Lower East Side – einem Stadtteil, der von den Touristenströmen verschont wird – ist das trotz der hippen Bars und coolen Barbershops an allen Ecken sichtbar.
Das war dort immer schon so. Als vor rund einhundertfünfzig Jahren die erste große Einwanderungswelle begann, wurden in der Lower East Side schnell primitive Wohnhäuser, sogenannte tenements, für die armen und einfachen Menschen gebaut. Die Neuankömmlinge wurden zu sechst in ein Zimmer gepfercht. Um 1900 lebten zwei Drittel der Einwohner in diesen Unterkünften. Es war dreckig und laut, und die Leute versuchten alles, um möglichst schnell von dort wegzukommen. Sie arbeiteten hart und zogen schließlich in etwas bessere Wohnungen in die Bronx. Aber auch dort war es immer noch dreckig und laut, sodass die Kinder und Kindeskinder der Einwanderer noch härter arbeiteten, um schließlich in die Vororte zu ziehen. Dort konnten ihre Kinder in einer sauberen und ruhigen Gegend aufwachsen. Doch die wiederum hassten die sterile Langeweile der Vororte. Und so zogen die Ur- und Ururenkel der ersten Einwanderer wieder zurück in die dreckige und laute Lower East Side, um sich dort zu sechst eine überteuerte Mietwohnung zu teilen.
Wie auch immer: Wir hatten großes Glück und fanden schließlich tatsächlich eine Wohnung, wenn auch nicht ganz ohne Beziehungen. Unsere Airbnb-Vermieterin Maria legte bei einem befreundeten Hausbesitzer ein gutes Wort für uns ein. Und so stellten wir uns, bewaffnet mit einem Blumenstrauß und einer Schachtel Pralinen, an einem Sonntagmorgen bei ihm vor. Etwas nervös versuchte ich mich im Small Talk und setzte voll auf die Komiker-Karte: »Wissen Sie, ich bin Deutscher, und meine Frau ist Österreicherin. Das ist sozusagen das genaue Gegenteil von Adolf Hitler und Eva Braun … verstehen Sie? Da war ja sie die Deutsche und er …«
»Halt den Mund!«, zischte mir Valerie zu und stieß mir kräftig in die Rippen. Auch der Vermieter, Mr Moishe Glickstein, fand meinen Vergleich nicht ganz so originell. Lange musterte er mich und sagte dann mit Grabesstimme: »Ich kann Ihnen für dreitausend Dollar im Monat meine fensterlose Kellerwohnung anbieten. Gerade Ihre Frau müsste sich als Österreicherin dort sehr wohlfühlen …« Betreten schauten Valerie und ich zu Boden. Worauf er plötzlich in schallendes Lachen ausbrach. »Nur ein Witz! Ihr könnt gerne die Wohnung im vierten Stock haben. Hier sind die Schlüssel …«
Wahrscheinlich gibt es wenige Orte auf der Welt, die ähnlich herausfordernd sind wie New York City. Der Lärm, der Geruch, die hohen Kosten, die extremen Temperaturen, das ständige Aufeinandertreffen der unterschiedlichsten Kulturen und sozialen Schichten, der Touristen-Irrsinn am Times Square, die Präsenz von Verrückten aller Art, von armen Teufeln, die emotional zerstört und schreiend an jeder fünften Straßenecke stehen – all das ist körperlich und seelisch extrem kräftezehrend.
Ich kann verstehen, dass dieser tägliche Irrsinn für viele nicht infrage kommt. Der Druck ist so unglaublich hoch, dass nicht wenige der Stadt den Rücken kehren. Seit einigen Jahren hat New York die höchste Nettoabwanderungsrate von allen amerikanischen Metropolregionen. Zwischen 2013 und 2017 hat die Stadt vierzigtausend Millennials verloren. Besonders junge Familien mit Kindern hatten in den letzten Jahren immer mehr Probleme, finanziell über die Runden zu kommen. Sie zogen vermehrt in den Sonnengürtel nach Texas, Florida oder Arizona: Bundesstaaten mit besserem Wetter, niedrigeren Steuern und deutlich weniger Hektik. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Chance, in New York Geld zu verdienen, sogar noch richtig gut war. Die Arbeitslosenzahlen lagen vor der Pandemie auf einem historischen Tief, und die Konjunktur brummte.
Auch ich muss zugeben: Es gab immer wieder Tage, an denen wir in unserer kleinen Wohnung erschöpft auf dem Bett lagen und uns fragten, ob es das alles wirklich wert war. Doch dann rissen wir uns zusammen, gingen raus und waren augenblicklich von der Stadt gefangen. Immer wieder ließen wir uns von ihr aufs Neue verführen und faszinieren.
Barcelona, Paris oder Lissabon sind wunderschön. Aber keine dieser Städte hat auch nur halb so viel Energie wie New York an seinem langweiligsten Tag im Jahr. Du willst einen Oscarpreisträger auf der Theaterbühne sehen? Dann auf zum Broadway! Du sehnst dich nach einem romantischen Waldspaziergang? Der Central Park ist nur vier Stationen entfernt. Oder ein Tag am Strand? Nimm den F Train nach Coney Island. Vielleicht möchtest du nachts um drei noch ein Wiener Schnitzel? Drei Querstraßen weiter, und der Tisch ist gedeckt.
Ironischerweise ist New York durch die Eroberung der Briten nach einem der ödesten Orte Großbritanniens benannt: York, ein stinklangweiliges Kaff im Nordosten von England. Ursprünglich hieß New York »New Amsterdam«, was dem Ganzen schon näher kam. Damals wie heute ist Amsterdam eine der aufregendsten Städte Europas. Im Bundesstaat New York gibt es übrigens auch heute noch eine Stadt namens Amsterdam, ein stinklangweiliges Kaff circa hundertfünfzig Meilen nördlich von New York City. Vom Glamourfaktor müsste Amsterdam / NY daher eigentlich New York heißen, und New York City hätte den Namen New Amsterdam behalten müssen.
Als im Jahre 1626 niederländische Seefahrer den ansässigen Indianern dieses Stück Land für gerade mal sechzig Gulden abgekauft haben, war alles andere als klar, dass auf diesem Grund einmal eine der schillerndsten Metropolen der Welt entstehen sollte. Was allerdings damals klar war: Städte haben die Menschen schon immer magisch angezogen. Seit jeher waren sie Orte der Hoffnung und der kulturellen Vielfalt. Die Moderne hatte dort ihren Anfang. Sie waren die Wiege der Demokratie, der Philosophie und der Industriellen Revolution. Je städtischer eine Gesellschaft wurde, desto mehr verdrängten soziale Aufsteiger mit neuen Ideen und Tatkraft die alten feudalen Eliten. Plötzlich entstanden Konkurrenz, Unternehmergeist, Risiko und Wettbewerb. Die Schichten mischten sich untereinander. Mit Handel und Handwerk brachten sich die Menschen freiwillig in Abhängigkeiten, und das wiederum förderte Kreativität, Wissenstransfer, Toleranz und Innovation. Und nicht zuletzt: Rücksichtnahme. Das französische Wort »politesse« bedeutet »Höflichkeit« und kommt ursprünglich von dem griechischen Wort für Stadt: »polis«. Stadtbewohner zeichneten sich also durch Höflichkeit aus. Was man von heutigen Politessen nicht behaupten kann.
Die Dynamik von Städten beruhte schon immer auf ihrer Vielfalt. Und auf der Zahl der positiv Verrückten, die in der Stadt leben. »Stadtluft macht frei«, hieß es bereits im Mittelalter. Das Wahrzeichen New Yorks, die Statue of Liberty, gilt, wie kein anderes Bauwerk, als Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit und den American Way of Life. Vielleicht war es genau diese Symbolik, die mich so gefangen nahm. Der Drang nach Selbstbestimmung, der Antrieb, Neues kennenzulernen, waren bei mir schon immer stärker als mein Bedürfnis nach Sicherheit und die Angst vor Unbekanntem. Mein Vater hat über die Hälfte seines Arbeitslebens einen Job gemacht, den er insgeheim hasste. Und das nur, weil er sich davor fürchtete, eine Stelle anzunehmen, die ihm viel besser gefiel, für die er allerdings in die nächste Stadt hätte fahren müssen. So ein Leben wollte ich nie führen.
GERMANGRÜNDLICHKEIT
So aufregend das Leben in einer Stadt wie New York ist, manche Dinge können einen dort zum Wahnsinn treiben. Jeder Deutsche, der eine Zeit lang drüben gelebt hat, vermisst nicht unbedingt deutsches Schwarzbrot – er vermisst die deutsche Ingenieurskunst. Es ist schon unglaublich. Diese Nation ist zum Mond geflogen. Amerikaner haben die Wasserstoffbombe, den Herzschrittmacher und die Glühlampe erfunden – aber die Mischbatterie bei Badarmaturen ist an diesem Land vollkommen vorübergegangen. Wenn Sie sich in einem amerikanischen Badezimmer die Hände waschen wollen, können Sie wählen zwischen Verbrühen oder Schockfrosten.
Als wir in unsere neue Wohnung eingezogen sind, habe ich Mr Glickstein etwas irritiert gefragt, ob es denn keinen Regler an der Heizung gäbe, um im Winter die Raumtemperatur einzustellen. »Of course«, meinte er fröhlich, »we call it window!« Jedes Mal, wenn wir unseren Gasherd aufdrehen wollten, brauchten wir das Fingerspitzengefühl eines Uhrmachers. Noch schlimmer war unsere Dusche. Denn »Wasserdruck« ist ein Wort, das im Amerikanischen anscheinend nicht existiert.
Auch mit elektrischem Strom geht der Amerikaner sehr unbedarft um. Zum Beispiel verlegt man die Leitungen konsequent über Putz. Wobei »verlegen« eigentlich zu viel gesagt ist. Man tackert oder klebt die Kabel lieblos an die Wand. Das Drahtende wird meist nicht mit einer Lüsterklemme abgesichert, weil es anscheinend auch dafür kein englisches Wort gibt. Das wiederum hat zur Folge, dass an vielen Häusern die Stromkabel zwanglos und völlig unisoliert aus der Wand ragen. Daher war unser Badezimmer auch mit dickem Teppich verlegt, damit der regelmäßige Stromschlag, den man sich beim Rasieren oder Föhnen holte, wenigstens nicht tödlich verlief.
All das stört Amerikaner nicht besonders. Warum auch? Sie kennen es ja nicht anders. Ich jedoch habe bereits nach wenigen Wochen gemerkt, wie »deutsch« ich in dieser Hinsicht bin. In grenzenloser Naivität ging ich davon aus, dass das stufenlose Regulieren der Wassertemperatur kein massives Problem für die größte Militärmacht der Welt darstellen sollte. Ich sollte mich irren.
Was die Erfindung und Entwicklung von technologischen Dingen angeht, sind wir Deutschen zwar nicht ganz so wagemutig wie die Amerikaner, doch unser Bestreben, Fehler zu vermeiden und stattdessen alle Probleme im Voraus zu durchdenken, hat eben auch positive Aspekte. Nicht umsonst hat uns die typisch deutsche Gründlichkeit zu Weltmarktführern in Küchenmaschinen, Duscharmaturen und Zylinderkopfdichtungen gemacht. Und wer es noch nicht wusste: Es waren deutsche Maschinenbauer, die die Spaßbremse entwickelt haben. Und sie funktioniert immer noch fehlerfrei.
In den USA sind diese deutschen Tugenden hoch angesehen. Immer wieder kam es vor, dass mich Amerikaner auf meinen Landsmann Dirk Nowitzki angesprochen haben. Nowitzki wurde durch deutsche Gründlichkeit zum amerikanischen Helden. 1998 ging der Würzburger Basketballer als totaler Nobody zu den Dallas Mavericks und spielte dort bis zu seinem Karriereende im Jahr 2019. Und das, obwohl er im Laufe seiner Karriere wesentlich lukrativere Angebote von anderen Clubs bekam. Zusammen mit seinem Jugendtrainer Holger Geschwindner, der mithilfe von mathematischen Formeln sogar den idealen Wurf berechnete, hat er zwanzig Jahre lang mit typisch deutscher Tüftelei und Akribie sein Spiel immer weiter perfektioniert. Anfangs belächelten die Amerikaner seine unorthodoxen Methoden und bezeichneten diesen rational-berechnenden Ansatz als Unfug. Nowitzki nahm es mit Humor und betitelte daraufhin seine Trainingsräume tatsächlich als »Institut für angewandten Unfug«.
Doch seine Erfolge sprechen eine deutliche Sprache. 2007 wurde Nowitzki als erster Europäer überhaupt zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison gekürt, 2011 gewann er mit Dallas die Meisterschaft. Mit über einunddreißigtausend erzielten Punkten gehört er zu den sieben besten Korbjägern der NBA-Geschichte. Letztes Jahr wurde in Dallas sogar eine Straße nach ihm benannt.
Es ist diese Mischung aus Bescheidenheit, Fleiß und Loyalität, die die Amerikaner an »Dirkules« so bewundern. Ich bin mir sicher, inzwischen könnte der NBA-Star in einem texanischen Supermarkt ein altes Mütterchen erschießen, und die Leute würden sagen: »Na ja, da hat er vielleicht ein bisschen überreagiert. Aber hey, der Mann ist über vierzig und trifft immer noch. Aus fünfzehn Metern! Wenn es um Präzision geht, ist auf die Deutschen eben Verlass …«
Es gibt in den USA noch einen anderen deutschen Superstar, der bei uns relativ unbekannt ist: Eckhart Tolle. Tolle wurde in Lünen geboren, aber in Amerika wurde er zum spirituellen Weltstar. Sein erstes Buch The Power of Now stand ewig auf Platz eins der New-York-Times-Bestsellerliste. Seitdem füllt er mit seinen Vorträgen in ganz Nordamerika riesige Hallen. Mein Kollege Eckart von Hirschhausen hat mal über ihn gescherzt: »Tolle lehrt kurzgefasst: Lebe jetzt. Aber das auf Englisch und mit einem so starken deutschen Akzent, dass die Amerikaner ihn umso mehr lieben, weil sie denken: Das ist Buddhismus plus deutsche technische Überlegenheit.«
Wir Deutsche sind eben fasziniert davon, den Kern einer Sache zu durchdringen. Das hat uns auch in der Wissenschaft sehr weit gebracht. Es waren deutsche Physiker, die vor einhundert Jahren herausgefunden haben, dass Licht sowohl eine Welle als auch ein Teilchen ist. Weil wir wissen wollten, was genau »Licht« ist. Deswegen hat Max Planck die Quantenphysik entwickelt, Thomas Alva Edison dagegen nur die Glühlampe. Zugegeben, ohne ihn müssten wir wahrscheinlich bis zum heutigen Tag Netflix bei Kerzenlicht schauen.
Die deutsche Mentalität ist zutiefst geprägt von Goethes Faust. Wir wollen verstehen, was genau die Welt im Innersten zusammenhält. Eine technische Erfindung, die diese Herangehensweise am klarsten auf den Punkt bringt, ist der sogenannte Flachspüler. Eine Toilettenschüssel, die im Volksmund auch als »Kackrampe« bezeichnet wird. Wie Sie vielleicht wissen, haben Toilettenschüsseln unterschiedliche Konstruktionsprinzipien. In Frankreich beispielsweise ist das Abflussrohr der Schüssel meist ganz hinten angebracht. So verschwindet alles, was man an festem Material produziert, sofort in den Tiefen des Raums. Im angloamerikanischen Raum befindet sich das Loch meistens in der Mitte und ist mit Wasser gefüllt. Dadurch bekommen Sie bei jedem großen Geschäft ein feuchtes Feedback. Im Fachjargon heißt diese Toilettenschüssel: Tiefspüler. In Deutschland hat die Kunst der Toilettenarchitektur eben zu der bemerkenswerten Entwicklung des Flachspülers geführt. In einem Flachspüler ist das Loch vorne angebracht, so dass das große Geschäft eben nicht sofort ins Wasser fällt. Nein! Es gleitet elegant auf die eigens konstruierte Kackrampe und kommt dort in seiner vollen Pracht zum Erliegen. Jedes Mal, wenn ich einem Amerikaner von der Funktionsweise des Flachspülers erzählt habe, erntete ich verständnisloses, angeekeltes Kopfschütteln. Ein New Yorker Bekannter lud uns daraufhin sogar nicht mehr ein. »Wer solche Toiletten herstellt, ist zu allem fähig«, sagte er ernst.
Der Philosoph Slavoj Žižek hat sich bereits vor mehreren Jahren über dieses Phänomen Gedanken gemacht. Žižek ist davon überzeugt, dass der eigentliche Grund für das unterschiedliche Toilettendesign in unseren historischen und kulturellen Wurzeln liegt. Nehmen Sie zum Beispiel unsere französischen Nachbarn. Franzosen sind stark geprägt durch die Französische Revolution. Dort hieß es im Wesentlichen: Kopf ab und weg damit. Klassische Problemverdrängung, wenn Sie so wollen. We don’t give a shit.
Die angloamerikanische Mentalität dagegen ist deutlich pragmatischer und rationaler. »Lass den Gedanken doch erst einmal sinken …« Deswegen: Loch in der Mitte, kurzes Feedback – danach ein rascher Druck auf die Taste, und das Problem ist gelöst.
Die deutsche Philosophie ist wesentlich geprägt durch den Gedanken der Metaphysik. Das Land der Dichter und Denker: »Lass uns die Dinge ganz genau betrachten. Aus allen Perspektiven. Mit all unseren Sinnen. Vergiss die Lösung, es ist das Problem, das zählt!« Der Flachspüler ist das in Porzellan gegossene Manifest der deutschen Seele.
Bevor wir Deutsche irgendein Gerät oder eine Maschine entwickeln, wollen wir zunächst einmal das theoretische Konzept dahinter verstehen. Erst dann beginnen wir mit der Arbeit. Die amerikanische Herangehensweise ist anders. Amerikaner probieren gleich mal etwas aus, und wenn es dann nicht funktioniert, fragen sie sich nach den Gründen und verbessern das Ganze. Das führt zwar dazu, dass amerikanische Firmen ihre Apps, Geräte und Maschinen sehr schnell auf den Markt werfen, aber im Gegensatz zu deutschen Produkten funktionieren sie eben oftmals nur so lala. Bei einem früheren USA-Urlaub haben wir drei Wochen lang in einem Haus in Florida gewohnt, in dem man die Mikrowelle anmachen musste, um das Garagentor zu öffnen.
Wir Deutschen haben eine große Liebe zur Präzision, zum exakten Messen und zum akribischen Berechnen. Immer, wenn wir von amerikanischen Bekannten »so gegen acht Uhr« zu einer Party eingeladen wurden, war deren Irritation sehr groß, weil wir präzise wie ein Uhrwerk zwischen 7:59 Uhr und 8:01 Uhr an der Tür geklingelt haben. Valerie meinte dann im Scherz: »Vince ist Physiker und hat seine heiß geliebte Atomuhr aus Deutschland mitgebracht. Die steht jetzt bei uns in der Küche, haha.« Und an der Reaktion unserer Gastgeber war jedes Mal ersichtlich, dass sie ihr die Story zu hundert Prozent glaubten.
»Ihr Deutschen seid auf so niedliche Art und Weise korrekt«, hörte ich immer wieder von Amerikanern. Wahrscheinlich haben sie recht. Als Christian Wulff noch Bundespräsident war, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Vorteilsnahme eröffnet, in dem es um den skandalösen Betrag von 753,90 Euro ging. Selbst bei der Korruption sind wir Deutschen irgendwie anständig und präzise.
Als US-Politiker müssen Sie – wenn überhaupt – erst dann zurücktreten, wenn es um Milliardenbeträge geht, wenn Sie Kernwaffen an verfeindete Nationen schmuggeln oder noch schlimmer: Wenn Sie Ihre Frau betrügen. Letzteres wiederum ist in Deutschland kein Rücktrittsgrund. Es ist sogar so, dass ein Bundestagsabgeordneter sein Mandat noch nicht einmal aberkannt bekommt, wenn er seine Frau umbringt. Aber wenn er einen Funken Anstand hat, wird er sein Mandat natürlich niederlegen. Andererseits, wie viele Funken Anstand besitzt ein durchschnittlicher Frauenmörder …
Richard Nixon ordnete heimlich Bombardierungen in Kambodscha an, spionierte illegal seinen politischen Gegner aus und belog den Kongress darüber, bevor er zurücktrat. Bei uns reichen 753,90 Euro, um politisch erledigt zu sein. Wenn die Buchhaltung nicht stimmt, verstehen wir Deutschen eben keinen Spaß.
Solange ich in Deutschland lebte, habe ich diesen Hang zur deutschen Gründlichkeit immer ein wenig abfällig bewertet. Aus der Ferne jedoch sehe ich die Sache inzwischen etwas anders. Denn sobald man in den USA etwas reparieren, installieren, befestigen oder anschließen muss, fangen die Probleme an, und mein Blutdruck steigt auf 150/95 Millimeter Quecksilbersäule. Schon allein damit kann der Amerikaner nichts anfangen, denn so etwas Absurdes wie Millimeter sind ihm unbekannt. Jeder Stecker, jede Schraube, jede Mutter hat eine willkürliche Länge, Breite oder Dicke. Wenn Sie in einem amerikanischen Baumarkt eine simple Holzleiste von exakt 13,74 892 Zentimetern Länge kaufen wollen, verzweifeln Sie. Stattdessen müssen Sie sich mit Füßen, Zoll und Meilen herumärgern. Außerdem gibt es ounces und pounds