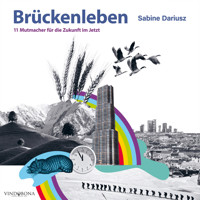23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vindobona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sollen wir zuerst das System oder uns selbst ändern? Diese Frage stellt sich erst gar nicht. Die Kunst besteht nämlich darin, das Richtige im Falschen zu tun. Wie uns das gelingt? Mit Strategien, die die Spannungen überbrücken. Brückenleben erzählt die berührenden Geschichten von 11 Menschen und ihren Herzensprojekten. Am Ende der Lektüre wissen Sie nicht nur über Wohnwagons, E-Learnings, Pay-as-you-wish-Restaurants, Windkraft, Textilproduktion, Lebensmittelrettung, Integrationsgesetze, Gemeinwohl-Ökonomie und Good-Impact-Journalismus Bescheid, Sie sind auch um 21 Strategien reicher, wie Sie selbstwirksam werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 Vindobona Verlag
ISBN Printausgabe: 978-3-903574-62-5
ISBN e-book: 978-3-903574-63-2
Lektorat: Petra Männel
Umschlaggestaltung: Karoline Golser unter Verwendung von Bildern auf pixabay.com
Layout & Satz: Vindobona Verlag
Innenabbildungen:
Bild 1, 3, 4, 5, 7, 8 © Sabine Dariusz
Bild 2 © rupertpessl.com
Bild 6 © Fotografie Carolin Bohn
Bild 9 © Verena Nussbaum
Bild10 © Daniel Zangerl
www.vindobonaverlag.com
Prolog
Ich hatte ihm nicht geglaubt. Jürgen wollte Modedesigner werden. Ich hielt das für aussichtslos. Das habe ich ihm zwar nie gesagt, er muss aber meine Skepsis gespürt haben. So etwas kann man schlecht verbergen. Jürgen ließ sich von den Zweiflern rund um ihn jedoch nie beirren. Die Textilindustrie ging in Österreich gerade endgültig den Bach hinunter und die Haute Couture war ohnehin in Paris und Mailand zu Hause. Seine Unbeirrbarkeit irritierte mich. Einmal wollte ich ihm helfen, und als mir die Naht nicht gelang, nahm er sie mir aus der Hand und sagte amüsiert und kein bisschen böse: „Gib her, lass mich das machen!“ Immer nahm er seine Sache selbst in die Hand. Während ich herumsuchte, was aus mir werden sollte, nähte er gefühlt Tag und Nacht in seiner kleinen Wohnung. Die meisten seiner Aufträge waren für Werbezwecke. Immerhin ließ sich mit Promotion Geld verdienen. Jahr für Jahr finanzierte er sich damit seine eigene Kollektion. Heute hat er einen Showroom auf der Wiener Ringstraße, gleich schräg vis-à-vis der Staatsoper.
Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich über die Ringstraße zwischen all den Menschen gehe, die im Gegensatz zu mir keine Ahnung haben, wer JCH – nämlich Jürgen Christian Hörl – ist oder woher er kommt. Gleichzeitig fühle ich mich bei meinen pessimistischen Gedanken ertappt, die ich als Jugendliche hegte. Mein Weg verlief ganz anders als seiner und führte nicht über die Mode. Er führte mich über die Wissenschaft, die Analyse und andere Formen der Praxis. Sie haben mich zu dem geschliffen, was ich heute bin. Nicht mehr suchend pessimistisch und auch nicht überschwänglich optimistisch – was mich zwischendurch auch überfiel. Gerne möchte ich behaupten: gesund realistisch. Aber wer ist das schon vollständig?
Wenn Jürgen heute von Journalisten nach den Herausforderungen der Modebranche gefragt wird, spricht er die Problematiken an, die Fast Fashion und Online-Shopping nach sich ziehen. Beide scheinen wir der Auffassung zu sein, dass wir Kleidung brauchen, die wir länger tragen, dass wir unseren Ressourcenverbrauch und das Verkehrsaufkommen aufgrund der Zustellservices in den Griff bekommen müssen, wenn wir den Planeten nicht zugrunde richten wollen. Ich nehme an, dass Jürgen seine Rolle als Wiener Designer in der globalisierten Textilbranche gut einordnen kann. Mit seinen Maßanfertigungen kann er nicht alle Probleme lösen. Dennoch: Ihm ist etwas Erstaunliches gelungen. In einer für Langsamkeit und Qualität unwirtlichen Welt führt er uns einen achtsamen Umgang mit Materialien vor Augen. Er ist beharrlich und ausdauernd in seiner Absicht, sich gegen den Mainstream zu behaupten. Und genau darum geht es in diesem Buch.
In der Realität läuft tatsächlich vieles schief. Nun könnten wir die Liste mit unseren Unzufriedenheiten ins Unendliche fortsetzen. Das tue ich nicht mit Ihnen. Auch wenn das gerüttelt Maß an Unsinn in dieser Welt nicht wegzureden ist, ich hatte mich geirrt. Heute sehe ich es vielmehr so: Wir alle stehen ständig in einem Spannungsfeld – in dem Spannungsfeld zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein könnte – ja, wie sie punktuell auch ist. Der springende Punkt inmitten des Chaos und der Unübersichtlichkeit ist: Resignieren wir vor den Widersprüchen oder schlagen wir eine Brücke dorthin, wo wir sein wollen? Stellen Sie sich vor, sie stehen auf einem Standbein fest in der Realität verankert – samt den Kompromissen, die Sie nicht gerne mögen. Dann haben Sie immer noch ein Spielbein frei, mit dem Sie in die Welt hinübertreten können, die Sie sich wünschen. Sie können gestalten, ganz ohne Ihre Existenz zu riskieren. Diese Strategie ist nicht übermütig, nicht resignierend und ihre Wirkung nicht von der Hand zu weisen. Warum fällt es uns dann so schwer? Warum packen wir nicht öfter an?
Die folgenden Sätze sind für diejenigen unter Ihnen, die theoretische Begründungen mögen. Die Praxisliebhaberinnen und -liebhaber springen zu den Kurzzusammenfassungen auf Seite 15, letzter Absatz.
Eine Antwort lautet: weil wir die Kritik kultivieren. Bisweilen finden wir sie geradezu chic. Mit der kritischen Perspektive können wir allerdings rasch in eine Aussichtslosigkeit geraten. Als ich zu studieren begann, besuchte ich die Vorlesungen eines Wiener Philosophen. Er brachte uns Studierende regelmäßig zum Lachen, und ich konnte seinem Vortrag gut folgen. Eines Tages stand ein höhersemestriger Student am Hörsaaleingang und belehrte uns Jüngere, dass wir auf die Oberflächlichkeit des Professors hereinfallen würden. Ich begann, an mir zu zweifeln. War ich zu leichtgläubig? Bedeutete intellektuell zu sein, womöglich kritisch zu sein, im Sinne von vernichtend kritisch zu sein? Einige Semester lief ich mit diesem Eindruck durch die Welt und ließ kaum an irgendetwas ein gutes Haar. Doch glücklicherweise lernte ich, professionell zu zweifeln. Eben dieser Professor wie auch andere, haben es mich gelehrt. Dadurch wurde ich zwangsläufig optimistischer. Denn nichts auf der Welt ist totalitär. Wirklich nichts. Das wäre ein grober Denkfehler. Was aber schon der Fall ist, ist, dass wir Denkfehlern gerne aufsitzen.
Beliebte Denkfehler sind schön zurechtgelegte Ausreden oder fantastisch einfach anmutende Lösungen. In besagter Vorlesung wurde Theodor W. Adorno besprochen. Sein Schaffen entstand unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges. Er selbst musste nach Amerika emigrieren. Wie waren die Gräueltaten nach den Errungenschaften der Aufklärung nur möglich? Wie konnte eine an sich kultivierte Zivilisation in die Barbarei zurückfallen? Warum schenkt uns der Massenkonsum nicht mehr Freiheit und Individualität? Adorno lieferte einige Antworten auf diese Fragen. Gemeinsam mit Max Horkheimer legte er dar, wie die Aufklärung zugleich Fortschritt und die nächsten Probleme auslöste. Der Aberglaube wurde ausgemerzt, die reine Vernunft eingeführt und einer Technik der Weg bereitet, die sich mit großer Distanziertheit anwenden lässt. Das Ausmaß der Gefühlskälte erreichte mit den ausgeklügelten Massenvernichtungseinrichtungen im Zweiten Weltkrieg einen schockierenden Höhepunkt. Andererseits bescherte uns das rationale Denken Technik, Industrialisierung und Wohlstand für die Massen. Die Technikfolgen sind allerdings diffizil und nur schwer abzuschätzen. Sie können sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kippen.
Adornos Leser reagieren bis heute unterschiedlich auf seine pointiert zugespitzten Texte. Die 68er-Generation nahm die Kritik am Massenkonsum zum Anlass für eine Kulturrevolution, setzte sich für die Emanzipation ein und erwirkte viele neue Freiheiten. Andere hören mehr die pessimistischen Töne heraus, die Adorno zeitlebens anschlug. Eines seiner Essays endet mit dem Satz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Aus dem Kontext gerissen, werden die Wörter des renommierten Philosophen gerne als Ausrede vorgeschoben. Wenn man ohnehin nichts verändern könne, müsse man sich auch nicht vergeblich anstrengen, sagen sich demnach viele. Sie ahnen es schon: So will ich das Missverständnis nicht stehen lassen! Das Richtige im Falschen ist möglich. Auch wenn sich Adorno aus nachvollziehbaren Gründen mit dem Optimismus schwertat, als differenzierter Denker würde er nie bestreiten, dass ein und dieselbe Erscheinung zugleich Fluch und Segen sein kann. Der Massenwohnbau, auf den er anspielt, versorgt viele Menschen mit einem neuen Heim, gleichzeitig lässt er ihnen jedoch wenig Gestaltungsfreiraum. Wenn Adorno mit einer ausweglosen Übertreibung endet, dann weil er um etwas Verlorengegangenes trauert und das Neue noch nicht sehen kann.
In dem Satz klingt aber noch etwas anderes an, was viele von uns beschäftigt. Es ist ein verwunderlicher Vorgang, dass uns von uns selbst aufgestellte Regeln entgleiten. Die Systemtheorie benutzt dafür verschiedene Bilder und Vergleiche. Ein zentrales Bild ist die Selbsterhaltung, nach der biologische Systeme streben. Demnach wollen natürliche Systeme grundsätzlich so bleiben, wie sie sind. Sie sind widerspenstig gegenüber äußeren Einflüssen und Veränderungen. Nur wenn es für ihren Erhalt unumgänglich ist, mutieren sie. Das kann auch schiefgehen, wenn sie zu spät reagieren. Bei uns Menschen fühlt es sich manchmal so an, als wären wir Goethes Zauberlehrlinge, die die hilfreichen Geister riefen und sie nicht mehr loswerden, selbst wenn diese längst Unfug treiben. Das, was zu einer bestimmten Zeit Sinn ergeben hat, kann sich überholen, nur ist es trotzdem beharrlich. Um besonders hartnäckige Widerstände zu erklären, werde ich punktuell die Systemtheorie heranziehen und uns gleichzeitig in Erinnerung rufen, dass die Umstände menschengemacht sind und damit auch veränderbar.
Die Auflösung von Blockaden kostet uns einiges an Überwindung. Das liegt daran, dass wir uns exponieren, wenn wir nicht mit der Masse laufen. Die Masse schützt uns. Sie lässt uns an ihrem Wohlstand partizipieren. Bringen wir ihr zu viel Verachtung entgegen, kann sie uns verstoßen, was uns in existenzielle Schwierigkeiten stürzen kann. Andererseits können wir mit der Mehrheit auch untergehen. Der Grat zwischen notwendiger Kritik und dem, Teil der Gesellschaft zu bleiben, ist dünn. Im Moment erscheint es allerdings eher so, dass wir zu wenig kritikfähig sind und nicht genug Erneuerungsschritte setzen. Erich Fromm diagnostizierte das Um-jeden-Preis-dazugehören-Wollen als eines unserer großen Probleme. Zu viel Konformismus birgt etwas Todbringendes. Wenn wir künftig nicht mehr Eigenverantwortung übernehmen und uns nicht mit positiven Ideen einbringen, wird es zu keiner sozialen und ökologischen Systemerneuerung kommen. Stattdessen werden sich die destruktiven Muster verstärken. Fromm begründet dieses Verhalten mit unserem kindlichen Verlangen nach Autoritäten. Andere mögen uns die Entscheidungen abnehmen und die Dinge für uns regeln (Politiker, Ehepartner, Wohlhabendere, …). Dass diese unreife Attitüde meistens gründlich schiefgeht, war während des Nationalsozialismus überdeutlich zu beobachten. Die Versuchung, alle Verantwortung abzugeben, gepaart mit dem Versuch, anderen etwas aufzuzwingen, endete in unserer fast vollständigen Zerstörung. Wenn es schon nicht mit der Beherrschung der Subjekte klappte, dann sollte zumindest ihre Auslöschung folgen – so die destruktive Logik. Damit erklärt Fromm sich den Holocaust und den Krieg.
Einen Ausweg sieht Erich Fromm in einem gereiften Verhalten. Wir müssten weniger delegieren und eigenverantwortlicher handeln. Dafür müssten wir uns frei machen von den Erwartungen und Konventionen, die an uns herangetragen werden, und eigene Vorstellungen entwickeln und umsetzen. Das klingt logisch. Doch wie soll eine Selbstverwirklichung entgegen den Normen aussehen? Wie kann das praktisch gelingen, im Kollektiv und nicht egozentrisch?
Überraschenderweise fand ich die Antwort über einen Umweg heraus. Auf der Suche nach einem tieferen Verstehen der Zusammenhänge zwischen sozialer und ökonomischer Welt widmete ich mich dem ausschweifenden Werk Max Webers. In seinen Erklärungsversuchen über den Kapitalismus und die gesellschaftlichen Turbulenzen spielt seine Religionssoziologie eine große Rolle. Keine Sorge, um an der Stelle weiterlesen zu können, müssen Sie weder religiös noch spirituell sein. Es gibt aber eine Funktion in unserem Leben, die wir entweder mit Religion oder mit einer anderen Strategie lösen müssen. Sie hat damit zu tun, dass wir im Grunde unseres Herzens wissen, dass wir vielen Ansprüchen nicht gerecht werden, selbst wenn wir uns noch so anstrengen oder exzellent im Verdrängen sind. Wir alle fühlen uns mehr oder weniger zerrissen zwischen unseren Idealen und der Realität. Und um das zuweilen quälende Gefühl zu mildern, legen wir uns unterschiedliche Strategien oder Tricks zu. Klassische Religionen bieten dafür einen Gott an, der für unsere Erlösung zuständig ist. In nicht-religiösen Weltanschauungen kommt die Selbsterlösung ins Spiel, also der eigene Beitrag zu unserem Seelenwohl. Darüber hinaus gibt es viele Mischformen zwischen Selbst- und Fremderlösung. Aber egal wie wir das Problem lösen, ob wir es durch Beten, Meditation, Fleiß oder Nächstenliebe versuchen, bei Max Weber wird deutlich, dass uns das damit einhergehende Heilsversprechen enorm motiviert. Mit den Leistungen, die wir dann als Kollektiv zustande bringen, können wir ganze Gesellschaften verändern. Es liegt also mehr in unserer Hand, als wir – schicksalsgläubig – vielleicht denken würden. Das Interessante bei Weber ist, dass er unsere Anstrengungen in ein Spannungsfeld einbettet – in die Spannung zwischen der verqueren und der heilen Welt. Diesen Grundwiderspruch zu zähmen, ist unsere Lebensaufgabe. Wir kommen nicht umhin. Und über je mehr Kompetenzen wir dafür verfügen, desto weniger sind wir auf den glücklichen Zufall angewiesen. Ich nenne diese Kompetenzen Brückenstrategien.
Im Nachhinein erkenne ich die vielen Vorbilder, die mich schon länger begleiten und die wohl über solche Strategien verfügen. Besagter Professor ließ sich von seinen Kritikern nicht beirren und öffnete den elfenbeinernen Turm für eine breitere Öffentlichkeit. Mit seiner verständlichen Sprache spricht er nicht nur Studierende an: Konrad Paul Liessmann gründete das Philosophicum Lech.
Inzwischen sind einige Jahre verstrichen, gefüllt mit Verbesserungen ebenso wie mit Verschlechterungen. Als gegen Ende der Corona-Pandemie dann auch noch der Krieg in der Ukraine ausbrach und der allgemeine Pessimismus wieder einmal einen traurigen Höhepunkt erreichte, beschloss ich, gegen das weit verbreitete Ohnmachtsgefühl anzuschreiben. Das Buch sollte aber keine theoretische Abhandlung werden, sondern von gelebten Beispielen handeln. Die hier vorgestellten Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen realisieren alle Projekte, die ihnen persönlich am Herzen liegen und gleichzeitig die Welt bereichern. Ich erzähle ihre bewegenden Geschichten und, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, restlos davon zu überzeugen, dass es sich hierbei nicht um Hexerei handelt, runde ich jede Biografie mit zwei irdischen Strategien ab.
Wer könnte besser einen hoffnungsvollen Auftakt machen als jemand, der professionell gute Nachrichten verbreitet. Bianca Kriel hat sich als Journalistin darauf spezialisiert, aus der täglichen Nachrichtenflut die positiven Ereignisse herauszufiltern und einen Kontrapunkt zu Katastrophenmeldungen und Skandalen zu setzen. Sie schreibt für das Good-Impact-Magazin und betreibt einen eigenen Podcast. Bianca ist eine der Jüngeren. Das bedeutet aber nicht, dass ihr die Vorgängergeneration bereits alle Wege geebnet hätte. Mitte dreißig hat sie bereits ein abwechslungsreiches Leben als Schauspielerin hinter sich. Immer wieder erfindet sie sich neu. Aus ihrer persönlichen Suche wird eine Recherche, die auch anderen Orientierung bietet. Fündig wird sie bei den Menschenrechten und in der Ethik sowie im unbeaufsichtigten Spiel ihrer Kindheit, das sich stimmig anfühlte und aus dem sie für ihre Zukunft schöpfen kann.
Heinz Feldmann ist der Prototyp des Lebens-Wandlers. Er betreibt sogar eine Webseite unter diesem Namen. Mit großer Offenheit teilt Heinz seine Beweggründe und Erfahrungen, die ihn vom hedonistischen Yuppie zum maßvollen Gemeinwohlunternehmer werden ließen. An einem bestimmten Punkt in seinem Leben konnte er sich eingestehen, dass ihn sein Ressourcen vergeudender Lebensstil nicht mehr glücklich und die Lebensgrundlage vieler kaputt machte. Heinz lebt uns vor, wie aus weniger mehr wird. Worauf es dabei ankommt, ist, dass man sich eine ausreichende und vernünftige Existenzgrundlage schafft – ein Thema, das alle beschäftigt und zu dem Sie hier noch mehr Anregungen finden werden. Heinz baut sich seinen sicheren Hafen in Form eines Gemeinschafts-Wohnprojektes. Es deckt viele seiner eigenen Bedürfnisse ab und bietet auch anderen ein bezahlbares und ökologisches Zuhause.
Zum Erscheinungszeitpunkt des Buches ist Traude Veran in ihrem einundneunzigsten Lebensjahr. Allein schon ihre lange Lebenserfahrung – sie ist vor dem Zweiten Weltkrieg geboren – beeindruckt mich. Wohl kaum jemand von uns hat so viel Auf und Ab in der Politik miterlebt wie sie. Wenngleich sie in ihrer ersten Lebenshälfte nicht mit Chancengleichheit gesegnet war, war sie immer hellwach. Und als es an der Zeit war, erkannte sie ihre Chance. Traude Veran ist die Schlüsselinitiatorin des Schulintegrationsgesetzes in Österreich. Die Verhandlungen, die sich über mehrere Jahrzehnte hinzogen, lesen sich beinahe wie ein Politkrimi und entbehren nicht der einen oder anderen tragisch-komischen Pointe. Frau Veran hatte aber zeitlebens einen wunderbaren Ausgleich. Sie ist Schriftstellerin. Als Kind schreibt sie mehr für sich, später für eine kleine Öffentlichkeit. Doch unabhängig vom Beifall liegt das Erfüllende am Schreiben im zwecklosen Tun.
Wer dem globalen Lohndumping zum Trotz im Westen eine Produktion aufrechterhalten kann, der muss irgendetwas besonders gut machen. Gert Rücker betreibt eine Bekleidungs-Manufaktur, und eine seiner Spezialitäten ist die Pflege des Betriebsklimas. Gut geölt, greifen in seiner Firma die unterschiedlichen Kompetenzen ineinander. Trotzdem strauchelte er zwischendurch. Nach der Ostöffnung musste er Insolvenz anmelden. Doch Gert Rücker erholte sich und mit ihm auch sein Betrieb. Er trägt das Familienerbe weiter – ein kapitalistisches, wenn man so will. Herr Rücker fühlt sich allerdings den Werten der 68er-Bewegung zugetan. Geworden ist aus ihm weder ein Berufs-Revoluzzer, noch ein angepasster Opportunist. Er folgt seinem Verantwortungsgefühl gegenüber den Mitarbeiterinnen. Das schafft er, indem er nicht einer bestimmten Ideologie nacheifert, sondern seiner Vorstellung von einem Gesamtkunstwerk.
„Wahnsinn, dass es das gibt!“, rief eine Freundin aus, als sie von David erfuhr. David Sonnenbaum lebt am unkonventionellsten von allen. Sein Essen und seine Kleidung stammen überwiegend aus Beständen, die unsere Gesellschaft nicht mehr haben will, aus dem Müll. Um der Lebensmittelrettung und dem Klimaschutz nachkommen zu können, hat er sich finanziell freigespielt und mit Gleichgesinnten organisiert. Er hat eine bezahlbare Wohnung und ein Lastenfahrrad mit E-Antrieb. Damit transportiert er Lebensmittel und Aktionsmaterialien. Darüber hinaus hat David mehrere urbane Gemeinschaftsgärten initiiert. Er ist Teil einer wachsenden Avantgarde, die sich Sorgen um unseren Planeten macht. Sie demonstrieren, mitunter provozieren sie und rütteln an den Grenzen unseres eingefahrenen Vorstellungsvermögens. David hat die Courage und die Besonnenheit für diese Gratwanderung.
Wo immer man gerade steht, genau von dort aus geht es weiter. Das demonstriert uns Gabriele Brandhuber. Ob im brasilianischen Urwald oder im unwirtlichen Großstadtdschungel. Nicht alle sind wir so weit gereist wie Gabi, aber alle kennen wir ähnliche Probleme wie karrieretechnische Marginalisierung oder Mehrfachbelastung als Alleinerziehende. Wohin dann mit unseren Idealvorstellungen? Mehrmals findet sich Gabi in einer Sackgasse wieder und findet auch wieder heraus. Sie ist ein Fan der Selbstermächtigung und eignet sich im Laufe ihres Lebens die unterschiedlichsten technischen und kulturellen Kompetenzen an. Heute betreibt sie ein Textilportal im Internet, hat einen Podcast und bloggt über den Erhalt und die Ökologisierung der Textilbranche. Im Textilportal laufen alle ihre Fähigkeiten zusammen, und Gabi fühlt sich in ihrem Element.
Seit kurzem ist Martin Steininger in Rente. Beruflich und privat blickt er auf ein erfülltes, nicht immer unkompliziertes Leben zurück. Wir durchmessen die Jahrzehnte von seiner Kindheit in den späten Nachkriegs- und Aufschwungsjahren über den Niedergang der bäuerlichen Landwirtschaft bis zu den Umbrüchen in der Industrie aufgrund der Ostöffnung. Schließlich der Erfolg: Martin Steininger wird zu einem der Pioniere der Windkraft in Österreich. In unserem Gespräch wird deutlich, dass man dafür nicht nur eine klare Vision braucht. Man muss auch erkennen können, wann die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen gegeben sind und wann nicht. Heute ist Martin mit sich und der Welt im Reinen. Es sei immer viel mehr möglich gewesen, als er gedacht habe. Trotzdem wundert er sich über die allgegenwärtigen Torheiten der Menschen und arbeitet in der Pension weiter – an seiner Biolandwirtschaft.
Natalie und Afzaal Deewan betreiben das originellste Geschäftsmodell. Denn es gibt sie, die Alternativen. Natalie und Afzaal zeigen uns, wie sie das Modell aus dem Leben heraus entwickeln, statt es am Reißbrett zu entwerfen. Afzaal ist in Pakistan aufgewachsen. Dort gibt es zahlreiche Konventionen und für mich unerwartete Freiräume. So kommt es, dass Afzaal vor seiner unfreiwilligen Flucht jenes Selbstbewusstsein und jene Kompetenzen erwirbt, die er später in Österreich brauchen wird. Natalie ist als Tochter einer alleinerziehenden Künstlerin in Wien aufgewachsen und begeistert sich für Sprachen und Literatur. Als Afzaal in einer Unterkunft für Asylbewerber strandet und sie sich bei einem Fest in Wien kennenlernen, treffen ihre unterschiedlichen Talente und der feste Wille, ein gemeinsames Leben zu wagen, aufeinander. Das Durchhaltevermögen beider Persönlichkeiten lässt sie zu erfolgreichen Gastronomen werden. Im Wiener Deewan erwarten einen frisch gekochtes pakistanisches Essen, ein bunt gemischtes Publikum und Kosten nach Selbsteinschätzung. Pay as you wish lautet das Motto. Das klappt seit fast zwanzig Jahren, und auch nach den Corona bedingten Beschränkungen werden die beiden für pragmatische Aufgeschlossenheit sorgen.
Dass man, wenn es über längere Zeit gut läuft, am besten nicht übermütig wird und sein Glück nicht leichtfertig aufs Spiel setzt, ruft uns Oliver Nussbaum ins Gedächtnis. Seit mehreren Jahren kann Oliver ein Unternehmen durch relativ ruhige Gewässer steuern. Der Kurs führte aber auch durch Turbulenzen. Nachdem er mit seinem Kollegen ein neues Produkt auf den Markt gebracht hatte, wuchs ihre Firma rasant. Sie entwickelten E-Learnings und pressten sie auf CDs. Inzwischen wird alles online abgewickelt und es gibt viel mehr Anbieter auf dem Markt. Um die entstandenen Probleme zu lösen, wurde die Firma neu aufgestellt und Oliver übernahm eine neue Rolle. Inmitten der allgemeinen Finanzkrise stellte das einen kräftezehrenden Prozess dar. Seither achtet Oliver noch mehr auf seine Work-Life-Balance. Er vernachlässigt weder seine Familie, noch seinen Freundeskreis. Man müsse wissen, wann es genug ist. Mit dieser Einstellung erweist Oliver sich selbst und seinen Mitarbeitenden einen großen Dienst.
Schließen möchte ich das Buch mit jemandem, der nicht zögert, anzupacken. Theresa Mai legt selbst Hand an und sie ist überzeugend. Das rührt daher, dass sie sich nicht mit man ‚könnte‘, ‚sollte‘, ‚müsste‘ aufhält. Stattdessen sagt sie sich: „Ich mache das.“ Und so wurde es dann auch. Theresa baut Wohnwagons. Das sind mobile Tiny Houses. Ihre Vision ist das energieautarke Wohnen in vernetzten Nachbarschaften. Damit begonnen hat sie im zarten Alter von zweiundzwanzig. Anfang dreißig ist sie das jüngste Mitglied in dieser Runde. Aus dem kleinen Start-up, das seine Entwicklungskosten mittels Crowdfunding zusammenkratzen musste, wurde ein mittelständisches Unternehmen. Dem steht Theresa heute vor. Und wenn es einmal Sand im Getriebe gibt – was in jedem Betrieb zu erwarten ist –, lautet ihr Motto: „Der nächste Schritt ist immer machbar.“ Und sei er noch so klein, er setzt unweigerlich den nächsten in Bewegung.
Bianca Kriel
Die Suche: ein Schatz
Biancas Projekt ist geradezu optimal für mein Buchvorhaben. Bei meiner Recherche nach positiven Beispielen sowie nach Menschen, die es schaffen, diese selbst gegen den Mainstream umzusetzen, entdecke ich „Good News“. Wie oft schon habe ich mir ein anderes Nachrichtenformat gewünscht als die mit Katastrophen und Skandalen gespickten. Sie steigern unsere negativen Gedanken und nicht die konstruktiven Handlungsoptionen. Good News setzen den Fokus bewusst anders. Täglich stellen sie eine Presseschau aus Artikeln mit positiven Meldungen zusammen. Damit fördern sie die konstruktive Ausrichtung unserer Gedanken und unserer Vorstellungskraft. Also will ich wissen, wer diese jungen Menschen in der Redaktion sind. Ist die Generation nach mir schon so anders aufgewachsen, dass es ihr leichtfällt, einen positiven Fokus zu setzen? Ist sie vielleicht sogar so privilegiert, dass ihr die guten Geschäftsideen einfach in den Schoß fallen? Oder womit hat sie zu kämpfen? Meine Anfrage trifft auf Resonanz und Bianca erklärt sich bereit, mir ein Interview zu geben. Wie wurde sie zur Good-News-Redakteurin? Und woher kommt Bianca Kriel?
Bianca Kriel lebt in Berlin. Umso überraschter bin ich, als sie ihre Biografie damit beginnt, dass sie in Pretoria, der Hauptstadt von Südafrika, geboren ist. „Ein Diplomatenkind?“, frage ich mich nicht hörbar. Nein, Biancas Großvater war Facharbeiter für einen international agierenden Schweizer Konzern. Daher verbrachte die Familie mehrere Jahre in Südafrika. Bianca war fünf Jahre alt, als ihre Mutter mit ihr in die Schweiz zurückkehrte. Ihre erste Station war Bern. Bald darauf, im Jahr 1990, zogen sie aufs Land. Dort verbrachte Bianca viel Zeit in der Natur und genoss jede Menge Freiheiten. Sie durfte unbeaufsichtigt spielen, konnte klettern und herumtoben und sie hatte viele Tiere. Wenn sie nicht draußen herumtollte, vergrub sie sich gerne in ihren Büchern. Die Bücher und das Lesen seien für sie prägend gewesen, erzählt sie mir. Ein ganzes Regal voller Bücher habe sie von der Hausärztin ihrer Mutter geschenkt bekommen. Das war ein Segen, weil sie nicht viel Geld gehabt hätten. Materiell war ihre Familie nicht besonders vermögend, doch sie bot ihr ein Umfeld, in dem sie sich die äußere Welt erobern und ihre innere Welt ungehindert und dennoch aufgehoben erschließen konnte. Bianca wird es im Laufe unseres Gespräches nicht explizit ansprechen, doch ich denke, dieses Gut-in-sich-und-der-Welt-verankert-Sein hat ihr später geholfen, sich zu erinnern, wie sich ein glückliches Leben anfühlt.
Nach ihrem Schulabschluss ging es erst einmal darum, Geld zu verdienen. Außerdem wusste sie nicht recht, was man an einer Universität macht. In ihrer Familie hatte sie diesbezüglich keine Vorbilder. Was sie aber hatte, war eine klare Vorstellung von dem, was sie werden wollte: Sie wollte Menschenrechtsanwältin werden. An diesem Punkt in ihrem Leben beginnt sie – im Vergleich zum kindlichen Spiel –, aktiv zu suchen. Und von nun an wird sie das Recherchieren ihr Leben lang als zentrale Aufgabe begleiten. Wie wird man also Menschenrechtsexpertin und wo gibt es dafür eine Ausbildung? Jetzt war klar, dass der Weg zum Wunschberuf wohl doch über ein Studium führen würde. Eine Spezialisierung auf Menschenrechte fand sie an der Universität in Genf. Doch da wollte sie nicht hin, weil sie sich verpflichtet fühlte, in der Nähe ihrer Mutter zu bleiben. Daher begann sie kurzerhand, in Freiburg, südlich von Bern, Jura zu studieren. Rasch stellte sie allerdings fest, dass das Einzige, was sie an dem Studium interessierte, die Rechtsphilosophie war, und sie mit dem ausgelegten Recht gar nichts anfangen konnte. Die Paragrafen waren ihr einfach zu trocken. Sie wechselte auf Medien und Kommunikation. Das Fach ging ihr leichter von der Hand und ein großer Vorteil war, dass es ihr Raum für andere Aktivitäten ließ. Sie konnte sich in verschiedenen Jobs und Sportarten ausprobieren. Dabei entdeckte sie das Theater.
Mit dem Theater tritt eine große Wende in Biancas Leben. Auf den Brettern, die ihr die Welt bedeuten, findet sie ihr vorläufiges Zuhause. Das Schauspiel liegt ihr, und auf Anhieb scheint ihr ganz viel zu gelingen. Der Einstieg ist allerdings nicht selbstverständlich.
„Das war eine ziemliche Odyssee, weil, um an einer stattlichen Schauspielschule zu studieren, muss man Aufnahmeprüfungen machen. Dazu muss man sagen, es gibt 200 Plätze, aber zirka 2000 Bewerber:innen. Deswegen macht man so eine Ochsentour. Ich habe sechzehnmal vorgesprochen und beim siebzehnten Mal wurde ich aufgenommen. Ja, und dann habe ich Schauspiel studiert – in Zürich an der Kunsthochschule. Das war eine großartige Zeit! Ich habe nichts anderes gemacht, außer sieben Tage die Woche Theater geprobt. Man kann sagen, ich war schon während des Studiums sehr erfolgreich. Ich habe x Stipendien gewonnen, war am Schauspielhaus Zürich und in Luzern, und ich hatte eine Gruppe. Es war wirklich so: Wow, ich habe meinen Platz in der Welt gefunden.“
Die Begeisterung und der Überraschungseffekt sind groß. Tatsächlich ist es ihr gelungen, Schauspielerin zu werden. Ich denke, als sie das Theater für sich fand, wusste sie noch gar nicht, dass sie explizit diesen Raum suchen würde. Sie war offen, etwas zu finden, was sich stimmig anfühlte. Dieser Zyklus – große Anstrengung gefolgt von einem Erfolgserlebnis – wird sich später jedenfalls unter anderen Vorzeichen wiederholen.
Ihre Theaterkarriere führte Bianca nach Chemnitz. Nach einem Jahr, als sie ihr Schauspielstudium abgeschlossen hatte, wurde sie vom Ensemble übernommen. Ihr Glück schien perfekt. Doch es währte nicht lange. Als Bianca 2014 schwanger wurde, verlängerte das Theater ihren Vertrag nicht mehr. Die Begründung lautete „künstlerische Differenzen“. Als wahren Grund vermutet Bianca aber die Schwangerschaft, was selbstverständlich himmelschreiend ungerecht ist und niemand offiziell aussprechen würde. Ein Entsetzen legt sich kurz über unser Gespräch. Ob es Bianca gefiel oder nicht, sie musste sich neu orientieren. Inzwischen hat sie sich wieder gefangen. Schlussendlich wollte sie nach der herben Enttäuschung nicht mehr ans Theater zurück, auch wenn es sie eine Übergangszeit kostete.
„Okay, und jetzt? Jetzt ist alles, wofür ich die letzten Jahre gearbeitet habe, so ein bisschen zusammengebrochen. Weil ich auch keine Lust hatte auf so ein System – sieben Tage die Woche arbeiten am Theater. Und alle Werte, die ich hatte, haben sich nicht so ganz gedeckt mit dem Theaterleben. Soziale Gerechtigkeit und politisches Engagement – das schien mir alles so scheinheilig am Theater, weil die gelebte Realität tatsächlich eine ganz andere ist.“
Sie bekommt ihr Kind und mit dem Kind kommt sie in einer neuen Realität an. Bianca siedelt nach Berlin um. Beruflich weiß sie in dem Moment noch überhaupt nicht, was sie jetzt machen soll. Sie versucht, an ihr altes Leben anzuknüpfen und sich als freie Schauspielerin zu etablieren, merkt aber bald, dass das nicht mehr zu ihr passt. Über die neuen Kontakte, die sie knüpft, kommt sie mit dem Dokumentartheater in Berührung. Dort wird journalistisch gearbeitet, was ihr von ihrem ersten Studium vertraut ist. So sei sie immer mehr ins Dokumentartheater hineingerutscht, schildert sie mir, und schließlich zur journalistischen Tätigkeit gekommen. Dazwischen liegt ein Aufenthalt in Griechenland, der sich für mich als Außenstehende gar nicht wie ein sanftes Hineinrutschen anhört, sondern wie ein mutiges Hineinspringen in eine Welt, vor der viele lieber die Augen verschließen.
„Ich bin dann für ein Projekt nach Athen gegangen, mit meinem Kind – das war damals sechs Monate alt. Das war 2016, als ganz viele Menschen in Geflüchteten-Camps gestrandet waren. Das ist auch heute noch so. Ich habe dort mit einer freien Theatergruppe recherchiert. So bin ich eben immer mehr ins journalistische Arbeiten gekommen. So hat das eine das andere ergeben.“
Zurück in Berlin vertieft sie ihre journalistische Arbeit und wird freie Redakteurin bei einer Stiftung. Für die arbeitet sie so lange, bis sie die Ausschreibung von Good News liest. Das Profil der Plattform für gute Nachrichten spricht sie sofort an. Die vakante Position ist die einer Redaktionsleiterin. Also bewirbt sie sich als solche.
„Das war ein wenig größenwahnsinnig, weil ich davor noch nie eine Redaktion geleitet habe. Und dann habe ich diesen Job bekommen! Dazu muss ich sagen, dazwischen habe ich noch einen Master in Philosophie gemacht, weil ich dachte, ich brauche noch einen anderen akademischen Boden für das, was ich hier tue oder was ich tun will – nämlich schreiben und Menschenrechte wirklich besprechen. Das war großartig! Also, habe ich noch einen Master in angewandter Philosophie, in Ethik gemacht. Und: Hier bin ich! Heute.“
Da, wo sie heute ist, ist es gut. Bei Good News kann Bianca die Werte vertreten, die ihr wichtig sind. Sie schreibt gerne und macht gerne Podcasts. Es ist Bianca, die bei Good News die Podcasts einführt. Die News bestehen aus Online-Nachrichten erweitert um eine mobile App, einem Newsletter und gleich mehreren Podcasts. Sie scharen sich um die Good Impact Family. Dazu zählen Good Jobs, Good Travel und Good Buy sowie das Good Impact Magazin, für das Bianca regelmäßig schreibt. Hinter allen Familienmitgliedern kann Bianca voll und ganz stehen. Die Inhalte passen. Als ich Bianca frage, was sie machen würde, wenn sie kein Geld verdienen müsste, sagt sie, sie würde trotzdem Podcasts machen. Also genau das Gleiche, nur weniger. Mehr Beweis dafür, dass sie hier vollkommen richtig ist, gibt wohl kaum.
Reality Check: Kind plus Vollzeitjob ist von allem etwas zu viel. Bianca liebt ihr Kind und ihre Tätigkeit, und es bleibt ein Balanceakt. Der per Programm überfrachtete Alltag klappt in der Regel ganz gut, weil ihr einige organisatorische Synergien entgegenkommen. Die Schule in ihrer Nähe ist von vornherein eine Ganztagsschule. Sie musste sie weder ausfindig machen noch sich explizit dafür entscheiden. Der Vater ihrer Tochter wohnt im gleichen Haus, eine Etage über ihr. Obwohl sie kein Paar mehr sind, verstehen sie sich ausgezeichnet, und sie teilen sich die Sorge für ihr Kind zu gleichen Teilen auf. Eine Woche ist sie für alles zuständig, die nächste er. So haben beide Elternteile etwas Raum für sich und ihre Tochter hat Vater und Mutter immer in greifbarer Nähe. Sie sehen sich täglich. Bianca kann ein wenig jonglieren und in den Wochen mit Kind weniger arbeiten, dafür in den Wochen ohne mehr. Dennoch würde alles unter großem Zeitdruck passieren, sagt sie. Sie würde sich wünschen, die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter weniger mit Hausarbeit vollstopfen zu müssen – einkaufen, kochen, putzen, waschen. Im Grunde ist Bianca aber zufrieden, weil sie sich mitsamt typischem Jungelternstress entsprechend gut einrichten kann, auch wenn ihr in dieser Lebensphase zu wenig Zeit für sich selbst bleibt. Wenn sie Zeit hätte, würde sie mehr lesen oder ein Buch schreiben. „Das kann noch werden“, denke ich mir.
Bianca ist jetzt Ende dreißig und wird wohl noch nach dem einen oder anderen neuen Ziel in ihrem Leben aufbrechen. Das Hochplateau, auf dem sie gerade weilt, fühlt sich großartig an. Weil sie gerade nicht kämpfen muss. Es ist eine Erleichterung, nicht um die finanzielle Existenz oder um die Inhalte ringen zu müssen. Wer von uns könnte das nicht nachvollziehen! Eigentlich würde sie gar nicht gerne kämpfen, weil sie es anstrengend fände. Trotzdem ist das Ringen darum, irgendwo anzukommen, ihr ständiger Begleiter. Auch heute sei noch nicht alles einfach, aber eben schon viel besser. Ihre Beharrlichkeit lohnt sich auch immer wieder. Sie war einige Jahre als Schauspielerin sehr erfolgreich, hat eine heranwachsende Tochter und ihren Platz beruflich und in Berlin gefunden.
Der Good-Impact-Podcast
Als Vorbereitung auf das Interview tausche ich mich mit Bianca über ihr Herzensprojekt aus. Ich dachte, es seien die Good News an sich. Doch nein, Biancas eigentliches Herzensprojekt ist der Podcast. Ich grüble etwas darüber nach, was das Besondere an Podcasts ist. Warum könnte Bianca gerade den Podcast so mögen? Mit ihrer Antwort wird sie mein Vorstellungsvermögen