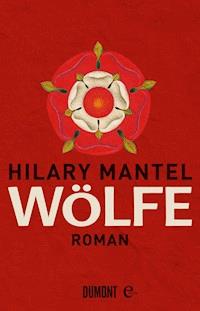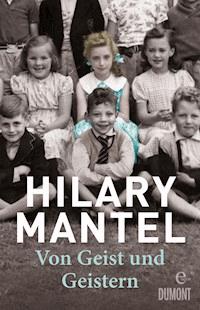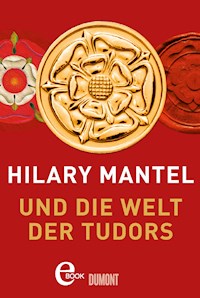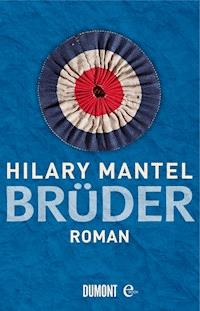
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Brüder‹ folgt drei sehr unterschiedlichen jungen Männern in die Wirren der Französischen Revolution. Da ist Georges Danton: ehrgeizig, energisch, hoch verschuldet. Maximilien Robespierre: klein, gewissenhaft und furchtsam. Und schließlich Camille Desmoulins: ein Rhetorikgenie, charmant und gutaussehend, aber auch wankelmütig und unzuverlässig. Während diese drei Helden in den berauschenden Sog der Macht geraten, macht jeder für sich die Erfahrung, dass Ideale auch eine dunkle Seite haben. Gemeinsam entfesseln sie einen Schrecken, dem sich niemand entziehen kann. ›Brüder‹ ist zu gleichen Teilen packende Erzählung und faszinierend akkurates Panorama eines der erschütterndsten Ereignisse der Weltgeschichte. Mit spitzer Feder zeichnet Hilary Mantel ihre Charaktere, legt ihnen jene scharfzüngigen Dialoge in den Mund, für die sie die Leser von ›Wölfe‹ zu Recht lieben, und lässt Geschichte so auf unnachahmliche Weise lebendig werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hilary Mantel
Brüder
Roman
Aus dem Englischen von Kathrin Razum
Die englische Originalausgabe erschien 1992 unter dem TitelA Place of Greater Safety bei Viking Press, an imprint of Penguin Books, London © Hilary Mantel 1992 eBook 2012 © 2012 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Übersetzung: Kathrin Razum u. Sabine Roth Umschlag: Zero, München Umschlagabbildung (Rosette): Bridgeman Art Library/Giraudon;
Anmerkung der Autorin
Dies ist ein Roman über die Französische Revolution. Fast alle Figuren, die darin vorkommen, haben wirklich existiert, und die Erzählung lehnt sich eng an die historischen Tatsachen an – sofern diese Tatsachen feststehen, was nur bedingt der Fall ist. Es handelt sich weder um einen Überblick noch um eine Gesamtdarstellung der Revolution. Im Mittelpunkt des Romans stehen die Vorgänge in Paris; was in den Provinzen geschah, wird nicht berücksichtigt, Militärisches nur in geringem Maße.
Meine Hauptfiguren wurden erst durch die Revolution berühmt, über ihr früheres Leben weiß man nicht viel. Ich habe das vorhandene Wissen verwertet und ansonsten wohlbegründete Vermutungen angestellt.
Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Objektivität. Ich habe versucht, die Welt durch die Augen meiner Protagonisten zu sehen, die ihre eigenen Meinungen und Vorurteile hatten. Wo möglich, habe ich ihre eigenen Worte – aus dokumentierten Reden und erhaltenen Schriftstücken – in meine Dialoge eingeflochten. Dabei habe ich mich von der Überzeugung leiten lassen, dass vieles, was schriftlich dokumentiert wird, vorher mündlich erprobt worden ist.
Es gibt eine Figur in diesem Roman, die etwas rätselhaft erscheinen mag, weil sie eine zwar untergeordnete, aber recht eigene Rolle spielt. Über Jean-Paul Marat ist allseits bekannt, dass er von einem hübschen Mädchen im Bad erstochen wurde. Seines Todes können wir uns sicher sein, doch fast sein gesamtes restliches Leben lässt unterschiedliche Auslegungen zu. Dr. Marat war rund zwanzig Jahre älter als meine Hauptfiguren und hatte zu Beginn der Revolution bereits eine lange, interessante Laufbahn hinter sich. Sie ausführlicher zu behandeln hätte ein Ungleichgewicht in die Erzählung gebracht, weshalb ich ihm einige wenige, aber markante Gastauftritte eingeräumt habe. Ich habe vor, zu einem späteren Zeitpunkt über Dr. Marat zu schreiben. Ein solcher Roman würde die Auffassung von Geschichte, die ich hier vertrete, untergraben. Während meiner Arbeit an diesem Buch habe ich immer wieder darüber nachgedacht, was Geschichte eigentlich ist. Und man muss seinen Fall darlegen, bevor man dagegen argumentieren kann.
Da die hier geschilderten Ereignisse ziemlich kompliziert sind, steht der Notwendigkeit der Veranschaulichung jene der Erklärung gegenüber. Wer einen Roman dieser Art schreibt, setzt sich den Kritteleien von Pedanten aus. Ich möchte an zwei Beispielen zeigen, wie ich versucht habe, die Dinge zu vereinfachen, ohne sie zu verfälschen.
In meiner Darstellung des prärevolutionären Paris spreche ich von »der Polizei« bzw. »Polizeibeamten«. Das ist eine Vergröberung: Tatsächlich gab es mehrere verschiedene Ordnungsmächte. Doch es wäre lästig, wenn der Fluss der Erzählung immer wieder dadurch aufgehalten würde, dass bei jedem Aufstand erläutert wird, welche Ordnungsmacht gerade im Einsatz ist.
Ein anderes, kleineres Detail: die Mahlzeiten. Der moderne Pariser nahm seine Hauptmahlzeit zwischen drei und fünf Uhr nachmittags ein und aß gegen zehn oder elf zu Abend. Wenn letztere Mahlzeit mit einer gewissen Förmlichkeit oder Feierlichkeit einherging, habe ich sie als Souper oder Diner bezeichnet. Im Allgemeinen bleiben die Personen in diesem Buch lange auf.
Ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, dass ein Roman eine Gemeinschaftsleistung ist, ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Autor oder Autorin und Leserschaft. Ich präsentiere hier meine eigene Version der Geschichte, doch die Fakten verändern sich je nach Betrachtung. Natürlich hatten meine Figuren nicht das Privileg, ihre Lage im Rückblick beurteilen zu können, sie lebten von einem Tag zum anderen, so gut sie eben konnten. Ich möchte niemanden dazu bringen, eine bestimmte Sichtweise zu übernehmen oder irgendwelche Lehren aus den geschilderten Ereignissen zu ziehen. Ich habe versucht, einen Roman zu schreiben, der den Lesern die Möglichkeit lässt, ihre Meinung zu ändern und ihre Sympathien zu verlagern: ein Buch, in dem man leben und denken kann. Man mag sich beim Lesen fragen, wie Fakt und Fiktion auseinanderzuhalten sind. Als grober Anhaltspunkt mag dienen: Was besonders unwahrscheinlich klingt, ist vermutlich wahr.
Personenverzeichnis
Teil I
IN GUISE:
Jean-Nicolas Desmoulins, ein Anwalt
Madeleine, seine Frau
Camille, sein ältester Sohn (*1760)
Elisabeth, seine Tochter
Henriette, seine Tochter († im Alter von neun Jahren)
Armand, sein Sohn
Anne-Clothilde, seine Tochter
Clément, sein jüngster Sohn
Adrien de Viefville; Jean-Louis de Viefville, ihre hochnäsigen Verwandten
Der Prinz von Condé, vornehmster Adeliger des Arrondissements und Klient von Jean-Nicolas Desmoulins
IN ARCIS-SUR-AUBE:
Marie-Madeleine Danton, eine Witwe, die wieder heiratet
Jean Recordain, ein Erfinder
Georges-Jacques, ihr Sohn (*1759)
Anne Madeleine, ihre Tochter
Pierette, ihre Tochter
Marie-Cécile, ihre Tochter, die Nonne wird
IN ARRAS:
François de Robespierre, ein Anwalt
Maximilien, sein Sohn (*1758)
Charlotte, seine Tochter
Henriette, seine Tochter († im Alter von neunzehn Jahren)
Augustin, sein jüngerer Sohn
Jacqueline, geb. Carraut, seine Frau, die bei der Geburt ihres fünften Kindes stirbt
Großvater Carraut, ein Brauer
Tante Eulalie; Tante Henriette, François de Robespierres Schwestern
IN PARIS, AM COLLÈGE LOUIS-LE-GRAND:
Pater Poignard, der Direktor – ein liberal gesinnter Mann
Pater Proyart, der stellvertretende Direktor – ein alles andere als liberal gesinnter Mann
Pater Herivaux, Altphilologe
Louis Suleau, ein Schüler
Stanislas Fréron, ein Schüler mit sehr guten Verbindungen, Spitzname »Karnickel«
IN TROYES:
Fabre d’Églantine, ein arbeitsloses Genie
Teil II
IN PARIS:
Maître Vinot, ein Anwalt, in dessen Kanzlei Georges-Jacques Danton seine Ausbildung erhält
Maître Perrin, ein Anwalt, in dessen Kanzlei Camille Desmoulins seine Ausbildung erhält
Marie-Jean Hérault de Séchelles, ein junger Adliger und ranghoher Jurist
François-Jérôme Charpentier, ein Cafébesitzer und Steuerprüfer
Angélique (Angelica), seine italienische Frau
Gabrielle, seine Tochter
Françoise-Julie Duhauttoir, Georges-Jacques’ Mätresse
IN DER RUE CONDÉ:
Claude Duplessis, ein höherer Beamter
Annette, seine Frau
Adèle; Lucile, seine Töchter
Abbé Laudréville, Annettes Beichtvater, ein Mittler
IN GUISE:
Rose-Fleur Godard, Camille Desmoulins’ Verlobte
IN ARRAS:
Joseph Fouché, ein Lehrer, Charlotte de Robespierres Verehrer
Lazare Carnot, ein Pionier, Freund von Maximilien de Robespierre
Anaïs Deshorties, ein nettes Mädchen, dessen Familie möchte, dass sie Maximilien de Robespierre heiratet
Louise de Kéralio, eine Schriftstellerin, die nach Paris geht, François Robert heiratet und eine Zeitung herausgibt
Hermann, ein Anwalt, Freund von Maximilien de Robespierre
DIE ORLEANISTEN:
Philippe, Herzog von Orléans, Vetter von König Louis XVI
Félicité de Genlis, eine Schriftstellerin – Philippes ehemalige Mätresse, jetzt Gouvernante seiner Kinder
Charles-Alexis Brulard de Sillery, Graf von Genlis – Félicités Mann, ein ehemaliger Marineoffizier und Spieler
Pierre Choderlos de Laclos, ein Schriftsteller, Sekretär des Herzogs
Agnès de Buffon, Mätresse des Herzogs
Grace Elliot, ehemalige Mätresse des Herzogs, Spionin des britischen Außenministeriums
Axel von Fersen, der Geliebte der Königin
IN DANTONS KANZLEI:
Jules Paré, sein Kanzlist
François Deforgues, sein Kanzlist
Billaud-Varennes, Aushilfskanzlist, ein sauertöpfischer Mensch
IN DER COUR DU COMMERCE:
MmeGély, die im Stockwerk über Georges-Jacques und Gabrielle Danton wohnt
Antoine, ihr Mann
Louise, ihre Tochter
Catherine, Marie, die Dienstmädchen der Dantons
Legendre, ein Metzgermeister, Nachbar der Dantons
François Robert, Rechtsgelehrter
René Hébert, Kartenverkäufer im Theater
Anne Théroigne, eine Sängerin
IN DER NATIONALVERSAMMLUNG:
Antoine Barnave, ein Abgeordneter – zunächst Radikaler, dann Royalist
Jérôme Pétion, ein radikaler Abgeordneter, später als »Brissotist« bezeichnet
Dr. Guillotin, ein Fachmann für das Gesundheitswesen
Jean-Sylvain Bailly, ein Astronom, später Bürgermeister von Paris
Honoré-Gabriel Riquetti,Comte de Mirabeau, ein abtrünniger Aristokrat, der für den Dritten Stand in der Versammlung der Generalstände sitzt
Teutch, Mirabeaus Kammerdiener
Clavière; Dumont;Duroveray, seine »Sklaven«, Genfer Politiker im Exil
Jean-Pierre Brissot, ein Journalist
Momoro, ein Drucker
Réveillon, Besitzer einer Tapetenfabrik
Hanriot, Besitzer eines Salpeterwerks
De Launay, Kommandant der Bastille
Teil III
M. Soulès, zeitweiliger Kommandant der Bastille
Der Marquis de Lafayette, Kommandant der Nationalgarde
Jean-Paul Marat, ein Journalist und Herausgeber von L’ami du peuple
Arthur Dillon, Gouverneur von Tobago und General in der französischen Armee, ein Freund von Camille Desmoulins
Louis-Sébastien Mercier, ein bekannter Schriftsteller
Collot d’Herbois, ein Dramatiker
Pater Pancemont, ein streitbarer Priester
Pater Bérardier, ein gutgläubiger Priester
Caroline Rémy, eine Schauspielerin
Père Duchesne, ein Ofensetzer – fiktives Alter Ego von René Hébert, ehemaliger Kartenverkäufer, jetzt Journalist
Antoine Saint-Just, ein unzufriedener Dichter, mit Camille Desmoulins bekannt oder verwandt
Jean-Marie Roland, ein älterer ehemaliger Beamter
Manon Roland, seine junge Frau, eine Schriftstellerin
François-Léonard Buzot, ein Abgeordneter, Mitglied des Jakobinerklubs und Freund der Rolands
Jean-Baptiste Louvet, ein Romanautor, Jakobiner und Freund der Rolands
Teil IV
IN DER RUE SAINT-HONORÉ:
Maurice Duplay, ein Schreinermeister
Françoise Duplay, seine Frau
Eléonore, seine älteste Tochter, eine Zeichenschülerin
Victoire, seine Tochter
Elisabeth (Babette), seine jüngste Tochter
Charles Dumouriez, ein General und zeitweiliger Außenminister
Antoine Fouquier-Tinville, ein Anwalt; Camille Desmoulins’ Vetter
Jeanette, die Dienerin der Desmoulins
Teil V
ALS GIRONDISTEN ODER BRISSOTISTEN GELTENDE POLITIKER:
Jean-Pierre Brissot, ein Journalist
Jean-Marie und Manon Roland
Pierre Vergniaud, Mitglied des Nationalkonvents, berühmter Redner
Jérôme Pétion
François-Léonard Buzot
Jean-Baptiste Louvet
Charles Barbaroux, ein Anwalt aus Marseille
Albertine Marat, Marats Schwester
Simone Evrard, Marats Lebensgefährtin
Defermon, ein Abgeordneter, zwischenzeitlich Präsident des Nationalkonvents
Jean-François Lacroix, ein gemäßigter Abgeordneter: 1792 und 1793 mit Danton auf kommissarischer Mission in Belgien
David, ein Maler
Charlotte Corday, eine Attentäterin
Claude Dupin, ein junger Bürokrat, der Dantons Nachbarin Louise Gély einen Heiratsantrag macht
Souberbielle, Robespierres Arzt
Renaudin, ein zur Gewalttätigkeit neigender Geigenbauer
Pater Kéravenen, ein widersetzlicher Priester
Chauveau-Lagarde, ein Anwalt, Verteidiger von Marie-Antoinette
Philippe Lebas, ein linker Abgeordneter, später Mitglied des Sicherheitsausschusses, heiratet Babette Duplay
Vadier, ein Mitglied des Sicherheitsausschusses, als »der Inquisitor« bekannt
IN DIE AFFÄRE UM DIE OSTINDIEN-KOMPANIE VERWICKELT:
Chabot, ein Abgeordneter, ehemaliger Kapuzinermönch
Julien, ein Abgeordneter, ehemaliger protestantischer Pastor
Proli, Sekretär von Hérault de Séchelles, angeblich ein österreichischer Spion
Emmanuel Dobruska und Siegmund Gotleb, als Emmanuel und Junius Frei bekannt; Spekulanten
Guzman, ein spanischstämmiger unbedeutender Politiker
Diedrichsen, ein dänischer »Geschäftsmann«
Abbé d’Espanac, ein betrügerischer Heereslieferant
Basire; Delaunay, Abgeordnete
Bürger de Sade, ein Schriftsteller und ehemaliger Marquis
Pierre Philippeaux,
ERSTER TEIL
Louis
XV
wird der Vielgeliebte genannt. Zehn Jahre vergehen. Dieselben Menschen denken, der Vielgeliebte bade in Menschenblut … Er meidet Paris, lebt zurückgezogen in Versailles, findet, dass es selbst dort noch zu viele Menschen gibt, zu viel Licht. Er wünscht sich einen dunklen Rückzugsort …
In einem Jahr der Not (solche gab es damals nicht selten) war er wie üblich im Wald von Sénart auf der Jagd. Er traf einen Bauern mit einer Totenbahre und fragte ihn, wohin er die Bahre bringe. An den und den Ort. »Für einen Mann oder eine Frau?« »Einen Mann.« »Woran ist er gestorben?« »Am Hunger.«
Jules Michelet
1. Das Leben als Schlachtfeld
1763–1774
Nun, da sich der Staub gelegt hat, können wir unsere Lage in Augenschein nehmen. Nun, da auch der letzte rote Ziegel auf dem Dach des Neuen Hauses liegt, nun, da der Ehevertrag vier Jahre alt ist. Die Stadt riecht nach Sommer, nicht angenehm also, aber nicht anders als letztes Jahr und nicht anders als in den kommenden Jahren. Das Neue Haus riecht nach Harz und Wachspolitur, der schweflige Geruch dräuender Familienzwistigkeiten liegt in der Luft.
Maître Desmoulins’ Arbeitszimmer befindet sich auf der anderen Seite des Hofes, im Alten Haus, das direkt an der Straße steht. Wenn man sich auf die Place des Armes stellt und die schmale weiße Fassade hinaufblickt, kann man oft seine schemenhafte Gestalt hinter den Jalousien im ersten Stock erkennen. Er scheint auf die Straße hinunterzuschauen, doch im Geiste, behaupten manche, ist er ganz woanders. Sie haben recht, und der Ort, an dem er weilt, lässt sich exakt benennen. Es ist Paris.
Leibhaftig ist er im Moment gerade auf dem Weg nach oben. Sein dreijähriger Sohn folgt ihm. Da er davon ausgeht, dass er das Kind noch die nächsten zwanzig Jahre am Bein haben wird, bringt es nichts, sich zu beklagen. Die Nachmittagshitze hängt in den Straßen. Die Kleinen, Henriette und Elisabeth, schlafen in ihren Bettchen. Madeleine beschimpft die Wäschemagd mit einer Redegewandtheit und Gehässigkeit, die nicht recht zu ihrer vornehmen Erziehung und ihrer Schwangerschaft passen wollen. Er schließt die Tür.
Kaum sitzt er an seinem Schreibtisch, wandern seine Gedanken wieder einmal in Richtung Paris. Das kommt häufig vor. Er lässt sich darauf ein, sieht sich mit einem mühsam errungenen Freispruch auf der Treppe des königlichen Gerichtshofs stehen, inmitten einer Traube gratulierender Kollegen. Er gibt den Kollegen Namen und Gesichter. Wo ist Perrin an diesem Nachmittag? Wo Vinot? Er fährt jetzt zweimal im Jahr hin, und Vinot – der früher, als sie noch studierten, seinen Lebensplan mit ihm zu besprechen pflegte – ist vor einer Weile auf der Place Dauphine geradewegs an ihm vorbeimarschiert, hat ihn wie Luft behandelt.
Das war letztes Jahr, und jetzt haben wir August, im Jahr des Heils 1763. Wir befinden uns in Guise in der Picardie; er ist dreiunddreißig Jahre alt, Ehemann, Vater, Advokat, Amtmann, Ratsherr, ein Mann, der eine hohe Rechnung für ein neues Dach zu begleichen hat.
Er nimmt seine Geschäftsbücher heraus. Vor zwei Monaten hat Madeleines Familie endlich die letzte Rate der Mitgift gezahlt. Sie stellten es als eine Art schmeichelhaftes Versäumnis dar, wohlwissend, dass er ihnen schlecht das Gegenteil beweisen konnte: Bei einem Mann in seiner Position, dem die Aufträge nur so zuflössen, fielen die letzten paar Hundert doch sicherlich nicht ins Gewicht.
Das war ein typischer de-Viefville-Trick, gegen den er machtlos war. Sie nagelten ihn an den Mast, und er, zitternd vor Scham, reichte ihnen auch noch selbst die Nägel. Er war auf ihr Geheiß von Paris nach Hause zurückgekehrt, um alles für Madeleine auf den Weg zu bringen. Er hatte nicht geahnt, dass ihr dreißigster Geburtstag verstreichen würde, ehe ihre Familie seine Lebensumstände auch nur halbwegs akzeptabel fand.
Sie lenken und leiten, die de Viefvilles: kleine Städte, große Anwaltskanzleien. Die Familie ist weit verzweigt, über das ganze Arrondissement Laon, die ganze Picardie – ein Haufen eiskalter Gauner, ständig am Reden. Ein de Viefville ist Bürgermeister von Guise, ein anderer Mitglied jenes erlauchten Gerichtshofs, des Parlaments von Paris. De Viefvilles heiraten für gewöhnlich Godards; Madeleine ist väterlicherseits eine Godard. Dem Namen der Godards fehlt das begehrte Adelsprädikat; dessen ungeachtet bringen sie es im Leben gemeinhin zu etwas, und wenn man in Guise und Umgebung eine musikalische Soirée, ein Begräbnis oder ein Diner der Anwaltskammer besucht, ist immer irgendeiner von ihnen da, vor dem man das Knie beugen kann.
Die Damen der Familie glauben an jährliche Vermehrung, und Madeleine ist da keine Ausnahme, auch wenn sie erst so spät begonnen hat. Daher das Neue Haus.
Dieses Kind, das jetzt quer durchs Zimmer läuft und auf die Fensterbank krabbelt, ist sein ältestes. Seine erste Reaktion beim Anblick des Neugeborenen: Das ist nicht meins. Die Erklärung kam bei der Taufe, von den grinsenden Onkeln und gehässigen Tanten: Na, wenn du mal kein kleiner Godard bist! Ist er nicht bis in die Fingerspitzen ein Godard? Drei Wünsche, dachte Jean-Nicolas missmutig: Ratsherr werden, die Cousine heiraten, gedeihen wie die Made im Speck.
Das Kind bekam eine ganze Reihe Namen, weil sich die Paten nicht hatten einigen können. Als Jean-Nicolas einen eigenen Namenswunsch äußerte, schloss sich die Familie zusammen: Du kannst gern Lucien zu ihm sagen, aber wir werden ihn Camille nennen.
Es kam Desmoulins vor, als wäre er mit der Geburt seines ersten Kindes zu einem Mann geworden, der sich durch einen zähen Sumpf kämpfte, ohne dass irgendwo Rettung in Sicht wäre. Er war durchaus willens, Verantwortung zu übernehmen, doch war er von den Wirrungen des Lebens schlicht überwältigt, gelähmt durch die Gewissheit, dass er in keiner denkbaren Situation etwas Konstruktives tun konnte. Insbesondere das Kind stellte ein unlösbares Problem dar. Es schien sich den Regeln der Vernunft völlig zu entziehen. Er lächelte es an, und es lernte das zu erwidern, doch nicht mit dem freundlichen, zahnlosen Lächeln der meisten Säuglinge, sondern, so schien ihm, mit einer Art verhaltenem Amüsement. Auch hatte er zu wissen geglaubt, dass Säuglinge Objekte noch nicht richtig mit den Augen fixieren konnten, doch dieser – sicher bildete er sich das nur ein – schien ihn kühl zu mustern. Das bereitete ihm Unbehagen. Insgeheim befürchtete er, dass sich das Kind eines Tages in Gesellschaft aufsetzen und sprechen würde; dass es seinen Blick suchen, ihn abschätzend betrachten und dann sagen würde: »Du Arschloch.«
Sein Sohn steht jetzt auf der Fensterbank, beugt sich hinaus und kommentiert das Kommen und Gehen draußen auf dem Platz. Da ist der Curé, und da ist M. Saulce. Jetzt kommt eine Ratte. Und jetzt kommt der Hund von M. Saulce – o je, die arme Ratte.
»Camille«, sagt er. »Geh da runter. Wenn du aufs Pflaster fällst und dir einen Hirnschaden zuziehst, wirst du nie Ratsherr. Das heißt – wer weiß. Es würde ja ohnehin keiner merken.«
Während er die Beträge der Handwerkerrechnungen addiert, lehnt sich sein Sohn in der Hoffnung auf weitere Gemetzel so weit wie möglich aus dem Fenster. Der Curé geht abermals über den Platz, der Hund schläft in der Sonne ein. Ein Junge kommt mit Halsband und Kette, legt sie dem Hund an und führt ihn davon. Schließlich blickt Jean-Nicolas auf. »Wenn ich das Dach bezahlt habe«, sagt er, »werde ich pleite sein. Hörst du mir zu? Da deine Onkel weiterhin dafür sorgen, dass nur der Bodensatz der hiesigen Rechtsfälle zu mir gelangt, muss ich für unsere monatlichen Ausgaben die Mitgift deiner Mutter angreifen, die eigentlich die Kosten deiner Ausbildung decken sollte. Um die Mädchen mache ich mir keine Sorgen, die können Handarbeiten verrichten, und vielleicht wird man sie einfach ihres Charmes wegen heiraten. Aber du wirst kaum auf diese Weise deinen Weg machen können.«
»Jetzt kommt wieder der Hund«, sagt sein Sohn.
»Tu, was ich dir sage, und geh vom Fenster weg. Und sei nicht kindisch.«
»Warum denn nicht?«, fragt Camille. »Ich bin doch ein Kind.«
Der Vater geht zu Camille, löst dessen Finger vom Fensterrahmen und schwingt ihn in die Luft. Die Augen des Jungen weiten sich vor Staunen, als er von dieser größeren Kraft davongetragen wird. Alles erstaunt ihn: die Tiraden seines Vaters, die Pünktchen auf einer Eierschale, Damenhüte, Enten auf dem Teich.
Jean-Nicolas trägt ihn durchs Zimmer. Mit dreißig, denkt er, wirst du an diesem Schreibpult sitzen, dich von deinen Geschäftsbüchern abwenden, um dich dem läppischen Auftrag zu widmen, mit dem du gerade befasst bist, und vielleicht zum zehnten Mal in deiner Laufbahn einen Hypothekenbrief für das Herrenhaus in Wiège aufsetzen, und dann wird dir dein erstaunter Gesichtsausdruck vergehen. Wenn du vierzig bist, allmählich ergraust und fast krank vor Sorge um deinen Ältesten bist, werde ich siebzig sein. Ich werde in der Sonne sitzen und zusehen, wie die Birnen an der Wand reifen, und M. Saulce und der Curé werden vorbeikommen und zum Gruß an ihren Hut tippen.
Was denken wir über Väter? Wichtig oder nicht? Rousseau sieht es folgendermaßen:
Die älteste und einzig natürliche Form aller Gesellschaften ist die Familie; obgleich die Kinder nur so lange mit dem Vater verbunden bleiben, wie sie seiner zu ihrer Erhaltung bedürfen … Demnach ist die Familie, wenn man will, das erste Muster der politischen Gesellschaften. Der Herrscher ist das Abbild des Vaters, das Volk ist das Abbild der Kinder.
Hier also noch einige Familiengeschichten.
M. Danton hatte vier Töchter sowie, jünger als diese, einen Sohn. Zu Letzterem hatte er keine spezielle Haltung; allenfalls verspürte er etwas wie Erleichterung angesichts seines Geschlechts. Im Alter von vierzig Jahren starb M. Danton. Seine Witwe war schwanger, verlor das Kind jedoch. Später im Leben meinte Georges-Jacques, sich an seinen Vater zu erinnern. Über die Toten wurde in seiner Familie oft gesprochen. Er hatte diese Unterhaltungen aufgesogen und sie in etwas umgewandelt, das als Erinnerung durchging. Das war durchaus in Ordnung. Die Toten kommen nicht zurück, um zu mäkeln oder zu berichtigen.
M. Danton war Schreiber an einem der örtlichen Gerichte gewesen. Es war etwas Geld vorhanden, etwas Grundbesitz, ein paar Häuser. Madame kam zurecht. Sie war eine herrische kleine Frau, die das Leben mit ausgefahrenen Ellenbogen anging. Ihre Schwäger kamen jeden Sonntag vorbei und erteilten ihr Rat.
Die Kinder verwilderten. Sie machten die Zäune anderer Leute kaputt, jagten Schafe und trieben auch sonst so manchen Unfug, den man auf dem Land eben treiben kann. Zur Rede gestellt, gaben sie freche Antworten. Und die Kinder anderer Familien warfen sie in den Fluss.
»Dass Mädchen sich so aufführen!«, sagte M.Camus, Madames Bruder.
»Das sind nicht die Mädchen«, sagte Madame. »Es ist Georges-Jacques. Aber sie müssen sich nun mal irgendwie durchschlagen.«
»Bloß sind wir hier nicht im Dschungel«, sagte M.Camus. »Oder in Patagonien. Wir sind in Arcis-sur-Aube.«
Arcis ist grün, das umliegende Land ist flach und gelb. Das Leben schreitet gemächlich voran. M.Camus betrachtet das Kind, das draußen vor dem Fenster Steine gegen die Scheune wirft.
»Der Junge ist wild und viel zu dick«, sagt M.Camus. »Wieso hat er einen Verband um den Kopf?«
»Warum sollte ich dir das verraten? Du wirst ihn nur schlechtmachen.«
Zwei Tage zuvor hatte eines der Mädchen ihn in der Wärme des frühen Abends nach Hause gebracht. Sie seien auf der Bullenweide gewesen, erzählte sie, und hätten Urchristen gespielt. So gab Anne Madeleine dem Ganzen einen frommen Anstrich; natürlich war es vorstellbar, dass nicht alle der frühkirchlichen Märtyrer bereit gewesen waren, sich aufspießen zu lassen, und dass einige sich wie Georges-Jacques mit einem spitzen Stock bewaffnet hatten. Das Horn des Bullen hatte sein halbes Gesicht aufgerissen. Voller Panik hatte seine Mutter seinen Kopf in die Hände genommen, das Fleisch zusammengeschoben und wider alle Vernunft gehofft, dass es halten würde. Sie legte ihm einen straffen Verband am Gesicht an und bandagierte zusätzlich seinen Kopf, um die Beulen und Risse auf der Stirn abzudecken. Zwei Tage blieb er derart behelmt im Haus und brütete in aggressiver Stimmung vor sich hin. Er klagte über Kopfschmerzen. Heute war der dritte Tag.
Vierundzwanzig Stunden nachdem M.Camus gegangen war, stand Mme Danton wieder am Fenster und sah – benommen, wie in einem grässlichen, sich wiederholenden Traum – zu, wie die sterblichen Überreste ihres Sohnes von den Feldern herangeschafft wurden. Ein Landarbeiter trug den schweren Körper in seinen Armen; sie sah, wie seine Knie unter dem Gewicht einknickten. Zwei Hunde liefen mit eingeklemmtem Schwanz hinterher, und das Schlusslicht bildete die vor Wut und Verzweiflung laut heulende Anne Madeleine.
Von nahem sah Mme Danton, dass der Mann Tränen in den Augen hatte. »Wir werden diesen verdammten Bullen schlachten müssen«, sagte er. Sie gingen in die Küche. Alles war voll Blut. Auf dem Hemd des Mannes war Blut, auf dem Fell des Hundes, auf Anne Madeleines Schürze, ja selbst auf ihrem Haar. Es lief auf den Boden. Sie suchte nach etwas – einer Decke, einem sauberen Tuch –, worauf sie den Leichnam ihres einzigen Sohnes betten konnte. Der Arbeiter taumelte erschöpft gegen die Wand und hinterließ einen langen rostfarbenen Streifen auf dem Putz.
»Legen Sie ihn auf den Boden«, sagte sie.
Als die kalten Fliesen seine Wange berührten, stöhnte der Junge leise, und da erst erkannte sie, dass er gar nicht tot war. Anne Madeleine sagte mit monotoner Stimme De profundis auf: »Von einer Morgenwache bis zur andern/Israel hoffe auf den HERRN.« Ihre Mutter gab ihr eine Ohrfeige, damit sie aufhörte. Dann flog ein Huhn durch die Tür herein und setzte sich auf ihren Fuß.
»Schlagen Sie das Mädchen nicht«, sagte der Mann. »Sie hat ihn unter den Beinen des Bullen hervorgezerrt.«
Georges-Jacques öffnete die Augen und erbrach sich. Sie hießen ihn stillhalten und untersuchten seine Gliedmaßen auf Brüche. Seine Nase war gebrochen. Er atmete Blutblasen. »Schneuz dich nicht«, sagte der Mann. »Sonst fliegt dein Gehirn raus.«
»Bleib ganz still liegen, Georges-Jacques«, sagte Anne Madeleine. »Du hast dem Bullen einen ordentlichen Denkzettel verpasst. Wenn er dich das nächste Mal sieht, rennt er davon.«
Seine Mutter sagte: »Ich wünschte, ich hätte einen Mann.«
Niemand hatte vor dem Unfall groß auf seine Nase geachtet, sodass keiner sagen konnte, ob ein vornehmes körperliches Merkmal Schaden genommen hatte. Aber von der Wunde, die ihm der Bulle ins Gesicht gerissen hatte, blieb eine hässliche Narbe zurück. Sie verlief seitlich über seine Wange und mündete als bräunlich-roter Sporn in seiner Oberlippe.
Im folgenden Jahr bekam er die Pocken. Die Mädchen ebenso; wie es sich fügte, überlebten sie alle. Seine Mutter empfand seine Pockennarben nicht als Beeinträchtigung. Wenn schon hässlich, dann am besten gleich richtig, gleichsam aus vollem Herzen. Nach Georges drehten sich die Leute um.
Als er zehn war, heiratete seine Mutter wieder. Einen Kaufmann aus dem Ort namens Jean Recordain; er war Witwer und hatte einen (ruhigen) Jungen großzuziehen. Er hätte ein paar kleine Eigenheiten, aber sie war der Ansicht, dass sie sehr gut zusammenpassten. Georges ging zur Schule, einer kleinen in der Nachbarschaft. Er merkte schnell, dass er völlig mühelos lernte, und ließ sich in seinem Leben folglich durch die Schule nicht weiter beirren. Eines Tages rannte ihn eine Herde Schweine um. Er trug Wunden und Prellungen davon, ein, zwei weitere Narben, die unter seinem drahtigen Haar verschwanden.
»Das ist mit Sicherheit das letzte Mal, dass ich auf mir herumtrampeln lasse«, sagte er. »Ob von Vierbeinern oder von Zweibeinern.«
»Gebe Gott, dass es so sei«, sagte sein Stiefvater andächtig.
Ein Jahr verstrich. Eines Tages brach er plötzlich zusammen, mit hohem Fieber und klappernden Zähnen. Er hustete, hatte blutigen Auswurf und ein Schaben und Rasseln in der Brust, das im ganzen Zimmer zu hören war. »Es steht vermutlich nicht gut um seine Lunge«, sagte der Arzt. »Nachdem immer wieder Rippen in sie hineingedrückt worden sind. Tut mir leid, meine Liebe. Sie holen wohl besser den Priester.«
Der Priester kam und gab ihm die letzte Ölung. Doch in der folgenden Nacht starb der Junge nicht. Und auch drei Tage später klammerte er sich noch an ein komatöses Halbleben. Seine Schwester Marie-Cécile organisierte eine Gebetskette und übernahm selbst die anstrengendste Schicht, von zwei Uhr morgens bis zum Tagesanbruch. Der Salon füllte sich mit Verwandten, die herumsaßen und versuchten, das Richtige zu sagen. Beklommenes Schweigen wechselte sich mit dem verzweifelten Durcheinanderreden aller Anwesenden ab. Von jedem Atemzug wurde Kunde gegeben.
Am vierten Tag setzte er sich auf, erkannte seine Familie. Am fünften Tag machte er Witze und verlangte nach größeren Mengen Essen.
Der Arzt erklärte, er sei außer Gefahr.
Man hatte vorgehabt, das Grab zu öffnen und ihn neben seinem Vater zu bestatten. Der Sarg, der bereits in einem Nebengebäude wartete, musste zurückgeschickt werden. Glücklicherweise hatte man nur eine Anzahlung geleistet.
Während Georges-Jacques genas, unternahm sein Stiefvater eine Fahrt nach Troyes. Als er wiederkam, verkündete er, er habe einen Platz am Konvikt für den Jungen organisiert.
»Du Trottel«, sagte seine Frau. »Gib’s zu, du willst ihn doch nur aus dem Haus haben.«
»Wie soll ich mich meinen Erfindungen widmen?«, fragte Recordain sachlich. »Ich lebe auf einem Schlachtfeld. Wenn es keine trampelnden Schweine sind, ist es eine rasselnde Lunge. Wer sonst steigt im November in den Fluss? Wer steigt überhaupt in den Fluss? In Arcis muss man nicht schwimmen können. Der Junge kennt keine Grenzen.«
»Vielleicht kann ja wirklich ein Priester aus ihm werden«, sagte Madame versöhnlich.
»O ja«, sagte Onkel Camus. »Ich sehe es richtig vor mir, wie er sich um seine Schäfchen kümmert. Vielleicht schicken sie ihn ja auf einen Kreuzzug.«
»Ich frage mich, woher er seine Intelligenz hat«, sagte Madame. »In der Familie liegt sie jedenfalls nicht.«
»Danke«, sagte ihr Bruder.
»Wobei er natürlich nicht Priester werden muss, wenn er aufs Konvikt geht. Er kann auch Jurist werden. Es gibt schon ein paar Juristen in der Familie.«
»Und wenn ihm die Entscheidung nicht behagt? Man mag es sich gar nicht vorstellen.«
»Wie dem auch sei«, sagte Madame, »lass ihn mir noch ein, zwei Jahre, Jean. Er ist mein einziger Sohn. Er ist mir ein Trost.«
»Ganz wie du möchtest«, sagte Jean Recordain. Er war ein milder, umgänglicher Mann, der den Wünschen seiner Frau stets entgegenkam; einen Großteil seiner Zeit verbrachte er in einem abgelegenen Wirtschaftsgebäude, wo er mit der Entwicklung einer Maschine zum Spinnen von Baumwolle beschäftigt war. Sie werde die Welt verändern, behauptete er.
Sein Stiefsohn war vierzehn Jahre alt, als er, ein lauter und massiger Junge, in die alte Domstadt Troyes umsiedelte. In Troyes herrschten Sitte und Ordnung. Das Vieh hatte einen Sinn für seine untergeordnete Stellung im Universum, und Schwimmen hatten die Patres verboten. Es bestand eine gewisse Chance, dass er überleben würde.
Im Rückblick sollte er seine Kindheit immer als außerordentlich glücklich beschreiben.
In einem spärlicheren, graueren, nördlicheren Licht wird eine Hochzeit gefeiert. Es ist der 2. Januar; die wenigen frierenden Gäste können einander auch gleich ein gutes neues Jahr wünschen.
Jacqueline Carraults Liebesaffäre hatte sich über den Frühling und Sommer 1757 erstreckt, und am Michaelistag wusste sie, dass sie schwanger war. Sie irrte sich nie. Oder wenn, dachte sie, dann gleich sehr grundsätzlich.
Da ihr Liebhaber ihr inzwischen die kalte Schulter zeigte und ihr Vater ein Choleriker war, ließ sie die Mieder ihrer Kleider aus und verhielt sich unauffällig. Wenn sie am Tisch ihres Vaters saß und keinen Bissen herunterbrachte, steckte sie das Essen dem Terrier zu, der neben ihrem Rock saß.
»Hättest du mich früher informiert«, sagte ihr Liebhaber, »dann hätte es bloß das Drama gegeben, dass die Tochter eines Brauers in die Familie de Robespierre einheiratet. Aber so wie du zurzeit auseinandergehst, kriegen wir auch noch einen handfesten Skandal dazu.«
»Ein Kind der Liebe«, sagte Jacqueline. Sie war eigentlich keine Romantikerin, fühlte sich jetzt jedoch zu dieser Rolle genötigt. Sie stand erhobenen Hauptes vor dem Altar und blickte der Verwandtschaft fest in die Augen. Ihrer eigenen Verwandtschaft – die de Robespierres waren nicht erschienen.
François war sechsundzwanzig Jahre alt. Er war der aufgehende Stern der örtlichen Anwaltskammer und einer der begehrtesten Junggesellen im Arrondissement. Die de Robespierres waren seit dreihundert Jahren im Arrondissement Arras ansässig. Sie hatten kein Geld und waren sehr stolz. Jacqueline war überrascht von dem Haushalt, in den sie da aufgenommen wurde. Ihr Vater, der Brauer, schimpfte den ganzen Tag herum und brüllte seine Arbeiter an, doch zu Hause kam fetter Braten auf den Tisch. Die de Robespierres gingen höflich miteinander um und aßen dünne Suppe.
Da sie Jacqueline für ein robustes, gewöhnliches Mädchen hielten, setzten sie ihr riesige Portionen von dem wässerigen Zeug vor. Sogar das Bier ihres Vaters boten sie ihr an. Aber Jacqueline war nicht robust. Sie war kränklich und schwach. Gut, dass sie in eine vornehme Familie eingeheiratet hat, lästerten die Leute. Zum Arbeiten wäre sie eh nicht geeignet. Ein reines Zierstück sei sie, ein Porzellanpüppchen, dessen schmale Figur durch das werdende Kind entstellt wurde.
François hatte sich vor den Priester gestellt und seine Pflicht getan, doch sobald sich ihre Körper zwischen den Laken trafen, spürte er wieder die ursprüngliche Leidenschaft. Er fühlte sich zu dem neuen Herz, das in ihrem Leib schlug, zur archaischen Rundung ihres Brustkorbs hingezogen. Ehrfürchtig betrachtete er ihre durchscheinende Haut, die am Puls wie Marmor grünliche Adern sehen ließ. Ihre kurzsichtigen grünen Augen zogen ihn an, große Augen, die wie die einer Katze mal sanft, mal hart dreinblicken konnten. Wenn sie redete, kamen die Sätze oft wie kleine Tatzenhiebe.
»Diese salzige Suppe fließt denen durch die Adern«, sagte sie. »Und wenn man ihnen eine Schnittwunde zufügen würde, kämen gute Manieren herausgeflossen. Gott sei Dank sind wir ab morgen in unserem eigenen Haus.«
Es war ein Winter der Peinlichkeit und Bedrängnis. François’ zwei Schwestern wanderten hin und her, überbrachten Botschaften und hatten Angst, zu viel zu sagen. Jacquelines Kind, ein Junge, kam am 6. Mai um zwei Uhr morgens zur Welt. Später am Tag traf sich die Familie am Taufstein. François’ Vater war Pate, also wurde das Kind nach ihm benannt. Das sei ein guter, alter Familienname, erklärte er Jacquelines Mutter, und ihre Tochter gehöre jetzt zu einer guten, alten Familie.
Innerhalb der nächsten fünf Jahre gingen drei weitere Kinder aus der Ehe hervor. Erst Übelkeit, dann Angst, dann Schmerz, das war bald der Normalzustand für Jacqueline. Sie erinnerte sich an kein anderes Leben mehr.
An jenem Tag las ihnen Tante Eulalie eine Geschichte vor. Sie hieß »Der Fuchs und die Katze«. Tante Eulalie las sehr schnell, blätterte hastig um. Das nennt man »nicht bei der Sache sein«, dachte er. Als Kind bekäme man dafür eine Ohrfeige. Dabei war es sein Lieblingsbuch.
Wie sie so das Kinn vorstreckte, wenn sie jemandem zuhörte, und ihre sandfarbenen Augenbrauen zusammenzog, ähnelte sie selbst dem Fuchs. Da ihn keiner beachtete, ließ er sich auf den Boden gleiten und spielte mit der Spitze an ihrer Manschette. Seine Mutter konnte Spitze klöppeln.
Eine böse Vorahnung beschlich ihn – er durfte sonst nie auf dem Boden sitzen (die guten Kleider abnutzen).
Seine Tante unterbrach sich mitten im Satz, um zu horchen. Oben lag Jacqueline im Sterben. Ihre Kinder wussten es noch nicht.
Die Hebamme hatte man hinausgeschickt, denn sie war keine Hilfe gewesen. Sie saß jetzt in der Küche und aß Käse, schälte ihn mit Hingabe von der Rinde herunter und ängstigte das Dienstmädchen mit Geschichten von ähnlichen Fällen. Man hatte nach dem Wundarzt geschickt; François stand oben auf der Treppe und diskutierte mit ihm. Tante Eulalie sprang auf und schloss die Tür, aber sie waren immer noch zu hören. Sie las mit einem eigenartigen Unterton und stieß dabei mit ihrer schmalen weißen Damenhand sanft Augustins Wiege an, wieder und wieder.
»Ich sehe keine andere Möglichkeit, sie zu entbinden«, sagte der Mann, »als durch einen Schnitt.« Er sprach das Wort sichtlich ungern aus, aber er musste es benutzen. »Das Kind können wir dadurch vielleicht retten.«
»Retten Sie sie«, sagte François.
»Wenn ich nichts tue, werden beide sterben.«
»Lassen Sie das Kind sterben, aber retten Sie sie.«
Eulalie umklammerte jäh den Rand der Wiege, und bei dem plötzlichen Ruck begann Augustin zu weinen. Der glückliche Augustin – er war bereits geboren.
Sie stritten jetzt lautstark; der Wundarzt war ungehalten, weil der Laie so begriffsstutzig war. »Dann kann ich auch gleich den Metzger holen!«, schrie François.
Tante Eulalie erhob sich, und das Buch rutschte ihr aus der Hand, glitt an ihrem Rock hinunter und landete aufgeklappt auf dem Boden. Sie rannte die Treppe hinauf. »Nicht so laut, Herrgott noch mal! Die Kinder!«
Die Seiten fächerten sich auf – der Fuchs und die Katze, die Schildkröte und der Hase, die kluge Krähe mit dem glitzernden Auge, der Honigbär unter dem Baum. Maximilien hob das Buch auf und strich die Eselsohren glatt. Er legte das pummelige Händchen seiner Schwester auf die Wiege. »So«, sagte er und stieß die Wiege an.
Sie hob ihr Gesicht mit dem schlaffen Kindermund. »Warum?«
Tante Eulalie ging an ihm vorüber, ohne ihn wahrzunehmen, Schweißtröpfchen an der Oberlippe. Er tapste die Treppe hinauf. Sein Vater saß in sich zusammengesunken in einem Sessel und weinte, den Arm vor den Augen. Der Wundarzt wühlte in seiner Tasche. »Meine Zange«, sagte er. »Ich will es zumindest versuchen. Manchmal ist diese Technik erfolgreich.«
Das Kind stieß die Tür einen Spaltbreit auf, gerade so weit, dass es hindurchschlüpfen konnte. Die Fenster waren geschlossen, um den Frühsommer auszusperren, das Gesumme und den Duft aus Garten und Feldern. Ein kräftiges Feuer brannte, und in einem Korb lagen weitere Scheite bereit. Eine drückende, sichtbare Hitze erfüllte den Raum. Seine Mutter lehnte in den Kissen, ihr Körper in Weiß gehüllt, das Haar aus der Stirn gekämmt und von einem Band gehalten. Sie wandte ihm den Blick zu, nur die Augen, nicht den Kopf, mit einem angedeuteten, leblosen Lächeln. Die Haut um ihren Mund war grau. Bald, schien sie zu sagen, werden wir beide voneinander scheiden.
Als er das sah, wandte er sich ab. An der Tür hob er die Hand in ihre Richtung, eine zaghafte Erwachsenengeste, die Solidarität ausdrückte. Draußen vor der Tür hatte der Wundarzt mittlerweile abgelegt und wartete darauf, dass ihm jemand den Mantel, den er überm Arm hielt, abnahm. »Wenn man mich ein paar Stunden früher geholt hätte …«, sagte er, an niemand Bestimmten gerichtet. François’ Sessel war leer. Er schien das Haus verlassen zu haben.
Der Priester traf ein. »Falls der Kopf herauskommt«, sagte er, »würde ich ihn taufen.«
»Wenn der Kopf herauskommt, sind unsere Sorgen vorbei«, sagte der Wundarzt.
»Oder irgendein Körperteil«, sagte der Priester hoffnungsvoll. »Die Kirche befürwortet das.«
Eulalie kam wieder ins Zimmer. Als sie die Tür öffnete, quoll die heiße Luft heraus. »Hier ist es ja furchtbar stickig. Ob ihr das gut tut?«
»Unterkühlung kann verheerende Folgen haben«, sagte der Wundarzt. »Wobei …«
»Dann die letzte Ölung«, schlug der Priester vor. »Ich hoffe, es gibt hier irgendwo einen geeigneten Tisch.«
Er zog eine weiße Altardecke aus seiner Tasche, dann holte er seine Kerzen heraus. Die Gnade Gottes, handlich und transportabel, zum Gebrauch an Heim und Herd.
Der Blick des Wundarztes schweifte über den Treppenabsatz. »Bringen Sie das Kind weg«, sagte er.
Eulalie nahm ihn in die Arme: das Kind der Liebe. Als sie ihn hinuntertrug, schabte der Stoff ihres Kleides leise raschelnd über seine Wange.
Eulalie wies die Kinder an, sich an der Eingangstür in einer Reihe aufzustellen. »Eure Handschuhe«, sagte sie. »Eure Mützen.«
»Es ist doch warm«, sagte er. »Wir brauchen keine Handschuhe.«
»Trotzdem«, sagte sie. Ihr Gesicht schien zu beben.
Die Amme schob sich an ihnen vorbei, Augustin, den Säugling, mit einer Hand an die Schulter gepresst wie einen Sack. »Fünf in sechs Jahren«, sagte sie zu Eulalie. »Was kann man da erwarten? Diesmal hat sie eben Pech gehabt.«
Sie gingen zu Großvater Carraut. Später am Tag kam Tante Eulalie und sagte, sie sollten für ihr Brüderchen beten. Großmutter Carraut formte mit den Lippen die lautlose Frage: »Getauft?« Tante Eulalie schüttelte den Kopf. Sie warf einen Blick auf die Kinder, der besagte: Kann jetzt nicht reden. Ebenfalls lautlos gab sie Großmutter zu verstehen: »Totgeburt.«
Er schauderte. Tante Eulalie beugte sich zu ihm hinunter und gab ihm einen Kuss. »Wann kann ich nach Hause?«, fragte er.
»Für ein paar Tage seid ihr bei Großmutter ganz gut aufgehoben, so lange, bis es eurer Mutter besser geht.«
Doch er erinnerte sich an die graue Haut um ihren Mund. Er begriff, was dieser Mund zu ihm gesagt hatte: Bald liege ich im Sarg, bald werde ich begraben.
Er fragte sich, warum man sie belog.
Er zählte die Tage. Tante Eulalie und Tante Henriette waren mal hier, mal dort. Sie fragten: Wollt ihr denn nicht wissen, wie es eurer Mutter heute geht? Tante Henriette sagte zu Großmutter: »Maximilien fragt gar nicht, wie es seiner Mutter geht.«
Großmutter erwiderte: »Er ist ein kalter Bursche.«
Er zählte die Tage, bis sie sich entschließen würden, die Wahrheit zu sagen. Neun Tage verstrichen. Sie saßen beim Frühstück, bei Brot und Milch, als Großmutter hereinkam.
»Ihr müsst jetzt sehr tapfer sein«, sagte sie. »Eure Mutter ist zu Jesus gegangen.«
Zum Jesuskind, dachte er. Und sagte: »Ich weiß.«
Er war sechs, als das geschah. Ein weißer Vorhang flatterte in dem leichten Wind, der durch das offene Fenster hereinkam, ein paar Spatzen hüpften auf dem Fensterbrett herum; Gottvater, himmlische Wolken im Gefolge, blickte von einem Bild an der Wand herab.
Einen oder zwei Tage später deutete seine Schwester Charlotte auf den Sarg, und die kleinere Schwester Henriette saß unbeachtet in einer Ecke und quengelte.
»Ich lese dir was vor«, sagte er zu Charlotte. »Aber nicht aus dem Tierbuch. Das ist mir zu kindisch.«
Später hob ihn die erwachsene Henriette, seine Tante, hoch, damit er in den Sarg schauen konnte, bevor der Deckel geschlossen wurde. Sie zitterte und sagte über seinen Kopf hinweg: »Ich wollte nicht, dass er sie sieht, aber Großvater Carraut hat gesagt, es muss sein.« Er begriff sehr gut, dass das seine Mutter war, diese Leiche mit der schmalen Hakennase und den schrecklichen papiernen Händen.
Tante Eulalie rannte auf die Straße hinaus. Sie sagte: »François, bitte!« Maximilien lief ihr hinterher, griff nach ihrem Rock; er sah, dass sich sein Vater kein einziges Mal umdrehte. François schritt zügig in Richtung Stadt aus. Tante Eulalie zog das Kind wieder mit sich ins Haus. »Er muss die Todesurkunde unterzeichnen«, sagte sie. »Aber er sagt, dass er seinen Namen nicht daruntersetzen wird. Was machen wir jetzt?«
Am nächsten Tag kam François wieder. Er roch nach Weinbrand, und Großmutter sagte, es sei offensichtlich, dass er bei einer Frau gewesen sei.
In den folgenden Monaten begann François stark zu trinken. Er vernachlässigte seine Klienten, die bald woandershin gingen. Er verschwand manchmal tagelang, und eines Tages packte er eine Tasche und erklärte, er gehe für immer.
Sie sagten – Großmutter und Großvater Carraut –, sie hätten ihn eh nie gemocht. Wir haben keinen Streit mit den de Robespierres, sagten sie, das sind anständige Menschen, aber er ist kein anständiger Mensch. Zunächst erhielt man die Fiktion aufrecht, dass er in einer anderen Stadt an einem aufwendigen, prestigeträchtigen Fall arbeite. Von Zeit zu Zeit schneite er tatsächlich wieder herein, meistens um sich Geld zu leihen. Die älteren de Robespierres sahen sich – »in unserem Lebensalter« – außerstande, seinen Kindern ein Heim zu bieten. Großvater Carraut nahm die beiden Jungen zu sich, Maximilien und Augustin. Tante Eulalie und Tante Henriette erklärten sich bereit, die beiden kleinen Mädchen aufzunehmen.
Irgendwann in seiner Kindheit fand Maximilien heraus – oder bekam es erzählt –, dass er außerehelich gezeugt worden war. Wahrscheinlich interpretierte er das auf die schlimmstmögliche Weise, denn von diesem Moment an sprach er nie wieder von seinen Eltern.
1768 tauchte François de Robespierre nach zweijähriger Abwesenheit wieder in Arras auf. Er sagte, er sei im Ausland gewesen, erzählte jedoch nicht, wo oder wovon er gelebt hatte. Er ging zu Großvater Carraut und wollte seinen Sohn sehen. Maximilien stand in einem Korridor und hörte die beiden hinter verschlossener Tür laut reden.
»Du sagst, du bist bis heute nicht darüber hinweggekommen«, sagte Großvater Carraut. »Aber hast du dich je gefragt, ob dein Sohn darüber hinweggekommen ist? Das Kind gerät nach ihr, es ist nicht kräftig; sie war auch nicht kräftig, und das wusstest du, als du dich ihr nach jeder Geburt gleich wieder aufgedrängt hast. Es ist nur mir zu verdanken, dass sie Kleider am Leibe haben und als Christen aufwachsen.«
Sein Vater kam heraus, entdeckte ihn und sagte: Er ist dünn, er ist klein für sein Alter. Ein paar Minuten lang sprach er mit ihm, bemüht, verlegen. Bevor er ging, beugte er sich herunter und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Sein Atem roch schlecht. Mit einer erwachsenen, angewiderten Miene zog das Kind der Liebe den Kopf weg. François schien enttäuscht. Hatte er vielleicht eine Umarmung erwartet, einen Kuss, hatte er seinen Sohn durch die Luft schwingen wollen?
Später fragte sich der Junge, der seine starken Gefühle sparsam zu dosieren gelernt hatte, ob er Bedauern empfinden sollte. Er fragte seinen Großvater: »Ist mein Vater wegen mir gekommen?«
»Er ist gekommen, weil er wieder Geld gebraucht hat. Werd endlich erwachsen«, knurrte der alte Mann und ging weg.
Maximilien machte seinen Großeltern keinerlei Ärger. Man merke kaum, dass er im Haus sei, sagten sie. Er las gern und hielt Tauben in einem Verschlag im Garten. Sonntags wurden die beiden kleinen Mädchen herübergebracht, und sie spielten zusammen. Er ließ sie – ganz sacht, mit einem Finger – den Rücken der zitternden Taube streicheln.
Sie bettelten um eine Taube, die sie selbst zu Hause halten wollten. Ich kenne euch doch, sagte er, in ein, zwei Tagen werdet ihr genug von ihr haben, aber man muss sich um sie kümmern, das sind keine Puppen, versteht ihr? Sie ließen nicht locker: Sonntag um Sonntag plärrten und jammerten sie. Schließlich ließ er sich erweichen. Tante Eulalie kaufte einen schönen vergoldeten Käfig.
Nach wenigen Wochen war die Taube tot. Sie hatten den Käfig draußen stehen lassen, und es hatte ein Gewitter gegeben. Er stellte sich vor, wie der Vogel sich in Panik gegen die Gitterstäbe geworfen und die Flügel gebrochen hatte, während über ihm der Donner grollte. Charlotte erzählte es ihm unter reuevollem Schluchzen und Hicksen, doch er wusste, dass sie fünf Minuten später in die Sonne hinausstürmen und nicht mehr daran denken würde. »Wir haben den Käfig rausgestellt, damit sie sich frei fühlt«, sagte sie schniefend.
»Das war kein freier Vogel. Um diese Vögel muss man sich kümmern. Ich habe es euch gesagt. Und ich hatte recht.«
Aber es bereitete ihm keine Freude, recht zu haben. Es hinterließ einen bitteren Nachgeschmack.
Sein Großvater sagte, wenn Maximilien alt genug sei, werde er ihn in sein Geschäft aufnehmen. Er führte das Kind durch die Brauerei, erklärte ihm die verschiedenen Produktionsschritte und ließ ihn mit den Männern sprechen. Der Junge zeigte nicht mehr als höfliches Interesse. Sein Großvater sagte, er könne auch Priester werden, da er ja eher dem Theoretischen als dem Praktischen zuneige. »Den Betrieb kann auch Augustin übernehmen«, sagte er. »Oder wir verkaufen ihn. Ich bin nicht sentimental. Es gibt noch andere Berufe als den des Brauers.«
Als Maximilien zehn Jahre alt war, machte man den Abt von Saint-Waast auf die Familie aufmerksam. Er befragte Maximilien persönlich und war nicht sonderlich von ihm angetan. Trotz seiner zurückhaltenden Art schien er für die Ansichten des Abtes Verachtung zu empfinden, so als hätte er Höheres im Sinn und als erwarteten ihn anderswo vielfältige Aufgaben. Andererseits lag auf der Hand, dass hier eine ausgeprägte Intelligenz zu verkümmern drohte. Dem Abt war immerhin bewusst, dass der Junge an den Missgeschicken in seinem Leben keine Schuld trug. Man konnte etwas für ihn tun; er besuchte seit drei Jahren die Schule in Arras, und seine Lehrer waren voll des Lobes über sein Fortkommen und seinen Fleiß.
Der Abt verschaffte ihm ein Stipendium. Er hatte nicht in kleinen Kategorien gedacht, als er sagte: »Ich werde etwas für dich tun.« Louis-le-Grand sollte es sein, die beste Schule des Landes, an der die Söhne des Adels ihre Ausbildung erhielten – eine Schule, die an Begabten interessiert war und an der es auch ein Junge aus bescheidenen Verhältnissen zu etwas bringen konnte. So der Abt, der seinerseits an harter Arbeit, blindem Gehorsam und ewiger Dankbarkeit Gefallen fand.
Maximilien sagte zu seiner Tante Henriette: »Wenn ich weggehe, musst du mir schreiben.«
»Natürlich.«
»Und Charlotte und Henriette sollen mir bitte auch schreiben.«
»Dafür werde ich sorgen.«
»In Paris werde ich sicher viele neue Freunde finden.«
»Bestimmt.«
»Und wenn ich erwachsen bin, werde ich für meine Schwestern und meinen Bruder sorgen. Dann muss das niemand anders mehr machen.«
»Und was ist mit deinen alten Tanten?«
»Für euch auch. Wir werden in einem großen Haus zusammen wohnen. Und uns nie mehr streiten.«
Sehr wahrscheinlich, dachte sie. Sie fragte sich: Ist es richtig, dass er geht? Er war noch so klein mit seinen zwölf Jahren, so leise und zurückhaltend; sie hatte Angst, dass man ihn außerhalb des Hauses seines Großvaters überhaupt nicht wahrnehmen würde.
Aber nein – natürlich musste er gehen. Solche Gelegenheiten boten sich wahrlich nicht oft; man musste vorwärtskommen im Leben, da half es nichts, sich am Schürzenband einer Frau festzuklammern. Manchmal erinnerte er sie an seine Mutter: Er hatte die gleichen meerfarbenen Augen, die das Licht einzufangen schienen. Ich habe nie etwas gegen das Mädchen gehabt, dachte sie. Jacqueline hatte ein weiches Herz.
Im Sommer 1769 arbeitete er an seinem Latein und Griechisch. Er gab die Versorgung der Tauben in die Hände eines Nachbarmädchens, das wenig älter war als er. Im Oktober fuhr er.
In Guise war es unter den Augen der de Viefvilles mit Maître Desmoulins’ Karriere vorangegangen. Er war Richter geworden. Abends nach dem Essen saßen er und Madeleine da und schauten einander an. Das Geld war immer knapp.
1767 – Armand hatte gerade laufen gelernt, und Anne-Clothilde war das jüngste Kind der Familie – sagte Jean-Nicolas zu seiner Frau: »Camille sollte woanders zur Schule gehen.«
Camille war mittlerweile sieben. Er folgte seinem Vater weiterhin durchs Haus, redete nach de Viefvillescher Manier unablässig und ließ kein gutes Haar an Jean-Nicolas’ Ansichten.
»Er sollte nach Cateau-Cambrésis gehen«, sagte Jean-Nicolas. »Zu seinen kleinen Vettern. Es ist ja nicht weit von hier.«
Madeleine hatte sehr viel zu tun. Das älteste Mädchen war dauernd krank, die Bediensteten nutzten sie aus, und das Haushaltsbudget war so schmal, dass zeitaufwendige Sparmaßnahmen erforderlich waren. Jean-Nicolas erwartete von ihr, dass sie das alles bewältigte, und außerdem sollte sie sich auch noch um seine Gefühle kümmern.
»Ist er nicht ein bisschen jung, um die Bürde deiner unerfüllten Ambitionen zu tragen?«, fragte sie.
Denn bei Jean-Nicolas hatte die Verbitterung eingesetzt. Er hatte sich seine Tagträumerei selbst ausgetrieben. Wenige Jahre später sollten ihn am Gericht von Guise vielversprechende junge Anwälte fragen: Warum haben Sie sich bei Ihrer unbezweifelbaren Begabung eigentlich mit diesem eingeschränkten Wirkungskreis zufriedengegeben, Monsieur? Worauf er sie anfuhr, ihm genüge seine eigene Provinz, und auch ihnen solle sie genügen.
Im Oktober schickten sie Camille nach Cateau-Cambrésis. Kurz vor Weihnachten kam ein überschwänglicher Brief des Schuldirektors, der Camilles erstaunliche Fortschritte pries. Jean-Nicolas wedelte den Brief durch die Luft und sagte zu seiner Frau: »Hab ich’s dir nicht gesagt? Ich wusste doch, dass es das Richtige sein würde.«
Aber Madeleine beunruhigte der Brief. »Es klingt, als wollten sie eigentlich sagen: ›Wie intelligent und attraktiv Ihr Kind doch ist, obwohl es nur ein Bein hat!‹«
Jean-Nicolas fasste das als witzige Bemerkung auf. Erst am Tag zuvor hatte ihm Madeleine erklärt, er habe weder Humor noch Fantasie.
Etwas später kam das Kind nach Hause. Es hatte einen schrecklichen Sprachfehler entwickelt und ließ sich kaum dazu bewegen, überhaupt etwas zu sagen. Madeleine schloss sich in ihrem Zimmer ein und ließ sich das Essen nach oben bringen. Camille sagte, die Patres seien sehr nett zu ihm gewesen, es sei seine eigene Schuld. Um ihn aufzumuntern, sagte sein Vater, von Schuld könne ja wohl keine Rede sein, es sei halt eine kleine Unannehmlichkeit. Camille beharrte auf einer dubiosen eigenen Verfehlung und fragte kalt, wann er wieder in die Schule zurückfahren dürfe, denn dort schere sich keiner darum und es werde nicht ständig darüber geredet. Jean-Nicolas setzte sich in kämpferischer Stimmung mit der Schule in Verbindung und fragte, warum sein Sohn neuerdings stottere. Die Priester behaupteten, er habe schon bei seiner Ankunft gestottert, worauf Jean-Nicolas erwiderte, dass er bei seiner Abreise von zu Hause nun ganz gewiss nicht gestottert habe, sodass man zu dem Schluss kam, seine flüssige Rede müsse irgendwo unterwegs auf der Kutschfahrt abhandengekommen sein wie ein Koffer oder ein Paar Handschuhe. Niemand war schuld, es war eines dieser Dinge, die einfach passieren.
Im Jahr 1770, Camille war zehn Jahre alt, rieten die Priester seinem Vater, ihn von der Schule zu nehmen, da sie ihm nicht die Aufmerksamkeit widmen könnten, die er angesichts seiner Fortschritte verdiene. Madeleine meinte: »Wir könnten einen Privatlehrer für ihn suchen. Einen wirklich guten.«
»Bist du verrückt?«, schrie ihr Mann sie an. »Hältst du mich für einen Herzog? Oder für einen englischen Baumwollbaron? Denkst du, ich besitze eine Kohlengrube? Oder Leibeigene?«
»Nein«, sagte seine Frau. »Ich weiß genau, was du bist und was nicht. Ich habe keinerlei Illusionen mehr.«
Letztlich war es ein de Viefville, der das Problem löste. »Eines ist gewiss«, sagte er, »es wäre ein Jammer, wenn aus Ihrem klugen Söhnchen nichts werden würde, nur weil es am Geld fehlt. Denn Sie«, fügte er rüde hinzu, »werden in diesem Leben ja ganz offensichtlich keine Berge mehr versetzen.« Er grübelte. »Er ist ein reizender Junge. Wir gehen davon aus, dass sich das Stottern verlieren wird. Lassen Sie uns mal über Stipendien nachdenken. Wenn wir ihn am Louis-le-Grand unterbringen könnten, wären die Ausgaben für die Familie vernachlässigbar.«
»Würde man ihn dort denn nehmen?«
»Nach allem, was ich höre, ist er außerordentlich intelligent. Als Anwalt wird er eine Zierde für die Familie sein. Ich werde dafür sorgen, dass sich mein Bruder, wenn er das nächste Mal in Paris ist, für ihn verwendet. Muss ich mehr sagen?«
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Frankreich ist mittlerweile auf fast neunundzwanzig Jahre gestiegen.
Das Collège Louis-le-Grand war ein altes Institut. Es hatte ursprünglich unter der Leitung von Jesuiten gestanden; als diese des Landes verwiesen wurden, übernahmen es die Oratorianer, ein aufgeklärterer Orden. Die Alumni des Collège waren berühmt, aber sehr verschieden: Voltaire, nunmehr im ehrenvollen Exil, war einer von ihnen, ein anderer der Marquis de Sade, der sich jetzt in einem seiner châteaux verkrochen hatte, während seine Frau sich um die Milderung eines jüngst gegen ihn ergangenen Urteils wegen Vergiftung und Analverkehr bemühte.
Das Collège befand sich in der Rue Saint-Jacques und war durch wuchtige hohe Mauern und Eisentore von der Stadt getrennt. Geheizt wurde dort nur, wenn sich auf dem Weihwasser im Taufbecken der Kapelle eine Eisschicht bildete, weshalb es im Winter häufig vorkam, dass jemand frühmorgens Eiszapfen erntete und in das Becken warf, in der Hoffnung, dass der Direktor es nicht so eng sehen würde.
Ein eiskalter Luftzug fegte durch die Räume, trug gedämpftes Gemurmel in toten Sprachen weiter.
Maximilien de Robespierre war seit einem Jahr dort.
Bei seiner Ankunft hatte man ihm gesagt, er solle hart arbeiten – dem Abt zuliebe, denn dem Abt habe er diese großartige Gelegenheit schließlich zu verdanken. Und wenn er Heimweh bekomme, hatte man ihm gesagt, so werde es vergehen. Er setzte sich als Erstes hin und schrieb alles auf, was er auf der Reise gesehen hatte, damit er sich dieser Schuldigkeit entledigt und den Kopf für anderes frei haben würde. Die Verben konjugierten sich in Paris nicht anders als in Artois. Und wenn man sich auf die Verben konzentrierte, fügte sich der Rest von allein. Er folgte dem Unterricht mit größter Aufmerksamkeit. Seine Lehrer behandelten ihn freundlich. Er schloss keine Freundschaften.
Eines Tages näherte sich ihm ein älterer Schüler, der ein kleines Kind vor sich her trieb. »He, Dingsda«, sagte der Junge. (Die anderen taten immer so, als könnten sie sich nicht an seinen Namen erinnern.)
Maximilien blieb wie angewurzelt stehen, drehte sich jedoch nicht gleich um. »Meinen Sie mich?«, fragte er. Freundlich-herausfordernd, das konnte er gut.
»Ich möchte, dass du ein Auge auf dieses Wickelkind hast, das aus unerfindlichen Gründen hier gelandet ist. Er ist aus deiner Gegend – Guise, glaube ich.«
Maximilien dachte: Diese ignoranten Pariser meinen, das sei alles ein und dasselbe. Ruhig sagte er: »Guise liegt in der Picardie. Ich komme aus Arras. Arras liegt im Artois.«
»Was spielt das schon für eine Rolle? Ich hoffe, du kannst etwas Zeit von deinen angeblich so fortgeschrittenen Studien abzwacken und ihm helfen, sich hier zurechtzufinden.«
»Na schön«, sagte Maximilien. Er drehte sich auf dem Absatz um und betrachtete das sogenannte Wickelkind. Es war ein sehr hübscher, sehr dunkler Junge.
»Wohin möchtest du denn?«, fragte er.
In diesem Moment kam Pater Herivaux fröstelnd durch den Korridor gelaufen. Er blieb stehen. »Ah, Camille Desmoulins, du bist also da.« Pater Herivaux war ein angesehener Altphilologe. Er betrachtete es als seine Aufgabe, alles zu wissen. Doch Gelehrsamkeit hielt die herbstliche Kälte nicht fern, und es würde noch frostiger werden.
»Wie ich höre, bist du erst zehn Jahre alt.«
Das Kind blickte zu ihm auf und nickte.
»Und sehr weit für dein Alter?«
»Ja«, sagte das Kind. »So ist es.« Pater Herivaux biss sich auf die Lippe. Er eilte weiter. Maximilien setzte seine Brille ab und rieb sich die Augenwinkel. »Versuch es mal mit ›Ja, Pater‹«, schlug er vor. »Das wird hier erwartet. Nick nicht mit dem Kopf, das gefällt ihnen nicht. Und als er dich auf deine Begabung angesprochen hat, hättest du bescheidener sein sollen: ›Ich versuche mein Bestes, Pater‹, etwas in der Art.«
»Bist wohl ein Speichellecker, Dingsda?«, sagte der kleine Junge.
»Hör zu, das war eine Anregung. Ich lasse dich einfach an meiner Erfahrung teilhaben.« Er setzte die Brille wieder auf. Die großen dunklen Augen des Kindes gewannen Kontur. Er musste an die Taube denken, der ihr Käfig zur Falle geworden war, spürte einen Moment lang die Federn, weich und tot, das kleine Knochengerüst ohne Puls. Er strich mit der Hand über seinen Mantel.
Das Kind stotterte. Ihm war das unangenehm. Überhaupt hatte die ganze Situation etwas Verstörendes. Er hatte das Gefühl, dass der Modus vivendi, den er gefunden hatte, gefährdet war, dass das Leben komplizierter werden würde und die Dinge sich für ihn zum Schlechteren gewendet hatten.
Als er über die Sommerferien nach Hause fuhr, sagte Charlotte: »Gewachsen bist du ja kaum.«
Das sagte sie Jahr für Jahr.
Seine Lehrer schätzten ihn. Er hatte kein Flair, fanden sie. Aber er sagte immer die Wahrheit.
Er war sich nicht ganz sicher, was seine Mitschüler von ihm hielten. Hätte man ihn selbst nach sich gefragt, hätte er sich als fähigen, sensiblen, geduldigen Menschen ohne Charme beschrieben. Doch inwiefern diese Selbsteinschätzung mit dem übereinstimmte, was andere über ihn dachten – nun ja, woher soll man wissen, ob die Gedanken, die man selbst im Kopf hat, jemals von jemand anderem gedacht worden sind?
Er bekam nicht viel Post von zu Hause. Charlotte schickte relativ häufig kindliche Berichte über triviale Belange. Er hob ihre Briefe ein, zwei Tage auf, las sie zweimal und warf sie dann weg, da er nicht wusste, was er sonst damit anfangen sollte.
Camille Desmoulins bekam zweimal in der Woche Post, seitenlange Briefe, die bald zu einer Art Volksbelustigung wurden. Er erklärte, er sei schon als Siebenjähriger auf ein Internat geschickt worden und kenne seine Familie daher schriftlich besser als im wirklichen Leben. Die einzelnen Briefe, die er zur allseitigen Unterhaltung vorlas, glichen Kapiteln eines Buches, sodass seine Freunde die Verwandten bald als Romanfiguren zu sehen begannen. Manchmal wurde die ganze Gruppe angesichts von Sätzen wie: »Deine Mutter hofft, dass du bei der Beichte warst« von einer absurden Heiterkeit erfasst, und dann wiederholten sie einander den Satz noch tagelang mit Lachtränen in den Augen. Camille erzählte, sein Vater schreibe an einer Enzyklopädie des Rechts. Seiner Ansicht nach diente das ganze Projekt nur als Vorwand, damit sein Vater sich abends nicht mit seiner Mutter unterhalten müsse. Er habe den Verdacht, dass sein Vater sich mit der Enzyklopädie einschloss, um dann das zu lesen, was Pater Proyart, der Direktor des Collège, »liederliche Literatur« nannte.
Camille beantwortete diese Briefe, indem er seinerseits Blatt um Blatt mit seiner formlosen Handschrift bedeckte. Er bewahrte die gesamte Korrespondenz auf, um sie später zu veröffentlichen.
»Versuche, folgende Tatsache zu verinnerlichen, Maximilien«, sagte Pater Herivaux. »Die meisten Menschen sind bequem und übernehmen einfach die Meinung, die man selbst von sich hat. Du solltest also eine möglichst hohe Meinung von dir haben.«
Für Camille war das nie ein Problem gewesen. Er hatte ein besonderes Geschick dafür, sich mit älteren, aus einflussreichen Familien stammenden Schülern zusammenzutun, dafür zu sorgen, dass man sich gern mit ihm schmückte. So nahm sich der fünf Jahre ältere Stanislas Fréron seiner an, der nach seinem Paten, dem König von Polen, benannt war. Frérons Familie war reich und gebildet, sein Onkel ein bekannter Gegner Voltaires. Als Sechsjährigen hatte man ihn nach Versailles mitgenommen, wo er für Mesdames Adelaide, Sophie und Victoire, die Töchter des alten Königs, ein Gedicht aufgesagt hatte; sie hatten viel Aufhebens um ihn gemacht und ihm Süßigkeiten geschenkt. Fréron sagte zu Camille: »Wenn du größer bist, werde ich dich in die Gesellschaft einführen und deine Karriere sichern.«
War Camille dankbar? Das konnte man nicht gerade behaupten. Er quittierte Frérons Ideen mit Hohn und Spott. Fing an, ihn »Karnickel« zu nennen. In Fréron keimte eine gewisse Verunsicherung auf. Ab und zu stellte er sich vor den Spiegel und überprüfte, ob er schüchtern aussah oder vorstehende Zähne hatte.
Dann gab es da Louis Suleau, einen zur Ironie neigenden Jungen, der lächelte, wenn die jungen Adligen den Status quo verunglimpften. Es ist sehr lehrreich, erklärte er, mitanzusehen, wie sich Menschen selbst das Wasser abgraben. Noch zu unseren Lebzeiten wird es einen Krieg geben, sagte er zu Camille, und wir werden auf entgegengesetzten Seiten stehen. Lass uns also nett zueinander sein, solange wir können.
Camille sagte zu Pater Herivaux: »Ich werde ab jetzt nicht mehr zur Beichte gehen. Wenn Sie mich dazu zwingen, werde ich so tun, als wäre ich jemand anders. Ich werde die Sünden eines anderen Menschen erfinden und sie beichten.«
»Sei vernünftig«, sagte Pater Herivaux. »Deinen Glauben kannst du aufgeben, wenn du sechzehn bist. Das ist das richtige Alter.«
Doch mit sechzehn beging Camille andere Regelverletzungen. Maximilien de Robespierre wurde täglich von Ängsten gepeinigt. »Wie schaffst du es bloß immer, rauszukommen?«, fragte er.
»Wir sind hier nicht in der Bastille, weißt du. Manchmal reicht schlichte Überredung. Oder ich klettere über die Mauer. Soll ich dir zeigen, wo? Nein, lieber nicht.«
Innerhalb der Mauern lebt eine rationale intellektuelle Gemeinschaft. Draußen vor den Eisentoren streichen Bestien umher. Es ist, als säßen die Menschen im Käfig, während draußen die wilden Tiere unterwegs sind und menschlichen Betätigungen nachgehen. Die Stadt stinkt nach Reichtum und Korruption; Bettler sitzen am Straßenrand im Dreck, der Henker führt öffentliche Folterungen durch, Menschen werden am helllichten Tag überfallen und ermordet. Was Camille außerhalb der Mauern vorfindet, fasziniert und ekelt ihn zugleich. Es ist eine verworfene, gottvergessene Stadt, ein Ort des schleichenden moralischen Verfalls mit einer alttestamentarischen Zukunft. Die Gesellschaft, in die Fréron ihn einführen will, ist ein riesiger, verkommener Organismus, der seinem Ende entgegenhinkt; nur Menschen wie du, sagte er zu Maximilien, sind dazu geeignet, ein Land zu regieren.
Und Camille sagte auch: »Warte, bis Pater Proyart Direktor wird. Dann werden wir alle in den Boden gestampft.« Seine Augen leuchteten bei dieser Vorstellung.
Diese Haltung war typisch für Camille, dachte Maximilien: Je schlimmer alles wird, desto besser. Niemand anders sah das so.
Doch wie es sich fügte, wurde Pater Proyart übergangen. Der neue Schulleiter war Pater Poignard d’Enthienloye, ein entspannter, liberaler, begabter Mann. Ihn beunruhigte die Gesinnung, die sich unter seinen Zöglingen breitgemacht hatte.
»Pater Proyart behauptet, in der Schülerschaft gebe es eine bestimmte Tendenz«, sagte er zu Maximilien. »Er meint, ihr wärt alle Anarchisten und Puritaner.«
»Pater Proyart mag mich nicht«, sagte Maximilien. »Außerdem übertreibt er meiner Ansicht nach.«
»Natürlich übertreibt er. Müssen wir eigentlich so trödeln? Ich muss in einer halben Stunde meine Andacht halten.«
»Puritaner sind wir? Das sollte ihn doch freuen.«
»Wenn ihr ständig über Frauen reden würdet, wüsste er, was er zu tun hat, aber er behauptet, ihr redet nur über Politik.«
»Ja«, sagte Maximilien. Er war durchaus bereit, sich den Problemen der Älteren zu widmen. »Er befürchtet, dass die hohen Mauern die amerikanischen Ideen nicht fernhalten können. Und natürlich hat er damit recht.«
»Jede Generation hat ihre eigenen Leidenschaften. Als Lehrer sieht man das. Manchmal denke ich, dass unser ganzes System schlecht durchdacht ist. Wir nehmen euch die Kindheit weg, züchten in dieser Treibhausluft euer Denken hoch, und dann überwintern wir euch in einem Klima der Despotie.« Nachdem er das losgeworden war, seufzte der Priester. Seine eigenen Metaphern deprimierten ihn.
Maximilien überlegte einen Moment lang, wie es wäre, die Brauerei zu übernehmen. Klassischer Bildung würde es dazu kaum bedürfen. »Meinen Sie, man sollte erst gar keine Hoffnungen wecken?«, fragte er.
»Ich meine, dass es ein Jammer ist, erst eure Begabung zu fördern und dann zu sagen:« – der Priester hielt die offene Hand hoch – »Bis hierhin und nicht weiter. Wir können einem Jungen wie dir nicht die Privilegien von Geburt und Reichtum verschaffen.«
»Nun ja.« Der Junge lächelte – ein schwaches, aber aufrichtiges Lächeln. »Das ist meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen.«
Der Schulleiter konnte Pater Proyarts Voruteile gegen diesen Jungen nicht verstehen. Er war weder aggressiv, noch schien er auftrumpfen zu wollen. »Was wirst du also tun, Maximilien? Ich meine, was hast du vor?« Er wusste, dass der Junge gemäß den Bestimmungen des Stipendiums einen akademischen Grad in Medizin, Theologie oder Jurisprudenz erwerben musste. »Wie ich höre, war die Idee, dass du eine kirchliche Laufbahn einschlagen würdest.«
»Das war die Idee anderer Leute.« Maximiliens Ton, dachte der Priester, war sehr respektvoll; er zollte der Meinung anderer die geziemende Achtung und ignorierte sie dann vollkommen. »Mein Vater hatte früher eine Anwaltskanzlei. Die möchte ich gern fortführen. Ich muss wieder nach Hause zurück. Ich bin der Älteste, wissen Sie?«
Natürlich wusste der Priester das; und er wusste auch, dass Maximiliens Stipendium von widerwilligen Verwandten um einen so kärglichen Betrag ergänzt wurde, dass sich der Junge seiner gesellschaftlichen Stellung immer schmerzlich bewusst sein musste. Im vergangenen Jahr hatte der Quästor einige Hebel in Bewegung setzen müssen, damit der Junge einen neuen Mantel bekommen konnte. »Eine Laufbahn in deiner Heimatprovinz«, sagte er. »Wird dir das genügen?«
»Nun, ich werde mich dort in meiner eigenen Sphäre bewegen.« Sarkastisch? Vielleicht. »Aber Sie haben sich wegen unserer moralischen Gesinnung gesorgt, Pater. Wollen Sie darüber nicht lieber mit Camille reden? Er kann sich viel unterhaltsamer zu diesem Thema äußern.«
»Ich missbillige diese Gepflogenheit, nur den Vornamen zu gebrauchen«, sagte der Priester. »Als wäre er berühmt. Gedenkt er denn mit nur einem Namen durchs Leben zu gehen? Ich habe keine gute Meinung von deinem Freund. Und erzähl mir nicht, du seist nicht sein Hüter.«
»O doch, ich fürchte, das bin ich.« Er dachte nach. »Aber in Wirklichkeit haben Sie doch sicher eine gute Meinung von ihm, Pater?«
Der Priester lachte. »Pater Proyart behauptet, ihr wärt nicht nur Puritaner und Anarchisten, sondern auch Poseure. Affektiert, unsicher … Das bezieht sich auch auf den jungen Suleau. Aber ich sehe, dass du nicht so bist.«
»Meinen Sie, ich sollte einfach ich selbst sein?«
»Warum nicht?«