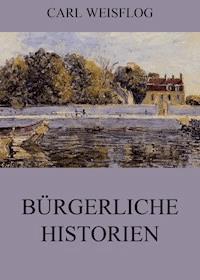
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band zeigt Weisflog von seiner besten Seite. Es sind freundliche Geschichten mit wenig Regen und viel Sonnenschein; Frohsinn und Biederkeit lacht aus behäbigen Gesichtern. Muntere Laune, ein herzliches Gemüt, eine ganze Portion Sentimentalität, aber in ihrer liebenswürdigsten, echt deutschen Art, und eine rege Fabulierkunst zeichnen diese drei Erzählungen aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bürgerliche Historien
Carl Weisflog
Inhalt:
Carl Weisflog – Biografie und Bibliografie
Bürgerliche Historien
Das Stille Wasser
Das große Los
Erste Historie
Zweite Historie
Dritte Historie
Die Mühle der Humoristen
Nachwort
Bürgerliche Historien, Carl Weisflog
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639587
www.jazzybee-verlag.de
Carl Weisflog – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 27. Dezember 1770 in Sagan, verstorben am 14. Juli 1828 in Warmbrunn. Unterstützungen von Verwandten und Freunden ermöglichten es ihm, 1774 das Gymnasium zu Hirschberg zu besuchen. 1790 bezog er die Universität Königsberg, wo er, entgegen dem Wunsche seiner Familie, die ihn zum Theologen bestimmt hatte, die Rechte studierte. Nach Abschluss seiner Studienjahre war er längere Zeit Hauslehrer, dann Referendar in Tilsit und Memel und kehrte 1802 in seine Heimatstadt als Stadtrichter zurück. Seine Teilnahme an den Befreiungskriegen, auf die er hinzudeuten scheint, lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen. Trotz frühzeitig auftretender und sich immer mehr steigernder Kränklichkeit genoss der in glücklicher Ehe lebende Mann die kleinen Lebensfreuden, die sich ihm boten, und pflegte eine heitere Geselligkeit.
Erst als Fünfzigjähriger hat W. zu schriftstellern angefangen. (Die ersten Arbeiten sandte er am 15. November 1821 an Theodor Hell.) 1819 wurde er während eines Badeaufenthaltes in Warmbrunn mit E. T. A. Hoffmann und dessen Freund Contessa bekannt, und nach Weisflog’s Angabe ist es Hoffmann gewesen, der die schlummernde Erzählergabe in ihm geweckt hat. „Sie waren der Prosper Alpano, der ihn mit dem Zauberstabe berührte“, so apostrophiert W. den toten Hoffmann, der freilich dagegen keinen Einspruch mehr erheben konnte. Selbstverständlich wollte er nicht für einen Nachahmer Hoffmann’s gehalten werden, und so suchte er den Unterschied zwischen seiner und Hoffmann’s Art grundsätzlich festzulegen. In Hoffmann’s „anmuthigsten Darstellungen und Späßen“ taucht nach seiner Ansicht „immer etwas Bitteres, Unheimliches und Grimmiges auf, was tief verborgenen Hohn, Verachtung des Menschen und Spott seiner heiligsten Interessen (so!) verrät.“ Im Gegensatz urteilt er, dass in seinem eigenen Schaffen „alles möglich heiter, mild und wohlwollend hervortritt, das klare Bewusstsein nie untergeht in grauenvoller geistiger Vernichtung, der Spaß zwar neckt und zwickt, aber niemals bis zum wirklichen Schmerze, und jedermann wohl mitlachen, dabei aber auch die Träne der Wehmut weinen muss, dass all dieses Fröhliche nur der kurze Silberblick eines Lebens voll menschlicher Unvollkommenheiten und Erdensorgen ist, dass er noch lachen und sich unter seinen Gestalten für den Glücklichsten halten kann auf der weiten Welt, der die Schattenseiten des Lebens kennt, wie Wenige, der aber allen Menschen so gern die Falte des Unmutes glätten und alle ebenso glücklich machen möchte, wie er selbst ist, wenn auch nicht in der Wirklichkeit, doch in der Idee“.
In der Tat wird man ihm zugestehen können, dass irgendwelche geistige Gemeinschaft zwischen ihm und Hoffmann nicht besteht; alles, was er von Hoffmann entlehnt hat, weist sich als äußerlich aufgeheftet, niemals als innerlich verarbeitet aus. Ein Stück Kreisler sucht er in seinem Bratschisten Fidelius festzuhalten (Bd. 5); der Karottenkönig Daukus Carotta bei Hoffmann gibt den Anstoß zu der Erfindung von Weisflog’s „Zwiebelkönig Egs“ – (Bd. 1), obwohl der Autor wiederholt mit Stolz seine Unabhängigkeit betont und die Erzählung „ein Phantasiestück in meiner Manier“ nennt. Auch die geschichtliche Erzählung mit romantischem Einschlage hat er nach Hoffmann’s Vorbilde wenigstens einmal versucht; allein sein „Sebastian, König von Portugal“ (Bd. 2), worin dem Könige ein Freundschaft heuchelnder satanischer Verführer an die Seite gestellt ist, der das Dämonische der Handlung ausmacht, während für die Rührung durch die Einführung des Camoëns und das Geschick des Königs selbst gesorgt wird, weist so viel unverarbeitetes und aufdringlich dargestelltes Material auf, dass auch nur von einem entfernten Vergleich mit Hoffmann’s entsprechenden Arbeiten nicht die Rede sein kann. Auch wenn er Hoffmann’s diabolische Grazie zu erreichen strebt, wie in der Erzählung „Der Teufel und sein Liebchen“ (Bd. 1), wo dem satanischen Stadtschreiber Hinzelmann die Junge, die er sich erkoren, abspenstig gemacht und er mit der Alten genarrt wird, bleibt er weit hinter seinem Vorbilde zurück. Wie im „Phantasiestück“, so hat er sich nach Hoffmann’s Muster auch im „Nachtstück“ versucht. Ziemlich genau kopiert er Hoffmann’s Weise in dem Nachtstück „Der Doctor Verber“ (Bd. 7), ohne irgendwelche tiefere Wirkung zu erzielen; „Der Nautilus“ (Bd. 5) stellt Schiffs- und Inselabenteuer dar, gelegentlich Situationen kräftig erfassend; als sein Bestes überhaupt wird das Nachtstück „Der Herr von Rumpelmeier“ (Bd. 9) zu bezeichnen sein, wo der Tod sich in seinen wechselnden Gestalten, je nach der Aufgabe, die er zu erfüllen hat, dem Erzähler offenbart. Auch die Künstlergeschichte nach Hoffmann’schem Vorbilde fehlt nicht ganz, aber gerade auf diesem Gebiete macht sich der ungeheure Abstand des künstlerischen Wertes auf das augenscheinlichste geltend.
Es ist sicher für W. nicht vorteilhaft gewesen, dass gerade Hoffmann – wahrscheinlich ohne es zu wollen – ihn zu selbständiger schriftstellerischer Tätigkeit angeregt hat. Denn seine ganze Entwicklung wies ihn auf ein Gebiet, auf dem er zwar auch im einzelnen von Hoffmann hätte lernen können, das aber doch im ganzen von dessen Weise fernab lag. Den Druck, der auf seiner Jugend- und Jünglingszeit lastete, hat er während seines ganzen Lebens nicht verwinden können; die Spuren machten sich in seiner Haltung, in der Art seines Auftretens auf das deutlichste geltend. Andererseits aber hatten ihn die Demütigungen, die er hinnehmen musste, doch keineswegs verbittert, und wenn er selbst den gedrückten linkischen Kandidaten schilderte, so erkennt man aus dem Tone der Erzählung, dass in ihm kein Groll mehr nachklang. Durch diese eigenen Erlebnisse und durch die Milde, mit der er auf sie zurückblickt, wurde er ganz naturgemäß dazu veranlasst, die Leiden und Freuden der Kreise, aus denen er selbst hervorgegangen war, in den Mittelpunkt seines Schaffens zu rücken. Wo er die vornehme Welt schildern will wie in der „Quellnymphe“ (Bd. 6), scheitert er vollständig, aber für die Lebensgewohnheiten und Anschauungen, für das Leben und Treiben des kleinen Mannes und des Mittelstandes hat er einen guten Blick und versteht manchen bezeichnenden Zug festzuhalten, wenn er sich auch zuweilen im Tone vergreift.
Indessen weit mehr als auf Erzielung der Lebenswahrheit war sein Augenmerk auf die Erweckung gefühlvoller Anteilnahme gerichtet. So gestaltet sich denn der Gang der Handlung meist so, dass Kummer und Unglück über die Helden seiner Erzählungen kommen, und das die ausführliche Darstellung der so hervorgerufenen Leiden zu rührenden Situationen und Betrachtungen reichlich Gelegenheit bietet. Schließlich laufen die vom Geschick Heimgesuchten aber doch immer noch glücklich in den Hafen ein, und der Erzähler weiß so den Wunsch des eigenen guten Herzens mit den Bedürfnissen des Publikums, auf das er rechnete, zu vereinigen (vgl. z. B. die Erzählungen „Die Pudelmütze“, Bd. 1, „Die Fahrten des Forstrathes von Elben“, Bd. 2, „Wohlthun trägt Zinsen“, Bd. 4, „Kunst- und Bettelfahrt des Bratschisten Fidelius“, Bd. 6, „Die Fichtelberger“, Bd. 8, und „Die Mühle der Humoristen“, Bd. 11. „Der Beruf“, Bd. 12). Mit besonderer Vorliebe zeichnet er, hier sicher ebenfalls Hoffmann’schen Anregungen folgend, wunderliche Käuze, Sonderlinge, hinter deren bärbeißigem Äußeren sich ein weiches Herz verbirgt, und auch bei der Bevorzugung derartiger Figuren schwebt ihm eine ähnliche Absicht wie bei der Anlage seiner Erzählungen vor; denn es ist sicher sein eigenes dichterisches Verfahren, das er darlegen will, wenn er das Wesen des wahren, gemütlichen Humors auseinanderzusetzen sucht: „Wer das Lächerliche guter Menschen wie eine Schattierung zu brauchen versteht, die ihre Lichter noch mehr erhebt, wer es versteht zu zeigen, wie diese Trefflichen ohne diese kleinen Menschlichkeiten gar nicht Menschen sein könnten, wer es versteht, durch das Wunderliche und Kontrastierende den klaren Grund einer reinen Seele durchschimmern zu lassen und die Träne der Wehmut darüber ins Auge zu locken, dass diese Herrlichen dennoch nur Menschen und keine Engel sind, der greift ans Herz und erhebt und befriedigt“ (Bd. 4, S. 178).
Aber es ist ihm nicht gelungen, die Charakteristik derartiger Gestalten scharf herauszuarbeiten; man vermag zwar meist zu erkennen, aus welchen Absichten heraus die Konzeption der dichterischen Figur erfolgt ist, aber diese Absichten treten nicht mit überzeugender Wahrheit ins Leben. Das Gleiche gilt von der Einkleidung und der Darstellung. Jene ist nicht selten gezwungen, auch Wiederholungen stellen sich ein; diese leidet unter einer Breite, die in keinem Verhältnis zu der Bedeutung des Vorwurfs steht. Dazu kommt die erkünstelte Sentimentalität, die sich zuweilen in ganz wunderlichen Bildern äußert; so wenn in der „Quellnymphe“ die junge Frau eines alten Mannes zu der Erkenntnis kommt, dass ein ihr gefährlicher Verführer ihrer Tugend nachstellt, und in die Worte ausbricht: „Die Luft ist schwül, drückend und still auf Isle de France, ehe der tobende Sturm hereinbricht, kein Hauch, kein Blatt regt sich in der Natur. Doch bald zittern die Blätter, fernher wirbelt der Staub, scheu fliehen die Tiere des Waldes in ihr sicheres Asyl, der Donner murmelt von weitem. – Bei Gott, das ist meine Angst, und was nun kommen könnte, Vernichtung und Verderben.“
Weist diese zuweilen faustdick aufgetragene Sentimentalität auf die Stimmung der zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, so erinnern doch Stoffwelt und Darstellung vielmehr an die Erzählungskunst der Aufklärungszeit. Er selbst nennt als einen vollkommenen Humoristen in seinem Sinne Musäus, und an die Weise des Musäus und anderer Erzähler des 18. Jahrhunderts wird man auch bei W. mehrfach erinnert, während der Einfluss Jean Paul’s, auf den Goedeke hinwies, nicht allzu groß gewesen zu sein scheint. Durchaus dem Durchschnittsgeschmack des achtzehnten Jahrhunderts entsprechen auch seine Gedichte, poetische Erzählungen, parodistische Stücke, Gelegenheitsarbeiten; eine Hymne an die Natur: „Du warst die Freundin meiner früheren Jugend, – die dir mein liebend Herz geweiht, – du zeigtest lächelnd mir den Weg zur Tugend, – die Pfade zur Unsterblichkeit“ (Bd. 12).
Nach alledem ist es ganz unrichtig, W. zu Hoffmann zu stellen; er gehört vielmehr zu den Schriftstellern, in deren Mitte er zuerst öffentlich erschien, zu Theodor Hell und seinem Kreise, zu v. d. Velde, also zu jenen Erzählern, die ältere Elemente mit dem modischen, im wesentlichen der Romantik entlehnten Flitter verbrämten. Wer sich eine Vorstellung von dem, was W. zu erreichen im Stande war, verschaffen will, greift am besten zu einem von den kürzeren Werken, dem „Herrn v. Rumpelmeier“ oder dem archaisierenden Bericht: „Der wüthende Holofernes“ (Bd. 1); die Hauptmasse seiner Schriften ist weniger für die Literaturgeschichte von Wichtigkeit als für den Kulturhistoriker, der die Geschmacksrichtungen des Durchschnittspublikums in der Zeit nach dem Wiener Kongress feststellen will.
Bürgerliche Historien
Das Stille Wasser
Die Reihe des freundlichen Mittwochabendkränzchens traf nun Kommerzienrats, und das Erzählen einer Begebenheit aus dem eigenen Leben gerade auch ihn, den Wirt. Draußen schlug Herr Blasius mit dem ersten Schneegestöber des Dezembers wacker an die Fenster. Desto heimlicher war es drinnen in der warmen Stube, wo nun die Brüder und Schwestern des sinnigen Vereins enger zusammenrückten, die letzteren das Strickzeug herausnahmen, die Veteranen am flackernden Kaminfeuer ihre Pfeifen anbrannten und der Dinge harrten, die der alte Biedermann zu Markte bringen werde, der so eben ins Zimmer trat und feierlich ein großes, eingerahmtes Bild vor sich her trug, so wie man etwa ein Kind zum Taufsteine trägt.
Hab' ich mir's doch gedacht, – rief beinahe erschrocken Sabine, die würdige Hausfrau, – daß nun am Ende doch noch das daran kommen werde! O du Plaudertasche!
Silentium, Mutter! – gebot der Eheherr. – Laß mir die Freude! Dir ist das allerdings nichts Neues mehr, du weißt es auswendig, aber unsere lieben Freunde wissen es nicht. Darum, wenn du etwa indes im anderen Zimmer Braten zu schneiden und Butterbrot zu schmieren hast, so will ich dir nicht hinderlich sein.
Freilich habe ich das, und auch noch mehr zu tun, – erwiderte sie, verschämt hinaustrippelnd, – aber fasse dich kurz, Vater!
Kurz, kurz! – brummte der ihr nach, – Ja, wir sollen uns kurz fassen, grade da, wo wir lieber gar nicht aufhören möchten, indes Ihr über einen erbärmlichen Kleiderschnitt, über einen Fetzen der neuesten Mode, über gar nichts, die ewigen Register euerer Vox Humana zieht!
Laß dich nicht irren, Herr Bruder, – tröstete der Justizamtmann – und stelle deine Tabulam auf, damit wir schauen und hören, denn aller Augen und Ohren warten auf dich.
Eigentlich werdet ihr es ihr auch nicht verdenken, – fuhr der Kommerzienrat mit milder Stimme fort – daß sie nicht dabei sein will. Doch aus meinem vollen Herzen muß es heraus. Habe ich euch letzthin erzählt, wie ich nach mancher Not und Trübsal denn doch endlich auf einen grünen Zweig gekommen und ein Mann bei der Stadt geworden, so sollt ihr nun auch erfahren, wie ich überhaupt ein Mann geworden, und zwar ein glücklicher, ein mehr als durch Reichtum gesegneter Mann. – Seht da das Bild!
Er stellte es auf den Tisch, hinter die mystisch schimmernde Sineumbralampe, und fuhr fort:
Der dichte Schleier der frühesten Morgendämmerung, lange vor Aufgang der Sonne, liegt noch auf der schönen Landschaft, in der ihr die Gegend wiedererkennen werdet, aus der ich vor zwanzig Jahren mit Weib und Kind hierher in euere Mitte gekommen. Seht, wie im fernen duftigen Hintergrunde die Stadt an den blauen Bergen sich hinzieht, wie näher im weißlichen Nebel der Fluß sich durch das Erlengebüsch windet. Noch starren die Bäume mit kahlen Ästen, noch grünen die Ufer nicht. Natürlich! Denn es ist noch zu früh im Jahre, es ist erst – Karfreitag – merkt es euch wohl, lieben Freunde, – Karfreitag. Und die holde Frauengestalt, die da, hinter den Erlen, auch in Nebelduft gehüllt, am Ufer kniet, aus dem Flusse schöpft und den flehenden Blick nach dem Himmel emporhebt, – sie holt – stilles Wasser. Ihr wißt, was das zu bedeuten hat. – Stilles Wasser, geschöpft am heiligen Karfreitage mit Glaube, Liebe und Hoffnung, ist gut gegen allerlei Übel des Leibes und der Seele. Es muß aber auch wirklich stilles Wasser sein, das heißt: wer dahin geht, es zu schöpfen, eine Stunde vor Sonnenaufgang, an heimlicher Stelle, das Antlitz gegen Morgen gekehrt, muß auf dem Wege hin und zurück nicht ein Wort sprechen, es geschehe auch, was da wolle.
Ihr lächelt und seid gütig genug, den lauten Ausruf: Aberglaube, Aberglaube! fast mitleidig und aus Schonung für den alten Träumer zu unterdrücken. Nun – mögt ihr doch! Ich weiß, was ich weiß. Und ist es euch denn nicht auch, wenn Ihr das dämmernde, nebelnde Bild mit dem Mystischheimlichen anseht, das soeben auf ihm geschieht, als liefe euch ein Frösteln über den Rücken, als ständet ihr selber hinter den Erlen in der Morgenfrühe des heiligen Tages am rauschenden Flusse und zittertet im Schauer des Geheimnisses, von dem ihr jedoch – ihr wißt nicht, warum, – nur Gutes erwartet? Nun – eben darum seid nachsichtig und denkt:
was so die ahnende Stimme spricht, das täuschet die hoffende Seele nicht.
Daß Freund Hain den ehrsamen Kauf- und Handelsmann Christoph Zobel, meinen seligen Vater, zum betrübten Witwer gemacht, ehe ich den süßen Namen Mutter lallen können, daß mein Vater dies auch selber schon lange gefürchtet, weil ihn dringende Umstände zur Trauung gerade an einem Freitag genötigt, der bekanntlich zum Hochzeitmachen als ein gar böser Tag von männiglich vermieden wird, daß besonders jener Freitag, an welchem der reiche Zinngießer begraben wurde mit dem Trauergeläute, unter welchem das junge Paar nach der Kirche fuhr, nichts als Unglück ominieren konnte, daß eine zweite Wahl den schmerzlichen Verlust nun noch fühlbarer gemacht; eine Stiefmutter mich, das einzig übriggebliebene Ehepflänzlein, geknöchelt nach der Möglichkeit, daß, und wie der sanfte Vater sich unter dem unerträglichen xantippischen Pantoffel zu Tode geseufzt und sein Prognostikon ihn betrogen, vermöge dessen er in der Liebsten ein mildes Lamm heimzuführen gehofft, weil sie gerade, als er sie das erstemal gesehen, Tauben gefüttert; was soll ich euch, lieben Freunde, dies alles lang und breit erzählen! Kurz daher hinweg über die Zeit meiner ersten Jugend, die mir freudenleer verging. Denn wenn andere Jungen meines Alters nach den Schulstunden draußen lustig Ball schlagen und jauchzen durften in der Frühlingssonne, mußte ich im dumpfen Laden sitzen und Tüten kleistern und Sonntags, wenn alles hinauszog ins Grüne, aus dem Taulerus und Herberger die ewigen Predigten lesen. Da fühlte dann das sehnende Herz, daß es verwaist sei, und meine Tränen rannen auf den heillosen Folianten. Mein Vater? der konnte sich meiner nicht erbarmen, der war lange schon untergegangen in knechtischem Gehorsam. Der wagte vor den Augen der Mutter nicht einmal ein zärtliches Wort zu mir. Was Kuß von Elternlippen sei, das weiß ich nicht. Aber noch ein Drache hauste in meinem traurigen Zwinger – der Ladenhelfer Habakuk Froschlaich, ein Auserwählter und Günstling der Mutter. Denkt euch einen buckeligen Knirps von Zwergform, mit roten, verwilderten Haaren, mit Augen, die tückisch über die semmelfarbenen, mit tausend Pockennarben und Sommersprossen gesprenkelten Hängewangen herabblinzeln, dabei eine, aus dem links am Halse sitzenden Kropfe heiser grölzende Stimme, und ihr habt das ziemlich treue Bild des Unholdes, der mir vollends alle Jugendlust verleidete, meinen unschuldigen Tritten und Schritten wie ein Luchs mit dem spähenden Blicke folgte, mich verklatschte und jegliches Strafamt an mir Armen übte, der sich darüber bei niemandem beklagen konnte. Denn mein Vater war mir, wie schon gesagt, unzugänglich und selbst ein Sklave des Zwerges, so daß auch ihm keine andere Freude blieb als seine Bücher in der stillen, finsteren Ladenstube und abends die Ressource, wo er auch nur still für sich saß, wenig teil am Gespräche nahm, in den Zeitungen blätterte, oder gedankenvoll sich in die blauen Wirbelwolken seiner Pfeife hüllte. Dabei hatte die Mutter ein System des Geizes eingeführt, von dem ihr keinen Begriff habt. Harte Eier und Salat, das war schon eine Luxussonntagsmahlzeit, Rosinenstielsuppe, sparsam mit Syrup versüßt, eine Extralabung, trockenes Brot mit Salz und Brunnenkresse im Sommer, eine Wassersuppe im Winter mein Frühstück. Denn Salz und Brot, pflegte sie zu sagen, macht Wangen rot. Doch muß ich gestehen, daß meine Kleidung immer sauber und reinlich war, da die Mutter bei dem allen auf äußeren Anstand hielt und wohl nicht unrecht hatte, wenn sie predigte: Niemand sieht dir in den Magen, aber wohl auf den Kragen! Daß unter solchen Umständen die Eltern reich werden mußten, das war ganz natürlich. Aber wem von ihnen half der Mammon etwas? – Keinem! Der Vater, erst in der Erinnerung besserer Tage jammernd, wurde endlich durch die Gewohnheit abgestumpft und lernte vergessen, was Lebensgenuß sei, und die Mutter, die solchen nie gekannt, erlag manchmal fast den peinigenden Schmerzen eines Rheuma, das mit den Jahren immer ärger ward, weil sie aus Geiz vernachlässigt, dagegen zweckdienliche Mittel zu brauchen und zu sympathetischen Quacksalbereien ihr Zuflucht nahm, die nichts nützten.
Ach, wie wohl war mir, als ich in meinem sechzehnten Jahre zu einem anderen Kaufmann in die Lehre kam. Konnte man es mir verdenken, daß ich mit fast kaltem Herzen dem väterlichen Hause Valet sagte und wohlgemut der fremden Stadt zuwanderte, in welcher ich nun bessere Tage hoffen durfte? Konnte man es mir verdenken, daß ich nach ausgestandener Lehrzeit noch länger im Hause meines wackeren Lehrherrn blieb, wo ich diese besseren Tage wirklich gefunden, wo die früh geknickte, fast zertretene Blume sich wieder erhoben in neuer Lebenskraft, wo Geist, Gemüt und Leib gereift zu höherem, edleren Dasein, wo mir das Glück ward, auf Geschäftsreisen die Welt und Menschen kennenzulernen? Zwar verlangte mein Vater, der alt und schwach geworden, mich zur Hilfe nach Hause, zwar schrieb mir nun auch die Mutter liebliche, ködernde Briefe; aber dennoch verzog ich die Erfüllung ihrer Wünsche so lange als möglich, denn ich wußte, was ich zu Hause zu erwarten. Endlich behielt kindliche Liebe die Oberhand. Ich packte den Reisekoffer und zog mit bangem, doch freiem Herzen, das Amors Fesseln noch nicht kannte, ob ich schon wie andere leicht und lustig um Blumen geflattert, weil ich in der Mode nicht zurückbleiben mochte, in die Heimat, die nur mir keine geliebte war. Denn ich hatte da keine Spielplätze wie andere, konnte mich nicht freuen auf den grünen Rasenteppich mit den neu hervorsprießenden Frühlingsblümchen, auf die dunkle kühle Waldnacht mit dem geheimnisvollen beerenreichen Gesträuch am Bache. Mir hatte ja kein Rasen gegrünt, kein Wald gerauscht, kein Jugendfreund sich näher an mich schließen dürfen.
Und wirklich fand ich auch beim Eintritte in das väterliche Haus nichts wieder als – das Elend und noch dazu in erhöhtem Grade. Der Vater wankte zitternd am Stabe, die Mutter war durch Krankheit noch grämlicher geworden. Nur Habakuk saß unverändert, wie ein lauschender Kobold im Laden, fletschte die Zähne und stieß Pfeffer, eselte auch so rüstig wie sonst als Wasserträger und Holzspalter. Seine ersten Blicke schossen nach mir wie giftige Pfeile. Aber mild und so freundlich, als es ihnen Mißmut und Körperschmerz zuließen, ward ich von den Eltern empfangen, deren Augen mit besonderem Wohlgefallen auf meiner entwickelten Gestalt ruhten, besonders da die Mutter genau beobachtet, daß ich die heimatliche Schwelle mit dem rechten Fuße zuerst beschritten, was bekanntlich Glück und Segen bedeutet. Daß ich ihnen Freude mache durch mich selber, das war im ersten Augenblicke des Wiedersehens meine eigene, einzige. Denn allzu schneidend erschien mir der Abstand der traurigen Einsamkeit, in die ich mich nun versenkt, gegen die fröhliche, gemütvolle Freiheit, die ich eben verlassen. Doch bald sollte eben diese Einsamkeit für mich ein ganz eigenes, unerwartetes Interesse gewinnen, bald es mir sehr fühlbar werden, daß es jetzt hier anders sei als sonst. Schon das Abendbrot, dem mein verwöhnter Appetit mit Zittern und Bangen entgegengesehen, machte mich stutzig. Es war nur eine frugale Kräutersuppe, nur ein Eierkuchen mit Pflaumenmuß, aber diese Suppe, dieser Eierkuchen konnte unmöglich aus Mutter Gertrudens Kochkunst hervorgegangen sein. So hatte mir lange, selbst in meines Lehrherrn Hause keine Mahlzeit gemundet. Noch war ich in frohem, heimlichen Staunen über dieses mir unerklärliche Phänomen am väterlichen Küchenhimmel, noch wiederholte ich mir die heimliche Frage: wag ist das? als geräuschlos, mich sacht und sittsam grüßend, ein Mädchen an der, wie ich nun wohl bemerkte, noch ledigen vierten Stelle des Tisches Platz nahm, mit niedergeschlagenen Augen gesegnete Mahlzeit wünschte und auf ihren Teller die Reste der Speisen erhielt. Ein sonderbares, mir ganz fremdes Gefühl durchzuckte mich bei dem ersten Blicke auf diese Gestalt, mein zweites Gefühl war fast Verzweiflung darüber, daß ich ein Vielfraß gewesen und der Armen so gar wenig übriggelassen. Die Eltern mochten mir die hinuntergeschluckte Frage angesehen haben, wer dieses Mädchen sei; denn die Mutter sagte, nach ihr mit dem Finger hinweisend, fast vornehm wegwerfend: das ist Sabine, unsere Köchin, die dir auch die Stube aufräumen und das Bett machen wird.
Köchin? stammelte ich überrascht und kaum hörbar, wagte nicht, vom Teller aufzuschauen und glühte, ich wußte nicht, warum.
Ja – antwortete die Mutter – du wirst dich noch besinnen auf den fortgelaufenen Steuereinnehmer, der nachher in Polen gestorben ist. Die Mutter lebte auch nicht lange mehr und hinterließ die Waise. Was sollten wir tun? Verwandt ist sie einmal mit uns, wenn auch weitläufig. Wir nahmen sie also vor drei Jahren ins Haus und geben ihr das Gnadenbrot.
Brot als Lohn, willst du sagen, lieber Schatz, – fiel der Vater verbessernd, doch furchtsam ein – denn – sie arbeitet.
Sie muß auch, – strafte die Mutter – darum ist auch an dem, was ich gesprochen, gar nichts zu tadeln.
Wie mir bei diesen Reden ward, als ich nun den scheuen Blick nach der armen Muhme richtete und sah, wie eine stille Träne aus dem gesenkten Auge herab auf das Gnadenbrot fiel, das vermögen Worte nicht zu schildern. Dieses sanfte, reinliche, kaum siebenzehn Jahre alte Geschöpf mit den brennenden Wangen, im bescheidenen Häubchen, das doch die Fülle der blonden Ringellocken nicht ganz zu bergen vermochte, dieses große, milde blaue Auge, in das ich nur bei einem allereinzigen Aufblicke geschaut, die Worte: Köchin, Gnadenbrot und Arbeit, regten plötzlich Empfindungen in mir auf, von denen ich in der Minute nicht wußte, ob sie angenehm oder schmerzlich waren. Und als sie nun ebenso sacht vom Tische aufstand, gute Nacht wünschte und das Zimmer verließ und meine Augen der reizenden, schlanken Gestalt folgten, da wiederholte mir eine innere leise Stimme die Worte: sie wird dir die Stube aufräumen und das Bett machen! O Himmel, das Bett wird sie mir machen, seufzte ich halblaut vor mich hin, und war kaum imstande, mich zu fassen.
Ei, ei, Kommerzienrat, – unterbrach ihn der Bürgermeister lächelnd – Ihr malt ja wie ein Zwanziger.
Laß ihn! – rief der Major. – Fuhrleute, die selber nicht mehr fahren, hören doch noch gern mit der Peitsche klatschen.
Und gar fein und lieblich – setzte der Justizamtmann hinzu – läßt das Blümlein Vergißmeinnicht, das aus dem Schnee herauswächst.
Euere bösen Zungen – entgegnete der Erzähler – sind mir hinlänglich bekannt. Doch das soll mich nicht irren. Genug, ich war außer mir, und nur erst das Wort der lächelnden Mutter, wir haben auch mit ihr so ein Plänchen, brachte mich wieder zu mir selbst.
Ein Plänchen haben sie also mit der Köchin? – wiederholte ich mir auf meinem Zimmer, unruhig auf- und niederschreitend. – Ein Plänchen? Und, wie mir das Lächeln der Mutter deutlich genug sagte, ein Plänchen mit mir? Mit mir und – der Köchin? – Charmant! – Daraus wird nichts! Hochmut hob sich in meinem Inneren. Ich, der kluge, reiche, junge, nicht häßliche Kaufherr, ich – eine Köchin? eine Magd? Und! im ausgesonnenen, angelegten Plane? – Nimmermehr! – Sie ist hübsch, sie ist ein Engel! Mag's! Sie ist arm, sie speist das Gnadenbrot! Sie ist – eine Magd!
Mit ganz eigenen, kämpfenden Gefühlen sank ich auf das Lager – ach! – das ja sie mir gebettet, und niemals in meinem Leben habe ich besser geschlafen. – Als die Morgensonne mir in die Vorhänge schien und ich den letzten Rest der traumlosen Nacht mir aus den Augen rieb, war mein erster Gedanke: nun wird sie kommen, das Waschwasser und das Frühstück bringen. Welcher Wunsch in mir der stärkere gewesen, ob der, daß sie komme, oder der, daß sie nicht komme, das kann ich wahrhaftig noch jetzt nicht sagen. Sie kam nicht. Ich kleidete mich an und ging hinunter, mit dem festen Vorsatze, die mir Zugedachte, die Magd, die natürlich Teilnehmerin des lieben Planes sein mußte, nicht eines Blickes zu würdigen. Sie wird die Schüchternheit schon ablegen, – dachte ich – sich schon zu schaffen machen um dich, doch du wirst standhaft sein, und kannst es auch unter diesen Umständen. Nur den Herrn soll sie in dir erblicken, nur den, der ihr auch zu befehlen hat, weil sie auch sein Brot ißt.
Eitler Wahn! – Sie ließ sich nicht sehen, obschon ich ihr wirtschaftliches Wirken in Haus und Küche deutlich wahrnahm. Nur zu Mittag und Abend kam sie, wie das erstemal, still und bescheiden an den Tisch. Aber wiederum merkte ich am Wohlgeschmacke des einfachen Mahles, an der Reinlichkeit, die überall herrschte, an der Sauberkeit meines Zimmers, in welchem eine unsichtbare Hand still ordnend waltete, daß es im väterlichen Hause wahrhaftig anders sei als sonst, und durch sie – die Köchin. Ich fing an, mir als ein Undankbarer zu erscheinen, ich fing an, zwischen Magd, Köchin und Dienstmädchen zu distinguieren und das letzte Wort schon feiner lautend zu finden als die beiden ersteren. Ist sie denn nicht auch – strafte ich mich – deine Muhme? – Freilich, im neunundneunzigsten Grade! – War ihr Vater nicht Steuereinnehmer? – Freilich, ein davongelaufener! – Was tut das? Was kann sie dafür? Leidet sie nicht im bitteren Drucke der Knechtschaft? Hast du nicht selbst ihre Tränen auf das Gnadenbrot fallen gesehen? – Trug! Trug und Verstellung! – rief ich unwillig. – Wie kann sie leiden bei dem, was sie weiß und sich einbildet! Diese Tränen gekränkter Eitelkeit werden aufhören, wenn die Eitelkeit befriedigt, wenn sie Herrin ist. Nun, bis dahin soll es gute Wege haben! Verdient sie auch nicht gerade meine Verachtung, so will ich doch tun, als sei sie gar nicht da, damit sie verbleibe in den Schranken ihres Berufs.
Ich sprach mit ihr kein Wort. Ich wollte sie nicht ansehen. Aber konnte ich das halten? – Und als die Mutter mir das neue feine, künstlich ausgenähte Halstuch gab und sagte: das hat Sabine für dich gemacht, mußte ich da nicht Schande halber mich bei ihr bedanken? Warum ich dabei gerade ein: "Liebes Binchen!" einfließen ließ, warum es mir warm zum Herzen heraufquoll, als sie mich in verschämter, errötender Erwiderung lieber Herr Vetter nannte, warum ich gedankenlos noch lange auf meiner Stube das Tuch in meinen Händen hielt, wußte ich das?
Du warst verliebt, Herr Bruder! fiel der Justizamtmann ein.
Freilich war ich verliebt! – antwortete der Kommerzienrat. – Mein Stündlein hatte geschlagen. Doch konnte und wollte ich damals noch nicht genauer darüber nachdenken, der Hochmutteufel blendete mich noch. Denn nach den Ansprüchen meiner vierundzwanzigjährigen Eitelkeit mußte meine Künftige wenigstens ein Fräulein mit hochadeligem Geburtstempel sein. Und dann der Plan, der Plan, der widerte mich am allermeisten an. Auch in dieser Hinsicht fand ich es anders im elterlichen Hause als sonst. Ehedem – darauf kannte ich die Mutter – würde es nur Torheit gewesen sein, an die Möglichkeit einer Verbindung mit einer Armen zu denken, und nun hatten sie sogar selbst eine solche für mich bestimmt. – Unbegreiflich! Nein, daraus wird nichts – in Ewigkeit nichts! – Sie mag sich den Habakuk nehmen! brummte ich in Gedanken vor mich hin, und wußte nicht, daß ich in der Stube der Mutter war.
Wie? – fuhr diese mit freudiger Überraschung auf und weckte mich aus meinen Träumereien. – Du findest das also auch passend?
Was? – fragte ich fast erschrocken. – Was, Mutter?
Nun, das Plänchen – antwortete sie – mit der Sabine und dem Habakuk?
Das Plänchen mit ihr? – stammelte ich. – Mit Sabine und Habakuk?
Nicht wahr? – lächelte sie. – Du staunst, daß wir so einerlei Gedanken haben? Und nicht wahr, das schickt sich? – Der Mensch hat seine paar tausend Taler erspart, und gut ist er ihr zum Sterben; was will sie mehr?
Schlaff und kraftlos fielen meine Hände herab. Ein kalter Schauer fuhr mir durch die Glieder. Also das ist das Plänchen? – rief ich auf meinem einsamen Zimmer und fand mich nun auf einmal wieder im alten väterlichen Hause. – Mit dem Zwerge verkuppeln wollen sie die Arme? Die holde, sanfte Schönheit mit einem Abschaume der Natur? – Die Arme? – wiederholte ich sinnend. – Weiß ich denn, ob sie sich nicht sehr reich fühlt und ob es nicht ihr Wille? – Konnte die Königin der schwarzen Inseln einem häßlichen Mohren gut sein; ist es nicht auch möglich, daß Sabinens Herz einem rothaarigen Buckelinski brennt? Der Geschmack ist verschieden.
Und wirklich, soeben hörte ich sie mit Nachtigallenstimme im Waschhause ein lustiges Liedchen singen.
Es ist richtig! – murrte ich grimmig. – Sie liebt den Elenden! Sie ist froh, sie ist heiter und nur in deiner Nähe still und stumm, du, durch deine Eitelkeit betrogener Tor! – Sie denkt nicht daran, daß du in der Welt und ein Hasenfuß bist, der da glaube, in dich müsse sich verlieben alles, was eine Schürze trägt! – Verwünschte Selbstsucht! Und noch verwünschteres, falsches Geschlecht!
Mit Basiliskenblicken verfolgte ich nun das Mädchen, gegen das ich erbittert war, weil es einen Plan auf mich nicht angelegt. Vor Bosheit war ich jedoch keines Wortes mächtig, so sehr ich auch anzügliche Reden mir einstudiert. Nun erst sah ich es, was ich früher gar nicht bemerkt, daß der buckelige Molch um sie herumhüpfte mit ekelhafter Süßigkeit. Nun erst fiel mir der Blumenstrauß ein, so groß wie ein Kehrbesen, den ich den Zwerg gestern ins Haus schleppen sah und den er niemand anderem gegeben haben konnte als ihr. Nun aber stand es auch in mir fest, ihr mit Verachtung zu begegnen und mich für die Täuschung meiner Eitelkeit zu rächen nach der Möglichkeit.
Die Gelegenheit dazu blieb nicht lange aus. Die Eltern und ich wurden zu Salzinspektors, zu dem alten podagrischen Herrn von Muschel, seiner ahnenstolzen, hageren Gnädigen, und den beiden überreifen Töchtern gebeten. Denen willst du die Cour machen aus Nummer ff, – beschloß ich – und sie soll es erfahren. Sind auch beide schon ziemlich verbrauchte Muscheln, haben sie auch in der Residenz, ehe Papa hierher versetzt wurde, viel Glück gehabt bei den Gardeoffizieren und Reisen gemacht, von denen sie etwas blaß zurückgekommen; was liegt daran? Sind sie nicht altadelige stift- und hoffähige Subjekte, Prachtstücke für Cytherens heilige Hallen, Musterbilder der Mode? – Und sie soll es erfahren und sich ärgern!
Ich Tor bedachte nicht, daß sie, wenn sie den Zwerg liebe, sich daraus gar nichts machen und sich im Geringsten nicht ärgern werde! Ich Tor handelte, als müsse ich ihr schlechterdings interessant sein! Aber so sind die Verliebten! Eine Inkonsequenz jagt bei ihnen die andere, und bei der ärgsten glauben sie wunder, wie klug sie sich benommen!
Das hochadelige Haus überhäufte uns mit Artigkeit. Es war sichtbar, daß schon lange eine Art von vertraulicher Freundschaft zwischen ihm und den Eltern, besonders der Mutter, bestehe. Der alte Herr redete mit mir über Handels-Konjunkturen, die gnädige Mama über die Bälle und Feten der Residenz, die Fräuleins über Schiller, Göthe und Jean Paul. Ja, Rebecka trieb die Huld so weit, mir aus heiler Haut am Flügel den Hopser abzutrommeln, in welchem sie auf dem Balle des Grafen X. am Arme des Kammerherrn von Y. Furore gemacht, und alle baten mich, nun auch ihnen etwas vorzuspielen und zu singen. Was wollte ich tun? Das Zieren bei solcher Gelegenheit ist mir in den Tod zuwider. Ich spielte und sang also frisch darauf los, obschon ich wohl wußte, daß das Singen eben nicht meine starke Seite, was ich auch vorher ganz unbefangen gestanden hatte. Umso größer war mein Schreck, als ich im spiegelnden Glase eines vor mir hängenden Bildes sah, daß die beiden Huldinnen, die hinter mir standen, sich verstohlen in die Seite stießen und das Schnupftuch vor den Mund nahmen. Falsches, nichtswürdiges Gezücht! – dachte ich ergrimmt, und die schöne Stelle des Schlußchors in Schweizers Elysiuum: "eure Freuden sind ein Blick in elysische Gefilde", bei der ich eben war, verwandelte sich in donnernden Lach- und Hohngesang, in klaren, strafenden Bezug auf das Elysium des Herzens, in welches mich diese heimlichen Freuden des Schwesterpaares blicken lassen. Mögen sie, – faßte ich mich während des Nachspiels, das ich zu dem Behufe verlängerte, – was hast du mit ihnen zu schaffen! Du tust, als ob du nichts gemerkt, bist zehnmal freundlicher als vorher und hast sie zum besten, wie könnte sie sonst sich ärgern! – Lustig paukte ich auf die Klaven, daß im höllischen Getöse selbst das Bellen des erschrockenen Mopses unhörbar unterging, und übertraf mich nachher in allerlei Liebenswürdigkeit so sehr, daß männiglich entzückt war und das Antlitz der Eltern, besonders das der Mutter, beim Nachhausegehen in süßer Verklärung glänzte.
Mein Richardchen, – sagte sie beim Abendessen, als schon Sabine ihren Platz eingenommen, – heute bist du wirklich ganz charmant gewesen, und Muschels wissen gar nicht, dich genug zu loben.
Es sind aber auch herrliche Leute, – fiel ich ein – so freundschaftlich, so bieder, und die Fräuleins hübsch, wie die Liebesgöttinnen, und reizend, wie Grazien! Alle Register preisender Suada wurden nun gezogen, und rundum blickte ich – zu einer Stelle freilich nur verstohlen – nach der Wirkung dieser erkünstelten Exaltation. Die Mutter war selig, trotz dem Reißen, das ihr im rechten Arme zuckte. Der Vater stierte mit finsterem, fast traurigen, doch furchtsamen Stirnrunzeln, daß es die Mutter nicht gewahre, vor sich hin. Um Sabinens Mund, die vom Teller nicht aufsah, spielte ein kaum merkliches, schalkhaftes Lächeln.
Sie lächelt? – fragte ich mich beim Auskleiden. – Was ist ihr so lächerlich? Ist es Freude über die Posaunenstöße zum Preise der Muscheln? Wer hat jemals gehört und gesehen, daß ein Mädchen sich freut, wenn andere mit Enthusiasmus gelobt werden? – Teilnahme? – Dem widerspricht der satirische Zug um den Mundwinkel. – Hohn? – Was hätte sie dazu für Grund? Und glaubt sie, welchen zu haben, – wie wäre der mit ihrem sonstigen Wesen zu vereinen? Oder ist auch dieses nur Trug? Oder dachte sie eben an ihren roten Seladon? – Wer löst diese Rätsel??
Ich Kurzsichtiger! Wie weit sind wir Männer zurück gegen Frauen im Katechismus der Lebensklugheit! Wo wir im Finsteren tappen, sehen sie hell und klar. Darum ehret die Frauen, sie sind listig und klug, wenn auch voll Schalksinn und heimlichen Trug.
Wir bedanken uns schönstens, riefen sämtliche Kränzchenschwestern wie mit einer Stimme, standen auf und machten zierliche Knixe.
Nicht Ursache! Nicht Ursache! – antwortete der Kommerzienrat, die Schlafmütze lüftend. – Es ist gern geschehen.
Was ich damals nicht herausbringen konnte, das ward mir in der Folge deutlich. In meinem Herzen hatte die Schlaue gelesen, und dann, freilich, dann mußte sie lachen. Damals hatte ich noch die Binde vor den Augen, und der Skrupel über das Warum liest mir weder Rast noch Ruhe. Ich mußte es herausbringen, ich mußte meiner inneren Bosheit Luft machen. Denn es war mir nun, wie schon gesagt, unausstehlich, daß sie mit mir kein Plänchen habe, daß sie so elend, so nichtswürdig sein könne, nach dem Zwerge zu greifen – vielleicht der paar tausend Taler wegen. Ich lauerte sie daher auf der oberen Hausflur ab, als sie eben vom Wäschetrocknen die Bodentreppe herabhüpfte. – Sie erschrak, als sie den Lauerer erblickte, dessen Absicht sie erraten mochte. Auch ich erschrak und wäre fast nicht imstande gewesen, ein Wort zu sagen, wenn nicht der Gedanke meine Zunge gelöst hätte, daß diese Gelegenheit sobald mir nicht wiederkommen dürfte. Darum trat ich ihr keck mit den Worten in den Weg: Halt, halt, Mühmchen! Wohin so eilig? Zum Liebsten kommen Sie schnell genug. Er wartet zärtlich auf Sie im Holzstalle und läuft nicht davon. Gönnen Sie mir auch einmal ein Wörtchen!
Was wollen Sie von mir? zitterte sie und sah blutrot zur Erde.
O nur wenig! – entgegnete ich. – Nur wissen möchte ich, – ob – ob – Sapperment! ich hatte das Konzept verloren und platzte in Seelenangst ungeschickt heraus: ob Sie den Habakuk heiraten?
Sollte ich nicht? – ermutigte sie sich schäkernd. – Ist's nicht ein charmanter Bursch? Sie werden doch tanzen auf meiner Hochzeit mit Fräulein Beckchen?!
Lachend war sie mir entsprungen, und verblüfft stand ich da im stummen Nachstarren.
Als ich wieder zu mir selber kam, wußte ich nicht, ob ich mich schämen, freuen, oder ärgern sollte. Schämen, weil ich durchaus das nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollen; freuen, über den Liebreiz des holden Geschöpfes, das mit den vollen, runden Armen, über die sie wirtschaftlich die blendend weiße Bauschhülle hoch hinaufgestreift, im reinlichen Hauskleide, in aller Anmut der Unschuld und Jugend vor mir gestanden; ärgern, über ihr Lachen und das Bekenntnis, daß eben dieser Liebreiz einem Kaliban zuteil werden solle. Vielmal noch setzte ich an, aber immer war es mir unmöglich, ihr irgendetwas Bitteres zu sagen. Hatte ich denn im Grunde auch Ursache dazu? Was ging es mich eigentlich an, wen sie heirate? Und mußte nicht alles, was ich von ihr sah und hörte, nur meine Achtung für sie vermehren? War sie es nicht, die manche Nacht bei der kranken Mutter verwachte und dennoch am Tage flink und fleißig die Wirtschaft versah, als bedürfe sie des Schlafes gar nicht? War sie es nicht, welche die oft fast unerträglichen Launen der Mutter nur mit stiller Milde und erhöhter Anstrengung erwiderte? War sie





























