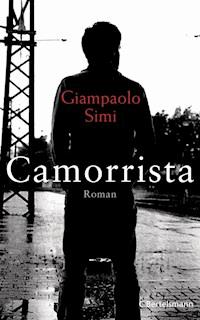Inhaltsverzeichnis
Widmung
I
Copyright
Alle Kreaturen der Abgründe sind Fleischfresser.
Für Anna Maria
I
Als ich klein war, nannten sie mich das elektrische Mädchen.
Wenn sie uns ins Bett brachten, knipste mein Bruder Diego das Licht aus und wollte, dass ich »Glühwürmchen« machte. Jeder synthetische Pullover knisterte und sprühte Funken, sobald ich ihn über den Kopf zog.
Das gefiel ihm wahnsinnig, kam ihm vor wie Zauberei. Mir gefiel es ein bisschen weniger, wenn ich an der Autotür, am Toaster oder an der Antenne des tragbaren Fernsehers einen Schlag bekam. Diego schloss daraus, ich hätte Superkräfte, und so bat er mich eines Tages, die kleinen Batterien des Walkmans, den er zu Weihnachten bekommen hatte, die ganze Nacht lang fest in meiner Hand zu halten.
Am nächsten Morgen funktionierte sein Walkman wieder. Dann stimmte es also, ich hatte Superkräfte. Ich glaubte daran, ohne mich groß zu wundern. Es erschien mir durchaus wahrscheinlich, dass es Menschen mit Superkräften geben konnte.
Meine Superkräfte mussten ein Geheimnis zwischen Diego und mir bleiben, doch an dem Tag, als ich zum ersten Mal meine Zahnspange trug, musste ich erleben, wie meine Beliebtheit in der Klasse massiv einbrach, und da erzählte ich den anderen davon. Ich prahlte geradezu mit meinen Superkräften, und eine Klassenkameradin gab mir die dicken Batterien einer dieser Puppen, die weinen können, zum Aufladen.
Da es ja größere Batterien waren, verkündete ich mit Kennermiene, dass ich mindestens zwei Nächte brauchen würde. Voller Angst, mein Bruder könnte etwas merken, umklammerte ich die Batterien drei Nächte lang, die letzte davon schlaflos. Doch diese dumme Puppe wollte einfach nicht weinen.
Ich wurde zum Gespött der Klasse. Als ich meinem Bruder alles gestand, war sein Urteil eindeutig: Wer seine Superkräfte offenbart, verliert sie für immer.
Einen Monat danach erklärte mir mein Vater, dass Diego immer die Batterien ausgetauscht hatte, während ich schlief. Und was aufladbare Batterien anging, so würden sie eines Tages überall verbreitet sein, und das wäre dann für die Natur viel besser. Die Natur war mir schnurz, und ich fühlte mich ganz schlecht, hauptsächlich weil niemand Superkräfte hatte.
Ich fragte ein paar Mal bei meinem Vater nach.
»Nein, niemand«, sagte er jedes Mal.
»Du auch nicht, Papa?«
»Aber nein.«
Plötzlich hatte ich das Gefühl, in einer todtraurigen Welt zu leben.
Ein Therapiezentrum ist auch kein besonders fröhlicher Ort.
Aber das hier befindet sich in einer Benediktinerabtei (was will man mehr). Sie heißt Spaccavento, und ich habe sie immer aus der Ferne gesehen. Ich muss sagen, sie hat schon ihre Wirkung, wenn man sich ihr auf dem alten Weg voller Teerkrusten nähert (die vielen Schlaglöcher haben allerdings auch ihre Wirkung auf meine beginnende Blasenentzündung).
Nach der (hoffentlich) letzten Kurve ragt die Einfriedungsmauer vor mir auf, hoch und senkrecht wie ein mit Kletterpflanzen überzogener Deich.
Ich stelle den Motor ab und stütze mich aufs Lenkrad. Der Glockenturm der Kirche, eckig und aus grobem Stein gemauert, erhebt sich über den dunklen Spitzen der Zypressen. Ich hole ein Erfrischungstuch aus der Handtasche, kontrolliere im Rückspiegel mein Aussehen und beschließe, den Lippenstift aufzufrischen (nicht zu wenig, aber auch nicht übertrieben viel).
Ich mache die Wagentür auf. Wenn Gott existiert, wird er sicher wissen, wie sehr ich jetzt, im Alter von dreißig Jahren, eine dieser Superkräfte brauchen könnte. Irgendeine, er kann sich eine aussuchen, egal welche.
Doch das einzig Elektrische, das ich spüre, ist ein Kribbeln im Knie. Ansonsten ist auch das Handy auf null. Kein Saft und kein Netz.
Hier drinnen sind überall Skelette.
Ich bin von langen Knochen umgeben. Von krummen alten Knochen.
Die auf der anderen Seite des Tischs mustern mich eingehend. Sie sind zu dritt.
»Daniele Mastronero, genannt Cocíss«, beginnt der Typ in der Mitte, der im blauen Anzug. »Ja, wie der Apachenhäuptling. Man nennt ihn wohl deswegen so, weil er zwei gleiche Narben unter den Augen hat. Wie die Kriegsbemalung der Indianer. Unser Mann war der Gebietsverantwortliche für den Block K, den nördlichen Bereich des Viertels 167, zwei Drogenumschlagplätze, ein Dutzend Soldaten, dazu die Dealer, die Schmieresteher und die Wachtposten. Heroin, Kokain, Crack und Fläschchen zu erschwinglichen Preisen. Sieht so aus, als hätte er seit ein paar Monaten direkt mit den Lieferanten verhandelt.«
Der Typ im blauen Anzug hat beinahe weißes Haar und schwarze Augenbrauen. Kleine, misstrauische Augen von einem, der nur jedes Schaltjahr mal lacht. Er schließt die Mappe und räuspert sich.
»Wir haben ihn am frühen Morgen aufgegriffen, in einem verlassenen Zigeunerlager. Mastronero hatte sich in einem Wohnwagen versteckt, den er mit seinen Komplizen benutzte, um, wie er es nannte, bestimmte Probleme bei der Arbeit zu lösen. Hier sind die Fotos der Inaugenscheinnahme und eine unvollständige Liste des sichergestellten Materials.«
Er reicht mir ein Dutzend zusammengehefteter Blätter.
»Wollen Sie einen Blick darauf werfen? Bitte.«
(Ich lege keinen Wert darauf.)
»Danke.«
Sie sehen mich alle drei an, mehr oder weniger aufmerksam. Es ist ein Test. Und aus den Schaukästen, ohne erkennbare Ordnung an den Wänden aufgestellt, starren mich die traurigen Augenhöhlen leerer Schädel an.
Die Fotos hat man von eins bis fünfundzwanzig durchnummeriert. Die Wände und der Boden des Wohnwagens sind übersät mit Spritzern. Weitere Aufnahmen zeigen eine Autobatterie mit Kabeln und Klemmen, eine Nagelzange, weiße Plastikflaschen, einen Schuh. Ich überfliege die Auflistung des sichergestellten Materials: »2 große Zehennägel, ganz; 1 distales Zehenglied, an einem Ende zerquetscht; 5 Knorpelfragmente einer Hörmuschel; 1 Stück Kopfhaut, rechteckig, ungefähr 3,5 cm × 1,2 cm mit ausgefransten Rändern …«
Ich schließe das Dossier. Der Mann in Blau scheint nicht die Absicht zu haben, weitere Ausführungen zu machen, vielleicht erwartet er, dass ich etwas sage, aber ich enttäusche ihn. Ich schaue zuerst ihn an, dann die beiden anderen, die in einer Reihe mir gegenüber an dem langen Tisch mit Marmorplatte sitzen. Dann rücke ich den Ausschnitt meines T-Shirts zurecht und lasse die Glieder meines Quarzarmbands durch die Finger gleiten, als wäre es ein kleiner Rosenkranz. Ich sehe auf die Uhr: Es ist zwei. Über uns brennt die Sonne auf die Dachziegel, und hier drinnen ist die Luft abgestanden.
»Wollen Sie etwas hinzufügen, Dottor Alamanni?«, fragt der Mann in Blau den Typen, der zu seiner Linken sitzt. Rosa Polohemd, um die vierzig, bisher hat er seinen Blick auf den Spalt des angelehnten Fensters gerichtet und dabei auf einem Bügel seiner Brille herumgekaut. Er ist Psychologe, kommt von der Zentrale in Rom. Bevor er etwas sagt, seufzt er und reibt sich die Lider.
»Mastronero ist ein ausgesprochen asozialer Charakter mit paranoiden Zügen. Er weist eine starke psychische Unausgeglichenheit auf, die wahrscheinlich mit gewohnheitsmäßigem Drogenkonsum in Verbindung steht. Die Abstinenz von Drogen und der Verlust seines - wenn wir so wollen - normalen Bezugsrahmens können bei ihm zu depressiven Spitzen führen, deren Beschaffenheit und Schwere nicht leicht vorherzusehen sind.«
Schlimmer konnte es für mich beim ersten Auftrag nicht kommen. Ich nicke, würde aber am liebsten aufstehen und gehen.
»Wann trifft er hier ein?«, frage ich.
Der andere antwortet mir, der zur Rechten.
»Heute Nacht. Nicht vor eins, glaube ich.«
Hemd mit orangefarbenen Streifen, das er über der Hose trägt, fitnessgestählte Figur und das Gesicht eines Draufgängers (der Netteste von den Dreien, würde ich sagen: jedenfalls hat er mich sofort geduzt). Er heißt Reja, ist Sovrintendente, im Grunde ist er der Verbindungsoffizier zwischen der Zentralen Abteilung Zeugenschutz und der regionalen Polizeieinheit, zu der ich von heute an offiziell gehöre.
»Wird er allein hierher überstellt?«
»Ja.«
»Frau und Kinder stehen nicht unter Schutz?«
Der Psychologe räuspert sich. Der Typ im blauen Anzug antwortet mir, als er schon die Hände auf den Tisch gestützt hat, um aufzustehen. Er trägt einen goldenen Ring, breiter als ein Ehering, und außerdem hat er ihn am Mittelfinger.
»Daniele Mastronero ist vergangenen Monat achtzehn geworden.«
Zwischen den irgendwie ungeordnet zusammengestellten Skeletten sind Reja und ich allein zurückgeblieben. Der Sovrintendente geht von einem der großen Schaukästen zum anderen, um sich die Beine zu vertreten. Er hat dreihundert Kilometer zurückgelegt, die anderen beiden wohl noch mehr. Interessiert schaut er sich den Mammutschädel an, der an zwanzig Zentimeter breiten Ledergurten von der Decke herunterhängt (allein auf dem Stoßzahn könnten bequem ein Dutzend Kinder sitzen).
»Was ist denn ein Fläschchen?«, frage ich. (Man ist halt neugierig.)
»Mehr oder weniger Acid aus LSD, Kokainbase und Bikarbonat. Sie stellen es in Halbliter-Plastikflaschen her. Ich glaube, man inhaliert es durch einen Strohhalm.«
»Hat unser Mann sich nach der Festnahme entschlossen zu kooperieren?«
Reja dreht sich ruckartig um, als wäre er bis vor einer Sekunde in Gedanken versunken gewesen, hebt die mächtigen Schultern und öffnet eine schwarze Gürteltasche, die unter seinem weiten Hemd verborgen war.
»Scheint so. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft riskiert er eine Menge. Die Kommission muss innerhalb einer Woche über das Schutzprogramm entscheiden. Aber wenn sie es in die Länge ziehen sollten, verlegen wir ihn an einen sichereren Ort.«
Ich sehe aus dem Fenster. Die gelbe Straße unterbricht die akkuraten Rebstockreihen, die so gerade verlaufen wie Rippen im Cord.
»Ist er hier nicht sicher genug?«
»Nein.«
»Es ist aber doch ein ruhiger Ort.«
»Zu ruhig.«
Er gibt mir einen verschlossenen Briefumschlag, weiß und unbeschriftet, erklärt mir, dass ich die ganze Woche damit auskommen muss. Ich stecke ihn in die Handtasche, ohne ihn zu öffnen (von der Dicke her würde ich sagen: tausend Euro in Fünfzigern).
»Wir haben uns gedacht, dass auch der Leiter des Zentrums nicht erfahren sollte, wie der Neuzugang wirklich heißt«, sagt er und kramt wieder in seiner Gürteltasche. Ich weise darauf hin, dass Padre Jacopo darauf besteht zu wissen, wen er aufnimmt, und mir Probleme machen könnte.
»Das kriegst du schon hin. Sein Name ist der, der auf den Tarndokumenten steht, und fertig.«
»Und wo sind sie, die Tarndokumente?«
»Kommen heute Nacht mit ihm an.«
Er setzt sich auf den Tisch, schiebt sich seine Locken aus der schweißnassen Stirn. Zwischen seinen Fingern funkelt ein grün fluoreszierendes Stäbchen. Ich weiß nicht recht, was das ist.
»Und im Zentrum? Weiß da schon jemand, dass du von der Polizei bist?«
»Nein. Nur Padre Jacopo.«
»Perfekt. Für alle anderen, Mitarbeiter eingeschlossen, bist du die ältere Schwester unseres Mannes. Und der muss den Kontakt zu den anderen im Zentrum auf das unvermeidliche Minimum beschränken.«
»Und damit meinst du?«
»Damit meine ich: null.«
»Im Zentrum sind keine anderen Vorbestraften.«
Er mustert mich erstaunt, aber überheblich.
»Das möchte ich sehen, Kollegin. Machen wir weiter: Er weiß, dass du Rosa heißt und von der Polizei bist. Wenn es irgendein Problem gibt, löst du es für ihn. Punkt. Er darf nicht wissen, wo du wohnst, wie du mit Nachnamen heißt, ob du verheiratet bist, nichts. Er darf deine Nummer nicht haben, auch weil es im Augenblick gut ist, wenn er vergisst, wie ein Telefon überhaupt aussieht. Und egal was ist, Padre Jacopo kann dich Tag und Nacht erreichen, haben wir uns verstanden?«
»Wir haben uns verstanden.«
»Noch etwas: Hier in der Gegend fällt ein neues Gesicht allen auf. Also: Große Spaziergänge nur innerhalb des Geländes, und nur wenn du dabei bist. Klar?«
(Es ist klar, dass ich bei einem solchen Typen mehr oder weniger als Strafvollzugsbeamtin fungiere.) Ich möchte ihm sagen, dass ich mich nicht mehr dazu in der Lage fühle. Doch das kann ich jetzt nicht, dies ist mein erster Auftrag, und ich klammere mich an die einzige positive Seite des Ganzen. Es dauert höchstens eine Woche, dann geht »die dringlichen Sonderschutzmaßnahmen unterstellte Person« in eine große Stadt, weit weg von hier, und wird unter Aufbietung weniger dringlicher Schutzmaßnahmen von irgendjemand anderem in Obhut genommen.
Reja kommt mit seiner Liste von Handlungsanweisungen ans Ende. Es ist eine besondere Lage, und dieser Typ muss sich die Regeln fest einprägen, und zwar sofort. Er muss wissen, dass ich der Zentralen Abteilung über alles berichte, selbst darüber, wie viele Zigaretten er raucht. Bei der kleinsten Verfehlung: Ende der Ferien und Rückkehr ins Gefängnis.
»Und dann hat er ein Problem«, sagt Reja schließlich, hebt die Augenbrauen und verzieht die Lippen. Das ist kein Lächeln, nur Haut, die sich auf dem kantigen Draufgängergesicht spannt. Zum Schluss reduziere ich die Möglichkeiten auf zwei, die da wären: Der Typ verbringt im Gefängnis entweder die nächsten drei Jahre in Isolationshaft, oder er lebt höchstens drei Tage, gerade so lange, wie sie brauchen, um eine Gelegenheit zu finden, ihm die Kehle durchzuschneiden.
Reja steht auf und tritt ans Fenster.
»Man kommt hier um vor Hitze.«
»Padre Jacopo hat Anweisung gegeben, nichts anzufassen und die Fenster nicht zu öffnen.«
Diese Räume darf seit einer ganzen Weile niemand mehr betreten. Es heißt, die naturwissenschaftliche Sammlung der Abtei soll in einem Jahr wieder geöffnet werden. Reja sieht sich einen alten Luftfeuchtigkeitsmesser an, ich bleibe vor einem anderthalb Meter hohen Schaukasten mit dem perfekt erhaltenen Skelett eines kleinen Dinosauriers stehen. Es ist einer von diesen zweibeinigen mit kurzen Vorderpfoten. Auf der angelaufenen Tafel steht, dass es sich um eine Rekonstruktion handelt, Geschenk eines argentinischen Museums.
Reja stößt geräuschvoll die Luft aus. Ich sollte keine weiteren Fragen stellen, tue es aber trotzdem.
»Kommt sein Anwalt auch mit?«
»Das weiß man im Augenblick nicht.«
»Wird er in der Zeit hier verhört?«
»Sicher. Doch wo und wann, erfahren wir erst im letzten Moment. Jetzt lass uns überlegen, wo wir ihn unterbringen: nicht im Erdgeschoss, kein Balkon, nur eine Tür und möglichst zwei leere Zimmer daneben. Geh du dir das bitte anschauen. Wenn im Zentrum irgendwelche Transen oder Rumänen sind, erkennen die schon an meinem Gesicht, dass ich ein Bulle bin.«
Am Gesicht vielleicht nicht. Am Gang und an der Art zu reden, das könnte allerdings sein. Er ruft mich zurück, als ich schon an der Tür bin.
»Fast vergessen: Hier ist Material, das du dir besser ansehen solltest.«
Von dem grün fluoreszierenden Stick baumelt ein schwarzes Bändchen.
»Hier sind die Daten seiner Komplizen drauf, Aktenvermerke, vertrauliche Quellen, die alles Mögliche über ihn erzählen. Wenn du dich wirklich amüsieren willst, gibt es auch die Geschichte dieser ganzen Scheiße, die in den letzten Wochen da unten passiert ist. Niederschriften, Berichte, Abhörprotokolle. Auch Fahndungsfotos von Leuten, die sich auf die Suche nach ihm machen könnten. Man weiß nie.«
Ich fummle schon wieder am Kragen meines T-Shirts herum, Reja hebt eine Augenbraue und fügt hinzu:
»Nur die Ruhe, ich habe gesagt: Man weiß nie. Dottor D’Intrò besteht darauf, dass man in solchen Situationen besser einen Gesamtüberblick hat.«
Ich fürchte, jetzt verstehe ich. Dieser Cocíss ist in Gefahr, weil er versprochen hat, über die Aprilfehde, wie die Zeitungen sie genannt haben, auszusagen. Mehr als zwanzig Tote in einem Monat, und letzte Woche ein Blutbad mitten im Zentrum. Sie haben einen Vorbestraften umgebracht und dabei zwei Mädchen getötet, die nichts damit zu tun hatten. Acht Jahre alt, vielleicht neun, nicht mehr. Von Nunzia und Caterina haben alle eine ganze Woche geredet, es sind die einzigen Opfer, die für den Rest Italiens noch ein Gesicht und einen Namen haben. Jetzt habe ich das Gefühl, sie hier zwischen den Fingern zu halten. Alles, was von ihnen bleibt, Bröckchen elektronischer Asche in einer Urne aus grünem Plastik. Ich schließe meine Finger fest darum und stecke den USB-Stick in die Handtasche.
»Du darfst diese Dateien auf keinen Computer laden, auch nicht im Büro. Nicht ausdrucken, und wenn du den Stick mit dem Computer verbindest, kontrollier vorher, dass du nicht online bist, okay? Ach, er wird dich nach einem Passwort fragen. Es ist ›Cocíss‹.«
»Wie geschrieben?«
»Mit C und zwei S hinten.«
Er wiederholt ihn noch einmal, den Kampfnamen von Daniele Mastronero, und die beiden S am Ende kommen mir vor wie das Zischen eines Messers, mit dem man meuchlings zusticht.
Am Ende des Südflügels finde ich eine Unterkunft, die mir alle Anforderungen Rejas zu erfüllen scheint. Das Zimmer ist groß, geht auf einen kleinen Garten mit einem Mandelbaum und einer Bougainvillea hinaus. Padre Jacopo lehnt die Matratze ans Fensterbrett und lässt die Bettlaken wechseln. Er will, dass sie neu sind. Wegen der symbolischen Bedeutung, erklärt er mir (wo sich einer wie Cocíss wohl symbolische Bedeutungen hinsteckt?).
Weil das Waschbecken nicht abfließt, schraubt Padre Jacopo das Abflussrohr auf. Als ich ihm sage, dass der neue Gast nicht vor ein Uhr nachts eintreffen wird, hält er die Zange um die fest sitzende Mutter geschlossen und sieht mich an.
»Nachts wird hier geschlafen.«
»Ich kann da nichts machen.«
»Es scheint ein besonderer Fall zu sein.«
Ich gehe nicht darauf ein.
»Kommt er mit Bewachung?«
»Außer mir noch zwei Kollegen.«
Alles in allem gefällt mir dieser Mann, er hat große, ehrliche Hände und fettige Fransenhaare, ein bisschen siebziger Jahre. Er schraubt die Mutter mit den Fingern fertig ab, zieht das Rohr heraus, und die Schüssel füllt sich mit einem schwarzen Matsch aus Haarknäueln. Er wischt sich die Hände an den Leinenhosen ab und schaut mich durch seine von Fingerabdrücken verschmierten Brillengläser an.
»Wir könnten ihn durch das Tor der Toten hereinbringen.«
Ich reiße die Augen auf, und er bemerkt es.
»Das ist nur das Gittertor hinten am Friedhof. Die Mönche nennen es so. Dann geht ihr durchs Kloster und kommt genau hier heraus, am Ende des Gangs, ohne alle aufzuwecken.«
Er steht auf, stützt sich dabei an die Wand. Ich sage ihm, dass mir das eine ausgezeichnete Lösung zu sein scheint.
»Aber man muss Frate Jacques um die Schlüssel und die Erlaubnis bitten. Und mit mir redet Frate Jacques seit zwei Monaten nicht mehr.«
Er erklärt mir, dass die Mönche die Einrichtung des Zentrums nicht verwunden haben. Sie sind ja nur noch zu fünft oder sechst und schaffen es nicht mehr, sich um alles zu kümmern. Er erklärt mir haarklein, dass die Räume verteilt worden sind, die Abmachungen klar: Die Mönche haben die Kirche behalten, einen Flügel des Klosters, den Kapitelsaal, den botanischen Garten und die Apotheke, während das Zentrum das allgemeine Gästehaus und jenes des Granduca, den Flügel der Laienbrüder, die alten Stallungen, das Land und das Museum bekommen hat.
»Und was für Probleme gibt es dann?«
»Das Problem ist, dass ich die Mädchen nicht daran hindern kann, sich im Badeanzug zu sonnen, zu tanzen und Musik zu hören.«
Frate Jacques ist klein, zäh und Franzose. Aus der Ariège, erklärt er mir. Ich gebe mich interessiert, aber für mich ist Frankreich das Land des Schlafes. Jede Region, jede Stadt erinnert mich nur an eines: die Sommernachmittage, wenn ich nach dem Meer im Arm meines Vaters einschlief, der sich die Tour de France ansah. Er verfolgte alle Etappen, von einem Liegestuhl aus, nachdem er den mächtigen Fernsehapparat zur Glastür Richtung Garten gedreht hatte. Er fischte Obst aus einer Plastikschale, und ich schlummerte ein, während ich seine Brusthärchen kräuselte, die weiß vom Salzwasser waren, noch nicht vom Alter. Ich war fünf Jahre alt.
Dann sechs, dann sieben, dann, mit acht Jahren, wog ich zu viel, und ihm wurde zu warm bei der Sache, und er wollte nicht mehr.
An meinem zehnten Geburtstag, im Juli, hatten wir nicht einmal mehr das Haus am Meer. Es war das Jahr, in dem mein Bruder zum ersten Mal von zu Hause weglief.
»Dies ist ein Ort der Besinnung und des Gebetes«, sagt Frate Jacques zu mir.
Neben dem Computer, auf einem kleinen halb ovalen Schreibtisch am Fenster, sehe ich die Taschenbuchausgabe der Bekenntnisse liegen.
»Ich habe an einer Examensarbeit über den heiligen Augustinus geschrieben, wissen Sie.«
»Tatsächlich?«
»Ja, über die antipelagianische Polemik.«
Wir reden eine Viertelstunde darüber, Frate Jacques ist enttäuscht, dass ich die Arbeit nicht abgeschlossen und also auch kein Examen habe. Und (noch einmal: also) die Studien und Forschungen nicht fortgesetzt habe und (zum letzten Mal: also) in die Arbeitswelt eingetreten bin, in einen Bereich, in dem sich allgemein wenig Philosophen finden.
»Und welcher Bereich ist das?«
»Ich bin Polizistin.«
Einen Augenblick lang sieht er mich an, als wäre ich oben ohne in sein Büro gekommen. Ich gebe ihm nicht die Zeit, sich zu erholen.
»Hören Sie, heute Nacht müssen wir eine Überwachungsmaßnahme durchführen. Das stellt für das Zentrum natürlich eine … sagen wir … ungewöhnliche Situation dar.«
Er würde mir gern sagen, dass er das wusste, dass es klar war, dass er sich das gedacht hat. Doch er bleibt in seiner Rolle, streichelt seine Hände und tut, als bedaure er das.
»Ich möchte Sie freundlich um einige Schlüssel bitten. Ich vertraue darauf, dass die Angelegenheit unter uns bleibt, auch Padre Jacopo darf nichts davon wissen, Sie verstehen mich.«
Er ist hochzufrieden, mich zu verstehen, der kleine Franzose.
»Welche Schlüssel brauchen Sie denn?«
»Die zum Tor der Toten«, antworte ich.
Ich sehe zu, wie die drei in die schwarze Limousine mit den schlammbespritzten Kotflügeln steigen. Der Wagen steht neben dem von Holzbalken getragenen Heuschuppen. Reja am Steuer, der Psychologe hinten, der Mann in Blau ist noch mit Telefonieren beschäftigt und lehnt an der Beifahrertür. Er hat sich das Jackett ausgezogen, und zwischen den Knöpfen seines Hemds schlängelt sich das Kabel des Ohrhörers.
Er hat eine fleischige Nase und die dicken Augenbrauen eines Mannes, der mit Kopfstößen einen Berg aus dem Weg räumen könnte. Und so habe ich gleich bei meinem ersten Auftrag niemand Geringeren als den Hauptkommissar Paolo D’Intrò kennengelernt, den Chefermittler der Operation Antigone. Zweiundsechzig Festnahmen in einer Nacht unter den Clans Scurante und Incantalupo, ich weiß nicht mehr, wie viele Kilo beschlagnahmtes Heroin, das Viertel 167 bis zum Morgengrauen belagert, der Supermarkt der Drogen durch eine Blitzaktion geschlossen. Wenigstens für ein paar Tage.
Zweiundsechzig Festnahmen, darunter Daniele Mastronero, genannt Cocíss, der Typ, um den ich mich kümmern muss. Sie haben sich zu dritt aufgemacht, um mir seine Ankunft anzukündigen und mir zu erzählen, was für eine Bestie er ist. Und ich wollte Nein sagen, Entschuldigung, aber das schaffe ich nicht. So einer, für mich? Ich bin gerade mit dem Lehrgang fertig, und bis vor einem halben Jahr war ich bei der Verkehrspolizei. Was soll das denn? Das ist doch verrückt.
Das Auto fährt zwischen den Reihen der Rebstöcke entlang. Man könnte meinen, dass an einem Ort wie diesem nie irgendwas passiert. Weit gefehlt.
Viertel vor sechs. Was mache ich noch hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich lieber zwischen den Wirbelsäulen aus Kalk und den polierten Lackschaukästen einschließen lassen möchte, als meinen ersten Auftrag anzugehen. Scheiße, muss das denn ausgerechnet mir passieren?
Ich betrachte den kleinen rekonstruierten Dinosaurier, sein Skelett im Lauf für immer festgehalten. Ich beuge mich vor, um noch einmal zu lesen, was auf dem Schild steht. Nur so, um mich abzulenken.
Eoraptor. Das heißt Jäger der Morgenröte. Ich lese, dass mit ihm die Dinosaurier auftreten, denn in einem gewissen Sinn ist er eine Art Prototyp. Sein Gebiss ist zum Teil noch das eines Pflanzenfressers. Ein kleines, schnelles, primitives Tier, erschienen und ausgestorben in der Oberen Trias. Das heißt: vor ungefähr 230 Millionen Jahren.
Ich lasse das Halbdunkel, die Stoßzähne und den Staub hinter mir. Schließe die Tür des Raums, und der Jäger der Morgenröte rennt wieder durchs Dunkel (warum nur hat die Natur immer wieder das Bedürfnis, neue Jäger zu schaffen?).
Vor 230 Millionen Jahren.
Ich gehe die Treppe hinunter. Was ist da schon eine Woche.
Ich gehöre zu den Jägern des Abendrots.
Davon existieren verschiedene Subspezies: junge Berufstätige, Karrierefrauen, Singles, Geschiedene und kinderlose Paare. Wir ziehen erst nach sieben Uhr abends im Supermarkt unsere Kreise. Wir bevorzugen Einkaufswagen. Wir kommen an die Kasse, wenn der Parkplatz sich schon geleert hat.
Wir kommen an die Kasse, und unser Handy klingelt. Immer.
Es ist meine Mutter, und sie legt sofort los. Mein Vater schließt sich jetzt jedes Mal, wenn das Telefon klingelt oder es an der Tür läutet, in den Keller ein. Er hat Angst vor nicht näher bezeichneten Gläubigern. Er sieht ein Dutzend Mal am Vormittag im Briefkasten nach, weil er zu Protest gegangene Wechsel oder bedrohliche Anwaltspost erwartet. Den Nachmittag dagegen verbringt er mit der Kontrolle von Kontoauszügen und Belegen jeder Anschaffung der letzten fünf Jahre, die, nach Monaten abgeheftet, aufs Sorgfältigste in einer Schublade verwahrt werden. Er ist davon überzeugt, dass die Bank ihm Geld abgenommen hat, was nicht stimmt (jedenfalls nicht in dem Maße, wie er es behauptet). Meine Mutter wollte alles wegwerfen, doch er hat die Schublade rausgezogen und sich damit in der Abstellkammer eingeschlossen. Dort drinnen ist er eine Stunde geblieben.
Sie sagt, dass sie noch vor ihm im Irrenhaus landet.
Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll, auch weil sich die Kassiererin inzwischen mit meiner EC-Karte herumschlägt. Zahlung nicht möglich. Wieso denn das?
Im Hintergrund höre ich meinen Vater schreien. So, wie es klingt, kapiere ich, dass er wirklich im Keller ist. »Du bist eine Lügnerin! Warum erzählen Frauen bloß all diese Lügen?«
Die Leute in der Schlange an der Kasse sehen mich inzwischen alle böse an. Die Jäger des Abendrots sind keine geduldige Spezies.
Das Gehalt müssten sie mir schon überwiesen haben. Doch jeden Monat machen sie das gleiche Spielchen mit der Wertstellung.
»Dann nehmen wir die Kreditkarte, entschuldigen Sie.«
Ich stopfe die Sachen irgendwie kreuz und quer in die Tüte und sage zu meiner Mutter ganz unschuldig, dass Papa mit den Banken nicht so ganz unrecht hat.
»… Daniele Mastronero fand sich seit mehr als einem Monat fast täglich vor der Schule ein und bot sich an, Loredana Chiarella mit seinem Motorroller nach Hause zu bringen. Auf deren wiederholte Ablehnung reagierte er mit einem jeden Tag heftigeren Drängen …«
Ich muss etwas essen. Mit einem Kribbeln in den Schenkeln löse ich mich vom Stuhl, mache den Kühlschrank auf und wieder zu. Zuerst will ich diesen Bericht der Carabinieri zu Ende lesen.
»… und ging so weit, dass er auch Mitschülerinnen des Mädchens bedrohte. So ist die Situation am 15. Januar 2002. Einigen getrennt zu Protokoll genommenen Zeugenaussagen zufolge soll Loredana Chiarella Mastronero mit beleidigenden Worten beschimpft haben, unter anderem als ›Drogengeburt‹. Das soll, nach dem aktuellen Kenntnisstand, die gewalttätige Reaktion von Mastronero ausgelöst haben, die nicht spontan erfolgte, sondern zusammen mit Dritten und organisiert, wodurch Vorsätzlichkeit vorliegt.
Laut der Aussage von Loredana Chiarella, die sie nach Überwindung des Schocks machen konnte, konkretisierte sich die besagte Reaktion in einer Entführung, geschehen am selben Nachmittag …
… es ist nicht klar, ob Mastronero und die anderen den Vorsatz hatten, so weit zu gehen, oder ob der Widerstand des Mädchens sie zum Exzess getrieben hat …
… Auskugelung des Handgelenks und Bruch zweier Knochen der Mittelhand, Riss einer Lendenrippe, Blutergüsse auf den Armen und Beinen, tiefe Hautabschürfungen im Gesicht und am Hals, verursacht durch Material mit Scheuerwirkung auf der Haut, wahrscheinlich Glaspapier, zumindest nach der Erinnerung des Opfers, das nach einer regulären Behandlung im Krankenhaus den Schulbesuch noch nicht wieder aufgenommen hat. Seit drei Monaten hat das Opfer faktisch das normale Leben sozialer Beziehungen mit Gleichaltrigen aufgegeben und eine Form der Bulimie entwickelt, die eine Einweisung in die Klinik notwendig machte.«
Ich öffne den Safe (mit Glaspapier übers Gesicht, Scheiße, wie kann man das machen?), nehme die Pistole heraus und stecke sie in die Innentasche, die ich mir eigens in meine Lieblingslederjacke habe nähen lassen, die mit dem schrägen roten Reißverschluss.
Viertel nach neun.
Ich mache weiter, und über meinen Bildschirm läuft die Mitschrift des Verhörs von Mario Crippa, genannt Marietto, besser bekannt als »Madonnino«, Capopiazza im Viertel 167, nördlich der Umgehungsstraße, Territorium der Incantalupo. Das Verhör wurde vor ungefähr anderthalb Jahren geführt.
»Es hieß, dass die Pärchen auf den Rastplätzen der Umgehungsstraße Sache von Cocíss und seinen Leuten waren. Man braucht nichts Spezielles dazu. Man wartet, bis der Mann sich die Hosen runterzieht. Dann ist einer in der Klemme, und wenn die Frau ausgezogen ist, denkt sie vor allem daran, sich was vorzuhalten, da besteht keine Gefahr … Du kannst ihnen alles wegnehmen. Mit ihm zusammen waren Zecchetto, der um einiges älter ist, also ein Mann, und außerdem Medina, den man so nennt, weil er immer, im Sommer wie im Winter, so ein Käppchen trägt wie die Araber … Aber die wirklichen Namen von denen weiß ich nicht, die habe ich eigentlich nie gewusst.«
Während ich den Salat aus der Tüte in eine Suppenschüssel gebe, höre ich den Summton der Mikrowelle. Ich ziehe die Schale heraus und werfe sie mit einem Schrei ins Spülbecken.
Ich mache Platz zwischen Zeitschriften und Rechnungen und bringe Schüssel, Gläser und Besteck auf dem Schreibtisch unter.
»… hauptsächlich war es wegen den Handys, sie zogen davon fünfzehn, zwanzig in der Woche ab, außerdem Geld und Uhren. Zecchetto machte auch Fotos mit seinem Handy und verkaufte sie an die Jungs im Viertel … das heißt, die ersten Male schickte er sie herum, um anzugeben, später fing er dann an, sich bezahlen zu lassen, weil man vielleicht den Busen der Frau sah oder wie sie ihren Slip in der Hand hatte und ganz panisch war. Das ist der Grund, warum ich sie auf dem Handy habe, Zecchetto hat sie mir geschickt, ich habe die Sache mit den Pärchen nie gemacht, sagen wir mal, es war nicht mein Ding.«
Die Handys. Ich habe zwei, irgendwo vergraben auf dem Schreibtisch. Auf dem einen erwarte ich die Mitteilung, wann und wo genau Daniele Mastronero, genannt Cocíss, ankommt. Mit dem anderen sollte ich meine Mutter anrufen, aber ich muss zugeben, ich bekomme schon Angst, wenn ich dieses Zeug lese.
»Ich weiß nicht, ob Cocíss sich aufgeregt hat, weil Zecchetto diese Sache mit dem Verkaufen der Fotos heimlich machte oder weil es vielleicht gefährlich war. Also ich glaube, er hatte recht, in einem gewissen Sinn. Aber was er mit ihm gemacht hat, das hätte ich nie mit ihm gemacht. Da erinnern sich alle im Viertel dran. Sie haben ihn eines Morgens im Stadtpark gefunden, wie er an einer Schaukel hing, mit dem Kopf nach unten. Er war halb tot, hatte mehr Zähne auf der Erde als im Mund, aber keiner hat sich getraut, ihn da runterzuholen, aus Angst. Es musste ein Krankenwagen kommen, und da war es schon fast elf. Es heißt, er hat eine Woche auf der Intensivstation gelegen. Und dann hat er sich nicht mehr blicken lasen, nicht im Viertel, meine ich. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Aber für ihn war kein Platz mehr. Es ist für keinen mehr Platz, wenn er sich gegen den stellt, gegen Cocíss, meine ich. Der ist wie ein Auto ohne Fahrer, das mit 300 Sachen losrast. Ein Auto, das mit Koks statt mit Benzin fährt. Ich arbeite für ihn, aber ich habe wenig mit ihm zu tun. Ich sehe ihn selten, fast immer nachts, er ist immer nachts unterwegs, tagsüber weniger. Ich sehe ihn ein oder zwei Mal im Monat insgesamt, und je seltener ich ihn sehe, desto besser geht es mir. Wir wechseln ein paar Worte, er fragt mich, ob alles in Ordnung ist, und sagt mir, ich soll meine Arbeit gut machen und nicht mehr fixen, weil ich jetzt Familienvater bin, und zu einem Familienvater passt es nicht, dass er Drogen nimmt. Ich sage ihm, dass er recht hat, und wenn er dann das Geld zählt, halte ich die Luft an, weil ich immer Angst habe, dass was fehlt oder dass er irgendein Problem erfindet, um mich fertigzumachen.«
»Cocíss habe ich nur ein paar Mal in der Spielhalle gesehen. Ich habe nie mit ihm gesprochen, aber ein älterer Freund von mir schon. Cocíss ist einer, den alle respektieren. Er ist gut angezogen und hat immer Geld und ein neues Motorrad. Manche sagen, er hat mit schlimmen Sachen wie Drogen zu tun, aber er zwingt die ja nicht dazu, Drogen zu nehmen. Und wenn es welche gibt, die Drogen kaufen, gibt es immer einen, der sie verkauft. Es heißt, dass einer was nicht bezahlt hatte, und da haben ihm Cocíss und zwei andere eines Nachts in der Bahnunterführung beide Knie kaputtgehauen. Seitdem sitzt er im Rollstuhl, weil er nicht genug Geld hat, um sich operieren zu lassen. Das war nicht schön, ich meine, es gefällt mir nicht, wenn Leute geschlagen oder sogar umgebracht werden. Aber was nehmen und dann nicht bezahlen ist auch nicht richtig. Das ist Stehlen, und auch der Pfarrer in der Kirche sagt, man darf nicht stehlen. Nur dass keiner Angst vor dem Pfarrer hat.«
Dieses Stück aus einem Aufsatz ist mit A. R. unterschrieben. Er wurde innerhalb eines Projekts zur Förderung von Jugendlichen ohne Abschluss geschrieben. Das Thema hieß: »Erzähle von einem Menschen, den du bewunderst«.
Das panierte Medaillon hatte eine klebrige Füllung, die undefinierbar schmeckte. Vielleicht Spinat und Käse. Ich hatte die Packung gekauft, geöffnet und weggeworfen, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Das heißt, ich habe nur »Sonderangebot« und »fertig in fünf Minuten« gelesen.
Ich gehe mit den beiden Handys nach draußen auf die Terrasse. Der Abend ist lau, und die von unten, denen auch die Mansarde gehört, in der ich wohne, essen unter der Pergola. Der Mond hat einen gespenstischen Schleier, was für morgen nichts Gutes ahnen lässt.
Ich schalte mein persönliches Handy aus und werde ein unerreichbarer Teilnehmer.
Die Unerreichbare.
So nennt mich Federico alias DJ Fede. Einer meiner aktuellen - sagen wir mal: Verehrer. Aber nicht, weil ich eine bin, die sich ziert. Bin ich nie gewesen, ehrlich nicht. Ich vergeude schon zu viel Zeit damit, mich zu fragen, was ich eigentlich wert bin, wo ich doch keinen Uniabschluss gemacht und einen Teil meiner glänzenden Zukunft schon verspielt habe. Doch was den Rest angeht, bin ich sicher, dass ich keinen Preis auszuhandeln habe. Ich habe mich immer ganz spontan entschieden. Impulsiv, unvorhersehbar, querköpfig: Man hat schon alles Mögliche über mich gesagt (und alles übertrieben, meiner Meinung nach).
Federico hat zwei präzise Gründe dafür, mich die Unerreichbare zu nennen: Erstens kennt er meinen Namen nicht. Zweitens sitzt er hinter Gittern, und es ist für ihn objektiv schwierig, mich zu erreichen. Zum Glück. Ich habe ihn nämlich mit sechstausend Pillen Ecstasy im Gepäck erwischt. Seitdem schreibt mir Federico, und er schickt mir CDs mit Techno. Dazu rezitiert er Gedichte. Eigene Gedichte. Schreckliche Gedichte. Doch der Psychologe sagt, das hilft ihm sehr, aus seiner Depression herauszukommen, während er darauf wartet, aus dem Gefängnis herauszukommen. Was in zwei oder drei Jahren passieren könnte.
Hin und wieder schicke ich ihm über einen Kollegen ein paar mit dem Computer ausgedruckte Zeilen. Ich danke ihm, versichere ihm, dass ich die CDs höre, sage ihm aber ehrlich, was ich von seinen Gedichten halte. Dass sie schrecklich sind.
Der Psychologe sagt, dass ich es genau so machen soll, und auch seine Familie ist einverstanden.
»Am Ende hat das Mädchen es nicht geschafft, vor Gericht zu gehen und alles zu erzählen, sondern die Aussagen zurückgenommen und gesagt, sie könnte sich nicht mehr richtig erinnern. Es heißt auch, die Familie Chiarella hätte ein - nennen wir es mal - Schmerzensgeld akzeptiert.«
»Und von wem?«
»Was weiß ich? Auf jeden Fall haben seine Komplizen den größten Teil der Schuld auf sich genommen und sind im Gefängnis gelandet, weil sie schon volljährig und vorbestraft waren. Die Entführung konnte Cocíss nicht nachgewiesen werden, und er hat ein Jahr Jugendstrafe bekommen und ist dann wegen guter Führung nach acht Monaten entlassen worden.«
»Und als er rausgekommen ist, hat der kleine Engel mit Drogen angefangen.«
»Er ist der Verantwortliche für ein Gebiet geworden: Capozona mit gerade mal siebzehn.«
»Mit siebzehn, Scheiße«, wiederholt der Kollege und legt die Hand mit der Zigarette aufs Steuer. Morano kommt mir noch neurotischer vor als sonst. Und auch sein T-Shirt aus Acryl riecht mehr nach Schweiß als sonst. Ich sollte es ihm irgendwann mal sagen (er hat keine Frau mehr, die solche Sachen bemerkt). »Da gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Die sind alle vollkommen verrückt geworden.«
Es ist halb zwei, seit einer Stunde stehen wir an der Stelle, wo die Schotterstraße zum Weinberg abgeht. Auf der Landstraße kommt schon ewig kein Mensch mehr vorbei. Dunstschleier liegen in der windstillen Luft. Nur der Glockenturm der Abtei ist beleuchtet. Er überragt um ein Weniges die Spitzen der Zypressen, auf dieser Anhöhe über zwei engen, steilwandigen Schluchten, in denen Brombeeren wuchern. Der Schlüssel war nicht ohne eine kleine Lektion von Frate Jacques über die Abtei Spaccavento zu haben. Nach der Legende sind die Schluchten durch Klauenschläge eines Dämons entstanden, der die Abtei zerstören wollte. Tatsächlich scheint sie wie eine Festung auf einem Felsausläufer erbaut. Aber so ist es nicht. Die Abtei stand mitten auf einem sanften Hügel, der im siebzehnten Jahrhundert abzurutschen begann, Stück für Stück, bis auch die unbeugsamsten Mönche den Ort verließen. Dann, in der Nachkriegszeit, hat irgendjemand die Geschichte aufgebracht, dass der Erdrutsch aufgehört und die Abtei unversehrt gelassen habe, sei ein Zeichen des Herrn. Die Klauenschläge des Dämons hätten die Festung des Glaubens nicht zerstören können. Die Bomben der Alliierten auch nicht
- und so ist Geld für die Restaurierung geflossen.
Ich erzähle die kleine Geschichte, um meinen Kollegen Morano ein bisschen zu zerstreuen. Er tut so, als würde er zuhören, aber sie interessiert ihn überhaupt nicht. Er hat fast ein halbes Päckchen geraucht, ich habe in kleinen Schlucken meine Flasche Wasser ausgetrunken: Zwei Liter an einem Tag sind keine Kleinigkeit. Und in Kürze werde ich bestimmt wahnsinnig dringend müssen, das ist mal sicher.
»Was für ein Dreckskerl, kaum schnappen sie ihn, bereut er schon.« Er nimmt einen letzten Zug, und da der Aschenbecher überquillt, wirft er die Kippe auf die Fußmatte. »Verdammte Scheiße noch mal.«
»Er hat nicht bereut. Er kooperiert.«
»Ah.«
»Das ist was anderes.«
»Anders daran ist, dass er nicht ins Gefängnis muss.« Morano hat keinen Sinn für Feinheiten, aber was diesen Punkt angeht, habe ich auch nicht recht verstanden, wie die Dinge liegen. Vorläufig müsste Cocíss im Gefängnis bleiben. Mir fällt ein, wie Reja heute Nachmittag über den Punkt hinweggegangen ist.
»Ich versuche noch mal, jemanden zu erreichen«, sage ich, doch als ich gerade die Hand nach dem Funkgerät unter dem Armaturenbrett ausstrecke, packt er mich am Handgelenk. Er hat einen Zangengriff.
»Da ist jemand«, sagt er. Er hebt schwer atmend die Brust und kramt unter seiner Jacke herum.
»Wo denn?«
»Im Weinberg. Da hat sich was bewegt.«
»Bestimmt ein Tier.«
Er schüttelt den Kopf. Seine Augen sind aufgerissen. Er lässt mein Handgelenk los, duckt sich und macht leise die Tür auf.
»Du bleibst hier.«
Er hebt eine Augenbraue, um zu fragen, ob ich eine Pistole habe. Ich stelle die Wasserflasche zurück in den Rucksack, der zwischen meinen Beinen steht, und schiebe zur Antwort meine Hand auf die Tasche.
Morano steigt aus und bleibt hinter der Tür in Deckung, dann huscht er rasch zwischen die Rebstockreihen.
»Ja sieh mal einer an, was wir da haben! Ein Nachtsicht-Fernglas mit dem Zeichen der Roten Armee … und was ist das hier? Eine digitale Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv und Filter.«
»Sie befinden sich auf Privatbesitz, und daher …«
Bei dem Versuch zu fliehen hat der Typ die Tasche mit der Ausrüstung auf der Straße verloren. Deshalb ist er zurückgekommen. Er ist dicklich und trägt eine altmodische Schildpattbrille. Mit seiner grünen Armeejacke und den Tarnhosen sieht er aus wie ein ruhiger Studienrat, der es sich in den Kopf gesetzt hat, Krieg zu spielen.
»Und daher?«, fragt Morano.
»Und daher sind Sie auf eigene Gefahr hier.«
Mit einem Blick flehe ich den Kollegen an, nicht den Bullen zu spielen, aber ich weiß, das reicht vielleicht nicht. Sicher, der Typ da sollte einen anderen Ton anschlagen, denn ich kenne Morano gut, und Geduld gehört nicht zu seinen (wenigen) Vorzügen.
»Aber es steht nirgendwo was … Es gibt kein Tor, keine Schranke.«
»Ja und?«
»Sind Sie denn der Besitzer?«
»Was geht Sie das an? Geben Sie mir meine Sachen zurück, aber schnell, sonst rufe ich die Polizei.«
Ich kann es nicht glauben. Wenn ich er wäre, hätte ich mich schon längst davongemacht. Und mich außerdem entschuldigt.
»Meinen Sie das ernst?«
»Geben Sie mir sofort die Kamera und das Fernglas, oder ich zeige Sie an. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt.«
Ich gehe zu Morano, lege einen Arm um seine Taille und wispere ihm zu, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich frage mich gerade, ob ich in der Rolle der kleinen Freundin gut bin, da höre ich ein Knacken.
Morano hat das Nachtsicht-Fernglas der Roten Armee in zwei saubere Teile gebrochen.
»Verflixt. Tut mir leid, aber wenn ich Hammer und Sichel sehe, werde ich nervös. So bin ich nun mal.«
»Los, komm, wir gehen«, sage ich nachdrücklich. Morano entwindet sich mir unwillig.
»Sei du mal schön still und brav.«
Er wirft die beiden Stücke des Fernglases weg, richtet dann die Kamera auf den Typ. Zweimal Blitzen aus der Nähe, und der stolpert, hält sich das Gesicht zu und droht weiter, uns anzuzeigen, streckt die Hände Richtung Objektiv aus, kommt aber nicht näher, als wäre zwischen ihm und Morano eine unsichtbare Wand. Der Kollege steht mitten in den Erdschollen, macht noch eine Aufnahme, nimmt dann die Speicherkarte raus, steckt sie ein und wirft die Kamera dem rechtmäßigen Besitzer zu. Der Mann stürzt nach vorn, um sie aufzufangen, bevor sie zu Boden fällt, und ich versuche in der Zwischenzeit Morano aus den Erdschollen herauszubekommen.
»Es reicht«, raune ich ihm zu. Und ich glaube, ich habe ihn überzeugt, weil ich es schaffe, ihn zum Auto zu ziehen.
»Wenigstens spiele ich nicht den Bullen.«
»Du spielst das Arschloch.«
»Der war da und hat gewartet, dass wir vögeln, verstehst du?«
»Und da hätte er ja lange warten können.«
»Findest du mich so abstoßend?«
»Hör auf damit.«
Wir steigen gerade ins Auto, da fängt der Typ wieder an.
»Du Mistkerl, jetzt hast du mir die auch noch kaputtgemacht. Ich habe einen Haufen Geld dafür bezahlt. Aber ich habe dein Kennzeichen, sei vorsichtig, ich schicke ein paar Freunde zu dir nach Hause …« (O Gott, nein).
Morano sagt kein Wort, schlägt nicht mal die Tür zu. Zwei Schritte, und er hat den Typen schon am Arm gepackt. Er dreht ihm den Arm auf den Rücken, bis er in die Knie geht. Die Brille fliegt weg. Während er sie mit der freien Hand sucht, drückt Morano ihn mit dem Gesicht in die trockene Erde.
»Es reicht«, sage ich zu ihm.
Er zieht seinen Kopf nur deshalb hoch, damit der Typ nicht erstickt. Dann lässt er seinen Arm los, steigt mit den Knien auf seine Schultern und durchwühlt seine Taschen. Er macht die Brieftasche auf und zieht den Ausweis heraus, leuchtet mit dem Handy darauf, um ihn zu lesen, klappt dann alles wieder zu.
Der Typ ist auf allen vieren, sabbert und hustet, als hätte er ein Nadelkissen verschluckt. Morano beugt sich über ihn, ohrfeigt ihn mit der Brieftasche.
»Jetzt weiß ich auch, wie ich dich finde. Dann kann ich dir die Fotos schicken, wenn sie fertig sind.«
Zum Glück ist dem Typ die Lust vergangen, Streit zu suchen.
Und zum Glück hat das Funkgerät im Auto mit seinen Pfeiftönen erst begonnen, als wir schon rückwärts fahren. Aus der Einsatzzentrale teilen sie uns mit, dass es eine Programmänderung gegeben hat. Der Treffpunkt ist verlegt worden: auf eine Raststätte an der A1, zwischen Incisa und Valdarno.
»Das sind bestimmt fünfzig Kilometer«, knurrt Morano.
»O nein«, sage ich.
»Oder auch mehr. Wofür haben die uns verdammt noch mal hier eine Stunde rumstehen lassen?«
Er sieht nach, ob ich angeschnallt bin, geht mit Vollgas in die Kurve und deckt dabei die Madonna mit Schimpfwörtern ein, wie es nicht mal mein Großvater getan hat. Meine Mutter versuchte immer, mir die Ohren mit ihren Fingern voller Ringe zuzuhalten (heute trägt sie nur noch den Ehering und einen kleinen Ring mit Brillanten).
Diese fünfzig Kilometer sind wie Rückwärtszählen. Die letzte Stunde in Freiheit vor einer Verurteilung. Und Morano ist ein besessener Kilometerfresser, immer eine brennende Zigarette in der Hand.
Ab und zu brennt Licht im Fenster irgendeines Einfamilienhauses. Wir sind ein rasender Lärm in der nächtlichen Stille. Hin und wieder spüren die Scheinwerfer ein aufblasbares Schwimmbecken oder eine bunte Rutsche im Dunkel auf.
Ich stelle mir einen Augenblick lang vor, ich wäre in einem dieser Häuser, läge unter Laken und auf Kissen, die nicht nur meinen Geruch hätten. Normale Sorgen und rituelle Familienessen. Ein Mann und zwei Kinder, ja, wenigstens zwei, ganz klar. Er schnarcht vielleicht, oder vielleicht verlangt er fast jeden Abend eheliche Pflichterfüllung, und sei es nur als selbstverständliche Belohnung dafür, wie er sich im Leben den Arsch aufreißt. Ich merke, dass sich der Rauch von Moranos Zigaretten auf meine Haare legt wie ein Spinnennetz. Ich schäme mich für den Gedanken, dass ich auch ein solches Leben akzeptieren würde - lieber, als hier zu sein, wo ich bin, mit Morano, in einem Auto, das nach Asche und schmutzigen Fußmatten stinkt und um zwei Uhr nachts zu einer Raststätte an der A1 rast (ich hoffe nur, dass sie dort eine Toilette haben).
Morano zieht den Ärmel seines T-Shirts hoch und kratzt sich über die gotischen Lettern auf seinem Bizeps. Ich habe
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Rosa elettrica« bei Einaudi in Turin.
1. Auflage
Copyright © 2007 Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-03798-3
www.cbertelsmann.de
Leseprobe
www.randomhouse.de