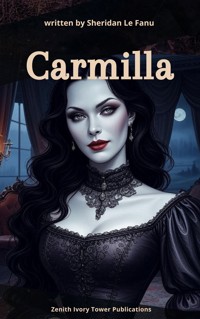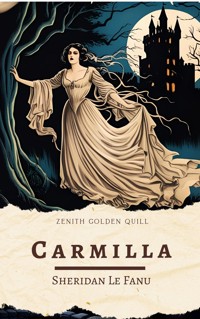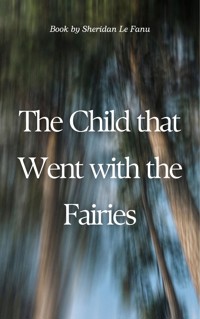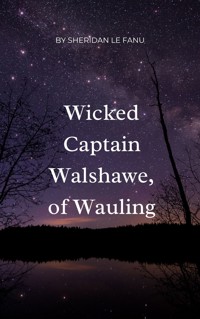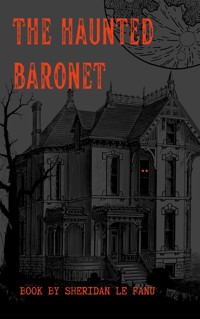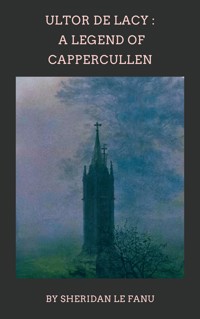12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die hübsche Laura bewohnt mit ihrem Vater und wenigen Bediensteten das prunkvolle, aber abgelegene Schloss in der idyllischen Steiermark. Das Leben ist beschaulich – bis eines Nachts eine wundersame junge Frau ins Leben der Schlossbewohner tritt. Niemand weiß, wer die schöne Carmilla ist; sie selbst muss sich auf Geheiß ihrer Mutter in Schweigen hüllen. Schnell wächst zwischen den jungen Frauen eine tiefe Freundschaft, deren wahre Natur jedoch vorerst im Verborgenen bleibt. Erst als Laura von einer mysteriösen Mattigkeit heimgesucht und von Tag zu Tag schwächer wird, sucht ihr Vater verzweifelt nach den Gründen – und kommt ungewollt der dunklen Vergangenheit Carmillas auf die Spur. Ein wahrer Leckerbissen: voll Spannung, böser Träume und süßer Hingabe – und echter Vampire!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sheridan Le Fanu
Carmilla, die Vampirin
Aus dem irischen Englisch von Helmut Degner
Diogenes
Ein unheimliches Vorzeichen
Unsere Familie besitzt, obgleich sie keineswegs zu den Reichen zählt, ein Schloss in der Steiermark. In jenem Teil der Welt kann man mit einem Einkommen, das die wohlhabenden Leute in England als überaus kärglich betrachten würden, auf sehr großem Fuß leben. Mein Vater ist Engländer, und ich trage, obwohl ich England nie gesehen habe, einen englischen Namen. Hier, an diesem einsamen, abgelegenen Ort könnte man mit noch so viel Geld kein komfortableres oder gar luxuriöseres Leben führen als wir.
Mein Vater, der im österreichischen Staatsdienst stand, trat mit einer Pension und seinem Erbteil in den Ruhestand und erwarb diesen feudalen Wohnsitz zu einem Spottpreis.
Ein idyllischeres Schloss kann man sich nicht vorstellen. Es steht mitten im Wald auf einer kleinen Anhöhe. Die Straße, sehr alt und schmal, führt an einer Zugbrücke, die zu meiner Zeit nie hochgezogen wurde, und an einem fischreichen Burggraben vorbei, auf dem zwischen weißen Wasserlilien stolze Schwäne schwimmen.
Darüber erhebt sich das Schloss mit seinen vielen Fenstern, seinen Türmen und seiner gotischen Kapelle.
Vor dem Tor weitet sich der Wald zu einer unregelmäßigen, sehr malerischen Lichtung, und zur Rechten führt eine steile gotische Brücke über einen kleinen Fluss, der sich durch den dunklen Wald schlängelt.
Wie ich schon sagte, es ist ein überaus einsamer Ort. Blickt man vom Eingangstor auf die Straße, so dehnt sich der Wald, in dem unser Schloss steht, fünfzehn Meilen nach rechts und zwölf Meilen nach links. Das nächste bewohnte Dorf befindet sich etwa sieben Meilen zur Linken, das nächste bewohnte Schloss, das des alten General Spielsdorf, fast zwanzig Meilen zur Rechten.
Ich sagte »das nächste bewohnte Dorf«, weil nur drei Meilen westwärts, also in der gleichen Richtung wie General Spielsdorfs Schloss, ein verlassenes Dorf mit einer alten kleinen, heute dachlosen Kirche liegt, in deren Seitenschiff sich die Grabstätten der stolzen, heute ausgestorbenen Familie Karnstein befinden, der einst das inzwischen verfallene Schloss gehörte, das oberhalb der öden Ruinen des Dorfes aus dem Wald aufragt.
Ich muss jetzt von den wenigen Bewohnern unseres Schlosses berichten. Die Familie bestand aus meinem alten Vater, dem gütigsten Menschen auf Erden, und mir, damals, zu der Zeit, da meine Geschichte spielt, erst neunzehn Jahre alt. Meine Mutter – sie stammte aus der Steiermark – starb, als ich noch ganz klein war, doch ich hatte eine Gouvernante, die mich seit meiner frühesten Kindheit betreute. Ich kann mich keiner Zeit entsinnen, da sich ihr rundes, gütiges Gesicht nicht mit meiner Erinnerung verbindet. Sie hieß Madame Perrodon und war aus Bern gebürtig, und mit ihrer Fürsorge und Gutherzigkeit ersetzte sie mir beinahe meine Mutter, an die ich mich nicht einmal erinnere, so früh habe ich sie verloren. Sie war das dritte Mitglied unserer kleinen Gesellschaft. Es gab noch ein viertes: Mademoiselle de Lafontaine, eine Art Hauslehrerin und Gesellschaftsdame. Sie sprach Französisch und Deutsch, Madame Perrodon Französisch und gebrochen Englisch, und mein Vater und ich bedienten uns, teils um uns seiner nicht zu entwöhnen, teils aus patriotischen Motiven, im täglichen Umgang des Englischen.
Der erste Vorfall in meinem Leben, der einen schrecklichen, bis heute nicht ausgelöschten Eindruck bei mir hinterließ, ereignete sich in meiner frühen Kindheit und bildet eine meiner ersten Erinnerungen. Manch einer wird ihn für gänzlich unbedeutend und nicht erwähnenswert halten. Doch man wird nach und nach erkennen, warum ich davon berichte.
Die Kinderstube war ein großer Raum im obersten Stockwerk des Schlosses mit einer spitzen Decke aus Eichenholz. Ich kann nicht älter als sechs Jahre gewesen sein, als ich eines Nachts erwachte und, mich von meinem Bett aus im Zimmer umblickend, das Kindermädchen nicht sah. Auch meine Amme war nicht da, und ich glaubte mich allein. Ich hatte keine Angst, denn ich war eines jener glücklichen Kinder, dem Geistergeschichten und Märchen zu erzählen man geflissentlich vermied, und so kannte ich jene Furcht nicht, die einen die Decke über den Kopf ziehen lässt, wenn plötzlich die Tür knarrt oder eine flackernde Kerze den tanzenden Schatten eines Bettpfostens auf die Wand wirft. Verärgert und beleidigt, weil man mich, wie ich glaubte, alleingelassen hatte, begann ich zu wimmern und wollte eben herzhaft losbrüllen, als ich zu meiner Überraschung ein ernstes, doch sehr hübsches Gesicht erblickte, das mich vom Bettrand her ansah. Es gehörte einer jungen Dame, die neben dem Bett kniete und ihre Hände unter meine Decke gesteckt hatte. Ich sah sie halb erfreut, halb staunend an und hörte zu wimmern auf. Sie streichelte mich mit ihren Händen, legte sich neben mich aufs Bett und zog mich lächelnd an sich; eine köstliche Müdigkeit befiel mich, und ich schlummerte wieder ein. Ein Gefühl, als ob mir zwei Nadeln tief in die Brust gebohrt würden, weckte mich, und ich schrie laut auf. Die Dame fuhr zurück und starrte mich aus großen Augen an, dann glitt sie auf den Fußboden und versteckte sich, wie es mir schien, unter dem Bett.
Ich bekam es nun doch mit der Angst und brüllte mit aller Kraft. Amme, Kindermädchen, Haushälterin – alle kamen hereingestürzt und bemühten sich, mir die Geschichte, die ich ihnen erzählte, auszureden und mich zu beruhigen. Doch so klein ich war, bemerkte ich doch, dass ihre Gesichter blass und merkwürdig furchtsam waren, und ich sah, wie sie sich im Zimmer umblickten, unter das Bett und unter die Tische schauten und Schränke aufrissen, und die Haushälterin flüsterte der Amme zu: »Legen Sie die Hand auf diese Mulde im Bett; es muss wirklich jemand dort gelegen haben, die Stelle ist noch warm.«
Das Kindermädchen drückte mich an sich, und die drei untersuchten meine Brust, wo ich die Stiche gespürt haben wollte, und versicherten mir, dass nichts zu sehen sei, was darauf schließen ließ, dass etwas Derartiges wirklich geschehen war.
Ich war nach diesem Vorfall lange Zeit sehr nervös. Ein Arzt wurde geholt, ein bleicher, älterer Mann. Wie gut erinnere ich mich an sein langes düsteres, mit Pockennarben bedecktes Gesicht und an seine kastanienbraune Perücke. Eine Weile kam er jeden zweiten Tag und gab mir eine Arznei, die überaus scheußlich schmeckte.
Am Morgen nach dieser Erscheinung war ich völlig verängstigt und wollte keinen Augenblick alleingelassen werden.
Ich weiß noch, wie mein Vater zu mir heraufkam, an mein Bett trat und fröhlich mit mir plauderte, wie er der Amme eine Reihe von Fragen stellte und über eine ihrer Antworten herzlich lachte; wie er mir auf die Schulter klopfte, mich küsste und mir sagte, ich solle keine Angst haben, es sei nur ein Traum gewesen und mir könne nichts geschehen.
Doch ich wollte mich nicht beruhigen, denn ich wusste, der Besuch der fremden Frau war kein Traum gewesen, und ich hatte schreckliche Angst.
Ein wenig ließ ich mich durch die Versicherung des Kindermädchens beschwichtigen, dass sie es gewesen sei, die heraufgekommen sei und nach mir geschaut und sich dann zu mir ins Bett gelegt habe, und dass ich halb geschlafen haben müsse und deshalb wohl ihr Gesicht nicht erkannt hätte. Doch auch dies nahm mir, obwohl die Amme es bestätigte, nicht völlig meine Furcht.
Ich erinnere mich, dass später an jenem Tag ein ehrwürdiger alter Mann in einer schwarzen Soutane mit der Amme und der Haushälterin in mein Zimmer kam und mit ihnen sprach; er war sehr freundlich zu mir, sein Gesicht war gütig und sanft, und er sagte mir, dass sie beten würden, und er legte meine Hände zusammen und sagte, ich solle, während sie beteten, leise sagen: »Herr, erhöre um Jesu willen all unsere guten Gebete.« Ich weiß, genau dies waren seine Worte, denn ich habe sie oft wiederholt, und meine Amme ließ sie mich viele Jahre lang sagen, wenn sie mit mir betete.
Ich sehe noch heute das nachdenkliche, gütige Gesicht des weißhaarigen alten Mannes in der schwarzen Soutane vor mir, das einfache, hohe braune Zimmer mit seinen dreihundert Jahre alten plumpen Möbeln, den schwachen Lichtschein, der durch das kleine Gitterfenster in den düsteren Raum drang. Er kniete nieder, die drei Frauen taten es ihm nach, und dann betete er mit feierlicher, bebender Stimme – endlos lange, wie es mir schien. Mein ganzes Leben vor diesem Ereignis habe ich vergessen und auch die Zeit danach; doch die Szenen, die ich soeben geschildert habe, ragen wie klare, deutliche Bilder aus dem Dunkel hervor.
Ein Gast
Ich will jetzt etwas erzählen, das so seltsam ist, dass man es mir nur glauben wird, wenn man volles Vertrauen in meine Wahrheitsliebe setzt. Doch ich gebe mein Wort darauf: Es ist wirklich so gewesen, ich selbst habe es erlebt.
Es war ein warmer Sommerabend, und mein Vater bat mich, wie er dies öfter tat, mit ihm einen kleinen Spaziergang über die Lichtung vor dem Schloss zu machen.
»General Spielsdorf wird uns leider nicht so bald besuchen können, wie ich hoffte«, sagte mein Vater, während wir dahinschlenderten.
Er hatte am nächsten Tag kommen und einige Wochen bei uns verbringen wollen. Er hatte die Absicht gehabt, eine junge Dame mitzubringen, Mademoiselle Rheinfeldt, seine Nichte, die ich noch nicht kannte. Man hatte mir jedoch erzählt, sie sei ein bezauberndes Mädchen, und ich hatte mich schon sehr auf ihre Gesellschaft gefreut.
»Wann wird er denn kommen?«, fragte ich.
»Nicht vor dem Herbst. Ich fürchte, wohl kaum vor zwei Monaten«, erwiderte mein Vater. »Ich bin jetzt sehr froh, meine Liebe, dass du Mademoiselle Rheinfeldt nie kennengelernt hast.«
»Warum denn?«, fragte ich erstaunt.
»Weil die arme junge Dame gestorben ist«, antwortete er. »Ich vergaß ganz, dass ich es dir noch nicht gesagt habe, doch du warst nicht im Zimmer, als ich heute Abend den Brief des Generals bekam.«
Wir setzten uns unter einer Gruppe herrlicher Linden auf eine roh gezimmerte Bank. Hinter dem waldigen Horizont ging mit melancholischer Pracht die Sonne unter, und in dem leise dahinplätschernden Bach zu unseren Füßen spiegelte sich das verblassende Rot des Himmels. General Spielsdorfs Brief war so merkwürdig, so leidenschaftlich und stellenweise so widersprüchlich, dass ich mir, nachdem ich ihn zweimal studiert – und beim zweiten Mal laut meinem Vater vorgelesen – hatte, noch immer keinen Reim darauf machen konnte, außer dass offenbar der Schmerz seine Sinne verwirrt hatte. Er lautete:
Ich habe meine geliebte Tochter verloren, denn als solche habe ich sie betrachtet. Während der letzten Tage von Berthas Krankheit war ich nicht fähig, Dir zu schreiben. Zuvor hatte ich keine Ahnung von der Gefahr, in der sie schwebte. Nun erst, da ich sie verloren habe, erfahre ich alles – zu spät. Sie starb friedlich im Stande der Unschuld und in der köstlichen Hoffnung auf ein besseres Jenseits. Die Schurkin, die unsere törichte Gastfreundschaft missbrauchte, ist schuld an allem. Ich dachte, Unschuld, Fröhlichkeit, eine amüsante Gefährtin für meine arme Bertha in mein Haus einzulassen. Himmel!, was für ein Narr bin ich gewesen! Ich danke Gott, dass mein Kind starb, ohne die Ursache ihrer Leiden zu ahnen. Sie ist dahingegangen ohne die leiseste Vermutung über die Natur ihrer Krankheit und die fluchwürdige Passion der Urheberin all dieses Leids. Ich werde meine restlichen Tage der Aufspürung und Vernichtung eines Monstrums weihen. Wie man mir sagt, darf ich hoffen, mein gerechtes und wohltätiges Werk zu vollbringen. Gegenwärtig erhellt kaum ein Lichtschimmer meinen Weg, und ich weiß noch nicht, wohin ich mich wenden soll. Ich verfluche meine eitle Ungläubigkeit, meine Blindheit, meinen Eigensinn – doch – ach – zu spät. Ich bringe jetzt nicht die innere Sammlung für einen Brief auf. Ich bin völlig zerrüttet. Sobald ich mich ein wenig erholt habe, werde ich mich einige Zeit meinen Nachforschungen widmen, die mich möglicherweise bis nach Wien führen werden. Irgendwann im Herbst, also in zwei Monaten, oder auch früher, wenn es Gott will, werde ich Dich besuchen – das heißt, wenn es Dir recht ist; dann werde ich Dir all das erzählen, was ich jetzt nicht zu Papier zu bringen wage. Leb wohl. Bete für mich, lieber Freund.
Die Sonne war indessen untergegangen, und es war schon halb dunkel, als ich meinem Vater den Brief des Generals zurückgab.
Der Abend war mild und klar, und wir gingen langsam zurück und diskutierten dabei über den Sinn der wirren, erregten Sätze, die ich soeben gelesen hatte. Bis zu der Straße, die am Schloss vorbeiführt, war es fast eine Meile, und als wir sie erreichten, strahlte schon der Mond am Himmel. An der Zugbrücke trafen wir Madame Perrodon und Mademoiselle de Lafontaine, die herausgekommen waren, die herrliche Mondnacht zu genießen.
Schon von Weitem hörten wir ihr angeregtes Geplauder. Wir traten zu ihnen an die Zugbrücke und wandten uns um, mit ihnen die schöne Aussicht zu bewundern.
Die Lichtung, über die wir soeben geschritten waren, lag vor uns. Zur Linken wand sich die schmale Straße zwischen dichten, hohen Bäumen hindurch und verschwand im dunklen Wald. Zur Rechten kreuzte die nämliche Straße die steile, malerische Brücke, neben der ein verfallener Turm stand, der einst zur Bewachung dieses Überganges diente; und jenseits der Brücke ragte jäh eine Anhöhe auf, bestanden mit Bäumen, in deren Schatten einige graue, efeuüberwucherte Felsen schimmerten.
Die Fantasie könnte kein sanfteres, lieblicheres Bild ersinnen. Die Neuigkeiten, die ich just erfahren hatte, ließen es melancholisch erscheinen; doch nichts trübte die tiefe Friedlichkeit, den düsteren Zauber dieses Anblicks.
Mein Vater und ich genossen ihn schweigend, während die beiden guten Gouvernanten, welche ein Stück hinter uns standen, ihrer Begeisterung über die nächtliche, in Mondlicht getauchte Landschaft laut Ausdruck verliehen.