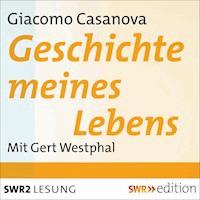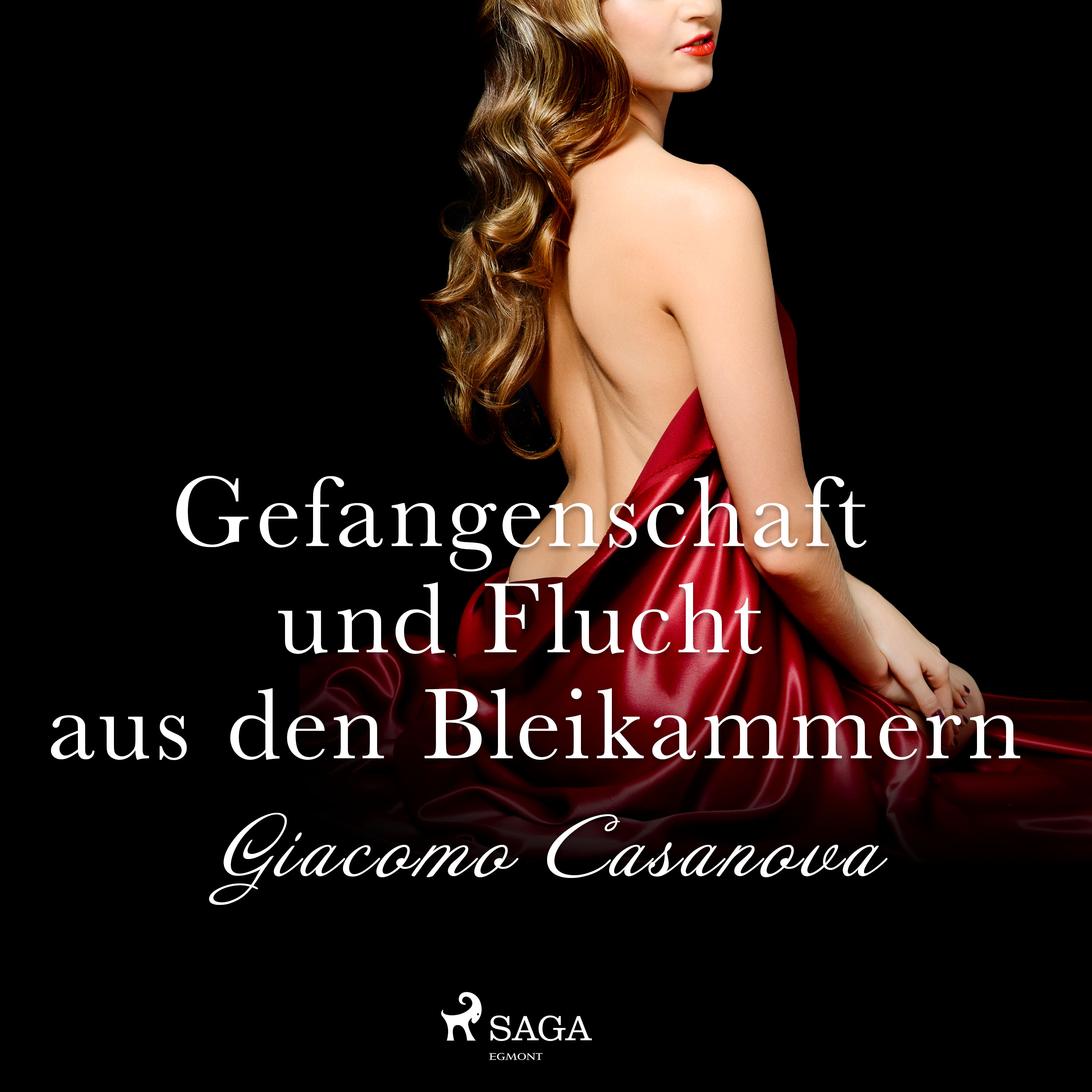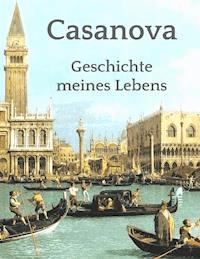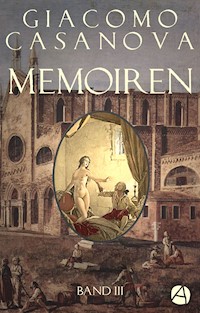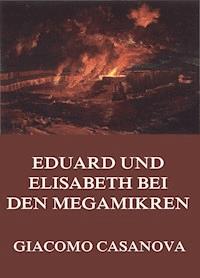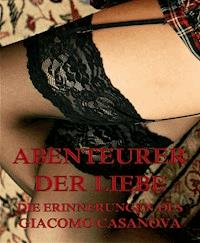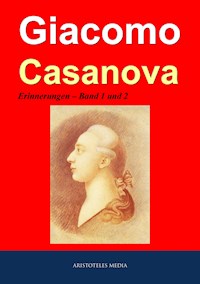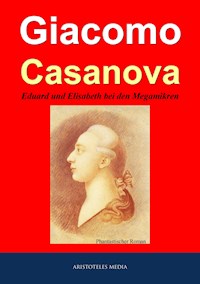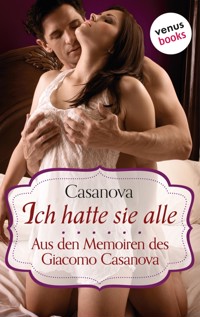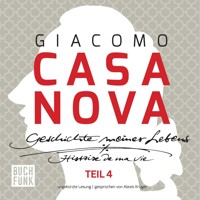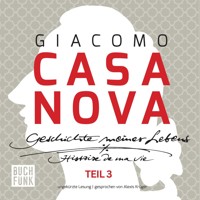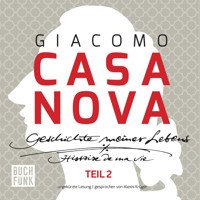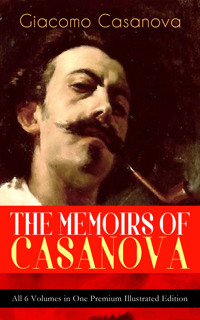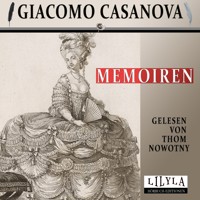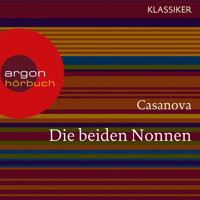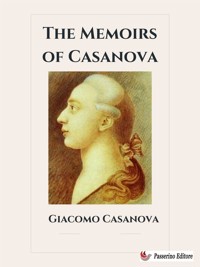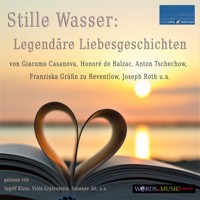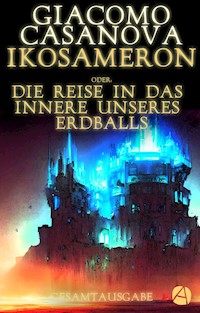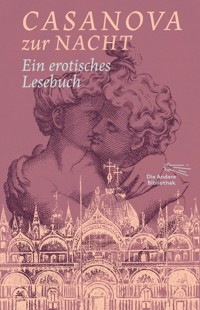
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
»Leidenschaftlich, gefährlich, verlumpt, rücksichtslos, amüsant, gemein, unanständig, frech, ludrig, immer aber spannungsvoll und unvermutet« – Stefan Zweig.
Sein Name ist ein Synonym für die Kunst der Verführung und der Liebe: Giacomo Casanovas Leben war spektakulärer als die meisten Fiktionen. Unbefangen erzählt er in diesem Band von Bekanntschaften, die von Schauspielerinnen, Adligen bis hin zu Nonnen reichen. Gewandt bewegt er sich durch das Europa des 18. Jahrhunderts, von den schillernden Seiten bis in die Abgründe, zwischen gesellschaftlichen Konventionen und heimlichen Grenzüberschreitungen.
Aus 33 sinnlichen Abenteuern, erstmals verdichtet auf Grundlage der 12-bändigen Autobiographie »Geschichte meines Lebens«, ergibt sich eine faszinierende Charakterstudie eines impulsiven Mannes, für den Freiheit und Lust an erster Stelle stehen.
Eines der authentischsten und provokativsten Werke des 18. Jahrhunderts – mit einem Essay von Stefan Zweig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Leidenschaftlich, gefährlich, verlumpt, rücksichtslos, amüsant, gemein, unanständig, frech, ludrig, immer aber spannungsvoll und unvermutet« – Stefan Zweig
Sein Name ist ein Synonym für die Kunst der Verführung und der Liebe: Giacomo Casanovas Leben war spektakulärer als die meisten Fiktionen. Unbefangen erzählt er in diesem Band von Bekanntschaften, die von Schauspielerinnen, Adligen bis hin zu Nonnen reichen. Gewandt bewegt er sich durch das Europa des 18. Jahrhunderts, von den schillernden Seiten bis in die Abgründe, zwischen gesellschaftlichen Konventionen und heimlichen Grenzüberschreitungen.
Aus 33 sinnlichen Abenteuern, erstmals verdichtet auf Grundlage der 12-bändigen Autobiographie »Geschichte meines Lebens«, ergibt sich eine faszinierende Charakterstudie eines impulsiven Mannes, für den Freiheit und Lust an erster Stelle stehen.
Mit Stefan Zweigs großem Casanova-Essay.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Giacomo Casanova
Casanova zur Nacht
Ein erotisches Lesebuch
Aus dem Französischen von Heinrich Conrad
Herausgegeben von Barbara Albrecht
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Stefan Zweig: Casanova
Casanova
Bildnis des jungen Casanova
Die Abenteurer
Bildung und Begabung
Philosophie der Oberflächlichkeit
Homo eroticus
Die Jahre im Dunkel
Genie der Selbstdarstellung
Giacomo Casanova: 33 Nächte
Die Pächtersfrau
Keine Rose ohne Dornen
Das Rosenbett
Lucrezia & Angelica
Bellino
Bei Ismail im Harem
Opfergaben
Henriettes Abschiedsbrief
Mimi, die Tochter der Wirtin
Die schöne O-Morphi
Liebschaft mit C. C.
Liebesspiele mit der Nonne M. M.
M. M.s großzügiger Liebhaber
Scharmützel mit M. M. und C. C.
Der Aroph
Die Frau des Bürgermeisters
Madame de … und der verhängnisvolle Irrtum
Verrücktheiten zu dritt
Die Schwestern Veronika und Annina
Wie aus der Braut die Tochter wird
Die schöne Lia aus Turin
Komödiantenorgie
Die Spitzbübin Corticelli
Die schöne Theologin Hedwig und Helenes Einweihung in die Mysterien der Liebe
Nächtlicher Besuch
Die Schlange Charpillon
Abenteuer mit Zaira
Die liebestolle Nina
Die Engländerin Betty
Die Zofe Anastasia
Koketterie
Margherita
Die zärtlichen Nonnen
Impressum
Stefan Zweig: Casanova
Casanova
Il me dit qu’il est un homme libre, citoyen du monde.
Muralt über Casanova in einem Brief an Albrecht von Haller, 21. Juni 1760
Casanova figuriert als Sonderfall, als einmaliger Glücksfall innerhalb der Weltliteratur, vor allem deshalb, weil dieser famose Scharlatan eigentlich genauso unberechtigt in das Pantheon des schöpferischen Geistes geraten ist wie Pontius ins Credo. Denn mit seinem dichterischen Adel steht’s nicht minder windig als mit jenem frech aus dem Alphabet zusammengeklitterten Chevalierstitel de Seingalt: seine paar Verse, hastig zwischen Bett und Spieltisch zu Ehren eines Dämchens hinimprovisiert, muffeln nach Moschus und akademischem Leim, und wenn unser guter Giacomo gar zu philosophieren anfängt, tut man gut, sich die Kinnbacken gegen Gähnkrampf zu sperren. Nein, er gehört so wenig zum dichterischen Adel, Casanova, wie in den Gotha, auch hier Parasit, Eindringling ohne Rechte und Rang. Aber ebenso verwegen, wie er’s zeitlebens zuwege bringt, als schäbiger Schauspielersohn, fortgejagter Priester, abgetakelter Soldat, anrüchiger Kartendreher, bei Kaisern und Königen zu verkehren und schließlich in den Armen des letzten Edelmannes, des Prinzen de Ligne, zu sterben, hat sein nachschweifender Schatten sich unter die Unsterblichen eingedrängt, obzwar kleiner Schöngeist scheinbar nur, unus ex multis, Asche im Streuwind der Zeit. Aber – kurioses Faktum! – nicht er, sondern alle seine berühmten Landsleute und sublimen Poeten Arkadiens, der »göttliche« Metastasio, der edle Parini e tutti quanti sind Bibliotheksschutt und Philologenfutter geworden, indes sein Name, in ein respektvolles Lächeln gerundet, noch heute von allen Lippen schwebt. Und aller irdischen Wahrscheinlichkeit nach wird seine erotische Ilias noch Dauer und entzündete Leser finden, wenn längst »La Gerusalemme liberata« und der »Pastor fido« als würdige historische Antiquitäten ungelesen in den Bücherschränken stauben. Mit einem Coup hat der gerissene Glücksspieler alle Dichter Italiens seit Dante und Boccaccio überspielt.
Und noch toller: Für so unendlichen Gewinst wagt Casanova gar keinen Einsatz, er hat schlankweg die Unsterblichkeit um ihren Preis geprellt. Nie erahnt dieser Spielmensch die unsagbare Verantwortung des wirklichen Künstlers. Er weiß nichts von Nächten, die durchwacht, von Tagen, die hingebracht werden müssen im dumpfen, sklavischen Feilwerk der Worte, bis endlich der Sinn rein und regenbogenhaft die Linse der Sprache durchstrahlt, nichts von der vielfältigen und doch unsichtbaren, von der unbelohnten, oft erst nach Menschenaltern erkenntlichen Werkarbeit des Dichters, nichts auch von seinem heroischen Verzicht auf Wärme und Weite des Daseins. Er, Casanova, hat, weiß Gott, das Leben sich immer nur leicht gemacht, kein Gran seiner Freude, kein Quäntchen seiner Genießerei, keine Stunde seines Schlafes, keine Minute seiner Lust der strengen Göttin Unsterblichkeit geopfert: Er rührt sein Lebtag keinen Finger arbeitend um den Ruhm, und doch fällt er ihm, dem Glücklichen, strömend in die Hände. Solange er noch einen Goldfuchs in der Tasche, einen Tropfen Öl in seiner Liebeslampe spürt, denkt er nicht daran, sich die Finger ernstlich mit Tinte zu beschmutzen. Erst hinausgeworfen aus allen Türen, ausgelacht von den Frauen, einsam, bettelhaft, impotent, erst dann flüchtet er, ein verschabter mürrischer Greis, in die Arbeit als Surrogat des Erlebens; und nur aus Nichtlust, aus Langeweile, aufgekratzt von Ärger wie ein zahnloser Köter von der Räude, macht er sich knurrend und murrend daran, dem abgestorbenen siebzigjährigen Casaneus-Casanova sein eigenes Leben zu erzählen.
Er erzählt sich sein Leben – dies seine ganze literarische Leistung –, aber freilich, welch ein Leben! Fünf Romane, zwanzig Komödien, ein Schock Novellen und Episoden, eine traubige, überreife Fülle charmantester Situationen und Anekdoten, eingekeltert in eine einzige strömende und überströmende Existenz: Hier erscheint eben ein Leben, selbst schon füllig und rund als vollendetes Kunstwerk ohne ordnende Beihilfe des Künstlers und Erfinders. Und so löst sich auf überzeugendste Weise jenes erst verwirrende Geheimnis seines Ruhmes – denn nicht, wie er sein Leben beschreibt und berichtet, zeigt Casanova als Genie, sondern wie er es gelebt. Was ein anderer erfinden muss, hat er atmend erfahren, was ein anderer mit dem Geist, hat er mit seinem warmen wollüstigen Leib gestaltet, darum brauchen hier Feder und Phantasie die Wirklichkeit nachträglich nicht zeichnerisch auszuschmücken: genug, dass sie Pausblatt sind einer schon dramatisch durchgeformten Existenz. Kein Dichter seiner Zeit hat dermaßen viel erfunden an Variationen und Situationen, wie Casanova erlebte, und schon gar kein wirklicher Lebenslauf schwingt in so kühnen Kurven durch ein ganzes Jahrhundert hin. Versucht man, an reinem Geschehnisgehalt (nicht an geistiger Substanz und Erkenntnistiefe) etwa die Biographien Goethes, Jean-Jacques Rousseaus und anderer Zeitgenossen mit der seinen zu vergleichen, wie arm an Abwechslung, wie eng im Raum, wie provinziell in der geselligen Sphäre erscheinen jene zielhaften und von schöpferischem Willen beherrschten Lebensläufe gegen diesen einen stromhaften und elementaren des Abenteurers, der Länder, Städte und Stände, Berufe, Welten und Weiber wechselt wie Wäsche an immer gleichem Leib – Dilettanten sie alle im Genießen wie jener Dilettant in der Gestaltung. Denn dies ist ja die ewige Tragik des Geistmenschen, dass gerade er, berufen und sehnsüchtig, alle Weite und Wollust des Daseins zu kennen, doch gebunden bleibt an seine Aufgabe, Sklave seiner Werkstatt, unfrei durch selbst auferlegte Pflichten, gefesselt an Ordnung und Erde. Jeder wahrhafte Künstler lebt die größere Hälfte seines Daseins in Einsamkeit und Zwiekampf mit seiner Schöpfung – voll hingegeben an die unmittelbare Wirklichkeit, frei und verschwenderisch vermag nur der Unschöpferische, der reine Genießer zu sein, der das Leben lebt um des Lebens willen. Wer sich Ziele setzt, geht am Zufall vorbei: Jeder Künstler gestaltet zumeist immer nur, was er versäumte zu erleben.
Den lockern Genießern aber, ihren Gegenspielern, ihnen mangelt fast immer die Macht, das vielfältig Erlebte auszuformen. Sie verlieren sich an den Augenblick, und damit geht dieser Augenblick allen andern verloren, indes der Künstler auch das geringste Erleben zu verewigen weiß. So klaffen die Enden auseinander, statt sich fruchtbar zu ergänzen: Dem einen fehlt der Wein, dem andern der Becher. Unlösbare Paradoxie: Die Tatmenschen und Genießer hätten mehr Erlebnis zu melden als alle Dichter, aber sie vermögen es nicht – die Schöpferischen wiederum müssen dichten, weil sie selten genug Geschehnis erlebten, um es zu berichten. Nur selten haben Dichter eine Biographie und selten wiederum die Menschen der wahrhaften Biographien die Fähigkeit, sie zu schreiben.
Da ereignet sich nun jener herrliche und beinahe einzige Glücksfall Casanova: Endlich erzählt einmal ein passionierter Genussmensch, der typische Augenblicksvielfraß, sein ungeheures Leben, erzählt es ohne moralische Beschönigung, ohne poetisierende Versüßlichung, ohne philosophische Verbrämung, sondern ganz sachlich, ganz wie es war, leidenschaftlich, gefährlich, verlumpt, rücksichtslos, amüsant, gemein, unanständig, frech, ludrig, immer aber spannungsvoll und unvermutet – und erzählt überdies nicht aus literarischem Ehrgeiz oder dogmatischer Prahlerei oder bußfertiger Reue oder exhibitionistisch gereizter Bekenntniswut, sondern ganz unbelastet und unbekümmert, wie ein Veteran am Wirtshaustisch mit der Pfeife im Mund ein paar knusperige und vielleicht brenzlige Abenteuer vorurteilslosen Zuhörern zum Besten gibt. Hier dichtet nicht ein mühseliger Phantast und Erfinder, sondern aller Dichter Meister, das Leben selbst, er aber, Casanova, hat nur der bescheidensten Anforderung des Künstlers zu genügen: das kaum Glaubwürdige glaubhaft zu machen. Dazu langt vollkommen trotz einem barocken Französisch seine Kunst und seine Kraft. Aber nicht im Traum hat dieser zittrige, von der Gicht verwackelte Murrgreis in seiner Sinekure zu Dux daran gedacht, dass über diese Erinnerungen einstmals graubärtige Philologen und Historiker forschend sich beugen würden als den kostbarsten Palimpsest des achtzehnten Jahrhunderts, und so selbstgefällig er sich zu spiegeln liebte, der gute Giacomo, dies hätte er doch als groben Spaß seines verruchten Widersachers, des Herrn Haushofmeisters Feltkirchner, vermerkt, dass sich eine eigene Société Casanovienne hundertzwanzig Jahre nach seinem Tod etablieren werde, nur um jedes Zettelchen seiner Hand, jedes Datum zu überprüfen und den sorgfältig ausradierten Namen der so angenehm kompromittierten Damen auf die Spur zu kommen. Nehmen wir’s als Glück, dass dieser Eitle seinen Ruhm nicht ahnte und darum mit Ethos, Pathos und Psychologie haushälterisch blieb, denn nur das Absichtslose erreicht jene unbesorgte und darum elementare Aufrichtigkeit. Ganz lässig wie immer ist der alte Glücksspieler in Dux an seinen Schreibtisch als den letzten Hasardtisch seines Lebens getreten und hat als letzten Coup seine Memoiren dem Schicksal hingeschmissen: Dann stand er auf, vorzeitig weggeholt, ehe er die Wirkung sah. Und wunderbar, gerade dieser letzte Wurf ging bis in die Unsterblichkeit. Ja, er hat sein Spiel vortrefflich gewonnen, der alte »commediante in fortuna«, dieser unübertreffliche Schauspieler seines Glücks, und dagegen nützt nun kein Pathos mehr und kein Protest. Man kann ihn verachten, unsern verehrten Freund, wegen mangelnder Moral und geringen sittlichen Ernstes, man kann ihn widerlegen als Historiker und desavouieren als Künstler. Nur eines kann man nicht mehr: ihn wieder totmachen, denn trotz allen Dichtern und Denkern hat die Welt seitdem keinen romantischeren Roman als sein Leben erfunden und keine phantastischere Gestaltung als seine Gestalt.
Bildnis des jungen Casanova
Wissen Sie, Sie sind ein sehr schöner Mann.
Friedrich der Große, 1764 im Park von Sanssouci, plötzlich innehaltend und ihn betrachtend, zu Casanova
Theater in einer kleinen Residenzstadt: Die Sängerin hat eben mit kühner Koloratur ihre Arie geendet, wie knatternder Hagel ist Beifall niedergeprasselt, jetzt aber, während der mählich einsetzenden Rezitative, lockert sich allgemein die Aufmerksamkeit. Die Stutzer machen Besuche in den Logen, die Damen lorgnettieren, essen mit silbernen Löffeln die sublimen Gelati und den orangefarbenen Sorbett: Beinahe unnötig, dass auf der Bühne indes Harlekin seine Lazzi mit einer pirouettierenden Kolumbine wirbelt. Da, mit einem Mal wenden sich alle Blicke neugierig einem Fremden zu, der kühn und lässig zugleich mit der rechten Desinvoltura eines vornehmen Mannes verspätet das Parkett betritt, jedem unbekannt. Reichtum umrauscht die herkulische Gestalt, ein aschfarben geschorenes Samtkleid schlägt sich faltig auf über zierlich durchstickter Brokatweste, und kostbare Spitzen, goldene Litzen zeichnen von den Halsspangen des Brüsseler Jabots hinab bis zu den seidenen Strümpfen die dunkleren Linien des Prunkgewandes mit. Die Hand trägt wie achtlos einen weißfedrigen Paradehut, ein dünner, süßer Duft von Rosenöl oder neumodischer Pomade weht dem vornehmen Fremden nach, der jetzt an die Brüstung der ersten Reihe sich nachlässig hinrekelt, die ringgespickte Hand hochmütig auf den juwelenbeschlagenen Degen aus englischem Stahl gestützt. Als spüre er nicht das allgemeine Bemerktwerden, hebt er sein goldenes Lorgnon, um mit gespielter Gleichgültigkeit die Logen zu mustern. Von allen Sitzen und Bänken zischelt’s schon: ein Fürst, ein reicher Ausländer? Köpfe drängen zusammen, ehrfurchtsvolles Flüstern deutet auf den diamantumringten Orden, der quer über die Brust an karmesinrotem Bande schwingt (und den er derart mit glitzernden Steinen überwuchert hat, dass niemand mehr das erbärmliche päpstliche Sporenkreuz erkennt, billiger als Brombeeren). Die Sänger auf der Bühne spüren sofort das Nachlassen der Aufmerksamkeit, lockerer fließen die Rezitative, denn über Violine und Gamba hinweg spähen die vorgehuschten Tänzerinnen aus der Kulisse, ob da nicht ein Dukatenherzog herwehe für ergiebige Nacht.
Aber ehe Hunderte im Saale die Scharade dieses Fremden, das Rätsel seiner Herkunft, zu lösen vermögen, haben die Frauen in den Logen schon ein anderes bemerkt, mit Bestürzung fast: wie schön dieser fremde Mann ist, wie schön und wie sehr Mann. Mächtig von Wuchs, breit gequadert die Schultern, griffig die durchmuskelten fleischigen Hände, keine weichliche Linie in dem angespannten, stählern-männischen Leib, steht er da, den Nacken ein wenig gesenkt, wie ein Stier vor dem Ansturm. Von der Seite gesehen, dünkt dies Antlitz eine römische Münze, so messerscharf und metallen ist jede einzelne Linie von dem Kupfer dieses dunklen Hauptes abgeschrägt. Mit schönem Schwung wirft eine Stirne, um die jeder Dichter diesen Fremden beneiden dürfte, sich aus kastanienfarbenem, zärtlich gelocktem Haar – ein frecher, kühner Haken springt die Nase vor, starkknochig das Kinn und unter dem Kinn wieder ein doppelnussgroßer wölbiger Adamsapfel (nach dem Weiberglauben die sicherste Bürgschaft tatkräftiger Männlichkeit): Unverkennbar, jeder Zug in diesem Gesicht meint Vorstoß, Eroberung, Entschlossenheit. Einzig die Lippe, sehr rot und sinnlich, wölbt sich weich und feucht und zeigt wie Granatapfelfleisch die weißen Kerne der Zähne. Langsam wendet der schöne Mann jetzt das Profil den dunklen Schaukasten des Theaters entlang: Unter den ebenmäßigen, sehr rund geschwungenen, buschigen Brauen flackert aus schwarzen Pupillen ein ungeduldiger Unruheblick, recht ein Jäger- und Beuteblick, bereit, mit einem Ruck adlerhaft auf ein Opfer zu stürzen. Aber noch flackert er nur, noch brennt er nicht ganz, bloß als tastendes Blinkfeuer streift er die Logen entlang und mustert an den Männern vorbei wie etwas Käufliches das Warme, Nackte, Weiße in den schattigen Nestern: die Frauen. Er betrachtet sie eine nach der andern, wählerisch, kennerisch, und fühlt sich betrachtet; dabei lockert sich ein wenig die sinnliche Lippe auf, ein beginnender Hauch von Lächeln um den satten, südländischen Mund lässt zum ersten Mal das breite, schneeweiße Tiergebiss blank vorleuchten. Noch gilt dies Lächeln keiner einzigen Frau, noch gilt es ihnen allen, dem Wesen Weib, das da nackt und heiß unter den Kleidern sich birgt. Aber jetzt hat er in der Loge eine Bekannte erspäht: Sofort sammelt sich der Blick, sofort überfließt ein samtiger und gleichzeitig glitzernder Glanz das eben noch frech fragende Auge, die linke Hand lässt den Degen, die rechte fasst nach dem schweren Federhut, und so tritt er heran, ein angedeutetes Wort des Erkennens auf den Lippen. Graziös beugt er den Muskelnacken zum Kuss über die dargebotene Hand und spricht sie höflichst an; aber man merkt am Zurückweichen und Verwirrtsein der Umschmeichelten, wie zärtlich schmelzend das Arioso der Stimme in sie eindringt, denn sie biegt sich verlegen zurück und stellt den Fremden ihren Begleitern vor: »Le chevalier de Seingalt.« – Verbeugungen, Zeremonien, Höflichkeiten, man bietet dem Gast einen Platz in der Loge, den er bescheiden zurückweist, und aus dem courtoisen Hin und Her faltet sich endlich Gespräch. Allmählich erhebt Casanova die Stimme, über die andern hinweg. Nach Schauspielerart lässt er die Vokale weich sich aussingen, die Konsonanten rhythmisch rollen, und immer sichtlicher spricht er über die Loge hinweg, laut und ostentativ; denn er will, dass die herangebeugten Nachbarn hören, wie geistvoll und gewandt er französisch, italienisch konversiert, wie geschickt er seinen Horaz zitiert. Scheinbar zufälligerweise hat er die Ringhand solcherart auf die Logenbrüstung gelegt, dass man von weit her die kostbaren Spitzenmanschetten und vor allem den riesigen Solitär an seinem Finger funkeln sehen kann – jetzt bietet er aus diamantenbesetzter Dose den Kavalieren mexikanischen Schnupftabak an. »Mein Freund, der spanische Gesandte, hat ihn mir gestern durch den Kurier geschickt« (– man hört es bis in die Nachbarloge –); und da einer der Herren höflich das Miniaturbild auf der Dose bewundert, äußert er nachlässig, aber doch laut genug, damit sich’s im Saal verbreite: »Ein Präsent von meinem Freund und gnädigen Herrn, dem Kurfürsten von Köln.« Ganz absichtslos scheint er so zu plaudern, aber inmitten dieses Paradierens wirft der Bramarbas immer wieder einen raschen Raubvogelblick nach rechts und links, um die eigene Wirkung zu erspähen. Ja, alles beschäftigt sich mit ihm, er fühlt die Frauenneugier an sich hängen, spürt, dass er bemerkt ist, bewundert, geehrt, und das macht ihn noch kühner. Mit einer geschickten Wendung dreht er das Gespräch bis hinüber in die Nachbarloge, wo die Favoritin des Fürsten sitzt und – er fühlt es – wohlgefällig seinem echt Pariser Französisch lauscht; und mit devoter Geste streut er, von einer schönen Frau erzählend, eine galante Artigkeit vor sie hin, die sie lächelnd quittiert. Und nun bleibt seinen Freunden nichts übrig, als den Chevalier der hohen Dame vorzustellen. Schon ist das Spiel gewonnen. Morgen Mittag wird er mit den Vornehmsten der Stadt speisen, morgen Abend wird er in irgendeinem der Paläste den Vorschlag zu einem kleinen Pharaospiel machen und seine Gastgeber plündern, morgen nachts wird er mit einer dieser funkelnden, unter ihren Kleidern nackten Frauen schlafen – und alles dies kraft seines kühnen, sicheren und energischen Auftretens, seines Siegerwillens und der männlich freien Schönheit seines braunen Gesichts, dem er alles dankt: das Lächeln der Frauen und den Solitär am Finger, die diamantene Uhrkette und die goldenen Litzen, den Kredit bei den Bankherren und die Freundschaft des Adels und, herrlicher als dies: Freiheit in der unendlichen Vielfalt des Lebens.
Unterdessen hat sich die Primadonna bereit gemacht, die neue Arie zu beginnen. Nach einer tiefen Verbeugung, schon dringlich eingeladen von den durch seine weltmännische Konversation bezauberten Kavalieren, bereits zum Lever der Favoritin gnädigst bestellt, tritt Casanova wieder an seinen Platz zurück und lässt sich nieder, die Linke auf den Degen gestützt, das schöne braune Haupt vorgeneigt, um kennerisch dem Gesang zu lauschen. Hinter ihm zischelt von Loge zu Loge die gleiche indiskrete Frage und als Antwort zurück von Mund zu Mund: »Der Chevalier von Seingalt.« Mehr weiß niemand von ihm, nicht, woher er gekommen, nicht, was er treibt, nicht, wohin er geht, nur der Name summt und surrt den ganzen dunklen und neugierigen Saal und tanzt – unsichtbar, flirrende Lippenflamme – bis hinauf zur Bühne, zu den gleichfalls neugierigen Sängerinnen. Aber plötzlich lacht eine kleine venezianische Tänzerin auf. »Chevalier de Seingalt? Oh, dieser Schwindler! Das ist ja Casanova, der Sohn der Buranella, der kleine Abbate, der meiner Schwester vor fünf Jahren die Jungfernschaft abgeschwatzt hat, der Hofnarr des alten Bragadin, Aufschneider, Lump und Abenteurer.« Jedoch das muntere Mädchen scheint ihm seine Untaten nicht sonderlich übel zu nehmen, denn aus den Kulissen zwinkert sie ihm erkennerisch zu und führt die Fingerspitzen kokett an die Lippe. Er merkt’s und entsinnt sich: Nur unbesorgt, sie wird ihm sein Spielchen mit den vornehmen Narren nicht stören und lieber heute nachts mit ihm schlafen.
Die Abenteurer
Weiß sie, dass dein einziges Vermögen die Dummheit der Menschen ist?
Casanova zum Falschspieler Croce
Vom Siebenjährigen Krieg bis zur Französischen Revolution, ein knappes Vierteljahrhundert dunstet Windstille über Europa, die großen Dynastien Habsburg, Bourbon und Hohenzollern haben sich müde gekriegt. Die Bürger blasen Tabak behaglich in stillen Kringeln vor sich hin, die Soldaten pudern ihre Zöpfe und putzen die nutzlos gewordenen Gewehre, die geplagten Länder können endlich ein wenig verschnaufen. Aber die Fürsten langweilen sich ohne Krieg. Sie langweilen sich mörderisch, alle die deutschen und italienischen und sonstigen Duodezfürsten in ihren liliputanischen Residenzen, und möchten gern amüsiert sein. Grässlich ennuyant haben es diese Armen, diese kleingroßen, scheingroßen Kurfürsten und Herzöge auf ihren noch kaltnassen, frisch aufgebauten Rokokoschlössern trotz allen Lustgärten, Fontänen und Orangerien, trotz Zwingern, Galerien, Wildparks und Schatzkammern. Aus Langeweile werden sie sogar Kunstgönner und Schöngeister, korrespondieren mit Voltaire und Diderot, sammeln chinesisches Porzellan, mittelalterliche Münzen, barocke Bilder, bestellen sich französische Komödien, italienische Sänger und Tänzer, und nur der Herr in Weimar hat mit gutem Griff sich ein paar Deutsche namens Schiller, Goethe und Herder an seinen Hof geladen. Sonst aber wechseln nur Sauhatzen und Wasserpantomimen mit theatralischem Divertissement, denn immer, wenn die Welt müde wird, erzwingt sich die Spielwelt, das Theater, Mode und Tanz besondere Wichtigkeit, und so überbieten sich damals die Fürsten mit Geld und diplomatischen Aktionen, um einer dem andern die interessantesten Amüseure, die besten Tänzer, Musiker, Kastraten, Philosophen, Goldsucher, Kapaunenmäster und Orgelspieler abzujagen. Gluck und Händel, Metastasio und Hasse, das wird sich ebenso wechselseitig abgeluchst wie Kabbalisten und Kokotten, Feuerwerker und Sauhetzer, Textschreiber und Ballettmeister. Und nun haben sie glücklich Zeremonienmeister und Zeremonien, Steintheater und Opernsäle, Bühnen und Ballette, nun fehlt nur noch Eines, um der Langeweile der Kleinstadt Schach zu bieten und der rettungslosen Monotonie der ewig gleichen sechzig Adelsgesichter den Anschein von wirklicher Gesellschaft zu geben: vornehme Visiten, interessante Gäste, ein paar Rosinen für den Sauerteig der kleinstädtischen Langeweile, ein wenig Wind von großer Welt in die Stickluft der Dreißigstraßenresidenz.
Dies hören von einem Hof, und – rutsch! – schon sausen sie her, die Abenteurer in Hunderten von Masken und Verkleidungen, niemand weiß, aus welchem Windwinkel und Versteck. Aber über Nacht sind sie da, mit einem Reisewagen und englischen Kutschen kommen sie vorgefahren und mieten mit lockerer Hand gleich die nobelste Zimmerfront der vornehmsten Herberge. Sie tragen phantastische Uniformen irgendeiner hindustanischen oder mongolischen Armee und führen pompöse Namen, die in Wirklichkeit pierre de strass sind, falsche Edelsteine wie ihre Schuhschnallen. Sie sprechen alle Sprachen, behaupten, alle Fürsten und großen Leute zu kennen, sie haben angeblich in allen Armeen gedient und an allen Universitäten studiert. Ihre Taschen stecken voller Projekte, ihr Mundwerk klappert von kühnen Versprechen, sie planen Lotterien und Extrasteuern, Staatsbündnisse und Fabriken, sie offerieren Weiber und Orden und Kastraten; und obwohl sie selbst keine zehn Goldstücke in der Tasche haben, flüstern sie jedem zu, sie wüssten das Geheimnis der Tinctura auri. Die Abergläubischen fangen sie mit Horoskopen, die Leichtgläubigen mit Projekten, die Spieler mit falschen Karten und die Ahnungslosen mit mondäner Vornehmheit –, all dies aber in den faltenrauschenden, undurchsichtigen Nimbus von Fremdartigkeit und Geheimnis gehüllt, unerkennbar und dadurch doppelt interessant. Wie Irrlichter, plötzlich aufglänzend und ins Gefährliche führend, flackern und zucken sie in der trägen, brackigen Sumpfluft der Höfe hin und her, kommend und verschwindend im gespenstigen Lügentanz.
Man empfängt sie bei den Höfen, amüsiert sich über sie, ohne sie zu achten, fragt so wenig nach ihrer Adelsechtheit wie ihre Frauen nach dem Ehering und die mitgebrachten Mädchen nach ihrer Jungfernschaft. Denn wer Pläsier gibt, auch eine Stunde nur die Langeweile, diese grässlichste aller Fürstenkrankheiten, lindert, ist dieser amoralischen, von materialistischer Philosophie aufgelockerten Atmosphäre ohne viel Fragen willkommen. Wie die Dirnen duldet man sie gern, solange sie amüsieren und nicht gar zu frech räubern. Manchmal kriegt das Künstler- und Gaunerpack (etwa wie Mozart) einen erlauchten Fußtritt in den Hintern, manchmal rutschen sie aus dem Ballsaal ins Gefängnis und sogar, wie der kaiserliche Theaterdirektor Afflisio, bis hinab in die Galeeren. Die Gerissensten zecken sich fest, werden Steuereinnehmer, Kurtisanenliebhaber oder als gefälliger Gatte einer Hofhure sogar echte Edelmänner und Barone. Aber meist tun sie wohl, nicht zu warten, bis der Braten brenzlig wird, denn ihr ganzer Zauber beruht in ihrer Neuheit und ihrem Inkognito; biegen sie zu frech die Karten, greifen sie unmäßig tief in die Taschen, machen sie sich gar zu lange häuslich an einem Hofe, so kann plötzlich einer kommen, der ihnen den Mantel aufhebt und darunter das Diebsmal oder die Staupe des Sträflings zeigt. Nur häufiger Luftwechsel kann sie vom Galgen salvieren, darum kutschieren auch diese Glücksritter unablässig in Europa herum, Geschäftsreisende ihres dunklen Handwerks, Zigeuner von Hof zu Hof, und so dreht sich durch das ganze achtzehnte Jahrhundert ein einziges Gaunerkarussell mit denselben Gestalten von Madrid bis Petersburg, von Amsterdam bis Preßburg, von Paris bis Neapel; erst nennt man’s Zufall, dass Casanova an jedem Spieltisch und bei jedem Höflein denselben Lumpenbrüdern begegnet, dem Talvis, dem Afflisio, dem Schwerin und Saint Germain, aber diese unablässige Wanderschaft bedeutet für die Adepten mehr Flucht als Vergnügen – nur in der Kurzfristigkeit sind sie sicher, nur durch Zusammenspiel können sie sich decken, denn sie alle zusammen bilden eine einzige Sippe, eine Freimaurerschaft ohne Kelle und Zeichen, den Abenteurerorden. Wo sie einander begegnen, halten sie, Gauner dem Gauner, die Leiter, einer schiebt den andern in die vornehme Gesellschaft hinein und legitimiert sich, indem er seinen Spielkumpan anerkennt; sie tauschen die Weiber, die Röcke, die Namen und nur eines nicht: den Beruf. Sie alle, die um die Höfe schmarotzen, Schauspieler, Tänzer, Musiker, Glücksritter, Huren und Goldmacher, sind mit den Jesuiten und Juden damals die einzigen Internationalen der Welt zwischen einem sesshaften, engstirnigen, kleingeistigen Hochadel und einem noch unfreien, dumpfen Bürgertum, ein modernes Zeitalter bricht an mit ihnen, eine neue Kunst der Ausbeuterei; sie plündern nicht mehr die Wehrlosen und berauben keine Straßenkutschen, sondern sie bluffen die Eitlen und erleichtern die Leichtsinnigen. Diese neue Art Beutelschneiderei hat ein Bündnis gemacht mit dem Weltbürgertum und soignierten Manieren; statt nach alter Mordbrennerart rauben sie mit gestochenen Karten und geschobenen Wechseln. Sie haben nicht mehr die plumpen Fäuste, die versoffenen Gesichter, die rüden Manieren der Soldatenkapitäne, sondern edel beringte Hände und eine gepuderte Perücke über der nachlässigen Stirn. Sie lorgnettieren und pirouettieren wie Tänzer, sprechen ein bravouröses Parlando wie Schauspieler, tun dunkel wie Erzphilosophen: Kühn ihren unruhigen Blick verdeckend, schlagen sie am Spieltisch die Volte und schmieren den Frauen mit geistreicher Konversation ihre Liebestinkturen und falschen Juwelen an.
Nicht zu leugnen: Ein gewisser Zug ins Geistige und Psychologische steckt in ihnen allen, der sie sympathisch macht, und einige unter ihnen reichen bis ins Geniale hinein. Die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts bedeutet ihr Heldenzeitalter, ihre goldene Epoche, ihre klassische Periode; genau wie vordem unter Ludwig XV. eine glänzende Plejade die französischen Dichter und später in Deutschland der wunderbare Augenblick von Weimar die schöpferische Form des Genius in wenige und dauernde Gestalten zusammenfasst, so glänzt damals das große Siebengestirn der sublimen Schwindler und unsterblichen Abenteurer sieghaft über die europäische Welt. Bald genügt ihnen nicht mehr der Griff in fürstliche Taschen, grob und großartig greifen sie ins Zeitgeschehen und drehen das riesige Rouletterad der Weltgeschichte. John Law, ein hergelaufener Ire, zerpulvert mit seinen Assignaten die französischen Finanzen, D’Eon, ein Zwitter von Mann und Weib, zweifelhaften Geschlechts und Rufs, leitet die internationale Politik, ein kleiner rundköpfiger Baron Neuhoff wird wahr und wahrhaftig König von Korsika, um dann freilich im Schuldturm zu enden; Cagliostro, ein sizilianischer Landbursche, der sein Leben lang nicht recht Lesen und Schreiben erlernte, dreht aus dem berüchtigten Halsband dem Königtum den Strick, der es erwürgt. Der alte Trenck, der tragischste von allen, weil Abenteurer ohne Unedelkeit, und der schließlich mit dem Kopf gegen die Guillotine rennt, tragiert mit roter Mütze den Heros der Freiheit, Saint Germain, der Magier ohne Alter, sieht den König von Frankreich demütig zu seinen Füßen und narrt noch heute mit dem Geheimnis seiner unentdeckten Geburt den Eifer der Wissenschaft. Alle haben sie mehr Macht in Händen als die Mächtigsten, sie blenden die Gelehrten, verführen die Frauen, sie plündern die Reichen und ziehen ohne Amt und Verantwortung heimlich die Fäden der politischen Marionetten. Und der Letzte, nicht der Schlechteste, unser Giacomo Casanova, der Historiograph dieser Gilde, der sie alle darstellt, indem er sich selber erzählt, rundet die Siebenzahl der Unvergessenen und Unvergesslichen in ergötzlichster Weise –, jeder einzelne berühmter als alle Dichter, wirksamer als alle Politiker ihrer Zeit, kurzfristige Herren einer schon dem Untergang verschworenen Welt. Denn nur dreißig oder vierzig Jahre im Ganzen dauert die Heldenzeit dieser großen Talente der Frechheit und mystischen Schauspielerei in Europa, dann zerstört sie sich selbst durch ihren vollendeten Typus, durch ihr vollkommenstes Genie, durch den wahrhaft dämonischen Abenteurer, Napoleon. Immer macht das Genie großartig Ernst, wo das Talent nur spielt, es begnügt sich nicht mit Episodenrollen, sondern fordert schöpferisch die ganze Bühne der Welt für sich allein. Wenn der kleine korsische Habenichts Bonaparte sich Napoleon nennt, so versteckt sich nicht wie bei Casanova-Seingalt, bei Balsamo-Cagliostro das Bürgerliche feig mehr hinter edelmännischer Maske, sondern herrisch tritt der Anspruch geistiger Überlegenheit vor die Zeit und heischt den Triumph als sein Recht, statt ihn listig zu erschleichen. Mit Napoleon, dem Genie all dieser Talente, dringt das Abenteurertum aus dem Vorzimmer der Fürsten in den Thronsaal; er beendet, indem er ihn vollendet, den Aufstieg des Illegitimen zur Höhe der Macht und setzt dem Abenteurertum die Krone Europas aufs Haupt.
Bildung und Begabung
Man sagt, dass er ein Literat sei, aber mit einem an Kabalen reichen Geist, dass er in England und Frankreich gewesen ist, bei Kavalieren und Frauen unerlaubte Vorteile zog, da es immer seine Art war, auf Kosten anderer zu leben und leichtgläubige Leute für sich einzunehmen … wenn man mit besagtem Casanova sich vertraut macht, sieht man in ihm Unglauben, Betrug, Unzucht und Wollüstigkeit in schreckenserregender Art vereint.
Geheimbericht der Venezianischen Inquisition 1755
Niemals leugnet Casanova, Abenteurer gewesen zu sein, im Gegenteil, mit vollen Backen rühmt er sich stolz, lieber den Narrenfänger als den Genarrten, lieber den Pelzscherer als den Geschorenen gespielt zu haben in einer Welt, die, wie schon der Lateiner weiß, allzeit gerne betrogen sein will. Aber nur eines lehnt er strikte ab, deshalb schon verwechselt zu werden mit den Galeerenbrüdern und Galgenschlingeln, die grob und geradeheraus die Taschen plündern, statt kultiviert und elegant den Dummen das Geld aus den Händen zu zaubern. Immer klopft er sich in den Memoiren sorgfältig den Mantel ab, wenn er eine Begegnung (und in Wahrheit Halbpartkompanie) mit den Falschspielern Afflisio oder Talvis zugestehen muss, denn obwohl er und sie sich da auf gleicher Ebene begegnen, so kommen sie doch aus anderen Welten, Casanova von oben, aus der Kultur, und jene von unten, aus dem Nichts. Genauso, wie der ehemalige Student, Schillers ethischer Räuberhauptmann Karl Moor, seine Spießgesellen Spiegelberg und Schufterle verachtet, weil sie als rüdes und blutiges Handwerk treiben, was ihn ein verkehrt getriebener Enthusiasmus ergreifen ließ, so sondert sich auch Casanova immer energisch von dem Falschspielergesindel ab, das dem herrlichen, dem göttlichen Abenteurertum allen Adel und Anstand nimmt. Denn tatsächlich, eine Art Edelmannstitel fordert unser Freund Giacomo für die Abenteurerei, als eine sehr subtile Kunst will er die Komödiantenfreude des Scharlatans gewertet wissen. Hört man ihm zu, so bleibt dem Philosophen auf Erden keine andere sittliche Pflicht, als sich weidlich auf Kosten aller Dummen zu amüsieren, die Eitlen zu düpieren, die Einfältigen zu prellen, die Geizigen zu erleichtern, die Ehemänner zum Hahnrei zu machen, ja kurzweg als Abgesandter der göttlichen Gerechtigkeit alle Narrheit dieser Erde zu bestrafen. Betrug ist für ihn nicht nur Kunst, sondern eine übermoralische Pflicht, und er übt sie, dieser wackere Prinz Vogelfrei, mit blühweißem Gewissen und einer unvergleichlichen Selbstverständlichkeit.
Und wirklich, dies darf man Casanova glauben, dass er nicht bloß aus Geldnot und Arbeitsfaulheit Abenteurer geworden ist, sondern aus eingeborenem Temperament, aus unaufhaltsamem Genie. Von Vater und Mutter her mit Schauspielertum belastet, macht er sich die ganze Welt zur Bühne und Europa zur Kulisse; Bluffen, Blenden, Düpieren und Narren ist ihm wie weiland Eulenspiegel eine blutnatürliche Funktion, und er könnte nicht leben ohne die Karnevalsfreude an Maske und Spaß. Hundertmal hat er Gelegenheit, in brave Berufe sich einzupassen, aber keine Versuchung kann ihn halten, keine Lockung ihn im Bürgerlichen heimisch machen. Schenkt ihm Millionen, bietet ihm Amt und Würde, er wird sie nicht nehmen, sondern immer wieder zurückflüchten in sein urtümliches, heimatloses, flügelleichtes Element. So steht es ihm rechtens zu, sich von den andern Glücksrittern mit einem gewissen Hochmut zu unterscheiden. Messer Casanova ist immerhin ehelich geboren und aus leidlich achtbarer Familie, seine Mutter, »la buranella« genannt, eine berühmte Cantatrice, die auf allen Opernbühnen Europas exzelliert, seines Bruders Francesco Namen findet man in jeder Kunstgeschichte und seine großen Schlachtenschinken noch heute in allen Galerien der Christenheit. Alle seine Verwandten betreiben hochanständige Berufe, tragen die respektable Toga des Advokaten, des Notars, des Priesters – man sieht also, er kommt durchaus nicht aus der Gosse, unser Casanova, sondern aus der gleichen künstlerisch angefärbten Bürgerschicht wie Mozart und Beethoven. Genau wie jene genießt er vortreffliche humanistische und europäische Sprachbildung, er lernt trotz allen Narrenspossen und früher Kenntnis des Weibes doch trefflich Latein, Griechisch, Französisch, Hebräisch, ein wenig Spanisch und Englisch – nur unser geliebtes Deutsch bleibt ihm dreißig Jahre lang ungekaut zwischen den Zähnen. In Mathematik exzelliert er ebenso wie in Philosophie, als Theologe hält er in einer venezianischen Kirche schon im sechzehnten Jahr seine Jungfernrede, als Violinist erfiedelt er sich ein Jahr lang im Theater San Samuele das tägliche Brot. Ob sein Rechtsdoktorat in Padua, das er mit achtzehn Jahren erworben haben will, rechtmäßig oder geflunkert war, über dies wichtige Problem liegen sich heute noch die illustren Casanovisten in den Haaren; jedenfalls hat er viel Akademisches gelernt, denn er kennt sich aus in Chemie, Medizin, Geschichte, Philosophie, Literatur und vor allem in den erträglicheren, weil dunkleren Wissenschaften wie Astrologie, Goldmacherei, Alchemie. Dazu brilliert der hübsche, flinke Bursche noch in allen höfischen und körperlichen Künsten, in Tanzen, Fechten, Reiten, Kartenspielen wie nur irgendein vornehmer Kavalier, und nimmt man zu all diesem gut und geschwind Gelernten noch das Faktum eines geradezu phänomenalen Gedächtnisses, das innerhalb von siebzig Jahren keine Physiognomie vergisst, nichts Gehörtes, Gelesenes, Gesprochenes, Geschautes aus dem Erinnern verliert, so gibt das alles zusammen schon eine Qualität besonderen Ranges: beinahe einen Gelehrten, beinahe einen Dichter, beinahe einen Philosophen, beinahe einen Kavalier.
Ja, aber nur beinahe, und dieses »beinahe« markiert unbarmherzig die Fraktur für Casanovas vielfältiges Talent. Er ist alles beinahe, ein Dichter und doch nicht ganz, ein Dieb und doch kein professioneller. Er streift hart bis an die höchste geistige Sphäre, hart gleichfalls an die Galeere, aber keine einzige Begabung, keinen einzigen Beruf füllt er völlig aus. Als der vollendetste und universalste Dilettant weiß er viel von allen Künsten und Wissenschaften, sogar unglaublich viel, und nur ein Kleines fehlt ihm, um wirklich produktiv zu werden: der Wille, die Entschlossenheit und die Geduld. Ein Jahr hinter den Büchern, und man fände keinen bessern Juristen, keinen geistreicheren Geschichtsschreiber, er könnte Professor werden jeder Wissenschaft, aber Casanova denkt niemals daran, irgendetwas gründlich zu tun. Er will nichts sein, ihm genügt, alles nur zu scheinen: Der Schein trügt ja die Menschen, und Betrügen bleibt für ihn die ergötzlichste Betätigung von allen. Er weiß, dass, um die Narren zu täuschen, nicht viel profunde Gelehrsamkeit sich als nötig erweist; in welcher Materie er nur ein Quäntchen Kenntnis hat, da springt ihm sofort ein herrlicher Helfer bei: seine ganz kolossalische Unverfrorenheit. Stellt Casanova was für eine Aufgabe immer, niemals wird er zugeben, in diesem Fache ein Neuling zu sein, sofort wird er die allerernsteste, fachmännischste Miene aufsetzen, als geborener Schwindler geschickt lavieren, und sich fast immer mit Anstand auch aus der anrüchigsten Affäre ziehen. In Paris fragte ihn der Kardinal de Bernis, ob er etwas vom Lotteriewesen verstünde. Natürlich hat er keine blasse Ahnung, aber ebenso natürlich für den Mauldrescher, dass er ernst die Frage bejaht und vor einer Kommission mit seiner unerschütterlichen Suada Finanzprojekte entwickelt, als wäre er zwanzig Jahre schon gerissener Bankier. In Valencia fehlt der Text für eine italienische Oper: Casanova setzt sich nieder und dichtet ihn aus dem Handgelenk. Würde man ihm angeboten haben, auch die Musik zu schreiben, er kratzte sie zweifellos aus alten Opern geschickt zusammen. Bei der Kaiserin von Russland erscheint er als Kalenderreformer und gelehrter Astronom, in Kurland inspiziert er als rasch improvisierter Fachmann die Bergwerke, der Republik Venedig empfiehlt er ein neues Verfahren zum Färben von Seide, in Spanien tritt er auf als Bodenreformer und Kolonisator, dem Kaiser Joseph II. überreicht er ein umfangreiches Elaborat gegen den Wucher. Für den Herzog von Waldstein dichtet er Komödien, der Herzogin von Urfé baut er den Baum der Diana und ähnliche alchemistische Gaunerstücke, der Madame Roumains öffnet er mit dem Schlüssel Salomons den Geldschrank, für die französische Regierung kauft er Aktien, in Augsburg figuriert er als portugiesischer Gesandter, in Bologna pamphletiert er über Medizin, in Triest schreibt er die Geschichte des polnischen Reiches und übersetzt die Ilias in Ottaverime – kurz, Hans Dampf in allen Gassen hat kein Steckenpferd, aber er weiß auf jedem zu reiten, das man ihm zwischen die Beine schiebt. Blättert man das Verzeichnis seiner nachgelassenen Schriften durch, so glaubt man, einen Universalphilosophen, einen neuen Leibniz erstanden. Da liegt ein dickleibiger Roman neben der Oper Odysseus und Circe, ein Versuch über die Kubusverdopplung, ein politischer Dialog mit Robespierre; und hätte von ihm jemand verlangt, theologisch das Dasein Gottes zu beweisen oder einen Hymnus auf die Keuschheit zu dichten, er hätte nicht zwei Minuten lang gezögert.
Immerhin, welche Begabung! In jede Richtung eingesetzt, in Wissenschaft, Kunst, Diplomatie, Geschäftstüchtigkeit, hätte sie genügt, Erstaunliches zu erreichen. Aber Casanova zersprengt bewusst seine Talente in den Augenblick, und der alles werden könnte, zieht vor, nichts zu sein, nichts – aber frei. Ihn beglückt Freiheit, Ungebundenheit, das lockere Schweifen unendlich intensiver als Hausung und Heimstatt in irgendeinem Beruf. »Der Gedanke, mich irgendwo festzusetzen, war mir immer widerwärtig, ein verständiger Lebenswandel vollkommen gegen die Natur.« Sein wahrer Beruf, so fühlt er, ist: keinen Beruf zu haben, alle Metiers und Wissenschaften nur locker auszuproben und dann zu tauschen wie der Schauspieler Gewand und Rolle. Wozu auch sich festlegen: Er will ja nichts haben und behalten, nichts gelten und nichts besitzen, denn nicht ein Leben, sondern Hunderte in dieser einen Existenz zu leben verlangt seine ungestüme Leidenschaft. »Mein größter Schatz ist«, sagt er stolz, »dass ich mein eigener Herr bin und nicht Angst vor dem Unglück habe« – eine männliche Devise, die diesen Tapfern mehr adelt als sein abgeborgter Chevalierstitel de Seingalt. Er denkt nicht daran, was die andern über ihn denken, er saust über ihre moralischen Hürden mit bezaubernder Sorglosigkeit hinweg; nur im Schwung, im Getriebensein spürt er die eigene Daseinslust, nie im Ruhen und behaglichen Rasten, und dank diesem leichten und ludrigen Dahin über alle Hemmungen, aus seiner Flugperspektive kommen ihm darum alle die braven Menschen recht lächerlich vor, die sich warm eingesponnen haben in ihre eine und immer dieselbe Beschäftigung: Weder die Kriegsherren imponieren ihm, schnauzbärtig ihren Säbel klirrend und doch einknickend vor dem Anschrei ihres Generals, noch die Gelehrten, diese Holzwürmer, die Papier, Papier, Papier fressen aus einem Buch ins andere hinein, noch die Geldmenschen, ängstlich sitzend auf ihren Geldsäcken und schlaflos vor ihren Truhen – ihn lockt kein Stand, kein Land, kein Gewand. Keine Frau kann ihn in ihren Armen, kein Herrscher in seinen Grenzpfählen, kein Beruf in seiner Langeweile halten: Auch hier bricht er kühn alle Bleidächer durch, lieber sein Leben wagend als es versauernd, übermütig im Glück und gleichmütig im Unglück, immer und überall aber voll Mut und Zuversicht. Denn Mut, das ist der rechte Kern von Casanovas Lebenskunst, die Begabung seiner Begabungen: Er sichert nicht, sondern er wagt sein Leben; hier wirft sich einmal inmitten der Vielen und Vorsichtigen einer auf, der wagt, der alles wagt, sich selbst und jede Chance und jede Gelegenheit. Das Schicksal aber gibt den Frechen mehr als den Fleißigen, den Groben lieber als den Geduldigen, und so misst es diesem einen Maßlosen mehr zu als sonst einem ganzen Geschlecht; es packt und wirft ihn auf und nieder, rollt ihn durch die Länder, schnellt ihn nach oben und stellt ihm im schönsten Sprunge das Bein. Es füttert ihn mit Frauen und narrt ihn am Spieltisch, es kitzelt ihn mit Leidenschaften und prellt ihn mit Erfüllungen: Nie aber lässt es ihn los und in Langeweile fallen, immer findet und erfindet das Unermüdliche diesem Unermüdlichen, seinem rechten und spielwilligen Partner, neue Wendung und Wagnis. Und so wird dieses Leben weit, farbig, vielfach, abwechslungsreich, phantastisch und bunt wie kaum eines in Jahrhunderten, und bloß, indem er es berichtet, wird er einer der unvergleichlichsten Dichter des Daseins, freilich nicht durch seinen Willen, sondern durch jenen des Lebens selbst.
Philosophie der Oberflächlichkeit
Ich habe als Philosoph gelebt.
Casanovas letzte Worte
Einer so breit ausströmenden Weite des Lebens entspricht freilich fast immer ein geringer seelischer Tiefgang. Um flink und behänd wie Casanova auf allen Wassern tanzen zu können, muss man vor allem leicht sein wie Kork. Und so liegt, genau besehen, das Spezifikum seiner vielbewunderten Lebenskunst gar nicht in einer besonders positiven Tugend und Kraft, sondern vor allem in einem Negativum: in dem völligen Unbelastetsein von jeder ethischen und moralischen Hemmung. Weidet man dieses saftige, blutüberfüllte, leidenschaftstrotzende Stück Mensch psychologisch aus, so konstatiert man zunächst das restlose Fehlen aller sittlichen Organe. Herz, Lunge, Leber, Blut, Gehirn, Muskeln und nicht zum Mindesten die Samenstränge, all das ist bei Casanova auf das Kräftigste und Normalste entwickelt, nur dort, an jenem seelischen Punkt, wo sich sonst sittliche Eigenheiten und Überzeugungen zum geheimnisvollen Gebilde des Charakters verdichten, überrascht einen bei Casanova ein vollkommenes Vakuum, ein luftleerer Raum, null, nichts. Mit allen Säuren und Laugen, mit Lanzetten und Mikroskopen vermag man in diesem sonst erzgesunden Organismus nicht einmal ein Rudiment jener Substanz nachzuweisen, die man Gewissen nennt. Und damit erklärt sich das ganze Geheimnis von Casanovas Leichtigkeit und Genie: Er hat, der Glückliche, nur Sinnlichkeit und keine Seele. Nichts von dem, was anderen Menschen heilig oder nur wichtig scheint, gilt ihm nur einen Skudo. Liebe zum Vaterland? – Er, der Weltbürger, der durch dreiundsiebzig Jahre kein eigenes Bett besitzt und immer nur im Zufall wohnt, er bläst auf Patriotismus. Ubi bene, ibi patria, wo er die Taschen am besten vollkriegt und die Weiber am leichtesten ins Bett, dort spreizt er behaglich die Beine unter den Tisch und fühlt sich zu Hause. Achtung vor Religion? – Er würde jede annehmen, sich beschneiden oder einen Chinesenzopf wachsen lassen, brächte ihm das Bekenntnis nur einen winzigen Happen Vorteil: Denn wozu braucht einer Religion, der an kein Jenseits glaubt und nur an das warme, wilde, diesseitige Leben? »Dahinter gibt es wahrscheinlich nichts, oder man wird es schon zur rechten Zeit erfahren«, argumentiert er höchst uninteressiert und nonchalant – also strichweg mit allen metaphysischen Spinnweben! Carpe diem, genieße den Tag, fasse jeden Augenblick fest, saug ihn aus wie eine Traube und wirf die Treber vor die Säue – das ist seine einzige Maxime. Streng sich an die Sinnenwelt halten, an das Sichtbare, Erreichbare, jeder Minute mit Daumschrauben das Maximum an Süße und Wollust auspressen – so weit und nicht einen Zoll weiter treibt Casanova Philosophie, und deshalb kann er all die ethisch-bürgerlichen Bleikugeln wie Ehre, Anstand, Pflicht, Scham und Treue, die den freien Auslauf ins Unmittelbare hindern, lachend hinter sich werfen. Denn Ehre? Was soll Casanova mit ihr anfangen? Er wertet sie nicht viel anders als der feiste Falstaff, der das Unzweifelhafte feststellt, man könne sie nicht essen und trinken, und als jener wackere englische Parlamentsmann, der einmal in voller Sitzung die Frage stellte, er höre immer vom Nachruhm sprechen, und er möchte doch endlich einmal wissen, was die Nachwelt schon für Englands Wohlstand und Wohlbehagen getan. Ehre lässt sich nicht genießen, sondern hemmt durch Pflichten und Verpflichtungen sogar noch den Genuss, ergo erweist sie sich als überflüssig. Denn nichts auf Erden hasst Casanova dermaßen wie Pflicht und Verpflichtung. Er erkennt keine anderen Pflichten an und will keine anderen kennen als die einzig bequem-natürliche, seinen braven, krafttätigen Leib mit Genuss zu füttern und den Frauen möglichst viel von dem gleichen Lustelixier zu spenden. Deshalb fragt er durchaus nicht, ob sein heißes Stück Dasein den anderen gut oder böse, süß oder sauer schmeckt, ob sie sein Verhalten als ehrlos oder schamlos ankreiden. Denn Scham – welch sonderbares Wort wiederum, welch unbegreifbarer Begriff! Diese Vokabel fehlt vollkommen in seinem Lebenslexikon. Mit der Nonchalance eines Lazzaroni lässt er sich vor versammeltem Publico munter die Hosen herunter, zeigt, lachend bis in die Augen hinauf, seine Sexualia, plaudert mit vollem Munde gemütlich aus, was ein anderer auch auf der Folter nicht zugeben würde, seine Gaunereien, seine Versager, seine Blamagen, seine geschlechtlichen Havarien und syphilitischen Kuren, weil ihm jedweder Nerv für ethische Unterschiede, jedes Organ für sittliche Komplexe vollkommen fehlt. Würde man ihm vorwerfen, falsch gespielt zu haben, er antwortete nur erstaunt: »Ja, ich habe doch damals kein Geld gehabt!« Würde man ihn beschuldigen, eine Frau verführt zu haben, er lachte bloß: »Ich habe sie doch gut bedient!« Nicht mit einem Wort fällt ihm jemals bei, sich zu entschuldigen, wackeren Bürgern die Ersparnisse aus der Tasche magnetisiert zu haben, im Gegenteil, er unterpolstert in den Memoiren noch seine Gaunereien mit dem zynischen Argument: »Man rächt die Vernunft, wenn man einen Dummkopf betrügt.« Er verteidigt sich nicht, er bereut nichts und nie, und statt am Aschermittwoch über sein verpfuschtes Leben zu klagen, das mit völligem Bankbruch in erbärmlichster Armut und Abhängigkeit endet, schreibt der alte zahnlose Dachs die frech-entzückenden Zeilen: »Ich würde mich für schuldig halten, wenn ich heute reich wäre. Aber ich habe nichts, ich habe alles verschwendet, und das tröstet und rechtfertigt mich.«
In eine Nussschale also geht die ganze Philosophie Casanovas bequem hinein, sie beginnt und endet mit der Vorschrift: ganz diesseitig leben, unbekümmert und spontan, sich nicht prellen zu lassen durch Aussichten auf ein allenfalls mögliches, doch höchst ungewisses Himmelreich. Irgendein sonderbarer Gott hat uns diesen Spieltisch Welt aufgestellt; wollen wir uns dort amüsieren, so müssen wir die Spielregeln akzeptieren, tel quel, ganz wie sie eben sind, ohne nach richtig oder falsch zu fragen. Und tatsächlich: Nicht eine Sekunde seiner Zeit hat jemals Casanova mit dem theoretischen Nachdenken über das Problem verloren, diese Welt könnte oder sollte eigentlich anders sein. »Lieben Sie die Menschheit, aber lieben Sie sie so, wie sie ist«, sagte er im Gespräch zu Voltaire. Nur sich nicht einmengen in das fremde Geschäft des Weltschöpfers, der für diese sonderbare Angelegenheit die volle Verantwortung hat, nur nicht den alten Sauerteig aufrühren und sich damit die Hände beschmutzen, sondern viel einfacher: die Rosinen mit flinken Fingern herausklauben. Dass es den Dummköpfen schlecht geht, findet Casanova ganz in der Ordnung, den Klugen wiederum hilft zwar nicht Gott, aber es liegt nur an ihnen, sich selber zu helfen. Ist die Welt schon einmal so vertrackt eingestellt, dass die einen seidenbestrumpft in Karossen fahren und den andern unter ihren zerlumpten Fetzen der Magen kracht, je nun, dann kann für den Vernünftigen nur eine Aufgabe gelten: selber in die Karosse zu kommen.
Niemals wird er Entrüstung trommeln oder wie weiland Hiob an Gott unziemliche Fragen stellen nach dem Warum und Wieso: Jedes Faktum nimmt er – ungeheure Ökonomie des Gefühls! – einfach als faktisch, ohne ihm den Zettel Gut oder Böse anzukleben. Dass die O-Morphi, ein kleines holländisches Dreckmensch von fünfzehn Jahren, heute noch verlaust in ihrem Bett liegt, freudigst bereit, ihre Jungfräulichkeit für zwei kleine Taler zu verkaufen, und dieselbe vierzehn Tage später als Mätresse des Allerchristlichsten Königs ihr Palais im Hirschpark hat, übersät mit Edelsteinen und bald Gemahlin eines gefälligen Barons, oder dass er selbst, gestern noch erbärmlicher Geigenspieler in einer venezianischen Vorstadt, am nächsten Morgen Stiefsohn eines Patriziers wird, Diamanten an den Fingern und ein reicher Jüngling, solche Dinge verzeichnet er als Kuriosa, ohne sich darüber aufzuregen. Mein Gott, so ist eben die Welt, völlig ungerecht und unberechenbar, und eben, weil sie ewig so sein wird, versuche man nicht, irgendein Gravitationsgesetz oder einen komplizierten Mechanismus für diese Rutschbahn zu konstruieren. Man kratze sich mit Nägeln und Fäusten das Beste heraus, voilà toute la sagesse, man sei bloß Philosoph für sich selbst, nicht für die Menschheit, und das heißt in Casanovas Sinn: stark, gierig, unbedenklich und ohne Rücksicht auf die nächste Stunde im Wellenspiel rasch die strömende Sekunde fassen und sie ausschöpfen bis zum letzten Rest. Nur was atmet, Lust mit Lust erwidert, was an die heiße Haut, mit Leidenschaft und Liebkosung antwortend, andrängt, nur dies dünkt diesem entschlossenen Antimetaphysikus wirklich real und interessant.
So reduziert sich Casanovas Weltneugier einzig auf das Organische, auf den Menschen: Keinen Blick hat er vielleicht zeitlebens sinnend emporgehoben zum Sternengewölke, und schon die Natur bleibt ihm völlig indifferent: Nie kann dieses eilfertige Herz an ihrer Ruhe und Grandiosität sich entzünden. Man blättere doch einmal die sechzehn Bände seiner Memoiren durch: Da reist ein helläugiger, wachsinniger Mensch durch die schönsten Landschaften Europas, vom Posilip bis Toledo, vom Genfer See bis in die russischen Steppen, aber vergeblich wird man eine einzige Zeile der Bewunderung für die Schönheit dieser tausend Landschaften suchen: Eine kleine schmutzige Magd im Winkel einer Soldatenspelunke scheint ihm wichtiger als alle Kunstwerke Michelangelos, ein Kartenspiel in schlecht gelüfteter Wirtsstube schöner als ein sorrentinischer Sonnenuntergang. Natur und Architektur, derlei bemerkt Casanova überhaupt nicht, weil ihm das Organ, dank dessen wir kosmisch verbunden sind, weil ihm die Seele vollkommen fehlt. Für ihn heißen Welt einzig die Städte mit ihren Galerien und Promenaden, wo abends die Karossen vorbeirollen, diese dunkel-schaukelnden Nester der schönen Frauen, wo Kaffeehäuser gefällig warten, in denen man eine Pharaobank zum Schaden der Neugierigen auflegen kann, wo Opern und Bordelle locken, in denen man sich rasch neues Nachtfleisch holt, Gasthöfe, in denen Köche in Saucen und Ragouts dichten und mit hellen und dunklen Weinen musizieren. Nur die Städte sind für diesen Lustmenschen Welt, dort wohnen die Frauen in der einzig ihm möglichen Form, in der Vielzahl, in wandelhaftem Plural, und innerhalb der Städte wiederum liebt er am meisten die Hofsphäre, den Luxus, weil dort das Wollüstige sich zum Künstlerischen sublimiert, denn, obzwar sinnlich wie nur einer, ist dieser breitbrüstige Bursche Casanova keineswegs ein grober Sinnenmensch. Eine Arie, kunstvoll gesungen, kann ihn bezaubern, ein Gedicht ihn beglücken, ein kultiviertes Gespräch wärmt erst richtig den Wein; mit klugen Männern über ein Buch zu reden, schwärmerisch an eine Frau gelehnt, vom Dunkel einer Loge her Musik zu lauschen, das steigert ihm zauberisch die Daseinslust. Aber täuschen wir uns darum nicht: Diese Liebe zur Kunst reicht bei Casanova nie über das Spielhafte, die gefällige Dilettantenfreude hinaus. Der Geist muss für ihn dem Leben dienen, nie das Leben dem Geist: So achtet und betrachtet er die Kunst nur als Aphrodisiakum, als schmeichlerisches Mittel, die Sinne zu erregen, als feineres Vorvergnügen des groben Genusses im Fleische. Er wird gern ein Gedichtchen machen, um es mit einem Strumpfband einer begehrten Dame zu überreichen, er wird Ariost rezitieren, um sie in Feuer zu versetzen, über Voltaire und Montesquieu sehr geistreich mit Kavalieren plaudern, um sich intellektuell zu legitimieren und einen Handstreich auf ihre Börse geschickt zu maskieren – nie aber begreift dieser südländische Sensualist die Kunst, die Wissenschaft, sobald sie Selbstzweck und Weltsinn werden will. Aus Instinkt lehnt dieser Spielmensch die Tiefe ab, weil er nur Oberfläche will, Mensch der Minute und der raschen Verwandlung. Veränderung ist ihm das »Salz des Vergnügens« und Vergnügen wiederum der einzige Sinn der Welt.