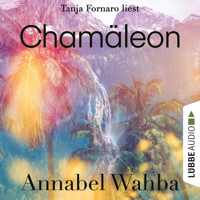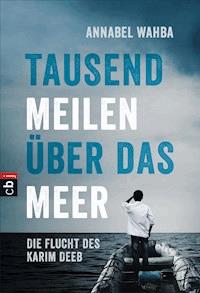14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Annabel Wahba sitzt am Bett ihres schwer kranken Bruders André. Von einem Bild schaut der Totengott Anubis auf ihn herab. Sie erinnert sich an die gemeinsame Kindheit in der Kleinstadt, in der ihre deutsch-ägyptische Herkunft etwas Exotisches war. In Andrés letzten Stunden unternimmt die Erzählerin eine Reise in ihre Familiengeschichte.
Zu den Vorfahren im München des Zweiten Weltkriegs. Ins New York der Fünfzigerjahre, wo ihre Mutter einst arbeitete. Ins Nildelta, wo ihr Vater aufwuchs und die Eltern noch die Ehepartner für die Kinder aussuchten.
Sie kann ihren Bruder nicht festhalten, dafür aber, was sie beide und ihre Eltern vor ihnen erlebt haben als ägyptisch-deutsche Chamäleons.
Buchpremiere: Am 1. September 2022 im Pfefferberg-Theater, Berlin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungPrologErding. Februar 2019Aufbruch IMünchen, Stollbergstraße 14Der letzte BriefDer Wolf und die sieben GeißleinHinterlandGroßmutter und der AdjutantDer GI, Jesus und Errol FlynnStockbettträumeErding. Februar 2019Aufbruch IITetaEntscheidungen am NilBunte Abende und Saure ZipfelEin Treffen auf der IsarKairoer JahreErding. Februar 2019AnkommenSchwarze ZöpfeDer GAUSchafskäse auf GebirgsrosenporzellanZurück in die StollbergstraßeFrau SchuschBesuch im PräsidentenpalastErding. Februar 2019EpilogDankÜber dieses Buch
Annabel Wahba sitzt am Bett ihres schwer kranken Bruders André. Von einem Bild schaut der Totengott Anubis auf ihn herab. Sie erinnert sich an die gemeinsame Kindheit in der Kleinstadt, in der ihre deutsch-ägyptische Herkunft etwas Exotisches war. In Andrés letzten Stunden unternimmt die Erzählerin eine Reise in ihre Familiengeschichte.
Zu den Vorfahren im München des Zweiten Weltkriegs. Ins New York der Fünfzigerjahre, wo ihre Mutter einst arbeitete. Ins Nildelta, wo ihr Vater aufwuchs und die Eltern noch die Ehepartner für die Kinder aussuchten.
Sie kann ihren Bruder nicht festhalten, dafür aber, was sie beide und ihre Eltern vor ihnen erlebt haben als ägyptisch-deutsche Chamäleons.
Über die Autorin
Annabel Wahba, Jahrgang 1972, studierte in München Politikwissenschaften und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Seit 2007 ist sie Redakteurin im ZEITmagazin. 2018 wurde sie mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet, 2019 zur Reporterin des Jahres gewählt. Neben ihrer Arbeit hat Annabel Wahba Drehbücher geschrieben, darunter 2015 die von eigenen Erlebnissen inspirierte ARD-Fernsehkomödie HERBE MISCHUNG über eine Deutsch-Araberin in Israel.
Annabel Wahba
Chamäleon
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Originalausgabe
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Ostermeyer, Berlin
Umschlaggestaltung: Studio Grau, Berlin
Umschlagmotiv: © wendy laurel/Stocksy; Paedii Luchs/Stocksy
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-9524-2
eichborn.de
lesejury.de
Für André
Prolog
Erding. Februar 2019
Draußen vor deinem Schlafzimmerfenster ist alles weiß. In den letzten Tagen ist so viel Schnee gefallen wie seit Jahren nicht mehr, die Zweige tragen einen dicken Pelz und biegen sich unter der Last. Der Schnee schluckt alle Geräusche. Die Welt steht still.
Drinnen liegst du in deinem Bett, die Augen geschlossen, noch atmest du leise. Wenn ich dich so ansehe, bin ich überrascht, wie schmal du geworden bist, wie spitz deine Nase ist, zumindest verdeckt dein schwarzer Bart die eingefallenen Wangen etwas. Von einem großen Bild an der Wand gegenüber schaut der ägyptische Totengott Anubis auf dich herab. Schon beim Hereinkommen spürte ich den Sog, der von dem Gemälde ausgeht: Der Gott mit dem Schakalkopf geleitet einen verstorbenen Pharao im Sarkophag ins Totenreich, von oben leuchtet der Vollmond auf sie herab. Anubis hat diesen Raum in seinen Bann gezogen.
Ich habe dich nie gefragt, warum du ihn dir ins Schlafzimmer gehängt hast, vielleicht hast du eine Vorahnung gehabt. Ich kann mir im Moment jedenfalls kein besseres Bild vorstellen, keines, unter dem man friedlicher ins Jenseits hinübergleitet. Vielleicht hat dich das Bild aber auch einfach an unsere ägyptische Herkunft erinnert. An das Land unseres Vaters. Du bist der Einzige von uns vier Geschwistern, der dort geboren wurde, und ich habe mich oft gefragt, warum du nie mehr dort gewesen bist, seit unsere Familie das Land wieder verlassen hat, als du noch ein Kind warst. Jetzt schließt sich der Kreis. Während du im Sterben liegst, wacht ein ägyptischer Gott über dich. Anubis beruhigt uns, fast habe ich das Gefühl, wir sind hier nicht allein.
Ich bin zum dritten Mal in diesem Monat hierhergekommen und weiß, es wird das letzte Mal sein, dass ich dich lebend sehe. Du hast nur noch wenige Tage. Vielleicht auch nur Stunden.
Als ich vorhin ins Zimmer kam und du noch einmal die Augen aufgemacht hast, versagte mir fast die Stimme, obwohl ich mir vorgenommen hatte, stark zu sein. Mehr als »Ich bin so froh, dass ich da bin« brachte ich nicht raus. Als du leise sagtest »Ich auch«, klang das in meinen Ohren wie eine Liebeserklärung. Wir hängen jetzt alle an deinen Lippen, jedes Wort, das du sprichst, könnte das letzte sein.
Seit du kurz nach Weihnachten so krank geworden bist, wechseln wir Geschwister uns mit den Besuchen bei dir ab. Kommen aus entfernten Städten und Ländern an unseren Heimatort gereist, wo du noch immer wohnst, nah bei den Eltern. Adam kommt aus Norwegen, Anouk aus der Schweiz, ich aus Berlin. Manchmal denke ich, dass unsere Eltern uns schon mit den Vornamen das Fernweh mit auf den Weg gegeben haben. Sie wählten Namen, die man in möglichst vielen Sprachen leicht aussprechen kann und weder deutsch noch ägyptisch sind: Adam, dann Anouk und André – französische Namen klingen ja überall gut –, schließlich Annabel. Das mit dem A am Anfang war ein Spleen, für den unsere Eltern heute keine vernünftige Erklärung mehr haben.
Aber gerade dich, der so weit entfernt geboren wurde, zog es nie fort. Du hast dich zu Hause immer am wohlsten gefühlt, in diesem Eck von Bayern, aus dem die Vorfahren unserer Mutter stammen.
Ist es nicht kurios, dass es unsere deutsch-ägyptische Familie hierher verschlagen hat? Viele Orte in der Welt wären als Familiensitz infrage gekommen, aber unsere Eltern siedelten sich ausgerechnet in dieser Kleinstadt an, in der man die Alpen am Horizont leuchten sieht. Als befände sich hier ein Kraftfeld, von dem sie angezogen wurden.
Ich weiß nicht, wie viel du noch mitbekommst von uns, von unseren Eltern, die jeden Tag an deinem Bett sitzen, stundenlang. Meist stumm, sie sehen dich einfach an, manchmal halten sie deine Hand. Nachts schläft deine Frau neben dir im Ehebett. Ich bewundere Sarah dafür, wie sie dich pflegt. Sie gibt dir die Medikamente, notiert deine Blutdruckwerte. Manchmal kommt auch dein kleiner Sohn herein, aber man spürt, dass es ihm unheimlich ist, dich so liegen zu sehen. Ich wünschte mir, er müsste nicht schon mit acht Jahren seinen Vater verlieren, ich hatte gehofft, du hieltest zumindest durch, bis er erwachsen ist.
Als du an Weihnachten plötzlich so schwach warst, ahnten wir schon, dass der Krebs zurückgekommen war, aber keiner sprach es aus. Du schliefst stundenlang auf der Couch, unter der Replik von Raffaels Madonna Tempi, während wir anderen um dich herum aßen, mit den Kindern spielten, Geschenke auspackten. Obwohl du mir schon nach der Diagnose vor drei Jahren offenbartest, dass du eine der aggressivsten Krebsarten hast, eine, die nur wenige Menschen überleben, war ich mir doch immer sicher, dass du noch ein oder zwei Jahrzehnte bei uns bleiben würdest. »André hat sich mal wieder etwas ganz Besonderes ausgesucht«, sagte Mama damals zu mir, um ihre Verzweiflung mit etwas Humor zu überspielen. Du hast dir immer die teuersten Kameras, die neuesten Handys, die schnellsten Autos gekauft. Und nun hast du also den schlimmsten Krebs. Zwei Tumore kamen und gingen. Diesen dritten wirst du nicht überleben.
Zu verdrängen, was nicht sein soll, war in den letzten drei Jahren eine gute Taktik für mich. Wir beide waren schon immer die größten Optimisten, wahrscheinlich haben wir das von Papa. »Hoffen wir’s Beste« ist einer seiner Lieblingssätze. Wir finden uns erst dann mit etwas ab, wenn es garantiert keinen Ausweg mehr gibt. Nun ist es so weit. Gestern konntest du noch aus dem Glas trinken, jetzt träufeln wir dir mit einer Pipette Saft in den Mund, wie einem Vögelchen. Als du vor zehn Tagen aus dem Krankenhaus nach Hause kamst, dachte ich, es gehe vielleicht noch ein paar Wochen oder sogar Monate gut. Jetzt isst du nichts mehr, öffnest kaum noch deine Augen. Nur Papa hofft noch, Gott werde an dir ein Wunder vollbringen.
Wir sind froh, dass deine Sterbebegleiterin jeden Tag kommt. Ruth sagt, dass du gut vorbereitet bist. Vor ein paar Tagen hat sie dich nach deinen Träumen gefragt. »Du willst mich wohl aushorchen«, sagtest du zu ihr. Sentimentalitäten sind dir zuwider. Dann erzähltest du ihr aber doch, dass du von einem hohen, hellen Raum mit großen Rundbogenfenstern geträumt hast. Auf den Tischen lagen medizinische Instrumente, fein säuberlich aufgereiht. Alles in bester Ordnung.
Heute Morgen hat Anouk Mangosaft in einer Eiswürfelbox gefroren und Zahnstocher hineingesteckt. Damit befeuchten wir deine Lippen und hoffen, dir die letzten Stunden etwas erträglicher zu machen. Als du vorhin an einem Mangowürfel ein wenig geleckt hast, hätte ich ihn mir danach am liebsten selbst in den Mund gesteckt und zu Ende gelutscht. Als letzten gemeinsamen Akt.
In Ägypten werden Mangos im Oktober reif, in deinem Geburtsmonat. Weißt du noch, wie wir alle immer darauf aus waren, hier eine Mango zu bekommen, die so gut schmeckt wie in Ägypten? Sie darf nicht hart sein, aber auch nicht zu weich. Innen schön gelb, aber nicht faserig. Das war unser Ding, die Suche nach der perfekten Mango.
Ich lege mich zu dir ins Bett und schiebe meine Hand unter deine. Ich hoffe, das stört dich nicht. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal deine Hand gehalten? Wahrscheinlich, als wir Kinder waren. Wir haben uns auch nie viel umarmt. Trotzdem fühlte ich mich dir immer sehr nah, so unterschiedlich wir auch sind.
Während du gern zu Hause bist, wollte ich hinaus in die Welt. Ich liebe Bücher, du liest vielleicht eins im Jahr. Du bist Mitglied in der CSU, ich habe diese Partei noch nie gewählt. Trotzdem sind wir in vielen Dingen einer Meinung. Wie wenig die politische Einstellung doch zählt, wenn die Grundhaltung zum Leben dieselbe ist.
Jetzt, da du im Sterben liegst, will ich so viel Zeit wie möglich in deiner Nähe verbringen. Am liebsten würde ich dich umarmen und nicht mehr loslassen. Aber wir sollen dich nicht zurückhalten, hat Ruth gesagt. Sterben ist Arbeit, und diese Arbeit müssen wir dich jetzt machen lassen. Sterbende Menschen suchen sich einen unbeobachteten Moment, um zu gehen, einen, in dem sie allein sind. Tiere machen das ähnlich, sie verstecken sich draußen in der Natur, wenn sie merken, dass ihr Ende kommt.
Ich denke in den letzten Tagen auch an verpasste Chancen. Du wolltest noch einmal an deinen Geburtsort zurückkehren. Letztes Jahr schlugst du vor, wir sollten alle zusammen an Ostern nach Kairo fliegen, aber wir anderen sorgten uns mehr um die schwierige politische Situation dort, anstatt darum, dass es für dich bald zu spät sein könnte. Am Ende blieben wir zu Hause. Ich wünschte, wir wären geflogen. Ich hätte dich auf deiner Reise in die Vergangenheit so gern begleitet.
Jetzt können wir nur noch im Geiste gemeinsam reisen, während Anubis über dich wacht.
Seit unsere Eltern 1968 mit euch drei älteren Geschwistern aus Ägypten nach Deutschland zurückgekehrt waren, mit nicht viel mehr als den Kleidern am Leib, ging es immer bergauf für uns. Erst als du vor drei Jahren so schwer an Krebs erkrankt bist, wurde plötzlich alles anders. Für mich war der Zeitpunkt gekommen zurückzublicken. Hast du dich auch manchmal gefragt, wie es kam, dass unsere deutsche Mutter sich Anfang der 1960er-Jahre ausgerechnet in einen Ägypter verliebte? Das Ende der Nazidiktatur mit ihrem Rassenwahn lag gerade mal fünfzehn Jahre zurück. Und warum akzeptierte ihre tiefgläubige katholische Mutter diesen Studenten aus Nordafrika ohne Vorbehalte als Schwiegersohn?
Aber wahrscheinlich war unser Vater derjenige, der damals den größeren Schritt ins Ungewisse tat. Er wuchs in einer Kleinstadt im Nildelta auf, wo seine Mutter noch selbst das Fladenbrot buk und die Hühner schlachtete, und wo die Eltern die Ehepartner der Kinder aussuchten. Für ihn war eigentlich seine Cousine Yvonne bestimmt.
Und was haben wir, die nächste Generation, aus diesen zwei Welten mitgenommen? Wir vier dunkelhaarigen Geschwister, die zwar anders aussahen als die übrigen Kinder in der Reihenhaussiedlung Erding-Ost, sich aber meistens nicht anders fühlten?
Während du dich von deiner ersten Operation erholtest, begann ich die Geschichte unserer Familie zu erforschen. Ich ging in den Keller unserer Eltern, wo im Hobbyraum zehn dicke Ordner mit den Briefen unserer deutschen Großeltern lagern. Hunderte Seiten vergilbtes Papier in seidengefütterten Umschlägen, dicht beschrieben in deutscher Volksschrift, Liebesbriefe, Ansichtskarten, Feldpost. Um die Jahrtausendwende hat Onkel Heinrich mit dem Computer alles abgetippt, Original und Abschrift fein säuberlich in Klarsichthüllen gesteckt und abgeheftet. Ich las mich durch die gesammelten Dokumente, durch Dramen zwischen zwei Pappdeckeln.
Ich sprach mit unserem Vater über seine Kindheit im Nildelta und mit unserer Mutter über ihre im zerbombten München. Über Momente, in denen ihr Leben auf dem Spiel stand – und damit auch unsere Existenz. Über den Drang nach Freiheit, als Maria in Bayern und Amir in Ägypten aufbrachen und ihre Heimat verließen – sie mit dem Schiff über den Atlantik in die USA, er übers Mittelmeer nach Deutschland. Und darüber, wie Maria und Amir, die auf zwei verschiedenen Kontinenten aufwuchsen, zufällig aufeinandertrafen und für immer zusammenblieben.
Was damals in Deutschland noch ungewöhnlich war, wurde durch Familien wie unsere zur Normalität. »Zu wem g’hörst du?«, fragte man in der Stadt unserer Kindheit gern, um herauszufinden, wessen Spross man vor sich hatte. Mit unserer Antwort konnte selten jemand etwas anfangen. Heute ist das anders, und das ist auch dein Verdienst. Unser Nachname sichert mir bei der örtlichen Sparkasse einen satten Dispokredit, weil unsere Eltern und du dort seit Jahren Kunden seid. Du bist Teil der Erdinger Geschäftswelt geworden, der Bürgermeister ist dein bester Freund. Wir alle haben die Fähigkeit, uns unserer Umgebung anzupassen. Am kompromisslosesten warst allerdings du.
Ich denke jetzt manchmal an Scheherazade und die Märchen aus Tausendundeiner Nacht.
Es ist ungefähr tausendundeine Nacht her, dass wir von deiner Krankheit erfahren haben. Scheherazade erzählte um ihr Leben. Der persische König heiratete jeden Tag eine neue Jungfrau, die er nach der Hochzeitsnacht tötete, aber Scheherazade erzählte ihm Nacht für Nacht an seinem Bett so spannende Geschichten, dass er sie am Leben ließ und sein grausames Ritual nach tausendundeiner Nacht für immer beendete.
Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Wenn ich nun an deinem Bett sitze und dir die Geschichte unserer Familie erzähle, erzähle ich nicht um mein Leben, sondern gegen deinen Tod. Bald wirst du nicht mehr da sein. Ich kann dich nicht festhalten, aber ich will festhalten, was wir beide erlebt haben. Auch du sollst weiterleben, und mit dir das ägyptisch-deutsche Chamäleon.
Aufbruch I
München, Stollbergstraße 14
In unserer Kindheit gab es einen Ort, an dem der Tod immer präsent war. Der Ort war nicht unangenehm, im Gegenteil, wir waren gern bei unserer Oma Elisabeth. Sie lebte in ihrer Wohnung in der Stollbergstraße 14, seit sie mit ihrem Mann und den sieben Kindern 1938 dort eingezogen war. Und hier starb sie auch, kurz vor ihrem neunundneunzigsten Geburtstag, in einer warmen Augustnacht des Jahres 1998.
Wenn wir sie besuchten, schlug uns der Duft vergangener Zeiten entgegen, hier war jahrzehntelang gebacken und gekocht worden, Schmalzgeruch und Kohldämpfe hatten sich in den Wänden festgesetzt. Wir schritten über Teppiche, über die schon zwei Generationen vor uns gelaufen waren. In ihrem Wohnzimmer saßen wir unterm Herrgottswinkel und bewunderten ihre handgeschnitzte Schwarzwalduhr. Das kleine Holzvögelchen, das alle Viertelstunde durch ein kleines Türchen herauskam und »Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck« rief, als wäre es lebendig, hat mich so fasziniert, dass unsere Eltern mir eine Miniatur-Kuckucksuhr aus Plastik für mein Zimmer kauften. Aber die konnte die Oma-Uhr natürlich nicht ersetzen.
Wenn unsere Mutter in der Münchner Innenstadt einkaufte, blieb ich bei Oma Elisabeth in der Wohnung. Ihr drei älteren Geschwister wart damals schon Teenager und froh, wenn ihr mal allein zu Hause in Erding sein konntet. Ich weiß nicht, was dir von Oma noch in Erinnerung ist, aber wenn ich an sie denke, dann sehe ich sie in der Küche stehen und Grießnockerlsuppe und Apfelstrudel zubereiten. Das hat sie oft gemacht, wenn ich zu Besuch kam. Ich kenne niemanden sonst, der diesen dünnen, fast durchsichtigen Teig so ziehen kann, wie sie es konnte. Überall in der Küche lagen die Teigblätter zum Trocknen herum, auf dem Büfett, der Arbeitsplatte, den Stühlen, sogar vom Gewürzregal hingen die runden Teigscheiben herunter, wie die weichen Uhren auf dem berühmten Dalí-Gemälde.
Ihre langen grauen Haare hatte Oma stets zu einem Dutt hochgesteckt, den metallene Haarnadeln zusammenhielten, von denen ich bis heute nicht so recht weiß, wie man sie benutzt, ohne sich dabei in die Kopfhaut zu piksen. Wenn sie in der Küche stand, waren die Ärmel ihrer Bluse hochgekrempelt, sodass ihre Unterarme zum Vorschein kamen, die so weich und weiß waren, wie nur Arme aussehen können, die nie der Sonne ausgesetzt werden. Sie trug immer langärmelige Kleider und ging fast nie ohne Hut aus dem Haus.
Weißt du noch, wie Oma zur Begrüßung immer »Hihi« zu uns Kindern sagte? Ich habe mich jedes Mal gewundert über diese Laute, die wahrscheinlich eine Abwandlung von »Huhu« sein sollten. Mir kam ihre Sprache überhaupt etwas altertümlich vor. Wenn sie auf die Toilette musste, sagte sie: »Ich geh verschwinden.« Vor dem Essen hieß es: »Wohl bekomm’s!« Und wenn sie sich nach meiner Arbeit erkundigte, fragte sie: »Wie läuft’s im Dienst?« Als wäre ich beim Militär.
Als Kind fand ich es auch erstaunlich, dass sie weder Rad fahren noch schwimmen konnte. Immer wieder fragte ich sie, ob das wirklich stimme. Und wenn sie bei uns im Auto mitfuhr, hielt sie sich verkrampft am Griff fest. Sie stammte aus dem letzten Jahrhundert, war 1899 geboren. In unserem Wohnzimmer hängt bis heute ihre Stickarbeit, die sie mit zehn im katholischen Mädcheninternat in Erding angefertigt hat: das Alphabet in geschwungenen Buchstaben, umrandet von einer Bordüre aus Blumen, so ordentlich wie von einer Maschine gestickt.
Unsere Oma konnte auch richtig gut sparen. Ihr Lebensmotto war auf den handbemalten Fliesen in der Küche verewigt: »Spare in der Zeit, so hast du in der Not.« Neulich fand ich bei Mama im Schrank einen alten Taschenkalender aus dem Jahr 1957, in den Elisabeth mit ihrer etwas krakeligen, spitz zulaufenden Schrift alle Ausgaben penibel eingetragen hat: Miete 161,06,- steht da zum Beispiel. Herder-Rechnung 3,20,- und Seife 2,-. Sogar Pfennigbeträge für Porto hat sie notiert. Ihre Rente damals reichte zwar aus, aber wie viele aus der Kriegsgeneration musste sie in ihrem Leben oft mit so wenig Geld zurechtkommen, dass die Sparsamkeit zu ihrem Wesen gehörte.
Ihre sieben Kinder zog Elisabeth allein groß, denn unser Großvater Rudolf starb während des Ostfeldzugs 1941 an Fleckfieber. Aber sein Geist lebte weiter in dieser Wohnung. Wenn Oma von ihm erzählte, und das tat sie bei jedem Besuch, sah er vom Foto auf dem Klavier auf uns herab, ein Mann mit wachen, blitzenden Augen, schütterem blonden Haar und einem ernsten Zug um die schmalen Lippen. In ihren Erzählungen war er ein liebevoller, fürsorgender, pflichtbewusster Vater und Gatte. »Der Vati war ein ganz feiner Mann«, sagte sie jedes Mal. Elisabeth glaubte fest daran, dass sie im Himmel mit ihrem Rudolf wieder vereint sein würde, wofür sie jeden Morgen betete. Solange es ging in der St.-Anna-Kirche, zehn Minuten von ihrer Wohnung entfernt, später dann unterm Herrgottswinkel.
Die Erinnerung an Rudolf, dessen Tod die Familie erschütterte, lange bevor wir geboren wurden, hilft mir jetzt, während wir dich verlieren. Elisabeth war gerade mal einundvierzig, als sie Witwe wurde, unsere Mutter, das jüngste Kind, wurde mit vier eine Halbwaise.
Der letzte Brief
In Omas Wohnung gab es immer etwas zu entdecken: Bildbände aus fernen Ländern, die sie sich gerne ansah, weil sie selbst nie weitergekommen war als bis nach Südtirol. Alte Fotoalben mit sepiafarbenen Familienfotos. Und sind dir mal die getrockneten Blumen aufgefallen, die in einem ovalen Bilderrahmen über Omas Bett hingen? Ich entdeckte sie neulich wieder, als ich Tante Josefa besuchte, bei der sie jetzt im Flur hängen. Die Blumen waren ein Geschenk, ein letzter Gruß von Rudolf. Elisabeth presste sie hinter Glas. Ein Moment des Glücks, gerettet für die Ewigkeit. Auf die Rückseite hat sie geschrieben: »Vom Hochfelln 1941«.
Unsere Großeltern sind gern in die Alpen gefahren, du bist, glaube ich, nach deiner Schulzeit auf keinen Berg mehr gestiegen. Bei Schulwandertagen mussten wir das, es war sozusagen bayerische Pflicht, aber sonst war Bergsteigen nichts für dich – man konnte da ja nicht mit dem Auto hochfahren. Ich hingegen bin geradezu süchtig nach den Gipfeln der Alpen und nach der Freiheit, die man empfindet, wenn man dort oben steht und einem die Welt zu Füßen liegt.
Auf dem Hochfelln spürt man das besonders, das Gipfelkreuz ragt aus einem schroffen Felsen empor, von dem es senkrecht nach unten geht. Man hat einen Blick über den ganzen Chiemgau, unten im Tal liegt der See wie ein riesiger Spiegel, und in einiger Entfernung sieht man Traunstein, eine Ansammlung von Häusern im Dunst, ein paar Kirchtürme und Schornsteine ragen empor. Unsere Urgroßeltern hatten dort einen Schreibwarenladen, dort wuchs unsere Großmutter auf, bis sie vierzehn war. Und im Juli 1941 verbrachten Rudolf und Elisabeth dort ihre letzten gemeinsamen Tage. Rudolf war gerade eingezogen worden, und man hatte ihn zunächst in Traunstein stationiert, zumindest ein vertrauter Ort bei all der Unsicherheit im Krieg. Rudolf hatte als Leutnant im Ersten Weltkrieg gekämpft, aber seit dreiundzwanzig Jahren kein Gewehr mehr in der Hand gehalten.
Ich weiß nicht, ob du das Gefühl nachvollziehen kannst, aber wenn ich auf einen Berg steige, spielt die Zeit keine Rolle mehr für mich: Er war schon vor meiner Geburt da, und er wird auch noch da sein, wenn ich längst tot bin. Als ich kürzlich wieder auf dem Hochfelln war, stellte ich mir vor, wie achtzig Jahre zuvor unsere Großeltern dort oben standen. Vielleicht Hand in Hand? Den Blick in weite Ferne gerichtet, während die Welt um sie herum aus den Fugen geriet? Elisabeth muss das Unheil bereits gespürt haben, denn seitdem ihr Mann Soldat war, litt sie an Migräne, die oft in derartigen Schüben kam, dass sie sich nur noch ins abgedunkelte Schlafzimmer legen konnte.
Warum hatte man einen zweiundfünfzigjährigen Vater von sieben Kindern überhaupt geholt? Weil Rudolf nicht in der Partei war? Elisabeth hasste die graue Uniform, die Stiefel, mit denen er von ihr fortmarschieren würde. Der Befehl zum Ausrücken konnte jederzeit kommen. Krieg im Westen, Krieg im Osten. Ihr eigener Vater war 1917 mit einem durchschossenen Bein heimgekehrt und konnte seither nie mehr richtig laufen. Jeder Krieg erschien ihr wie ein Irrsinn.
Auf dem Hochfelln unternahm sie einen letzten Versuch, ihren Mann davor zu bewahren. Waren ihre schwache Gesundheit und die sieben Kinder nicht Grund genug für eine Eingabe beim Reichskriegsministerium? Sie hatte Gallenprobleme und war erst kurz vor seiner Einberufung von einer wochenlangen Kur heimgekehrt, was nur möglich gewesen war, weil ihre Mutter und ihre älteste Tochter Josefa sich um den Haushalt gekümmert hatten. Was, wenn Rudolf nun in den Osten müsste, nach Russland, wo auch sein neunzehnjähriger Neffe kämpfte? Die Nachrichten von dort klangen besorgniserregend.
Rudolf versuchte sie zu beschwichtigen, ihm war eine Stelle als Ausbilder in Berchtesgaden in Aussicht gestellt worden, außerdem glaubte er fest daran, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. Wie so viele damals noch an einen deutschen Sieg glaubten.
An diesem schönen Sommertag, so stelle ich es mir vor, küsste er sie und pflückte ihr den Blumenstrauß, der bis heute an ihn erinnert.
Am nächsten Morgen war Elisabeth nicht wohl bei dem Gedanken, ihren Mann wieder verlassen zu müssen, aber sein Kurzurlaub war vorbei, und die Kinder erwarteten sie. Bevor sie das Gasthaus verließ, in dem sie übernachtet hatten, legte sie die Blumen in ein Taschentuch und presste sie zwischen die Seiten ihres Buches, damit sie die Rückfahrt überstanden. Daraufhin kehrte sie schweren Herzens nach München zurück.
»Liebe Mutti! Wenn dich dieser Gruß erreicht, sind wir bereits über alle Berge. Ich bin guter Dinge und weiterhin mit dir in Gottvertrauen.«
Wie müssen Elisabeths Hände gezittert haben, als sie im August 1941 diesen ersten Feldpostbrief in Händen hielt und nun Gewissheit hatte, dass ihr Mann im Krieg und nicht in Berchtesgaden war. Heute liegt er im Keller unseres Elternhauses, und neulich hat einer ihrer vielen Urenkel ihn neugierig hervorgekramt.
Erinnerst du dich noch an das silberne Medaillon, das Oma immer an einer langen Silberkette trug? An das Porträt ihrer Schwiegermutter darin, die so gutmütig dreinblickte und von der sie auch später noch glaubte, sie wäre ihr Schutzengel? Manchmal sprach sie sogar mit ihr, und ich bin sicher, auch in diesem Moment. »Josefa, was soll ich tun?«
Josefa war eine Baroness, ihr Mann Oberlandesgerichtsrat in Köln, und Elisabeth verehrte sie sehr. Ihre eigenen Eltern waren einfache bayerische Kaufleute, die ersten aus ihren jeweiligen Familien, die den Bauernhof der Familie verlassen hatten und in die Stadt gezogen waren. Aus diesem Grund war Elisabeth Zeit ihres Lebens davon überzeugt, dass die noblen Kölner Verwandten sich für ihren Rudolf, das siebte von vierzehn Kindern, insgeheim eine bessere Partie gewünscht hätten, eine junge Frau aus gutem Hause und mit einer ordentlichen Mitgift. An dieser Überzeugung änderten auch die herzlichen Briefe nichts, die bis zu Josefas Tod im Jahr 1936 hin- und hergingen, und auch nicht, dass Josefa genauso religiös war wie sie.
Elisabeth selbst hatte keine Geschwister, ihr kleiner Bruder war früh an Diphtherie gestorben. Auch deshalb gab sie sich alle Mühe, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Egal ob Handarbeiten, Hauswirtschaft, Schönschrift oder Buchführung, sie bekam fast nur Einsen im Internat. Ihren bairischen Dialekt gewöhnte sie sich ab, nur das »mei« und das »gelt«, die sie gerne in ihre Sätze einstreute, verrieten ihre Herkunft.
Von ihrer Mutter lernte Elisabeth, wie man Geld zusammenhält. Während der Vater sein gesamtes Vermögen durch unsichere Aktiengeschäfte verlor, versorgte die Mutter die Familie mit ihrem Schreibwarenladen. Auch Elisabeth musste früh ihr eigenes Geld verdienen und trat im Alter von einundzwanzig Jahren ihre erste Stelle an der Kasse einer großen Münchner Buchhandlung an, bei Herder am Dom in der Löwengrube 14. Dort nahm kurz darauf auch ein neuer Geschäftsführer seine Arbeit auf, ein Mann mit flaumigem blondem Haar und glasklaren blauen Augen, dessen energisch abstehende Nasenflügel nicht so recht zu seinem sonst eher zarten Äußeren passen wollten. Gleich nach seinem ersten Arbeitstag erzählte Elisabeth ihrer Mutter daheim von ihrem neuen Vorgesetzten. Er stamme aus Köln und sei ein ganz feiner Herr. »Wenn ich einmal heirate, dann so einen«, sagte sie. In den kommenden Wochen entwickelte sich im Schatten des Münchner Doms, umgeben vom staubigen Geruch Hunderter Bücher, eine zarte, bald ernsthafte Liebesgeschichte.
Als ich die alten Briefe unserer Großeltern durchsah, entdeckte ich auch Rudolfs ersten Liebesbrief an Elisabeth, auf der Rückseite eines vergilbten Rechnungsformulars der Buchhandlung Herder. Was unser Großvater vor hundert Jahren ohne Anrede hastig und mit Bleistift auf das dünne Papier schrieb, ist noch immer gut lesbar:
»Seien Sie guten Mutes. Ich bringe Ihrer Liebe und Ihren persönlichen Verhältnissen die größte Beachtung und Wertschätzung entgegen. Meine Liebe wird sich aufbauen auf klarer Erkenntnis und vollster Lebensbejahung.«
Er sei zuweilen ein »undankbarer Philosoph«, warnte Rudolf seine Angebetete. Ich nehme an, er spielte damit auf seine Vergangenheit als Ordensbruder an: Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg wollte Rudolf eigentlich Mönch werden, aber diesen Plan gab er nach wenigen Monaten im Kloster wieder auf.
Ein halbes Jahr nach dem ersten Liebesbrief, am 30. Dezember 1922, heirateten Elisabeth und Rudolf. Zehn Monate später kam ihr erstes Kind zur Welt: Josefa, benannt nach der Schwiegermutter.
Rudolfs Kompanie war nach Weißrussland geschickt worden, in bereits eroberte Gebiete, er sei der Kommandant eines Zugs, schrieb er seiner Frau. Später wurde er Kommandant einer kleinen Stadt in der Nähe von Gomel. Alle paar Wochen bekam sie einen Brief von ihm, doch die Schilderungen seiner Erlebnisse blieben vage. Er berichtete von der »unverbesserlichen Not«, die dort herrsche, von der »Not der Kriegsgefangenen«. Er erlebe »ganz furchtbare Dinge. Einzelheiten zu berichten, muss ich mir allerdings für später versparen.« Er schrieb auch von »den Juden, die nun weg« seien. Mehr schrieb er dazu nicht, die Feldpost wurde zensiert. »Etwas Unheimliches lastet auf diesem Land, für Gott existiert es nicht«, schloss er einen seiner Briefe.
Zu Hause in München tat Elisabeth, was sie immer tat: beten und arbeiten. Auch wir lernten sie noch so kennen: morgens um sechs der Kirchgang, dann waschen, kochen, flicken. In jenen Kriegsmonaten waren die Nahrungsmittel schon rationiert und vieles war gar nicht mehr zu bekommen, doch zum Glück überließen ihr die Verwandten von den Bauernhöfen in Grabing und Steinkirchen Äpfel, Kartoffeln und Gläser mit eingemachtem Gemüse. Dafür musste sie mit den älteren Kindern jedes Mal eine lange Reise auf sich nehmen. Erst fuhren sie mit dem Zug nach Taufkirchen, dann liefen sie einige Kilometer zu Fuß, und auf dem Rückweg schleppten sie die kiloschweren Taschen und Rucksäcke.
Wann immer Elisabeth ein paar Minuten Zeit fand, schrieb sie ihrem Mann und erzählte ihm von den Kindern, von Josefa, Adelheid, Heinrich, Korbinian, Therese, Theo und der kleinen Maria – oder Schnucki, wie Mama als Kind genannt wurde. Sie schickte ihm Pakete mit Geräuchertem, Gebäck und wollener Unterwäsche, damit er nicht hungern und nicht frieren musste im sowjetischen Winter.
Am vorletzten Tag des Jahres 1941, ihrem neunzehnten Hochzeitstag, schrieb Elisabeth ihm einen besonderen Brief. Auch in München war dieser Winter eisig, dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, und ein scharfer Wind blies durch die Straßen Münchens, als sie sich an den runden Esstisch unterm Herrgottswinkel setzte. Schnucki fuhr unten im Hof mit Theo Schlitten, und die älteren Brüder bastelten an ihren Holzfliegern, die sie zu Weihnachten bekommen hatten. Elisabeth war froh, überhaupt etwas für sie gefunden zu haben. Die Spielwarengeschäfte waren fast leer, die Arbeiter und Handwerker alle eingezogen, und was es an Holz und Metall noch gab, wurde zu kriegswichtigem Gerät verarbeitet und nicht zu Spielwaren.
Ich sehe sie vor mir, wie sie ihren damals noch schwarzen Dutt richtet und ihre Brille aufsetzt, das einst runde Gesicht von den Strapazen der letzten Jahre spitz und hager geworden. Wie sie einen Bogen ihres cremefarbenen Briefpapiers aus der Kommode holt und das Datum notiert: 30. 12. 1941. Zu Beginn hatte sie ihren Mann noch mit »Lieber Rudolf« angeredet und er sie mit »Liebe Liesel« oder »Liebes Kind«, aber nun war sie nur noch »Mutti«, und auch sie begann diesen Brief mit »Lieber Vati!«. Weiter schrieb sie:
»Heute, an unserem Hochzeitstage, musst du doch noch einen kurzen Gruß haben. Ich war heute in der Kirche und habe dem lieben Gott für das Glück, dass wir beide gemeinsam unseren Lebensweg gehen dürfen, gedankt. Wenn es auch manchmal schon schwere Zeiten waren, so hat doch in Treue und Liebe eines zum andern gestanden. Gebe Gott, dass wir noch viele Jahre beisammen sein dürfen.«
Sie erzählte von den Kindern, von Schnucki, die das Vaterunser schon fehlerfrei beten könne, und von Adelheid, siebzehn inzwischen, die ihren Arbeitslohn als Laborantin schon wieder beim Friseur ausgegeben habe. Sie bedankte sich für das Weihnachtspaket, das Rudolf der Familie geschickt hatte, vor allem für die Zahnpasta, die man gerade so schwer bekomme und über die sich die Kinder sehr gefreut hätten.
»Hoffentlich bekomme ich bald gute Nachricht von dir. Ich muss so oft an dich denken und möchte am liebsten jeden Tag von dir hören. Recht herzliche Grüße. In Liebe, Mutti.«
Die Nachricht kam vier Tage später, am frühen Nachmittag. Um diese Zeit ruhte Elisabeth, und selbst die kleine Schnucki, die eigentlich immer vor sich hin plapperte, saß still im Wohnzimmer und lauschte dem Summen des Wasserkessels, der damals noch auf dem alten Ofen vor sich hin bullerte, die älteren Kinder lasen in ihren Zimmern oder stickten. Es war also still in der Wohnung, als die Türklingel den Schrecken, der nun über Elisabeth und ihre Kinder hereinbrach, um so schriller ankündigte.
Die achtzehnjährige Josefa mit den langen braunen Zöpfen und dem großen Kreuz, das um ihren Hals hing und sie regelrecht vornüber zu ziehen schien, öffnete die Tür und nahm das Kuvert vom Postboten entgegen. Seit zwei Wochen hatte Elisabeth nichts mehr von ihrem Mann gehört, und nun kam ein Einschreiben. Auf der Rückseite des Kuverts prangte ein Stempel mit dem Eingangsdatum in München: 03. 01. 1942, darunter das Hakenkreuz und rundherum der Schriftzug »Hauptstadt der Bewegung«. Wie damals, als sie ihren ersten Feldpostbrief erhielt, zitterten Elisabeths Hände beim Öffnen des Umschlags. Stumm und hastig überflog sie, was der Chefarzt des Lazaretts in Gomel ihr am Heiligen Abend geschrieben hatte.
»Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Mann, der Oberleutnant RUDOLFSEITZ, der am 7. Dezember 1941 mit Fleckfieber ins Lazarett eingeliefert wurde, am 16. Dezember 1941 gestorben ist.«
Die nächsten Zeilen, in denen der Militärarzt berichtete, dass Rudolf auf dem »Heldenfriedhof in Gomel« beigesetzt worden war, verschwammen vor Elisabeths Augen. An ihrem Hochzeitstag war Rudolf also schon tot gewesen. Ihr fiel ein, dass sie am 16. Dezember abends im Weihnachtskonzert des Bach-Vereins gewesen war. Im Wohnzimmer lag noch das Programm. Als der Chor »Morgenstern der finstern Nacht« gesungen hatte, hatte sie sich ihrem Mann so nah gefühlt.
Dann verlor Elisabeth das Bewusstsein.
Der Wolf und die sieben Geißlein
Die Geschichte unserer deutschen Großeltern hat auch dich immer fasziniert. Du hättest dich zwar niemals durch die vielen Leitz-Ordner mit den alten Briefen gequält, aber als unsere Oma Ende neunzig war, bist du mit deiner Videokamera zu ihr nach München gefahren, um sie über ihr Leben zu befragen. »Sie hat fast ein Jahrhundert gelebt. Das muss man doch festhalten, bevor alles mit ihr verschwindet«, hast du damals gesagt.
Was genau daraus wurde, wusste ich lange nicht. Aber jetzt fiel mir diese Aufnahme wieder ein, und ich habe Mama danach gefragt.
»Ja, die DVD liegt in irgendeiner Schublade.«
»Und? Hast du sie dir nie angesehen?«
»Nein. Irgendwie nicht.«
Warum Mama diesen Film seit zwanzig Jahren dort liegen lässt, kann ich mir nicht erklären. Aus Schmerz über den Tod ihrer Mutter? Sie war damals ein Jahr lang nicht mehr sie selbst, weinte viel.
Ich werde mir deinen Film ansehen, aber im Moment schaffe auch ich es nicht: unsere tote Oma, plötzlich wieder lebendig, im Zwiegespräch mit dir, der nun im Sterben liegt.
Wenn ich deinen Sohn ansehe, wie er verstohlen um dein Bett schleicht, muss ich daran denken, dass auch Mama ihren Vater als Kind verloren hat. Sie hat nie viel davon gesprochen, woraus man schließen könnte, es hätte ihr wenig ausgemacht. Doch als ich mir neulich ihr Fotoalbum aus der Teenagerzeit ansah, blickte mir von der ersten Seite ein Porträt unseres Großvaters entgegen, damit eröffnete sie das Album. Der Tag der Trauerfeier habe sich für immer in ihr Gedächtnis gebrannt, erzählte sie mir.
Obwohl Rudolfs Leichnam längst in Gomel unter der Erde lag, organisierte Elisabeth in München nicht nur die übliche kirchliche Zeremonie, sondern ließ auch einen Grabstein für ihren Mann anfertigen. Als Kind habe ich mich immer gewundert, wenn wir auf den Ostfriedhof gingen und vor diesem Stein standen, weil ich wusste, dass der Leichnam unseres Opas irgendwo weit entfernt im Osten beerdigt worden war. Du kennst sicher auch die alten Schwarz-Weiß-Fotos von seinem Grab in Gomel, die man mit der Todesnachricht geschickt hatte, Oma hat sie uns ein paarmal gezeigt: Man sieht darauf einen Grabhügel im Schatten einer Birke, am Kopfende steht ein Holzkreuz mit der Aufschrift »Rudolf Seitz«, dahinter und daneben erheben sich Dutzende gleicher Hügel, nur die Namen auf den Kreuzen sind andere.
Schon Tage vor der Trauerfeier hörte die kleine Maria ihre Geschwister über die vielen Verwandten reden, die zu Besuch kommen würden, sogar die Familien vom Land wollten den beschwerlichen Weg auf sich nehmen. Als ihre große Schwester Josefa sie dann aber am Morgen der Feier für den Kindergarten fertig machte, anstatt sie in die Kirche mitzunehmen, weinte sie. Warum durfte sie nicht dabei sein?
»Schnucki, so eine Trauerfeier ist nichts für dich«, hieß es, und damit war die Sache erledigt.
Die Kinder gingen zum Schlittenfahren in die Isaranlagen. Sie stapften die Böschung hoch, oben zwischen den Bäumen leuchtete der goldene Friedensengel, unten rauschte der Fluss vorbei.
Woran erinnert sie sich heute, wenn sie an die Vierjährige von damals denkt? Dass sie sich in den Schnee warf, wie ein Hampelmann die Beine auf und ab bewegte und »ein Schneeengel!« rief, als sie aufstand und ihren Abdruck am Boden betrachtete. Josefa hatte ihr gesagt, dass der Vater jetzt auch ein Engel sei und vom Himmel aus auf sie aufpassen werde. Oben auf dem Hügel war ihr plötzlich alles ganz leicht vorgekommen, weshalb sie sich auf den Schlitten setzte, mit den Beinen abstieß und hinuntersauste. Direkt auf den Baum zu, da nutzte kein Fersenstemmen etwas, der Schlitten tat, was er wollte.
Mit einem weißen Verband um den Kopf platzte sie später mitten in die Trauergesellschaft, die sich zu Hause in der Stollbergstraße versammelt hatte. Aller Augen waren auf sie gerichtet, und aus Elisabeths blassem Gesicht wich noch der letzte Anflug von Farbe.
»Das wird schon wieder. Zum Glück hat die Schnucki ja einen Dickschädel«, sagte ihr großer Bruder Theo und brachte damit alle zum Lachen.
Unsere Mutter muss als Kind eine Frohnatur gewesen sein. Fast auf allen Fotos aus jener Zeit lacht sie, die Augen zu kleinen Schlitzen zusammengekniffen, Grübchen auf den Wangen. Vielleicht liegt es auch an ihrer Nase, die wie eine Rutschbahn geschwungen ist, dass sie immer etwas frech aussieht. Von den sieben Geschwistern kam sie wohl am besten mit dem Verlust des Vaters zurecht, wahrscheinlich weil sie noch so jung war und sich alle um sie kümmerten. Und weil sie ihren Vater ohnehin seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Außerdem war ja im Haus immer etwas los. Ihre Oma Anna und Tante Marille, eine Freundin der Familie aus Schwabing, waren da, um zu helfen.
Dafür machten sich ihre älteren Geschwister umso mehr Sorgen, dass sie bald nicht nur ohne Vater sein würden. Nach der Beerdigung versank Elisabeth in ihrer Trauer, verweigerte jedes Essen und schien immer mehr zu verschwinden. Sie lag in ihrem dunklen, unbeheizten Zimmer wie im Koma und sprach kaum. Nur Schnucki, die handgenähte Puppe vom Weihnachtsfest immer im Arm, schaffte es hin und wieder, dass sie ein paar Stücke Brot oder Apfel von ihr nahm, während der neunjährige Theo vor ihrer Zimmertür saß und hoffte, seine Mutter möge endlich wieder herauskommen.
Unser Onkel Theo, dem wir später bei seinen Marathonläufen zujubelten, war ein schmächtiger kleiner Junge, das vorletzte Kind, das von den älteren Geschwistern manchmal wegen seiner mandelförmigen Augen gehänselt wurde. Weil niemand sonst in der Familie solche Augen hatte, meinten die Älteren, er sei wohl ein Findelkind und stamme von den Mongolen ab. Nach dem Tod des Vaters stritt er sich vor allem mit Josefa, die nun das Regiment übernommen hatte und die Arbeiten im Haus verteilte. Er war dafür zuständig, Schnucki in den Kindergarten zu bringen, der neben seiner Schule lag, was nicht einfach war, weil Schnucki immer herumtrödelte und nicht auf ihn hörte. Theo wiederum wollte sich von Josefa nicht herumkommandieren lassen und nannte sie wegen ihrer herrischen Art nur noch Josef.
Auch Korbinian, der Vierzehnjährige, geriet mit Josefa aneinander. Sie hatte die Verteilung der Brotrationen übernommen: Jedes Kind bekam seinen eigenen Laib, in den sie den Anfangsbuchstaben des Vornamens ritzte und die Rinde einschnitt, sodass jeder wusste, wie viel er täglich essen durfte. Korbinian, der größte von allen, war immer hungrig und schnitt sich, wenn er es nicht mehr aushielt, bei den anderen heimlich eine Scheibe ab. Auch wenn die es vielleicht nicht mitbekamen, Josefa bemerkte es und machte den Diebstahl in einem großen Donnerwetter publik. Um dem täglichen Ärger unter den Geschwistern zu entgehen, verbrachte sein ein Jahr älterer Bruder Heinrich die Nachmittage am liebsten im Hort der St.-Anna-Schule, wo es auch damals noch gutes Essen für die Kinder gab.
Es sollte mehrere Wochen dauern, bis Elisabeth wie durch eine innere Eingebung eines Morgens wieder aufstand, ihre Finger ins kleine Weihwasserbecken an der Wand ihres Zimmers tippte, sich bekreuzigte und beschloss, dass es irgendwie weitergehen musste. Um der Kinder willen.
Sie fuhr nach Langengeisling zu ihrer Cousine Betty – erinnerst du dich, die dunkelhaarige Frau mit dem Damenbart, die noch in hohem Alter an ihrer Nähmaschine saß und Kleider schneiderte? Betty nähte auch die Dirndl, die Mama mir als Mädchen so gern anzog und die ich überhaupt nicht mochte. Elisabeth ließ sich damals zwei schwarze Blusen und Röcke von ihr nähen. Den Ehering ihres Mannes, den man ihr mit den anderen Sachen aus Gomel zurückgeschickt hatte, brachte sie mit ihrem eigenen zum Juwelier und ließ aus beiden einen einzigen machen, mit sieben winzigen Steinen darin, einen für jedes Kind.
Seither stand Rudolfs Porträt, das er kurz vor seiner Einberufung hatte machen lassen, auf dem Klavier im Wohnzimmer, und wurde verehrt wie ein Heiligtum. Wenn sie fortan von ihm erzählte, dann von dem »feinen Mann«, der nie ein böses Wort an sie gerichtet habe, der, wann immer er konnte, mit den Kindern für die Schule gelernt und ihnen im Volksbad das Schwimmen beigebracht habe. Von seiner zaudernden, grüblerischen Art, vor der er seine Braut schon in seinem ersten Brief gewarnt hatte, war nie die Rede.
Alle Fährnisse der letzten Jahre, die Nöte und Mühen, schienen in Elisabeths Erinnerung wie weggewischt. Doch wie groß die Geldsorgen unserer Großeltern lange gewesen waren, wurde mir erst klar, als ich die vielen Briefe las, die sie sich in der Anfangszeit schrieben. Rudolf war in den ersten Ehejahren kaum zu Hause. Wie es damals üblich war, gab Elisabeth nach der Hochzeit ihre Stelle in der Buchhandlung Herder auf, und bald kündigte sich das erste Kind an. Auch Rudolf verließ die Münchner Traditionsbuchhandlung und wechselte in den Vertrieb des Pustet Verlags. Aber auch dort hielt es ihn nicht lange. Er wollte sein eigener Herr sein und versuchte sich als Verkäufer von Messbüchern, wofür er erst mit dem Fahrrad und dann mit dem Moped durch ganz Deutschland zog. Elisabeth hielt daheim das Geld zusammen und ermahnte ihren Mann zur Sparsamkeit, wenn er auf seinen Touren mehr Benzin verbrauchte, als er durch den Verkauf der Bücher verdiente. Sie besserte die Einnahmen auf, indem sie in München Eier von den Höfen ihrer Verwandten verkaufte. Und einmal schrieb sie ihrem Mann, er solle ihr bitte endlich Geld schicken, sie habe nur noch fünf Mark im Portemonnaie.
Eine Zeit lang plante die Familie, nach Hamburg umzuziehen, wo Rudolf die Buchabteilung der neuen Karstadt-Filiale in Barmbek aufbaute, aber aus der erhofften Festanstellung in dem modernen Kaufhaus wurde nichts. Dann wollte Rudolf die Buchhandlung einer Pfarrei übernehmen. Auch das zerschlug sich. Ob er seine Eltern nicht um Geld bitten wollte, oder ob sie – hochbetagt und mit vierzehn Nachkommen – außer ihrem noblen Stammbaum nichts zu bieten hatten, weiß heute niemand mehr.
Erst 1930, als Rudolf und Elisabeth im schwäbischen Aalen einen Schreibwarenladen übernahmen, kehrte Ruhe ein. Bis 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen. In der Kleinstadt sprach sich schnell herum, dass Rudolf, anders als die meisten Geschäftsleute im Ort, nicht in die NSDAP