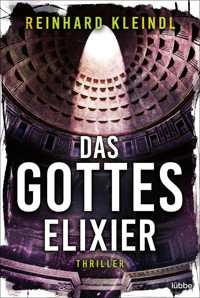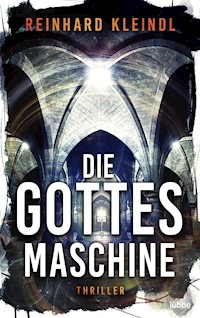9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kein Code der Welt ist mehr sicher!
Als eines Tages das Internet von scheinbar sinnlosen Zahlenreihen geflutet wird, ist die Verwirrung groß. Journalistin Line Berg wendet sich an den Nobelpreisträger Josef Weisman, der vermutet, jemand habe eines der größten Rätsel der Mathematik gelöst. Die Konsequenzen wären brandgefährlich: Diese Person könnte jeden Code der Welt knacken, jedes Sicherheitssystem umgehen und wäre fast allmächtig.
Aber wer könnte der Unbekannte sein? Berg und Weismann erfahren von einem Wahrsager aus Nigeria, der sehr präzise Wetterprognosen abgab, bis er und seine Familie ermordet wurden. Nur Tochter Hope überlebte. Hat der alte Mann das Rätsel gelöst? Berg und Weismann eilen nach Lagos. Doch sie sind nicht die einzigen, die hinter der Lösung her sind, und ihre Gegner sind bereit, über Leichen zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Kein Code der Welt ist mehr sicher! Als eines Tages das Internet von scheinbar sinnlosen Zahlenreihen geflutet wird, ist die Verwirrung groß. Journalistin Line Berg wendet sich an den Nobelpreisträger Josef Weisman, der vermutet, jemand habe eines der größten Rätsel der Mathematik gelöst. Die Konsequenzen wären brandgefährlich: Diese Person könnte jeden Code der Welt knacken, jedes Sicherheitssystem umgehen und wäre fast allmächtig. Aber wer könnte der Unbekannte sein? Berg und Weismann erfahren von einem Wahrsager aus Nigeria, der sehr präzise Wetterprognosen abgab, bis er und seine Familie ermordet wurden. Nur Tochter Hope überlebte. Hat der alte Mann das Rätsel gelöst? Berg und Weismann eilen nach Lagos. Doch sie sind nicht die einzigen, die hinter der Lösung her sind, und ihre Gegner sind bereit, über Leichen zu gehen.
ÜBER DEN AUTOR
Reinhard Kleindl ist ein österreichischer Thrillerautor, Wissenschaftsjournalist und Extremsportler. Er besuchte ein katholisches Gymnasium, studierte Theoretische Elementarteilchenphysik und diplomierte mit Auszeichnung. Internationale Bekanntheit erlangte er als Extremsportler, mit Slacklineaktionen an den Victoria-Wasserfällen und auf den Drei Zinnen. Er gehört zu den aktivsten Wissenschaftserklärern Österreichs und schrieb für Zeitungen, Magazine und Universitäten. Derzeit schreibt er freiberuflich für den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Alle Charaktere dieser Geschichte sind fiktiv.
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: René Stein, Kusterdingen
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © AiCreatorArt/stock.adobe.com; octomesecam/
shutterstock.com; maxpro/shutterstock.com; isaravut/shutterstock.com;
Bits And Splits/shutterstock.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4771-4
luebbe.de
lesejury.de
»Mich kümmert es nicht, dass Sie ein Mädchen sind,aber das Wichtigste ist, dass es Sie nicht kümmert.Dazu gibt es keinen Grund.«
Albert Einstein im Jahr 1946 in einem Brief an diesechzehnjährige Schülerin und Hobby-AstronominMyfawny aus Kapstadt, nachdem er sie anfangsfälschlicherweise für einen Jungen hielt.
Unter jenen Personen, die von Berufs wegen mit Geheimnissen zu tun haben, gibt es eine Legende – von einer Formel, die alles verändern würde. Keine sensible Information wäre mehr sicher, kein schmutziges Geheimnis ließe sich mehr verbergen. Während manche den Tag X fürchten, an dem diese Formel gefunden wird, fördern andere die Suche danach und versprechen dem, der sie findet, Millionen. Und während das Leben der Geheimnisbeschützer in den staatlichen Nachrichtendiensten und IT-Sicherheitsfirmen trotz der latenten Bedrohung weitergeht wie bisher, macht ein neues Gerücht die Runde, das sich trotz mangelnder Beweise immer schneller verbreitet: dass diese Formel bereits gefunden wurde und die Revolution unmittelbar bevorsteht.
EINIGE WOCHEN ZUVOR
Die Zeitreisendenparty war Tradition bei der für das Knacken von Codes zuständigen Abteilung des britischen Geheimdienstes. Ort und Zeit unterlagen strengster Geheimhaltung und waren nur den Organisatoren bekannt, einer kleinen Gruppe von Nerds innerhalb des Dienstes. Sie hatten in den starren Strukturen, die noch aus Kriegszeiten stammten und für Kriegszeiten gemacht waren, kein leichtes Leben. Viele von ihnen waren auf verworrenen Wegen hierhergekommen, manche waren nicht ganz freiwillig hier und hatten eines dieser sprichwörtlichen Angebote bekommen, die man nicht ablehnen kann. Manche waren in einem früheren Leben Hacker mit einem starken Faible für anarchistisches Gedankengut gewesen, einer hatte sich beim Hacken von Regierungsseiten erwischen lassen, wo statt des Logos des britischen Oberhauses plötzlich ein pixeliges Einhorn über den Bildschirm der offiziellen Website geflogen war – mit einem Regenbogenschweif aus seinem After. Danach hatte es geheißen: Gefängnis oder ein Job beim Geheimdienst. Wenige überlegten lange.
Doch sie sehnten sich neben den Geheimdienstveteranen – ernsten, undurchsichtigen Gestalten ohne echtes Privatleben – nach der verlorenen Freiheit. Die Zeitreisendenparty war eine der wenigen Gesten des Aufbegehrens, die sie sich zugestanden. Zwar war ihnen die Ausrichtung mehrmals explizit verboten worden, doch sie wussten, dass diese Aktivität stillschweigend geduldet wurde.
Dieses Jahr befanden sie sich im Bletchley Park in der Nähe von Milton Keynes, knapp fünfzig Kilometer nordöstlich von Oxford, und die Party nahm zusehends Fahrt auf. Hazeem Light, der jüngste der Anwesenden, der zum ersten Mal dabei war, machte sich im Kopf einen Vermerk, als sein Kollege Robin sich ein neues Glas einschenkte. Er war ungewöhnlich ausgelassen, seine Locken hingen ihm inzwischen schweißnass ins Gesicht. Robin trug heute ein neues T-Shirt, das wie immer Übergröße hatte. Darauf stand: Ihr seid doch nur neidisch, dass die leisen Stimmen nicht zu euch sprechen.
Zwölf Gläser indischer Gin waren es inzwischen, drei Gläser Wodka, neun Gläser Sake, einundzwanzig Flaschen belgisches Bier und vier Flaschen Cola. Drei der Colaflaschen gingen auf sein Konto, eine hatte Mikaela sich genehmigt, nachdem sie zum Schluss gekommen war, dass sie genug vom Alkohol hatte. Ihr pinker Kurzhaarschnitt und ihre Ohrringe mochten Rebellion suggerieren, doch sie war definitiv die Besonnenste unter den Anwesenden.
Obwohl nur die Hälfte der herangeschafften zwanzig Stühle besetzt war und zehn Gläser unberührt blieben, wurde die Stimmung immer ausgelassener. Auch Nerds konnten trinken, wenn der Anlass es erforderte. Die geladenen Gäste waren nicht gekommen, doch das war jedes Jahr so, und irgendwer musste die Flaschen schließlich leer trinken.
Während die anderen hitzig diskutierten, ob nun Predestination oder Looper der beste Zeitreisefilm aller Zeiten war, tat Hazeem das, was er immer tat, wenn er unter Menschen war. Er verhielt sich ruhig und vertrieb sich die Zeit, indem er in Gedanken die Vorgänge protokollierte. Lieber wäre er zu Hause geblieben, aber sie hatten darauf bestanden, dass er mitkam. Sie schienen ihn als fixen Teil der Gruppe zu betrachten. Es war das erste Mal, dass er so etwas wie Freunde hatte, und auch wenn ihn dieses Konzept immer noch verwirrte, glaubte er denen, die ihm versicherten, dass es sich um eine gute Sache handelte.
Als Ort dieses Treffens hatten sie sich für eine Baracke aus dem Zweiten Weltkrieg entschieden, in der in den letzten Kriegsjahren ein Team um den Mathematiker Alan Turing die Codes der Nazis geknackt hatte. Heute war die Stätte ein Museum, und der Block H, in dem sie sich befanden, enthielt neben der originalen Rechenmaschine Turings, die liebevoll »Bombe« genannt worden war, auch einen auf Elektronenröhren basierenden Computer, der den treffenden Namen »Colossus« trug.
Der Ort war nicht zufällig ausgewählt. Die Menschen, die hier über den Codes der Nazis gebrütet hatten, waren ihre direkten Vorgänger gewesen. Aus der Abteilung, für die diese Leute gearbeitet hatten, war später das britische Government Communications Headquarter hervorgegangen, besser unter der Abkürzung GCHQ bekannt, für das sie arbeiteten. Sie identifizierten sich mit Alan Turing und seinem Team, und nebenbei fanden sie hier die Ruhe, die sie benötigten. Natürlich hatten sie nach Ende der offiziellen Besuchszeiten einbrechen müssen, um die Geheimhaltung zu wahren.
Aus Nebengebäuden hatten sie zwanzig Stühle und zwei Tische herbeigeschafft, um die mitgebrachten Getränke darauf zu platzieren. Eine gute internationale Auswahl verschiedener Alkoholika, denn niemand wusste, aus welchem Land oder welchem Zeitalter die Gäste zu ihnen kommen würden. Es war genug da, um zwanzig Leute in gute Stimmung zu versetzen. Seit zwei Stunden saßen sie nun hier, bei verhängten Fenstern, um keinen Verdacht zu erregen.
Das Fehlen der Gäste war eine einkalkulierte Enttäuschung, die sich jedes Jahr wiederholte. Sie wussten, dass die Chance eines Erfolgs ziemlich gering war. Das war auch so gewesen, als der legendäre Physiker Stephen Hawking erstmals eine derartige Zeitreisendenparty veranstaltet hatte. Er hatte sich an einem willkürlich gewählten Ort zu einer willkürlich gewählten Zeit hingesetzt und gewartet. Erst nach dem Ende der »Party« hatte er die Einladung verschickt. So wollte er sicherstellen, dass nur Gäste kamen, die tatsächlich die Zukunft kannten und vorab wussten, dass er am Ende die Einladung verschicken würde. Seit dem Tod Hawkings wiederholten sie das Experiment jedes Jahr und stießen als Höhepunkt der Veranstaltung auf den großen Physiker an.
Hazeem war froh, dass nicht mehr Leute anwesend waren. Ein solcher Austausch, besonders mit Fremden, war für ihn immer noch eine große Herausforderung, auch wenn es schon besser geworden war. Die Kollegen kannten ihn und seine Bedürfnisse. Sie nahmen auf ihn Rücksicht, und das war mehr, als er irgendwo sonst erlebt hatte. Es verschaffte ihm eine innere Ruhe, die er bisher nicht gekannt hatte.
Doch diese Ruhe war gefährdet. Die Kollegen wussten nichts davon, aber das, woran er im Auftrag des Chefs im Alleingang arbeitete, hatte sich in eine unerwartete Richtung entwickelt. Es war womöglich die letzte Party dieser Art. Eine große Veränderung stand an, die Nachrichtendienste wie den ihren grundlegend infrage stellte.
Er hätte sich gern mit jemandem darüber ausgetauscht, aber er hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Er befürchtete, dass man ihn nicht verstehen würde. Es war ihm schon viel zu oft passiert.
Deshalb musste er ganz sichergehen, seine Informationen mussten wasserdicht sein. Dann würde er McLeary informieren, seinen Chef. Ihm vertraute er noch am ehesten.
Als Robin neben ihm mit seinem Stuhl umkippte, wurde Hazeem aus seinen Gedanken gerissen. Die anderen kriegten sich vor Lachen gar nicht mehr ein, und Robin lachte mit ihnen. Nachdem das Gelächter abgeebbt war, kamen die anderen überein, dass es an der Zeit war, die Party zu beenden und die Einladung vorzubereiten. Jemand holte einen Laptop hervor und ließ sich von den anderen diktieren.
Zeitreisender, Zukunftskenner, schrieben sie, wir wissen, dass es dich gibt. Beehre uns mit deiner Präsenz, und du wirst es nicht bereuen. Für dein Wohl ist gesorgt, und wir garantieren dir Verschwiegenheit. Fürchte dich nicht, wir können Geheimnisse bewahren, und niemand weiß so gut wie wir, wie gefährlich zu viel Wissen über die Zukunft sein kann. Sei also unbesorgt und leiste uns Gesellschaft!
Nach einigem Hin und Her und nachdem sich alle auf ein Losungswort geeinigt hatten, waren alle mit dem Text einverstanden. Anschließend räumten sie auf und packten ihre Sachen ein. Beim Verlassen der Baracke wollten sie die Nachricht absetzen.
Mikaela war gerade dabei, den völlig betrunkenen Robin reisefertig zu machen, als ein Donnern sie zusammenzucken ließ.
Sie hielten inne und lauschten. Das Geräusch schien von überallher gekommen zu sein, die ganze Baracke hatte gebebt. Da war es wieder, zweimal, dreimal. Die Blicke richteten sich zum Eingang. Nun war es klarer zu vernehmen gewesen: Jemand hämmerte an die Tür. Erneut wurde es still. Jemand drückte die Klinke nach unten, doch die Tür ging nicht auf. Der Riegel war davorgeschoben. Fünf, sechs, sieben, acht Schläge zählte Hazeem, während er im Kopf nach möglichen Erklärungen suchte. Die anderen waren wie erstarrt. Hazeem konnte Gesichter nicht besonders gut lesen, aber er glaubte zu sehen, dass sie Angst hatten. Wer war das? Niemand konnte wissen, dass sie hier waren.
»Sollen wir aufmachen?«, flüsterte Mikaela, doch keiner der Anwesenden rührte sich.
Nach dreiunddreißig Schlägen verstummte das Geräusch. Stille senkte sich über die Baracke mit den riesigen Rechenmaschinen.
Es war Mikaela, die als Erste aus ihrer Starre erwachte. Sie schlich zur Tür hin, lauschte kurz, bevor sie den Riegel zurückschob und öffnete. Doch draußen war nur die Dunkelheit des Parks.
Zögerlich wagten sie sich vor die Baracke, um sich umzusehen. Es war schließlich Hazeem, der hinter der Baracke den Toten fand. Er hatte die dunkle Haut eines Afrikaners, und in seiner Hand hielt er einen USB-Stick.
23. MÄRZ
Der erste Notruf ging um 18 Uhr ein, als sich gerade die Dämmerung über die Londoner Innenstadt senkte. Autos hatten ihre Scheinwerfer eingeschaltet, der Abendverkehr verstopfte die Straßen. Der Mann in der Notrufzentrale der Polizei, der den Anruf entgegennahm, stand kurz vor dem Ende seiner Schicht und glaubte zuerst an einen Irrtum, doch er leitete die Information pflichtschuldig weiter. Erst als wenige Minuten später zwei weitere Anrufer dasselbe berichteten, kam er zum Schluss, dass es sich nicht um eine Falschmeldung handelte.
Auf dem höchsten Wolkenkratzer der Stadt stand jemand über dem Abgrund und drohte zu springen. Die anderen Angaben variierten, manche sprachen von einem jungen Mann, manche von einem älteren, manche glaubten, er habe eine helle Hautfarbe, manche sprachen von dunkler.
Die Information gelangte über informelle Kanäle an die Nachrichtenredaktionen der Stadt. Erste Kameras wurden auf die Hochhausspitze gerichtet, wo sich in der einsetzenden Dunkelheit nicht viel erkennen ließ. Journalisten versuchten, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, wurden aber von den Sicherheitsleuten abgewiesen, die angaben, von nichts zu wissen, während im Haus längst Aufruhr herrschte, man den Zugang zum Dach abgesperrt hatte und diskutierte, wie zum Teufel der Kerl die Sicherheitssysteme hatte umgehen können und was man jetzt tun sollte, bis die Polizei eintraf.
Es war schließlich ein junger Blogger, der seine Drohne entlang der Glasfassade aufsteigen ließ und die ersten Bilder des Lebensmüden einfing. Das Video wurde mangels anderer Aufnahmen von allen Medien geteilt und ging schnell viral. Es zeigte neben der Tatsache, dass es sich wirklich um einen jungen, dunkelhäutigen Mann handelte, noch ein weiteres Detail, das bald rund um den Globus für Gesprächsstoff sorgen sollte. Der Mann schrie etwas über die Stadt hinaus. Das Sonderbare war, dass sich nicht sofort feststellen ließ, um welche Sprache es sich handelte. Schnell aufgestellte Richtmikrofone von Fernseh- und Radiostationen sollten Klarheit bringen, machten die Sache aber nur noch komplizierter. In den sozialen Medien lieferten sich die Teilnehmer heiße Diskussionen, und nur langsam kristallisierte sich heraus, dass eine der Sprachen Klingonisch gewesen war, während andere Behauptungen, dass es sich um Sanskrit, Esperanto oder Latein handelte, nicht bestätigt werden konnten.
Trotz der schlechten Qualität der Aufnahmen gab es auch nicht wenige Leute, die glaubten, die Nachricht verstanden zu haben, die der junge Mann in den Wind schrie. Manche behaupteten, dass es immer dieselben Worte waren, allerdings in verschiedenen Sprachen:
»Es muss aufhören.«
*
Jeff McLeary, der Leiter der wahrscheinlich meistunterschätzten Abteilung des britischen GCHQ, war müde und gereizt, als er sein Haus in Cheltenham betrat. Er hatte in seinem Büro Bescheid gegeben, dass er in der folgenden Stunde keine Anrufe entgegennehmen würde.
McLeary hatte Ärger wegen eines Mitarbeiters, der seit ein paar Tagen nicht zur Arbeit erschienen war. Derartiges wäre schon in einem normalen Job problematisch gewesen, doch in der Profession, in der McLeary tätig war, war es untragbar.
Er war in einer Welt aufgewachsen, in der Agenten lernten, wann sie beim Beschatten einer Person die Straßenseite wechseln mussten. Heute bestand der Großteil der Belegschaft von Geheimdiensten aus Computerspezialisten, die nie im Feld gearbeitet hatten und das auch nie tun würden. Es musste früher oder später schiefgehen.
Dieser Fall tat ihm besonders weh, denn McLeary hatte den jungen Mann gefördert. Doch seit einiger Zeit hatte er sich zunehmend sonderbar verhalten, seine Arbeit vernachlässigt.
Die Sache schien sich herumzusprechen, denn zuvor hatte seine Chefin angerufen und nach ihm gefragt. McLeary hatte lügen müssen. Er hatte verschwiegen, dass er nicht mehr in der Lage war, den Mann zu erreichen. Müde und frustriert hatte er nach dem Gespräch alle anstehenden Termine abgesagt und war nach Hause gefahren.
»Hallo Schatz«, sagte er, als er eintrat. Er stellte seine Tasche auf einen Stuhl am Esstisch, der im Zentrum der großen Wohnküche stand. Dort lag bereits das tägliche Kreuzworträtsel aus der Zeitung bereit, mit dem er sich nach langen Arbeitstagen beruhigte.
Heute aber galt seine Aufmerksamkeit seiner Frau. Nancy war gerade dabei, ein Bild aufzuhängen. Es handelte sich um eine abstrahierte Darstellung eines Mannes, der auf einem Lehnstuhl saß. Etwas Befremdliches war daran. Er glaubte, dieses Bild schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Sie hatte es letzte Woche bei einer Vernissage erworben. Nancy hielt das Gemälde hoch, ohne ihn anzusehen.
»Wie findest du das?«
Sie hatte das Sofa von der Wand weggeschoben und stand dahinter an der Wand. McLeary sah, dass sie schon einen Nagel in die Wand geschlagen hatte.
»Soll ich dir helfen?«, fragte er.
»Lass nur, ich habe es schon.« Sie hob das Bild noch ein Stück und hakte den Rahmen an einem unsichtbaren Band oder Kabel an der Rückseite ein. Sie wischte sich die Hände an einem Taschentuch ab. »Und?«
»Es wirkt gut hier«, sagte er und meinte es auch so. Das Bild ging ihm auf eine seltsame Art und Weise nahe, die er noch nicht einordnen konnte. Das gefiel ihm.
Er hatte von Kunst eigentlich keine Ahnung, es war Nancy, die sich dafür interessierte. Alles, was er wusste, hatte er von ihr gelernt. Anfangs hatten die Bilder, die sie ihm zeigte, sündteure moderne Werke von Künstlern mit Namen wie Bacon oder Richter, ihn verwirrt und befremdet. Er hatte sie abgelehnt, bis sie ihm klargemacht hatte, dass viele Bilder genau auf dieses Gefühl abzielten. Er machte nichts falsch. Als er dem entgegengehalten hatte, dass er diese Gefühle vielleicht gar nicht erleben wollte, und sie fragte, warum Menschen sich Bilder aufhängten, die sie befremdeten anstatt solcher, bei denen sie sich besser fühlten, hatte sie geschmunzelt und ihn gefragt, auf welche Weise er sich denn besser fühlen wollte.
Das hatte ihn sehr nachdenklich gemacht. Und er hatte festgestellt, dass in den widersprüchlichen Gefühlen, die ihre Bilder auslösten, etwas war, das ihm tatsächlich so etwas wie Genugtuung bereitete. Die Künstler, die diese Bilder geschaffen hatten, belogen ihn nicht. Sie zeigten ihm etwas Wahrhaftiges. Ihm wurde klar, wie selten er in seiner Lebenswelt mit Dingen konfrontiert war, für die sich das sagen ließ. Seither sah er Nancys Kunstvorlieben mit anderen Augen und beschwerte sich auch nicht mehr über die horrenden Preise, die sie dafür bezahlte – von ihrem Geld, verstand sich. Das Sammeln von Kunst hatte sich für sie von einer Leidenschaft zu einem Berufszweig gewandelt, den sie mit großem Geschick verfolgte. Er hütete sich deshalb auch, ein vorschnelles Urteil über das Bild abzugeben. Sie verlangte gar keine Zustimmung. Dafür war es viel zu früh, das wussten sie beide. Aber vorerst konnte das Bild hier hängen, er hatte nichts dagegen.
»Harter Tag?«, fragte sie ihn, nachdem sie gemeinsam die Couch zurück an ihren Platz geschoben hatten.
»Mhm«, stimmte er ihr zu.
Sie fragte nicht weiter nach, schon seit Jahren nicht mehr. Es genügte zu wissen, wie es ihm ging.
»Ich dachte es mir schon. So früh kommst du sonst nie. Möchtest du etwas essen?«
»Nein danke, nur eine Tasse Tee.«
»Ich mache uns welchen«, sagte sie und ging in die Küche.
Doch noch bevor das Teewasser kochte, hörte er ein dumpfes Dröhnen, das sich zum flatternden Fluggeräusch eines Hubschraubers verdichtete. Zugleich rief ihn jemand aus dem Chefbüro des GCHQ an. Wenn sein Wunsch nach Ruhe ignoriert wurde, musste es wichtig sein, deshalb hob er ab. Als er hörte, was die Person am anderen Ende zu sagen hatte, war er erst verwirrt.
»Sind Sie sicher, dass Sie bei mir an der richtigen Adresse sind?«
Doch als McLeary verstand, worum es ging, erkannte er den Ernst der Lage sofort. Er gab seiner Frau einen Kuss und ging hinunter auf die Straße, wo ihm ein Mann entgegenrannte, der ihn zu dem bereits gelandeten Eurocopter brachte, dessen Rotorblätter sich noch drehten.
McLeary hatte sich kaum angeschnallt, als der Pilot die Turbinen des Hubschraubers aufheulen ließ. Der Helikopter erhob sich in die Luft und flog nach Osten in Richtung London.
*
The Shard.
Man hatte ihm also die Wahrheit gesagt. McLeary reckte den Hals, um aus dem Fenster des Hubschraubers zu sehen. Neben ihm ragte der größte Wolkenkratzer Londons auf, eine spitz zulaufende Glaspyramide am Ufer der Themse, die sich, wie so viele Londoner Immobilien, im Besitz von Investoren aus Katar befand. Mehrere große Scheinwerfer waren nach oben gerichtet, doch ihr Licht verlor sich auf den dreihundert Metern bis zur Spitze. Die Joiner Street, eine Seitengasse der St. Thomas Street, hatte die Polizei bereits abgesperrt. Als die Beamten den Hubschrauber sahen, machten sie sofort Platz.
Nachdem McLeary ausgestiegen war, kam sofort Sandra Gardener, die Leiterin des GCHQ, auf ihn zu.
»Sie haben mich gerufen«, begann er.
Er wusste, dass Gardener sich nicht für Begrüßungen oder andere Höflichkeiten interessierte. Manchmal irritierte ihn ihre kühle Professionalität. Für ihn war sie eine Person ohne Privatleben. Niemand im Haus wusste, ob sie allein oder in einer Beziehung lebte oder was sie nach Feierabend machte. Manchmal ertappte er sich bei dem Gedanken, dass sie abends, wenn sie ihr streng geschnittenes Kostüm für den nächsten Tag zu zehn anderen identischen in den Schrank hängte, danach selbst hineinstieg und die Schranktür hinter sich schloss.
Diesmal war er dankbar für ihre Unaufgeregtheit.
Sie bedeutete ihm mitzukommen. »Niemand weiß, wie er hineingekommen ist. Es gibt dort eigentlich Überwachungskameras. Er kann nicht über die Besucherplattform gekommen sein, die Polizei versucht es noch herauszufinden. Es muss der Lastenaufzug gewesen sein, aber die Gebäudeverwaltung konnte den zuständigen Mitarbeiter nicht ausfindig machen.«
»Wer?«, fragte er.
»Wir hofften, dass Sie uns das sagen können. Es gibt den Verdacht, dass es jemand aus Ihrem Team ist.«
Gardeners Aufmerksamkeit wurde von einigen Männern in dunklen Kevlarwesten gefesselt, die gerade Helme aufsetzten. Sie trugen Sturmgewehre und schienen sich gerade für den Einsatz bereit zu machen. Sie gehörten zur SFO, einer speziell ausgebildeten Einheit, die für den Schusswaffeneinsatz geschult war.
»Was tun die hier?«, fragte Gardener einen von ihnen. »Sagen Sie Ihren Kollegen, sie sollen warten.«
Gardener begann mit dem Einsatzleiter zu diskutieren, der offenbar die Order hatte hineinzugehen. Der Bürgermeister hatte sich eingeschaltet, aus Angst, Unbeteiligte könnten verletzt werden. Gardener diskutierte hitzig, deshalb ließ McLeary sie stehen und scannte die Umgebung nach jemandem, der ihm Genaueres sagen konnte.
Als er zur Polizeiabsperrung blickte, standen dort zwei junge Mädchen, keine zwanzig Jahre alt, die in ihre Handys starrten. Sie unterhielten sich aufgeregt, ohne ihre Blicke von den Displays zu nehmen. Zu ihnen ging er hin.
»Ihr wisst nicht zufällig, was hier los ist?«, fragte er mit einem aufgesetzten jovialen Lächeln, das er in seiner Zeit im Außendienst oft benutzt hatte.
»Da steht einer oben und ruft etwas«, sagte eine von ihnen, die kurzes, gebleichtes Haar hatte.
Als ihre langhaarige Freundin sich immer noch nicht vom Handy losreißen konnte, versetzte sie ihr einen Stoß mit dem Ellbogen. »Mary!«
»Lass mich, Philippa!« Beide sahen McLeary verlegen an. Sie schienen trotz seiner Zivilkleidung zu spüren, dass er eine offizielle Position innehatte. McLeary hätte viel dafür gegeben herauszufinden, wie sich das verhindern ließ. Früher einmal hatte er unauffällig sein können, wenn er wollte. Irgendwann war ihm diese Fähigkeit verloren gegangen, unwiederbringlich, wie er befürchtete.
Er deutete auf die Handys. »Irgendwas Neues?«
Die Mädchen tauten schnell auf. »Nichts«, sagte Philippa. »Seit einer Stunde ruft er etwas, aber niemand versteht ihn.«
»Er ruft etwas?«, vergewisserte sich McLeary. Noch bestand Hoffnung, dachte McLeary. Vielleicht war es nur ein Verrückter.
»Hören Sie doch!«, forderte ihn Mary auf.
McLeary hielt inne und lauschte, doch er hörte nichts.
»Sie sagen, dass er nie zweimal die gleiche Sprache verwendet.«
McLeary stutzte. »Er ändert die Sprache?«
»Es ist verrückt«, sagte Philippa.
Sie hob ihr Handy, sodass McLeary es sehen konnte.
Es war die verwackelte Aufnahme einer Drohne, die an der Fassade höher stieg. Die Kamera zeigte spiegelndes Glas mit Fugen dazwischen, die schnell durch das Bild glitten. Dann kam die Spitze des Wolkenkratzers in Sicht, eine Stahlkonstruktion, die von den Londonern mit einem abgebrochenen Flaschenhals verglichen wurde. Ein passendes Bild, wie er zugeben musste, auch wenn das Stahlgebilde immer wieder spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung trug.
Und da sah er, was sich gerade über ihrem Kopf abspielte: Ein schwarz gekleideter Mann stand auf einem Geländer. Das Gesicht ließ sich nicht erkennen.
Aus meinem Team? Wer könnte das sein?
Philippa drehte den Ton lauter, und tatsächlich war da etwas hinter dem Brummen der Rotoren, das sich wie eine menschliche Stimme anhörte.
»Das gerade ist Hoch-Valyrisch.«
»Hoch-Valyrisch?«
»Kennen Sie Game of Thrones? Es gibt auch jemanden, der sagt, dass Klingonisch dabei war.«
»Klingonisch?«, fragte McLeary ungläubig. »So wie aus Star Trek?«
Die Mädchen grinsten. »Sie kennen sich ja doch nicht so schlecht aus.«
Star Trek kannte er. Den ersten Film mit William Shatner hatte er einmal sehr gemocht. Er verstand aber nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hatte.
»Und was ruft er?«, wollte McLeary wissen.
Darauf wussten die Mädchen keine Antwort. Bedrückt und voller dunkler Vorahnungen kehrte McLeary zu Gardener zurück, die inzwischen mit dem Einsatzteam fertig geworden zu sein schien. Sie hatten sich jedenfalls wieder zurückgezogen und ihre Waffen gesichert.
»Können wir rein?«, fragte McLeary.
»Gleich. Noch etwas anderes, wir konnten es verifizieren. Der Mann stammt tatsächlich aus Ihrer Abteilung. Sein Name ist Hazeem Light.«
Als McLeary den Namen hörte, zuckte er zusammen. Er hätte von selbst darauf kommen müssen. Es war, als hätte ein Teil von ihm das Offensichtliche nicht wahrhaben wollen.
»Sie müssen mit ihm reden«, sagte sie.
»Ich bin bereit«, sagte er, obwohl dem nicht so war.
*
McLeary spürte den kalten Luftzug, als er ins Freie trat. Er befand sich im 75. Stock, am höchsten Punkt der Aussichtsplattform. Über ihm war nur noch ein Turm aus Stahl, der von hier oben viel größer wirkte als aus der Ferne. Als er hochblickte und dort Wolken vor der Scheibe des Vollmonds vorbeiziehen sah, überkam ihn ein kurzer Schwindel.
Und nun hörte er auch den Mann. Seine schrille Stimme war leise durch den Wind zu vernehmen.
Das Einsatzteam war mit nach oben gekommen, hielt sich nun aber im verglasten Bereich der Aussichtsplattform auf, um den Lebensmüden nicht zu irritieren. Bis jetzt hatte sich ihm noch niemand genähert.
McLeary fröstelte. Das war nicht nur der Wind, er war nervöser als sonst. Er dachte daran, dass er alt geworden war. Zu gerne hätte er jemand anderen geschickt, aber er konnte sich Gardener gegenüber keine Blöße geben. Das hier musste er selbst lösen. Vielleicht konnte er so Schlimmeres verhindern. Er stieg eine weiße Metalltreppe hoch und entfernte sich von dem massiven Mauerwerk des Turms. Die Luft pfiff durch das Gestänge. Die Stadt lag im Halbdunkel unter ihm, alles sah klein und eben aus, wie Spielzeug. Das letzte Abendrot war inzwischen verschwunden.
Und da sah er ihn. Er hatte ihm den Rücken zugewandt und stand auf einem Geländer. Trotzdem erkannte McLeary ihn sofort. Es gab keinen Zweifel, Gardener hatte recht gehabt.
Light hatte inzwischen bemerkt, dass jemand hinter ihm stand, und aufgehört, seine Sprüche in den Wind zu schreien. Er blickte sich umständlich um und umklammerte den Stahlträger neben sich dabei mit beiden Händen.
»Light, was tun Sie hier?«, fragte McLeary. Er senkte in einem unbedachten Moment den Blick, und sofort war ihm, als würde sich alles um ihn zu drehen beginnen. Er musste kurz die Augen schließen, bis er sich wieder im Griff hatte.
»Erkennen Sie mich? Ich bin’s, McLeary.«
Light nickte nach einer Pause.
»Kommen Sie doch runter, damit wir uns unterhalten können. Okay?«
Doch Light bewegte sich nicht. McLeary konnte sehen, dass er zitterte.
»Was immer es ist, wir können darüber reden. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen.« McLeary legte all seine Überzeugungskraft in diese Worte.
»Es muss aufhören«, sagte Light plötzlich.
McLeary stutzte. »Was muss aufhören?«, fragte er dann. Doch er sah Light an, dass dieser nicht vorhatte, sich zu erklären. Light wandte den Blick wieder hinaus in die Stadt. »Wir können über alles reden. Kommen Sie zuerst herunter.«
McLeary machte einen Schritt auf Light zu, der sich wieder zu ihm umwandte und den Pfeiler noch verzweifelter umklammerte.
»Sie wollen aussteigen? In Ordnung. Kein Problem, ich verstehe das.«
»Es muss aufhören!«, wiederholte Light.
»Was? Hat es mit unserer Arbeit zu tun?« McLeary zögerte. »Aber Sie verstehen doch, dass wir Menschen Gutes damit tun.«
Es war ihm herausgerutscht. McLeary sah sofort, dass es ein Fehler gewesen war. Light sah nach unten, als prüfte er, wie sich der Sturz wohl anfühlen würde.
»Okay, okay. Wir hören auf. Wenn Sie das wollen, hören wir auf. Sie müssen nur von diesem Geländer heruntersteigen.«
McLeary spürte die Präsenz von Personen hinter sich, wagte aber nicht, sich umzublicken.
Bleibt verdammt noch mal, wo ihr seid!
Doch Light wirkte plötzlich ruhiger als zuvor. »Alles wird gut«, sagte McLeary. »Wir kriegen das hin.«
»Es wird aufhören«, sagte Light, und es klang nun nicht mehr wie eine Bitte.
Er löste eine Hand vom Träger und fasste in seine Tasche. Der Geheimdienstler in McLeary dachte an eine Waffe, und trat einen Schritt zurück. Er brauchte einen Moment, bis er seinen Fehler einsah. Light hatte etwas in seiner Hand, das die Größe eines Mobiltelefons hatte, und plötzlich gingen die Lichter aus.
Dunkelheit umgab McLeary, die so durchdringend war, dass er unwillkürlich blinzelte, um sicherzugehen, dass er nicht sein Augenlicht verloren hatte. Einige Sekunden lang war es totenstill, dann begannen die Sirenen zu heulen. Aus der Stadt war plötzlich vereinzeltes Krachen zu hören. Jemand hupte.
McLeary versuchte vergeblich, im Dunkeln Light zu erkennen. Hinter sich hörte er Stiefelgeräusche, die sich näherten. Er musste eine Entscheidung treffen.
McLeary tastete sich eilig zum Geländer vor, doch aus der Nähe konnte er erkennen, dass Light nicht mehr da war. Aus der Tiefe hörte er Schreie. Und da erkannte McLeary, dass mit der Stadt etwas nicht stimmte.
Erst als er am Geländer stand, konnte McLeary das ganze Ausmaß der Veränderung erkennen. London lag in vollständiger Dunkelheit.
*
Pawel Peskin, ein Mann, den die meisten Leute nur als den »Händler« kannten, saß in seiner zu großen Hotelsuite im Zentrum der nigerianischen Metropole Lagos neben seinen ungeöffneten Koffern und konnte sich nicht beruhigen. Die Suite war klimatisiert wie ein Eisschrank, und er fror in seinem durchgeschwitzten Anzug, der für die Temperaturen in den Straßen dieser Stadt viel zu warm gewesen war. Hier in diesem Haus schien man eine überdimensionierte Klimaanlage als Statussymbol zu betrachten. Große Teile von Lagos lebten in Armut, doch es gab hier, wie in jeder Stadt, auch märchenhaften Luxus. In der Tiefgarage hatte er mehrere Lamborghinis und einen McLaren gesehen, in der Lobby war vorhin eine Influencerin mit eigenem Beleuchter-Team dabei gewesen, ein Video zu drehen.
Pawel hätte bei der Rezeption anrufen und eine Szene machen können, doch er war zu gefesselt von den Fernsehbildern aus London. Er musste an das Gespräch denken, das er zuvor auf der Fahrt hierher in einer Limousine des Hotels mit einem Mitarbeiter des GCHQ geführt hatte. Er hatte zum wiederholten Mal verlangt, zu jemandem aus der Führungsebene durchgestellt zu werden, doch man hatte ihn abblitzen lassen. Ein weiteres gescheitertes Verkaufsgespräch. Sie konnten den Wert der Ware, die er ihnen anbot, einfach nicht verstehen. Und das, was in London passierte, zeigte ihm, dass seine Zeit knapp wurde.
Er war es nicht gewohnt, abgewiesen zu werden. Als er sich vor drei Jahren nach einer missglückten Karriere als professioneller Schachspieler selbstständig gemacht hatte, waren Gespräche wie dieses öfter vorgekommen. Doch er war hartnäckig geblieben, hatte geduldig viele Hundert Stunden auf versteckten Marktplätzen im Netz verbracht, dubiosen Plattformen, die man nur auf Empfehlung hin betreten durfte und wo man alles nur Erdenkliche kaufen konnte, was in der analogen Welt durch Gesetze oder andere Hindernisse unverkäuflich war. Dinge, die Pawel manchmal mit Abscheu erfüllten, mit denen er aber dennoch handelte, um Kontakte zu knüpfen und sich Glaubwürdigkeit zu erarbeiten.
Seine Bemühungen hatten gefruchtet, und er war immer öfter den einen Schritt schneller als die anderen gewesen. Er hatte sich Ware gesichert, die mit Gold aufzuwiegen gewesen wäre, wenn sie denn ein Gewicht gehabt hätte. In gewissem Sinn handelte es sich um nichts, für das er in dem einen Fall dreißigtausend Euro und im anderen das Zehnfache bezahlt hatte: um Lücken. Er dealte mit Softwarefehlern – Sicherheitslücken in Betriebssystemen von Computern und Handys oder Software von Industrieanlagen oder beliebten Apps. Meist ging es um Zero Day Exploits. Das Zero stand für die Zeit seit dem Bekanntwerden. Ein Zero Day war eine Sicherheitslücke, von der noch niemand wusste. Das bedeutete, dass sie noch keine offizielle CVE-Nummer zugewiesen bekommen hatte und niemand an ihrer Korrektur arbeitete. Das Wort »Exploit« stand streng genommen für eine kriminelle Methode zur Ausnutzung dieser Sicherheitslücke.
Das machte den Wert dieser Ware aus, denn Sicherheitslücken hatten eine für Kriminelle und Nachrichtendienste enorm nützliche Eigenschaft: Mit ihrer Hilfe ließen sich Tools entwickeln, die es erlaubten, elektronische Geräte unter Kontrolle zu bekommen, allen voran Mobiltelefone. Sie lieferten Kamerabild, Ton, Standort und die gesamte Kommunikation einer Person. Alles, was man brauchte, um jemanden zu überwachen. Diese Methode war inzwischen international Standard und so effektiv, dass kaum noch jemand Ziele auf klassische Art und Weise beschatten musste. Die Krux dabei: Um ein solches Tool zu programmieren, benötigte man nicht nur eine, sondern eine ganze Kette von Zero-Day-Exploits.
Für Sicherheitslücken gab es folglich einen volatilen Markt, der zum Großteil im sogenannten Darknet angesiedelt war – ein Modeausdruck, den nur Ahnungslose verwendeten. Die Interessenten waren einerseits Kriminelle, kommerzielle Anbieter von Überwachungssoftware, aber auch staatliche Dienste. Dass immer öfter Beamte mit Betrügern um die Wette boten, entbehrte nicht der Ironie. Seit mehr und mehr Leute ihre Nachrichten verschlüsselten, waren Sicherheitslücken noch wertvoller geworden. Genau genommen hatte er eine Art geografisches Wissen gekauft, die Positionen von Brüchen und Verwerfungen im Mantel, durch die man in die Tiefe steigen konnte.
Pawel ließ den Blick vom Fernseher los und betrachtete das Schachbrett vor ihm. Es handelte sich um ein afrikanisches Brett aus hellem und dunklem Holz, Letzteres vermutlich afrikanisches Teak. Die Figuren waren von Hand gemacht und sahen aus wie afrikanische Gottheiten. Sie waren zu einem komplizierten Bild arrangiert, das er bis jetzt nicht zur Gänze zu durchschauen vermocht hatte.
Er hatte extra vorab betont, dass er ein Schachbrett auf seinem Zimmer haben wollte, doch als er das Zimmer bezogen hatte, hatte das Brett gefehlt. Nachdem er sich beim Management darüber beschwert hatte, schien jemand auf einem lokalen Markt das erstbeste Brett erstanden zu haben.
Bald wollte er über seinen nächsten Zug entscheiden, doch noch war er sich nicht ganz sicher, welcher der richtige war. Sein Gegenspieler in den USA wartete bestimmt schon seit Tagen auf seine Mail. Die Fernschach-Partie, die sie führten, zog sich bereits über zwei Monate.
Im Grunde war es so, wie Kasparow es in seinem Buch behauptete: Das Leben imitiert Schach. Wer taktisch denken kann und hartnäckig ist, findet für alles eine Lösung.
Sein neues Geschäft hatte sich gut entwickelt, bis Pawel vor etwas mehr als einem Jahr einen Tipp bekommen hatte, nur ein Gerücht, dem er aber nachgegangen war. Von einer Sicherheitslücke, größer als alle, mit denen er bisher zu tun gehabt hatte. Erst nach und nach hatte er herausgefunden, dass es sich nicht um einen Softwarebug handelte, sondern um etwas völlig anderes. Er hatte sofort die Bedeutung für sein Geschäftsfeld verstanden. Und er hatte verstanden, dass er nicht viel Zeit hatte. Wenn es nicht bereits zu spät war.
Eigentlich hätte er zufrieden sein können, er hatte genug Geld auf der Seite, um bis ans Ende seiner Tage ein Leben zu führen, das andere als luxuriös wahrnehmen würden. Pawels Problem war, dass er sich inzwischen an seinen neuen Lebensstil gewöhnt hatte. Das Geld von dem letzten großen Deal schmolz erschreckend schnell dahin.
Pawel war nicht der Typ, der so etwas auf sich sitzen lassen konnte. Er ahnte, wenn er jetzt nachgab, würde er wieder dort landen, wo er hergekommen war. Nicht sofort zwar, doch mit der Zeit. Und was dann? War es nicht klüger, in Bewegung zu bleiben?
Er musste an seinen Vater denken. Wie sie mit ihm umgegangen waren. Sein Vater hatte sich immer viel zu viel gefallen lassen. Pawel hatte sich damals bei der Beerdigung, als sie seinen Sarg in ein einfaches Grab weitab seiner Heimat hinabgelassen hatten, geschworen, es selbst nie so weit kommen zu lassen. In Wahrheit war er auf das Gelingen dieses Deals mehr angewiesen, als ihm lieb war. Es musste eine Möglichkeit geben, Bewegung in diese Sache zu bringen. Viele glaubten nicht an das Gerücht, aber Pawel wusste schon seit Längerem, dass etwas dran war. Das Zweifeln der anderen war ein Vorteil, den er für sich nutzen konnte, wenn es ihm nur gelang, mehr in Erfahrung zu bringen.
Diesen Vorsprung büßte er gerade ein, das bewiesen ihm die Bilder aus dem Fernsehen. Jemand hatte offenbar die Sicherheitssysteme der Stromversorgung Londons geknackt. Wie das gelungen war, darüber rätselte man in Medien ebenso wie in den geschlossenen Foren des Netzes. Doch Pawel verstand, womit er es zu tun hatte: Sein anvisierter Deal würde platzen. Die Sicherheitslücken, die er feilbot, würde bald niemand mehr benötigen. Es war nur eine Frage von Stunden, bis jemand da draußen den Zusammenhang herstellen würde.
Die Wahrheit lautete: Die Ware, die er dem GCHQ und anderen angeboten hatte, befand sich noch nicht in seinem Besitz.
Im selben Moment brummte sein Mobiltelefon.
Wir haben gefunden, wonach Sie suchen, stand dort. Es ist der Wahrsager, wie wir vermutet haben.
*
»Ein Virus?«, wiederholte McLeary. »Das ergibt doch keinen Sinn!«
Er befand sich mit Gardener in der Beddington Substation, einem der großen Umspannwerke Londons. Bei der Herfahrt hatten sie ein schier unendliches Netz von Stromleitungen und futuristisch aussehenden Spulen gesehen. Von hier hatte das Unglück seinen Ausgang genommen.
Es war inzwischen fast Mitternacht. Die letzten Stunden hatten Gardeners Leute den Abtransport der Leiche in die Wege geleitet, während er nur hilflos hatte zusehen können. Sie hatte einige Fäden bei den Londoner Behörden gezogen, die hoffentlich halfen, den Ball möglichst flach zu halten. Ob es etwas nützte, ließ sich noch nicht sagen.
Ein Mitarbeiter hatte ihnen auf seinem Rechner ein paar Codezeilen gezeigt, nun standen sie vor einem großen Steuerungsgerät, das im Wesentlichen die Funktion eines Leistungsschutzschalters hatte, der das Netz vor Überlastung schützen sollte. Im Normalbetrieb durfte der natürlich nicht aktiviert werden. Seiner Überzeugung nach musste jemand ins System eingedrungen sein und den Schadcode injiziert haben. Das Wort »Schadcode« wäre McLeary deutlich lieber gewesen, es klang technisch, wie etwas, womit sich normale Leute nicht beschäftigen mussten. Er ahnte aber schon jetzt, dass die Medien die Diktion vom »Virus« nur allzu bereitwillig aufgreifen würden.
Wie der Schadcode dorthin gelangt war, ließ sich allerdings nicht schlüssig erklären. Das Gerät sei mit einer 256-Bit-Verschlüsselung geschützt, erklärte der Mann. McLeary wusste, dass das der Standard war, mit dem das Königreich auch seine Staatsgeheimnisse schützte.
Den Mitarbeiter hatten sie inzwischen fortgeschickt. Nun starrten sie das Steuerungsgerät an, als ob es ihnen irgendetwas Wichtiges sagen würde, wenn sie nur lange genug warteten.
»Es gibt bestimmt eine andere Erklärung«, sagte McLeary. »Sie wissen, womit wir uns beschäftigen. Er hatte weder das Know-how noch die Möglichkeiten.«
»Es muss Light gewesen sein«, beharrte Gardener.
»Aber wie? Sie haben den Mann gehört.«
»Der Zeitpunkt des Stromausfalls passt genau. Sagten Sie nicht, er hatte etwas in der Hand, bevor er sprang? Das Virus hatte den Zweck, eine Hintertür zu installieren, die auf Knopfdruck einen Fehler im System generiert, der für eine Überlastung sorgt.«
Wenn sie recht hatte, dann hatte Light das alles mit langer Hand geplant. McLeary versuchte zu begreifen, was das bedeutete. Wie war es Light gelungen, das System zu knacken?
Es muss aufhören.
»Wie viele Leute wissen von Light?«, fragte Gardener. »Dass er für Sie arbeitete?«
Er erschrak, als sie ihn so offen darauf ansprach. Sie hatte es leise gesagt, aber McLeary hatte trotzdem Angst, dass jemand mitgehört haben könnte.
»Ich kann Ihnen die Namen geben. Light hat dieselbe Verschwiegenheitserklärung unterschrieben wie alle anderen in meinem Team. Meines Wissens hat er sich daran gehalten.«
Gardeners Schweigen zeigte ihm, dass das nicht genügte. Dass Light sich schon eine ganze Weile nicht mehr an die Regeln gehalten hatte, war inzwischen offenkundig.
»Wie steht es mit den Medien?«, wollte er wissen. »Was schreiben sie?«
»Noch tappen sie im Dunkeln. Sie haben das, was offiziell bekannt ist, und rätseln rum, was es mit den Sprachen auf sich hat. Das Klingonische verwirrt sie.«
Zumindest etwas. Sie kannten Light nicht, die Art, wie er dachte.
»Jemand wird dahinterkommen, dass Light etwas damit zu tun hat«, beharrte sie.
»Nicht, wenn wir schnell und richtig handeln.«
»Es gibt da noch etwas, McLeary. Noch hat niemand es bemerkt, aber das wird sich bald ändern. Light hat eine Nachricht hinterlassen.«
24. MÄRZ
Stromausfall terroristischer Akt?
London. Nach dem größten Stromausfall in der britischen Hauptstadt seit dem Zweiten Weltkrieg und der Wiederherstellung der Elektrizitätsversorgung läuft die Suche nach dem Auslöser auf Hochtouren. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, verdichten sich die Anzeichen darauf, dass es sich nicht um einen technischen Defekt, sondern um einen Sabotageakt handelt. Medienberichten zufolge, die sich auf ungenannte Insiderquellen stützen, wurde in der Steuerungselektronik von mehreren Umspannwerken der Hauptstadt Schadcode gefunden. Sogar von einem Virus ist die Rede. Behörden wollen einen Terrorakt noch nicht bestätigen, zudem hat sich bislang niemand zu der Tat bekannt. Allerdings ist der Zeitpunkt des Selbstmordes eines jungen Mannes auffällig, der sich vor wenigen Stunden vom Shard stürzte, dem höchsten Hochhaus der Londoner Skyline. Berichten zufolge soll es sich um einen 26-jährigen Autisten namens Hazeem Light handeln. Die Behörden halten sich diesbezüglich nach wie vor bedeckt. Ob er hinter dem Stromausfall steckt und es sich in Wirklichkeit um einen terroristischen Akt handelt, lässt sich derzeit nicht bestätigen, zumal bislang kein Abschiedsbrief bekannt ist, der genaueren Aufschluss geben könnte. (red)
*
Magnus Konrad, Chefredakteur der Tageszeitung »Weltblick«, betrat den Besprechungsraum und fand sein Team bereits zur Morgenbesprechung versammelt. Die Leute sahen müde aus, doch Konrad war gut gelaunt. Sie hatten gestern wegen der Ereignisse in London kurzfristig noch die Titelseite umgebaut und dafür sogar die Druckerpresse ein paar Minuten angehalten. Doch auf diese Weise hatten sie heute als eines der wenigen heimischen Medien die Geschichte des sonderbaren Stromausfalls druckfrisch im Blatt. Konrad war also guter Dinge.
»Schönen Morgen allerseits«, begrüßte er seine Leute und setzte sich. »Ein Update, bitte. Marc.«
Marc war vom Team für Aktuelles und hatte auf allen möglichen digitalen und analogen Kanälen versucht, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Er war ein junger, energischer Typ mit Hornbrille und schwarzem T-Shirt, der wie so viele beim Weltblick von Natur aus von ständiger Unruhe erfüllt war.
»Nach wie vor scheint es sich auf London zu konzentrieren«, begann Marc. »Meldungen aus anderen Städten ließen sich nicht bestätigen. In London war auch ein Fußballspiel von Chelsea betroffen.«
»Die Armen«, sagte jemand. »Das war doch ein Europacupspiel, nicht wahr?«
»Die Londoner Innenstadt scheint das Epizentrum zu sein«, sagte Marc, ohne auf die Frage einzugehen.
»Epizentrum«, wiederholte Konrad, »merken, das ist gut. Hat schon jemand unseren Korrespondenten erreicht? Wissen wir schon etwas über diesen Selbstmörder?«
Sie alle hatten die Geschichte des Mannes gehört, der vom Shard gesprungen war, und die Spekulationen, er könnte etwas mit dem Stromausfall zu tun haben.
Ralf Thielemann räusperte sich und reckte seine große Gestalt. Er war einer der langgedienten Journalisten im Haus, ein griesgrämiger, in letzter Zeit oft müde wirkender Innenpolitikschreiber, der ab und zu auch Theaterkritiken zum Besten gab. Sein ständiger Begleiter war ein Seidenschal, den er über dem Sakko trug.
»Noch nicht, aber ich habe mit einem Freund telefoniert«, sagte er und seufzte, als wäre das besonders schwierig gewesen. »Dort weiß auch noch niemand etwas Konkretes.«
Thielemann gab Marc ein Zeichen, der daraufhin die Meldung einer englischen Zeitung auf den Bildschirm projizierte.
»Klingonisch …«, murmelte jemand kopfschüttelnd.
»Ein einzelner Mann? Wie kommen die darauf?«, fragte Konrad, dem die Sache entschieden zu spekulativ war.
»Die englischen Medien zitieren irgendwelche anonymen Insider. Und es sieht so aus, als wäre der Strom ziemlich genau in dem Moment ausgefallen, als er sprang.«
Konrads Puls beschleunigte sich. Er hatte sich nicht getäuscht, das war eine Geschichte.
»Weiß sonst jemand etwas darüber? Irgendwelche Ideen?«
Alle wichen seinem Blick aus, nur die Berlinerin Line Berg tat so, als würde sie alles nichts angehen. Sie trug den unvermeidlichen Rollkragenpullover, der an ihr aber so elegant wirkte, dass sie gut und gern mit Thielemann in die Oper hätte gehen können. Ihre Aufmerksamkeit galt ihrem Handy. Sie wirkte noch gelangweilter als sonst.
»Line, irgendwelche Anmerkungen? Du hast doch auch in London gearbeitet.«
Ihr Blick blieb auf das Mobiltelefon fixiert. Er konnte nicht sagen, ob sie ihn überhaupt gehört hatte.
»Komm schon, streng dich ein wenig an!«, forderte er.
Sie seufzte hörbar und ließ das Handy sinken. »Es ist noch zu früh«, sagte sie.
»Zu früh für was?« Er spürte, dass da noch mehr war. »Raus damit, ich will es hören.«
»Da war diese Mail«, sagte sie. »Habt ihr die gesehen?«
Niemand schien zu wissen, wovon sie sprach.
»Sie ging kurz vor dem Stromausfall in London ein, an die Redaktionsadresse.«
»Ich weiß nichts von einer Mail«, sagte Konrad. »Was hat es damit auf sich?«
»Sie enthält keinen Text, nur irgendwelche Zahlen. Ich dachte, ihr wisst vielleicht etwas.«
»Glaubst du, das ist wichtig?«
»Lässt sich schwer sagen. Ist noch zu früh, wenn du mich fragst.«
Line lächelte ihn an und legte kokett den Kopf schief. Du bist der Chef, sagte dieses Lächeln. Thielemann kicherte hörbar. Er machte kein Geheimnis daraus, was er von Line Berg hielt. Ihre Respektlosigkeit betrachtete er als Zeichen für mangelnde Professionalität, was natürlich Unsinn war.
Konrad schluckte den Ärger über ihre unverschämte Art hinunter. Er konnte sich nicht jedes Mal über sie aufregen, aber wusste auch nicht, was er mit ihr anfangen sollte. Seit dem Skandal, den sie verursacht hatte, schien sie überhaupt nichts mehr zu interessieren. Nicht, dass er kein Verständnis hatte. Andere hätten den Job nach einem derartigen Fauxpas vermutlich an den Nagel gehängt.
»Ich will, dass jemand unseren Korrespondenten erreicht. Ralf, sag deinem Freund, er soll ihn aus dem Bett holen, wenn nötig. Ich will wissen, warum er es getan hat. Und ich will, dass die Leute es bei uns zuerst lesen.«
*
McLeary wies den Fahrer an, zur Zentrale des GCHQ zu fahren. Noch in der Nacht war er zurück nach Cheltenham gebracht worden, diesmal ohne Hubschrauber, sondern mit einem Wagen inklusive Chauffeur, den Gardener ihm zur Verfügung gestellt hatte – ›bis diese Sache erledigt ist‹, so ihre Worte.
Sie hatte ihn extra noch mal zur Eile gedrängt. Gardener hatte sich vor dem Premier verantworten müssen und war außer sich. Auch die höchste politische Ebene des Landes war aufgrund der kursierenden Gerüchte nervös. Inzwischen hatten sie erfahren, dass Light per E-Mail eine Art Bekennerbrief verschickt hatte, der aber nur Zahlen enthielt, die niemand verstand. Typisch Hazeem. Auch wenn noch niemand etwas damit anfangen konnte, war nicht auszuschließen, dass sich darin ein Hinweis versteckte, der McLeary oder seinen Arbeitgeber in Bedrängnis bringen könnte.
Gerade war er in Lights Wohnung gewesen, für die es beim GCHQ einen Zweitschlüssel für Notfälle gab. Die Wohnung wurde ihm zur Verfügung gestellt und war eigentlich zu groß für eine einzelne Person. Sie war kahl, bis auf das Schlafzimmer, dessen Einrichtung etwas von einem Kinderzimmer hatte. Es wirkte, als wäre eine Familie ausgezogen und hätte nur das Kind mit seinen Sachen zurückgelassen. McLeary hatte nur einen kurzen Blick hineingeworfen und dann ein Spezialistenteam an die Arbeit gelassen.
Der Wagen hielt vor dem Eingang der Zentrale, die etwa 7000 Angestellte des GCHQ beherbergte, dem berühmten »Donut«. Das Gebäude war kreisrund, mit einem Garten in der Mitte. Damit ähnelte es anderen Gebäuden, die auf Geheimhaltung bedacht waren, darunter das Pentagon der US-Regierung oder die Apple-Zentrale im kalifornischen Silicon Valley. Alle bemühten sich, ein sicheres Inneres zu schaffen, mit möglichst wenig Angriffsfläche nach außen. Die runde Form war eine Konsequenz davon, einzellige Lebewesen folgten derselben Logik.
Beim Eintreten bemerkte er, wie die anderen Mitarbeiter ihren Blick abwandten, sobald sie ihn erkannten. Jeder schien von seinen Problemen zu wissen, und niemand schien scharf auf ein Gespräch mit ihm. McLeary war das nur recht.
Er hielt direkt auf die Abteilung zu, der er vorstand. Man konnte sie nicht verfehlen: Vor dem Eingang stand eine riesige gelbe Statue aus Stahl. Sie stellte Bumblebee dar, einen der Charaktere aus Transformers, bekannt durch die Filme aus den Nullerjahren und den Zeichentrickfilm von 1986 mit Orson Welles in seiner letzten Rolle als Sprecher. McLeary wollte diesmal darauf verzichten, sich über die Statue aufzuregen. Er hatte dem Team mehrmals verboten, sie draußen aufzustellen. Das erzeugte nur unnötig Aufmerksamkeit.
Doch die Statue hätte drinnen keinen Platz gehabt. Vor ihr stand ein Aufsteller mit einem Werbebanner des ersten Star-Wars-Films. Seine Leute hatten das Teil im Internet auf Kosten des GCHQ ersteigert. Er musste seine nicht mehr ganz schlanke Figur vorsichtig an einem mannshohen Stapel alter VHS-Kassetten vorbeischieben, um ins Innere des Büros zu gelangen, das etwas aufgeräumter aussah. Hier konnte man tatsächlich den Eindruck bekommen, dass auch gearbeitet wurde, selbst wenn die Stapel mit Gesellschaftsspielen und Rätselbüchern einen Außenstehenden hätten verwirren können. Derzeit schien Schach wieder das Spiel der Stunde zu sein, wie ein Brett mit laufender Partie auf einem der Schreibtische bewies. McLeary kannte sich mit Schach nicht so gut aus, aber es sah ein wenig so aus, als ob Weiß auf der Gewinnerstraße wäre.
Die Leute hier waren keine klassischen Geheimdienstmitarbeiter. Einer war Angestellter in einer IT-Sicherheitsfirma gewesen und hatte sich dabei erwischen lassen, wie er aus Langeweile die Kunden ausspionierte, einer hatte Videospiele programmiert. Und dann war da noch Light gewesen.
Der Fokus der Abteilung, der McLeary vorstand, war eigentlich ganz einfach. Er lautete: Wettbewerbe. Wettkämpfe aller Art spielten seit vielen Jahren eine Schlüsselrolle beim Recruiting der Nachrichtendienste in aller Welt. Agenten liefen nicht mehr mit Hut und Trenchcoat durch regnerische Gassen. Inzwischen drehte sich alles um Daten, Computer und manchmal auch schlicht um Mathematik. Seitdem ein Team aus Mathematikern um Alan Turing mitentscheidend dazu beigetragen hatte, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg den Sieg davontrugen, dank der Weitsicht von Winston Churchill, der ihnen unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt hatte, hatten Teams aus Nerds und Sonderlingen immer größere Bedeutung in der Welt der Nachrichtendienste erlangt.
Und solche Leute sprach man nicht mit klassischen Stellenanzeigen an – sicheres Gehalt … verantwortungsvolle Position … Dienst am Vaterland. Diese Leute tickten anders, sie waren daran gewöhnt, von der Welt missverstanden zu werden, und schlossen sich zu Communitys zusammen, in denen sie unter ihresgleichen waren und wo sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln konnten.
Diese Fähigkeiten waren der Schlüssel. Manche dieser Leute nahmen spaßeshalber an Rätselwettbewerben teil. Deshalb schrieben Geheimdienste wie der GCHQ Wettbewerbe aus oder verschafften sich Zugang zu bestehenden. Im Zweiten Weltkrieg waren es noch Kreuzworträtsel gewesen, die darüber entschieden, wer Teil der später kriegsentscheidenden Forschungsgruppe rund um Turing werden sollte. Heute veröffentlichte der GCHQ in Form der von McLeary geführten Abteilung immer wieder Rätsel. Inzwischen war es Tradition, dass der GCHQ regelmäßig Aufgaben publizierte, unter anderem auf Twitter. Es gab sogar zwei offizielle Rätselbücher, in denen die Aufgaben gesammelt herausgegeben wurden und die zu Bestsellern geworden waren.
Die Führung des GCHQ spielte die Aktivitäten von McLearys Abteilung herunter. Die Bücher seien eine PR-Aktion, eher dazu da, Sympathien zu werben, als wirklich Rekruten aufzuspüren. Die kreativen Köpfe hinter den Rätseln machten das im Übrigen allesamt ehrenamtlich, und ihre Namen mussten bedauerlicherweise geheim bleiben.
Dass McLearys Abteilung innerhalb des GCHQ nur geringe Wertschätzung erfuhr, wäre also eine gehörige Untertreibung gewesen.
McLeary kümmerte das nicht weiter. Es stimmte, dass die Rätselbücher nur wenige mögliche Bewerber hervorbrachten. Doch neben dem Erstellen der offiziellen Rätsel hatte McLeary außerdem bei verschiedenen Mathematikolympiaden sowie Programmier- und Codeknacker-Wettbewerben seine Finger im Spiel. Und dabei war schon eine ganze Reihe interessanter Köpfe herausgefiltert worden, von denen manche dann auch eine Karriere beim GCHQ gestartet hatten.
Seit fünfzehn Jahren stand McLeary dieser Abteilung nun schon vor. Begonnen hatte alles mit einem Zufall. Er war von einem Einsatz in Hongkong zurückgekehrt, bei dem nichts so funktioniert hatte wie geplant. McLeary war schon zuvor ausgebrannt gewesen, das Hongkong-Desaster mit mehreren Toten, bei dem er selbst nur knapp dem Sensenmann entronnen war, ließ ihn zusammenbrechen. Einige Monate verbrachte er in einer Rehabilitationsklinik, ohne dass sich sein Zustand sichtbar besserte. Er war am Ende, es gab bereits Gespräche, wie man ihn mit einer Invalidenrente in den Ruhestand schicken konnte.
Zum Zeitvertreib begann McLeary bei seiner Reha, Kreuzworträtsel zu lösen. Seine Affinität für Rätsel sprach sich herum. Und so schlug man ihm eine neue Aufgabe vor, da bei einer kleinen Abteilung eine Leitungsposition frei geworden war. Es war eine Beschäftigung abseits des Rampenlichts, ohne Risiko. Eine Zwischenlösung, bis er wieder bei Kräften war.
Aus der Übergangslösung war eine Langzeitanstellung geworden. McLeary hatte sich erholt, doch als man ihm anbot, zurück in den Außendienst zu gehen, hatte er kurz mit seiner Frau gesprochen und dann abgelehnt. Er war gerade fünfzig geworden und trauerte seinem alten Job nicht nach. Die Nerds in seiner Abteilung waren ihm fremd geblieben, aber er hatte einen Riecher für die guten Köpfe, und einige der Leute, die er direkt aus Wettbewerben angeworben hatte, besetzten heute wichtige Positionen beim GCHQ.
Doch nun schien er sich verschätzt zu haben.
McLeary ging zum Arbeitsplatz von Light. Er hatte den Büros seines Teams in letzter Zeit wenig Beachtung geschenkt, sondern sie einfach ihr Ding machen lassen. Auf den ersten Blick war auch an Lights Arbeitsplatz nichts Auffälliges, er sah zwei benutzte Kaffeetassen, eine leere Chipspackung. Post-its an einem der Monitore, auf denen allerdings keine Passwörter standen, wie McLeary schnell nachprüfte.
»Zeigen Sie mir, woran er gearbeitet hat«, befahl McLeary Lights Kollegen Robin Myers, der gerade den Raum betreten hatte und sich verhielt, als wäre er bei etwas Verbotenem ertappt worden. Der Typ war Mitte zwanzig, hatte lange, dunkle Locken und war dicker, als es seinem alten Judas-Priest-T-Shirt guttat. McLeary, der seine Jugend mit Training und Büffeln auf einer Eliteschule verbracht hatte, konnte immer noch nicht verstehen, warum manche Leute sich derart gehen ließen. Er hatte früher geglaubt, dass so jemand auch in anderen Bereichen keine Leistung bringen konnte, doch die Jahre hatten ihn gelehrt, dass sich Menschen nicht so einfach kategorisieren ließen. Das galt auch für Robin hier, der trotz seines legeren Auftretens und seiner kindischen Vorlieben, die nicht zuletzt mit seinem früheren Job als Programmierer für Spezialeffekte von Filmen zu tun hatte, sein bester Mann war.
Nun wirkte Robin etwas verloren. »Ich befürchte, das kann ich nicht, Sir«, erklärte er.
»Warum nicht?«
»Ich zeige es Ihnen«, sagte er und setzte sich an Lights Rechner.
Die Finger flogen über die Tasten, und McLeary konnte sehen, dass er nervös war.
»Hier«, sagte Robin.
McLeary starrte auf einen leeren Bildschirm. Verschwommen schimmerte der Desktophintergrund durch, der ein Tier zeigte. »Was soll das sein? Wo ist seine Arbeit?«
»Das ist es ja gerade«, sagte Robin. »Sie ist nicht da.«
»Okay, aber es gibt doch ein Back-up.«
»Natürlich gibt es das. Aber sehen Sie her.« Zwei Tastendrucke später erschien wieder ein leerer Bildschirm. »Das Back-up ist nicht da.«
»Wie?«
»Er muss es gelöscht haben.«
»Er hatte dazu doch gar keine Berechtigung.«
»Nein.«
»Und? Wie kam er dann rein?«
Robin zuckte mit den Schultern.
»Strengen Sie sich ein bisschen an!«, fuhr McLeary ihn verärgert an. »Hazeem ist in streng gesicherte Bereiche der Stromversorgung eingedrungen und hat unsere eigenen Sicherheitssysteme ausgetrickst. Er hat die Verschlüsselung ausgehebelt. Wie hat er das gemacht?«
»Wir wissen es nicht«, gestand Robin.
McLeary ließ sich das Gehörte durch den Kopf gehen. Auch wenn es ihm nicht gefiel, es passte ins Bild. Light war in Bereiche eingedrungen, zu denen er keinen Zutritt hatte.
»Es gibt also keine Aufzeichnungen über das, womit Light sich beschäftigt hat?«
Robin schüttelte seine schwarzen Locken. Er schloss das Fenster auf dem Schirm, und das dahinter liegende Katzenbild blickte McLeary hintergründig an.
»Wissen Sie, ob es stimmt?«, begann Robin. »Dass er Klingonisch gesprochen hat?«
McLeary zögerte. »Wieso, sprechen Sie etwa Klingonisch?«
Robin sah aus, als fühlte er sich ertappt. »Ein bisschen.«
McLeary starrte ihn an, um zu eruieren, ob er einen Scherz machte. Das schien nicht der Fall zu sein.
»Hazeem konnte es besser als ich«, erklärte Robin. »Ich denke, dass ihm alle Sprachen ein wenig wie Klingonisch vorkamen. Sie bestanden aus Regeln, die er nicht verstand, sondern auswendig lernte.«
»Man sollte es nicht zu ernst nehmen«, sagte McLeary. »Wir wissen alle von Hazeems Problemen.«
»Er soll ›Es muss aufhören‹ gesagt haben.«
McLeary schluckte. »Das habe ich auch gehört«, brachte er hervor.
Robin schien damit nicht zufrieden zu sein.
»Was noch?«, fragte McLeary etwas zu schroff.
»Ich frage mich, ob das etwas mit dem zu tun hat, was im Bletchley Park passiert ist«, sagte Robin leise. »Der Afrikaner …«
»Warum sollte das etwas damit zu tun haben?«
McLeary hätte die sonderbare Episode nur zu gern vergessen. Sein Team hatte in den Museumsräumen des Bletchley Parks an einer nicht genehmigten Geheimparty teilgenommen und dort einen Toten gefunden. Sie hatten dessen Identität bis jetzt nicht klären können, nur, dass es sich um einen afrikanischen Flüchtling handelte, der vermutlich übers Mittelmeer gekommen war und es unter dem Radar bis nach Großbritannien geschafft hatte. Was er gewollt hatte, wusste niemand.
Robin starrte auf den Boden und rang sichtlich um Fassung. Er hatte soeben aus dem Fernsehen erfahren, dass sein Kollege tot war.
McLeary legte ihm die Hand auf die Schulter, doch es fühlte sich schrecklich unehrlich an. »Es tut mir leid, was mit ihm passiert ist. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich mehr weiß, okay? Bitte sagen Sie, wenn Sie etwas brauchen.«
*
Pawel war hinausgegangen, als es laut geworden war. Die Leute, mit denen er zusammenarbeitete, waren Söldner eines chinesischen Sicherheitsunternehmens namens Water Dragon. China war hier omnipräsent, chinesische Firmen bauten Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen. Pawel hatte auch überlegt, eines der hier aktiven russischen Söldnerunternehmen zu engagieren, sich dann aber für die Chinesen entschieden. Bisher hatte er es nicht bereut, sie arbeiteten schnell und effektiv.
Doch die Kälte, mit der sie sich um den Wahrsager und seine Familie gekümmert hatten, nachdem die Gegenwehr überraschend heftig ausgefallen war, war selbst ihm unangenehm geworden. Pawel fragte sich, ob es verrückt war, bei so etwas wie Folter die Menschlichkeit zu vermissen, aber genau dieses Gefühl hatte er. Wie die Maschinen hatten sie ein Familienmitglied nach dem anderen in die Mangel genommen und dabei alle Tricks aus dem Lehrbuch ausgepackt. Keiner aus dem Einsatzteam hatte mit der Wimper gezuckt. Normalerweise war immer zumindest einer dabei, der derlei Einsatz auf eine absurde Weise genoss, irgendein Psychopath, der gern Menschen wehtat, doch dieses Mal nicht. Professionelle Pflichtschuldigkeit war alles, was die vier Chinesen an den Tag legten.
Pawel stand vor der Tür des Wellblechgebäudes und hielt sich den Ärmel vor die Nase. Das Haus stand auf Stelzen, über eine Wasserfläche gebaut, aus der ein bestialischer Gestank aufstieg. Er war hart im Nehmen, wenn es ums Geschäft ging, genau deshalb war er so erfolgreich. Nur wenige kannten seinen wunden Punkt. Wenn die Erinnerungen an die Vergangenheit hochkochten, legte das bei ihm zuweilen einen Schalter um. Er war dann wie gelähmt, bekam kaum noch Luft und wurde hilflos wie ein Kind. Die Auslöser waren immer Kleinigkeiten, keine realen Belastungen wie diese hier. Das machte sie so unangenehm, weil sie sich nie vorhersehen ließen. Das letzte Mal war es vor einigen Monaten geschehen, als er in England einen Mann verfolgt hatte. Zum Glück passierte es immer seltener. Vielleicht konnte er so die Geschichte seines Vaters endlich hinter sich lassen.
Niemand war zu sehen, doch Pawel glaubte, dass sich das schnell ändern konnte. Die erstickten Schreie aus dem Inneren würden früher oder später jemanden aufscheuchen.
Deshalb war Pawel erleichtert, als der Chef der Chinesen, ein groß gewachsener Typ mit breitem Gesicht, der Si hieß, zu ihm ins Freie trat und eine mit Blut bespritzte Schutzbrille von der Nase nahm.
»Niemand von ihnen weiß etwas. Und ich bin überzeugt, dass keiner von ihnen der ist, den Sie suchen.«
Das war eine schlechte Nachricht. Er war überzeugt gewesen, die Quelle gefunden zu haben. Ein Mann, der die Zukunft vorhersagen konnte. Die IP-Adresse passte auch. Er musste es einfach sein.
»Seid ihr ganz sicher?«
Der Mann zögerte. »Es scheint noch jemand in dem Haus gelebt zu haben«, gab er schließlich zu. »Sie könnte im Besitz der Quelle sein.«
»Sie?«, fragte Pawel.
»Sie«, sagte der Mann. »Es ist eine Frau.«
»Das muss sie sein«, sagte Pawel bestimmt. »Findet sie.«
*
Line Berg saß an ihrem Rechner und scrollte durch die Meldungen. Sie hatte gehört, dass der Korrespondent in London auf Granit biss. Ein Software-Ausfall beim Betreiber des Stromnetzes sollte dafür verantwortlich sein, mehr hatte er nicht in Erfahrung bringen können. Die Behörden gaben sich ungewöhnlich wortkarg, was vermutlich bedeutete, dass mehr dahintersteckte.