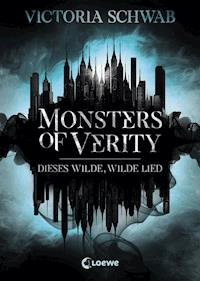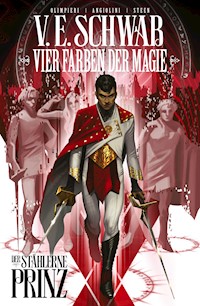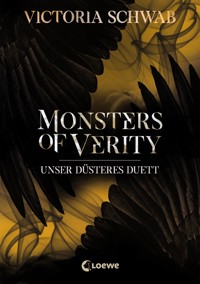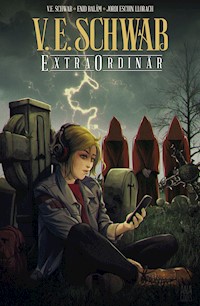9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die City of Ghosts-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nur weil du sie nicht sehen kannst, heißt das noch lange nicht, dass es sie nicht gibt ...
Seit Cassidy Blake fast ertrunken wäre, kann sie Geister sehen und die Welt der Toten betreten. Sogar ihr bester Freund ist ein Geist! Und als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, werden ausgerechnet ihre Eltern die neuen Stars einer Geisterjäger-Fernsehshow. Der erste Drehort: Edinburgh. Die Friedhöfe, Burgen und Geheimgänge der alten Stadt wimmeln nur so vor Geistern – und nicht alle sind freundlich. An diesem unheimlichen Ort wird Cassidy langsam klar, wie viel sie noch über ihre Verbindung zum Reich der Toten zu lernen hat. Doch dafür bleibt ihr nicht viel Zeit, denn eine besonders dunkle Seele streckt schon die Krallen nach ihr aus ...
Alle Bände der City-of-Ghosts-Reihe:
Die Geister, die mich riefen
Im Reich der vergessenen Geister
Der Bote aus der Dunkelheit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Victoria Schwab
Die Geister, die mich riefen
Aus dem Englischenvon Tanja Ohlsen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2018 by Victoria Schwab Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »City of Ghosts« bei Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc.Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A. © 2019 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen Karte von Edinburgh: © 2018 Maxime Plasse Umschlagillustration und -gestaltung: Melanie Korte ml · Herstellung: SeS Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-24034-9V001www.cbj-verlag.de
Für die Stadt, in der meine Knochen liegen
»Sterben ist bestimmt ein tolles Abenteuer«J.M. Barrie, Peter Pan
TEIL EINS
Inspecters
Kapitel 1
Die meisten Leute glauben, dass Geister nur nachts oder an Halloween erscheinen, wenn die Welt dunkel ist und die Mauern zwischen den Lebenden und Toten dünn sind. Aber im Grunde sind Geister einfach überall. In der Brotabteilung im Supermarkt, mitten im Garten eurer Großmutter, auf dem Nachbarsitz im Bus.
Nur weil ihr sie nicht sehen könnt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht da sind.
Ich sitze gerade in der Geschichtsstunde, als ich das Tipp-tipp-tipp auf meiner Schulter spüre, wie Regentropfen. Manche Leute nennen es Intuition, andere das zweite Gesicht. Es ist ein Kribbeln am Rande des Bewusstseins, das einem sagt, dass da noch etwas anderes ist.
Ich spüre das nicht zum ersten Mal – bei Weitem nicht. Nicht einmal hier in der Schule. Ich habe versucht, es zu ignorieren – das versuche ich immer –, aber es nützt nichts. Es raubt mir die Konzentration, und ich weiß, dass ich es nur zum Verstummen bringen kann, indem ich nachgebe und der Sache auf den Grund gehe.
Von der anderen Seite des Raums fängt Jacob meinen Blick auf und schüttelt den Kopf. Er kann das Tipp-tipp-tipp nicht spüren, doch er kennt mich gut genug, um zu wissen, wann ich es fühle.
Unruhig rutsche ich auf dem Stuhl herum und versuche, mich auf das Geschehen in der Klasse zu konzentrieren. Mr Meyer versucht heroisch, uns noch etwas beizubringen, obwohl es die letzte Woche vor den Sommerferien ist.
»… Gegen Ende des Vietnamkrieges im Jahr 1975 haben die US-Truppen …«, erzählt er. Niemand kann still sitzen, geschweige denn zuhören. Derek und Will schlafen mit offenen Augen, Matt arbeitet an seinem neuen Papierfußball, und Alice und Melanie schreiben irgendeine Liste.
Alice und Melanie sind beliebt.
Das sieht man daran, dass sie wie Kopien voneinander aussehen: das gleiche glänzende Haar, die gleichen perfekten Zähne, die gleichen lackierten Fingernägel. Ich bestehe nur aus Ellbogen und Knien, habe runde Wangen und braune Locken. Nagellack besitze ich nicht einmal.
Ich weiß, man sollte eigentlich zu den beliebten Kids gehören wollen, aber eigentlich hatte ich nie Lust dazu. Ich finde es viel zu anstrengend, mich an all die Regeln zu halten. Lächeln, aber nicht zu breit. Lachen, aber nicht zu laut. Die richtige Kleidung tragen, die richtigen Sportarten machen, Anteilnahme zeigen, aber nicht zu viel.
(Jacob und ich haben zwar auch Regeln, aber die sind anders.)
Wie aufs Stichwort steht Jacob auf und geht zu Melanies Tisch. Er könnte beliebt sein, mit seinem verwuschelten, blonden Haar, den strahlend blauen Augen und der immer guten Laune.
Er wirft mir einen teuflischen Blick zu und setzt sich auf den Rand ihres Tisches.
Er könnte beliebt sein, doch da gibt es ein kleines Problem.
Jacob ist tot.
»Was wir für die Filmnacht brauchen«, liest er laut von Melanies Blatt ab. Aber ich bin die Einzige, die ihn hören kann. Melanie faltet ein weiteres Blatt zusammen – die Großbuchstaben und die rosa Schrift sagen mir, dass es eine Einladung ist – und reicht sie an Jenna weiter, die vor ihr sitzt. Dabei geht ihre Hand glatt durch Jacobs Brust hindurch.
Er sieht pikiert nach unten, als wäre das extrem beleidigend. Dann springt er vom Tisch.
Tipp-tipp-tipp, macht es in meinem Kopf wie ein kaum hörbares Flüstern. Ungeduldig sehe ich zur Wanduhr und sehne das Klingeln herbei.
Jacob schlendert zu Alice’ Tisch und betrachtet die vielen Buntstifte, die sie ordentlich aufgereiht hat. Er beugt sich herunter und streckt vorsichtig einen Finger danach aus. Hoch konzentriert stupst er den äußersten Stift an.
Doch der rührt sich nicht.
Im Film können Poltergeister Fernseher anheben und Betten durchs Zimmer schieben. Aber in Wirklichkeit braucht es schon eine Menge Willenskraft, damit ein Geist den Schleier – den Vorhang zwischen ihrer Welt und unserer – durchbrechen kann. Und die Geister, die diese Macht haben, sind normalerweise echt alt und nicht sehr nett. Die Lebenden beziehen ihre Kraft meistens aus Liebe und Hoffnung, aber die Toten nähren sich von anderen Dingen. Von Schmerz und Zorn und Reue.
Jacob runzelt die Brauen, während er vergeblich versucht, Matts Papierfußball wegzukicken.
Ich bin froh, dass er nicht so viel Kraft hat.
Ich weiß nicht, wie lange Jacob schon tot ist. (Ich denke das Wort leise, denn ich weiß, dass er es nicht mag.) Es kann noch nicht so lange sein, denn an ihm ist überhaupt nichts retro. Er trägt ein Superhelden-T-Shirt, dunkle Jeans und Chucks. Er spricht nicht darüber, was ihm passiert ist, und ich frage nicht nach. Man muss seinen Freunden ihre Privatsphäre lassen – auch wenn er meine Gedanken lesen kann. So etwas kann ich zwar nicht, aber ehrlich gesagt bin ich lieber lebendig und nicht übersinnlich begabt als übersinnlich begabt und ein Geist.
Beim Wort Geist sieht Jacob auf und räuspert sich. »Ich bevorzuge den Ausdruck ›körperlich eingeschränkt‹.«
Ich verdrehe die Augen. Er weiß, dass ich es nicht mag, wenn er ohne meine Erlaubnis meine Gedanken liest. Ja, das ist eine merkwürdige Nebenwirkung unserer Freundschaft, aber so ist es eben. Es gibt Grenzen!
»Ist doch nicht meine Schuld, wenn du so laut denkst«, entgegnet Jacob grinsend.
Ich schnaufe und ein paar Schüler sehen sich nach mir um. Ich rutsche auf meinem Stuhl tiefer nach unten, wobei meine Turnschuhe an meine Büchertasche stoßen. Die Einladung, die Melanie an Jenna gegeben hat, macht ihre Runde durch den Raum. Bei mir landet sie nicht. Ist mir egal.
Es ist fast Sommer, und das heißt: frische Luft und Sonne und Bücher, die man nur zum Spaß liest. Es bedeutet den jährlichen Familienausflug zum gemieteten Strandhaus auf Long Island, damit Mum und Dad an ihrem nächsten Buch arbeiten können.
Aber vor allem heißt es: keine Geister.
Ich weiß nicht, was es mit dem Strandhaus auf sich hat – vielleicht liegt es daran, dass es so neu ist oder an einem ruhigen Strandabschnitt liegt –, aber dort scheint es weit weniger Geister zu geben als hier nördlich von New York. Und das bedeutet: Wenn die Schule aus ist, liegen sechs Wochen mit Sonne, Sand und ruhigen Nächten vor mir.
Sechs Wochen ohne das Tipp-tipp-tipp unruhiger Geister.
Sechs Wochen, in denen ich mich fast normal fühle.
Ich kann es kaum erwarten.
Ich kann es kaum erwarten, und dennoch springe ich auf, sobald es läutet, werfe mir den Rucksack über die eine und den lila Kamerariemen über die andere Schulter und folge dem hartnäckigen Tipp-tipp-tipp.
»Ich habe eine verrückte Idee«, sagt Jacob, der neben mir herläuft. »Wir könnten doch einfach essen gehen.«
Es ist Hackbratendonnerstag, denke ich, bedacht darauf, nicht laut zu antworten. Da sind mir sogar Geister noch lieber.
»Na, na«, antwortet er. Aber wir wissen beide, dass Jacob kein normaler Geist ist, so wie ich kein normales Mädchen bin. Nicht mehr. Es gab einen Unfall. Ein Fahrrad. Ein zugefrorener Fluss. Die Kurzversion lautet: Er hat mir das Leben gerettet.
»Genau, ich bin quasi ein Superheld«, bestätigt Jacob, bevor ihm eine Schranktür ins Gesicht schwingt. Ich zucke zusammen, doch er geht einfach durch die Tür hindurch. Es ist nicht so, dass ich vergesse, was Jacob ist – es ist schwer zu vergessen, wenn dein bester Freund für alle anderen unsichtbar ist. Aber es ist schon erstaunlich, an was man sich so alles gewöhnt.
Und die Tatsache, dass Jacob mich schon seit einem Jahr begleitet, ist nicht einmal das Merkwürdigste in meinem Leben.
Wir kommen an die Abzweigung im Gang. Links geht es zur Cafeteria, rechts zu den Treppen.
»Letzte Chance für Normalität«, warnt Jacob, doch er hat dieses schiefe Lächeln im Gesicht. Er weiß genauso gut wie ich, dass wir über normal schon seit einer ganzen Weile hinaus sind.
Wir gehen nach rechts.
Die Treppe hinunter und durch einen weiteren Gang, gegen den Strom zum Mittagessen. An jeder Abzweigung wird das Tipp-tipp-tipp stärker, wird zu einem Sog, wie ein Seil. Ich muss nicht darüber nachdenken, wohin ich gehe. Es ist sogar leichter, wenn ich gar nicht darüber nachdenke, sondern mich einfach ziehen lasse.
Es zieht mich zur Tür des Auditoriums. Jacob schiebt die Hände in die Hosentaschen und murmelt etwas von blöder Idee, woraufhin ich ihn daran erinnere, dass er ja nicht mitkommen muss, auch wenn ich froh bin, dass er da ist.
»Neunte Freundschaftsregel«, erklärt er: »Geisterbeobachtung ist eine Zwei-Personen-Aktivität.«
»Genau«, erwidere ich und nehme die Kappe von der Kameralinse. Die Kamera, die an dem lila Riemen an meiner Schulter hängt, ist ein klobiges altes Gerät, manuell, mit einem kaputten Sucher und Schwarz-Weiß-Film.
Wenn mich ein Lehrer im Auditorium erwischt, sage ich, ich mache Fotos für die Schulzeitung. Auch wenn die Wahlfächer für dieses Schuljahr alle schon vorbei sind.
Und ich nie für die Zeitung gearbeitet habe …
Ich mache die Tür zum Auditorium auf und trete ein. Es ist ein großer Saal mit hoher Decke und schweren roten Vorhängen vor der Bühne.
Plötzlich ist mir klar, warum mich das Tipp-tipp-tipp hierher geführt hat. Jede Schule hat ihre Geschichten. Geschichten, die erklären, woher das Knarren im Waschraum der Jungen kommt, warum es im Englischzimmer hinten immer so kalt ist und wieso es im Auditorium nach Rauch riecht.
An meiner Schule ist es genauso. Der einzige Unterschied ist, dass ich herausfinden kann, ob diese Geistergeschichten wahr sind oder nicht. Meist sind sie es nicht.
Das Knarren kommt von einer Tür mit schiefen Angeln.
Die Kälte ist nur ein Luftzug.
Doch als ich dem Tipp-tipp-tipp durch den Saal bis zur Bühne folge, weiß ich, dass an dieser Geschichte etwas Wahres ist.
Es geht um einen Jungen, der bei einer Theateraufführung ums Leben gekommen ist.
Angeblich gab es bei der Vorstellung des Mittsommernachtstraums vor langer Zeit, als die Schule gerade eröffnet worden war, im zweiten Akt ein Feuer. Die Kulissen gingen in Flammen auf, doch alle konnten rechtzeitig ins Freie entkommen – glaubte man jedenfalls.
Bis man den Jungen unter der Falltür fand.
Jacob neben mir schaudert und ich verdrehe die Augen. Für einen Geist bekommt er echt viel zu leicht Angst.
»Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht eher so ist, dass du nicht leicht genug Angst bekommst?«, meint er.
Aber ich fürchte mich genauso wie andere Leute. Glaubt es oder nicht, ich will meine Zeit nicht damit verbringen, Geister zu suchen. Sie sind nur einfach da und ich kann sie nicht ignorieren. Das ist so, wie wenn einem gesagt wird, dass da jemand hinter einem steht, aber man darf sich nicht umdrehen. Man spürt den Atem im Genick, und jede Sekunde, die man nicht hinsieht, macht es nur noch schlimmer. Denn letztendlich ist immer das, was man nicht sieht, furchterregender als das, was man sehen kann.
Ich klettere auf die Bühne, gefolgt von Jacob. Ich merke, dass er zögert, und sein Widerstreben zieht auch mich zurück. Aber ich hebe trotzdem eine Ecke des schweren roten Vorhangs an und schlüpfe hindurch, in den Bereich hinter der Bühne. Jacob folgt mir, wobei er direkt durch den dicken Vorhang läuft.
Hier ist es dunkel – so dunkel, dass ich einen Augenblick brauche, um mich daran zu gewöhnen und die verschiedenen Requisiten und Bänke auf der Bühne zu erkennen. Unter dem Vorhang fällt ein schmaler Streifen Licht herein. Es ist vollkommen ruhig, und doch habe ich das seltsame Gefühl, dass sich hier etwas bewegt. Das leise Seufzen der Sandsäcke an ihren Haken. Ein flüsternder Luftzug unter den Bühnenbrettern. Das Rascheln, das hoffentlich von Papier und nicht von Ratten stammt.
Ich weiß, dass einige der älteren Schüler es zu einer Mutprobe machen, hierherzukommen, das Ohr an den Boden zu legen und nach dem Jungen zu lauschen, der es nicht geschafft hat. Auf dem Flur habe ich einmal gehört, dass sie damit angaben, wie lange sie es ausgehalten haben. Eine Minute. Zwei. Fünf. Manche behaupteten, sie hätten die Stimme des Jungen gehört. Andere sagten, sie hätten Rauch gerochen und die Schritte flüchtender Kinder gehört. Aber es ist schwer zu sagen, wo die Gerüchte enden und die Wahrheit anfängt.
Mich hat noch nie jemand aufgefordert, hierherzukommen. Das mussten sie nicht. Wenn deine Eltern Bücher über paranormale Aktivität schreiben, gehen die Leute davon aus, dass du schräg genug drauf bist, um alleine zu gehen.
Sieht so aus, als hätten sie recht damit.
Auf halbem Weg über die dunkle Bühne stolpere ich über etwas und falle. Jacob streckt die Hand aus, um mich zu fangen, doch seine Finger gleiten durch meinen Arm, und ich knalle mit dem Knie auf den Holzboden. Meine Handflächen schlagen hart auf, und verwundert stelle ich fest, dass der Boden ein wenig nachgibt, bis ich realisiere, dass ich auf der Falltür knie.
Das Tipp-tipp-tipp wird unter meinen Händen noch hartnäckiger. An meinem äußeren Gesichtsfeld tanzt ein dünner grauer Schleier wie in einem konstanten Luftzug. Er ist anders als der schwere rote Vorhang. Diesen hier kann sonst niemand sehen.
Der Schleier.
Die Grenze zwischen dieser Welt und etwas anderem, zwischen den Lebenden und den Toten. Danach suche ich.
Jacob tritt von einem Fuß auf den anderen. »Bringen wir es hinter uns.«
Ich stehe auf.
»Geister-Five!«, sage ich, um uns Glück zu wünschen. Ein Geister-Five ist eine Art High Five für Freunde, die einander nicht berühren können. Dabei halte ich meine Hand hoch, und er tut so, als würde er einschlagen, während wir beide ein »Patsch«–Geräusch von uns geben.
»Autsch!«, beschwert sich Jacob und zieht die Hand weg. »Du schlägst so hart zu!«
Ich lache. Manchmal ist er echt albern. Aber das Lachen ist befreiend, es vertreibt Furcht und Nervosität, während ich nach dem Schleier greife.
Im Fernsehen habe ich gesehen, wie selbst ernannte »Geisterbeschwörer« davon reden, wie sie hinübergehen. Dass sie mit der anderen Seite in Verbindung treten, indem sie eine Art Schalter umlegen oder eine Tür öffnen. Aber bei mir ist es anders: Ich suche den Schleier, greife ihn und ziehe daran.
Manchmal, wenn es nichts zu finden gibt, ist der Schleier kaum vorhanden, mehr Rauch als Stoff und schwer zu fassen. Aber wenn ein Ort von Geistern heimgesucht wird – von richtigen Geistern –, dann schlingt sich der Stoff um mich und zieht mich praktisch hindurch.
Genau hier und jetzt tanzt er zwischen meinen Fingern und wartet nur darauf, gefangen zu werden.
Ich bekomme ihn zu fassen, hole tief Luft und ziehe.
Kapitel 2
Als ich noch klein war, hatte ich immer Angst vor Monstern im Schrank. Ich konnte nicht einschlafen, bevor nicht mein Dad kam, die Schranktür aufriss und mir zeigte, dass nichts dahinter war. Durch den Schleier zu gehen ist genauso, wie diese Schranktür aufzumachen.
Mit dem Unterschied, dass die Monster nicht real waren. Der Schrank war immer leer.
Die Welt hinter dem Schleier dagegen ist alles andere als leer.
Ein Schauer überläuft mich. Einen Moment lang bin ich nicht auf der Bühne, sondern unter Wasser. Der eisige Strom schließt sich über meinem Kopf, und das Licht verschwindet, während mich etwas Schweres immer tiefer und tiefer zieht …
»Cassidy.«
Jacobs Stimme lässt mich blinzeln und die Erinnerung an den Fluss verblasst. Ich bin wieder auf der Bühne, und alles ist so wie zuvor, aber anders. Die Bühne ist blasser, wie auf einem alten Foto, doch es ist nicht so dunkel wie zuvor. Stattdessen wird sie von einigen Scheinwerfern erleuchtet und vor dem Vorhang erklingt das Murmeln des Publikums.
Jacob ist immer noch bei mir, aber er wirkt fester, realer. Ich sehe an mir selbst herunter. Wie immer sehe ich ganz normal aus, vielleicht ein wenig verwaschen, aber immer noch ich selbst, bis hin zur Kamera um meinen Hals. Der einzige Unterschied ist das Licht in meiner Brust. Es ist eine Spirale aus kühlem, bläulich weißem Licht, das durch meine Rippen scheint wie der Leuchtdraht in einer Glühbirne.
Wie Iron Man, witzelt Jacob manchmal. Ich halte mir die Kamera vor die Brust, um das Leuchten zu dämpfen.
»Auf die Plätze!«, erklingt die Stimme eines Erwachsenen aus den Kulissen und lässt mich zusammenzucken. Jacob greift nach meinem Ärmel, um mich zu halten, und dieses Mal gleitet seine Hand nicht durch mich hindurch. Er hat hier mehr oder ich weniger Substanz, so oder so bin ich dankbar für den Kontakt.
»Zweiter Akt!«, fügt die Stimme hinzu.
Jetzt weiß ich, was hier los ist.
Und wann es ist.
Die Nacht des Brandes.
Flatternd wie aufgescheuchte Fledermäuse laufen Jungen und Mädchen mit Feenkronen und Glitzercapes über die Bühne. Mich und Jacob bemerken sie nicht. Der Vorhang geht auf und aus dem dunklen Theatersaal erklingt das Murmeln des Publikums. Instinktiv möchte ich mich ducken und in die Kulissen zurückziehen, doch ich erinnere mich daran, dass das Publikum nicht wirklich da ist. Dieser Ort, dieser Raum und diese Zeit – das alles gehört zu dem Geist und seinen Erinnerungen.
Der Rest sind nur Kulissen.
Ich hebe die Kamera, ohne durch den Sucher zu sehen (der hat einen Sprung). Schnell mache ich ein paar Fotos, obwohl ich weiß, dass ich auf dem Film höchstens einen Schatten dessen sehen werde, was hier ist. Etwas mehr als normal, etwas weniger als die Wahrheit.
»Kaum zu glauben«, flüstert Jacob wehmütig. »Wir könnten jetzt auch in der Cafeteria sitzen und mittagessen wie normale Menschen.«
»Du kannst nicht essen und ich sehe Geister. Nicht sehr normal, würde ich sagen«, flüstere ich zurück, während der zweite Akt beginnt. Im Kulissenwald versammeln sich die Feen um ihre Königin.
Ich sehe mir die Bühne genau an, die Laufstege darüber, die Requisiten, und suche nach der Ursache des Feuers. Vielleicht werde ich deshalb zu solchen Orten gerufen. Geister sind immer aus einem bestimmten Grund da. Wenn jemand die Wahrheit herausfindet, darüber, was mit ihnen geschehen ist – wenn ich sie herausfinde –, dann bringt ihnen das vielleicht Frieden. Und sie gehen weg.
»So funktioniert das nicht«, flüstert Jacob.
Ich fahre zu ihm herum. »Wie meinst du das?«
Er macht gerade den Mund auf, um zu antworten, als ein Junge auftaucht. Er ist klein, blass und hat wirre dunkle Locken. Das ist er – der Geist. Ich bin mir sicher, denn da ist dieses Gefühl: Es ist, als neige sich der Boden zu ihm hin.
Sein Umhang verfängt sich in einem Gerüst neben der Bühne. Er schafft es, sich zu befreien, und stolpert auf die Bühne vor uns, verliert dabei aber seine Krone und muss zurück. Einen Augenblick lang sehen wir uns in die Augen. Ich glaube, dass er mich sieht, und will etwas sagen, doch Jacob legt mir die Hand über den Mund und schüttelt den Kopf.
Die Musik beginnt und der Blick des Jungen verschleiert sich. Ich sehe ihm nach, während er seinen Platz einnimmt.
»Wir sollten gehen«, flüstert Jacob. Aber ich kann nicht. Noch nicht. Ich muss wissen, was passiert ist.
Wie aufs Stichwort höre ich das Zischen eines Seils und sehe, wie sich das Gerüst, an dem sich der Junge verfangen hat, löst und schräg neigt. Ein Sandsack darauf gerät ins Rutschen, fällt herunter, bleibt dabei an einem Stromkasten hängen und schlägt eine Sicherung heraus.
Ein Funke fliegt – nur ein kleiner Funke –, doch ich sehe, wie er auf das nächstbeste Objekt fällt, ein ungenutztes Stück Pappwald, das man in den Seitenflügel geschoben hat.
»Oh nein«, flüstere ich, während das Theaterstück weitergeht.
Es bricht kein Feuer aus, jedenfalls nicht gleich. Es beginnt mit Wärme und Rauch. Rauch, der im dunklen Theatersaal nicht auffällt. In einer dünnen Säule steigt er nach oben und sammelt sich unter der Decke wie eine tief hängende Wolke. Immer noch merkt keiner etwas.
Nicht, bis endlich das Feuer ausbricht.
Die Bühne ist voller Brennmaterial: ein Wald aus Holzbrettern und Spinnweben und Farbe. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus und nun ist auch der Bann des Theaterstücks gebrochen. Die Feenschüler laufen davon und das Publikum gerät in Panik. Obwohl ich weiß, dass es nur eine Erinnerung ist, ein Echo von etwas, das längst vorbei ist, kann ich doch die Hitze des Feuers spüren.
Jacob greift meine Hand und zieht mich von den wütenden Flammen fort.
Trotz der Angst drehe ich am Objektiv der Kamera und schieße Fotos, um wenigstens irgendetwas einzufangen, während sich die Welt um mich herum in Rauch, Feuer und Panik auflöst.
Ich fühle mich benebelt, als hätte ich zu lange die Luft angehalten. Ich war lange genug hier, es ist Zeit, zu gehen, doch meine Füße wollen mir nicht gehorchen.
Dann sehe ich den dunkelhaarigen Jungen, der versucht, nahe am Boden zu bleiben, so wie er es im Unterricht gelernt hat, doch das Feuer breitet sich zu schnell aus, verschluckt die Kulissen zu beiden Seiten und klettert am Vorhang hinauf. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit, die ganze Bühne steht in Flammen, also lässt er sich fallen und krabbelt auf Händen und Knien weiter, bis er an die Falltür kommt.
»Nicht!«, rufe ich, aber das ist natürlich sinnlos. Er hört mich nicht, dreht sich nicht um. Er macht die Tür auf und klettert hinunter. Kurz darauf fällt ein brennendes Teil der Kulisse herunter und landet auf der Falltür.
»Cassidy«, mahnt Jacob, doch ich kann den Blick nicht vom Feuer abwenden, während sich meine Lungen mit Rauch füllen.
Jacob packt mich an den Schultern.
»Wir müssen gehen!«, befiehlt er, und da ich mich noch immer nicht vom Fleck rühre, gibt er mir einen Stoß, sodass ich stolpere und rücklings über eine Holzbank falle. Als ich auf dem Boden aufschlage, ist dieser kalt. Das Feuer ist ebenso verschwunden wie das Licht in meiner Brust. Jacob hockt wieder als Geist über mir und ich lasse mich atemlos zurücksinken.
Wisst ihr, manchmal bleibe ich hängen.
Es ist wie in Peter Pans Nimmerland – je länger die verlorenen Jungs dort blieben, desto mehr vergaßen sie. Und je länger ich auf der anderen Seite des Schleiers bleibe, desto schwerer ist es, zurückzukommen.
Jacob verschränkt die Arme vor der Brust. »Bist du jetzt zufrieden?«
Zufrieden trifft es nicht ganz. Das Tippen ist immer noch da – es geht nie ganz weg –, aber zumindest weiß ich jetzt, was auf der anderen Seite ist. Das macht es leichter, es zu ignorieren.
»Sorry«, sage ich, stehe auf und klopfe mir unsichtbare Asche von der Jeans. Ich kann den Rauch immer noch schmecken.
»Freundschaftsregel Nummer 21«, erklärt Jacob. »Lass deine Freundin nie hinter dem Schleier zurück.«
In diesem Moment ertönt die Schulglocke.
Die Mittagspause ist offiziell vorbei.
Kapitel 3
Bevor ich weitererzähle, muss ich erst ein wenig zurückspulen.
Denn ihr müsst drei Dinge wissen.
Das erste ist, dass ich, seit ich denken kann, fotografiere.
Dad sagt, dass sich die Welt und alles, was darin ist, permanent verändern, in jeder Sekunde eines jeden Tages. Das heißt, dass du in diesem Moment ein anderes Du bist als zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, diesen Satz zu lesen. Verrückt, nicht wahr? Und auch unsere Erinnerung verändert sich. (Ich könnte zum Beispiel schwören, dass der Teddybär, den ich als kleines Kind hatte, grün gewesen ist, doch meinen Eltern nach war er orange.) Aber wenn man ein Foto macht, bleibt das. Dann bleiben die Dinge so, wie sie waren, wie sie sind und wie sie sein werden.
Deshalb liebe ich Fotos.
Nummer zwei ist: Mein Geburtstag ist Ende März, genau zu der Zeit, wenn die Jahreszeiten wechseln. Die Sonne ist schon warm, aber der Wind ist kalt, an den Bäumen zeigen sich Knospen, aber der Boden ist noch halb gefroren. Mum sagt gerne, ich sei mit einem Fuß im Winter und dem anderen im Frühling geboren. Deshalb kann ich nicht still sitzen und gerate (ihrer Meinung nach) ständig in Schwierigkeiten – weil ich nicht nur zu einem Ort gehöre.
Drittens: wir leben in einem kleinen Vorort, umgeben von Feldern und Hügeln (und einer ganzen Menge Geister), von Bäumen, die ihre Farben wechseln, und Flüssen, die im Winter zufrieren, und jeder Menge malerischen Landschaften.
Diese drei Dinge scheinen nichts miteinander zu tun zu haben, die Fotos, die Zeit und der Ort, aber sie sind alle wichtig, das kann ich euch versichern. Sie sind alle Fäden im gleichen Gewebe.
An meinem elften Geburtstag schenkten meine Eltern mir meine Kamera, das alte Modell, das ich noch heute habe, mit einem lila Riemen, einem altmodischen Blitz und einer Blende, die man manuell verstellt. Alle Kinder in der Schule verwenden ihre Handys als Kamera – aber ich wollte etwas Solides, etwas Echtes. Es war Liebe auf den ersten Blick, und ich wusste sofort, wo ich hingehen und was ich als Erstes fotografieren wollte.
Ein paar Meilen von unserem Haus entfernt gibt es eine Stelle, eine Schlucht in den Bergen, wo die Sonne, wenn sie untergeht, genau dort zwischen den beiden Abhängen liegt wie ein Ball, der mit beiden Händen gehalten wird. Ich bin Dutzende Male da gewesen und jedes Mal sieht es anders aus. Ich hatte die Idee, ein Jahr lang jeden Tag dort hinzugehen und jeden einzelnen Sonnenuntergang zu fotografieren.
Und damit wollte ich sofort anfangen.
Wisst ihr noch, was ich über meinen Geburtstag im März gesagt habe? Nun, an diesem Tag in diesem Jahr war es zum ersten Mal so warm, dass ich das Fahrrad nehmen konnte, auch wenn die Luft, wie meine Mutter so schön sagte, immer noch Biss hatte. Also hängte ich mir den lila Riemen der Kamera um den Hals und fuhr mit dem Fahrrad in die Berge, der untergehenden Sonne nach. Die Reifen zischten über den halb gefrorenen Boden, die Straße am Fußballfeld entlang und zur Brücke.
Die Brücke. Es ist nur ein schmaler Steg aus Metall und Holz, der sich über das Wasser spannt, eine Brücke, die immer nur ein Auto auf einmal überqueren kann, weil sie für zwei Autos nicht breit genug ist. Ich war halb darüber hinweg, als ein Lkw um die Ecke rauschte und auf mich zuschoss.
Ich versuchte auszuweichen. Er ebenfalls. Die Reifen quietschten, während mein Fahrrad so heftig gegen das Geländer knallte, dass Funken flogen. So heftig, dass ich über den Lenker flog.
Und über das Geländer.
Ich fiel. Das klingt ganz einfach, nicht wahr? Als ob man stolpert, hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Aber bis zum Wasser, das noch vor ein paar Tagen fest zugefroren war, waren es sieben Meter. Und als ich durch das Eis brach, verschlugen mir der Aufprall und die Kälte den Atem.
Vor meinen Augen wurde es erst weiß, dann schwarz, und als ich wieder sehen konnte, sank ich immer noch, wobei die Kamera um meinen Hals mich wie ein Bleigewicht immer tiefer und tiefer zog. Der Fluss wurde dunkler, die Oberfläche zu einer gerippten weißen Fläche. Irgendwo über dem Wasser glaubte ich jemanden sehen zu können, eine verschwommene Person, nur ein Schatten. Aber dann war sie fort und ich sank immer noch.
Ich dachte nicht ans Sterben.
Ich dachte nur an das eisige Wasser in meinen Lungen, an das drückende Gefühl des Flusses, und selbst diese Dinge begannen zu verblassen, bis ich nur noch dachte: Ich falle vom Licht weg. Es heißt doch immer, man solle darauf zugehen. Ich versuchte es, konnte aber nicht. Meine Glieder waren zu schwer. Und ich hatte keine Luft mehr.
Ich weiß nicht, was dann geschehen ist. Nicht genau, jedenfalls.
Die Welt flackerte irgendwie, wie wenn ein Film plötzlich anhält, hakt und vorspult. Dann saß ich plötzlich am Ufer und rang keuchend nach Atem, während ein Junge in Jeans und einem Superhelden-T-Shirt neben mir saß. Sein blondes Haar stand ab, als wäre er sich gerade mit den Fingern hindurchgefahren.
»Das war knapp«, meinte er.
Ich hatte ja noch keine Ahnung, wie knapp.
»Was ist denn gerade passiert?«, fragte ich zähneklappernd.
»Du bist ins Wasser gefallen«, erklärte er. »Ich hab dich rausgeholt.«
Das war völlig unsinnig, weil ich klatschnass war, er aber nicht mal feucht. Wenn ich nicht so gezittert hätte, meine Augen nicht vom Flusswasser getränt hätten und mein Kopf nicht voller Eis gewesen wäre, wäre mir vielleicht seine merkwürdig graue Hautfarbe aufgefallen, und dass ich beinahe durch ihn hindurch sehen konnte. Aber ich war zu erschöpft und mir war viel zu kalt.
»Ich bin Jacob«, sagte er.
»Cassidy«, antwortete ich und ließ mich zurückfallen.
»He!«, verlangte er und beugte sich über mich. »… bleib wach …«