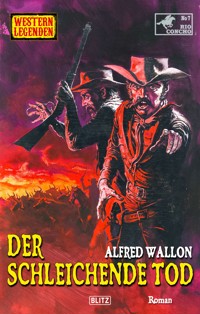Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Civil War Chronicles
- Sprache: Deutsch
Lieutenant Durango und seine Truppe brechen in Richtung Pennsylvania auf. Dort hat General Lee seine Streitkräfte konzentriert. Auf dem Weg dorthin gerät der Zug in einen Hinterhalt und entgleist. Ein mörderischer Kampf entbrennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
Sterben für den Süden
Civil War Chronicles
Buch Vier
Alfred Wallon
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 Blitz-Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Alfred Wallon, Jörg Kaegelmann
Titelbild: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
4804 vom 23.02.2025
ISBN: 978-3-7579-8517-2
Inhalt
Prolog - Der Hinterhalt
Erstes Buch - Das Grauen von Bull Run
Zweites Buch - Der Schattenreiter
Über den Autor
Prolog - Der Hinterhalt
Lieutenant Jay Durango und seine Männer schliefen, während der Zug durch die Nacht fuhr. Oder besser gesagt, sie versuchten, es sich so bequem wie möglich zu machen. Das war in den mit konföderierten Soldaten besetzten Waggons aber alles andere als einfach. Denn das Schnarchen einiger Männer oder das Rattern des Zuges riss viele der Soldaten immer wieder aus ihren Träumen. Glücklich waren diejenigen, deren Erschöpfung der letzten Tage endlich ihren Tribut forderte und sie tief und fest schlafen ließ.
Auch Durango hatte die Beine ausgestreckt und den Hut ins Gesicht gezogen. Mit über der Brust verschränkten Armen hatte er sich ein wenig zu entspannen versucht. Jedoch war dieses Gefühl der Ruhe nicht von langer Dauer, denn das leise Stöhnen seines Kameraden Porter sorgte dafür, dass Durango von einer Sekunde zur anderen wach wurde.
„Nein ...“, keuchte der Soldat. „Ihr dürft ihn nicht ...“
„Ganz ruhig, Junge“, versuchte Sergeant Sean McCafferty den aufgeregten Porter zu besänftigen. McCafferty saß direkt neben Porter und war durch dessen unruhige Bewegungen ebenfalls aus dem Schlaf gerissen worden. Ein kurzer Blick zu Durango zeigte dem Sergeant, dass dieser sofort erkannt hatte, wie es um Porter bestellt war. Wahrscheinlich hatte er einen sehr realistischen Albtraum gehabt.
„Mac!“, stieß Porter aufgeregt hervor. „Verdammt, ich dachte schon, dass ...“
„Du hast nur geträumt“, sagte McCafferty. „Komm wieder zu dir. Es ist alles in Ordnung.“
Auch Fisher, Higgins und Vance waren nun aufgewacht und blickten zu ihrem Kameraden, den die Schrecken des Traums noch immer nicht losließen. Zum Glück bekamen die meisten anderen Soldaten von diesem kurzen Zwischenfall nichts mit, denn Durango und seine Männer verhielten sich leise.
„Wo sind wir?“, murmelte Porter und schien erleichtert zu sein, dass seine Kameraden bei ihm waren.
„Auf dem Weg nach Nordosten“, ergriff nun Lieutenant Durango das Wort. „Schau mich nicht so erstaunt an, Frank. Ich weiß zwar nicht, was du gerade geträumt hast. Aber noch sind wir alle am Leben.“
„Das ist auch besser so.“ Porter nickte seufzend und wich dem Blick des Lieutenants für einen kurzen Moment aus. „Verdammt, manchmal weiß man wirklich im ersten Moment nicht, was Traum und was Wirklichkeit ist. Ich war mitten auf einem Schlachtfeld, und ringsherum donnerten die Kanonen pausenlos. Überall war dichter Rauch, und ich hörte die Schreie von vielen sterbenden Männern. Ich war ganz allein, und weiter drüben in dem dichten Rauch sah ich eine schreckliche Gestalt, die ...“ Porter brach ab und schüttelte kurz den Kopf. „Ich dachte, nun wäre es endgültig aus.“
„Noch nicht“, grinste McCafferty und stieß seinem Kameraden grinsend in die Seite. „Wir haben vermutlich einen ganzen Trupp Schutzengel, der über uns wacht. Und jetzt beruhige dich endlich.“
„Tut mir leid“, murmelte Porter. „Ich wollte euch nicht aufwecken.“
„Bei dieser holprigen Fahrt kann man ohnehin nicht richtig schlafen“, winkte McCafferty ab. „Also mach dir jetzt keine Vorwürfe. Machen wir eben das Beste draus.“
Das war leichter gesagt als getan. Lieutenant Durango und seine Truppe hatten in den letzten Wochen viele schreckliche Dinge erlebt und gesehen. Der Tod war ihr ständiger Begleiter gewesen, und mehr als nur einmal hatten sie sich in solch ausweglosen Situationen befunden, dass keiner von ihnen mehr daran geglaubt hatte, entkommen zu können. Aber immer wieder hatte ihnen das Schicksal eine Chance gegeben. So auch zu dem Zeitpunkt, als sie das belagerte Vicksburg noch hatten verlassen können, um General Lee und seinem Stab von dieser sich immer deutlicher abzeichnenden Niederlage zu berichten.
Wie sie aber mittlerweile wussten, hielt sich Lee gar nicht mehr in Richmond auf, sondern war mit dem größten Teil seiner Truppen weiter in Richtung Nordosten marschiert, wo es bald zu einer weiteren Konfrontation mit Grants Armee kommen würde. Irgendwo in Pennsylvania.
„Wie lange wird es noch dauern, bis wir endlich am Ziel sind, Mac?“, wollte Higgins wissen. Der Sergeant gab ihm jedoch mit einer eindeutigen Geste zu verstehen, dass er das selbst nicht wusste, und schaute deshalb zu seinem Lieutenant.
„Major Wills hat gesagt, dass der Zug einige kritische Regionen durchqueren muss“, sagte Durango. „Deshalb müssen wir immer wieder auf Nebenstrecken ausweichen.“
Er konnte diesen Satz nicht zu Ende sprechen, weil auf einmal ein gewaltiger Donnerschlag ertönte. Von einem Augenblick zum anderen veränderte sich alles, und Durangos Leute wurden erneut zum Spielball dramatischer Ereignisse.
* * *
Eine unsichtbare Faust packte Durango und riss ihn einfach nach vorn. Genau auf Sergeant McCafferty zu, der gar nicht begriff, wie ihm geschah, als Durango auf ihn prallte und ihn mit zur Seite riss. Der Ire fluchte, verlor das Gleichgewicht und hörte, wie seine Kameraden zu schreien begannen.
Higgins wurde einige Schritte nach vorn gestoßen und prallte so hart gegen einen Holzsitz, dass er für einige Sekunden benommen liegen blieb. Porter und Vance hatten mehr Glück als ihr Kamerad. Sie hatten sich geistesgegenwärtig an einer Stange festhalten können, genau wie Fisher, der angesichts dieser plötzlichen Ereignisse kreidebleich geworden war.
Als Durango sich aufzurappeln versuchte, hörte er plötzlich das Echo unzähliger Schüsse und sah, wie Corporal Graham nur wenige Schritte von ihm entfernt mit einem grässlichen Röcheln in die Knie ging.
Irgendwo in diesem ganzen Durcheinander befand sich auch Major Luther Wills, der versuchte, Ordnung in dieses ganze Chaos zu bringen. Aber nur wenige Sekunden später wurde er selbst von einer Kugel in den Kopf getroffen und nach hinten gestoßen.
„Wir werden angegriffen!“, schrie ein Soldat voller Panik. „Die Yankees haben einen Hinterhalt gelegt!“
Durango hob den Kopf, spähte aus dem Fenster und erkannte zu seinem Entsetzen, dass weiter vorn meterhohe Flammen in den nächtlichen Himmel emporstiegen. Immer wieder fielen neue Schüsse, und ein weiterer Soldat brach getroffen zusammen.
Natürlich wussten weder Durango noch die anderen Soldaten, was weiter vorn genau geschehen war. Sie wussten nur, dass sie unweigerlich verloren waren, wenn sie sich weiter in die Enge treiben ließen.
„Raus hier!“, brüllte Durango, während er seine Waffe aus dem Holster riss. „Sonst knallen sie uns alle ab!“
Ein kurzer Blick zu McCafferty signalisierte ihm, dass der irische Sergeant den Ernst der Lage längst begriffen hatte. Auch die übrigen Männer seiner kleinen Einheit handelten sofort und taten das, was Durango ihnen befohlen hatte. Sie näherten sich dem Ende des Waggons und kletterten rasch ins Freie, während sie Feuerschutz von ihren Kameraden bekamen.
Durango hatte mehr Glück als Verstand, als zwei Kugeln haarscharf an ihm vorbeistrichen. Sofort duckte er sich wieder und zielte in die Richtung, wo er das Mündungsfeuer zu sehen geglaubt hatte. Auch McCafferty und die übrigen Soldaten erwiderten jetzt das Feuer, während sie im Schutz der Nacht nach einer Deckung suchten.
Weiter vorn brannte der Kessel der Lokomotive lichterloh. Bruchteile von Sekunden später erfolgte eine weitere Explosion, die die Soldaten fast taub werden ließ. Metallteile und Eisenverstrebungen wurden umhergeschleudert, während eine dichte Rauchwolke in den nächtlichen Himmel stieg und allen signalisierte, dass es hier kein Weiterkommen mehr geben würde.
„Da drüben in den Büschen sind sie!“, rief ein Corporal, während immer noch Schüsse auf beiden Seiten fielen. Noch nicht einmal zehn Minuten waren vergangen, seit die erste Explosion erfolgt war, und die Lage spitzte sich gefährlich zu, nachdem Major Wills von einer Kugel getroffen und getötet worden war.
Durango ergriff nun die Initiative und scharte weitere Soldaten um sich, die das Feuer erwiderten und die Heckenschützen und deren Kumpane am weiteren Vordringen hinderten. Durango wusste genau, dass die nächsten Minuten von entscheidender Bedeutung waren. Er musste um jeden Preis verhindern, dass er und die anderen Soldaten von den Gegnern weiter in die Enge gedrängt wurden. Deshalb hatte er genau das getan, womit niemand von den Feinden rechnete, indem er und die übrigen Soldaten die Waggons verließen und dadurch die Regeln des Kampfes änderten.
„Mac!“, rief Durango dem Iren zu. „Nimm dir zehn Männer und versuch, die Flanke anzugreifen. Beeil dich!“
„Gute Idee.“ Der Sergeant nickte und wählte sofort die betreffenden Leute aus. Zu ihnen gehörten auch Fisher, Porter und Higgins. Nur Vance blieb bei Durango und den Soldaten, die ihre derzeitige Position verteidigten und ihren weiter vorpreschenden Kameraden Feuerschutz gaben.
Die Schüsse der Gegner nahmen ab. Der eine oder andere wütende Schrei erklang, als McCafferty und seine Leute näher herankamen.
„Los, wir schnappen sie uns!“, entschied Durango, als er nach wenigen Minuten die Lage richtig einschätzte. Die Yankees wurden von McCafferty und seinen Leuten beschäftigt. Eine bessere Gelegenheit als diese gab es nicht mehr.
Geduckt verließen Durango, Vance und der Corporal mit fünfzehn weiteren Soldaten ihre Deckung und näherten sich von rechts außen der Stelle, wo sie die meisten ihrer Gegner vermuteten. Die Flammen hatten mittlerweile auf den Tender und den ersten Waggon des Zuges übergegriffen und erhellten die Nacht an dieser Stelle. Es roch penetrant nach geschmolzenem Eisen und Öl, aber das nahmen Durango und seine Kameraden nur am Rande wahr, denn ihr Interesse galt natürlich den Gegnern aus dem Hinterhalt.
Weiter links fielen mehr Schüsse, deren Echo sich mit lauten Triumphschreien mischten. Mac riskiert wieder mal sehr viel, dachte Durango, als ihm klar wurde, was das bedeutete. Aber wir sind auch gleich zur Stelle und werden diesen verdammten Bastarden ordentlich einheizen.
Noch bevor er diesen Gedanken so richtig zu Ende gebracht hatte, tauchten zwischen den Büschen plötzlich schemenhafte Gestalten auf. Einige von ihnen drehten sich immer wieder um und schossen in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Das reichte für Durango aus, um sofort die richtige Entscheidung zu treffen.
„Schießt, Männer!“, feuerte er seine Leute an und nahm einen der Gegner aufs Korn. Bruchteile von Sekunden später fiel der Schuss und streckte den Mann nieder. Auch Vance hatte mittlerweile das Feuer eröffnet, und die Flucht der Yankees geriet ins Stocken, als sie nun völlig überraschend von zwei Seiten bedrängt wurden. Und das, obwohl sie zunächst am längeren Hebel gesessen und gehofft hatten, mit den Rebellen leichtes Spiel zu haben.
Durango erkannte sofort die Chance und ließ nicht locker. Auch McCafferty und seine Leute setzten den Gegnern ordentlich zu, und der heimtückische Hinterhalt wurde zu einem schrecklichen Fiasko für die Yankees.
Drei weitere Männer wurden von Kugeln niedergestreckt, während ihre Kumpane hastig das Weite suchten und im Dunkel der Nacht untertauchten. McCafferty wollte ihnen noch nachsetzen, aber Durangos lauter Befehl stoppte ihn.
„Es reicht!“, rief er. „Die haben genug! Lasst sie!“
„Der zweite Waggon!“, rief auf einmal Fisher besorgt. „Unsere Pferde ...“
Durango drehte sich um und erkannte sofort die Gefahr. Die Flammen breiteten sich immer weiter aus und leckten nun gierig nach dem trockenen Holz der beiden Frachtwaggons, in denen die Pferde untergebracht waren. Ihr lautes Wiehern war bis hierher zu hören. Dumpfe Schläge gegen die Waggonwände zeigten, in welcher Panik sich die Tiere befanden.
„Holt sie raus“, wandte sich Durango an Fisher und Vance. „Beeilt euch.“
Fisher und Vance sowie vier weitere Männer eilten auf die Wagen zu und bemühten sich mit vereinten Kräften, die völlig verängstigten Pferde aus den Waggons zu holen, während McCafferty und einige Kameraden die nähere Umgebung nach den geflüchteten Yankees absuchten. Aber sie waren im Dunkel der Nacht untergetaucht und hatten das Weite gesucht, weil ihr heimtückischer Plan nicht aufgegangen war. Hätte Durango nicht die Initiative ergriffen und den Spieß umgedreht, dann wäre alles ganz anders verlaufen.
In der Zwischenzeit hatten sich Vance und Fisher um die Tiere gekümmert und sie in Sicherheit gebracht. Die Flammen suchten weiter nach Nahrung, und es dauerte nicht mehr lange, bis sie auch auf die anderen Waggons übergriffen. Die Hitze hatte sich mittlerweile so stark entwickelt, dass Mensch und Tier Abstand zu dem brennenden Zug halten mussten.
„Diese Schweinehunde“, brummte Corporal Graham. „Wenn sie nicht geflüchtet wären, dann ...“
„Sie haben trotzdem das erreicht, was sie wollten“, brummte Durango, als er einen kurzen Blick auf die verbogenen Schienen und den brennenden Zug warf. „Wir kommen nicht mehr so schnell weiter, wie wir es ursprünglich beabsichtigt hatten. Kennen Sie die Gegend, Corporal?“
Graham schüttelte den Kopf.
„Gut, dann werden wir uns schon irgendwie durchschlagen“, sagte Durango. „Die Männer sollen aufsitzen. Es wird Zeit, dass wir von hier verschwinden. In dieser Nacht kann man das Feuer schon von Weitem sehen. Die Yankees werden ihre Kameraden informieren, und dann kann es brenzlig für uns werden, wenn wir noch hier in der Nähe sind.“
„Sie sind der einzige Offizier, Lieutenant“, meinte Graham. „Meine Kameraden und ich würden uns Ihnen gerne auf dem Weg nach Nordosten anschließen.“
„Einverstanden.“ Durango nickte, obwohl er es eigentlich gewohnt war, mit einer kleineren Einheit zu operieren. „Reiten wir.“
Zehn Minuten später ritten Durango und die übrigen Soldaten hinaus in die Nacht. Auch als sie schon eine Meile vom Ort der dramatischen Ereignisse entfernt waren, sahen sie immer noch den hellen Schein des großen Feuers.
* * *
Sie waren die ganze Nacht geritten. Erst als sich am fernen Horizont die ersten rötlichen Schimmer der Morgendämmerung abzeichneten, befahl Durango einen Halt und gönnte seinen Leuten endlich eine kurze Ruhepause.
Es waren insgesamt vierzig Soldaten, die unter seinem Kommando standen und darauf hofften, dass er sie auf sicherem Wege nach Nordosten bringen würde, um sich dann wieder mit den konföderierten Truppen zu vereinigen.
Aber das war leichter gesagt als getan, denn auch Durango kannte das Land nicht und hatte demzufolge auch keine Ahnung, wo sich die Nordstaatenarmee jetzt befand. Vicksburg lag mittlerweile weit entfernt, und was an anderen Schauplätzen des Krieges zwischenzeitlich stattgefunden hatte, darüber ließ sich nur spekulieren.
Als die Sonne aufging und die letzten Schatten der Dämmerung vertrieb, beschloss Durango, zumindest ein weiteres Stück dem Schienenstrang zu folgen. Denn das war der einzige Hinweis darauf, dass sie auch die Richtung beibehielten. Aber das hieß auch, dass sie doppelt wachsam sein mussten, denn in der Nähe der Schienen würden sie zwangsläufig auf feindliche Patrouillen stoßen, die das Gelände durchkämmten. Schließlich war eine Eisenbahnlinie nach wie vor von großer militärischer Bedeutung für beide Seiten. Denn wer den Schienenstrang kontrollierte, hatte zwangsläufig den Vorteil auf seiner Seite.
Deshalb hatte Durango entschieden, Sergeant McCafferty und fünf weitere Späher loszuschicken. Wenn sie wirklich Hinweise auf die Nähe von feindlichen Truppen entdeckten, würden Durango und seine Leute so rechtzeitig gewarnt sein und konnten dementsprechende Maßnahmen treffen.
Der irische Sergeant ließ seine Blicke über die von zahlreichen Büschen und Bäumen bewachsenen Hügel schweifen, zwischen denen der Schienenstrang verlief. Die Sonne war mittlerweile ein gutes Stück weiter nach Süden gewandert. Kein Wölkchen zeigte sich am blauen Himmel. Es war ein schöner, sonniger Tag in einer idyllischen friedlichen Landschaft. Nichts wies darauf hin, dass der Norden und der Süden miteinander Krieg führten und dass es schon unzählige Tote auf beiden Seiten in großen Schlachten gegeben hatte. Zumindest diesen Teil des Landes schien der Krieg noch nicht erreicht zu haben. Das hieß aber nicht, dass dies auch so bleiben würde.
McCaffertys Gedanken brachen ab, als er Corporal Graham heranreiten sah. Der Mann war vor einer Viertelstunde losgeritten, um das Gelände weiter nördlich zu erkunden, und kam jetzt schon wieder zurück. Das bedeutete nichts anderes, als dass er etwas entdeckt haben musste.
„Da ist eine Station!“, berichtete der Corporal ganz aufgeregt. „Ich habe einen einzelnen Reiter gesehen, der sich von Norden her näherte.“
„Und was ist daran so außergewöhnlich?“, wollte McCafferty von dem Corporal wissen.
„Er hielt immer wieder an und blickte zurück“, berichtete der Corporal weiter. „Als ob er sichergehen wollte, dass ihm niemand folgt. Erst dann ritt er weiter zur Station.“
McCafferty hörte interessiert zu und kratzte sich nachdenklich an der Schläfe, während der Corporal weitererzählte.
„Ich sah eine Frau, die aus dem Stationsgebäude kam. Sie trug Männerkleidung. Aber ich konnte trotzdem an den langen Haaren erkennen, dass sie ...“ Seine Stimme geriet ins Stocken. „Na ja, dass sie eben eine Frau war. Sergeant, warum in aller Welt trägt eine Frau Hosen, und weshalb hält sie sich auf dieser einsamen Station abseits der Schienen auf? Die Gebäude sehen heruntergekommen aus. Als ob dort schon lange niemand mehr Hand angelegt hat. Vielleicht war das früher ein Handelsposten. Würde mir das Anwesen gehören, dann hätte ich schon längst dafür gesorgt, dass ...“
„Ich denke, das schauen wir uns mal aus der Nähe an“, stoppte McCafferty den Redeschwall des Corporals. „Wer weiß, was das alles in Wirklichkeit zu bedeuten hat?“
* * *
„Ist Ihnen jemand gefolgt?“
Die Stimme der schlanken dunkelhaarigen Frau klang besorgt, während sie ihre Blicke über die Hügel schweifen ließ. Ihr blasses Gesicht spiegelte die Sorge und die Unruhe wider, die sie angesichts dieses Treffens erfasst hatte. Denn sie riskierte eine ganze Menge, und das wusste sie.
„Nein!“ Die Stimme des vollbärtigen Mannes klang spröde, während er sein Gewehr an sich nahm und auf die Frau zuging. „Ich habe aufgepasst. Es ist weit und breit niemand zu sehen.“
„Bringen Sie Ihr Pferd hinters Haus“, bat ihn die Frau. „Und beeilen Sie sich. Ich möchte nicht, dass man von dort drüben etwas sehen kann.“
„Ich kümmere mich sofort darum“, erwiderte Will Calhoun und griff nach den Zügeln seines Pferdes. Rasch führte er das Tier hinter das wuchtige Blockhaus und band es dort an einem Pfosten fest. Anschließend ging er zurück ins Haus, wo eine sichtlich ungeduldige Elizabeth van Lew auf ihn wartete.
Will Calhoun hatte sich auf dieses Treffen mit gemischten Gefühlen eingelassen. Aber seit ihm sein Bruder Larry dazu verholfen hatte, Mitglied von Allan Pinkertons Detektivtruppe zu werden, hatte er schon einige ungewöhnliche Situationen erlebt. Dass allerdings eine äußerlich eher harmlos wirkende Frau in Wirklichkeit eine wichtige Informantin der Union war und schon seit etlichen Monaten auf konföderiertem Territorium operierte, bereitete ihm gewaltiges Kopfzerbrechen. Denn er hatte noch niemals zuvor eine Frau getroffen, die als Spionin unterwegs war und auf diese Weise entscheidende Erkenntnisse übermitteln konnte, und das schon seit geraumer Zeit. Ohne dass es General Lee wusste.
Will schloss die Tür hinter sich und blickte sich um. Er sah sofort, dass diese Station schon lange verlassen war. Staub hatte sich breitgemacht, und es roch muffig. Aber das spielte keine Rolle. Schließlich war er nicht hierhergekommen, um ein Kaffeekränzchen zu halten, sondern um wichtige Informationen entgegenzunehmen, die Elizabeth van Lew für ihn bereithielt.
„Können Sie sich legitimieren?“, erkundigte sich die Frau. „Wer sagt mir denn, dass Sie wirklich derjenige sind, für den ich Sie halte?“
Will grinste, während er seinen Hut abnahm und ihn auf den Tisch legte.
„Glauben Sie vielleicht, ich würde einen Ausflug in diese gottverlassene Gegend machen, Mrs. van Lew?“, fragte er provokant und bemerkte das kurze Aufblitzen in ihren Augen. „Kommen wir lieber zur Sache. Mister Pinkerton hat mich gebeten, dieses Treffen wahrzunehmen. Und hier bin ich jetzt. Also sagen Sie mir, um was es geht. Und dann sollten wir beide zusehen, dass wir so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden. Schließlich müssen wir immer noch damit rechnen, auf Späher der Konföderierten zu stoßen. Dann hätten auch Sie einen gewissen Erklärungsnotstand.“
„Ich habe alles aufgeschrieben, was Sie wissen müssen“, sagte die Frau und holte einen Umschlag hervor, den sie auf den Tisch legte. „Das Papier enthält wichtige Informationen über das Libby-Gefängnis und den Zustand der inhaftierten Soldaten. Und zusätzlich noch weitere Details über Pläne der Konföderierten.“
„Waren Sie selbst dort?“, wollte Will wissen.
„Glauben Sie, ich würde Märchen aufschreiben?“, erwiderte Elizabeth van Lew gereizt. „Ich lebe schon seit über einem Jahr in Richmond, und bei bestimmten Gelegenheiten sind Offiziere manchmal sehr redselig. Hören Sie, ich weiß nicht, wie lange Sie schon für Pinkerton arbeiten, Mister ...?“
„Calhoun. Will Calhoun“, kam prompt die Antwort. „Noch nicht lange.“
„Kennen Sie einen Larry Calhoun?“
„Das ist mein Bruder“, sagte Will. „Er hat mich in Pinkertons Truppe eingeschleust. Warum wollen Sie das wissen?“
„Weil Sie ganz anders als er sind. Larry Calhoun ist ein sehr freundlicher Mann.“
„Manchmal kann man sich seine Gesprächspartner eben nicht aussuchen“, brummte Will und nahm den Umschlag an sich. Er verbarg ihn unter seinem Hemd. „Ist sonst noch etwas, was Sie mir sagen wollen?“
„Ja.“ Elizabeth van Lew nickte leicht verstimmt. „Es ist ein gut gemeinter Rat, den ich Ihnen gebe. Ich weiß zwar nicht, was mit Ihnen ist, aber Sie sollten irgendwann damit fertig werden. Sonst werden Sie daran zerbrechen.“
„Ich glaube, das ist einzig und allein meine Sache“, erwiderte Will leicht gereizt, weil es ihn ärgerte, dass Elizabeth van Lew offensichtlich seine innersten Gedanken erraten konnte. „Ich komme schon klar damit.“
„Schauen Sie mich nicht so wütend an“, sagte die Frau. „Wenn Sie die Wahrheit nicht vertragen können, ist das nicht mein Problem.“
„Ich finde, es reicht jetzt“, erwiderte Will und griff nach seinem Hut. „Sie haben mir das ausgehändigt, weswegen ich hier bin. Für mich ist das Gespräch damit beendet. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Rückweg mache, und ich rate Ihnen, das auch zu tun. Diese Gegend ist nicht sicher. Auf dem Weg hierher bin ich auf Spuren gestoßen. Von vielen Reitern. Passen Sie also besser auf sich auf.“
Elizabeth van Lew kam nicht mehr dazu, darauf etwas zu erwidern, denn in diesem Moment wurde die Tür des Hauses aufgestoßen, und drei bewaffnete Männer traten ein.
„Ich würde noch nicht einmal daran denken“, sagte einer der grau uniformierten Männer, der am rechten Ärmel den Winkel eines Sergeants trug. „Lassen Sie die Hände besser oben, Mister!“
Will Calhoun murmelte einen leisen Fluch angesichts dieser unverhüllten Drohung.
„Ich habe ihn genau im Visier, Mac!“, erklang auf einmal eine Stimme vom Fenster her, die Will erneut zeigte, in welcher Gefahr er sich jetzt befand. Aber was ihn noch mehr beunruhigte, war das Gesicht des Sergeants. Er kannte diesen Mann, und wenige Sekunden später wurde ihm klar, wo er ihn zuletzt gesehen hatte.
* * *
Lieutenant Durangos Miene wirkte angespannt, als er und seine Männer sich rasch dem Gebäudekomplex näherten. Nachdem er erfahren hatte, dass McCafferty auf eine abgelegene Station gestoßen war und dort zwei verdächtige Personen beobachtet hatte, die offensichtlich darum bemüht waren, nicht entdeckt zu werden, hatte er es sehr eilig, sich selbst ein Bild von der ganzen Sache zu machen.
Wenige Minuten später zügelte er sein Pferd direkt vor dem Haus und stieg ab. Ein Soldat aus Major Wills Truppe kam aus der Tür und bat den Lieutenant, einzutreten.
Als Durango den Raum betrat, sah er zuerst die Frau, deren Wangen vor Wut gerötet waren. Ihre Augen sprühten Blitze, als sie sich an Durango wandte.
„Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten, Lieutenant“, redete sie auf Durango ein. „Ich habe nichts getan, was ...“
„Sie ist eine Spionin, Lieutenant“, fiel ihr McCafferty ins Wort. „Wir haben draußen vor dem Fenster Teile des Gesprächs mitbekommen, bevor wir uns eingemischt haben. Ich glaube, wir sind durch Zufall einer großen Sache auf die Schliche gekommen. Und das Verrückte daran ist, dass ausgerechnet dieser Mann dort damit zu tun hat.“
Die Art und Weise, wie McCafferty das sagte, ließ Durango hellhörig werden. Erst jetzt musterte er den vollbärtigen Mann, der von zwei Soldaten mit vorgehaltenen Waffen in Schach gehalten wurde, etwas genauer. Und dann erinnerte er sich an ihn.
„Calhoun“, murmelte er. „Was für ein Zufall.“
„Wo er sich aufhält, ist vermutlich sein Bruder auch nicht weit“, meinte McCafferty. „Los, gib dem Lieutenant den Umschlag, den du von der Frau bekommen hast. Ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf.“
Als Calhoun nicht gleich reagierte, stieß ihm einer den Soldaten den Revolverlauf hart in den Rücken. Erst dann griff Calhoun nach dem Umschlag und händigte ihn wortlos dem Lieutenant aus. Dieser öffnete ihn und warf einen kurzen Blick auf den Inhalt. Seine Miene wirkte ungewöhnlich ernst, als ihm klar wurde, was das bedeutete.
Diese Frau ist eine Spionin der Yankees, und Calhoun ist ihr Gehilfe, dachte Durango. Und ausgerechnet hier draußen auf dieser abgelegenen Station kreuzen sich wieder unsere Wege. Ist das wirklich noch Zufall?
„Ich glaube, General Lee wird sich für diesen Umschlag sehr interessieren“, meinte er mit einem wütenden Blick auf Calhoun. Weil er sich jetzt wieder daran erinnerte, unter welch dramatischen Umständen die Calhoun-Familie immer wieder mit ihm und seinen Männern zusammengetroffen war.
Erstes Buch - Das Grauen von Bull Run
„Da kommen Reiter, Pa!“
Brett Justin Calhoun blickte hinauf zur Hügelkuppe, als er die warnende Stimme hörte. Wenige Sekunden später musste der kräftige Farmer dann erkennen, dass sein Sohn Will recht hatte. Tatsächlich, es war ein ganzer Reitertrupp, der sich der Farm im grünen Shenandoah Valley näherte. Und sie trugen blaue Uniformen!
„Will! Josh!“, rief Brett Justin Calhoun nun mit lauter Stimme seinen beiden Söhnen zu. „Geht rüber ins Haus und wartet dort. Nun beeilt euch doch!“
Während er das sagte, griff er nach seiner Enfield Rifle und sah zu, wie sich der Reitertrupp seiner Farm näherte. An der Spitze ritt ein Mann, den Calhoun nur zu gut kannte. Sein Name war Mathew Dobbs, und er hatte schon seit Wochen nichts Besseres zu tun, als Freiwillige zu suchen, die sich der Armee des Nordens anschließen und kämpfen sollten. Nun kam er gleich mit einem ganzen Trupp Soldaten auf Brett Justin Calhouns Farm, und was das bedeutete, das war klar. Trotzdem blieb Calhoun noch immer ganz ruhig und wartete ab, bis die Männer ihre Pferde zügelten.
„Was wollen Sie hier, Dobbs?“, richtete Calhoun nun das Wort an den untersetzten Mann im schwarzen Anzug, der in Begleitung eines Colonels und dessen Schwadron gekommen war. „Ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, dass Sie meine Söhne nicht bekommen werden!“
Ein Schatten überzog das Gesicht von Mathew Dobbs, als er den scharfen Ton des Farmers vernahm. Trotzdem blieb er freundlich, als er sich nun an Calhoun wandte.
„Mister Calhoun, das hier ist Colonel Israel Richardson“, sagte er. „Ich glaube, es ist besser, wenn er Ihnen selbst erzählt, wie wichtig es ist, dass unsere Truppen ...“
„Halten Sie den Mund, Dobbs!“, fiel ihm Brett Justin Calhoun ins Wort und richtete dabei den Lauf seiner Enfield Rifle auf den Magen des untersetzten Mannes. Dobbs wurde daraufhin eine Spur blasser und musste erst einmal schlucken.
„Sir, vielleicht geben Sie mir Gelegenheit, zu sprechen“, ergriff nun Colonel Richardson das Wort. „Oder wollen Sie auf einen Offizier der Union schießen?“
„Reden Sie schon, Colonel“, erwiderte der Farmer, ohne auf die Frage Richardsons direkt einzugehen. „Spucken Sie aus, was Sie zu sagen haben, obwohl ich mir das schon denken kann. Sie wollen meine Söhne haben, nicht wahr?“
„Mister Calhoun, wir haben Krieg“, antwortete Israel Richardson. „Und das ändert eine ganze Menge, auch hier draußen im Shenandoah Valley. Auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen. Aber niemand kann die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Fast alle jungen Männer haben sich unseren Truppen angeschlossen, und sie kamen freiwillig. Wir können stolz auf sie sein, weil ...“
„... weil diese Narren wohl ganz wild darauf sind, Krieg zu spielen!“, unterbrach ihn Calhoun. „Aber das hier ist eine Farm, wo von morgens bis abends hart gearbeitet wird. Ich habe zwei Söhne, Colonel, und ich bin stolz auf sie. Weil sie hier ihren Mann stehen, nicht in diesem unsinnigen Bruderkrieg!“
Während er das sagte, beugte sich Dobbs im Sattel kurz herüber zu dem Offizier und flüsterte ihm etwas zu. Colonel Richardson nickte nur kurz und richtete dann seine Blicke wieder auf den bewaffneten Farmer.
„Sie haben noch einen Sohn, Mister Calhoun“, fuhr der Colonel fort. „Und man sagt, dass er sich in Washington aufhält und sich dort sehr für die Sache der Union engagiert. Meinen Sie nicht, dass ...?“
„Jetzt hören Sie mir mal gut zu!“, sagte der Farmer nun zu dem Colonel, als die Rede auf seinen ältesten Sohn Larry fiel, der vor mehr als einem Jahr die Farm verlassen hatte. „Dieser Bursche hat sich nur vor der Farmarbeit drücken wollen, und es ist mir ziemlich egal, was er jetzt gerade treibt. Also kommen Sie mir ja nicht damit, ist das klar?“ Als Richardson nichts darauf erwiderte, fuhr Calhoun fort: „Meine beiden Söhne Josh und Will werden ihren Hals nicht für einen Krieg riskieren, mit dem wir weiß Gott nichts zu tun haben. Ich hoffe, Sie haben mich jetzt verstanden, Sir!“
„Vielleicht können mir das Ihre Söhne ja selbst sagen, Mister Calhoun“, meinte Colonel Richardson und blickte hinüber zum Farmhaus.
Brett Justin Calhoun überlegte einen kurzen Moment, bevor er schließlich nickte. „Ich weiß zwar nicht, was Sie damit erreichen wollen, aber nun gut.“ Er drehte sich um, erhob seine Stimme. „Will! Josh! Ihr könnt herkommen, dieser Offizier möchte mit euch reden!“
Sekunden vergingen, bis sich die Haustür öffnete und Brett Justin Calhouns Söhne ins Freie traten. Natürlich spürten sie sofort die prüfenden Blicke des Offiziers auf sich gerichtet, denn Will und Josh waren ebenfalls kräftige große Burschen, genau wie ihr Vater.
„Jungs, ich glaube, ich muss euch nicht mehr sagen, was im Moment geschieht“, richtete Colonel Richardson nun das Wort an die beiden Farmersöhne. „Schon bald wird es die erste Schlacht geben, und ihr wisst, dass wir dann vorbereitet sein müssen. Wollt ihr euch denn uns nicht anschließen und für eine Sache kämpfen, die es wert ist?“
Will blickte seinen jüngeren Bruder Josh an, als erwarte er von ihm eine Erwiderung auf die provozierende Frage des Colonels. Und Josh war es auch, der nun das Wort ergriff.
„Colonel, mein Bruder und ich wollen bei unserem Vater bleiben“, kam es über die Lippen Joshs. „Wir werden hier gebraucht, und deshalb kommen wir nicht mit. Sonst geht unsere Farm zugrunde, wenn wir hier alles im Stich lassen.“
„Und das sagt ein Bursche, der mit John Brown geritten ist!“, mischte sich Dobbs mit höhnender Stimme ein. „Bist du jetzt feige geworden, Junge?“
Josh Calhoun blieb ganz ruhig, als er die anklagenden Worte vernahm. Stattdessen blickte er Dobbs verachtend an.
„Mister Dobbs, ich weiß, was es bedeutet, zu kämpfen, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Als ich in Harpers Ferry war und beinahe draufgegangen wäre, saßen Sie doch ganz bestimmt hinter Ihrem warmen Ofen und haben es sich da gemütlich gemacht. Also erzählen Sie mir nichts von Feigheit, verstanden?“
Er sah mit sichtlicher Genugtuung, wie Dobbs bei diesen Worten zusammenzuckte. Erst dann wandte er sich wieder an den Colonel.
„Sir, es gibt noch kein Recht, das uns zwingt, Ihrer Armee beizutreten“, fuhr er dann fort. „Also geben Sie es endlich auf, uns überreden zu wollen. Sie werden uns nicht von unserem Entschluss abbringen, hierzubleiben. Es ist so, wie es Pa schon gesagt hat, dieser Krieg ist nicht unsere Sache, und wir werden uns da nicht einmischen.“
„Gut, dann werdet ihr alle auch die Folgen tragen müssen“, bekam Josh von Colonel Richardson zu hören. „Bestimmt werden sich die anderen Menschen hier sehr dafür interessieren, wenn sie erfahren, wie ihr zu dem Krieg steht. Junge, es ist eure Sache, was ihr tut. Aber bei Gott, ihr macht einen Fehler, ihr wisst es nur noch nicht!“
„Das reicht jetzt, Colonel!“, ergriff Brett Justin Calhoun mit wütender Stimme das Wort. „Sie wollten mit meinen Söhnen reden, nun gut, Sie haben das jetzt getan. Also gibt es keinen Grund mehr für Sie und Ihre Männer, noch länger hierzubleiben. Verlassen Sie unser Land!“
Der Unionsoffizier musste einsehen, dass er bei einem Mann wie Calhoun mit seinem Anliegen auf taube Ohren stieß. Seufzend hob er die Hand und gab seinen Leuten ein Zeichen, wieder loszureiten.
Während die kleine Schwadron vom Hof der Farm ritt, hörten Brett Justin Calhoun und seine Söhne die erregte Stimme von Mathew Dobbs, der sich wahrscheinlich nicht beruhigen konnte, weil die Soldaten unverrichteter Dinge wieder abgezogen waren. Vor allen Dingen Josh blickte den Uniformierten recht nachdenklich hinterher. So lange, bis ihn die Stimme des Vaters aus seinen Gedanken riss.
„Was ist los, Junge?“, bekam er dann zu hören. „Zerbrich dir nicht unnötig den Kopf über Dinge, die uns nun weiß Gott nicht betreffen. Geh mit Will hinüber in den Stall. Es ist Zeit, das Vieh zu füttern. Und wenn ihr beiden damit fertig seid, dann könnt ihr mir helfen, den Corral auszubessern.“
Josh nickte nur und fügte sich. Während er zusammen mit Will hinüber zum Stall ging, kamen ihm die Worte Colonel Richardsons wieder in den Sinn. Der Offizier hatte behauptet, es wäre ein Fehler gewesen, sich aus allem herauszuhalten, und diese Worte hatten ziemlich wütend geklungen. Ob er damit erreichen wollte, dass es sich Josh und Will womöglich doch noch einmal anders überlegten?
Josh wusste es nicht, aber ein kurzer Blick zu seinem älteren Bruder zeigte ihm, dass auch Will darüber nachdachte, was es für sie alle bedeutete, wenn der Krieg erst diese Gegend erreichte. Denn dann war es aus und vorbei mit der Ruhe!
* * *
„Pa ist stinksauer auf die Soldaten“, sagte Will zu seinem Bruder Josh, als er neben ihm auf dem Bock des Pritschenwagens saß, dessen Zügel Josh lenkte. „Heute war kaum ein vernünftiges Wort mit ihm zu reden. Mensch, hoffentlich beruhigt er sich bald wieder. Das ist ja sonst kaum mit ihm auszuhalten.“
Josh blickte hinauf zum wolkenverhangenen Himmel, während er das Pferdegespann nach Rivers Bend lenkte. Es sah aus, als ob es gleich zu regnen anfing, und dann würden sie klatschnass werden, bevor sie die kleine Stadt erreicht hatten. „Du kennst doch Pa“, antwortete Josh auf die Bemerkung seines Bruders. „Er ist nun einmal ein ziemlicher Dickschädel, seit Ma ihn vor fünf Jahren verlassen hat. Aber er hat trotzdem recht. Keiner von uns ist gefragt worden, als sich Nord und Süd den Krieg erklärt haben. Also brauchen sie uns auch nicht mehr zu fragen, ob wir für diese Politiker unser Leben aufs Spiel setzen.“
„Und was wollen wir tun, wenn die Rebellen ins Shenandoah Valley kommen?“, fragte ihn Will, während es am fernen Horizont bereits zu donnern begann. „Würdest du untätig zusehen, wenn die Farm überfallen und geplündert wird?“
„Das ist etwas ganz anderes“, hielt ihm Josh nun vor. „Da geht es ja schließlich um unser Hab und Gut, oder?“
„Und im Krieg geht es um die Befreiung der Sklaven, sagt man“, fuhr Will fort. „Es ist ja schon eine gerechte Sache, aber ich denke, dass ...“
„Es geht nicht um die Sklaven“, fiel Josh dem älteren Bruder ins Wort. „Will, da ist noch eine ganze Menge mehr im Spiel, das einfache Leute wie wir nicht verstehen werden. Und deswegen mische ich nicht mit in dem Krieg dieser Narren.“
„Hoffentlich behältst du recht mit allem“, meinte Will achselzuckend und zog sich den Kragen seiner Jacke etwas höher, als plötzlich Wind aufkam. „Es ist schon ein ziemlich komisches Gefühl, zu sehen, wie Burschen in unserem Alter sich der Union anschließen. Ferris Parker und Hank Miller werden uns bestimmt für Feiglinge halten, weil wir noch zu Hause bei Pa sind.“
„So was darfst du noch nicht einmal denken“, wies Josh ihn zurecht. „Ferris und Hank haben noch Brüder, die sich um ihre Farmen kümmern können. Pa hat aber außer uns sonst niemanden. Und das gibt uns das Recht, hierzubleiben.“
Während ihm diese letzten Worte über die Lippen kamen, öffnete der wolkenverhangene Himmel seine Schleusen. Zuerst waren es nur ein paar dicke Tropfen, aber schon wenige Minuten später begann es heftig zu regnen.
Hastig holten Josh und Will zwei Decken von der Ladefläche des Pritschenwagens hervor, um sich wenigstens notdürftig vor dem Regen zu schützen. Aber selbst das verhinderte nicht, dass sie nass wurden. Zum Glück tauchten eine gute halbe Stunde später die ersten Häuser der kleinen Ansiedlung Rivers Bend am Horizont auf.
Josh war sichtlich erleichtert, als er das Gespann direkt vor Walt Myers’ General Store anhielt und dann hastig abstieg. Will tat es ihm gleich. Als sie den schützenden Vorbau des Hauses erreicht hatten, in dem sich der Store befand, streiften sie erst einmal die nassen Decken von sich und bemerkten dabei drei Männer drüben auf der anderen Straßenseite, die verächtlich zu grinsen begannen, als sie erkannten, dass die Brüder klatschnass geworden waren.
„Was soll das?“, wandte sich Will an Josh, als er das Gelächter von der anderen Straßenseite hörte. „Die machen sich ja lustig über uns. He, ihr da!“, rief er dann mit lauter Stimme zu den Männern hinüber. „Passt ja auf, sonst ...“
Will Calhoun war ein Bursche, der sich vor anderen nicht zu verstecken brauchte. Deshalb reagierte er umso erstaunter, als er spürte, dass Josh ihm andeutete, mit ihm zu kommen.
„Vergiss die Kerle“, erwiderte Josh knapp. „Wir sind nicht hier, um uns mit denen anzulegen, sondern um Werkzeuge zu kaufen, oder hast du das schon vergessen, du Hitzkopf?“
„Natürlich nicht“, antwortete Will, folgte dann aber seinem Bruder in den General Store. Obwohl es erst Mittag war, hatte der Besitzer des Stores, Walt Myers, eine Petroleumlampe brennen, denn draußen war es trübe durch die dichten Regenwolken geworden.
„Guten Tag, Mister Myers“, begrüßte Josh den älteren Mann, der hinter der Ladentheke stand und gerade damit zugange war, zwei Frauen zu bedienen. Diese drehten sich nun um, als sie Joshs Stimme vernahmen, und steckten dann die Köpfe zusammen. Was sie einander zu sagen hatten, konnte Josh vom Eingang aus natürlich nicht verstehen. Aber die Mienen der Frauen waren ziemlich abweisend.
Josh und Will gingen nun zur Theke. Walt Myers Miene war auch nicht gerade freundlich, als Will sich in den Regalen umzusehen begann.
„Wir brauchen neue Werkzeuge draußen auf unserer Farm, Mister Myers“, wandte er sich dann an den Besitzer des Stores. „Nägel, einen neuen Hammer und zwei Äxte, das dürfte fürs Erste ausreichen. Und dann noch Kaffee und Zucker. Sie können schon anfangen mit dem Zusammenpacken. Josh und ich schauen uns inzwischen hier noch etwas um. Vielleicht finden wir ja noch was.“
Die beiden Frauen verließen den Store etwas schneller als gewohnt. Josh sah das und begriff nicht, was dies bedeutete. Genauso wenig konnte er verstehen, warum Myers ihn und Will so seltsam lange musterte, bevor er dann endlich die Waren aus dem Regal holte.
„Was ist los mit Ihnen, Mister Myers?“, richtete Will nun das Wort an den Storebesitzer, weil ihm dieser Blick natürlich auch nicht entgangen war. „Weshalb in Dreiteufelsnamen starren Sie uns so an?“
Der Storebesitzer murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und beeilte sich jetzt mit dem Zusammenpacken. Für Will war das aber keine Antwort. Deshalb ging er jetzt direkt auf die Theke zu und blickte Myers herausfordernd an.
„Ich habe Sie was gefragt, Mister!“, versuchte er es ein zweites Mal. „Wollen Sie nicht antworten?“
„Mit Feiglingen redet man eben nicht gerne!“, erklang plötzlich eine Stimme vom Eingang des Stores her. Will und Josh drehten sich um und erkannten nun die drei Kerle, die eben noch drüben auf der anderen Straßenseite gestanden und sich über sie lustig gemacht hatten. Sie betraten nun Myers Store und grinsten immer noch abfällig.
„He, Moment mal“, sagte Will jetzt, während Zorn in ihm aufkam. „Was willst du damit sagen?“
„Willst du es noch deutlicher hören?“, meldete sich jetzt ein muskulöser Kerl zu Wort und stieß dabei seinem Kumpan in die Seite. „Das kannst du haben, Mann. Wir glauben nämlich, dass ihr Calhouns eine Bande von Drückebergern seid, die gar nicht begreifen wollen, wie ernst die Lage hier draußen geworden ist. Clete, Horace und ich haben uns heute freiwillig gemeldet und werden morgen schon unseren Dienst in der Armee der Union antreten.“
„Und da können wir natürlich nicht einfach mit ansehen, dass es hier im Shenandoah Valley noch solche Feiglinge wie euch gibt“, sagte nun der Bursche ganz links. „Ihr macht euch wohl die Hosen voll, wenn es gegen die Rebellen gehen soll, wie?“
Josh und Will Calhoun waren zwar recht friedfertige Zeitgenossen, die sich eigentlich aus Streitigkeiten heraushielten. Aber es gab auch einen Punkt, wo man nicht mehr alles einfach einstecken konnte, und der war nun erreicht!
„Sag das noch mal“, flüsterte Will mit leiser Stimme. „Sag das nur noch ein einziges Mal, und ich schlage dich ungespitzt in den Boden, du Schweinehund!“
„Wenn du das unbedingt noch mal hören willst“, höhnte der Kerl in der Mitte. „Also, ihr Calhouns seid eine Bande von gelbgestreiften Coyoten und ...“