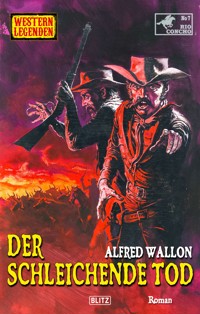Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Civil War Chronicles
- Sprache: Deutsch
Lieutenant Jay Durango, Sergeant Sean McCafferty und der Soldat Neil Vance befinden sich in ihrem Winterquartier. Mit dem nahenden Ende des Winters zeichnen sich weitere Auseinandersetzungen ab. Immer mehr Unionstruppen marschieren in Richtung Chattanooga und planen offensichtlich eine größere militärische Operation. Der Tod marschiert mit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
Atlanta soll brennen
Civil War Chronicles
Buch Acht
Alfred Wallon
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2025 Blitz-Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Alfred Wallon, Danny Winter
Titelbild: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
4808 vom 24.03.2025
ISBN: 978-3-68984–336-6
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nachwort
Alfred Wallon
Vorwort
Vorwort
Nach den Kämpfen um Chattanooga im November 1863 hatte die Union einen weiteren entscheidenden Vorteil errungen. Durch die Eroberung und anschließende Besetzung der Stadt konnte ein entscheidender Vorteil genutzt werden. Denn von Chattanooga aus ließ sich das Herz der Konföderation, der Staat Georgia mit seiner Hauptstadt Atlanta, vergleichsweise einfach erreichen.
Das waren auch die Pläne von General William T. Sherman, der eine solche Invasion schon seit der Eroberung Chattanoogas plante und wenig später auch General Ulysses S. Grant und Präsident Abraham Lincoln davon überzeugen konnte, dass eine solche militärische Operation die Konföderation so entscheidend schwächte, dass sich Lees Armee davon niemals wieder erholen würde. Fast vier Jahre tobte der blutige Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd mittlerweile, und es bestand jetzt eine berechtigte Hoffnung, durch eine gezielte militärische Operation den Sieg zu erringen.
Atlanta war das logistische Zentrum des Südens. Sherman kannte diese Region, auch wenn schon einige Jahre vergangen waren, seit er zuletzt als junger Lieutenant 1844 dort stationiert gewesen war. Damals hieß die Stadt noch Marthasville, hatte aber bereits zu dieser Zeit schon eine gewisse strategische Bedeutung gehabt. Jetzt lebten in Atlanta fast 20.000 Menschen, und die Bedeutung dieser Stadt wurde nur noch von Richmond, der Hauptstadt der Konföderation, übertroffen.
Atlanta nannte man auch das Tor zum Süden, weil es den Zugang zu denjenigen Staaten der Konföderation darstellte, die sich an der Atlantikküste befanden. Atlanta war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und gleichzeitig ein großes Arsenal. In den Fabriken in und rund um die Stadt wurden wichtige Kriegsgüter und Waffen hergestellt. Die Bandbreite reichte von Kanonen und Gewehren bis hin zu Schienen und Eisenplatten. Selbst Uniformen und Särge wurden hier produziert, und all dies wurde in Kriegszeiten dringend benötigt. Die vier Eisenbahnlinien transportierten diese Waren zusammen mit Lebensmitteln von den reichen und üppigen Farmgebieten in Georgia, Alabama und Mississippi zu den kämpfenden konföderierten Truppen.
Grund genug also, um dem Feind einen entscheidenden Schlag zu versetzen und den Krieg auf diese Weise zu beenden. Die letzten vier Jahre hatten unzählige Tote auf beiden Seiten gefordert. Aber trotz der vielen Vorteile, die die Union mittlerweile auch offen gegen die Konföderation ausspielte, war es Präsident Lincoln und seinen Generälen noch immer nicht gelungen, den Süden in die Knie zu zwingen.
Durch Shermans Plan sollte sich dies jedoch sehr bald ändern. Denn Sherman wusste, dass der Weg zur Atlantikküste für ihn und seine Truppen offen sein würde, wenn Atlanta erst gefallen war. Wie effektiv und zerstörerisch diese militärische Kampagne für die Konföderation tatsächlich sein sollte, ahnten im Mai 1864 weder Sherman noch seine Gegner.
Kapitel1
Kapitel 1
Was für ein beschwerlicher Marsch durch Regen, Matsch, Staub und Hitze nach solch vergleichsweise ruhigen Wochen! Aber die Rebellen müssen endlich besiegt werden, und da wir das nicht schaffen, wenn wir zuhause bleiben, müssen wir sie eben zum Teufel jagen.
Major James A. Connolly, 121st Illinois Regiment
Als der Zug die Bahnstation von Chattanooga erreichte, waren noch weitere dichte Wolken aufgezogen. Das trübe Wetter war ein Spiegelbild der Stimmung, die unter den wenigen zivilen Passagieren herrschte, die sich im Waggon befanden. Unter ihnen weilte auch ein großer schlanker Mann im dunklen Anzug, der am Fenster saß und in Gedanken versunken zu sein schien. Trotzdem hatte er alles registriert, was in diesem Waggon geschah. Er hatte sowohl die ältere Frau mit ihrem Mann bemerkt, die auf der gegenüberliegenden Seite saßen und sich kurz gestritten hatten, als auch die zehn Soldaten, die mit ihrem Sergeant in Knoxville zugestiegen waren.
Larry Calhoun wusste, dass insbesondere die Soldaten immer wieder zu ihm schauten und sich wahrscheinlich fragten, wer dieser gut gekleidete Mann war. Hätte man ihn direkt darauf angesprochen, dann hätte er den Soldaten ein Dokument präsentieren können, das ihm einige Vollmachten gab, die andere sehr erstaunt hätten. Dieses Schreiben stammte von Präsident Abraham Lincoln höchstpersönlich und war an General William T. Sherman gerichtet, dessen logistisches Hauptquartier sich in Chattanooga befand. Lincoln hatte präzise Anweisungen erteilt, und die musste auch ein Offizier wie Sherman befolgen. Auch wenn es ihm ganz sicher nicht passen würde, dass Larry dieses Mal erneut ein wichtiger Bestandteil einer militärischen Operation sein würde.
„Chattanooga!”, erklang jetzt die laute Stimme eines Bahnbediensteten, der den Waggon betrat und seine Blicke in die Runde schweifen ließ. „Letzter Halt, Ladies und Gentlemen. Der Zug endet hier!”
Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, bemerkte Larry die verstärkte militärische Präsenz an den Bahngleisen. Wohin er auch schaute, er sah viele bewaffnete Soldaten, die das Gelände sicherten und dadurch zumindest in der näheren Umgebung für einen reibungslosen Ablauf des Bahnbetriebes sorgten.
Mit einem kurzen Ruck kam der Zug zum Stehen, und die Passagiere stiegen aus. Ebenso Larry. Der Sergeant und seine Soldaten bildeten den Schluss. Sie wurden schon von einem Captain erwartet und schlossen sich ihm kurz darauf an.
Larry hatte eine Tasche bei sich, in der er das Notwendigste mit sich führte. Bei seiner weiteren Mission würde er nicht viel Gepäck brauchen. Denn schon bald würde er Teil der Armee sein, die nach Georgia einmarschierte und den konföderierten Truppen dadurch einen entscheidenden Schlag versetzte. Zumindest wenn es nach den Plänen der Generäle Grant und Sherman ging.
Larry wusste, dass Sherman die treibende Kraft dieser Operation war. Ihm war es auch gelungen, den eher nüchternen Grant von seinen Plänen zu überzeugen. Und nachdem auch Präsident Lincoln davon erfahren und die gesamte Aktion gebilligt hatte, gab es kein Zurück mehr.
Die Maschinerie des Krieges war angelaufen. Seit Wochen fanden Truppenbewegungen zwischen Nashville, Knoxville und Chattanooga statt, die alle nur ein Ziel hatten: nach Georgia einzumarschieren und den Gegner das Fürchten zu lehren.
„Mister Calhoun?”, riss ihn auf einmal eine Stimme aus seinen Gedanken. Larry drehte sich um und blickte in das Gesicht eines jungen Lieutenants, der eine blitzsaubere Uniform trug.
„Ja”, sagte dieser.
„Ich bin Lieutenant Ben Bridges. General Sherman erwartet Sie”, antwortete der Lieutenant. „Wenn Sie mir bitte folgen wollen?”
Der junge Offizier ging voran, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Larry nahm seine Tasche und verließ das Bahnhofsgelände, wo auch zu dieser späten Nachmittagsstunde immer noch ein geschäftiges Treiben herrschte. Er registrierte im Vorbeigehen die zahlreichen Waggons, die auf den benachbarten Gleisen standen und wo etliche Soldaten damit beschäftigt waren, sie zu entladen. Dies war der Beweis dafür, dass die schon seit Wochen geplante logistische Unterstützung der Truppen auf Hochtouren lief. Zum ersten Mal war der Befehl erteilt worden, dass keiner der Generäle auf eigene Faust vorging, sondern sich nur einem einzigen Ziel bedingungslos unterordnete. Und dies war der Einmarsch nach Georgia.
Der aufkommende Wind wurde jetzt stärker, und der Himmel hatte sich gänzlich zugezogen. Auf dem Weg zu Shermans Quartier begannen die ersten Regentropfen zu fallen. Larry und der Lieutenant beschleunigten jetzt ihre Schritte, um trockenen Fußes die andere Straßenseite zu erreichen.
„Es ist nicht mehr weit, Mister Calhoun”, sagte Lieutenant Bridges, als er Larrys mürrischen Gesichtsausdruck wegen des einsetzenden Regens bemerkte. „Wir sind gleich am Ziel.”
„Keine Sorgen, Lieutenant”, erwiderte Larry und zog sich den breitkrempigen Hut tiefer in die Stirn. „Ich bin ganz andere Dinge gewohnt, auch wenn man das wegen meiner Kleidung vielleicht nicht glauben mag.”
Ihm war der argwöhnische Blick des jungen Offiziers, der Larry beim Aussteigen aus dem Zug gegolten hatte, natürlich nicht entgangen. Lieutenant Bridges wusste wahrscheinlich nur, dass Larry direkt aus Washington gekommen war und eine Botschaft des Präsidenten für General Sherman bei sich trug. Aber dass dieser Mann trotz seines dunklen Anzuges den Krieg aus nächster Nähe schon mehrere Male hautnah miterlebt hatte, traute ihm der Lieutenant wahrscheinlich nicht zu. In dessen Augen war Larry nur ein einflussreicher Beamter aus Washington, der sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen in die Nähe der Front wagte.
Larry hätte ihm einiges darüber berichten können, dass er die Stadt Chattanooga sehr gut kannte, und dies galt auch für das benachbarte Umland. Als General Braggs Männer einen Belagerungskessel um die Stadt gezogen hatten und dadurch General Rosecrans und General Thomas zum Aufgeben hatten zwingen wollen, war es Larry gewesen, der sich auf verschlungenen Pfaden nach Chattanooga begeben hatte, um den Unionsgenerälen auszurichten, dass Verstärkung bereits auf dem Weg war und alles dafür getan werden sollte, um den Ring der Belagerer im entscheidenden Moment zu durchbrechen. Was ja dann auch geschehen war und zwar mit einer verheerenden Niederlage für die konföderierten Truppen, die ihre Stellungen am Lookout Mountain und am Missionary Ridge in heilloser Flucht verlassen und dieses strategisch so wichtige Gelände der Union überlassen hatten.
All dies lag ein gutes halbes Jahr zurück, aber die Erinnerungen an diese Zeit wurden jetzt wieder gegenwärtig, als Larry mit Lieutenant Bridges durch die Stadt ging und dabei unter den Vordächern der Häuser Schutz vor dem allmählich stärker werdenden Nieselregen suchte, den der Wind in Schleiern vor sich hertrieb.
Draußen auf der Straße hielten sich jetzt gar keine Menschen mehr auf. Der plötzlich einsetzende Regenguss hatte sie vertrieben, und wer es konnte, der machte es sich an einem wärmenden Feuer vor dem Kamin gemütlich. Das galt aber nur für die Zivilbevölkerung der Stadt und nicht für die Soldaten von Shermans Armee. Die mussten jedem Wetter trotzen, so widrig die Umstände auch waren.
Larry ging an einem, von außen unscheinbar wirkenden Haus vorbei, über dessen Eingangstür ein Schild mit der Aufschrift Boardinghouse angebracht war. Das Fenster zur Straße war von einem Vorhang teilweise verdeckt. Selbst wenn Larry in diesem Moment einen Blick durchs Fenster geworfen hätte, so wäre ihm vermutlich nichts aufgefallen, was sein Mistrauen erweckt hätte. Aber der Mann, der ihn im gleichen Augenblick entdeckte, dachte da ganz anders.
* * *
Sean McCafferty zuckte zusammen, als er auf einmal den Yankee-Offizier in Begleitung eines Zivilisten im dunklen Anzug am Fenster der Pension vorbeigehen sah. Im ersten Moment glaubte er sich getäuscht zu haben, aber als er dann kurz das Gesicht des Mannes sah, verdüsterte sich seine Miene und er murmelte einen leisen Fluch. In seinen Augen funkelte es wütend auf, und er erhob sich so rasch vom Stuhl, dass dieser nach hinten fiel und mit einem dumpfen Geräusch zu Boden polterte.
Rasch bückte sich McCafferty, hob den Stuhl wieder auf und rückte ihn zurecht. Dann ging er mit schnellen Schritten zur Tür, öffnete sie und trat hinaus in den Regen. Er ignorierte die allgegenwärtige Feuchtigkeit, sondern richtete seine Blicke stattdessen auf den Yankee und den Mann, der neben ihm ging.
Es blieb keine Zeit mehr, um Durango und Vance zu verständigen. Er musste unbedingt herausfinden, ob er sich nicht getäuscht hatte und der Mann im dunklen Anzug wirklich Larry Calhoun war. Sollte dies so sein, dann standen die Zeichen auf Alarm. Denn dieser elende Yankeespion hatte bisher immer einen guten Grund gehabt, um seine Anwesenheit in dieser Region zu rechtfertigen.
McCafferty bemühte sich, Abstand zu den beiden Männern zu halten und folgte ihnen in gebührendem Abstand. Ein Gedanke jagte den anderen, weil McCafferty jetzt auf eigene Faust etwas unternahm. Seine beiden Kameraden würden davon nicht begeistert sein, denn hier in Chattanooga mussten sie sich so unauffällig wie möglich verhalten, sonst würde ihre Mission zum Scheitern verurteilt sein. Wenn irgendjemand herausfand, dass es sich bei den drei Männern nicht um Zivilisten, sondern um konföderierte Soldaten handelte, dann würden sie gewaltige Probleme bekommen.
Der Regen bildete große Pfützen und verwandelte die Straße allmählich in einen Morast. McCafferty hielt sich weiter im Schutz der Vordächer und verfluchte die Tatsache, dass ausgerechnet jetzt keine anderen Menschen auf der Straße waren und man sehen konnte, dass er jemandem folgte.
Aber weder der Lieutenant noch sein Begleiter schienen damit gerechnet zu haben. Keiner von beiden drehte sich um oder vergewisserte sich, dass ihnen niemand folgte. Wozu denn auch? In einer Stadt wie Chattanooga, die nach dem Sieg über Braggs Truppen in den letzten Monaten zu einem großen Militärstützpunkt der Union ausgebaut worden war, rechnete nun wirklich niemand damit, dass sich Rebellen oder Spione in der Stadt oder der näheren Umgebung aufhielten. Das wäre viel zu riskant gewesen.
Gerade deshalb hofften Durango und seine Leute, dass ihre Tarnung funktionierte und sie nicht aufflogen. Die Order, die Durango und seine Kameraden erhalten hatte, war ganz eindeutig gewesen. Sie sollten nach Chattanooga reiten und sich in der Stadt umsehen und natürlich herausfinden, was die Union als nächsten militärischen Schachzug beabsichtigte. Denn die Gerüchte darüber, dass eine weitere Operation in den nächsten Wochen bevorstand, hatten sich verdichtet.
Lees Armee hatte zwar im vergangenen Spätherbst eine verheerende Niederlage erlitten, aber dennoch funktionierte das Netz aus Spionen und Agenten, die hinter den feindlichen Linien operierten. Und genau diese Leute hatten berichtet, dass sich die Truppenbewegungen der Union in diesem Sektor deutlich verstärkt hatten. Was nichts Anderes bedeutete als dass die Dinge in Bewegung geraten waren.
Genau deswegen waren Durango, McCafferty und Vance nach Chattanooga aufgebrochen. Die Papiere, die sie bei sich hatten, würden sicher einer ersten Überprüfung standhalten. Trotzdem mussten sie vorsichtig sein und durften nichts Unnötiges riskieren.
McCafferty dagegen dachte jedoch nicht an die ermahnenden Worte von Lieutenant Durango. Als er Larry Calhoun gesehen hatte, beschäftigten sich seine Gedanken nur noch mit einer einzige Sache: Diesen Yankeespion nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. Er hatte Tom Higgins kaltblütig erschossen und trug auch die Schuld am Tod von Frank Porter und Ben Fisher. Am Grab von Higgins hatte McCafferty einen Schwur geleistet, und dies bestimmte seitdem insgeheim sein weiteres Denken und Handeln, auch wenn der Lieutenant und Vance bisher nur wenig davon bemerkt hatten.
Jetzt war die Chance greifbar nahe, endlich Rache für den Mord nehmen zu können. McCafferty dachte nicht über die Konsequenzen nach, die sein Verhalten unter Umständen auslösen konnte. In seinem Kopf kreiste nur der Wunsch nach Rache, und deshalb bemühte er sich, Calhoun und dem Yankee-Offizier möglichst unbemerkt zu folgen. Er sah, wie die beiden jetzt die schlammige Straße überquerten und dabei den größten Pfützen auswichen. Das Ziel der beiden Männer war ein Hotel schräg gegenüber.
In einem der Fenster oberhalb des Eingangs entdeckte der irische Sergeant plötzlich eine konturenhafte Gestalt, die ausgerechnet jetzt einen Blick auf die Straße warf. Die Petroleumlampe im Zimmer ließ McCafferty die Konturen des Mannes im Zimmer erkennen. Als er sich abwandte und den Vorhang wieder zuzog, sah McCafferty, dass der Mann eine dunkelblaue Uniform trug. Zum Glück schien er nicht bemerkt zu haben, dass sich McCafferty an die Fersen Calhouns und des Lieutenants geheftet hatte.
„He Mac!”, hörte er auf einmal eine nervöse Stimme hinter sich. McCafferty war so in Gedanken versunken, dass er im ersten Moment zusammenzuckte, als hätte ihn jemand beim Stehlen erwischt. Als er sich dann aber umdrehte, sah er Neil Vance, und er begann sich zu entspannen.
„Was machst du denn hier draußen bei diesem Hundewetter?”, fragte ihn Vance. „Ich kam gerade die Treppe herunter und sah dich gehen. Deshalb bin ich dir gefolgt, um zu sehen, was du ...”
„Calhoun ist hier”, fiel ihm McCafferty ins Wort. „Er ist zusammen mit einem Yankee-Lieutenant in das Hotel dort drüben gegangen.”
„Bist du sicher?”
„Ich glaube ja”, antwortete McCafferty. „Und er wird wahrscheinlich sogar schon erwartet. Ich sah einen Mann in Uniform dort oben am Fenster.” Er zeigte auf die betreffende Stelle. „Neil, vielleicht täusche ich mich auch, aber das sind mir ein bisschen zu viele Zufälle. Meinst du nicht auch?"
„Das muss der Lieutenant sofort erfahren, Mac”, meinte Vance. „Komm mit, wir müssen mit ihm sprechen.” Er sah, dass McCafferty zögerte und runzelte die Stirn. „Verdammt, was ist los mit dir?”, wollte er dann von seinem Kameraden wissen. „Du denkst doch nicht etwa daran, etwas auf eigene Faust zu unternehmen?”
„Natürlich nicht”, antwortete McCafferty, wich dabei aber dem Blick seines Kameraden für einen kurzen Moment aus. Vance bemerkte das jedoch nicht, weil er wieder hinüber zu dem Hotel schaute, in dem sich laut der Meinung des irischen Sergeants der Yankeespion Calhoun aufhalten sollte, und offensichtlich noch jemand anderer, der die Unform der Union trug.
„Das wäre auch schlimm, wenn dir sowas einfallen würde, Mac”, sagte Vance. „Vergiss nicht, welches Risiko wir eingegangen sind. Wenn einer von uns einen Fehler macht, dann kriegen wir Ärger.”
„Gut, dann geh los und sag dem Lieutenant Bescheid”, sagte McCafferty. „Ich halte hier so lange die Stellung. Nun schau mich doch nicht so erstaunt an, Neil. Ich will doch nur wissen, was da drüben in der Zwischenzeit geschieht. Da wäre es schon angebracht, wenn einer von uns das Fenster da oben im Blickfeld behält.”
„Mac, versprich mir, dass du dich zurückhältst”, versuchte Vance seinem Kameraden noch einmal ins Gewissen zu reden. „Ich weiß, wie nahe dir Toms Tod gegangen ist, aber du bist nicht der Einzige, dem es so geht. Trotzdem müssen wir unseren Job erledigen, und zwar so, dass keiner von uns in Gefahr gerät.”
„Du muss mir jetzt keine Moralpredigten halten, Neil”, brummte McCafferty. „Ich werde mich schon zurückhalten. Ich bleibe hier stehen und beobachte nur, was da drüben vor sich geht.” Er schaute dabei hinauf zum trüben Himmel und grinste Vance zu. „Der Regen lässt jetzt nach. Also wird es auch nicht auffallen, dass ich mich hier draußen aufhalte. Da drüben ist ein Store. Dort findest du mich.”
Vances Blicke richteten sich auf das Geschäft. Es war ein Eisenwarenladen mit einem größeren Schaufenster. Wenn McCafferty sich dort die Auslagen anschaute, dann verhielt er sich ganz normal, und niemand würde etwas Verdächtiges darin sehen.
„Ich bin gleich wieder zurück, Mac”, sagte Vance. „Der Lieutenant soll dann entscheiden, was wir als nächstes tun.”
McCafferty erwiderte nichts darauf, sondern nickte nur. Während Vance mit schnellen Schritten zurück zum Boardinghouse ging, näherte sich der irische Sergeant dem Eisenwarenladen. Das Pianogeklimper aus dem nahen Saloon registrierte er nur am Rande.
* * *
„So schnell sieht man sich also wieder, Mister Calhoun”, sagte General William T. Sherman und ergriff die ausgestreckte Hand des Mannes im dunklen Anzug. „Und ich vermute, dass Präsident Lincoln Ihnen eine Botschaft für mich mitgegeben hat?”
Die letzten Worte klangen ein wenig sarkastisch. Aber Larry Calhoun überhörte diesen Tonfall. Er kannte Sherman mittlerweile zu Genüge und wusste, was er von ihm zu halten hatte. Natürlich passte es Sherman nicht, dass sich auf Geheiß des Präsidenten wieder ein Zivilist in Dinge einmischte, von denen dieser Shermans Meinung nach gar nichts verstand. Deshalb war Larry auch sehr froh, dass er eine Legitimation bei sich trug, die von Lincoln persönlich unterzeichnet worden war.
Er holte das Dokument aus seiner Jackentasche und legte es wortlos auf den Tisch, neben dem Sherman stand. Der General öffnete das Siegel, faltete das Papier auseinander und las, was dort geschrieben stand. Sein Blick war eine Mischung aus verhaltenem Grübeln und unterdrückter Wut, als ihm klar wurde, was die Entscheidung des Präsidenten für ihn zu bedeuten hatte.
„Sie haben einen mächtigen Fürsprecher, Mister Calhoun”, seufzte er schließlich. „Ich wüsste aber nicht, was es ändern würde, wenn Sie mich und meine Truppen auf diesem Feldzug nach Atlanta begleiten. Sie erinnern sich doch bestimmt noch daran, wie knapp Sie mit dem Leben vor einigen Monaten davongekommen sind?”
„Aber jetzt bin ich hier, General”, antwortete Larry. „Und ich erfülle genauso meine Pflicht für die Union, wie Sie es tun. Ich trage nur keine Uniform.”
„Ich weiß”, winkte Sherman ab und bemühte sich, nach außen hin eine gewisse Gelassenheit zu zeigen. Larry kannte den General aber lange genug, um zu wissen, dass Sherman nach wie vor eine Abneigung gegen ihn hegte, aus welchen Gründen auch immer. Vermutlich, weil Larry so gute persönliche Kontakte ins Weiße Haus hatte.
Aber auch Shermans Einfluss in der Unionsarmee war gewachsen, seitdem es ihm gelungen war, General Grant als Vertrauten und verlässlichen Freund zu gewinnen. Dazu trug natürlich auch die Tatsache bei, dass Lincoln Grant mittlerweile zum Oberkommandierenden der Unionsstreitkräfte ernannt hatte. Damit stieg auch gleichzeitig Shermans Einfluss. Wenn man so wollte, waren die beiden Generäle in gewisser Weise voneinander abhängig, und der militärische Erfolg des einen stärkte zwangsläufig auch die Position des anderen.
„Der Präsident hat Sie über unsere Pläne wahrscheinlich schon informiert?”, fuhr Sherman fort und sah, wie Larry nickte. „Dann gibt es ja nicht mehr viel zu besprechen. Unsere Truppen stehen bereit. Die Cumberland- und die Tennessee-Armee sind bereits vollständig aufmarschiert. Sie haben sicher die vielen Zelte außerhalb der Stadt bemerkt?”
„Und die Ohio-Armee wird auch bald eintreffen?”, fügte Larry hinzu.
„Ich rechne gegen Ende der Woche damit”, sagte Sherman. „Dann verfügen wir über eine erfahrene Truppe von insgesamt 100.000 Mann. Keine blutjungen, unerfahrenen Soldaten, sondern ausgebildete Männer, die wissen, wie man eine Schlacht zu führen hat. Das wird von entscheidendem Vorteil sein, wenn wir in Richtung Atlanta marschieren.”
„Die letzten Monate waren verhältnismäßig ruhig. Das dürfte auch die Moral der Soldaten stärken. Ich vermute, dass viele die Zeit genutzt haben, um einen kurzen Urlaub zuhause zu verbringen?”
„Stimmt. Sie sind jetzt ausgeruht und motiviert. Und sie können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht.”
„Haben die Konföderierten denn nichts unternommen?”, erkundigte sich Larry. „Insbesondere Nathan Bedford Forrests Kavallerie müsste doch mittlerweile wissen, dass sich unsere Armeen um Chattanooga konzentrieren. Also wäre es doch logisch, den Transport von Munition und Vorräten hierher zu stören.”
„Das haben die Rebellen ja auch versucht”, brummte Sherman. „Ich nehme an, Sie haben von dem Massaker in Fort Pillow gehört?”
„Ja. Das war nichts Anderes als Massenmord. Soldaten einfach niederzumetzeln, die sich bereits ergeben haben, ist keine große Ruhmestat.”
„230 Tote und über 100 Verletzte waren es. Es geschah alles so plötzlich”, sagte Sherman. „Aber solch einen Triumph werden die Rebellen niemals wieder feiern. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort, Mister Calhoun. Ich weiß, dass der Krieg mitunter ein sehr hässliches Gesicht hat. Bei Fort Pillow war das so. Aber diesmal werden wir sie jagen, und wenn es nach mir ginge, bis an die Küste des Atlantiks. Wenn dieser Feldzug beginnt, dann wird nichts mehr so sein wie es einst war. Wir wollen diesen Krieg gewinnen, und sowohl General Grant als auch ich haben nur dieses Ziel vor Augen.”
So entschlossen hatte Larry den General selten erlebt. Sherman war förmlich besessen, dem Krieg eine entscheidende Wende zu geben. Die Zeichen dafür standen gut. Jetzt war alles nur noch eine Frage der Zeit, und selbst Forrests gefürchtete Reiter würden nichts mehr dagegen tun können. Dazu war die Übermacht der Unionsarmeen zu groß. Auf Dauer hatten die Truppen der Konföderation dem nichts mehr entgegen zu setzen.
„Genießen Sie den Aufenthalt in Chattanooga, solange es Ihnen noch möglich ist, Mister Calhoun”, sagte Sherman abschließend. „Ich nehme an, dass dieses Hotelzimmer Ihren Wünschen entspricht?”
„Ich hätte mich auch mit einem Quartier bei Ihren Truppen zufriedengegeben”, antwortete Larry. „Ich möchte keine Sonderbehandlung haben. Das müssten Sie doch eigentlich wissen?”
„Ich will, dass Sie die Zeit nutzen, um sich in der Stadt umzusehen, Mister Calhoun”, meinte Sherman. „Ein Zivilist, von dem man noch nicht weiß, welche Rolle er spielt, könnte sehr nützlich in manchen Situationen sein. Deshalb habe ich das Hotel auch durch die Hintertür betreten und werde es genauso wieder verlassen. Der Hotelbesitzer ist natürlich eingeweiht.”
„Glauben Sie, dass sich Rebellenspione in Chattanooga aufhalten, General?”
„Das weiß ich nicht”, kam sofort die Antwort. „Aber Sie könnten sich bemühen, es herauszufinden, oder?”
„Gut”, erwiderte Larry. „Ich werde mich ein wenig unauffällig umsehen. Ich bekomme von Ihnen Nachricht, sobald die Truppen nach Georgia aufbrechen?”
„Lieutenant Bridges wird Ihnen Bescheid geben”, sagte Sherman. „Bis dahin benehmen Sie sich wie ein unauffälliger Zivilist. Vielleicht mag Ihnen das alles etwas umständlich erscheinen, aber ich will ganz sichergehen, dass alles nach Plan verläuft und uns die Rebellen keine unangenehme Überraschung bereiten.”
Während Sherman mit Larry sprach, war dieser ans Fenster getreten, schob den Vorhang zur Seite und blickte hinaus auf die Straße, die der kurze, aber umso heftigere Regenguss in einen Schlammpfad verwandelt hatte. Die Abenddämmerung war nicht mehr fern, und in den meisten Häusern brannte Licht.
Plötzlich zerbarst die Fensterscheibe mit einem klirrenden Geräusch. Larry hörte das Aufbellen eines Schusses. Bruchteile von Sekunden später schlug etwas in seinen linken Oberarm und riss ihn herum. Larry spürte einen kurzen, aber heftigen Schmerz, während er nach hinten fiel und hart gegen den Tisch prallte, der neben dem Fenster stand. Hätte ihn Sherman jetzt nicht gestützt, dann wäre Larry sicher zusammengebrochen.
Larry stöhnte, als er den Schmerz im linken Oberarm fühlte und blickte zu den Glassplittern der zerbrochenen Scheibe, während Sherman das Licht der Petroleumlampe löschte, seinen Armeerevolver aus dem Halfter zog und dem Verletzten mit einem kurzen, aber unmissverständlichen Zeichen andeutete, sich vom Fenster zurück zu ziehen.
Vorsichtig riskierte Sherman einen Blick hinunter auf die Straße. Aber alles, was er sah, waren drei betrunkene Soldaten, die soeben den Saloon schräg gegenüber verlassen hatten. Zwei hielten ihren wankenden Kameraden fest und versuchten ihm die Waffe zu entreißen, mit der er einen Schuss abgegeben hatte.
Auch draußen auf dem Flur waren jetzt laute Stimmen zu hören.
„General Sherman!”, erklang jetzt die besorgte Stimme von Lieutenant Bridges, der unten im Hotel zurückgeblieben war. „Um Himmels Willen, was ist geschehen?”
Als Sherman nicht gleich antwortete, riss Lieutenant Bridges mit vorgehaltener Waffe die Tür auf und blickte entsetzt auf Larry Calhoun, der seine rechte Hand auf die blutende Wunde am linken Oberarm presste, um das heraustretende Blut zu stoppen.
„Es ist noch mal gut gegangen, Lieutenant”, redete Sherman auf den aufgeregten Bridges ein. „Einer dieser betrunkenen Idioten da unten hat um sich geschossen, und die Kugel hat Mister Calhoun verletzt. Mit denen werde ich ein ernstes Wort reden, und zwar auf der Stelle. Diese Idioten knöpfe ich mir höchstpersönlich vor. Und dann werden sie sich wünschen, niemals solch einen bodenlosen Leichtsinn begangen zu haben!”
Er hatte sich so in Rage geredet, dass er gar nicht bemerkt hatte, dass Stuart Coleman, der Besitzer des Hotels, nun ebenfalls ins Zimmer gestürmt kam und besorgt auf den Verletzten schaute.
„Holen Sie einen Arzt, Mister Coleman”, sagte Sherman. „Verdammt, beeilen Sie sich!”
„Natürlich, General”, antwortete der eingeschüchterte Hotelbesitzer und spurtete sofort los.
„Bleiben Sie bei Mister Calhoun”, befahl Sherman dem jungen Lieutenant. „Kümmern Sie sich um ihn, bis der Arzt eingetroffen ist. Ich werde mir inzwischen diese Trunkenbolde vornehmen.”
* * *
McCafferty gingen Dutzende von unterschiedlichen Gedanken durch den Kopf, während er weiter das Fenster des Hotels beobachtete. Seine rechte Hand tastete nach dem Revolver im Holster, und er ertappte sich mehr als nur einmal bei dem Wunsch, einfach ins Hotel zu stürmen und Calhoun niederzuschießen. Über die Konsequenzen war er sich zwar bewusst, aber der persönliche Wunsch, seinen Racheschwur zu erfüllen, den er an Higgins Grab geleistet hatte, trat stärker in den Vordergrund.
Er hörte das Grölen aus dem Saloon, nahm es aber nur aus ganz weiter Fern wahr. Stattdessen fixierte er seine Blicke auf das Hotelfenster und sah zu seiner großen Genugtuung den Mann dort stehen, der Higgins auf dem Gewissen hatte. McCafferty stand hinter einem Pritschenwagen, von dem er das Fenster sehr gut im Blickfeld hatte, aber nicht den Saloon und das, was genau im selben Moment dort seinen Anfang nahm. Drei Soldaten kamen ins Freie gewankt, und einer von ihnen riss seinen Armeerevolver aus dem Halfter, bevor ihn seine Kameraden daran hindern konnten.
Aber da hatte McCafferty bereits seine eigene Waffe gezogen und zielte auf Calhoun, der immer noch am Fenster stand und hinunter auf die Straße blickte.
„Stirb, du verdammter Schweinehund”, murmelte der irische Sergeant und drückte ab. Das Aufbellen des Schusses übertönte das Grölen der drei Soldaten. Bruchteile von Sekunden später fiel ein zweiter Schuss, aber das registrierte McCafferty nur am Rande. Sein Interesse galt dem Mann, der am Fenster plötzlich zu wanken begann und dann auf einmal nicht mehr zu sehen war.
Aber dann wurde McCafferty auf einmal auch bewusst, was er gerade getan hatte und dass er sich jetzt in Sicherheit bringen musste. Drüben beim Saloon versuchten die beiden Soldaten ihren aufgebachten Kameraden zu beruhigen, und daraus entwickelte sich ein kleines Handgemenge, das sofort von einer Schar Schaulustiger beobachtet und sogar noch angefeuert wurde.
Nur weg von hier, dachte McCafferty. Er steckte seine Waffe ein, drehte sich einfach um und setzte seinen Weg fort, als sei er ein völlig Unbeteiligter, der mit all dem gar nichts zu tun hatte. Er musste sich zwingen, nicht loszurennen, als er beim Hotel eine laute und befehlsgewohnte Stimme hörte, die etwas rief, was McCafferty aber trotzdem nicht verstehen konnte. Er ging einfach weiter, und ihm wurde immer mehr bewusst, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Weder ihm noch seinen Kameraden.
„Mac!”, hörte er auf einmal jemanden rufen. Er sah, dass es Vance war, und Lieutenant Jay Durango befand sich ebenfalls bei ihm.
„Was zum Teufel ist los, Mac?”, wollte Durango nun von ihm wissen, als er erkannte, dass die Menschengruppe vor dem Saloon immer größer wurde.
„Ich habe auf diesen Bastard geschossen, Lieutenant”, antwortete McCafferty. Aber seine Stimme klang längst nicht mehr so überzeugt von dem, was er getan hatte. „Ich glaube, ich habe Calhoun erwischt.”
„Was?”, entfuhr es Durango, während es in seinen Augen wütend aufblitzte. „Bist du denn ganz verrückt geworden?”
„Ich konnte nicht anders, Lieutenant”, antwortete McCafferty und wich dem zornigen Blick Durangos aus. „Als ich Calhoun erkannte, habe ich sofort das Boardinghouse verlassen und bin ihm nachgegangen. Ein Lieutenant hat ihn zum Hotel gebracht, und dort hat er sich mit einem anderen Offizier getroffen. Ich konnte nicht genau erkennen, wer es war.”
„Darüber reden wir noch”, brummte Durango. „Jetzt müssen wir erst einmal weg von hier. Wir reiten sofort los. Neil du gehst schon vor zum Stall und sattelst die Pferde. Mac, du schließt dich ihm an. Worauf wartet ihr noch?”
„Komm schon, Mac!”, forderte Vance den Sergeant auf. „Wenn sie uns erwischen, ist alles vorbei.”
„Die denken doch, dass es einer der Soldaten war. Der hat auch geschossen”, teilte McCafferty seinen beiden Kameraden mit.
„Du hast uns diese Suppe eingebrockt, Mac”, wies ihn Durango zurecht. „Der Teufel muss dich geritten haben, dass du so unüberlegt gehandelt hast. Die Sache ist noch nicht vorbei. Los, beeilt euch. Ich komme gleich nach.”
Der Blick, den er dem Iren dabei zuwarf, war eindeutig. Durango erkannte McCafferty nicht wieder. Normalerweise handelte er kühl und besonnen und ließ sich von nichts und niemandem aus der Fassung bringen. Aber seit Tom Higgins Tod hatte er sich verändert und war schweigsamer geworden. Natürlich wusste Durango, dass McCafferty den Yankeespion am liebsten tot gesehen hätte, aber damals war er entkommen und seitdem untergetaucht. Dass er ihm ausgerechnet jetzt und hier wieder begegnen würde, damit hatte keiner von ihnen gerechnet.
Durango sah, wie ein Mann in Offiziersuniform aus dem Hotel gestürmt kam. Sofort zog er sich zurück, als er erkannte, um wen es sich dabei handelte. Es war General William T. Sherman. Also musste er derjenige gewesen sein, der sich mit Calhoun im Hotel getroffen hatte. Und was noch schlimmer war: Durango und seine Kameraden würden jetzt keine Chance mehr haben, den Grund für dieses Treffen herauszufinden. Und alles wegen der überhitzten Reaktion McCaffertys!
Durango wandte sich hastig ab. Er hatte es jetzt sehr eilig, den Mietstall zu erreichen.
* * *
„Ihr gottverdammten Idioten!”, polterte Sherman los, als er das Wort an die drei Soldaten richtete. „Wer von euch hat geschossen?”
Betreten blickten die Unionssoldaten zu Boden, weil sie natürlich nicht damit gerechnet hatten, jetzt und hier in der Öffentlichkeit von keinem anderen als General Sherman höchstpersönlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Dass sie alle drei dem Alkohol kräftig zugesprochen hatten, konnte man ihnen ansehen. Denn sie standen ziemlich unsicher auf den Beinen. Einer musste sogar von seinem Kameraden gestützt werden, weil er sonst sicher gestürzt wäre.
„Ich ... ich war es, Sir”, meldete sich schließlich der Mann in der Mitte zu Wort. Er war groß und hager. Aschblondes Haar umrahmte sein stoppelbärtiges Gesicht, während er versuchte, dem Blick des Generals standzuhalten. „Aber es ist doch gar nichts passiert.”
„Wie ist Ihr Name, Soldat?”, fuhr ihn Sherman an.
„Jones, Sir. Private Cyrus Jones!”, erwiderte der Soldat und versuchte stramm zu stehen. Aber diese militärische Haltung wirkte missglückt und in diesem Moment völlig deplatziert.
„Sie haben einen Mann verwundet, als Ihre Kugel das Hotelfenster dort oben getroffen hat, Private Jones”, fuhr Sherman fort. „Dafür werden Sie zur Verantwortung gezogen, und auch dafür, dass Sie im Dienst getrunken haben.”
„Aber das ist doch ...” Der Soldat suchte verzweifelt nach den passenden Worten. „Sir, ich habe doch gar nicht auf dieses Fenster gezielt. Das weiß ich genau.”
„Das stimmt”, ergriff nun auch einer seiner Kameraden das Wort. „Wir haben es genau gesehen. Jones hat nur in die Luft geschossen, und er stand doch auch da drüben. Von dort aus hätte er das Fenster gar nicht treffen können.”
„Ich war das nicht”, beteuerte Jones noch einmal seine Unschuld. „Sie müssen mir das glauben, Sir. Gut, wir drei haben alle zu viel getrunken, und dazu stehen wir auch. Aber keiner von uns würde mutwillig auf ein Fenster oder gar einen Zivilisten schießen. Wir wollten alle nur ein bisschen Spaß haben. Das ist alles.”
„Und wer soll es dann gewesen sein?”, stellte Sherman die Gegenfrage.
„Jemand, der einen Grund dafür hatte”, entgegnete Jones. „Ich jedenfalls nicht. Vielleicht war es der Mann, der dort drüben beim Wagen gestanden hat.” Er zeigte kurz in die betreffende Richtung. „Da war jemand. Aber ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Du hast das doch auch bemerkt, Tabor?”
Der angesprochene Soldat überlegte einen kurzen Moment und nickte dann schließlich.
„Ja, aber ich habe nicht genau darauf geachtet”, erwiderte er mit einem bedauernden Achselzucken und verzog das Gesicht, als er die Kopfschmerzen wieder spürte, die der Alkohol mittlerweile ausgelöst hatte.
Shermans Miene verdüsterte sich bei diesen Worten. Er überlegte nur wenige Sekunden, bis er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Denn wenn dies stimmte, was diese beiden Trunkenbolde behauptet hatten, dann war dieser Schuss auf Calhoun kein Zufall gewesen, sondern eiskalte Absicht. Und das bedeutete nichts Anderes als das, was Sherman schon im Gespräch mit Calhoun vermutet hatte: Dass sich Personen in Chattanooga aufhielten, die ganz sicher nicht zur Union gehörten! Womöglich hatte diese Kugel sogar Sherman selbst gegolten und der auf Calhoun abgefeuerte Schuss war nur eine Verwechslung gewesen.
Zum Glück befanden sich jetzt weitere Soldaten in der Nähe, die ebenfalls den Saloon aufgesucht hatten. Im Gegensatz zu ihren angetrunkenen Kameraden befolgten sie sofort Shermans Befehl. Und der lautete, die unmittelbare Umgebung des Hotels nach verdächtigen Personen abzusuchen!
* * *
Durango bemerkte die unruhigen Blicke seiner Kameraden, als auch er endlich den Stall erreichte, in dem sie die drei Pferde untergebracht hatten. Vance und McCafferty hatten die Tiere bereit gesattelt und nur noch darauf gewartet, dass der Lieutenant wieder zu ihnen stieß.
„Sherman war im Hotel”, berichtete Durango seinen Gefährten, während er die Zügel seines Pferdes von McCafferty entgegennahm. „Und ich möchte wetten, dass er mit Calhoun einige wichtige Dinge zu besprechen hatte. Aber das werden wir jetzt leider nicht mehr erfahren, wegen unseres hitzköpfigen Kameraden.”
Er hatte zu Vance gesprochen, aber McCafferty damit gemeint. Der Ire murmelte etwas Unverständliches vor sich hin, hielt sich aber ansonsten zurück. Vance war indes beim Stalltor angelangt und riskierte einen vorsichtigen Blick hinaus.
„Sieht aus, als wenn die Luft rein wäre”, meinte er. „Ich kann keine Soldaten sehen.”
„Gut, dann reiten wir”, sagte Durango und stieg in den Sattel seines Pferdes. Auch McCafferty und Vance saßen auf und ritten hinaus auf die schlammige Straße. Die trüben Wolken waren mittlerweile ein gutes Stück nach Westen weitergezogen, und die Abenddämmerung hatte bereits eingesetzt.
Umso besser, dachte Durango. Die Dunkelheit wird uns genau den Schutz geben, den wir jetzt brauchen. Und alles nur, weil dieser Hitzkopf McCafferty unbedingt seine persönliche Rache haben wollte. Er hat die gesamte Mission gefährdet. Wegen ihm werde ich einige unangenehme Fragen beantworten müssen.
Seine Gedanken brachen von einer Sekunde zur anderen ab, als er plötzlich eine aufgeregte und zugleich drohende Stimme von weiter oberhalb der Straße hörte.
„Halt!”, hörte er jemanden rufen. „Stehen bleiben!”
Durango drehte sich kurz um und erkannte drei blau uniformierte Soldaten, die ihn, Vance und McCafferty jetzt auf die Straße reiten sahen. Der konföderierte Lieutenant wusste, dass ihm und seinen Kameraden jetzt nur noch eine kurze Zeitspanne blieb, um aus dieser Falle zu entkommen.
Und deshalb tat er genau das, was in solchen Momenten nämlich das einzig Richtige war: Er riss seinen Revolver aus dem Holster und schoss auf die Soldaten. Auch Vance hatte seine Waffe gezogen und zielte auf einen Mann. Beide drückten fast gleichzeitig ab. Während Durangos Kugel einen der Soldaten am rechten Bein verwundete und ihn zu Boden stürzen ließ, ging Vances Kugel ins Leere und gab nun seinerseits dem Gegner die Chance, das Feuer auf die flüchtenden Reiter zu eröffnen.
Dazu kam er jedoch nicht, denn zwischenzeitlich hatte auch McCafferty seinen Revolver schussbereit und streckte den Unionssoldaten mit einem gezielten Schuss nieder, während der dritte Yankee hastig in Deckung ging. McCafferty hätte ihn höchstwahrscheinlich auch noch erwischt, wenn der Soldat nicht in letzter Sekunde geistesgegenwärtig reagiert hätte.
„Weg von hier!”, rief Durango und gab seinem Pferd die Zügel frei. Vance folgte ihm, und den Schluss bildete McCafferty, der noch einen dritten Schuss in Richtung des letzten Gegners abgab, bevor er ebenfalls die Straße hinunterritt.
Die drei getarnten Konföderierten hatten bewusst diesen Mietstall gewählt, um ihre Pferde unterzubringen. Er befand sich am Beginn einer Seitenstraße, an deren Ende sich nur wenige vereinzelte Häuser befanden. Dahinter erstreckte sich hügeliges Gelände, das von zahlreichen Büschen und Bäumen umgeben war. Eine bessere Möglichkeit zur Flucht gab es nicht. Das Lager der Unionssoldaten befand sich genau auf der anderen Seite der Stadt, und bis eventuelle Verfolger sich auf ihre Fersen zu heften versuchten, würden Durango, McCafferty und Vance schon längst im Dunkel der einsetzenden Nacht untergetaucht sein.
Durango drehte sich im Sattel um und versuchte etwas zu erkennen. Aber er hörte nur noch vereinzelte Schüsse und wütende Stimmen, als er zusammen mit seinen Gefährten die letzten Häuser der Stadt erreichte. Minuten später waren die die Gefährten in der Nacht untergetaucht.
* * *
Larry Calhoun biss die Zähne zusammen, als der Arzt eine Tinktur auf seine Wunde pinselte und anschließend einen sauberen Verband anlegte. Larrys Gesichtszüge waren blass, und er fühlte sich geschwächt.
„Sie haben verdammt viel Glück gehabt, Mister”, sagte der graubärtige Arzt zu ihm, nachdem er seine Arbeit beendet hatte. „Wenn die Kugel einen Knochen verletzt hätte, wäre die ganze Sache nicht so glimpflich vonstattengegangen. Sie werden sich noch ein paar Tage schonen müssen.”
Larry hörte nur mit halbem Ohr zu. Weil er natürlich wissen wollte, was in der Zwischenzeit draußen auf der Straße geschehen war. Aber auch Lieutenant Bridges war schließlich gegangen und hatte dem Arzt noch einmal eingeschärft, sich gut um den verletzten Calhoun zu kümmern. Nun blieb ihm nichts Anderes übrig als zu warten, und diese Ungewissheit zehrte an seinen Nerven.
Gerade als der Arzt das Zimmer verlassen wollte, betraten General Sherman und Lieutenant Bridges Larrys Zimmer. Die Petroleumlampe hatte der Arzt etwas heruntergedreht und den Vorhang am Fenster wieder zugezogen. Ein weiterer Heckenschütze sollte diesmal keine so leichte Chance mehr haben.
„Sie kommen am besten mit in unser Lager, Mister Calhoun”, sagte Sherman, nachdem er dem Arzt mit einer kurzen Geste zu verstehen gegeben hatte, dass er sich nun um alles Weitere kümmern würde. „Hier sind Sie nicht mehr sicher.”
„Haben Sie etwas herausfinden können?”, erkundigte sich Larry.
„Wir dachten zuerst, dass es einer von den Betrunkenen war, die aus dem Saloon schräg gegenüber kamen”, klärte ihn General Sherman auf. „Einer von ihnen hat einen Schuss abgegeben, aber nicht in Richtung Hotelfenster. Die beiden anderen Soldaten haben das mittlerweile bestätigt. Aber sie haben einen anderen Mann gesehen, der offensichtlich das Hotel beobachtet hat. Sekunden später, nachdem der Schuss fiel, war er nicht mehr zu sehen.”
„Wo ist er jetzt?”
„Er ist entkommen, zusammen mit seinen anderen Kumpanen”, musste nun Sherman zugeben. „Zwei unserer Soldaten wurden dabei verwundet.”
„Drei Männer?” Larry strich sich gedankenverloren übers Kinn. „Weiß man, wie sie aussehen? Hat irgendjemand Einzelheiten erkennen können?”
„Dazu ging alles viel zu schnell”, antwortete Sherman. „Sie sind in die Hügel entkommen. Ich habe einen Suchtrupp hinterhergeschickt. Aber bis jetzt wissen wir nichts. Kennen Sie eventuell diese Männer, Mister Calhoun?”
„Vielleicht”, erwiderte dieser ausweichend. „Dazu müsste ich mehr wissen, um etwas Genaues sagen zu können. Aber wenn es sich wirklich um diejenigen Männer handelt, an die ich denke, dann ist Ihr geplanter Atlanta-Feldzug nicht mehr so geheim wie Sie es vermuten, General.”
„Sie meinen, dass ...?”