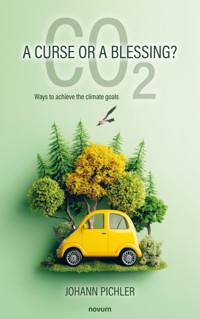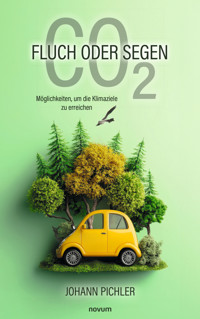
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Klimawandel ist unumstritten, doch wie gehen wir mit dem Kohlendioxid um, das als Sündenbock für die globale Erwärmung gilt? Dieses Buch bietet einen kritischen Blick auf CO₂ und seine Rolle in der aktuellen Klimadiskussion. Es beleuchtet den Einfluss der Land– und Forstwirtschaft, die Bedeutung der Baumartenwahl bei den Aufforstungen, die Herausforderungen bei der Nutzung von Biogas und Wasserstoff und hinterfragt die Rolle fossiler Brennstoffe. Sie erfahren, wie Waldbrände und Bodennutzung das Klima beeinflussen und welche Methoden tatsächlich zur Reduzierung von CO₂ beitragen können. Auch wird aufgezeigt, warum das CO₂ nicht nur als Umweltproblem, sondern auch als essenzieller Bestandteil für das Leben auf der Erde betrachtet werden sollte. Ein Ratgeber für alle, die den komplexen Zusammenhang zwischen CO₂ und unserem Planeten verstehen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bildquellennachweis:
S. 27, 32, 33, 41, 42, 43, 160, 184, 196-198 © Foto Pichler
S. 83, 86, 94, 104, 108, 110, 114, 118, 120, 128, 129 © Foto Wikipedia
S. 36 © Foto Morty
S. 103 © Foto Kelly/marken
S. 20 © Tabelle Prof. Dr. Schönwiese
S. 85 © Tabelle Wikipedia
S. 14, 73, 102, 105, 111 © Grafik Wikipedia / Internet
S. 28 © Grafik Dr. Berg
S. 135 © Tabelle Wikipedia
S. 141 © Frau Dipl. Ing. Marianne Priblatter-Hackl, von der NÖ-LLK & Statistik Austria
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0290-9
ISBN e-book: 978-3-7116-0291-6
Lektorat: Emma J. Dharmaratne
Umschlagfoto: Surachet Vangda, Yuliya Derbisheva | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen:
Bild 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 37, 38 © Foto Pichler
Bild 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 © Foto Wikipedia
Bild 36 © Foto Morty
Bild 20 © Foto Kelly/marken
Bild 2 © Tabelle Prof. Dr. Schönwiese
Bild 16 © Tabelle Wikipedia
Bild 34 © Tabelle LLK Priblata-Hackl
Bild 1, 14, 19, 22, 25, 33 © Grafik Wikipedia / Internet
Bild 4 © Grafik Dr. Berg
www.novumverlag.com
Der Klimawandel
Seit Bestehen der Erde hat es schon viele Klimaperioden gegeben. Jedes Erdzeitalter hatte sein bestimmendes Klima.
Durch die Plattentektonik, wo sich die Kontinente vor Milliarden von Jahren verschoben haben und wiederum zusammengestoßen sind, entstanden durch Anhebung riesige Gebirgszüge, wie die Alpen und der Himalaja. Durch die Verschiebung der Platten kommt es auch jetzt noch zu verheerenden Erdbeben und Vulkanausbrüchen. In Erinnerung ist ein Erdbeben zu Weihnachten 2004 vor Sumatra, wo das Epizentrum im Meer lag und einen gewaltigen „Tsunami“ auslöste. Dieser Tsunami löste eine Sturmflut aus, welche hunderttausenden Menschen das Leben kostete. Erst nach Wochen kam diese Sturmflut im Westen an den Küsten des indischen Ozeans an und niemand war darauf vorbereitet. Deshalb waren auch auf Sri Lanka viele Tote.
Es gab ein Zeitalter, in dem Österreich südlich des Äquators lag. Man kann dies im Naturhistorischen Museum in einem Film ansehen. Durch die Wanderung der Erdteile entstand überall ein anderes Klima. Ein Beweis dafür ist der Streit um die Gebiete um den Nordpol, weil jeder Staat dort die Erdöl- und Erdgaslager für sich in Anspruch nehmen will.
Wie wir aus dem Geschichtsunterricht wissen, lag Karthago zur Römerzeit in einem fruchtbaren Gebiet, südlich von Tunis, doch jetzt ist dort eine Wüste.
Es gibt jedoch auch in Wüstengebieten in größeren Tiefen Grundwasser, welches zur Bewässerung der Felder genutzt wird. Ich habe gelesen, dass in Libyen große Kartoffelfelder angelegt wurden, welche mit diesem Grundwasser beregnet werden, um Europa jederzeit mit Frühkartoffeln versorgen zu können.
Es gibt viele Faktoren, welche das Klima bilden. Dies sind hauptsächlich die Jahres-Durchschnittstemperatur und die Verteilung der Niederschläge. Weiters beeinflusst die Höhenlage, die geografische Breite, die Geländeausformung, wie Süd- oder Nordhang, und auch die Entfernung zum Meer unser Klima.
Es gibt überall auf der Welt ein anderes Klima. Auf Sizilien ist es wärmer als in Südtirol. Es können sich die Leute in der Mongolei auch nicht beschweren, weil es bei ihnen nicht so warm ist, wie in Indien. Überall leben Menschen und es wachsen dort klimaangepasste Bäume, Pflanzen und Feldfrüchte.
Dass sich unser Klima in den letzten Jahrzehnten verändert hat, haben wir alle erlebt und verspürt. Es wird kaum jemanden geben, der gegen eine Reduktion der Treibhausgase ist und für den Klimawandel eintritt.
Die Debatte darüber, muss ohne Einfluss von wirtschaftlichen und politischen Interessen oder Wichtigtuerei erfolgen. Man kann nicht die Bevölkerung in Geiselhaft und der Wirtschaft die Grundlagen nehmen, sodass diese nicht mehr konkurrenzfähig ist und die Arbeitsplätze verloren gehen.
Am 25. oder 26. März wurde im ORF-Teletext geschrieben, dass das Heizen mit Pellets umweltfreundlicher sei als das Heizen mit Brennholz. Diese Aussage ist derart falsch und kann nur von der Pellets-Industrie bezahlt worden sein.
Laub-Brennholz stammt ausschließlich aus Pflegemaßnahmen, hauptsächlich von der Durchforstung und den starken Ästen, krummen oder hohlen Stämmen von der Schlägerung. Um daraus Pellets zu erzeugen, muss dieses zuerst zu kleinen Spänen geraspelt werden, welche dann mit einem beigemischten Bindemittel (weil Laubholz keinen Harzanteil hat) gepresst werden können. Niemand weiß, welchen Ausstoß an CO₂ dieses Bindemittel emittiert.
Im Wienerwald gibt es einen Biosphärenpark, in dessen Kernzone kein Holz entnommen werden darf. Sogar von Windwürfen wird das Blochholz im Wald belassen. Beim Verfaulen des Holzes entweicht die gleiche Menge CO₂, welche darin gespeichert wurde. Beim Verheizen des Holzes würde die gleiche Menge CO₂ entstehen.
Es sollen die Fakten ehrlich aufgezeigt werden, wie die Emissionen reduziert werden können und wie man auf vernünftiger Basis die unvermeidlichen Treibhausgase aus derAtmosphäre wieder entfernen kann.
Vorgänge in der Natur
Das Klima ist der mittlere Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum.
Oftmals werden die Begriffe ‚Klima‘ und ‚Wetter‘ als gleichwertig gebraucht.
Mit Wetter meinen wir, was heute oder morgen draußen passiert: scheint die Sonne, gibt es Regen oder ist es stürmisch?
Mit Klima ist das gesamte Wetter über eine längere Zeit in einem bestimmten Gebiet gemeint.
Wasserdampf (Wolken und Nebel) hat den größten Einfluss auf unser Wetter.
Klimabestimmende Faktoren
Klimaelemente sind Temperatur, Niederschlag und Bewölkung.
Die wesentlichen, natürlichen Klimafaktoren sind geographische Breite, topographische Höhe und Exposition (Gebirgszüge), Entfernung vom Meer und anderen größeren Wasserflächen, Bodenart und Bodenbedeckung.
Einen wesentlichen Einfluss auf das Klima hat die Hauptwindrichtung. Hier wiederum sind die Hoch- und Tiefdruckgebiete entscheidend.
Man unterscheidet zwischen fünf großen Klimazonen: Polarzone, Subpolarzone, Gemäßigte Zone, Subtropen und Tropen.
Die wichtigsten Klimaelemente sind Temperatur, Luftdruck, Wind, Niederschlag, Bewölkung, Sicht, Sonnenscheindauer und Strahlung (http://www.dwd.de).
Das Klima wird aus den langjährigen Mittelwerten der Klimaelemente (Temperatur, Niederschlag, Luftdruck, Wind, Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Bewölkung) ermittelt.
Durch den Treibhauseffekt ändert sich das Klima vor allem durch die Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen. Diese werden von natürlichen Gasen und Wolken aufgenommen und zu einem Teil auf die Erde zurückgestrahlt. Dadurch tritt eine Erwärmung der Atmosphäre ein. Die wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit halten und trocknet daher durch die Luftbewegung den Boden aus.
Klimaunterschiede gibt es in den Vegetationszonen.
Tundra (Dauerfrost), borealer (nördlicher) Nadelwald/Taiga, Laub- und Mischwald, Steppe, Hartlaubgehölze, Wüste, Savanne und tropischer Regenwald.
Die Klimazonen in Europa haben einen Anteil an drei großen Klimazonen: der subpolaren Zone mit borealem und Tundren-Klima im Norden, den Mittelbreiten mit gemäßigtem Klima sowie den südlich angrenzenden Subtropen.
Die Einflüsse vom Atlantik nehmen von Westen nach Osten ab und man spricht deshalb davon, dass das Klima zunehmend kontinentaler geprägt ist.
Die Niederschlagsmengen und Temperaturen sind teilweise durch die Geländeausformung abhängig. Bei einer Südströmung kann es im Winter in den Staulagen der Alpen zu enormen Schneefällen kommen, während nördlich der Alpen durch den Föhn verhältnismäßig hohe Temperaturen herrschen und durch Regen die Landschaft schneefrei ist.
Zusammensetzung der Luft in Bodennähe
Eine Studie von Herrn Prof. Dr. Christian-Dietrich Schönwiese, Leiter der Klimaforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main, hat in zahlreichen Publikationen die Zusammensetzung der Elemente der Luft in Bodennähe ohne Berücksichtigung des Wasserdampfes beschrieben.
Die ZAMAG Wien hat im Jahr 2008 den Klimawandel auf Grund dieser Studie zu erklären versucht. Dabei wurde damals der (Kohlendioxidgehalt) – CO₂ – der Luft mit 382 ppm angegeben, welcher sich nach anderen Publikationen bis 2018 auf 407 ppm erhöht hat.
Wie man die Teile der Elemente anschaulich machen kann
In nachfolgender Tabelle habe ich versucht, eine Zusammenstellung der Elemente nach Prof. Dr. Schönwiese in:
Die Daten konnte ich aus dem Internet https://www.zobodat.at › pdf › Umwelt-SchrReihe…März 2022 und Wikipedia in Erfahrung bringen und habe Teile davon in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:
In der Tabelle sind folgende Größen und Werte angegeben:
Prozenten – ppb (milliardstel Teilen)Spezifisches Gewicht des Gases in absteigender ReihenfolgeAnteil in Kilogramm (kg) je m³ Luft,Menge des Elements in kg welches in 2 Mio. m³ Luft enthalten ist (1 ha mal 200 m Höhe)Menge der Luft in m³, welche für 1 kg des Elements erforderlich ist.In einem Raum von 1 Hektar (10.000 m²) und einer Höhe von 200 Metern sind in 2 Mio. m³ Luft und darin folgende Mengen der Gase enthalten:
Die Treibhausgase:
Die Edelgase:
1 953 000,00 kg Stickstoff
1,87 kg Helium
598 690,00 kg Sauerstoff
30,54 kg Neon
1 609,00 kg Kohlenstoffdioxid – CO₂
33 325,12 kg Argon
2,60 kg Methan
8,55 kg Krypton
1,27 kg Lachgas
1,06 kg Xenon
0,10 kg Wasserstoff
Die Edelgase verbinden sich unter normalen Bedingungen nicht mit anderen Elementen.
Die, als Treibhausgase bedeutenden Elemente, sind spezifisch am schwersten und drängen immer in Bodennähe. Zu bemerken ist dies am deutlichsten, wenn man eine Bergwanderung macht und beim Atmen spürt, dass man weniger Luft bekommt. Der Sauerstoff ist spezifisch schwerer und sinkt in tiefere Lagen ab.
CO₂ zählt zu den schädlichsten Klimagasen und ist neben Lachgas – N₂O – am schwersten. Sauerstoff und Stickstoff sind annähernd gleich schwer und befinden sich ebenfalls in Bodennähe, in unserem Lebensbereich.
Das sehr klimaschädliche Gas, Methan – CH₄ – ist eines der spezifisch leichtesten Gase und verflüchtigt sich nach der Entstehung in obere Regionen.
Eine Behauptung, dass 1 Kilo Methan (CH₄) 28-mal schädlicher ist als 1 Kilo CO₂, ist bei der Klimadebatte ein beliebtes Szenario.
Eine Fangfrage bei Kindern war immer: was ist schwerer, 1 Kilo Gänsefedern oder 1 Kilo Gold?
Den Unterschied merkt man, wenn man sich diese auf die Zehen fallen lässt.
1 Kilo eines Elementes ist in folgenden m³ Luft enthalten und verflüssigt sich bei minus Grad C°:
Stickstoff
1,02 m³
- 196 °C
Sauerstoff
3,34 m³
- 183 °C
CO₂
1 242,00 m³
- 56 °C
Methan
7 748 334,00 m³
- 156 °C
Lachgas
1 579 878,00 m³
-88 °C
Wasserstoff
20 228 992,00 m³
-252 °C
Ammonium
(NH₄)
- 33 °C
In der Natur ist der Sauerstoff in der Luft zum Atmen und Stickstoff nur in Verbindungen als Dünger und zur Bildung von lebensnotwendigem Eiweiß notwendig. CO₂ brauchen alle Pflanzen zur Photosynthese, damit sie wachsen können und allen Lebewesen als Nahrung dienen.
Ich habe mich vor kurzem mit der Biologin Mag. Karin Kaiblinger (Freundin meiner Tochter) über das CO₂ unterhalten.
Sie sagte spontan: „CO₂ ist das Gas des Lebens.“
Wasserstoff ist das leichteste Gas und ist für uns Menschen in Verbindung mit Sauerstoff zu Wasser von großer Bedeutung. Wasserstoffverbindungen mit Kohlenstoff zu Methan und einigen anderen zu Säuren sind für uns ebenso wichtig.
Die anderen, von Prof. Dr. Schönwiese, angeführten Gase, aufgereiht nach ihrem spezifischen Gewicht :.
Xenon, Krypton, Neon und Helium sind Edelgase und gehen keine Verbindungen mit anderen Elementen ein.
Vom Menschen verursachte Eingriffe in die Natur, welche zum Teil einen Einfluss auf unser Klima haben, sind:
Die Entwaldung durch Rodung
In Europa
Mit der Besiedelung in Mitteleuropa brauchte die Bevölkerung Weide- und Ackerland. Auch wurden die spärlichen Erzvorkommen genutzt, hauptsächlich Eisen, aber auch Nickel und Kupfer. In manchen Gebieten wurde wegen der Salzgewinnung viel Holzkohle benötigt und deswegen großflächig im Gebirge viel Holz geschlägert. Auch war das Holz ursprünglich das einzige Heizmaterial, weil man die Kohle noch nicht kannte. Im 17. Jahrhundert wurde mittels Flößerei Brennholz bis nach Wien gebracht.
In der Zeit der Pest und der Kriege wurden ganze Landstriche entvölkert und die Waldfläche nahm wieder zu. In England, Schottland und Irland wurden im Mittelalter große Flächen gerodet, um Weideland für die Schafherden zu gewinnen. Englische Stoffe aus Schafwolle waren am Kontinent sehr begehrt und brachten gute Erlöse. In Schottland, den sogenannten Highlands, haben die Schafe alle guten Gräser abgeweidet und das Heidekraut konnte sich vermehren.
Durch die Niederschläge wurde die Humusschicht abgeschwemmt und hat sich in Mulden gesammelt. Dieses Material wurde durch die Jahrhunderte zu Torf, welchen man als Heizmaterial verwendet. Dieser Torf gibt dem Whisky seinen rauchigen Geschmack, wodurch er weltberühmt wurde.
Heute sind die Highlands mit einer Fläche von tausenden Hektar fast unbewohnt und es ist dort schwierig, auf dem felsigen Untergrund mit einer Rohhumusauflage wiederum eine Gras-, Strauch- oder Baum-Vegetation zu bekommen. In den sumpfigen Mulden hat man nach dem Ersten Weltkrieg auf Anraten kanadischer Soldaten Aufforstungen mit Sitka-ichte (Picea sitchensis) gemacht. Das Saatgut kam aus Britisch-Columbien.
In Irland brauchte man wegen der starken Zunahme der Bevölkerung die Flächen für Weide- und Ackerland. Im 17. Jahrhundert brach wegen der Kartoffelkrautfäule eine Hungersnot aus, welche vielen Menschen das Leben kostete. Es begann dann eine große Auswanderungsbewegung nach Amerika. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden jene Böden mit wenig Ertrag in Irland wieder aufgeforstet.
Russland – Sibirien
In Russland, der damaligen Sowjetunion, wurden zur Erfüllung des Plansolls viele Flächen gerodet und das Holz meist exportiert, um Devisen zu bekommen. Diese Rodungen erfolgten auch großflächig in Sibirien. Ich war 1979 mit einer Reisegruppe in der Nähe von Irkutsk, wo am 11. Juni die Apfelbäume blühten und die Getreidefelder vielleicht 5 cm hoch waren. Uns hat man erzählt, dass dies eine besondere Züchtung des Weizens ist. Doch bei kühlen und nassen Sommern gibt es sehr oft Missernten. Der Baikalsee beginnt Mitte September zuzufrieren.
Ich habe gehört, dass diese Flächen teilweise wieder aufgeforstet werden. Es werden auch Versuchsaufforstungen mit Holzarten aus dem Himalaya, aus Canada und Alaska gemacht. Ich habe mir eine Handvoll Samen der Baikal-Ceder mitgenommen und im Forstgarten in einem Gewächshaus in Töpfen angebaut. Es haben aber nur wenige gekeimt und die Pflanzen waren nach einigen Jahren erst ca. 8 cm hoch. Die Bäume wachsen sehr langsam und brauchen mindestens die doppelte Anzahl an Jahren, um jene Stärke wie bei uns zu erreichen. Sehr bekannt ist die Sibirische-Lärche, welche sehr enge Jahrringe hat und als Schnittholz sehr begehrt und auch sehr teuer ist.
Nordamerika
Mit der Entdeckung Amerikas kamen aus Europa aus den dichtbesiedelten Ländern, anfangs aus Irland und England, später auch Gruppen aus Deutschland, der Schweiz und auch aus Österreich, welche wegen ihrer Religion verfolgt wurden, nach Amerika. Hier fanden sie reichlich Weide- und Ackerland vor, welches zuerst, hauptsächlich bis zum Mississippi, besiedelt wurde. Hier wurden keine wesentlichen Rodungen gemacht, da wegen der Trockenheit höchstens ein Strauchwald vorhanden war und die Flächen als Weideland diente.
Nordamerika, wo die Küstenregion im Osten bewaldet und von der „indigenen Bevölkerung“ sehr dünn besiedelt war, wurde von Frankreich und England in Besitz genommen.
Um Acker- und Weideland zu gewinnen, wurden geeignete Flächen gerodet, um auf den landwirtschaftlichen Flächen so viele Lebensmittel zu produzieren, welche zum Überleben reichten.
„Der Westen Nordamerikas wurde aus dem asiatischen Raum, aus China, Russland und Japan besiedelt. In Oregon und vor allem in Portland war bis ins 19. Jahrhundert eine mehrheitlich russische Bevölkerung. Dies wurde uns anlässlich einer Exkursion 1987 in BC, Washington, Oregon und Kalifornien, in dem Douglasiengebiet, erzählt.
Ab dem 17. Jahrhundert wanderten Menschen aus verschiedenen Regionen Europas in die englischen und französischen Kolonien in Nordamerika ein. Sie suchten oft Schutz vor politischer Verfolgung und Freiheit für die Ausübung ihrer Religion.“
Da man in Kalifornien Gold gefunden hat, entstand ein „Goldrausch“, welcher durch den Eisenbahnbau über die Roky-Mountains vielen Auswanderern die Reise erleichterte. Landwirtschaftstaugliche Flächen wurden gerodet, um die ankommenden Menschen zu ernähren. Viele kamen auch, um wertvolle Mineralien zu finden.
Südamerika
In Südamerika waren Expeditionen von den Spaniern auf der Suche nach Edelmetallen, vorwiegend Gold, welches man anfangs den Inkas I abgenommen hat, aber auch nach anderen wertvollen Erzen gestartet.
Brasilien
Eine große Debatte herrscht bei uns in den Medien derzeit über die Abholzung und das Abbrennen des Regenwaldes. 2013 nahm ich bei einer Brasilien-Reise teil, weil mich das Thema Regenwald interessierte. Da unsere Reisegruppe nur aus 2 Personen bestand (meiner Partnerin und mir), hatten wir mehr Zeit und konnten auch andere Orte aufsuchen und vom Reiseleiter viel von der Geschichte und der Entwicklung dieses Landes erfahren.
Brettwurzel – Dunkle Linie am Stamm zeigt den Wasserstand in der Regenzeit an. Brettwurzel erhöhen die Standfestigkeit des Baumes.
An der dunkleren Linie am Stamm sieht man noch den Wasserstand von der Regenzeit.
Die Spanier hatten in der Küstenregion von Brasilien nichts Wertvolles gefunden und es war daher für sie uninteressant. Das kleine Land Portugal hat sich im 16. Jahrhundert dieser Gegend angenommen.
Landkarte Brasilien
Landkarte von Brasilien – Größenvergleich mit Österreich
Brasilien: Fläche 8,516.000 km²
Österreich: Fläche 83.878 km²
Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde und
ist 101-mal so groß wie Österreich.
Der König teilte das Land in Regionen auf und vergab diese an junge Adelige. Nach einigen Jahren gaben die meisten wieder auf und fuhren nach Europa zurück.
Im Amazonas-Regenwald fand man eine Holzart (Paubrasilia echinata) aus der man einen besonders schönen roten Farbstoff gewinnen konnte. Man nannte es damals Brasilholz, welches dann dem Land den Namen gab.
Ähnliches sahen wir im Bundesstaat „Minas Gerais“, wo im 17. u. 18. Jahrhundert viele wertvolle Erze gefunden wurden.
Zum Schmelzen dieser Erze wurde Holzkohle gebraucht. Deshalb wurde großflächig der Wald geschlägert. Ein Aufforsten war vor 400 Jahren nicht üblich und wurde auch aus Kostengründen nicht gemacht.
Da man in Brasilien damals noch keine Steinkohlevorkommen kannte, welche in günstiger Entfernung lagen, wurde Holzkohle zum Schmelzen der Erze verwendet. Brasilien hat, soviel man jetzt weiß, fast kein Kohlevorkommen.
Deshalb wurden die naheliegenden Wälder abgeholzt und daraus Holzkohle gewonnen. Der Bedarf an Holzkohle wird sicher enorm gewesen sein und wurde auch aus großen Entfernungen herangeschafft.
Es war auch in Europa üblich, dass die Erze anfangs mittels Holzkohle geschmolzen wurden.
Heute gibt es im großen Umkreis von „Oro Preto“, der damaligen Hauptstadt und dem Zentrum der Erzgewinnung, keinen Wald mehr.
Die abgeholzten, landwirtschaftlich nutzbaren Flächen wurden zur Produktion von Nahrungsmitteln genutzt, die bergigen Gebiete blieben kahl und dort wurde vielfach das Erdreich abgeschwemmt. Nur in einigen kleinen Mulden werden Aufforstungen mit Eukalyptus gemacht.
Im 18. Jahrhundert entdeckte man, dass im Regenwald Bäume standen, aus deren Saft Kautschuk gewonnen werden konnte, die sogenannten Gummibäume. Am Zusammenfluss von Rio Solimões (europäisch Amazonas) und Rio-Negro entstand die Großstadt Manaus, das Zentrum des Kautschukhandels.
Ab Manaus heißt der Fluss erst offiziell Amazonas. Er hat eine Breite von mehreren Kilometern und eine Tiefe von 70 Metern. Deshalb können bis Manaus die Hochseeschiffe den Amazonas, ungefähr 2200 km vom Atlantik her, befahren.
Manaus ist eine Millionenstadt und es gibt auch zahlreiche Fabriken. Zum Beispiel steht dort die größte Honda-Fabrik, in der die meisten Motorräder erzeugt werden. Wir sahen im Hafen ein Hochseeschiff, welches gerade mit Motorrädern beladen wurde.
Im 19. Jahrhundert hatte diese Stadt schon 1,5 Mio. Einwohner und es gab viele Millionäre, welche sich prunkvolle Villen bauen ließen. Auch das weltberühmte Opernhaus zeugt heute noch von diesem Reichtum. Manaus ist die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas.
Es war durch Todesstrafe verboten, Samen dieses Gummibaumes zu exportieren. Engländern ist es aber gelungen, über Peru an diese Samen zu kommen. Sie haben in Malaysia und Indochina Plantagen angelegt und konnten so die Produktion steigern und das Produkt billiger auf den Markt bringen. Bei einer Rundreise in Kambodscha und Vietnam 2018 sahen wir in Vietnam noch solche Plantagen. Der Naturkautschuk, welcher für manche Zwecke noch gebraucht wird und einen guten Preis erzielt, wird mit der gleichen Methode, wie bei uns das Harz der Schwarzkiefer gewonnen.
Erst mit der Erzeugung dieser Gummiwaren aus Erdölprodukten kam im 19. Jahrhundert der Niedergang der Kautschukgewinnung aus dem Regenwald. Heute hat Manaus ca. 2 Mio. Einwohner und ist eine Industriestadt.
Es haben sich viele Betriebe angesiedelt, weil die Arbeitskräfte verhältnismäßig billig waren. Der Verkehr spielt sich, mit Ausnahme in der Stadt, hauptsächlich per Motorbooten auf dem Wasser ab.
Anlässlich einer Rundreise in Brasilien hatten wir in Salvador de Bahia viel Zeit und fuhren mit einem Taxi ins Landesinnere nach Sao Felix.