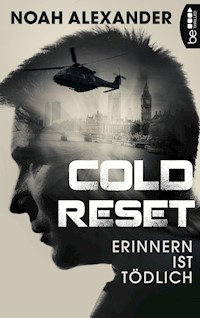
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du hast vergessen, wer du bist. Du weißt nicht, wie du in das Auto gekommen bist, das mit dir langsam im Fluss versinkt. Mit knapper Not befreist du dich aus dem Wagen. Da vibriert dein Handy. Eine SMS. Drei Worte: "Lauf, Ben, lauf!"
Plötzlich Rufe, Schüsse, Kugeln schlagen neben dir ein. Du rennst los, fliehst vor deinen Verfolgern.
Wer will dich töten? Warum?
Deine Flucht führt dich quer durch Europa. Doch deine Verfolger sind dir stets einen Schritt voraus.
Bald ist dir klar: Um zu überleben, musst du dich erinnern.
Aber was du nicht weißt: Das Schicksal der Menschheit liegt in deinen Händen.
Ein rasanter Action-Thriller, der seinen Lesern den Atem nimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Wie es zu diesem Thriller kam
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Über dieses Buch
Er hat vergessen, wer er ist. Er weiß nicht, wie er in das Auto kam, das mit ihm im Fluss versinkt. Mit knapper Not befreit er sich aus dem Wagen und rettet sich ans Ufer. Da vibriert das Handy in seiner Tasche. Eine SMS. Drei Worte: »Lauf, Ben, lauf!«
Plötzlich Rufe, Schüsse, Kugeln schlagen neben ihm ein. Ben rennt los, flieht vor seinen Verfolgern.
Wer will ihn töten? Warum?
Bens Flucht führt ihn quer durch Europa. Doch seine Verfolger sind ihm stets einen Schritt voraus.
Ihm ist bald klar: Er muss sich erinnern, um zu überleben.
Was er nicht weiß: Das Schicksal der Menschheit liegt in seinen Händen.
Ein rasanter Action-Thriller, der seinen Lesern den Atem nimmt.
Über den Autor
Hinter dem Pseudonym Noah Alexander stehen fünf erfolgreiche deutschsprachige Autoren, die während eines Writers-Room gemeinsam die Idee zu dem Thriller »Cold Reset – Erinnern ist tödlich« entwickelt und zu Papier gebracht haben. Die Autoren sind: Martin Conrath, Sabine Klewe, Ralf Pingel, Anette Strohmeyer und Markus Stromiedel.
Wie es zu diesem Thriller kam
Was passiert eigentlich, wenn man fünf herausragende Autoren fünf Wochen lang gemeinsam in einen Konferenzraum sperrt und ihrer Fantasie freien Lauf lässt? Markus Stromiedel über das Projekt »Writers-Room« und den Entstehungsprozess von »Cold Reset«.
Die Gott-Phase des Schreibens als Gruppenprozess
Wie lange brauchen Sie, um einen guten Roman bis zur letzten Seite zu lesen? Vermutlich ein paar Tage oder auch nur eine Nacht, wenn die Story besonders spannend ist.
Einen Roman zu schreiben dauert länger. Viel länger. Manche Kollegen schaffen es in sechs Monaten, die meisten benötigen mehr Zeit, bis sie das Wort »Ende« unter ein Manuskript setzen können. Ich selbst verbringe von der ersten Idee bis zum fertigen Roman etwa ein Jahr mit meinem Text, und wenn das Thema viele Recherchen verlangt, wie zuletzt mein Thriller »Zone 5«, bin ich erst nach achtzehn Monaten fertig.
Schreiben kostet Zeit. Jeder weiß das in der Buchbranche, es ist eine unumstößliche Wahrheit.
Umso verblüffter waren die Verantwortlichen im Bastei-Lübbe-Verlag, als ich Ihnen am Rand der Buchmesse ein ungewöhnliches Projekt vorschlug: »Fünf Autoren schreiben in fünf Wochen einen kompletten Roman.« Nachdem man sich vergewissert hatte, dass das kein Scherz war, kamen die Fragen: Wie soll das gehen?
Ich wusste damals nicht, ob es klappen würde. Ich wusste nur, dass es mich wahnsinnig nervte, wie lange es dauerte, bis eine Geschichte, die ich mir bei langen Spaziergängen ausgedacht und am Schreibtisch niedergeschrieben hatte, endlich als Roman erschien. Denn nicht nur das Schreiben eines Buches kostet Zeit, sondern auch die Arbeit mit dem Text im Verlag, dazu der Druck, die Werbung für das Werk, der Vertrieb an die Buchhandlungen und Online-Shops. Erschien ein Buch ein Jahr, nachdem ich die Idee zur Story gehabt hatte, war das rasend schnell, zwei Jahre warten war durchaus normal. Zwei Jahre, in denen eine brandheiße Idee merklich abgekühlt sein konnte.
Das musste schneller gehen!
Aus meiner Zeit als Drehbuchautor kannte ich das Prinzip »Writers-Room«: Eine Gruppe von Autoren sitzt zusammen mit einem Head-Autor (oder einer Head-Autorin, klar) in einem Raum und schreibt gemeinsam an einer Serie. »Gemeinsam schreiben« heißt hier, dass gemeinsam eine Story entwickelt oder eine vorgegebene Story weiter ausgearbeitet wird. Danach werden die verschiedenen Drehbücher der Serie an die einzelnen Autoren verteilt und zuletzt vom Head-Autor wieder überarbeitet. So schafft ein Team von Kreativen in wenigen Monaten, wofür ein einzelner Drehbuchautor Jahre benötigen würde.
Könnte es gelingen, ein solches Prinzip auf die Prosa zu übertragen? Wohlgemerkt, ich wollte keinen Episodenroman entstehen lassen, also ein Buch mit einer Reihe von einzelnen Geschichten. Auch sollte kein Roman entstehen, in dem die Kapitel offen ersichtlich jeweils von einem anderen Autor verfasst worden sind und denen man den speziellen Schreibstil des betreffenden Autors ansieht. Am Ende meines Writers-Rooms sollte ein Roman stehen, bei dessen Lektüre man nicht merkt, dass er von verschiedenen Autoren geschrieben ist. Ein Buch aus einem Guss, so wie es der Leser gewohnt ist und wie er es auch von einem guten Thriller verlangen kann.
Ich präsentierte mein Konzept. Der Bastei-Lübbe-Verlag sagte zu.
Die folgenden Wochen waren mit die spannendsten meines Autorenlebens. Wir mussten ein enormes Tempo vorlegen, um den Zeitplan einzuhalten. Bis zum geplanten Start blieben nur zwei Monate, um das Team zusammenzustellen, die Infrastruktur im Verlag aufzubauen und die Verträge auszuhandeln, ein durchaus schwieriger Punkt bei diesem Projekt, das ja ohne Vorbild in der Buchbranche war. Und bis auf die Grundidee hatte ich noch keine Ahnung, was für eine Geschichte wir erzählen würden. Doch als Drehbuchautor schockte mich das nicht. Oft genug hatte ich im Writers-Room als Autor und auch als Head-Autor erlebt, wie zügig ein eingespieltes Team aus dem Nichts eine spannende Story erschaffen kann.
Alle zogen mit. Räume wurden gebucht, Computer angeschafft, Mitarbeiter freigestellt. Die Spannung stieg, im Verlag und auch bei mir. Denn die schwerste Aufgabe lag noch vor mir: die richtigen Kollegen für den Writers-Room auszusuchen und sie von dem Projekt zu überzeugen.
Der Anforderungskatalog für einen Autor, der im Writers-Room überleben soll, ist hoch: Sie oder er muss nicht nur gut schreiben können. Ein solcher Autor muss teamfähig sein, uneitel und pragmatisch, belastbar und verlässlich. Er muss in der Lage sein, Ideen in den Ring zu werfen und auszuhalten, wenn die anderen sie Sekunden später zerfetzen. Er muss die Fähigkeit haben, Einfälle anderer weiterzuentwickeln und eine Story im Kopf immer wieder umzubauen. Er muss Tag für Tag in den Ring steigen, egal, wie er sich fühlt, die anderen verlassen sich auf ihn. Und er darf bei all dem nicht den Spaß an der Sache verlieren. Denn ohne Spaß – und den hatten wir – geht es nicht, die Belastung wird sonst schnell unerträglich. Wenn ein Writers-Room scheitert, dann weniger an inhaltlichen als vielmehr an zwischenmenschlichen Problemen.
Das Autoren-Team, das sich an jenem Morgen im Konferenzraum »Unger« im zweiten Stock des Bastei-Lübbe-Verlages in der Kölner Schanzenstraße einfand, war – aus der Rückschau gesehen – perfekt. Martin Conrath, Sabine Klewe, Ralf Pingel und Anette Strohmeyer sind nicht nur hervorragende Autoren, sondern sie harmonierten sehr gut miteinander, verfolgten uneitel die gemeinsame Idee und fügten sich, ohne sich selbst zu verleugnen, in das Team ein, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Es würde in den kommenden fünf Wochen kaum Konflikte geben, die wenigen, die es gab, waren alle schnell ausgeräumt. Doch das konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Umso größer war die Spannung in mir.
Gut einen Tag brauchten wir, um uns einzugrooven: erstes Kennenlernen, Technik-Einführung und Verteilen der Codes für das Verlags-Netzwerk, man hatte uns dort für unser Projekt eine virtuelle Spielwiese eingerichtet. Dann, hochoffiziell und zugleich sehr lässig, die Begrüßung vom Bastei-Lübbe-Vorstand samt Rundgang durchs Haus, bei dem wir einen Haufen neugierige Blicke auf uns zogen: Das also waren die verrückten Autoren, die in ein paar Wochen einen kompletten Roman schreiben wollten. Uns begegnete wohlwollende Skepsis und sehr viel Freundlichkeit. Ich bin mir sicher, der eine oder andere bemitleidete uns, weil er erwartete, dass wir krachend scheitern würden.
Wir schlugen unser Lager inmitten der Lektoren der Abteilung Digitales Programm auf und fühlten uns in dem jungen Team sofort wohl. Anfangs waren wir noch die Exoten: Obwohl jeder in der Abteilung täglich mit Autoren und deren Werken zu tun hatte, war es bis zu diesem Zeitpunkt doch etwas Ungewöhnliches, Schreibende live bei der Arbeit beobachten zu können.. Autoren, das waren jene Wesen, mit denen man einen Kaffee trank und eine Story verabredete, dann verschwanden die Wesen im Nirgendwo und es war still, bis irgendwann mit einem »Pling« ein Manuskript im E-Mail-Postfach landete oder auch der Hilferuf, dass man ganz dringend noch ein paar Wochen oder Monate länger brauchte. Autoren waren nett oder anstrengend und manchmal auch zeitraubend, wenn der Termindruck hoch und die Zahl der Konferenzen unabsehbar war und ein Autoren-Anruf gerade überhaupt nicht passte. Und jetzt saßen da auf einmal diese fünf Paradiesvögel im Konferenzraum, redeten laut und lachten viel und diskutierten auch dann noch weiter, wenn sie in der Kaffeeküche standen und die Espressomaschine traktierten.
Mit der Zeit gewöhnte man sich an uns, so wie auch wir die Scheu verloren, und bald schaute niemand mehr überrascht auf, wenn wir um die Ecke fegten. Wir wurden Teil des Verlages, eine sehr wertvolle Erfahrung. Als mir beim Weg zum Mittagessen im Treppenhaus das erste Mal ein beiläufiges »Mahlzeit« entgegenschallte, wusste ich: Wir waren angekommen.
Die ersten beiden Wochen des Writers-Room waren ein riesengroßer Spaß. Acht Tage lang entwickelten wir Figuren, wählten Schauplätze aus und erdachten die Story, Kapitel für Kapitel. Alles war möglich, es gab keine Einschränkungen, die Gott-Phase des Schreibens als dynamischer Gruppenprozess. Das Tempo, mit denen wir Ideen ausspuckten und wieder verwarfen, war atemberaubend, wir fühlten uns wie Surfer, die sich ins Meer warfen und Wellen abritten und dabei schauten, welche dieser Wellen – also Geschichten – am meisten Spaß machten.
Wir saßen in diesen Tagen an einem großen Konferenztisch zusammen, darauf eine Reihe von Laptops, aus denen sich Kabel schlängelten und nicht nur virtuell, sondern auch räumlich ein Netz bildeten. Über allem hing der Beamer und projizierte das Monitorbild eines der Rechner an die Wand. Einer von uns schrieb, vier dachten nach und diskutierten und spielten den anderen wortreich Szenen vor und sahen dabei zu, wie ihre Ideen auf dem Laptop des Kollegen zu kurzen Texten wurden. Es war so, wie ich es erhofft und erwartet hatte: Die Geschichte zu unserem Roman entstand in diesen acht Tagen, 100 Kapitel, in knappen Worten zusammengefasst, inklusive aller Plot-Points und Szenen-Cliffs, dazu die Charakterbeschreibungen aller Hauptfiguren samt Fotos, die wir aus dem Internet fischten, um unserer Phantasie ein konkretes Bild zu geben. Und das, obwohl es am Anfang unseres Writers-Rooms nicht mehr gab als eine Idee, eine Situation: Der Held wacht nach einem Unfall auf, sein Auto versinkt im Wasser. Er weiß nicht, wer er ist. Aber er weiß, was er tun soll, denn sein Handy vibriert, und eine Nachricht poppt auf dem Bildschirm auf: »LAUF«. Und genau das taten wir gemeinsam mit unserem Helden, der von uns quer durch Europa gehetzt wurde auf der Jagd nach dem Geheimnis, das er in sich trägt.
Dann begann die Schreibphase. Nun wurde es stiller im Konferenzraum und in den Büros, die man uns zur Verfügung gestellt hatte. Uns blieben noch 16 Arbeitstage bis zur Deadline, knapp zwei durchgeschriebene Kapitel pro Tag waren nötig, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Diese Zahl ergab sich aus eine simplen Rechnung: Vier Autoren schrieben, jeder hatte 25 Kapitel vor sich, also ein Viertel des Buches. Als Head-Autor fiel mir die Aufgabe zu, die Texte der Kollegen sofort zu lesen, stilistisch zu bearbeiten und das Ergebnis zu besprechen, damit der gemeinsam verabredete Schreibstil von allen verinnerlicht und eingehalten wurde. Ich hatte den zeitlichen Aufwand dieser Arbeit total unterschätzt: Acht Kapitel pro Tag prasselten auf mich ein, dazu drei Besprechungen täglich, an denen wir uns gegenseitig auf Stand brachten und die Änderungen im Plot und in den Hauptfiguren, die sich durch die Arbeit am Text ergaben, besprachen. Bald hing ich ein paar Tage hinter meinem Zeitplan hinterher, eine Verspätung, die ich bis zum Schluss nicht aufholte.
Für mich als Head-Autor war diese Phase eine besondere Herausforderung, nicht nur wegen der Stoffmenge, die ich zu bewältigen hatte. Die ersten zwei Wochen des Writers-Rooms waren für mich als einstiger Drehbuchautor vertrautes Terrain gewesen, ich hatte schon oft mit Co-Autoren und mit Autorenteams zusammengearbeitet, kannte die inhaltlichen und gruppendynamischen Prozesse und wusste, wie man am besten mit ihnen umgeht. Jetzt kam ein weiterer Schwierigkeitsgrad hinzu: Hatten wir während der Plotphase die Geschichte noch chronologisch durchgesprochen, musste ich nun Tag für Tag in der Handlung hin- und herspringen. Denn jeder der vier schreibenden Kollegen hatte seine Arbeit an einem anderen Punkt der Geschichte begonnen, ich griff also in den täglich entstehenden Kapiteln in Texte ein, in denen unsere Hauptfigur an vier unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung stand – um 10 Uhr ran an die Exposition, um 12 Uhr rüber zum Midpoint, ab 14 Uhr dann zwei Kapitel Showdown, während das Telefon klingelt und eine Plotfrage aus dem zweiten Viertel der Geschichte geklärt werden muss. Die sehr genauen Aufzeichnungen während der Plotphase halfen dabei, nicht die Orientierung zu verlieren.
Am vorletzten Tag der letzten Woche schließlich knallten die Korken: Wir hatten es tatsächlich geschafft. Wir hatten einen kompletten Roman geschrieben, in nur fünf Wochen. Alle waren zufrieden und total erschöpft und auch ein bisschen stolz. Wir freuten uns, dass wir zusammen so viel Spaß gehabt hatten und waren froh, dass wir noch miteinander redeten. Es war mehr als nur ein Spaß, als wir flachsten: Wann beginnt der nächste Writers-Room?
Während meine vier Kollegen das Projekt verließen und ihre Texte in meine Obhut gaben, lag vor mir die Aufgabe, unseren Roman für das Lektorat vorzubereiten. Das bedeutete: noch einmal alles lesen, an Details schleifen, einzelne Abschnitte neu schreiben, wenn mir oder den Kollegen ein Fehler unterlaufen war. Jetzt wurde endgültig der Stil angeglichen, um aus dem Geschriebenen eine Einheit zu schaffen, die wie aus einer Hand wirkte. Ich empfand diese Arbeit als sehr erfüllend, weil ich hervorragende Texte bekommen hatte, die ich jetzt abrunden und weiter verbessern durfte. Erst jetzt wurde mir klar, wie viel in diesen Tagen entstanden war, wie viel geballte Kreativität ein solcher Writers-Room zu entfachen vermag.
Am Ende bleibt das Fazit: Mit einem guten Team, mit einer guten Vorbereitung, mit dem nötigen Know-how ist es möglich, einen Roman in sehr kurzer Zeit zu schreiben. Realistische zehn Wochen dauert es von der ersten Idee bis zu einem satzfähigen Manuskript (wenn der Lektor eine Nachtschicht einlegt und niemand krank wird). Das heißt, die Buchbranche kann, wenn sie das möchte, sehr schnell auf aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Strömungen reagieren. Das wollte ich beweisen, und dieser Beweis ist gelungen. Dass das Buch nicht nur als eBook, sondern auch als klassischer Print-Roman erscheint, ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit.
Offen bleibt eine Frage: Ist das Ergebnis gelungen? Das müssen Sie, liebe Leser, beurteilen.
Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit »Cold reset – Erinnern ist tödlich«!
IhrMarkus Stromiedel
NOAH ALEXANDER
ERINNERNISTTÖDLICH
Thriller
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock:ostill | © Baldas1950
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3741-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Tag 0 – 12:00 UhrFluss nahe Berlin
Ich treibe.
Ich treibe in einem endlosen Nichts.
Wo bin ich?
Blitze zucken, Sterne strahlen, Sonnen gehen auf und verlieren sich im Nebel.
Bin ich tot?
Bilder nähern sich, erst wenige, dann werden es immer mehr. Es sind Gesichter, sie taumeln an mir vorbei. Sie wollen mir etwas sagen, doch ich höre nichts.
Wer sind diese Gesichter?
In meinem Kopf ist nur Leere. Keine Namen. Keine Erinnerungen.
Immer mehr Bilder stürmen auf mich ein. Sie beginnen zu glühen, zu brennen, bis ein Feuersturm mich erfasst und zu ersticken droht.
Ein Schrei zerreißt das Feuer in tausend Fetzen. Es ist mein Schrei.
Etwas rauscht um mich herum. Wasser! Aber es ist nicht das Rauschen einer Welle. Ein Fluss? Ein Wasserfall? Ich friere. Meine Zähne schlagen aufeinander, so kalt ist mir. Ich brauche einen Moment, bis ich begreife, dass ich in die Wirklichkeit zurückkehre. Aber warum spüre ich meinen Körper nicht? Meine Arme, meine Beine sind nur taubes, eisiges Fleisch.
Langsam, ganz langsam hebe ich die Lider. Jeder Millimeter ist eine endlose Qual. Licht zuckt, Blech knarrt unter hohem Druck. Endlich schaffe ich es, die Augen zu öffnen.
Ich sitze in einem Auto, das in einem Fluss versinkt. Gerade erreicht das Wasser die Seitenscheiben, es drängt dagegen, sprudelt durch die Lüftungsöffnungen zu mir herein. Die Brühe im Wageninnern reicht mir schon bis zur Brust.
Was ist passiert? Wie bin ich hierhergekommen?
Ich kann mich an nichts, an überhaupt nichts erinnern!
Ich versuche, mich zu bewegen, aber mein Körper will mir nicht gehorchen. Wie eine Puppe sitze ich angeschnallt auf meinem Sitz, starre auf die Frontscheibe, warte auf mein Ende.
Jetzt tu was!
Der Wagen, ein Landrover, sinkt tiefer. Das Wasser an den Scheiben steigt höher, es erreicht das Dach, schlägt mit einem leisen Gurgeln darüber zusammen. Langsam versinkt der Wagen in der Tiefe. Es wird dunkel, im Wasser treiben Algenwolken, sie schlucken das Tageslicht.
Du musst hier raus, sofort!
Das Auto setzt mit einem Ruck auf dem Grund auf. Mit dem Kopf stoße ich heftig gegen die Windschutzscheibe. Meine Wirbelsäule krümmt sich, meine Fingerspitzen kribbeln. Das Wasser im Wagen steigt weiter, sprudelnd, gurgelnd, es erreicht meine Schultern, meinen Hals, mein Kinn. Nur noch ein paar Zentimeter Luft unter dem Wagendach bleiben mir zum Atmen. Voller Panik pruste ich in das faulige Flusswasser.
Los, beweg dich!
Ich taste nach dem Griff, stemme mich gegen die Tür. Nichts passiert. Ist der Wagen noch verschlossen?
Ich schnappe nach Luft, tauche unter. Luftblasen streben nach oben. Meine Finger gleiten an der Scheibe hinab, suchen nach dem Riegel, lösen die Sperre. Endlich gelingt es mir, die Tür einen Spalt weit aufzustemmen. Blubbernd entweicht die restliche Luft aus dem Wagen.
Raus! Du musst sofort raus aus dem verdammten Auto!
Doch etwas hält mich in der Tiefe fest. Der Gurt! Hastig taste ich nach dem Schloss und löse den Verschluss. Der Sauerstoff in meiner Brust schwindet. Mit letzter Kraft ziehe ich die Beine unter dem Lenkrad hervor und drücke mich aus der Türöffnung. Mein Herzschlag dröhnt. Das Wasser umschließt mich wie ein Leichentuch. Panik steigt in mir auf. Ich will atmen! Doch ich darf den Mund nicht öffnen! Die Lippen fest aufeinandergepresst, stoße ich mich am Wagen ab und schieße nach oben. Mit Wucht durchstößt mein Kopf die Wasseroberfläche.
Luft, endlich Luft!
Erleichtert spüre ich, wie der Atem in meinen Körper strömt.
Doch der Fluss will mich nicht loslassen. Wie ein Stück altes Holz reißt er mich mit sich.
Weiter, gib nicht auf!
Das Ufer ist nur ein paar Meter entfernt. Ich kämpfe mich durch die Fluten, bis ich Grund unter den Füßen spüre, und krieche die flache Böschung hinauf. Stöhnend kotze ich faules Wasser auf den Rasen. Ich taumle, Schwindel erfasst mich, ich lasse mich zur Seite fallen.
Dann wird alles schwarz um mich.
Kapitel 2
Tag 0 – 12:30 UhrFluss nahe Berlin
Als ich aufwache, liege ich auf dem Rücken und starre in den Himmel. Schwere Wolken verdecken die Sonne, Blätter rascheln im Wind. Ich richte mich auf und blicke um mich. Der Fluss zu meinen Füßen schiebt sich träge durch eine gleichförmige Landschaft: Felder, Wiesen, kleine Wälder, alles menschenleer. Am anderen Ufer dieselbe grüne Böschung. Keine Häuser, keine Straße, nur ein Feldweg am Rand des Ufers.
Wie lange war ich ohnmächtig?
Mehr als ein paar Minuten können es nicht gewesen sein, denn meine Kleidung klebt noch immer nass an meinem Körper.
Was um Himmels willen ist mit mir passiert?
Ich weiß, dass ich gerade eben fast in dem kalten Wasser ertrunken wäre. Aber was war davor?
Konzentrier dich! Denk nach!
Welcher Tag ist heute? Welches Jahr? Ich habe nicht die geringste Ahnung! Wie bin ich hierhergekommen? Was war das für ein Auto? Was waren das für Bilder, die ich gesehen habe, was für Gesichter? Ich fühle mich wie ausgespuckt, ohne Anker, ohne Halt in einer fremden Wirklichkeit.
Wer bin ich?
Panik steigt in mir auf. Ich atme tief durch und versuche, mich zu beruhigen. Ganz sicher gibt es für diesen Albtraum eine Erklärung. Vielleicht ist es nur der Schock, mit dem Wagen in den Fluss gefahren zu sein, der mir die Erinnerung nimmt.
Zeit, meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Da wäre erst einmal meine Kleidung: Jeans, eine leichte dunkelblaue Outdoor-Jacke, grüne Trekkingschuhe, dazu eine Uhr mit Kompass und Barometerfunktion. War ich gerade auf dem Weg in die Berge, als mein Auto von der Straße abgekommen ist? Bin ich ein Kletterer? Aber die Landschaft hier sieht alles anders als bergig aus.
In den Taschen meiner Jeans finde ich nichts. Aber als ich meine Jacke durchsuche, entdecke ich einen Kugelschreiber. Auf der Seite steht: ATELIER ISABEL EISNER / MODE & FASHION. Dazu die Adresse: BREDSTEDTER STRASSE 5, BERLIN.
Isabel Eisner? Der Name sagt mir nichts. Immerhin: Berlin. Ein erster Anhaltspunkt.
Ich durchwühle die anderen Taschen. Alle leer. Aber dann, im Handyfach im Jackeninneren, ertaste ich etwas. Ein Outdoor-Smartphone mit einer stoßsicheren Gummihülle. Trotz meines Ausflugs auf den Grund des Flusses funktioniert es noch. Ein Klick, und der Bildschirm leuchtet auf. Keine Passwortsperre! Hastig öffne ich das Adressbuch.
Nichts. Verfluchter Mist!
Das Handy ist leer. Alles ist gelöscht. Es gibt keine Adressen, keine Namen, keine Fotos, nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Nur eine GPS-App ist auf dem Startbildschirm installiert.
Ich will gerade mit meinen tauben Fingern die GPS-App öffnen, als ich plötzlich Motorengeräusch höre. Endlich Hilfe! Ächzend wende ich mich zur Seite und versuche durch das Grün der Böschung mehr zu erkennen.
Am Flussufer, etwa dreihundert Meter von mir entfernt, stehen zwei schwarze Geländewagen. Voller Hoffnung hebe ich den rechten Arm.
»Hier bin ich!«, krächze ich. Niemand hört mich.
Fünf Männer steigen aus, sie tragen schwarze Cargohosen und Bomberjacken. Suchend blicken sie um sich. Ich will gerade noch einmal rufen, als ich es sehe: In ihren Händen halten sie Maschinengewehre.
»Wo steckt das Schwein?«, ruft einer.
»Scheint einen Unfall gehabt zu haben!«, erwidert ein anderer. »Dort! Die Bremsspuren führen direkt in den Scheißfluss.«
Adrenalin jagt durch meinen Körper. Was sind das für Männer? Soldaten? Ganz bestimmt keine Freunde.
Schnell krieche ich unter einen Busch und drücke mich fest auf den Boden.
Die Unbekannten kommen näher. Sie sind jetzt nur noch ein paar Meter von mir entfernt.
Nicht bewegen!
Ich presse mein Gesicht in den Morast und rühre mich nicht. Die Sekunden dehnen sich endlos. Die Männer gehen an mir vorbei, ohne mich zu entdecken.
»Er ist weg.«
»Los, sucht weiter! Wir müssen ihn finden!« Eine tiefe Stimme, sie klingt wütend. Der Mann kommt näher, wird langsamer, bleibt stehen. Jetzt ist er direkt neben mir. Ich kann seine Schuhe sehen, keinen Meter von mir entfernt, es sind Slipper aus schwarzem Schlangenleder mit blank polierter Stahlspitze.
Ich wage kaum zu atmen. Der Mann braucht sich nur umzudrehen, dann entdeckt er mich. Doch ich habe Glück. Meine Verfolger beschließen, das Ufer in die andere Richtung abzusuchen. Langsam entfernen sie sich.
Erleichtert atme ich durch.
Plötzlich ein Signalton, laut und deutlich. Es ist ein Handy.
Das Handy, das ich noch immer in der rechten Hand halte.
Kapitel 3
Tag 0 – 12:40 UhrFluss nahe Berlin
Hektisch will ich den Alarm ausstellen. Doch es war nur ein kurzes Signal. Eine Nachricht blinkt auf dem Display, es ist eine SMS:
»Lauf, Ben, lauf!«
Nur diese drei Worte.
Ich reagiere ohne nachzudenken, krieche durch das Unterholz, robbe über den nassen Boden, verberge mich hinter einem umgestürzten Baum.
Auch die bewaffneten Männer haben das Handy gehört. Sofort kommen sie zurück, rufen Kommandos auf Deutsch, auf Englisch.
Wer hat mir die Nachricht geschickt?
Ben, ist das mein Name?
Die Männer kommen näher.
Hier werden sie dich entdecken!
Ohne zu zögern springe ich auf, durchquere das Dickicht, quetsche mich zwischen zwei Baumstämmen hindurch und husche hinter eine Eiche. Mein Körper schmerzt, aber er scheint solche Bewegungen gewöhnt zu sein.
Erneut frage ich mich, wer oder was ich bin. Ein Soldat? Ein Agent?
Ein entflohener Sträfling?
Vielleicht sollte ich mich meinen Verfolgern ausliefern, um die Wahrheit zu erfahren.
Lauf, Ben. Jetzt nicht aufgeben!
Schritte krachen durchs Unterholz, meine Verfolger kommen näher. Ich drücke mich eng an den Baum, spüre einen Ast in meinem Rücken. Mein Herz hämmert. Ich bin sicher, das laute Pochen wird mich verraten.
»Fußabdrücke! Hier sind Fußabdrücke!«
»Das Schwein muss in der Nähe sein!«
»Ausschwärmen! Er darf uns nicht entkommen!«
Ich schließe die Augen, presse mich an den Stamm. Schweiß rinnt mir über die Stirn.
Plötzlich ein lautes Knacken, ein morscher Ast zerbricht unter meinen Füßen. Sofort halten die Männer inne.
»Ruhig!«
»Woher kam das?«
Die Schritte nähern sich. Plötzlich ein lauter Ruf:
»Da ist der Dreckskerl!«
Sie haben mich entdeckt! Wie im Reflex stoße ich mich ab, schnelle nach vorne, renne los. Wohin soll ich laufen?
Egal, nur weg von hier!
Ich taumle durch das Gestrüpp, springe über Steine, über halb verfaulte Baumstämme. Äste klatschen mir ins Gesicht, Dornen reißen mir die Hände auf. Endlich entdecke ich einen Pfad. Jetzt komme ich schneller voran.
Plötzlich Schüsse, sie schlagen direkt vor mir ein. Holz splittert, Blätter fegen davon. Mein Magen krampft sich zusammen. Sie wollen mich umbringen!
Was habe ich bloß getan? Warum sind sie hinter mir her?
Weiter, nicht nachdenken! Wilde Haken schlagend, renne ich die Böschung entlang. Jemand brüllt Kommandos, aber ich kann sie nicht verstehen.
Auf einmal stehe ich am Flussufer, der Pfad endet an einer kleinen Landzunge. Außer Atem betrachte ich eine Ente. Auf dem Wasser treibend glotzt sie zurück.
Weiter!
Nur wohin? Ich sitze in der Falle.
Hinter mir kommen die Männer näher, fluchend, schreiend.
Und jetzt? Willst du etwa aufgeben?
Mein Kopf ruft: ja. Aber mein Instinkt sagt mir: nein.
Mein Körper reagiert zuerst, er stürzt sich in den Fluss. Mir stockt der Atem, als ich erneut in das eiskalte Wasser eintauche. Mit kraftvollen Schwüngen kraule ich durch die Fluten.
Erneut peitschen Schüsse, direkt neben mir spritzen kleine Fontänen in die Luft. Aus den Augenwinkeln sehe ich die Männer, sie stehen am Ufer und zielen mit ihren Gewehren in meine Richtung.
Sofort tauche ich unter. In der dunklen Brühe kann ich die Hand vor Augen nicht sehen. Aber ich höre, wie Kugeln über mir in den Fluss zischen.
Ich gleite hinab bis dicht über den fauligen Grund, schwimme so schnell ich kann. Für einen flüchtigen Moment denke ich an die SMS. Wer wollte mich warnen? Versteckt er sich in der Nähe? Beobachtet er meine Flucht?
Ich schwimme, so weit ich kann, bis mich meine brennenden Lungen zum Auftauchen zwingen. Vorsichtig schiebe ich den Kopf über die Wasseroberfläche. Ich blicke um mich. Die Strömung hat mich ein Stück flussabwärts getragen, vielleicht fünfzig Meter. Doch die Männer haben die Strömung offenbar überschätzt. Ich sehe sie weiter flussabwärts nach mir suchen.
Leise tauche ich wieder unter und schwimme dicht unter der Wasseroberfläche zum Ufer. Ich verlasse den Fluss, krieche die Böschung hinauf. Meine Glieder sind taub vor Kälte. Zitternd verstecke ich mich hinter einem Baum, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Habe ich es geschafft? Habe ich die Soldaten abgehängt?
»Keine Bewegung!«
Die Stimme ist direkt hinter mir.
»Und jetzt die Flossen hoch und umdrehen! Schön langsam!«
Zögernd wende ich mich um. Vor mir steht ein junger Mann mit Cargohose, Bomberjacke und schwarzer Wollmütze. Er grinst über das ganze Gesicht. Sein Maschinengewehr zielt auf meinen Kopf.
»Hast wohl geglaubt, du kannst uns verarschen, was?«, sagt er und lacht.
Dann trifft ihn ein schwerer Ast auf den Hinterkopf.
Kapitel 4
Tag 0 – 12:50 UhrFluss nahe Berlin
Mit einem überraschten Grunzen bricht der Soldat zusammen. Hinter ihm steht ein alter Mann: kahl rasierter Schädel, grauer Vollbart, wettergegerbte Haut. Sein schwerer Körper steckt in einer Anglerhose.
»Was ist hier los, verdammt noch mal?«, sagt er und schaut mich vorwurfsvoll an.
Ich zucke mit den Schultern. Noch bin ich zu erschöpft, um zu antworten.
»Raus mit der Sprache! Warum schießen diese Kerle auf Sie?« Er hebt den schweren Ast. Offensichtlich traut er auch mir nicht.
»Ich habe absolut keine Ahnung«, antworte ich, noch immer außer Atem.
Verrückt, selbst meine eigene Stimme hört sich fremd an.
Der Mann mustert mich misstrauisch. »Wie heißen Sie?«
Ich zögere. »Ben«, behaupte ich. »Bitte, Sie müssen mir helfen!«
Kurz darauf sitze ich neben Geert in einem alten Opel Omega Kombi. Es stinkt nach Fisch und altem Mann. Wir rasen über einen Wirtschaftsweg, entlang abgeernteter Felder und struppiger Kiefernwälder, vorbei an Flüssen und Seen. Unser Ziel: eine Polizeiwache in einem kleinen Kaff, dessen Namen ich nicht kenne.
Ein Signalton ertönt, es ist mein Handy. Eine SMS! Es ist der Unbekannte, seine Nachricht blinkt auf dem Display: »Bist du ihnen entkommen? Sei wachsam! Geh nach Berlin. Lass das Handy eingeschaltet. Ich melde mich, sobald du dort bist.« Ich schalte das Handy auf Vibration, bevor ich es zurück in die Tasche schiebe.
Geert sieht mich misstrauisch von der Seite an. Wahrscheinlich glaubt er meine Geschichte nicht.
»Sie wissen also nicht, dass das hier die Havel ist?!«
Ich schüttle den Kopf.
»Und Ihren Namen kennen Sie auch nicht?«
»Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass ich nach Berlin muss.«
Ich zeige ihm die SMS, die ich bekommen habe.
Geert mustert mich wie einen Außerirdischen.
Zum Glück ist der Alte kein Freund vieler Worte. Stattdessen traktiert er das Gaspedal. Nervös schaue ich auf den Tacho: einhundert Stundenkilometer, auf einem Wirtschaftsweg! Die holprige Straße besteht zwar aus aneinandergereihten Betonplatten, ist aber kaum breiter als der Wagen. Die Äste der Büsche peitschen gegen die Karosserie.
Geert nimmt eine Hand vom Lenker und kramt in der Ablage nach einer zerknitterten Zigarettenschachtel.
»Auch eine?«
Ich schüttle den Kopf. Kein Bedarf. Offensichtlich bin ich Nichtraucher.
Plötzlich ein Knall. Geert verreißt das Lenkrad, schafft es nur mit Mühe, den Omega auf der Straße zu halten.
»Was soll denn die Scheiße?«, brüllt er.
Erschrocken drehe ich mich um. Ein schwarzer SUV hängt direkt an unserer Stoßstange. Wie ein Raubtier springt er heran und versucht uns von der Straße zu rammen. Wieder und wieder prallt Blech auf Blech.
Geert tritt das Gaspedal durch. Wir rasen an verfallenen Gebäuden vorbei, alte Lagerhäuser, vergessen von der Welt.
Was wollen diese Typen von mir? Was habe ich getan?
Ich blicke zu Geert. Der alte Mann zeigt keine Angst. Im Gegenteil: Seine Augen funkeln entschlossen. Er quält den Motor seines Wagens bis zum Äußersten.
Der Geländewagen ist schneller, er versucht uns zu überholen. Doch Geert passt auf und versperrt unserem Verfolger immer wieder den Weg. Er lacht zufrieden, obwohl wir beide wissen: ein hochgetunter SUV gegen einen verbeulten Kombi – wir haben keine Chance.
Plötzlich, am Anfang einer Kurve, steht ein schwarzer Mercedes quer auf der Straße. Zwei Männer springen vor den Wagen, richten die Läufe ihrer Maschinengewehre auf uns. Geert flucht und tritt mit voller Wucht auf das Bremspedal. Der schwere Omega schlingert heftig, das Heck bricht aus, das Auto rutscht quer über die Fahrbahn. Nur ein paar Meter vor den Männern bleiben wir stehen. Ich schaue zurück. Die Straße hinter uns ist durch den SUV versperrt.
Shit, wir sitzen in der Falle!
Geert zeigt noch immer keine Angst. Wütend stemmt er seinen Körper aus dem Sitz.
»Na warte, denen werde ich was erzählen!«
»Nein, nicht! Bleiben Sie hier …«
Ich springe ebenfalls aus dem Auto. Begreift er denn nicht, dass man mit diesen Leuten nicht reden kann? Doch Geert rollt wie eine Dampflok auf die Männer zu.
»Seid ihr verrückt geworden? Macht gefälligst die Straße frei, ihr beschissenen Arschlöcher …«
Ein kurzer Knall unterbricht ihn. Das Projektil trifft Geert in den Kopf, genau zwischen die Augen. Das Loch ist rot und klein. Geert sieht mich an, erstaunt, hilflos. Dann bricht er zusammen.
Die Zeit steht still.
Ich bin taub und wie gelähmt. Der alte Mann wollte mir helfen, und jetzt ist er tot. Blut fließt unter seinem Kopf hervor, es färbt den Betonboden rot.
Mir fehlt die Luft zum Schreien. Ich sehe zu den Männern, die mit ihren Gewehren auf mich zielen.
Warum haben sie das getan? Warum haben sie ihn getötet?
»Ruft den Boss an!«, befiehlt einer der Männer den anderen, während er auf mich zukommt.
Dann erlöst mich ein Schlag auf den Kopf aus diesem Albtraum.
Kapitel 5
Tag 0 – 16:40 UhrBerlin
Ich erwache aus meiner Ohnmacht, zum dritten Mal innerhalb weniger Stunden. In meinem Schädel pulsiert der Schmerz, der Schlag auf meinen Hinterkopf war heftig.
Wo bin ich?
Alles um mich herum ist schwarz, auch mit offenen Augen sehe ich nichts. Muffiger Stoff bedeckt meine Gesichtshaut, sie haben mir eine Augenbinde umgebunden. Meine Hände sind gefesselt.
Was geschieht mit mir?
Ich höre ein gleichmäßiges Brummen, mein Körper ruckelt, Stöße lassen den Boden unter mir vibrieren. Ich brauche einen Moment, bis ich begreife, dass ich im Kofferraum eines Autos liege.
Was für ein Scheiß-Albtraum!
Der Mercedes. Der Fluss. Die Männer mit den Maschinenpistolen. Die Verfolgungsjagd. Der Blick des Alten, bevor er tot zusammengebrochen ist. Diesen Blick werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen.
Sicher?
Ich höre leise Stimmen, es sind die Männer vorne im Wagen. Was haben sie mit mir vor? Ich kann ihre Worte nicht verstehen, es ist zu laut in meinem Gefängnis, offenbar sind wir auf einer dicht befahrenen Straße. Wo wollen sie mich hinbringen? Bestimmt nicht zu einem gedeckten Kaffeetisch. Eher zu einem Loch, in dem ich für immer verschwinde.
Du musst raus aus diesem Auto, sofort.
Prima Idee. Nur: Wie soll ich mich mit gefesselten Händen aus einem fahrenden Auto befreien?
Tu endlich was!
Ich drehe meinen Körper, bewege vorsichtig meine Arme. Meine Kleidung ist fast trocken, offenbar liege ich schon länger hier. Zum Glück haben mir die Männer die Hände vor dem Bauch zusammengebunden und nicht auf dem Rücken. Den Kabelbinder kann ich nicht lösen, aber es gelingt mir, die Augenbinde abzuziehen.
Sehen kann ich trotzdem nichts, im Inneren des Kofferraums ist es stockdunkel.
Plötzlich vibriert es in meiner Hosentasche. Es ist mein Handy! Verblüfft fummle ich es hervor. Entweder haben die Männer es übersehen, oder sie haben versäumt, mich zu durchsuchen. Gespannt blicke ich auf das Display. Es ist eine SMS: »Gratuliere! Ich wusste, dass du es schaffst! Denk dran, Sie sind weiter hinter dir her! Also bleib in Bewegung!«
Mein unbekannter Helfer scheint ein Spaßvogel zu sein. Oder weiß er nicht, wo ich gerade bin?
Ich schiebe mein Handy zurück in die Tasche. Dann drücke ich meinen Rücken gegen den Kofferraumdeckel, taste im Dunkel nach dem Riegel. Er ist verschlossen, natürlich, und von innen kann ich ihn nicht öffnen.
Los, denk nach, du hast nicht viel Zeit!
Der Wagen biegt ab, ich höre das Klicken des Blinkers.
Plötzlich kommt mir eine Idee, es ist ein kleines Licht in meinem schmerzenden Hirn. Ich taste die Verkleidung des Kofferraums ab, erst die eine Seite, dann die andere. Bingo! Unter dem Stoff spüre ich den Sicherungskasten. Ich warte. Als ein Motorrad an uns vorbeidröhnt, reiße ich mit aller Kraft die Abdeckung herunter. Mit einem Tritt öffne ich den Kasten.
Ich schiebe die Splitter zur Seite, ertaste Schalter, Sicherungen, einen Kabelbaum. Schwitzend vor Anspannung warte ich, bis der Wagen stoppt. Jetzt! Mit einem Ruck reiße ich den Kabelbaum heraus, schlage die Sicherungen aus ihren Halterungen und presse die blanken Kabelenden an das Blech. Funken schlagen, es riecht verbrannt. Das Motorengeräusch verstummt. Der Mann hinter dem Steuer flucht.
Hastig taste ich nach dem Riegel und stemme meinen Rücken gegen den Kofferraumdeckel. Es funktioniert! Der Kurzschluss hat die Sperre gelöst, ich spüre, wie der Deckel nach oben schwingt. Gleißendes Licht fällt auf mich. Ich bin frei!
Geblendet kneife ich die Augen zusammen. Wir sind mitten in einer Stadt, der Wagen steht auf einer Kreuzung. Überall Autos, Menschen, Bewegungen. Ich richte mich auf, klettere aus dem Wagen, stolpere auf die Straße. Autos hupen, Bremsen quietschen. Ärgerliche Rufe. Hinter mir werden die Türen des Mercedes aufgerissen.
Hau ab!
Ich tauche in die Menschenmenge ein, laufe auf ein älteres Paar zu. Ich packe den Mann am Arm. »Rufen Sie die Polizei, schnell, ich werde verfolgt!«
Er starrt mich an wie einen Verrückten. Seine Frau sieht verstört auf meine Fesseln und versteckt sich hinter dem Rücken ihres Gatten.
Du hast keine Zeit für Erklärungen. Weiter!
Die Männer aus dem Mercedes haben mich entdeckt, sie laufen mir nach. Ihre Mienen sind hasserfüllt, ihre Hände tasten nach ihren Waffen. Ich dränge mich durch die Menge, weiche auf die Straße aus, vier Spuren, Berufsverkehr, ein Auto bremst in letzter Sekunde. Ich rutsche über die Motorhaube, pralle auf die Straße. Sehe das Kennzeichen.
Berlin, du bist in Berlin!
Aber alles ist mir fremd, alles ist neu. Zu viele Eindrücke. Zu viele Gesichter. Dazu der Lärm. Mein keuchender Atem. Der Herzschlag, der in meinem Schädel hämmert.
Wie im Rausch hetze ich durch die Stadt.
Reiß dich zusammen! Du brauchst ein Versteck!
Meine Verfolger sind dicht hinter mir. Ich renne um mein Leben. Außer Atem biege ich in eine Seitenstraße ein. Weiter, weiter, nach rechts, nach links, geradeaus, ohne Plan, ohne Ziel. Ich spüre, wie ich schwächer werde.
Dann passiert es. Ein Linienbus schiebt sich zwischen mich und die beiden Männer, für einen Augenblick können sie mich nicht sehen. Im vollen Lauf ändere ich die Richtung, stolpere durch einen Torbogen, pralle gegen die Wand. Mein Kopf touchiert den Stein, ich taumele.
Nicht stehen bleiben!
Der Torbogen führt in einen Hinterhof: Sperrmüll, alte Fahrräder, ein verkrüppelter Kastanienbaum. In der Ecke ein Müllcontainer – meine letzte Chance. Ich stoße den Deckel auf, ziehe mich hoch und lasse mich in das Loch fallen. Hart pralle ich auf den stinkenden Unrat. Ich schaufele Müll auf mich, vergrabe mich unter fauligem Gemüse, verbeulten Dosen, schimmelndem Plastik. Und rühre mich nicht.
Stille.
Mein Herz dröhnt in meinem Kopf. Alles tut mir weh. Ich halte die Luft an und hoffe, dass mich die Männer nicht finden.
Etwas drückt in meiner Tasche, ich brauche eine Weile, es zu bemerken. Mein Handy!
Es kostet mich einige Mühe, bis ich es mit meinen gefesselten Händen herausziehen kann. Jetzt kann ich Hilfe rufen.
Plötzlich ein Flackern, blau, gleichmäßig, es ist ganz in der Nähe. Die Polizei? Erleichtert atme ich durch. Wenn das stimmt, hat der Albtraum hier ein Ende. Ich schiebe meinen Kopf an die Öffnung, drücke den Deckel einen winzigen Spalt weit auf und riskiere einen Blick aus dem Container.
Auf der Straße vor dem Torbogen steht ein Streifenwagen, davor zwei Beamte mit blauen Uniformen.
Sie sind nicht allein.
Sie unterhalten sich mit meinen Verfolgern. Es wirkt freundschaftlich. Dann reichen sie sich die Hände.
Kapitel 6
Tag 0 – 17:00 UhrBerlin
Entsetzt starre ich auf die Männer, die in der Toreinfahrt stehen: Die Polizei und das Kommando vom Fluss arbeiten zusammen! Mein Albtraum ist nicht zu Ende, er fängt gerade erst an. Aus dem Müllcontainer heraus kann ich nicht verstehen, was die Polizisten sagen. Aber ich bin mir sicher: Es geht um mich.
Offensichtlich sucht auch die Polizei nach mir.
Bist du ein Verbrecher?
Ich kann das nicht glauben. Obwohl mein Hirn nur noch eine graue Hülle ist, bin ich davon überzeugt, auf der guten, auf der richtigen Seite zu stehen.
Ich bin Opfer, kein Täter.
Bist du dir wirklich sicher?
Mein Handy vibriert in meiner Hosentasche. Eilig schließe ich den Deckel des Müllcontainers und blicke auf das Display. Es ist eine SMS, mein unbekannter Freund meldet sich. »Du bewegst dich nicht mehr. Hast du ein gutes Versteck gefunden? Geh nicht zur Polizei! Dein Ziel ist das Safe-House, das wir für dich vorbereitet haben. Isabel kennt das Haus, auch wenn sie nichts davon weiß. Geh zu ihr.«
Ratlos lasse ich das Handy sinken. Was soll das sein, ein Safe-House? Vermutlich das, was der Name sagt: ein Ort, an dem ich sicher bin. Einen solchen Ort könnte ich in der Tat gut gebrauchen. Aber wie soll ich ihn finden? Geh zu Isabel – ein toller Tipp, wenn man sich an nichts erinnern kann!
Draußen ist es still geworden, ich höre die Polizisten nicht mehr. Vorsichtig spähe ich aus dem Container. Das Blaulicht ist verschwunden, auch meine Verfolger sind nicht mehr zu sehen. Mich beruhigt das nicht. Vermutlich sind sie immer noch in der Nähe.
Du musst weg hier, und zwar so schnell wie möglich!
Als ich mich aufrichte, entdecke ich im Müll eine Konservendose mit einer scharfen, rostigen Kante. Ich ziehe den Kabelbinder über den Rand, nach wenigen Bewegungen ist meine Fessel aufgeschnitten.
Und jetzt?
Wer ist diese Isabel, die mir den Weg zum Safe-House verraten soll? Ich habe keine Ahnung.
Oder doch? Habe ich den Namen nicht schon einmal gelesen?
Eilig hole ich den Kugelschreiber aus meiner Jacke und lese die Aufschrift. Und da steht es: ATELIER EISNER / MODE & FASHION – ISABEL EISNER. Darunter eine Adresse. BREDSTEDTER STRASSE 5, BERLIN.
Ich versuche, mich an irgendetwas zu erinnern. Isabel Eisner. Weder ihr Name noch die Straße, in der sie ihren Laden hat, sagen mir etwas. Immerhin weiß ich jetzt, wohin ich gehen muss.
Ich hole mein Smartphone hervor, aktiviere die Navigations-App, tippe die Adresse in die Suchmaske ein. Die Straße liegt in einem Stadtteil namens Schöneberg. Ich verkleinere die Ansicht, sodass ich einen größeren Kartenausschnitt von Berlin sehe. Doch der Berliner Stadtplan bleibt für mich ein Labyrinth aus Linien und Strichen.
War ich schon einmal in dieser Stadt?
Egal. Beweg dich endlich!
Vorsichtig schiebe ich meinen Kopf über den Rand der Öffnung. Als ich niemanden sehe, klettere ich aus dem Container und klopfe den schlimmsten Müll von meiner Kleidung. Ich stinke erbärmlich.
Niemand beachtet mich, als ich den Hof verlasse.
Mit meinem Smartphone in der Hand suche ich den Weg zur nächsten U-Bahn-Station, Neu-Westend, U2 Richtung Pankow, sagt mir meine App. Geld für eine Fahrkarte habe ich nicht. Ich warte, bis die Bahn einfährt, betrete einen der Wagen und stelle mich an die Tür, bereit, sofort zu reagieren, falls ein Kontrolleur kommt.
Oder die Polizei.
Oder die Männer, die dich erschießen wollen!
Wie die meisten anderen Fahrgäste, starre ich auf mein Handy. Verrückt, dass es immer noch funktioniert. Hat mir mein unbekannter SMS-Schreiber das Smartphone gegeben? Ich durchsuche jeden Winkel des Geräts, bevor ich es enttäuscht in meine Tasche schiebe. Warum hat mir der Unbekannte nicht mehr Informationen hinterlassen? Adressen, Namen, irgendetwas!
Ich blicke in die Scheibe der fahrenden U-Bahn und zucke zusammen. Zum ersten Mal sehe ich mein Spiegelbild.
Kennen wir uns?
Rotblonde Haare, kurz geschnitten. Blaue, traurige Augen, darunter tiefgraue Schatten. Auch wenn ich im Moment viel älter wirke, tippe ich mein Alter auf höchstens vierzig. Mit dem Finger streiche ich über meine unrasierten Wangen, über meine Nase, meine Stirn. Gehört dieses Gesicht wirklich zu mir?
Wer bin ich?
Die anderen Fahrgäste werfen mir misstrauische Blicke zu. Ich weiche ihnen aus, hänge meinen Gedanken nach.
Zehn Minuten später erreiche ich mein Ziel: Nollendorfplatz. Ruckelnd gleiten die Türen auf. Ich steige aus. Auf den Treppen drängen Menschenmassen nach oben, andere versuchen gegen den Strom nach unten zu gelangen. Draußen umtost Verkehrslärm den Bahnhof.
Jeder weiß, wer er ist, jeder hat ein Ziel.
Den Kopf gesenkt, den Blick auf dem Handydisplay, suche ich den Weg zur Bredstedter Straße. Junge Leute schlendern an Bars und Restaurants entlang. Lachen schallt zu mir herüber, Musik, Gesprächsfetzen. Dazwischen ich, ein Phantom ohne Vergangenheit.
Werde ich jemals wieder Teil dieser bunten Welt werden?
Vielleicht kann mir Isabel Eisner helfen.
Das Atelier befindet sich in einem liebevoll restaurierten Altbau am Anfang der Bredstedter Straße. Im Schaufenster hängen vier Kleider, daneben liegen trendige Accessoires: Handschuhe, Schals, etwas Modeschmuck. Ich rüttle an der Tür, sie ist geschlossen.
Hast du wirklich geglaubt, dass es so einfach ist?
Ich blicke auf die Namensschilder im Hauseingang nebenan. Ich habe Glück: Isabel Eisner wohnt im dritten Stock.
Als ein Bewohner das Haus verlässt, nutze ich die Gelegenheit und halte die zufallende Tür auf. Ein letztes Mal sehe ich mich um. Niemand hat mich verfolgt, niemand beobachtet mich.
Ich husche in das Haus.
Das Treppenhaus ist hell und freundlich, hohe Kristallfenster lassen das schwächer werdende Tageslicht herein. Die Wände sind verziert, Jugendstil, seltsam, dass ich das weiß. Ich steige die Treppe hinauf. Knarrend biegen sich die Stufen unter meinen Schritten.
In der Wohnung im dritten Stock brennt Licht, Schuhe stehen neben der Fußmatte. Isabel Eisner scheint zu Hause zu sein. Mein Herz klopft aufgeregt. Ich hole tief Luft, will gerade klingeln, als mir etwas auffällt: Die Wohnungstür ist nur angelehnt.
Ich zögere. Dann betrete ich die Wohnung.
Kapitel 7
Tag 0 – 18:00 UhrBerlin, Wohnung Isabel
Der Boden knarrt, als ich den Flur betrete.
»Hallo? Ist jemand da?« Ich horche. Als sich nichts rührt, taste ich mich langsam weiter. »Frau Eisner?«
Keine Antwort.
Ich sehe mich im Flur um. Es sind Details, die mir auffallen: die frischen Blumen auf der Anrichte, die hellen, freundlichen Farben an der Wand, der Spiegel mit der kleinen Ablage, darauf Lippenstifte und Haarbürsten. Mäntel und Jacken hängen sorgfältig geordnet an der Garderobe, vor dem Schuhregal stehen Pumps, Stiefel, elegante Damenslipper. Ich sehe keinen einzigen ausgetretenen Männerschuh. Isabel Eisner lebt allein in dieser Wohnung.
Und trotzdem … Ich spüre es, seit ich den Flur betreten habe: Zum ersten Mal, seit ich in dem Auto mitten im Fluss aufgewacht bin, kommt mir etwas bekannt vor! Es ist nichts Konkretes, es ist nur ein Gefühl. Der leichte Geruch nach Limonen, das Knirschen der alten Dielen, der weiche Läufer unter meinen Füßen, all das scheint mir seltsam vertraut. Eine gedämpfte Ahnung, die mein Verstand nur bis zu einer unsichtbaren Grenze zulässt.
Hier bin ich schon einmal gewesen. Je sicherer ich mir dessen werde, desto dringender möchte ich mit dieser Isabel reden.
Aus der Küche erklingt leise Musik.
»Frau Eisner?«
Ich klopfe vorsichtig an den Türrahmen, bevor ich eintrete.
Die Küche ist verlassen. Auf dem Fensterbrett steht ein altes Radio. Ich schalte es ab, sehe mich in der Küche um. Und wieder habe ich das Gefühl des Erkennens: das Gewürzregal, der Wandkalender mit den Geburtstagsterminen, der rustikale Tisch, der verrät, dass Isabel gerne Gäste zum Essen einlädt. Auf der Arbeitsplatte neben der Spüle steht ein Becher mit kaltem Kaffee. Daneben ein Teller mit einem angebissenen Stück Rührkuchen.
Ein Schauer läuft über meinen Rücken, zugleich spüre ich eine unglaubliche Wärme. Ein Gefühl von Geborgenheit, das mir fast die Tränen in die Augen treibt.
Aber wo ist Isabel? Ihre Wohnungstür stand offen.
Bestimmt plaudert sie gerade mit ihrer Nachbarin. Oder sie bringt kurz den Müll runter. Sie wird sich zu Tode erschrecken, wenn sie zurückkommt und einen fremden Mann in ihrer Wohnung entdeckt.
Oder wird sie sich freuen? Weil ich gar kein Fremder für sie bin?
Im Wandkalender entdecke ich meinen Vornamen, Ben, am 10. April, keine Jahreszahl, offenbar mein Geburtstag.
Bist du dir sicher, dass du dieser Ben bist?
Ich will die Küche gerade verlassen, als mein Blick auf ein Foto fällt, es hängt neben einer Einkaufsliste an einer Pinnwand.
Isabel. Sie muss es sein. Dunkelblonde gelockte Haare, blaue Augen, ein weiches, sympathisches Gesicht. Weitere Bilder zeigen eine fröhliche junge Frau beim Sport, im Park, lachend auf Partys, zusammen mit ihren Freunden, die mir alle völlig fremd sind. Bis auf einen.
Auf zwei der Fotos erkenne ich mein Gesicht.
Das erste Bild zeigt Isabel und mich, entspannt lächelnd in T-Shirt und Bluse an einem hellen Sommertag. Wir sitzen auf der Terrasse eines Hafencafés irgendwo an der deutschen Küste, zumindest sind Kutter im Hintergrund zu sehen, und das Werbeschild am Terrasseneingang preist den Kuchen in deutscher Sprache. Auf dem zweiten Foto stehen wir vor einem weißen Haus mit Reetdach. Wir berühren uns nicht, schauen uns nicht an, blicken nur in die Kamera. Und trotzdem: Beide Fotos strahlen große Vertrautheit aus. Isabel und ich, wir müssen gute, sehr gute Freunde sein.
Mindestens.
Ich nehme eines der Bilder in die Hand. Schwindel erfasst mich. Ich erkenne meine Gesichtszüge, es ist eindeutig: Das dort bin ich. Und doch ist dieser Mann ein völlig anderer. Nicht der gebrochene Mensch, dessen Spiegelbild ich in der U-Bahn betrachtet habe. Der Ben auf dem Foto wirkt entspannt, fröhlich und zufrieden. Er hätte gut zu den jungen Leuten gepasst, an denen ich vorhin vorbeigegangen bin.
Du hattest ein Leben. Wer hat es dir genommen?
Nachdenklich betrachte ich das Bild. Was mag dem Ben auf dem Foto in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen sein? Wer waren seine Freunde, was seine Ziele? Hatte er Träume? Was war er für ein Mensch?
Mir wird bewusst, wie einsam ich bin.
Ich gehöre nicht in diese Welt.
Mein Blick fällt auf die Bilder von Isabel. Sie wird mir sagen können, wer ich bin. Ich muss mit ihr reden, ich kann es kaum erwarten.
Nur wo ist sie? Vielleicht finde ich in der Wohnung einen Hinweis, wo ich sie finden kann.
Ich verlasse die Küche und durchsuche die anderen Räume: ein kleines Büro, ein bonbonfarbenes Bad. Ein überraschend großes Wohnzimmer. Der nächste Raum muss ihr Schlafzimmer sein. Ich drücke die Klinke hinunter, stoße die Tür auf – und zucke erschrocken zurück.
Ich schwanke wie ein angeschlagener Boxer und will nicht glauben, was ich sehe.
Ich habe Isabel gefunden.
Kapitel 8
Tag 0 – 18:20 UhrBerlin, Wohnung Isabel
Ich würge. Mein Magen krampft sich zusammen. Ich zittere am ganzen Körper.
Ich will, ich kann nicht glauben, was ich sehe: Auf dem Bett liegt Isabel Eisner, nackt, blutüberströmt.
Sie ist tot.
Wie in Trance gehe ich zu dem Bett. Dunkelblonde Locken quellen unter dem Rand der Klarsichttüte hervor, die ihr Mörder ihr über den Kopf gezogen hat.
Ich spüre Tränen, sie laufen mir über die Wangen, tropfen auf das blutige Laken.
Erst nach einem bangen Moment schaffe ich es, der Frau die Tüte vom Kopf zu ziehen.
Jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Die Ermordete ist Isabel, die Frau auf den Fotos. Ihre Augen sind weit aufgerissen, der Mund vom Todeskampf verzerrt. Blut ist aus der Nase ausgetreten und über das Gesicht gelaufen.
Ist sie erstickt? Oder ist sie an ihren Verletzungen gestorben?
Offenbar hat man sie gefoltert, ihr nackter Körper ist übersät mit Schnittwunden. Die Arme und Beine sind an den vier Enden des Bettes festgebunden, die Fesseln an den Hand- und Fußgelenken sind tief ins Fleisch eingedrungen. Die blutigen Wunden beweisen, wie sehr sie gekämpft hat. Schreien konnte sie nicht, ein Knebel in ihrem Mund hat es verhindert.
Und das ist noch nicht alles. Ein Blick auf ihre Hände verrät mir, dass ihr mehrere Fingernägel rausgerissen wurden.
Ich merke, wie Übelkeit in mir hochsteigt.
Das alles ist zu viel.
Ich kann nicht mehr.
Stöhnend gehe ich in die Knie und übergebe mich direkt auf den Teppich, der vor dem Bett liegt. Ich kotze mir die Seele aus dem Leib, wieder und wieder, bis nur noch bittere Galle kommt.
Warum das alles? Bin ich schuld an ihrem Tod? Ist sie für mich gestorben?
Was hast du getan? Erinnere dich!
Stöhnend rapple ich mich wieder auf und starre auf die tote Frau hinab. Mein Blick ist leer.
So leer wie dein Kopf.
Ich denke an die Bilder aus der Küche. Isabel muss ein liebenswerter Mensch gewesen sein. Trotzdem wurde sie zu Tode gefoltert, trotzdem hat ihr jemand unbeschreibliche Schmerzen zugefügt. Mit welchem Ziel? Was sollte sie ihren Peinigern verraten?
Behutsam streichle ich ihr über die Wange. Dass ich dabei meine Hände mit ihrem Blut beschmiere, ist mir egal.
Isabel hätte mir sagen können, wer ich bin. Jetzt ist sie tot. Kurz schäme ich mich, dass ich angesichts ihres grausamen Todes an meine Probleme denke. Doch das Gefühl der Hilflosigkeit ist übermächtig, ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Wohin soll ich jetzt gehen? Wo mich verstecken?
Vielleicht ist es das Beste, wenn ich mich der Polizei stelle.
Der Unbekannte hat dich vor der Polizei gewarnt!
Aber kann ich ihm trauen? Vielleicht war das hier eine Falle, in die er mich geschickt hat.
Ich hole mein Handy hervor. Doch ich zögere, die Notrufnummer zu wählen.
Unbekannte Männer irgendeines Spezialkommandos haben mich gejagt, auf mich geschossen und versucht, mich zu entführen. Sie haben vor meinen Augen einen völlig Unschuldigen getötet. Und der vielleicht einzige Mensch, der mir hätte weiterhelfen können, wurde zu Tode gefoltert.
Das kann kein Zufall sein.
Was, wenn hinter Isabels Tod die Männer mit den schwarzen Cargohosen stecken? Nur so macht es Sinn.
Alles nur wegen dir.
Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Ich bin der Grund, warum zwei unschuldige Menschen gestorben sind.
Das muss ein Ende haben! Jetzt.
Ich aktiviere die Telefonfunktion, will gerade das Feld »Notruf« antippen, als das Handy in meiner Hand vibriert.
Es ist eine neue Nachricht! Meine Finger zittern, als ich die SMS öffne.
»Du bist bei Isabel. Sehr gut. Hier bist du sicher. Erzähle ihr, was du suchst. Nur sie kann dir helfen, den Weg zum Safe-House zu finden. Sie weiß nicht, dass es dort ist. Aber sie kennt den Ort. Ihr habt euch dort kennengelernt.«
Ratlos lasse ich die Hand mit dem Handy sinken.
Offenbar weiß mein unbekannter Helfer nicht, dass Isabel ermordet wurde. Das beweist, dies war keine Falle. Der Mord geht auf das Konto meiner Verfolger.
Nachdenklich stecke ich das Handy zurück in meine Tasche. Wie soll ich ohne Isabel das Safe-House finden, das der Unbekannte offenbar für mich vorbereitet hat?
Plötzlich dröhnt ein Poltern durch die Wohnung, jemand stößt gegen die Tür, dann ertönt ein Schrei.





























