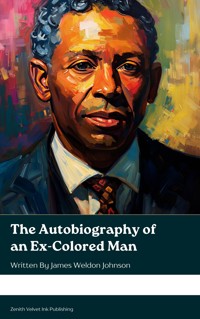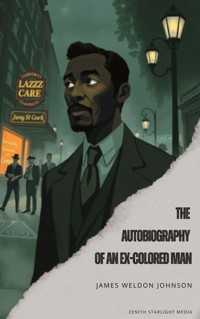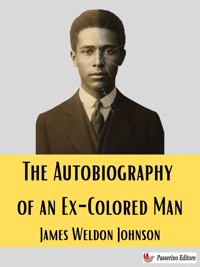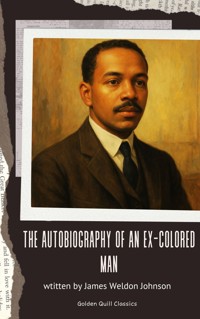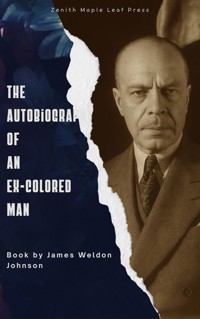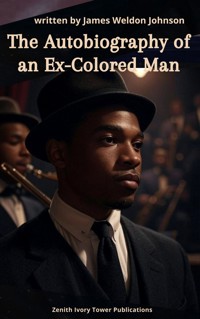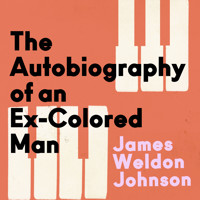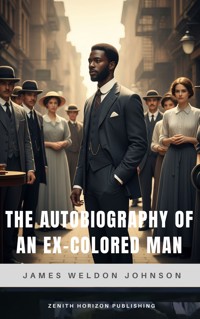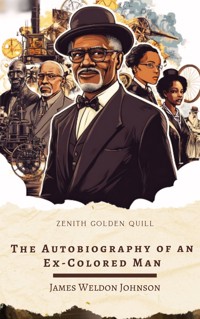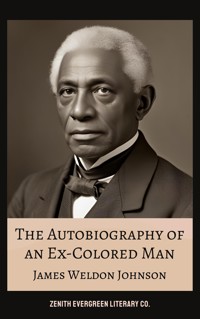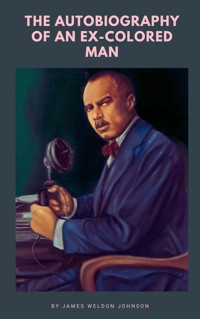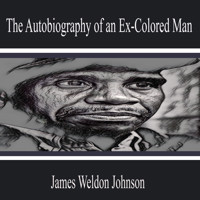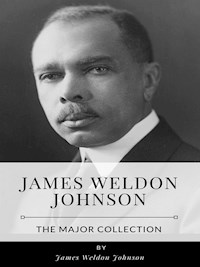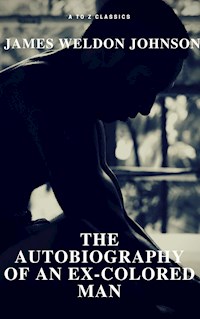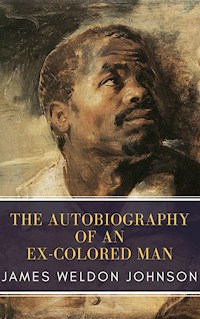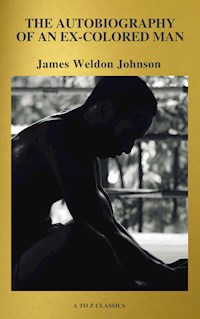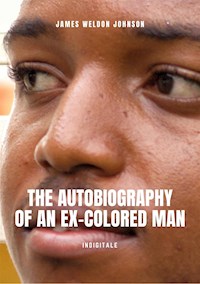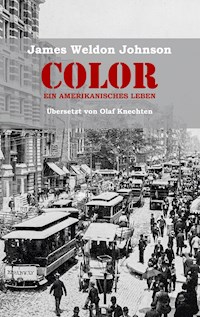
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist man auch dann ein Schwarzer, wenn es niemand sehen kann? In einem tief gespaltenen Land macht sich ein hellhäutiger Afroamerikaner auf die Suche nach seiner Identität. Die fiktive Autobiografie "Color - Ein amerikanisches Leben" wurde 1912 zunächst anonym veröffentlicht. Darin beschreibt der namenlose Ich-Erzähler die Stationen seines bewegten Lebens. Die Suche nach Zugehörigkeit und Heimat treibt ihn einmal quer durch die USA, nach Europa und wieder zurück, von der Zigarrenfabrik über die Spielhölle in den Ragtime-Club, von der Pariser Oper über Berliner Konzerthäuser bis zu einem Treffen evangelikaler Christen in den Südstaaten. Zwei Morde erweisen sich als schicksalsentscheidend ... Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Coming-of-Age-Roman und Road Novel. Schnörkellos, ehrlich und zugleich unterhaltsam vermittelt es einen Einblick in das diverse Leben der schwarzen Bevölkerung und einen Eindruck der amerikanischen Gesellschaft um 1900.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
James Weldon Johnson (1871-1938) war ein Mann mit vielen Talenten. Er war Schriftsteller, Komponist, Lehrer, Jurist, Diplomat und Bürgerrechtler.
Er unterrichtete die Nachkommen ehemaliger Sklaven und arbeitete als Rechtsanwalt, war führendes Mitglied der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) und setzte sich u. a. für ein Anti-Lynch-Gesetz ein, da damals die Täter nicht verfolgt wurden.
Gemeinsam mit seinem Bruder John Rosamond Johnson schrieb er das Lied Lift Every Voice and Sing, das zur Hymne des schwarzen Amerikas wurde. Später komponierten die beiden noch einige Ragtime-Hits.
Johnson gehörte gemeinsam mit vielen weiteren schwarzen Künstlern, Musikern und Schriftstellern der Kulturbewegung Harlem Renaissance an. Er verfasste Gedichte, Essays und eine Autobiografie. Color – Ein amerikanisches Leben blieb sein einziger Roman.
Olaf Knechten ist ein deutscher Übersetzer, Lektor und Künstler und übersetzt aus dem Englischen, Französischen und Niederländischen.
Er ist auch Herausgeber dieses Buchs und konnte die Veröffentlichung mithilfe eines Stipendiums des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von »Neustart Kultur« verwirklichen.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
Nachwort
KAPITEL 1
Mir ist bewusst, dass ich mit den folgenden Aufzeichnungen das große Geheimnis meines Lebens preisgebe, ein Geheimnis, das ich jahrelang viel sorgsamer gehütet habe als meine irdischen Güter. Es fällt mir nicht leicht zu analysieren, was mich dazu veranlasst, dies niederzuschreiben. Ich habe das Gefühl, dass mich der gleiche Impuls antreibt wie den unentdeckten Kriminellen, der sich jemandem anvertrauen muss, wohlwissend, dass dies sein Verderben bedeuten kann. Ich weiß, dass ich mit dem Feuer spiele, und spüre auch die Erregung, die mit diesem faszinierenden Zeitvertreib einhergeht. Eigentlich glaube ich, liegt meinem Tun das unbändige, teuflische Verlangen zugrunde, all die kleinen Tragödien meines Lebens zusammenzufassen und sie als großen Scherz darzustellen, den ich mir mit der Gesellschaft erlaubt habe. Außerdem verspüre ich ein vages Gefühl von Unzufriedenheit, Bedauern, ja fast Reue, von dem ich mich befreien will und das ich im letzten Abschnitt dieses Buchs noch ansprechen werde.
Ich wurde kurz nach Ende des Bürgerkriegs in einer kleinen Stadt in Georgia geboren. Ihren Namen will ich nicht nennen, da dort noch Personen leben, die man mit dieser Erzählung in Verbindung bringen könnte. Ich habe nur eine vage Erinnerung an meinen Geburtsort. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, kann ich wie im Traum Dinge heraufbeschwören, die sich offenbar vor langer Zeit in einer anderen Welt zugetragen haben. Undeutlich kann ich ein kleines Haus ausmachen – ich bin mir sicher, dass es nicht groß war – und erinnere mich, dass im Vorgarten Blumen wuchsen und jedes Beet mit einer Reihe verschiedenfarbiger Glasflaschen eingefasst war, die mit dem Hals im Boden steckten. Als ich einmal im Sand spielte, fragte ich mich, ob die Flaschen wie Blumen aus der Erde wuchsen, und grub sie aus, um es herauszufinden. Für meinen Forscherdrang bekam ich ordentlich den Hintern versohlt. Deshalb hat sich dieser Vorfall für immer in mein Hirn gebrannt. Hinter dem Haus befand sich ein offener Schuppen, in dem ein paar hölzerne Waschzuber standen. Sie waren mir damals ein Gräuel, denn ich wurde regelmäßig abends in einen dieser Zuber gesteckt und abgeschrubbt, bis meine Haut brannte. Bis zum heutigen Tag erinnere ich mich an den beißenden Schmerz, wenn ich die übelriechende Seife in die Augen bekam.
Hinter dem Haus lag ein Gemüsegarten von etwa dreißig Metern Länge, doch in meiner kindlichen Vorstellung war das Grundstück grenzenlos. Ich erinnere mich noch, wie ich voll freudiger Erregung und Staunen Expeditionen durch diesen Garten unternahm, um ganz hinten Brombeeren zu pflücken, die dort, teils reif, teils grün, am Zaun wuchsen.
Ich erinnere mich auch, wie gern ich zu einer kleinen Weide ging, auf der eine Kuh stand, um ihr zuzusehen, wie sie gleichmütig wiederkäute. Manchmal bot ich ihr durch den Zaun ein Stück von meinem Brot mit Zuckerrohrsirup an, und wenn es aussah, als wollte sie mein Angebot annehmen, riss ich erschrocken die Hand zurück.
Ich kann mich vage an verschiedene Personen erinnern, die in unserem kleinen Haus ein- und ausgingen. Doch es gibt nur zwei Menschen, die ich noch deutlich vor mir sehe, meine Mutter und einen großen Mann mit einem schmalen, dunklen Schnurrbart. Er trug stets glänzende Schuhe oder Stiefel und hatte eine goldene Taschenuhr, mit der er mich spielen ließ. Die Uhr und seine Schuhe faszinierten mich fast gleichermaßen. Er kam zwei- bis dreimal die Woche abends zu uns, und mir wurde die Aufgabe zuteil, ihm ein Paar Pantoffeln zu bringen und seine glänzenden Schuhe in immer dieselbe Ecke zu stellen. Oft gab er mir zur Belohnung eine funkelnde Münze, die ich auf Geheiß meiner Mutter sofort in eine Spardose steckte. Ich erinnere mich noch genau an das letzte Mal, als uns der große Mann in unserem kleinen Haus in Georgia besuchte. Bevor ich an dem Abend zu Bett ging, hob er mich hoch und drückte mich ganz fest. Meine Mutter stand hinter seinem Stuhl und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. Ich saß auf seinem Knie und sah zu, wie er mühsam ein Loch in eine Zehn-Dollar-Goldmünze bohrte, um sie mir an einem Band um den Hals zu hängen. Fast mein ganzes Leben habe ich diese Münze um den Hals getragen und besitze sie immer noch, doch mehr als einmal wünschte ich mir, er hätte eine andere Befestigungsmöglichkeit gefunden, als sie zu durchbohren.
Am Tag, nachdem er mir die Münze umgehängt hatte, begaben meine Mutter und ich uns auf eine schier endlose Reise. Ich kniete auf dem Sitz und sah durch das Zugfenster zu, wie die Mais- und Baumwollfelder vorbeirauschten, bis ich einschlief.
Als ich wieder wach wurde, fuhren wir gerade durch eine große Stadt: Savannah. Ich setzte mich auf und blinzelte in die hellen Lichter. In Savannah gingen wir an Bord eines Dampfers, der uns nach New York brachte. Von dort aus fuhren wir in eine Stadt in Connecticut, in der ich meine Jugend verbringen sollte.
Meine Mutter und ich bewohnten ein kleines Cottage, das mir fast luxuriös eingerichtet schien. Im Salon gab es Sessel mit Rosshaarpolstern und ein kleines Klavier. Eine Treppe mit rotem Teppich führte zu einem niedrigen Dachgeschoss. An den Wänden hingen Bilder und in einer Vitrine standen ein paar Bücher.
Meine Mutter kleidete mich immer adrett, und ich entwickelte einen Stolz, wie ihn gut gekleidete Jungen oft an den Tag legen. Sie achtete auch sehr darauf, mit wem ich umging, aber ich war in der Hinsicht selbst recht wählerisch. Wenn ich zurückblicke, sehe ich einen perfekten kleinen Aristokraten vor mir. Meine Mutter besuchte selten andere Leute zu Hause, aber da sie als Näherin arbeitete, gingen viele Damen bei uns aus und ein. Oft riefen sie mich zu sich, fragten mich nach meinem Namen und Alter und sagten zu meiner Mutter, ich sei ein hübscher Junge. Manche tätschelten mir den Kopf und küssten mich.
Meine Mutter hatte als Näherin reichlich zu tun, und manchmal half ihr auch eine andere Frau. Sie muss also recht gut verdient haben. Außerdem erhielt sie mindestens einmal im Monat einen besonderen Brief. Ich hielt immer nach dem Postboten Ausschau, nahm den Brief entgegen und lief damit zu meiner Mutter. Ganz gleich, ob sie beschäftigt war oder nicht, sie steckte ihn sofort in ihren Ausschnitt. Ich habe sie nie einen dieser Briefe lesen sehen. Später erfuhr ich, dass sie Geld enthielten und etwas, das für sie noch wertvoller war als Geld. Obwohl sie fast ständig arbeitete, fand sie die Zeit, mir das Alphabet, die Zahlen und das Schreiben einiger einfacher Wörter beizubringen. Sonntagabends setzte sie sich immer ans Klavier und spielte Kirchenlieder. Immer wenn sie Lieder aus dem Gesangbuch spielte, war ihr Tempo entschieden largo. Doch an manchen Abenden, wenn sie nicht nähte, sang sie alte Lieder aus dem Süden und begleitete sich selbst mit einfachen Akkorden. Bei diesen war sie freier, denn sie spielte sie nach Gehör. Die Abende, an denen sie sich ans Klavier setzte, waren die schönsten meiner Kindheit. Sobald sie auf das Instrument zuging, folgte ich ihr mit all der Neugier und unbändigen Vorfreude, die ein verzogener Schoßhund an den Tag legt, wenn ein Päckchen geöffnet wird, von dem er weiß, dass es eine Leckerei für ihn enthält. Ich stand immer neben meiner Mutter und unterbrach und ärgerte sie, indem ich mit seltsamen Harmonien einfiel, die ich entweder bei den hohen Soprannoten oder den tiefen Bassnoten fand. Ich erinnere mich, dass ich eine Vorliebe für die schwarzen Tasten hatte. Wenn die Musik verklungen war, saß meine Mutter oft noch lange da und hielt mich in den Armen. Sie drückte mich dann an sich und summte ein altes Lied, während sie sanft mit dem Gesicht an meinem Kopf entlangstrich. Oft schlief ich dabei ein. Ich sehe sie jetzt noch vor mir, sehe ihre großen dunklen Augen, die ins Feuer starren. Was sie dort sah, wusste nur sie. Die Erinnerung an dieses Bild hat mich oft davor bewahrt, mich allzu weit von dem Ort der Reinheit und Sicherheit zu entfernen, an dem ihre Umarmung mich festhielt.
Schon in frühester Kindheit begann ich, allein auf dem Klavier herumzuklimpern, und es dauerte nicht lange, bis ich ein paar Melodien spielen konnte. Mit sieben Jahren beherrschte ich schon alle Lieder, die meine Mutter kannte. Ich hatte auch die Bezeichnungen der Noten in beiden Schlüsseln gelernt, doch ich zog es vor, mich nicht von Noten einschränken zu lassen. Verschiedene Damen, für die meine Mutter nähte, hörten mich damals spielen und überzeugten sie, dass ich sofort Musikunterricht bekommen müsse. Also wurde für mich Klavierunterricht bei einer Dame arrangiert, die eine recht gute Musikerin war, während ihre Tochter mich in anderen Fächern unterrichten sollte. Meine Musiklehrerin konnte mich anfangs nur mit Mühe dazu bringen, mich auf die Noten zu konzentrieren. Immer wenn sie mir ein Stück vorspielte, das ich üben sollte, versuchte ich, die gewünschten Töne zu erzeugen, ohne das Notenblatt auch nur eines Blickes zu würdigen. Ihre Tochter, meine andere Lehrerin, hatte auch ihren Kummer mit mir. Denn wenn ich beim Lesen auf ein schwieriges oder unbekanntes Wort stieß, nahm ich meine Fantasie zu Hilfe und las statt der Wörter die Illustrationen. Lachend erzählte sie mir später, dass ich manchmal ganze Sätze oder Abschnitte durch das ersetzte, was ich auf den Bildern sah. Sie sei nicht nur über meinen einfallsreichen Umgang mit manchen Themen amüsiert gewesen, sondern habe, wenn ich einer Geschichte eine neue Wendung gegeben hatte, oft gespannt auf den Ausgang gewartet. Doch ich bin sicher, dass ich nicht an mangelnder Aufnahmefähigkeit litt, denn sowohl in der Musik als auch in den anderen Fächern machte ich schnell Fortschritte.
Und so teilte ich mein Leben für ein paar Jahre zwischen Musik und Schulbüchern auf, wobei Ersteres die meiste Zeit in Anspruch nahm. Ich hatte überhaupt keine Spielgefährten, war immer allein und spielte Spiele, die ich zum Teil selbst erfunden hatte. Ich kannte ein paar Jungen aus der Kirche, in die meine Mutter und ich gingen, doch mit keinem von ihnen war ich eng befreundet. Dann, als ich neun Jahre alt war, beschloss meine Mutter, mich auf die öffentliche Schule zu schicken, und so wurde ich plötzlich in einen bunt zusammengewürfelten Haufen von Jungen geworfen. Manche kamen mir vor wie Wilde. Die Verwirrung, die Traurigkeit und den Schmerz dieses ersten Schultages werde ich nie vergessen. Ich war offenbar der einzige Fremde in der Schule. Alle anderen Jungen kannten sich. Doch zum Glück kam ich in die Obhut einer Lehrerin, die mich kannte, denn meine Mutter schneiderte ihre Kleider. Sie war eine der Damen, die mir den Kopf getätschelt und mich geküsst hatten. Und sie besaß das Feingefühl, vor der Klasse einige Worte an mich persönlich zu richten. Das verlieh mir unter den Schülern ein gewisses Ansehen und beruhigte mich etwas.
Schon nach wenigen Tagen hatte ich einen treuen Freund, und mit den meisten anderen Jungen kam ich auch gut aus. Den Mädchen gegenüber war und blieb ich schüchtern. Selbst heute noch lässt mich ein Wort oder der Blick einer hübschen Frau erzittern.
Mein neuer Freund war ein plumper, kräftiger Junge mit feuerrotem Haarschopf und einem Gesicht voller Sommersprossen. Er war vielleicht vierzehn Jahre alt, vier oder fünf Jahre älter als die anderen Jungen, denn er hatte schon mehrere Klassen wiederholt. Ich hatte erst wenige Stunden an der Schule verbracht, als ich spürte, dass »Red«, wie ich ihn unwillkürlich taufte, und ich Freunde werden würden. Ein Grund war sicher auch, dass mir eines schnell klar wurde: In einer öffentlichen Schule konnte ich einen kräftigen Freund gut gebrauchen. Und vielleicht hatte Red trotz seiner geistigen Schwerfälligkeit erkannt, dass auch ich ihm von Nutzen sein konnte. Jedenfalls fühlten wir uns sofort zueinander hingezogen.
Für einen Wettbewerb hatte die Lehrerin die Schüler an den Wänden entlang aufgestellt. Als die Schüler eine ordentliche Reihe gebildet hatten, fand ich mich durch geschicktes Manövrieren auf dem dritten Platz, während ich Red auf den Platz direkt neben mir bugsiert hatte. Als Erstes ließ die Lehrerin uns das Wort buchstabieren, das unserem Platz in der Reihe entsprach.
»Buchstabiere ›Erster‹.«
»Buchstabiere ›Zweiter‹.«
»Buchstabiere ›Dritter‹.«
»D, R, I, T, T, E, R, Dritter«, rasselte ich auf eine Art herunter, die sagte: »Haben Sie nichts Schwierigeres für uns?«
Mir war bewusst, dass ich Glück hatte, auf einem der vorderen Plätze zu landen und ein so einfaches Wort zu erwischen. So jung ich auch war, fiel mir doch die Ungerechtigkeit der ganzen Prozedur auf, und mir taten die Jungen weiter hinten leid, die Wörter wie »Zwölfter« oder »Zwanzigster« buchstabieren mussten, nur um ihre Plätze zu verteidigen.
»Buchstabiere ›Vierter‹.«
Die Hände fest hinter dem Rücken verschränkt buchstabierte Red tapfer: »V, I, R, T, E, R.«
Blitzartig schossen zwanzig Hände in die Höhe, und die Lehrerin mahnte: »Nicht mit den Fingern schnippen. Nicht mit den Fingern schnippen.«
Dies war das erste falsch buchstabierte Wort, und manche Schüler schienen darüber fast den Verstand zu verlieren. Sie hüpften auf einem Bein, eine Hand hochgestreckt, fuchtelten wild mit den Fingern und strahlten vor Freude übers ganze Gesicht. Andere standen still, die Hände nicht so weit hochgereckt, die Finger ruhiger, ihr Ausdruck gelassener. Wieder andere bewegten sich überhaupt nicht, hoben ihre Hände auch nicht, sondern standen nur stirnrunzelnd da und sahen aus, als würden sie nachdenken.
Dies alles war neu für mich, und ich streckte nicht die Hand in die Luft, sondern flüsterte Red mehrmals verstohlen den Buchstaben E zu.
»Zweite Chance«, sagte die Lehrerin. Die Hände sanken herab, und die Klasse beruhigte sich.
Red, nun rot angelaufen, starrte flehentlich an die Decke, senkte dann den Blick erbarmenswert zu Boden und begann zögerlich: »V, E …«
Sofort fuhr ein Impuls, die Hände zu recken, durch die Klasse, doch die Lehrerin gebot den Schülern Einhalt, und der arme Red, der sicher wusste, dass jeder zusätzliche Buchstabe ihn weiter vom Ziel abbringen würde, fuhr beharrlich fort: »… R, T, E, R.«
Die Aufregung war groß. Noch mehr Hände flogen in die Höhe. Die, die sich vorher nicht gerührt hatten, wedelten jetzt mit den Händen über den Köpfen. Red fühlte sich sichtlich verloren. Er wirkte so schwerfällig und töricht, dass ein paar Schüler zu kichern begannen. Seine Hilflosigkeit tat mir im Herzen weh und weckte mein Mitleid. Ich hatte das Gefühl, wenn er versagte, hätte ich in gewisser Weise auch versagt. Ich hob die Hand und nutzte die allgemeine Aufregung und die Versuche der Lehrerin, die Ordnung wiederherzustellen, um ihm schnell und deutlich ins Ohr zu flüstern: »V, I, E, R, T, E, R! V, I, E, R, T, E, R!«
Die Lehrerin klopfte auf ihr Pult und verkündete: »Dritte und letzte Chance.«
Die Hände sanken wieder, und bedrückte Stille folgte. Red begann: »V …« Seit jenem Tag habe ich viele Male bang zugesehen, wie ein Glücksrad sich dreht, doch nie mit einer solchen Spannung wie in dem Augenblick, da ich darauf wartete, in welcher Reihenfolge die Buchstaben aus Reds Mund kullern würden. »… I, E, R, T, E, R.«
Ein Seufzer der Erleichterung und Enttäuschung ging durch die Klasse. Von da an und während unserer gesamten Schulzeit half ich Red mit meiner schnellen Auffassungsgabe und meinem Denkvermögen aus, während ich von seiner Kraft und bedingungslosen Treue profitierte.
Auf unserer Schule gab es einige mehr oder weniger dunkelhäutige Kinder, ein paar auch in meiner Klasse. Einer der Jungen weckte vom ersten Tag an mein besonderes Interesse. Sein Gesicht war schwarz wie die Nacht, doch es glänzte wie poliert. Seine Augen strahlten, und wenn er den Mund öffnete, zeigte er seine blendend weißen Zähne. Deshalb fand ich es völlig passend, ihn »Shiny Face«, »Shiny Eyes« oder »Shiny Teeth« zu nennen und benutzte diese Namen auch häufig, wenn ich mit anderen Jungen über ihn sprach. Schließlich blieb nur »Shiny« hängen, und während der gesamten restlichen Schulzeit hörte er gutmütig auf diesen Namen.
Shiny war ohne Zweifel der Beste von uns im Buchstabieren, Lesen und Schreiben – kurzum, der Klassenbeste. Er hatte eine schnelle Auffassungsgabe, lernte aber trotzdem fleißig, besaß also zwei Eigenschaften, die man nur selten in einem Jungen vereint sieht. Jahr für Jahr, bis in die Highschool, erhielt er die meisten Auszeichnungen für Pünktlichkeit, Betragen, Aufsätze und Vorträge. Doch bald stellte ich fest, dass trotz seines Rufs als Musterschüler viele auf ihn herabsahen. Die anderen schwarzen Kinder genossen noch weniger Ansehen. Manche Jungen bezeichneten sie als »Nigger«. Auf dem Heimweg lief manchmal eine Meute Kinder hinter ihnen her, die skandierten:
»Nigger, Nigger, ritzeratze, helle Augen, schwarze Fratze.«
Eines Nachmittags drehte sich einer der schwarzen Jungen plötzlich um und schleuderte seine Tafel in die Meute. Sie traf einen weißen Jungen an der Lippe, die aufplatzte. Als der schwarze Junge das Blut sah, rannte er weg, und seine Freunde taten es ihm nach. Wir rannten ihnen hinterher und warfen Steine nach ihnen, bis sie sich in verschiedene Richtungen zerstreuten. Ich war über diese Sache sehr aufgebracht und erzählte meiner Mutter zu Hause, wie einer der »Nigger« einen Jungen mit einer Tafel verletzt hatte. Ich werde nie vergessen, wie sie auf mich losging.
»Nimm nie wieder dieses Wort in den Mund«, sagte sie, »und lass bloß die schwarzen Kinder in Ruhe. Du solltest dich schämen.«
Betreten senkte ich den Kopf, nicht weil sie mich überzeugt hätte, etwas Falsches getan zu haben, sondern weil ich gekränkt war, denn es war das erste Mal, dass sie so scharfe Worte gegen mich gerichtet hatte.
Meine Schuljahre plätscherten angenehm dahin. Meine Leistungen wurden für gut erachtet, doch mein Betragen weniger. Ich ließ mir nie etwas Ernsthaftes zuschulden kommen, aber ich hatte gern meinen Spaß, und das brachte mir manchmal Ärger ein. Doch stellte ich mich bei meinen Streichen meist geschickt genug an, dass jemand anders den Ärger bekam. Mein Klaviertalent, das ich in der Schule vorführen konnte, wurde bei einem Jungen meines Alters fast als ein Wunder angesehen. Ich war zwar mit den meisten meiner Klassenkameraden nicht eng befreundet, aber doch einigermaßen beliebt.
Eines Tages gegen Ende meines zweiten Jahrs an der Schule kam die Rektorin in die Klasse, und nachdem sie mit der Lehrerin gesprochen hatte, sagte sie aus irgendeinem Grund: »Ich möchte, dass alle weißen Schüler kurz aufstehen.«
Als ich mich mit den anderen erhob, sah die Lehrerin mich an, rief meinen Namen und sagte: »Setz dich erst einmal wieder hin und steh mit anderen auf.«
Ich verstand nicht recht. »Ma’am?«
Sie wiederholte in einem sanfteren Ton: »Setz dich wieder hin und steh mit den anderen auf.«
Verwirrt setzte ich mich. Ich nahm nichts mehr wahr. Als die anderen aufgefordert wurden aufzustehen, bekam ich es nicht mit. Nach Schulschluss ging ich wie benommen hinaus. Ein paar weiße Jungen verhöhnten mich und sagten: »Ach, du bist also auch ein Nigger.«
Ich hörte einige schwarze Kinder sagen: »Wussten wir doch, dass er ein Schwarzer ist.« Shiny wies sie zurecht: »Kommt jetzt und hört auf, ihn zu hänseln.«
Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar. So schnell wie möglich lief ich weiter und hatte schon ein gutes Stück Weg zurückgelegt, bevor ich merkte, dass Red neben mir herging. Nach einer Weile sagte er: »Komm, ich trage deine Bücher.«
Ohne ein Wort herauszubringen, gab ich ihm mein Bündel. Als wir mein Gartentor erreichten, gab er mir die Bücher zurück und sagte: »Du kennst doch meine große, rote Achatmurmel? Ich kann damit nicht mehr so richtig schießen. Ich bringe sie dir morgen mit.«
Ich nahm die Bücher und rannte ins Haus. Als ich durch den Flur lief, sah ich, dass Mutter mit einer Kundin beschäftigt war. Ich eilte hinauf in mein kleines Zimmer, schloss die Tür und stellte mich vor den Spiegel an der Wand. Zuerst hatte ich Angst hineinzuschauen, doch dann studierte ich lange mein Gesicht. Ich hatte oft Leute zu meiner Mutter sagen hören: »Was für einen hübschen Jungen Sie doch haben!« Bemerkungen über mein gutes Aussehen war ich also gewohnt, aber jetzt wurde es mir zum ersten Mal selbst bewusst. Ich sah die Elfenbeinblässe meiner Haut, meine schön geformten Lippen, die feuchte Dunkelheit meiner großen Augen und die langen schwarzen Wimpern, die sie in einer Art umrahmten und beschatteten, die sogar mich selbst faszinierte. Ich bemerkte mein weiches, glänzendes Haar, das mir in Wellen über die Schläfen fiel und meine Stirn weißer erscheinen ließ, als sie wirklich war. Wie lange ich dort stand, um mein Spiegelbild zu betrachten, weiß ich nicht. Als ich das Zimmer verließ, hörte ich auf dem Treppenabsatz, wie die Kundin das Haus verließ. Schnell rannte ich hinunter zu meiner Mutter, die bei einer Näharbeit saß. Ich vergrub meinen Kopf in ihrem Schoß und platzte heraus: »Mutter, Mutter, sag mir, bin ich ein Nigger?«
Sie hatte Tränen in den Augen. Ich konnte sehen, dass sie mit mir litt. Und in diesem Moment studierte ich zum ersten Mal kritisch ihr Gesicht. Ich hatte sie immer auf kindliche Art als die schönste Frau der Welt betrachtet. Nun suchte ich nach Makeln. Mir wurde bewusst, dass ihre Haut fast braun und ihr Haar nicht so weich war wie meines. Außerdem unterschied sie sich in bestimmter Weise von den Frauen, die unser Haus besuchten. Dennoch erkannte ich, wie schön sie war, schöner als jede von ihnen.
Sie muss bemerkt haben, dass ich ihr Gesicht studierte, denn sie vergrub es in meinem Haar und sagte mit brüchiger Stimme: »Nein, mein Schatz, du bist kein Nigger.« Sie fuhr fort: »Du bist genau so viel wert wie jeder andere. Wenn dich jemand Nigger nennt, ignorier ihn einfach.«
Doch je mehr sie redete, desto verunsicherter war ich, deshalb unterbrach ich sie: »Also, Mutter, bin ich weiß? Bist du weiß?«
Mit zittriger Stimme antwortete sie: »Nein, ich bin nicht weiß, aber du … Dein Vater ist einer der wichtigsten Männer des Landes … Du hast das edelste Blut des Südens in dir …«
Dies riss in meinem Herzen einen neuen Abgrund von Zweifel und Angst auf, und fordernd fragte ich: »Wer ist mein Vater? Wo ist er?«
Sie strich mir übers Haar und sagte: »Eines Tages werde ich dir von ihm erzählen.«
»Ich will es jetzt wissen«, erwiderte ich schluchzend.
»Nein, nicht jetzt«, sagte sie.
Vielleicht musste ich die Wahrheit erfahren, doch ich habe der Frau, die sie mir auf so grausame Weise beibrachte, nie verziehen. Vielleicht war ihr gar nicht bewusst, dass sie mir an jenem Tag in der Schule eine tiefe Wunde geschlagen hatte, die Jahre brauchte, um zu heilen.
KAPITEL 2
Seit ich älter bin, denke ich oft an diese Zeit zurück und versuche, den Wandel zu analysieren, den mein Leben nach diesem schicksalhaften Tag in der Schule durchmachte. Der tiefgreifenden Veränderung war ich mir trotz meiner Jugend bewusst, auch wenn ich sie nicht ganz verstand. Wie das erste Mal, als ich eine Tracht Prügel bezog, ist dies eines der wenigen Ereignisse in meinem Leben, an die ich mich deutlich erinnere. Jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens einige unglückliche Erfahrungen, die sich nicht einfach in seinem Gedächtnis verankern, sondern sich dort einbrennen. Noch Jahre später kann man sie detailliert abrufen und die von ihnen erzeugten Gefühle aufs Neue durchleben. Dies sind die Tragödien des Lebens. In späteren Jahren mögen wir manche davon als triviale Vorkommnisse unserer Kindheit abtun – ein zerbrochenes Spielzeug, ein nicht eingelöstes Versprechen, harte, verletzende Worte –, jedoch gehören sie ebenso wie die bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen reiferer Jahre zu den Tragödien des Lebens.
Und so habe ich viele Male jene Stunde, jenen Tag, jene Woche neu durchlebt, als ich auf wundersame Weise von einer Welt in die andere hinüberwechselte. Denn ich fand mich tatsächlich in einer anderen Welt wieder. Von da an sah ich alles mit anderen Augen, meine Gedanken waren gefärbt, meine Worte bestimmt, meine Handlungen beschränkt durch eine alles dominierende, alles durchdringende Vorstellung, die immer gewaltiger und gewichtiger wurde, bis ich darin schließlich eine große, klare Tatsache erkannte.
Diesem alles hemmenden, verzerrenden und verfälschenden Einfluss unterliegt jeder Schwarze in den Vereinigten Staaten. Er ist gezwungen, alles nicht etwa aus der Perspektive eines Bürgers, eines Mannes oder einfach eines Menschen zu betrachten, sondern aus dem Blickwinkel eines Schwarzen. Es ist ein wahres Wunder, dass wir so große Fortschritte machen konnten, denn die meisten unserer Gedanken und all unsere Handlungen müssen sich durch dieses Nadelöhr zwängen.
Das ist auch ein Grund, warum die schwarzen Menschen dieses Landes für die Weißen so rätselhaft sind. Für einen Weißen ist es sehr schwierig zu ergründen, was ein Schwarzer wirklich denkt. Seine Gedanken müssen in einem anderen Licht betrachtet und zusätzlich ausgeleuchtet werden, denn sie werden oft von so subtilen und heiklen Überlegungen beeinflusst, dass es ihm unmöglich wäre, sie einem Weißen zu offenbaren oder zu erklären. Dadurch entwickelt jeder Schwarze eine seiner Intelligenz entsprechende gespaltene Persönlichkeit. Er besitzt eine Seite, die er nur innerhalb der verschworenen schwarzen Gemeinschaft zeigt. Oft habe ich mit Interesse und bisweilen Erstaunen beobachtet, wie selbst ungebildete Schwarze in Anwesenheit von Weißen verborgen hinter einem breiten Grinsen und Minstrel1-Clownereien dieses doppelte Spiel spielten.
Ich bin überzeugt, dass die Schwarzen dieses Landes die Weißen besser kennen und verstehen als umgekehrt.
Ich glaube heute, dass ich die Veränderung in meinem Leben anfangs eher subjektiv empfunden habe, als dass sie objektiv existierte. Ich glaube nicht, dass sich die Haltung meiner Schulkameraden mir gegenüber merklich veränderte, sondern dass ich mich ihnen gegenüber anders verhielt. Ich wurde distanzierter, misstrauischer, weil ich fürchtete, meine Gefühle und mein Stolz könnten verletzt werden. Häufig sah ich Beleidigungen, wo sicher keine beabsichtigt waren. Falls meine Lehrer und Freunde sich überhaupt anders verhielten als vorher, waren sie eher besonders rücksichtsvoll mir gegenüber. Aber es war genau diese Haltung, die mir gegen den Strich ging. Red war der Einzige, der mich nicht auf diese Weise verletzte. Bis zum heutigen Tag wird mir warm ums Herz, wenn ich an seine unbeholfenen Bemühungen zurückdenke, mir zu verstehen zu geben, dass nichts seine Zuneigung zu mir mindern könne.
Ich bin mir sicher, dass meine weißen Klassenkameraden damals den Unterschied zwischen ihnen und mir weder wahrnahmen noch verstanden, aber einige waren offensichtlich zu Hause informiert worden, und mehr als einmal stellten sie ihr Wissen in Wort und Tat unter Beweis. Im Laufe der Jahre wurden sich auch die Unschuldigsten und Unwissendsten unter den anderen Schülern dieses Unterschieds bewusst.
Ich selbst hätte ihn nicht so deutlich wahrgenommen, wenn nicht die anderen schwarzen Kinder gewesen wären. Ich hatte gelernt, welchen Status sie hatten, und nun lernte ich, dass dies auch mein Status war. Ich empfand weder besondere Sympathie noch Abneigung gegenüber diesen schwarzen Jungen und Mädchen. Mit Ausnahme von Shiny hatte ich mir selten Gedanken über sie gemacht. Doch als mich dieser Schlag traf, wehrte ich mich innerlich dagegen, mit ihnen in einen Topf geworfen zu werden. Also wurde ich zum Eigenbrötler. Red und ich blieben unzertrennlich, und auch Shiny und ich waren einander wohlgesonnen, aber im Umgang mit anderen war ich nie ganz unbefangen. Allerdings beschränkte sich diese Befangenheit fast ausschließlich auf den Umgang mit Gleichaltrigen. Bei Personen, die älter waren als ich, blieb dieses Gefühl aus. Und als ich erwachsen wurde, war ich gegenüber älteren Weißen viel unbefangener als gegenüber denen in meinem Alter.
Ich war damals erst elf Jahre alt, aber die oben beschriebenen Gefühle und Eindrücke hätten