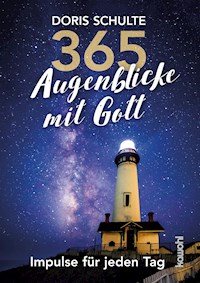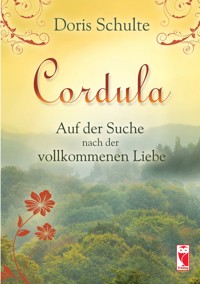
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Frieling & Huffmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Cordula ist eine Frau um die 50, Pianistin und Professorin an einer Musikhochschule. Sie lebt in zwei verschiedenen Welten: in der ländlichen Idylle des Bergischen Landes und in der städtischen Gemeinschaft mit Künstlern, Wissenschaftlern und Studenten. Mit Leidenschaft regt Cordula ihre Studenten dazu an, Gegengewichte zu einer kalten, technisierten Welt zu schaffen, in der Gefühle und Werte wenig zählen. In Helge, einem Literaturwissenschaftler und Hochschulprofessor, findet sie einen Partner, der ähnlich denkt und fühlt. Beide sehen ihre Sehnsucht nach der vollkommenen Liebe endlich erfüllt. Doch die Beziehung ist gefährdet … Cordula erlebt den Wechsel von höchstem Glück und tiefstem Leid. Musik und Literatur werden gleichsam zu Spiegel und Medium ihrer Seele.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
1
Vera saß auf der Kante der Rundbank, gekleidet in einen schwarzen Hosenanzug, der wie maßgeschneidert wirkte und ihre schlanke Figur betonte. Über der weißen Bluse trug sie eine dunkelviolette Weste. Ein dünnes Kettchen mit einem winzigen Anhänger schmückte das nicht mehr faltenfreie, gebräunte Dekolleté. Sie saß betont aufrecht und bewegte das kleine Köpfchen gezielt hin und her. Ihre dunklen Augen musterten die Gäste, die um die Tische versammelt waren. In ihrem kurzen, nach hinten gekämmten grau melierten Haar steckte eine winzige Brille.
Der Raum war fensterlos und nur durch in verschiedene Richtungen weisende Halogenlämpchen schwach beleuchtet. Eine Treppe führte in die Seminarräume, die jetzt im Dunkel lagen. Nun hatte sich die illustre Gesellschaft, die sich zuvor in die rund 150 Jahre zurückliegende Gedankenwelt des Dichters Christian Friedrich Hebbel versenkt hatte, zum gemütlichen Plaudern zusammengefunden. Bei Bier und Wein saßen sie, überwiegend Damen, elegant gekleidet, zwischen 50 und 70 Jahren. Dazwischen verloren wirkend ein paar Herren, ein wortgewandter Jurist und ein alter, hagerer Mann, der einmal Betriebsleiter war. Er starrte mit wässrigen Augen auf die Beine der Frau, die rechts neben ihm saß.
Es war Cordula van Bergen, eine schlanke Dame mittleren Alters. Ihr rotes Kostüm ließ ihr halblanges blondes Haar aufleuchten. Ihr Gesicht war nahezu faltenfrei. Die mit dunkelrosé Lipgloss nachgezogenen vollen Lippen und das dezent aufgetragene Rouge verliehen ihr ein jugendliches Aussehen. Nur selten ließ sie ein Wort vernehmen. Dieses war aber dann wohlbedacht und traf den Kern der Sache. Sie verfolgte aufmerksam die Worte Herrn Tenbrinks, des Referenten der Literaturtagung, der zu ihrer Linken saß und sich nach allen Seiten wortreich, sachkundig, mit rednerischer Gewandtheit und wohlklingender Stimme äußerte. Man merkte, dass er es genoss, die Blicke all der Damen und weniger Herren auf sich zu ziehen.
Helge Tenbrink war auch äußerlich ein auffälliger Mann mit großem Kopf und großen blauen Augen, mit breiten Schultern und einem fülligen Leib. Seine Haltung war betont aufrecht; man könnte fast sagen: Er warf den Kopf in den Nacken. Wenn er mit großen federnden Schritten über die Flure ging, strahlte er Entschiedenheit und Zielstrebigkeit aus. Schritt er zu dem Seminarraum, so wusste jeder: Gleich beginnt die Sitzung und alle beeilten sich, um nicht zu spät zu kommen. Überall sprach man mit Bewunderung von ihm. Diese galt vor allem seinem umfangreichen Wissen und seinem rednerischen Talent. Aber auch war sein Charme gegenüber Frauen bekannt: „Helge und die Frauen“, murmelte man hinter vorgehaltener Hand.
Nun lobte er kurz eine Äußerung Cordulas. Sie lächelte verlegen und schlug die dunkelgrau abgeschatteten, großen blauen Augen nieder. In diesem Augenblick sprang Vera von ihrem Platz auf, zückte ihr Handy, richtete das Objektiv auf Helge und Cordula aus und drückte ab.
***
Am anderen Morgen, nach Beendigung des dreitägigen Wochenendseminars, brachte Vera Helge nach Hause, zusammen mit Cordula. Sie parkte direkt vor seiner Junggesellenwohnung in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Er konnte nicht fahren und besaß auch kein Auto. Den Führerschein hatte er vor langer Zeit mal gemacht, als er noch nicht geschieden war, auf einem Auto mit automatischer Gangschaltung. Als ihn dann seine Frau nach bestandener Prüfung abholte und ihm das Steuer überließ, hatte er Probleme mit der Handschaltung. Eine abfällige Bemerkung seitens seiner Frau über seine Ungeschicklichkeit bewirkte, dass er nie wieder das Steuer in die Hand nahm.
Nun schloss Helge die Haustür auf und betrat den Flur des alten Gebäudes. Die beiden Frauen folgten ihm. Im Hausflur roch es etwas moderig. Der Sockel des Flurs war gefliest, die obere Fliesenreihe mit Ornamenten gestaltet. Cordula, die zum ersten Mal hier war, betrachtete die Ornamente.
„Wie schön!“, sagte sie halblaut.
„Spätes 19. Jahrhundert, Jugendstil“, erklärte Helge. Dann schloss er die Etagentür auf und forderte mit einem „Bitte schön“ die Frauen auf einzutreten.
Cordula benutzte zunächst die Toilette. Der Raum war winzig klein. In der Badewanne lag ein nasses Handtuch, offenbar, um ein Ausrutschen zu verhindern. Auf der Spiegelablage standen und lagen verschiedene Toilettenartikel, die auch auf eine Frau als Bewohnerin hätten hinweisen können. Auffällig war die strenge Ordnung der verschiedenen Utensilien.
Während Cordula die Toilette benutzte, lief Vera in die Küche. „Ich koch schon mal Kaffee“, sagte sie und hantierte mit verschiedenen Dingen. Sie kannte sich in der Wohnung aus und es war für sie Ehrensache, Menschen zu helfen, die sich ein wenig schwertaten.
Das Wohnzimmer war geräumig und hoch, mit großen Fenstern und einer Tür, die zu einer breiten, verlassen wirkenden Terrasse führte. Die ehemals weißen Fliesen des Terrassenbodens waren gerissen und ver-moost. Dürres Laub wehte der Wind leicht darüber hin. Zwischen zwei niedrigen Säulen mit abgebröckeltem Putz führten drei Stufen in einen von allerlei Gerümpel belagerten Garten. Hier wuchs zwischen Wassergräben eine riesige Kastanie. Sie mochte im Sommer ihren wohltuenden Schatten bis weit über die Terrasse hinaus spenden. Weit hinten kletterte an einer verklinkerten Hauswand einsam ein ausgestopfter Nikolaus.
Mitten im Wohnzimmer ragte eine breite, quaderförmige Säule vom Boden bis zur Decke. An der dem eintretenden Besucher zugewandten Seite der Säule prangte in einem dicken goldfarbenen Rahmen ein Bild von Klimt, das fast die Größe eines realen Menschen hatte: Eine elegante Frauengestalt, die stilisiert wirkte, blickte kühl von oben auf den Betrachter herab. Rechts neben der Säule stand ein kleiner Tisch. An der Wand gegenüber der Tür nahm man über einem weißen Ledersofa zwei große Porträts wahr: rechts das von Schiller, links das von Goethe. In der Mitte hing eine mittelalterliche Darstellung des ptolemäischen Weltbildes: Ein alter Mann kniete am Rande der Erde, über ihm die verschiedenen Schichten des gestirnten Himmels. Mit der einen Hand hielt er einen Spazierstock, mit der anderen griff er durch die Schichten des Himmels nach dem, was er dahinter wahrzunehmen glaubte.
Links von dieser Bildergruppe ging das Wohnzimmer in das Arbeitszimmer über. Auf der Grenze der beiden Raumzonen stand ein nicht mehr im Gebrauch befindlicher antiker gusseiserner Ofen, der grün emailliert war. Darauf waren dicht an dicht Familienfotos aufgestellt. Auf dem Schreibtisch des Arbeitszimmers stand eine Lampe mit grünem Schirm. Die Arbeitsplatte war an der dem Arbeitenden gegenüberliegenden Längsseite mit einer Bücherreihe bestellt, die exakt gerade ausgerichtet war. Daneben war ein Fach mit Briefen. Vor der Bücherreihe befand sich eine Messingschale mit ein paar Schreibutensilien. Die Schreibfläche war mit einer durchsichtigen Folie bedeckt. Darunter klebte ein Terminkalender.
Um die Ecke erblickte man einen Raum, der wohl das Schlafzimmer war. Hinter einem Rundbogen nahm man die Scheiben eines Spiegelschrankes wahr und die Breitseite einer mit einem rot-grün karierten Tuch abgedeckten Liege.
Helge hatte Cordula kurz herumgeführt und auf dieses und jenes gedeutet, während Vera den Tisch deckte.
„So viele Bücher“, staunte Cordula und zeigte auf die voll bepackten Schränke und Regale. Helge zog das eine und andere heraus und zeigte es. Es waren auch von Helge verfasste Bücher dabei. Dann lobte er Vera, die gerade mit der Kaffeekanne in der Hand aus der Küche kam, und hieß die beiden, an dem kleinen Tisch rechts neben der Säule Platz zu nehmen. Er entzündete die ungleich heruntergebrannten Kerzen des schon etwas verdorrten Adventskranzes.
„So, heute ist es das letzte Mal, wir haben ja schon Dreikönigstag“, sagte er. „Aber die Kugel da, die lass ich übers ganze Jahr stehen“, ergänzte er und zeigte auf eine Glaskugel auf dem Fernsehtisch rechts vom Fernseher, in der ein romantischer Winterwald eingefangen war.
Sie tranken Kaffee und Helge brachte den CD-Player in Gang. Es erklang Klaviermusik: Grieg.
„Der Huldigungsmarsch von Grieg“, sagte Helge. „Ihn lege ich immer auf, wenn ich von meinen Seminaren nach Hause komme. Das Alleinsein hier ist so ein großer Kontrast zu dem wunderschönen Wochenende in geselliger Runde – alles verhallt so plötzlich.“ Es traten ihm fast die Tränen in die Augen. Cordula würdigte das Werk und die Interpretation.
„Willst du nicht auch mal ein Grieg-Konzert geben?“, fragte Helge. „Dann komme ich bestimmt!“
***
Cordula hatte Helge vor drei Jahren kennengelernt, auf dem Geburtstag ihrer Freundin Vera. Vera hatte ihren Fünfzigsten gefeiert in einem noblen Hotel in Bad Neuenahr, ganz in der Nähe ihrer Wohnung. Hier gab es einen Flügel und einen repräsentativen Raum, in dem die vielen Gäste Platz fanden: Mitglieder des Vereins „Frau und Kultur“, in dem Vera eine führende Rolle zu übernehmen trachtete, Vertreter einer Kirche in Neuenahr, ihr Golfklub und ein Bibel-Gesprächskreis, zu dessen Teilnehmern sie gehörte.
An diesen erlauchten Kreis richtete Vera, kokett um sich blickend, ein paar begrüßende Worte: „… Ich bin nicht einfarbig, ich bin nicht schwarzweiß gestreift, ich bin bunt kariert und nach allen Seiten offen“, begann sie ihre Rede. Alles schmunzelte und sie schmunzelte mit. Für diese Feier hatte sie Helge und Cordula gebeten, einen anspruchsvollen kulturellen Beitrag zu liefern. Helge sollte wegen des beginnenden 200. Todesjahres Schillers ein paar Gedichte des Meisters rezitieren und interpretieren; Cordula sollte Klavierstücke von Beethoven und Schubert spielen. „Das war doch ‚Perlen vor die Säue werfen‘“, meinte Helge später im Gespräch mit Cordula, als er die Gäste beobachtet hatte. Es wurden aber auch noch andere Beiträge geboten, die für Vera eine Überraschung darstellen sollten. So sang ein Pfarrer „Danke für diese schöne Feier“ und begleitete sich dabei selbst auf der Gitarre. Die Pfarrerin des Bibelkreises las ein Gedicht von einer alten Schraube vor und überreichte Vera als Clou eine Halskette mit einer verrosteten Schraube daran. Sie hängte Vera die Kette um den Hals mit den Worten: „Willkommen im Klub der alten Schrauben!“
Cordula war am meisten beeindruckt von den Gedichten Schillers und von dem Vortrag und der Interpretation derselben durch Helge, aber auch von der Aufgeschlossenheit und der Begeisterungsfähigkeit Helges, die sich im späteren Gespräch mit ihm kundtaten. Er fragte nach dem beruflichen Werdegang Cordulas. Cordula sprach von ihrer Dissertation über Humperdincks Oper „Königskinder“. Er wusste allerlei über Humperdinck zu sagen, schwärmte von dessen „Abendsegen“ und dem „Engelreigen“, fragte nach Cordulas Sternzeichen und bestimmte dessen Aszendenten. Vera merkte wohl, dass sich hier zwei verwandte Seelen getroffen hatten. Sie beobachtete die beiden mit sichtlicher Genugtuung, wie ein Lehrer, der sich an dem Erfolg seiner Unterrichtsmethode ergötzt. Cordula gegenüber saß Cordulas Schwager Raymund. Er verfolgte argwöhnisch und mit eifersüchtigen Blicken die Sympathiebekundungen Helges gegenüber Cordula.
Seither waren nun drei Jahre vergangen. Seit Veras rundem Geburtstag hatte Cordula hin und wieder an Helges Seminaren teilgenommen. Einmal war Cordula zusammen mit Helge zum Mittagessen in Veras Wohnung in Bad Neuenahr eingeladen worden. Auf der gemeinsamen Zugfahrt bot Helge Cordula das „Du“ an. Im letzten Herbst besuchten Vera und Cordula gemeinsam die Schillertagung Helges in Weimar. An der Grabstätte Schillers lauschte Cordula ergriffen der Rede Helges, die sie so ins Herz traf, als sei der große Dichter eben erst verstorben.
***
An all das dachte Cordula beim Hören der Grieg-Musik. Jetzt erklang Solveigs Lied von Grieg auf dem Peer-Gynt-Text Ibsens. „Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehn …“, begann die weiche Altstimme und endete mit: „Ich will deiner harren, bis du mir nah, und harrest du dort oben, so treffen wir uns da!“ Mit einer auf „A“ gesungenen sehnsüchtigen Melodie, die sich in wiegenden Achtelpassagen erhob und zwischendurch in anhaltenden jubelnden Tönen verströmte, klang das Lied aus. Jetzt trafen sich die Blicke von Helge und Cordula und versanken still ineinander. Vera, die die ganze Zeit wasserfallartig über ihre Hilfsaktion für ein Waisenhaus in Rumänien geschwatzt hatte, bemerkte es kaum.
Am späten Nachmittag machte sich Vera mit Cordula auf den Weg ins Bergische Land. Hier wohnte Cordula in einem Fachwerkhaus abseits der Touristenattraktionen. Immer wenn Vera gemeinsam mit Cordula Helges Tagung in Bad Godesberg besuchte, machte sie diesen Abstecher, bevor sie zu ihrer Wohnung nach Bad Neuenahr fuhr.
Vera fuhr ein schwarzes Mercedes-Cabrio mit dunkelroten Ledersitzen. Der Wagen wirkte von innen wie von außen sehr gepflegt. Auf dem Rücksitz lag eine Tüte mit Kinderkleidung für das Waisenhaus in Rumänien, die sie in einem Kaufhaus billig erstanden hatte. Rechts neben ihr steckte in einem Behälter eine Flasche Wasser. Vera zog vor Beginn der Fahrt ihr schwarzes Jackett aus. Ihre kurzärmelige weiße Bluse kontrastierte angenehm zu den runden, vom Solarium gebräunten Armen. Sie klappte den Autospiegel auf und zog mit einem dunkelroten Lippenstift die schmalen Lippen nach, schnallte sich an und fuhr los.
„Ich fahre Landstraße, da können wir uns Zeit nehmen und noch was Privates erzählen“, sagte sie. „Ich meine, es ist höchste Zeit, dass du dich mal von deiner Familie löst!“, sprach sie in einem gouvernantenhaften Ton. „Nimm dir doch einfach eine Zweitwohnung in Düsseldorf, Geld hast du doch genug. Ich war 30, als ich mich selbstständig gemacht habe, 20 Jahre jünger, als du jetzt bist. Früher hat mich meine Mutter unterdrückt, dann mein Mann. Marius war zehn, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wer bin ich denn, nur im Alltag einer Ehe zu ersticken! Ich bin seitdem ein ganz anderer Mensch geworden. Auch durch Helge. Er ist wie ein geistiger Vater für mich. Du musst dich frei machen! Dann kannst du dich ganz anders entfalten, auch privat.“
Ihre Rede klang dramatisch, vor allem dadurch, dass sie jeweils die letzten Worte der Sätze mit betontem Nachdruck und etwas gedehnt sprach.
Cordula ließ stumm die nicht enden wollenden Ratschläge über sich ergehen und beobachtete etwas ängstlich die hektische Fahrweise Veras. Diese kannte die Landstraßenstrecke nach Wuppertal nicht und fuhr mehr oder weniger aufs Geratewohl. Sie wendete häufig mit quietschenden Reifen, wenn sie an einem Hinweisschild erkannte, dass sie die falsche Strecke gefahren war. Cordula kannte diese Strecke auch nicht, sie besaß zwar den Führerschein und fuhr auch sehr gerne ihren dunkelblauen BMW, aber sie unternahm Autofahrten nur in ihrer näheren Umgebung. Zur Musikhochschule nach Köln fuhr sie immer mit dem Zug. Da konnte sie ungestört lesen und träumen.
Vera schwieg einen Augenblick. Cordula dachte über die wechselvollen Ereignisse in Veras Leben nach, von denen sie ihr seit ihrem Kennenlernen im gemeinsamen Bibelgesprächskreis erzählt hatte. Nach einer kaufmännischen Lehre im Schuhgeschäft ihrer Eltern arbeitete sie bei verschiedenen Firmen als „Disponentin“. Cordula wusste nicht genau, worin diese Tätigkeit bestand. Einmal wurde sie an der Rezeption eines vornehmen Seniorenheimes eingesetzt. Nach ihrer Scheidung war sie ein Jahr lang in psychotherapeutischer Behandlung. Danach war sie als private Lebensberaterin tätig. In verschiedenen Wohltätigkeitsvereinen wirkte sie aktiv mit. Und dann die vielen Seminare, die sie besuchte: Kalligrafie- und Grafologieseminare, Schreibwerkstätten, Literatur- und Theologieseminare. In vielfältigen Begegnungen erwarb sie eine große Menschenkenntnis. Sie war äußerlich attraktiv, stets exzellent gekleidet und frisiert, war beredt und hatte ein gewandtes Auftreten. Cordula hätte sich Vera gut als Empfangsdame eines großen Hotels vorstellen können, aber dafür fehlten ihr offenbar die notwendigen Ausbildungszertifikate.
„Nun sag doch mal was!“, hämmerte Vera auf Cordula ein.
„Ja, ich müsste ja dann auch ein Klavier in Düsseldorf haben“, sagte Cordula zögerlich.
2
Sie hatten nun ihr Ziel erreicht. Vera parkte ihren Wagen an der Scheune neben dem Fachwerkhaus Cordulas. Es war Abend geworden und die Luft war frostig. Über der Scheune leuchtete der Abendstern. Darüber wölbte sich die feine Sichel des Mondes. Cordula dachte an die Tagung, an Hebbels Worte vom „wunderbaren Walten“ „über den Gestalten“, vom Geist, der alles lenkt und „Menschen … wie Fackeln brennen“ lässt. Die Verse klangen ihr noch in den Ohren. Helges weiche und doch feste Stimme hatte sie wie auf Schwingen in ihre Seele getragen. Dazu mischten sich die Klänge von Solveigs Lied und der Blick Helges. Beim Abschied hatte er sie leicht an sich gedrückt.
Cordula ging zum Fachwerkhaus. Es war klein und schief mit einer großen Tanne davor. Hier wohnte Cordula seit ihrer Geburt. Ihre Schwester hatte mit ihrem Mann nebenan ein Haus gebaut. Cordula schloss die Haustür auf und stellte den Koffer in den Flur. Dann ging sie mit Vera zum Haus ihrer Schwester. Hier wurden sie schon erwartet. Cordulas Schwager Raymund, ein kleiner untersetzter Mann mit großem Kopf und lebhaften braunen Augen, lief den beiden entgegen.
„Ihr kommt aber spät!“, rief er und half Cordula aus dem Mantel.
„Wir haben mit dem Kaffee auf euch gewartet!“, ergänzte Cordulas Schwester Hannelore in vorwurfsvollem Ton. Der Hund wuselte um Cordula herum.
„Cora, mein Herz“, sagte sie und strich ihm über das schwarzseidene dichte Fell. Als Hannelore die Haustür schließen wollte, flutschte noch schnell eine weiße Katze durch den Türspalt. Sie schmiegte sich an Cordulas Beine und rieb sich das Köpfchen.
„Ach, die Lola“, sagte Cordula.
Sie gingen ins Wohnzimmer und nahmen in der Kaminecke Platz. Raymund blieb zurück, um Kaffee zu kochen. Auf dem Tisch stand ein selbst gebackener Kuchen. Cordula blickte in den weiten Raum, in den die Kaminecke überging. Er war jetzt von Licht überflutet. Am Fenster zu ihrer Linken war ein illuminiertes Reh mit einem Nikolausschlitten dahinter angebracht. Vom Nebenfenster leuchtete ein Stern mit einem Schweif. Schräg darunter, in der Fensterbankecke, erstrahlte eine Kapelle aus Glas in hellstem farbigen Licht. Am nächsten Fenster hing eine Lichterkette aus lauter fünfzackigen Sternen. Auf dem großen Tisch des Wohnzimmers stand eine mehrstufige gusseiserne Pyramide mit 25 brennenden weißen Teelichtern und mitten im Wohnzimmer stand ein bunt geschmückter Tannenbaum.
Den schönsten Anblick boten jedoch die Tür zum Wintergarten und die vielen Glasscheiben des Wintergartens. In der großen Scheibe der Tür spiegelte sich der Tannenbaum mit seinen vielen erleuchteten Lichterketten. Er spiegelte sich auch in der Scheibe des Wintergartens. Diese warf das Spiegelbild zurück an die Scheibe der Tür. Hin und her ging das Licht. Eine ins Unendliche gehende Kette von immer kleiner werdenden Weihnachtsbäumen bildete sich ab in den Scheiben des Wintergartens. Cordulas Blick verlor sich in dieser Unendlichkeit. Dann schweifte er ab zur Fensterbank.
Dort, neben einer großen, weißen sitzenden Porzellankatze, hatte Lola auf den durch die Heizung erwärmten Marmorplatten Platz genommen. Ihr Köpfchen hatte sie auf die gekrümmte Vorderpfote gelegt und blinzelte durch die fast verschlossenen Lider. Die Hinterbeine lagen über Kreuz und der Schwanz hing lang an der Fensterbank herunter.
„Sieh mal, die Lola“, sagte Cordula zu Vera, „so hat Raymund sie noch nie gemalt!“ Vera nickte. Ihr Blick richtete sich auf die vielen Dinge, die auf den Fensterbänken lagen und standen: Muscheln, verschiedene Nikoläuse, zwei Porzellanenten und zwei Clowns, ein Samowar, Blumentöpfe, ein kleines Spinnrad aus Holz, ein niedliches Parfümfläschchen und vieles andere mehr. Unruhig gingen ihre Augen hin und her und ihre schmalen Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. Hannelore redete unentwegt von kuriosen Ferienerlebnissen und bot ihren Gästen immer wieder Kuchen an. Raymund goss Kaffee ein, lächelte und schwieg.
„Jetzt muss ich aber fahren“, sagte Vera, sprang auf, verabschiedete sich mit flüchtigen Wangenküsschen, lief behände den Gartenweg hinunter, wendete ihren Wagen und fuhr los. Cordula, Hannelore und Raymund standen im Haustürrahmen und winkten hinterher.
‚Wie sie dasteht‘, dachte Vera, ‚völlig unter dem Pantoffel von den beiden. Die ältere Schwester dominiert und schikaniert sie und Raymund vergöttert sie und trägt sie auf Händen, nur damit sie bleibt und ihm das Leben mit der zänkischen Schwester erträglich macht.‘
***
Zwei Tage waren vergangen seit Helges Hebbel-Tagung. Seitdem hatte es ununterbrochen geschneit. Cordula fuhr die Höhenthaler Straße entlang. Dicht wirbelten die Flocken im Scheinwerferlicht. Kaum ein Auto war unterwegs. Cordula fuhr auf den Hof eines großen, frei stehenden alten Backsteingebäudes, dessen Silhouette in dem dämmrigen Schneegestöber nur schwer erkennbar war. In einigen Räumen des ersten Stockwerks brannte Licht. Dort probten die Schauspieler und Sänger der Volksbühne Höhenthal. Die Fenster im Giebel des Hauses waren ebenfalls erleuchtet. Die alte Hausmeisterin mit ihrem unverheirateten Sohn wohnte in diesem Gebäudeteil. Im Erdgeschoss waren die Räume des DRK. Hier brannte nirgends Licht.
In einem dieser DRK-Räume probte Cordula einmal im Monat mit ihren „Höhenthaler Lerchen“. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, deutsche Volkslieder vor dem Untergang zu bewahren. Rund 40 Frauen, überwiegend über 30 Jahre alt, kamen hier regelmäßig zusammen und sangen mit Begeisterung „All mein Gedanken, die ich hab, die sind bei dir“ und anderes. Bei Höhenthaler Volksfesten wurden diese Lieder vorgetragen.
Cordula war wegen des heftigen Schneefalls früh losgefahren. Nun hatte sie noch reichlich Zeit bis zum Probenbeginn um 20 Uhr. Sie stellte in aller Ruhe ihren Notenständer auf und sortierte die Lieder, die sie an diesem Abend singen wollte. Dann nahm sie in dem kargen Raum Platz. Es war die Altentagesstätte des DRK Höhenthal: 24 mit holzfarbenem Kunststoff beschichtete Tische standen hier in Gruppen mit Stühlen davor. Auf die Tische hatte man kleine Glasvasen mit künstlichen Blumen gestellt. An den Wänden hingen Fotos von historischen und aktuellen Ansichten der Stadt Wuppertal und Fotos von DRK-Festen, die in den letzten 20 Jahren hier im Haus und rund um das Haus stattfanden. Cordulas Schwester Hannelore, die als Helferin beim DRK arbeitete, war auch auf verschiedenen Bildern zu verschiedenen Zeiten abgebildet.
Cordulas Blick ging nun zu den Fenstern. Es waren noch dieselben wie vor 40 Jahren: schmal und hoch, mit Rundbögen und mit jeweils vier Sprossen pro Fensterflügel. Unter den Fensterbänken standen auch damals schon die Rippenheizungen. Das Gebäude war etwa 150 Jahre alt und ehemals die „Evangelische Grundschule Höhenthal“, die Cordula von der ersten bis zur vierten Klasse besuchte. Und genau dieser Raum war damals ihr Klassenraum. Etwa dort, wo sie jetzt saß, hatte sie gesessen. Auf einer zweisitzigen Holzbank mit einem Holztisch daran. Die Tischplatte war abgeschrägt. Vorne war eine Vertiefung für das Schreibwerkzeug, rechts daneben war ein Loch. Vor langer Zeit steckte wohl ein Tintenfässchen darin. Die Bänke mit den Tischen standen in Dreierreihen exakt hintereinander. Vorne links stand auf einem Podest das Lehrerpult. Cordula erinnerte sich an eine Rechenstunde, die 40 Jahre zurücklag:
Voll Freude wartete sie auf ihren Lieblingslehrer, Lehrer Tannenberg, ein großer, schlanker Mann mit einem fröhlichen Gesicht. Die Schulglocke klingelte zum Unterrichtsbeginn. Es war Punkt acht. Die Klassentür wurde geöffnet, das Raunen der Kinder verstummte und alle standen auf. Mit federnden Schritten, eine Mappe unter dem Arm haltend, ging der Lehrer an der rechten Bankreihe entlang und dann vorne an Cordula vorbei bis zum Pult. „Guten Morgen, Herr Lehrer Tannenberg“, ertönte es im Chor. „Guten Morgen, Kinder“, antwortete der Lehrer und legte die Mappe auf das Pult. Er stellte den Kindern Rechenaufgaben, zuerst leichte, dann immer schwierigere, bis sie zum Schluss keiner mehr lösen konnte. Alle bemerkten beschämt, dass sie an ihre Grenzen gestoßen waren. Nur der Lehrer wusste die Antwort und Cordula bewunderte ihn.
Dann erinnerte er die Kinder daran, dass sie in ihr Rechenheft parallele Linien gezeichnet hatten und den Abstand zwischen ihnen an verschiedenen Stellen gemessen hatten. Er nahm nun das Demonstrationslineal in die Hand und zog mit Kreide zwei parallele Linien an die Rechentafel. Dann sagte er, dass zwei exakt parallele Linien sich im Endlichen nie schneiden können. „Sie laufen immer weiter bis in die Un-end-lich-keit“, sagte er in geheimnisvollem Ton, und seine Augen leuchteten.
Cordula starrte auf die beiden Linien und versuchte sich vorzustellen, wie sie über den Tafelrand hinaus weiterliefen, immer weiter, immer mit gleichem Abstand zueinander. Der Lehrer nannte den Raum „Endlichkeit“, in den sie hineinliefen. Und die Unendlichkeit? Wo begann sie? Wo hörte sie auf? Cordula ahnte, dass sie etwas ganz anderes sein musste, etwas Unbegreifliches, von dem aber eine große Anziehungskraft ausging, ein heimliches Leuchten. Cordula liebte den Lehrer Tannenberg. Sie liebte seine Augen, die so strahlten, wenn er von geheimnisvollen Dingen sprach.
Und überall machte sie sich auf die Suche nach diesem Geheimnisvollen, diesem Unbegreiflichen. Sie entdeckte es in dem bunten Schmetterling, der sich aus der unscheinbaren Puppe befreite und davonflog, in der varian-tenreichen Symmetrie der Schneekristalle, in Jesus, der übers Wasser lief. Als sie älter wurde, dachte sie, in der ganz großen, ewigen Liebe müsse sich doch der geheimnisvolle Grund der Welt in reinster Form offenbaren, und sie sehnte sich nach diesem Erlebnis der ganz großen Liebe.
Die Tür ging auf und zwei Höhenthaler „Lerchen“ traten ein. Jäh wurde Cordula aus ihren Träumen gerissen. Sie sprang auf und begrüßte die beiden. „Wir sind zu Fuß gekommen wegen des Wetters“, sagte die eine. „Ich habe nämlich keine Winterreifen“, ergänzte die andere. Nach und nach trudelten alle ein. Eine junge Frau, Mitte 30, war hocherfreut über das Wetter: „Klasse! Da kann am Wochenende die ganze Familie rodeln!“ Cordula probte für das Höhentaler Frühlingsfest. Es war merkwürdig, mitten im Winter Lieder zu singen wie „Alle Vögel sind schon da“ und „Der Winter ist vorüber“. Die Probe verlief erfreulich. Als Cordula die Haustür abschloss, bemerkte sie, dass die Luft milder geworden war. Sie stapfte durch den Schnee, der nun nicht mehr so knirschte. Als sie ihr Auto startete, ging ihr die zweite Strophe des Liedes „Der Winter ist vorüber“ durch den Kopf: „Die Schöne hinterm Fenster schaut sich die Augen aus und hofft, dass ihr der Kuckuck den Liebsten bringt ins Haus.“
***
Noch in derselben Nacht setzte Tauwetter ein. Am anderen Morgen war die weiße Pracht des Vortages in unansehnlich grauen Schneematsch verwandelt. Am Nachmittag waren die Straßen frei. Da kam Vera überraschend bei Cordula hereingeschneit. Cordula sah durch die kleinen Fensterscheiben, wie sie leichtfüßig auf das Fachwerkhaus zuschritt, schick wie immer: gekleidet in ein gut sitzendes graues Kostüm, einen plissierten lila Schal um die Schultern drapiert.
„Hallöchen“, sagte sie und gab Cordula einen Wangenkuss. „Na, hast du dich erholt von Helges Seminar?“ Sie grinste versteckt.
„Es war doch schön“, antwortete Cordula.
„Ja, er ist ja unübertroffen. Ich war ja schon zweimal in einem Hebbel-Seminar bei ihm, beim ersten habe ich ihn kennengelernt. Das ist jetzt schon – warte mal – ja, vor 15 Jahren war das. Seitdem sind wir befreundet, was heißt befreundet, er ist wie ein Bruder für mich, aber ich bin ihm nicht intelligent genug.“ Sie blickte auf die vielen Blätter mit handgeschriebenen Noten, die auf dem Tisch lagen.
„Was ist das?“, fragte sie.
„Ein Singspiel für Weihnachten, für Soli, Chor und Klavier. Dieses Jahr Weihnachten wird es in Höhental uraufgeführt“, sagte Cordula zögerlich.
„Was du alles machst!“, wunderte sich Vera.
Hier hatte Vera einen empfindlichen Nerv getroffen. Cordula wollte nicht, dass sie in irgendeiner Weise über Vera stand. Sie glaubte, das würde ihrer Freundschaft schaden. Sie überhäufte nun Vera mit allerlei Komplimenten zu ihrer Kleidung und ihrer Figur.
„Nein, so ist es ja nun nicht, ich habe auch meine Problemzonen und muss einiges korrigieren. Mein Busen ist zu klein“, meinte Vera, und ehe sich Cordula versah, stand Vera mit entblößtem Oberkörper da. Es stimmte schon, Veras Brust war klein, jedoch fest und mit einem gleichmäßig gefärbten dunkelbraunen Warzenhof. Sie hatte eine knabenhafte Figur, die auch zu ihrem Wesen passte. Cordula war etwas verlegen geworden und Vera kleidete sich wieder an. Sie zupfte Cordula ein wenig an der Bluse und strich ihr eine blonde Strähne aus dem Gesicht.
„Du könntest auch noch mehr aus dir machen“, sagte sie fürsorglich.
Dann nahm sie wieder Platz und kramte in ihrer Tasche. Sie holte Fotos hervor.
„Sieh mal, ist das nicht schön geworden?“, fragte sie und zeigte das Foto, das sie im Keller der „Himmelspforte‘“ von Helge und Cordula gemacht hatte. „Ist doch ein schönes Paar“, sagte sie, sah Cordula an und lächelte.
„Ach, wie schön!“, rief Cordula aus und vertiefte sich schmunzelnd in das Bild.
„Ja, ehrlich, ich finde, ihr passt sehr gut zusammen. So eine Frau, wie du es bist, hat sich Helge immer gewünscht: Du siehst gut aus, bist lieb, Pädagogin, interessierst dich für Musik, für Literatur und für Philosophie. Da stimmt doch alles!“
Dann zeigte Vera noch andere Fotos.
„Ich hab Hochzeitsbilder von unserem Marius dabei“, sagte sie und legte einige Fotos auf den Tisch. Auf ihnen war inmitten etlicher anderer Personen ein sehr gut aussehendes Brautpaar abgebildet: ein großer, stattlicher Mann mit schwarzem Haarschopf und eine kleine, zierliche Frau mit fein geschnittenem Gesicht und großen dunklen Augen. Im langen schwarzen Haar trug sie eine weiße Orchidee.
„Eine schöne Braut“, sagte Cordula.
„Eine Inderin“, erwiderte Vera. Cordula suchte nun unter den Hochzeitsgästen nach Vera.
„Ich bin nicht drauf. Ich war nicht eingeladen. Die Fotos hat eine Bekannte von mir gemacht“, sagte Vera.
Marius war Veras Sohn. Er war 30 Jahre alt und schon ein angesehener Physikprofessor, der im Internet mit einer Menge von Veröffentlichungen zu finden war. Mit 23 Jahren hat sie ihn zur Welt gebracht. Zehn Jahre später, als sie sich selbst verwirklichen wollte und die Scheidung einreichte, ehelichte Veras abgelegter Mann, ein gut situierter Kaufmann, eine Frau, die einen elfjährigen Sohn hatte. Die beiden Jungen wuchsen nun auf wie Brüder. Seit seinem 18. Lebensjahr hatte Marius keinerlei Kontakt mehr zu seiner leiblichen Mutter.
Cordula hielt die Fotos still in den Händen und dachte daran, wie schmerzlich es doch sein musste, mehr als zehn Jahre lang keine Verbindung zu seinem Kind zu haben und vom wichtigsten Tag seines Lebens ausgeschlossen zu sein. Sie erinnerte sich daran, wie Vera einmal weinend zur Tür des Seminarraumes hinausstürzte, als Helge einmal ein Gedicht über eine von Liebe erfüllte Mutter-Kind-Beziehung rezitierte. Ein Hauch von Trauer überflog Cordulas Gesicht.
Vera nahm ihr die Fotos aus der Hand, steckte sie in einen Umschlag und breitete Fotos von ihrem derzeitigen Freund aus. Ein verheirateter Mann, dessen Ehe Vera retten wollte.
„Du siehst ihm das doch an, dass er diesen endlosen Stress mit seiner Frau hat. Die müssen sich mal aussprechen, das geht doch nicht! Die will den einfach loswerden und vor die Tür setzen. Dann will er auch noch bei mir einziehen. Das will ich natürlich auch nicht. Stell dir mal vor, was das für mich bedeutet!“
Vera hatte zuvor manchen Freund, aber etwas Ernstes war nicht dabei. Einmal hatte sie sich sehr verliebt in einen Don-Juan-Typen. Wenn er von seinen Abenteuern zurückkam, hat sie ihn immer wieder aufgenommen, sobald er seinen Spruch sagte: „Du bist doch die Beste!“
„Weißt du, das tut so weh, wenn man in der Liebe enttäuscht wird, deshalb habe ich mir vorgenommen, jeden Körperkontakt zu meiden, und wenn es nur die leiseste Berührung ist. Schon beim Händeschütteln muss man aufpassen“, hatte sie mal zu Cordula gesagt. Wenn der Mann nun reich wäre und sie sich eine Haushaltshilfe leisten könnte, würde man ja eine Ausnahme machen; hier, im vornehmen Kurort Bad Neuenahr, wo sie vor fünf Jahren hingezogen war, könnte man ja vielleicht einem solchen Mann begegnen, dachte sie. Aber bisher war die Suche erfolglos.
Cordula hatte Kaffee gekocht, Raymund und Hannelore kamen vom Nachbarhaus mit einem Rest selbst gebackener Weihnachtsplätzchen hinzu und die vier plauderten noch ein Weilchen. Dann fuhr Vera nach Hause.
***
Es war an einem Mittwoch. Der Mittwoch war für Cordula ein vorlesungsfreier Tag. Da fuhr sie nicht nach Köln zur Musikhochschule, sondern arbeitete zu Hause. Sie saß in einem weinroten samtenen Hausanzug am Klavier und übte. Das Foto von Helge und ihr, das Vera ihr geschenkt hatte, stand seit sieben Tagen, seit Veras Besuch, auf ihrem Klavier. Es lehnte gegen zwei barocke Meißner Porzellanengel, die jeweils ein goldenes Band hoch in der Hand hielten, der eine Engel in der rechten, der andere in der linken. Die Engelchen saßen auf einem mit goldenem Rand verzierten Podest. Das Band war jeweils um ihre Körper geschlungen. Cordula hatte sie so gestellt, dass sie sich anschauten.
Auf dem Klavier standen noch einige andere Porzellanfiguren: eine „Lesende“, die auf einem Baumstumpf saß, ein Junge in Schuluniform mit einer Tasche unter dem Arm und ein Mädchen mit einem Milchkrug in der Hand, das gerade dabei war, einer Katze, die ihr zu Füßen saß, Milch in einen Napf zu füllen. Neben einem Bild von Cordulas Eltern, das von einem reich verzierten Messingrahmen eingefasst war, standen zwei 15 Zentimeter hohe griechische Statuen aus Alabaster, die sich anschauten. Daneben stand ein Pelikan aus Porzellan inmitten einer Schar kleinerer Vögel. Quer über das Klavier lag eine künstliche rote Rose. All dies stand und lag vor einem Bild von Claude Monet, das hinter dem Klavier an der Wand hing – die Darstellung eines breiten Flusses: Rosa und hellblau getünchte Häuser mit hellgrauen, dunkelgrauen und roten Dächern säumten die Ufer, dazwischen Trauerweiden. In wechselvollem Farbenspiel waberten die Wellen dem Morgenlicht entgegen.
Cordula übte seit zwei Stunden Klavier. Jetzt stand sie auf und ging zum Fenster. Draußen war es trüb und regnerisch. Auf der Wiese vor dem Fachwerkhaus Cordulas lagen noch einige Schneereste. Dazwischen vergilbtes Gras. Daraus ragten vereinzelt die dunkelgrünen Blattspitzen der Schneeglöckchen. Sie ging zu ihrem Hund, der neben der Heizung lag.
„Cora, mein Schatz“, sagte sie und betrachtete das glänzende Fell des Hundes. Er hatte die Färbung eines Dobermanns: tiefschwarz mit braunen Pfoten und ein paar braun-weißen Flecken an Schnauze und Brust. Über den Augen, die jetzt geschlossen waren, war jeweils ein kleiner ovaler hellbrauner Fleck.
Cordula strich Cora sanft mit zwei Fingern über den Kopf, von der Schnauze ausgehend, zwischen den Augen bis zum Ende der Stirn, der Rille folgend, die hier war. Cora schlug die blauen Augen auf und blickte Cordula an. Geheimnisvoll leuchtete das strahlende, marmorierte Blau der Iris im schwarzen Fell. Die schwarzen Pupillen waren genau auf ihre Pupillen gerichtet. Was mochte in der Seele des Tieres vor sich gehen? Cordula wünschte sich sehnlichst, nur einmal mit der Seele des Hundes die Welt zu erleben. Sie kraulte Cora die Brust. Das Tier schloss die Lider bis auf einen schmalen Spalt und fuhr kurz mit der Zunge über Cordulas Arm. Cordula ging zum Klavier zurück.
Jetzt wollte sie mit den Vorbereitungen für ein Grieg-Konzert beginnen. Gerade spielte sie „An den Frühling“. Mit weichem Anschlag intonierte sie mit der rechten Hand die einleitenden Fis-Dur-Dreiklänge. Wie helle Farbtupfer muteten sie an. Den Klängen folgten andere Dur-und Moll-Dreiklänge, eine Farbe reihte sich an die andere: Ein bunter Farbteppich in hellen Pastellfarben breitete sich aus. Darunter entfaltete sich eine sehnsüchtig schwelgende Melodie. Cordulas Finger der linken Hand ließen sie an- und abschwellen. Die rechte Hand, die die Farbtupfer erzeugte, folgte dieser Dynamik. ‚Frühlingserwachen in Klängen‘, dachte Cordula.
Im Mittelteil des Klavierstückes setzte sich die Melodie im Bass fort. In den Klangteppich wurden dunklere Farben eingewebt. In Verkürzungen und Modulationen der Motive türmten sich dann emphatische Steigerungen auf: Ein Drängen und Wachsen ließ die Natur zur Entfaltung kommen. Cordula folgte durch dynamische Steigerung und Tempobeschleunigung den Erfordernissen der Komposition. Dann kam die letzte Steigerung: In rauschenden Arpeggien stürmten nun die Dreiklänge dahin, übertönt von der stetig dahinfließenden Melodie, die in höchste Höhen getragen wurde, bis zum höchsten Ais: Das Leben hat den Sieg davongetragen, überall breitete sich die Natur in ihrer ganzen Fülle aus.
Am Schluss endete alles in einem weit auseinandergezogenen arpeggierten Fis-Dur-Dreiklang, der zwischen seinen beiden Grundtönen ruhte. Die Grundtonart war wieder erreicht. Cordula intonierte den Dreiklang hauchzart. Es war derselbe Dreiklang wie zu Beginn des Stückes. ‚Es ist wie mit dem Grund des Seins‘, dachte sie, ‚aus ihm entfaltet sich alles und zu ihm kehrt alles wieder zurück.‘
***
Cordula fühlte nun eine leichte Erschöpfung und wollte sich bei irgendeiner anderen Tätigkeit erholen. Sie stand auf. Da fiel ihr Blick auf das Foto von ihr und Helge, das an die beiden barocken Engelchen gelehnt war. Sie nahm es in die Hand. Vera hatte die Rückseite beschriftet: „Helge und Cordula im Keller der ‚Himmelspforte‘“, stand darauf. Am 6.1.2008 hatte Cordula Helge zum letzten Mal gesehen; seitdem hatte sie nichts von ihm gehört. Kein Brief, kein Anruf. Sein Blick, der sie beim Hören von Griegs „Solveigs Lied“ traf und sie so beflügelt hatte, war wohl bedeutungslos gewesen. Die Hoffnung auf eine ganz große Liebe, wo Geist, Seele und Körper im Du verschmelzen, wo die Pforte des Himmels berührt wird, schien nicht in Erfüllung zu gehen. Sie wollte das Bild, das zum Fetisch einer offenbar unstillbaren Sehnsucht geworden war, begraben und mit ihm ihre ganze Hoffnung darauf, den Himmel noch irgendwann auf der Erde zu erleben. ‚In diesem Jahr werde ich 50‘, dachte sie, ‚da wäre es albern, noch an die ganz große Liebe zu glauben.‘
Sie holte aus ihrem antiken Nussbaumschrank den großen Schuhkarton heraus mit all den ihr wichtigen Erinnerungen darin, Bilder und Briefe aus vergangenen Zeiten, von ihren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, Schwester und Schwager, Freundinnen und Freunden und von ihren Geliebten. Briefe und Fotos der Letzteren hatte sie gesondert in einem Umschlag aufbewahrt. Sie zögerte, das Foto von Helge und ihr dazuzustecken, schließlich war bisher nur eine Freundschaft zwischen ihnen und nur zuletzt eine Riesenhoffnung auf ihrer Seite. Also legte sie es erst mal auf den Tisch. Es überkam sie dann eine Lust, all die Briefe und Bilder zu durchstöbern, die in diesem gesonderten Umschlag waren.
Zunächst fiel ihr ein Brief von Hans in die Hände. Hans war Nervenarzt und wohnte in der Nachbarschaft Cordulas. Seine Praxis hatte er in Köln. Als Cordula kurz vor dem Abitur stand und sie die Befürchtung hatte, in Prüfungsangst zu fallen, empfahl ihr ihre Mutter, sie solle doch mal die Praxis des benachbarten Nervenarztes aufsuchen. Dieser könne ihr doch ein Beruhigungsmittel verschreiben. Aus dem geplanten einmaligen Besuch wurde eine „Dauerbehandlung“, die zunächst im gemeinsamen Hören von Musik und Gesprächen über Musik bestand. Hans hatte ein Klavier in seiner Praxis und Cordula spielte manchmal darauf. Er führte ihr auch seine Platten vor. Er schloss beim Hören die Augen und versenkte sich ganz in die Musik. Nur hin und wieder schaute er Cordula verstohlen an. Nach dem Hören erzählte er allerlei aus dem Leben des Komponisten und von der Entstehungsgeschichte des Werkes. Er wusste sehr viel und Cordula verehrte ihn.
Als Cordula in der Kölner Musikhochschule studierte und in einer Studentenbude wohnte, schrieb er ihr Briefe. Aus dieser Zeit stammte dieser Brief. „Dusie“ nannte er sie darin und auch „Asterkind“. Immer wieder andere Blumennamen fielen ihm in diesen Briefen ein. Die Unterschrift war stets unleserlich geschrieben. Es waren Briefe voller Verehrung und Erotik. Täglich kamen sie an und Sträuße von Rosen, Lilien und Astern. Der Hauswirt, der sie Cordula überreichte, wenn sie abends von der Musikhochschule kam, sagte dann meist mürrisch: „Hier, von Ihrem Verehrer!“ Cordula empfand das Verhältnis zum Teil abenteuerlich und zum Teil erniedrigend. Sie genoss seine Verehrung und fürchtete seine Demütigung. Er war ein verheirateter Mann mit vier Kindern und immer wusste sie, dass seine Ehe und Familie ihm heilig waren. Sie redeten sich nie mit Namen an. Die Koseworte der Briefe wurden im Umgang miteinander nie ausgesprochen. Nie hatte er sie geküsst.
Nach ihrem Musikstudium wohnte Cordula wieder in Wuppertal und es war nicht mehr möglich, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Cordula war 22 Jahre alt, als das Verhältnis zu diesem Nervenarzt zerbrach. Sie hatte nun ihr Konzertexamen und gab auch mit Erfolg schon im ersten Halbjahr nach ihrem Examen einige Klavierkonzerte. „Begabte Pianistin voll auf Romantik eingestimmt“, „Romantisches Schwelgen“, „Seelenvolle Schumann-Interpretin“ waren Schlagzeilen der Rezensenten.
Trotz ihrer Begeisterung für das Klavierspielen verspürte Cordula ein starkes Verlangen, Philosophie, Pädagogik und Musikwissenschaft zu studieren. Sie immatrikulierte sich an der Uni Frankfurt.
Aus dieser Zeit stammte das Foto, das sie jetzt aus dem großen Briefumschlag zog. Es zeigte sie mit Bernd vor einer Kirmesbude in Frankfurt. Sie trug eine fast durchsichtige weiße Bluse, die schlanken Beine kaum bedeckt von einem blauen Minirock. Das lange blonde Haar war seitlich mit einer Blütenspange zusammengerafft. Er hatte ihr ein Herz mit der zuckrigen Aufschrift „Ich liebe Dich“ umgehängt und sie lachte und strahlte ihn mit ihren großen blauen Augen an, einen Mann, an dem sie heute vorübergegangen wäre. Er hatte ein kräftiges Kinn und starre graue Augen. Er stand da in Schaufensterpuppenpose und bleckte die Zähne.
Kurz zuvor hatte er seine Antrittsvorlesung als Romanistikprofessor gehalten und war damals mit 32 Jahren der jüngste Professor der Uni. Es war seine Redegewandtheit, die Cordula fasziniert hatte, als sie ihm in der Mensa begegnet war. Er nahm sie mit in seine Wohnung, eine Zweizimmerwohnung mit Küche, Diele, Bad. Das Wohnzimmer war dürftig möbliert mit einem Tisch und zwei Stühlen, einer schäbigen Couch und einer mit Büchern vollgepfropften Stellwand. Sie führten viele geistreiche Gespräche, und sie schliefen miteinander. Sie liebte ihn leidenschaftlich.
Sie merkte nicht, dass sein Herz starr war wie seine Augen und seine Liebesworte nichtssagend wie Aufschriften auf Lebkuchenherzen. Nach einem Jahr eröffnete er ihr, dass er in seinem Leben wohl mehr als hundert Frauen „besessen“ und ihm keine etwas Besonderes bedeutet habe. Er ließe sich nach São Paulo berufen, weil man dort als Professor bei Weitem nicht so viel arbeiten müsse wie in Deutschland; dort sei auch immer schönes Wetter und Frauen gebe es wie Sand am Meer. Noch fünf Jahre danach hielt dieser Mann Cordulas Seele gefangen.
Dann lernte sie einen gleichaltrigen Chemiker kennen. Vier Briefe hatte er ihr in den acht Jahren ihres Zusammenseins geschrieben. Einen davon hatte sie aufbewahrt. Diesen hielt sie jetzt in den Händen. Eine spitze, magere Schrift hatte er. Das „C“ von Cordula sah fast aus wie ein kleines „l“. Er nannte sie nur „Cordula“ in den Briefen. Auch im Umgang miteinander sprach er sie nie mit Kosenamen an. Dies entsprach ganz seinem nüchternen Naturell. Er war ihr ein gesprächiger, heiterer und friedliebender Freund und sie verbrachte mit ihm eine ruhige Zeit. Politik und zweckmäßig konstruierte Häuser waren seine einzige Leidenschaft. Cordula trennte sich von ihm, als er wiederholt auf Heirat drängte. Sie fürchtete, mit ihm zusammen an Langeweile zu ersticken.
Als Cordula den nächsten Brief ergriff, hörte sie den Briefkasten klappern. Sie ließ den Brief fallen und sprang vor die Tür, noch bevor der Briefträger die Post in den Kasten geworfen hatte. Der Postbote überreichte ihr eine Karte. Sie sah es sofort an der Schrift: Die Karte hatte Helge geschrieben: Buchstaben, die zu tanzen schienen. Sie hatte Mühe, sie zu Wörtern zusammenzulesen. Es war ein verspäteter Neujahrswunsch. Ein Wunsch, den er bereits Anfang Januar, nach seiner Tagung, ihr gegenüber ausgesprochen hatte. Ganz klein geschrieben war da noch ein Zusatz, am Rand, quer zum übrigen Schriftbild. Cordula konnte ihn kaum entziffern. Sie nahm die Lupe zu Hilfe. „Höre gerade Solveigs Lied von Grieg“, stand da geschrieben. ‚Er denkt an mein Lieblingslied, er denkt an unsere Blicke‘, fuhr es Cordula durch die Seele.
Sie wendete die Karte, und was sie sah, verschlug ihr den Atem: Sie erblickte die Silhouette der Basilika „Vierzehnheiligen“ vor dem Hintergrund der Morgenröte. Ausgehend von der hellen Lichtquelle im Osten dehnte sich das Rot über den ganzen Himmel aus. Mitten in das Leuchten hinein ragte hinter dem Dachfirst emporsteigend die Silhouette eines Heiligen oder Engels. Den rechten Arm mit dem weisenden Zeigefinger hatte er gen Himmel erhoben. ‚Er sieht ganz so aus wie einer meiner barocken Engel auf meinem Klavier‘, dachte Cordula. Da las sie, was mit dunkelroter Schrift in die Morgenröte geschrieben stand:
DINGE ZU PLANEN IST SACHE DES MENSCHEN, DINGE ZU VOLLENDEN IST SACHE DES HIMMELS.
Eine große Bescheidenheit lag in diesen Worten: All unser Tun ist nur begrenzt, ist Planung und Stückwerk; Vollendung ist Sehnsucht und Hoffnung, ein Geschenk des Himmels. ‚So ist es auch mit der Liebe‘, dachte Cordula. ‚Die Liebe: ein Geschenk des Himmels! Das größte Geschenk! Es ist eine heimliche Liebeserklärung!‘ Davon war sie überzeugt. Die Karte machte sie glücklich. Sie fühlte eine Seelenverwandtschaft mit Helge. Das Foto von ihr und Helge begrub sie nicht in dem alten Schuhkarton. Sie stellte es wieder zwischen die beiden Porzellanengel, die ihre Hand zum Himmel erhoben. Die Karte von „Vierzehnheiligen“ legte sie davor.
3
Am darauffolgenden Tag hatte Cordula Vorlesungen und Seminare an der Musikhochschule Köln abzuhalten. Sie hatte ihre Stunden auf drei Wochentage verteilt: Montag, Dienstag und Donnerstag. Morgens lehrte sie jeweils Pädagogik und nachmittags Musikalische Formenlehre und Klavierdidaktik und -methodik. Ihre Studenten waren angehende Klavierpädagoginnen und -pädagogen. Einige besonders Begabte begleitete sie bis zum Konzertexamen.
Es war neun Uhr. Cordula ging in den Garderobenraum und hängte ihren schwarzen Ledermantel auf. Um 9.15 Uhr begann ihre doppel-stündige Pädagogikvorlesung. Sie machte sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsraum. Gekleidet in ein dunkelblaues Samtkostüm schritt sie beschwingt in schwarzen Stiefeln über die langen Flure, vorbei an Türen, hinter denen Klavier geübt wurde. Klangfetzen flogen an ihr vorbei. Die Lämpchen über den Türen ließen im Vorübergehen ihre weiße Spitzenbluse, die unter der offen gelassenen Kostümjacke hervorlugte, in hellem Licht erstrahlen. Unter dem Arm trug sie eine schwarze Mappe. Ihr blondes Haar fiel bei jedem Schritt locker auf ihre Schultern.
Ein Kollege kam ihr entgegen. ‚Ach, der‘, dachte sie und schlug die dunkelblau abgeschatteten Augenlider nieder. Als er an ihr vorbeischritt, blickte sie ihn kurz an, um seinen Gruß zu erwidern. Er unterrichtete Harmonielehre und Komposition. Vor drei Jahren hatte er ihr mal „den Hof gemacht“. Zuerst mochte sie ihn. Aber dann merkte sie, dass er für viele Frauen entflammbar war. Sie fühlte sich an Bernd erinnert: Diesen langen Abschied, dieses schmerzvolle „Lebewohl“ konnte sie nicht vergessen. Nicht noch einmal wollte sie es, konnte sie es durchleben. Noch ehe Amors Pfeil sie getroffen hatte, sagte sie unmissverständlich „Nein“.
Cordula hatte ihren Arbeitsraum erreicht. Er war eine Art Mehrzweckraum. Wenn man eintrat, sah man rechts ein Dirigentenpult vor etlichen Stuhlreihen. Hier fand die praktische Ausbildung der Chorleiter(innen) statt. Links war eine lange Tischreihe mit etwa 20 Stühlen, für Vorlesungen und Seminare gedacht. Zwischen dem Chorbereich und dem „Vorlesungstisch“ stand ein Steinway-Flügel. An der linken Wand war eine Tafel angebracht. Cordula nahm am Kopfende des langen Tisches Platz und legte ihr Konzept bereit. Durch die breite Fensterfront hinter ihr flutete das rötliche Licht der aufgehenden Wintersonne in den Raum hinein. Nach und nach traten die Studentinnen und Studenten ein. Es waren insgesamt 15, zehn weibliche und fünf männliche. Sie waren zwischen 19 und 24 Jahre alt.
Cordula hielt heute eine Vorlesung über Friedrich Fröbel. Dieser entsprach ganz ihrem Denken, lag seiner Pädagogik doch eine Philosophie zugrunde, die den Menschen unter dem kosmischen Gesetz von Natur und Geist stehend sieht. Nach einer ausführlichen Ausführung über Fröbels Biografie und Philosophie ging sie zur Pädagogik Fröbels über.
„Von seiner Philosophie ausgehend entwickelte Fröbel eine Pädagogik, die die harmonische Ausbildung aller Kräfte des Menschen anstrebt“, erläuterte Cordula. Sie fuhr fort: „Ausbildung von ‚Kopf, Hand und Herz‘ forderte schon Pestalozzi. Fröbel entdeckte bei seinen Beobachtungen, dass das Kind von Ahnung und Sehnsucht erfüllt ist: Es strebt nach einer ‚alle Dinge und Wesen einenden Einheit‘. Es ist die Sehnsucht nach dem göttlichen Gesetz, die das Kind bei all seinem Tun leitet. Das war die feste Überzeugung Fröbels. Auf seinen psychologischen Beobachtungen und philosophischen Reflexionen begründete Fröbel allgemeine Grundsätze für die Erziehung des Kindes, als oberster Grundsatz: die Pflege eines freitätigen Lebens. Freitätiges Leben für das Kind, ja für den Menschen allgemein, das ist das Spiel. Im SPIEL sah Fröbel die Möglichkeit des Geistigen und Göttlichen.“
Cordula geriet ins Schwärmen. Ihre Augen leuchteten und sie unterbrach ihre Ausführungen über Fröbel mit einem Appell: „Bedenken Sie, welche pädagogische Möglichkeit und Verpflichtung Sie als Klavierpädagoge haben! Wie nah ist man mit dem Klavierspielen doch an der harmonischen Förderung aller Kräfte: der Ausbildung von Kopf, Herz und Hand! Wir wissen heute durch die Hirnforschung, wie die Förderung von Gemüt und Intellekt durch die manuelle Tätigkeit unterstützt wird! Das geistige Potenzial eines Werkes wird beim Klavierspielen nicht nur durchdacht und empfunden, seine Struktur und sein Ausdrucksgehalt werden durch die Gestaltung, überwiegend mithilfe der Hände, buchstäblich ‚begriffen‘ und damit zum geistigen Eigentum des Spielers.
Denken Sie zum Beispiel an ein Werk wie die ‚Pathétique‘ von Beethoven: die Himmel und Erde umspannende gravitätische Einleitung, dann das leidenschaftliche Drängen des Allegros und schließlich die göttliche Ruhe, die im 2. Satz erlebt wird! All dies lebt in der Seele des Pianisten unvergleichlich intensiver auf als beim Nur-Hörer. Der Pianist ruft aus Geist und Seele geboren das Werk ins Leben, gestaltet er doch selbst das Werk, mit Tönen, die unter seinen Händen Wirklichkeit werden!
Und bedenken Sie: Es ist die Sehnsucht nach Vollkommenheit, die ihn leitet, und das oberste Prinzip ist die Harmonie, die im Himmel beheimatet ist und durch das Musizieren des Kunstwerkes in die irdische Welt eintritt. Sie fühlen, dass sich hier Fröbels Idee in hohem Maße verwirklicht: dass im Spiel der Mensch dem Geistigen und Göttlichen begegnet. Vollkommenheitsstreben und Harmonie sind für mich göttlichen Ursprungs. Ein Pianist, der sich mit seinem Vollkommenheitsstreben ganz dem Gestalten eines Kunstwerkes hingibt, ist ganz nah an der ‚alle Dinge und Wesen einenden Einheit‘, wie Fröbel das Göttliche umschreibt.
Lesen Sie doch bitte dazu das ‚Glasperlenspiel‘ von Hermann Hesse. Ich lege Ihnen die Lektüre sehr ans Herz. Hesse hebt das von Harmonie getragene geistige Spiel auf die höchste Stufe menschlicher Aktivitäten, und die Musik spielt bei ihm im Kanon der verschiedenen Spiele eine ganz große Rolle. Ich stimme ihm zu, wenn er sagt: ‚Die Musik beruht auf der Harmonie zwischen Himmel und Erde.‘ Abschließend möchte ich sagen, dass unser Vollkommenheitsstreben beeinflusst, in welchem Maße das Himmlische im Irdischen erscheint.“
Cordula hatte sich fast in Ekstase geredet, ihre Wangen glühten. Ihre Augen streiften Jerry, der die ganze Zeit intensiv mitgeschrieben hatte.
Jerry war Amerikaner, 20 Jahre alt, und lebte seit zehn Jahren in Deutschland. Zum Klavierspielen kam er verhältnismäßig spät, erst mit zwölf Jahren. Er war groß wie ein Riese und schlank. Seine Haltung war extrem aufrecht. Es schien, als seien seine Augen beständig in die Ferne gerichtet. Wenn ihm jemand begegnete, schaute er freundlich zu ihm hinab. Seine dunklen Augen ruhten dann still auf denen seines Gegenübers, wie um ihm in die Seele zu schauen, und er lächelte. Trotz seines jugendlichen Alters wirkte er wie ein Weiser. Man fühlte sich von ihm verstanden und angenommen. Wenn er auch äußerlich nicht gerade „schön“ zu nennen war, so hatte er doch eine starke erotische Ausstrahlung: Das, was ihm Faszination verlieh, waren in erster Linie sein liebender Blick und sein sinnlicher Mund. Cordula konnte es kaum ertragen, wenn er sie ansah. Sie schaute ihm nur flüchtig auf den Mund und bemühte sich, in sachlichem Tonfall mit ihm zu reden. Er sprach etwas unbeholfen mit amerikanischem Akzent, aber sanft, und seine Worte verrieten viel Einfühlungsvermögen, gute Beobachtungsgabe und sichere Urteilskraft. Technisch einfach auszuführende Musikstücke spielte er in überwältigender Vollendung, sodass es einen kalt überlief. Da war nie ein Zuviel oder Zuwenig im Ausdruck, das Timing und die Balance waren perfekt. Jedermann fühlte: Er war ein begnadeter Künstler. Mit technisch schwierigen Werken war er jedoch noch überfordert.
„Meine Damen und Herren, die Sitzung ist beendet, morgen fahren wir weiter fort mit Fröbel.“ Mit diesen Worten schloss Cordula die Pädagogikvorlesung. Die Studenten klopften auf den Tisch und brachen auf. Jerry packte umständlich seine Sachen zusammen. Er blickte jetzt Cordula, die gerade ihre Unterlagen in die Mappe schob, mit scheuer Verehrung an.
„Nun, alles gründlich mitgeschrieben?“, fragte sie.
„Ich wollte Ihnen noch was überreichen“, sagte er und ging mit ein paar zusammengehefteten Blättern rasch zu ihr. „Es sind meine Gedanken zur letzten Pädagogikvorlesung, zu Pestalozzi.“ Er überreichte ihr die Blätter mit einer unterwürfigen Geste.
„Schön, danke, da hab ich ja übers Wochenende was zu lesen“, meinte Cordula. Sie ging zum Ausgang. Er öffnete ihr die Tür und ließ ihr den Vortritt.
***
Um 14.15 Uhr begann Cordulas Seminar „Musikalische Formenlehre“. Die Student(inn)en saßen im großen Halbkreis um den Steinway-Flügel versammelt. Cordula spielte 22 Takte der Mozartsonate B-Dur, KV 333. „Spüren Sie die Leichtigkeit, den schwebenden Charakter dieser Musik? Es sind keine prägnanten Motive und Themen, die sich zielstrebig entwickeln wie bei der Musik Beethovens. Die Musik wächst aus einer belanglosen musikalischen Geste, einer fallenden Tonleiterfigur, die ständig variiert wird. Kleine und kleinste Veränderungen reihen sich aneinander, bauen sich auf zu wachsenden Bögen. Wir werden durch die Zeit getragen wie durch ein Meer von Blüten, immer wieder neue und doch vertraute gleiten an uns vorbei und am Horizont sind noch ungeahnt viele. Unendlich, grenzenlos erscheint dieses Spiel. Und das ist der besondere Reiz, dass wir im Fluss der wechselnden musikalischen Gestalten immer wieder diese Tonleiterfigur wiederfinden: In der Mannigfaltigkeit entdecken wir die Einheit. Es ist ganz so wie in der Natur.“
Cordula schwieg jetzt und sah auf die Notenbücher, die auf den Knien ihrer Zuhörer lagen. „Suchen Sie doch bitte mal diese Tonleiterfigur in ihren verschiedenen Varianten aus dem Klaviersatz heraus!“, forderte sie ihre Studenten auf. „Kreisen Sie die Figuren einfach mit Bleistift ein.“ Schrittweise wurde nun das musikalische Material und seine Verarbeitung betrachtet und am Flügel vorgespielt. Cordula skizzierte den Formverlauf des 1. Satzes der Sonate an der Wandtafel. Dann war Mittagspause.
***
Um 17.15 Uhr trafen sich die angehenden Klavierpädagogen wieder im Mehrzweckraum der Hochschule. Sie nahmen auf den Stühlen Platz, die im Halbkreis um den Flügel standen. Hinter der Fensterfront glühte das Abendrot. Cordula trat ein und knipste das Licht an. „Ich denke, es wird recht bald dunkel werden“, sagte sie mehr zu sich selbst und näherte sich dann der Gruppe. „Nun, alle versammelt?“ Irgendeiner sagte „Ja“, obwohl man wusste, dass es eine rein rhetorische Frage war. „Bitte, erheben Sie sich einmal“, fuhr Cordula weiter fort. „Ballen Sie die Fäuste und spannen Sie alle Muskeln Ihrer Arme und Ihres Rückens an, mit aller Kraft – ja, so. Und jetzt lösen Sie die Spannung, aber ohne völlige Erschlaffung, lassen Sie die Arme einfach fallen, entspannen Sie den Rücken – so ist gut.“ Sie sprach jetzt in beruhigendem Tonfall. Einige Male wiederholte sie diese Übung.
„Spannung und Entspannung, das ist das Gesetz der Natur und des Lebens: Sommer und Winter, Tag und Nacht, Jugend und Alter, Wachen und Schlafen, Bewegung und Ruhe. Irgendwie müssen wir uns dareinfinden, wenn das Leben funktionieren soll. – Spannung und Entspannung bestimmen auch den Bewegungsablauf beim Musizieren. Auf den Wechsel von Spannung und Lösung müssen Sie Ihr Augenmerk richten, wenn Sie selbst erfolgreich Klavier spielen wollen und wenn Sie Ihre Schüler unterrichten: Jeder Anspannung im Bewegungsapparat muss eine Entspannung folgen. Ein Zuviel an Spannung führt zur Verkrampfung, lässt den musikalischen Fluss stoppen und kann sogar zu Sehnenscheidenentzündung führen. Wir beobachten einmal das Verhältnis von Spannung und Lösung, wenn ein anderer spielt. Wir Zuhörer und Zuschauer achten nun genau auf den Bewegungsablauf. – Jasmin, spielen Sie doch bitte mal ein Stück aus Ihrem Repertoire!“
Jasmin war eine verträumte junge Frau von 21 Jahren. Sie war vor drei Jahren, nach dem Abitur, zur Hochschule gekommen, mit dem festen Ziel, Konzertpianistin zu werden. Ihre Mutter war Klavierlehrerin und hatte Jasmin seit ihrem vierten Lebensjahr auf dieses Ziel hin vorbereitet. Cordula riet Jasmin, das Klavierstudium mit einem Pädagogikstudium zu verbinden, damit in jedem Fall ihre Lebensgrundlage gesichert sei. Dies gefiel Mutter und Tochter zunächst gar nicht. Es war der Überredungskunst Cordulas zu verdanken, dass Jasmin seit einem Jahr nun doch neben ihrem Klavierstudium noch Klavierpädagogik studierte.
Jasmin wählte zum Vorspielen das Fantasie-Impromptu cis-Moll von Frédéric Chopin. Man merkte, dass sie jahrelang intensiv geschult worden war. Instinktsicher spielte sie das Werk. Nie war ein Zuviel an Spannung oder ein vorzeitiges Erschlaffen zu bemerken: Im schnellen A-Teil perlten die Läufe über einem schwebenden Bass. Jasmin spielte diesen Teil und seine Variante am Schluss sehr schnell und technisch perfekt.
Als sie das Werk zu Ende gespielt hatte, bemerkte man nicht die geringste Spur von Erschöpfung. Cordula leitete eine Reflexion über die Darbietung ein. „Wir haben gesehen, dass Jasmin keinerlei Mühe hatte, das Werk zu spielen. Dies hängt mit dem optimalen Einsatz von Spannung und Entspannung zusammen.“
Cordula spielte jetzt die erste Figur der rechten Hand. „Sehen Sie, mit der Figur wird Spannung aufgebaut und wieder gelöst. Der Aufbau und Abbau von Spannung erstreckt sich über zwei Takte. Die linke Hand folgt jedoch einem anderen Spannungsbogen. Dazu kommt auch noch die Schwierigkeit ‚vier gegen drei‘: Die rechte Hand spielt acht Töne, während die linke zur gleichen Zeit sechs spielt. Das ist für Schüler gar nicht so einfach. Diese Verhältnisse erfordern unbedingt, besonders bei Ihren Schülern, ein getrenntes Üben beider Hände und dann ein Auswendigspielen, um die Konzentration ganz auf die Bewegung richten zu können. Spannung und Entspannung müssen zunächst bewusst am isolierten Problem erlebt werden, um später automatisiert zu werden.“
Cordula schwieg einen Augenblick. Sie dachte an die Gestaltung des Mittelteils. Jasmin spielte ihn zu schnell und zu flach. Es gelang ihr nicht, die großartige Weite und Tiefe der musikalischen Seelenlandschaft, die das Herz des Werkes war, angemessen zum Ausdruck zu bringen. Cordula wusste, dass sich an diesem Mittelteil der wahre Künstler erweist und dass dem Erlernen dieser Kunst Grenzen gesetzt sind. Sie nahm sich vor, einmal im Einzelunterricht mit Jasmin an diesem Teil zu arbeiten, und ging jetzt zu einem anderen Werk über, um den Wechsel von Spannung und Lösung beim Musizieren beobachten zu lassen.
„Jerry, ich bitte Sie, uns eine Kostprobe aus Ihrem Repertoire vorzuführen“, forderte sie den Studenten auf. Er spielte den 1. Satz der Sonate „Les Adieux“ von Ludwig van Beethoven. Schon beim Anschlagen der ersten drei Akkorde, unter die Beethoven „Le – be – wohl“ geschrieben hatte, zeigte sich, dass Jerry Spannung und Lösung an der Phrasierung der Motivik orientierte. Die Musik schien zu atmen, Rede und Gegenrede waren deutlich voneinander abgesetzt. Unter den Händen des „großen Jungen“, wie Cordula Jerry liebevoll nannte, wurde die Musik zu einem wehmütigen Zwiegesang: Fragen wurden mit Fragen beantwortet. Die letzten beiden Akkorde stellte er quasi ins Offene, Ungewisse. Sie schienen über einem namenlosen Abgrund zu schweben. ‚Wie kann ein 20-Jähriger diesen Abgrund so tief erfassen?‘, ging es Cordula durch den Kopf.
Den fragenden Akkorden folgte attacca das dahinstürmende Allegro mit seinen dreimaligen Quartaufschwüngen am Anfang. Es erfordert einen raschen Wechsel von Spannung und Lösung. Und hier zeigte sich Jerrys Schwäche: Eben bei diesen schnellen Figuren vernachlässigte er die Entspannung. Dies wirkte sich aus in einem nicht mehr störungsfreien Bewegungsablauf im Folgenden. Jerry war erfüllt vom leidenschaftlichen Gestus der Musik; sein Gestaltungswille und seine Gestaltungskraft erwachten mächtig in ihm. Er baute dabei ein Zuviel an Spannung auf. Seine Hände verkrampften sich. Cordula spürte, wie er darunter litt, der Musik nicht die angemessene Präzision verleihen zu können. Sie unterbrach ihn, um das Problem auch für die zuschauenden und zuhörenden Studenten gewinnbringend zu bearbeiten.
„Jerry, bitte stoppen Sie hier mal!“, sagte Cordula. Sie demonstrierte an den Quartaufschwüngen den Wechsel von Spannung und Lösung. „Sehen Sie, jeweils nach einem Quartmotiv muss ganz schnell die Entspannung folgen“, sagte sie.
„Tut mir leid, ich glaub, mit der schnellen Entspannung ist das so eine Sache, ich denk, die Nervenleitung vom Gehirn zu den Fingern ist bei mir zu lang“, meinte er mit einer Anspielung auf seine Körpergröße.
„Sie scherzen“, sagte Cordula mit einem Lächeln. „Sie können das Problem in den Griff bekommen, indem Sie beim Üben langsam das Tempo steigern und immer kontrollieren, dass sofort nach der Spannung die Lösung folgt.“
In ähnlicher Weise ging Cordula auch bei fünf weiteren Studenten vor. „Wir werden das Thema Spannung und Entspannung in der nächsten Stunde fortsetzen. Dann sind die übrigen Studenten an der Reihe.“ Mit diesen Worten beendete sie die Übung. Die Studenten verabschiedeten sich und waren im Begriff, den Raum zu verlassen. Cordula winkte sie zurück. „Ich wollte Ihnen noch sagen: Im ‚Demo‘ laufen nächste Woche Mittwoch zwei Filme, die für Sie von Interesse sein dürften: ‚Russlands Wunderkinder‘ und ‚Die Konkurrenten‘. Ich habe mir die Filmpremiere mit der Regisseurin und den vier Protagonisten angeschaut. Zwischen beiden Filmen liegen zehn Jahre Zeitunterschied. Beide wurden mit