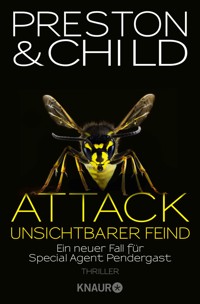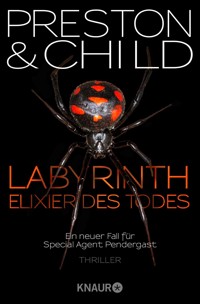9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Gideon Crew
- Sprache: Deutsch
Hochspannung von Preston & Child, Amerikas Meister-Duo des Abenteuer-Thrillers, über einen möglichen Terror-Anschlag mit einer Atombombe Agent Gideon Crew soll in New York City einen anscheinend wahnsinnigen Atomwissenschaftler zur Vernunft bringen, der seine Familie als Geisel genommen hat. Aber die Mission geht schief, der Täter wird erschossen. Die Aufzeichnungen des Toten offenbaren einen mörderischen Plan: In zehn Tagen wird seine selbstgebaute Atombombe eine nukleare Katastrophe auslösen. Doch niemand weiß, welche amerikanische Stadt das Ziel des Anschlags sein wird. Der Countdown läuft … "Reißt die Nerven in Fetzen wie hochexplosives Dynamit." Literaturmarkt.info
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
COUNTDOWN – jede Sekunde zählt
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In wenigen Tagen wird eine Atombombe gezündet – doch niemand weiß, welche amerikanische Stadt das Ziel des Terrorschlages sein wird. Militär und Geheimdienst ermitteln fieberhaft. Nur einer folgt ganz anderen Spuren: Gideon Crew. Schnell findet er Hinweise auf eine ungeheure Verschwörung – und wird selbst zum Verräter erklärt. Ihm bleibt nur wenig Zeit, das Attentat zu verhindern und sein Leben zu retten …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
Danksagung
Über die Autoren
DIE PENDERGAST-ROMANE
Unsere anderen Romane
Für Barbara Peters
1
Gideon stand am Fenster des Konferenzraums und schaute auf den ehemaligen Meatpacking District Manhattans. Sein Blick fiel auf die geteerten Dächer der alten Gebäude, in denen sich inzwischen schicke Boutiquen und angesagte Restaurants angesiedelt hatten, streifte dann den neuen High Line Park, der voller Menschen war, und die verrotteten Piers, bis er schließlich auf der breiten Wasserfläche des Hudson zur Ruhe kam. Im dunstigen frühsommerlichen Sonnenlicht sah der Fluss zur Abwechslung mal wie ein richtiges Gewässer aus: eine riesige blaue Fläche, die sich mit der Flut stromaufwärts bewegte.
Der Hudson erinnerte ihn an andere Flüsse, die er gekannt hatte, und Bäche und Bergschluchten. Vor allem an einem Bach, hoch in den Jemez Mountains, blieben seine Gedanken hängen. Er dachte an einen bestimmten tiefen Abschnitt darin und an die große Cutthroat-Forelle, die gewiss dort unten in der sonnenbeschienenen Tiefe lauerte.
Er konnte es kaum erwarten, aus New York City herauszukommen, weg von diesem verhutzelten Gnomen namens Glinn und seiner ominösen Firma Effective Engineering Solutions.
»Ich gehe angeln«, sagte er.
Glinn verlagerte das Gewicht im Rollstuhl und seufzte. Gideon wandte sich um. Glinns verkrüppelte Hand kam unter der Decke hervor, die auf seinen Knien lag, und streckte ihm ein dickes Kuvert aus braunem Papier entgegen. »Ihr Geld.«
Gideon zögerte. »Sie bezahlen mich? Nach allem, was ich getan habe?«
»Fakt ist, dass sich unsere Honorarstruktur aufgrund dessen, was Sie mir gesagt haben, geändert hat.« Glinn öffnete den Umschlag, zählte mehrere mit Banderolen versehene Päckchen Hunderter ab und legte sie auf den Konferenztisch. »Hier ist die Hälfte von den hunderttausend.«
Gideon griff nach dem Geld, bevor Glinn es sich anders überlegen konnte.
Dann reichte ihm Glinn zu seiner Überraschung die andere Hälfte. »Und hier ist der Rest. Allerdings nicht als Bezahlung für geleistete Dienste, sondern mehr als eine Art, wie soll ich sagen, Vorschuss.«
Gideon stopfte sich das Geld in die Jacketttaschen. »Ein Vorschuss worauf?«
»Ich dachte mir, dass Sie, bevor Sie die Stadt verlassen, vielleicht mal kurz bei einem alten Freund vorbeischauen möchten.«
»Danke, aber ich bin mit einer Cutthroat-Forelle im Chihuahueños Creek verabredet.«
»Aha. Aber ich hatte so sehr gehofft, Sie hätten Zeit, Ihren Freund zu besuchen.«
»Ich habe keine Freunde. Und selbst wenn, ich wäre im Moment hundertprozentig nicht daran interessiert, ›mal kurz bei einem alten Freund vorbeizuschauen‹. Wie Sie mir freundlicherweise mitgeteilt haben, läuft meine Zeit ja ohnehin bald ab.«
»Reed Chalker ist sein Name. Sie haben mal mit ihm zusammengearbeitet, glaube ich.«
»Wir waren in derselben Abteilung. Das ist nicht dasselbe, wie mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich habe den Typen seit Monaten nicht mehr in Los Alamos gesehen.«
»Nun, Sie sind im Begriff, ihn jetzt zu sehen. Die Behörden hoffen, Sie könnten sich mal ein bisschen mit ihm unterhalten.«
»Die Behörden? Ein bisschen unterhalten? Worum geht’s hier eigentlich?«
»In diesem Augenblick hält Chalker eine Geisel gefangen. Vier Geiseln, genau genommen. Eine Familie in Queens. Bedroht sie mit vorgehaltener Waffe.«
Gideon lachte. »Chalker? Unmöglich. Der Typ, den ich kannte, war ein waschechter Los-Alamos-Streber, absolut gesetzestreu. Der könnte keiner Fliege was zuleide tun.«
»Er ist durchgeknallt. Paranoid. Völlig neben der Spur. Sie sind die einzige Person in unmittelbarer Nähe, die ihn kennt. Die Polizei möchte, dass Sie ihn beruhigen, ihn dazu bringen, dass er die Geiseln freilässt.«
Gideon gab keine Antwort.
»Deshalb tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Dr. Crew, dass die Cutthroat-Forelle sich noch etwas länger ihres Lebens erfreuen wird. Doch jetzt müssen Sie wirklich los. Die Familie kann nicht länger warten.«
Gideon merkte, wie Empörung in ihm aufwallte. »Suchen Sie sich jemand anderen.«
»Dazu bleibt keine Zeit. Es geht um zwei Kinder und ihre Eltern. Wie’s aussieht, ist der Vater Chalkers Vermieter, er hat Chalker die Souterrainwohnung in seinem Reihenhaus vermietet. Offen gesagt, haben wir großes Glück, dass Sie hier sind.«
»Ich kenne Chalker kaum. Er hat sich wie eine Klette an mich gehängt, aber nur kurz, nachdem seine Frau ihn verlassen hatte. Danach ist er gläubig geworden und aus meinem Blickfeld verschwunden, und zwar zu meiner großen Erleichterung.«
»Garza fährt Sie hin. Ihr Kontaktmann vor Ort ist Special Agent Stone Fordyce, FBI.«
»Kontaktmann? Warum hat das FBI mit der Sache zu tun?«
»Es ist die übliche Vorgehensweise, wenn jemand mit einem so hohen Sicherheitsstatus wie Chalker in Schwierigkeiten gerät und es sein kann, dass er, äh, fremdgeht.« Glinn richtete das unverletzte Auge auf Gideon. »Es handelt sich hier nicht um eine verdeckte Operation wie beim letzten Mal, sondern um einen ganz offiziellen Auftrag. Wenn alles gutgeht, müssten Sie in ein, zwei Tagen auf dem Rückweg nach New Mexico sein.«
Gideon schwieg. Er hatte noch elf Monate zu leben – zumindest war ihm das mitgeteilt worden. Andererseits: Je länger er darüber nachdachte, umso mehr Fragen stellten sich ihm, und deshalb hatte er vor, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit eine zweite Meinung einzuholen. Glinn war ein meisterhafter Strippenzieher, und Gideon traute weder ihm noch seinen Leuten über den Weg.
»Wenn Chalker so knallverrückt ist, wie Sie behaupten, dann könnte es doch sein, dass er seine Waffe auf mich richtet.«
»Zwei Kinder. Acht und zehn. Junge und Mädchen. Und ihre Eltern.«
Gideon drehte sich um und stieß einen langen Seufzer aus. »In Gottes Namen, einverstanden. Aber ich gebe Ihnen einen Tag – nur einen Tag. Und ich werde lange, sehr lange stocksauer auf Sie sein.«
Glinn bedachte ihn mit einem kühlen Lächeln.
2
Am Tatort herrschte eine Art kontrolliertes Chaos. Die unmittelbare Umgebung war eine unscheinbare Wohnstraße in einer groteskerweise »Sunnyside« benannten Arbeitersiedlung in Queens. Das Haus war Teil einer langen Reihe von miteinander verbundenen Backsteinhäusern, gegenüber befand sich eine identische Häuserzeile, dazwischen lag eine asphaltierte Straße voller Schlaglöcher. An der Straße stand kein einziger Baum; die Vorgärten waren verwildert, die Rasenflächen vertrocknet, weil es lange nicht geregnet hatte. Der Verkehr auf dem nahegelegenen Queens Boulevard dröhnte herüber, der Geruch von Autoabgasen hing in der Luft.
Ein Polizist zeigte ihnen, wo sie parken sollten, und sie stiegen aus. Die Polizei hatte beiderseits der Straße Absperrgitter und Betonsperren aufgestellt, außerdem standen überall Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht herum. Garza zeigte seinen Ausweis und wurde durch eine Absperrung gewunken, die eine drängelnde Menge von Schaulustigen zurückhielt, viele von ihnen tranken Bier, ein paar trugen sogar Partyhütchen und führten sich auf wie auf einem Straßenfest.
New York City, dachte Gideon und schüttelte den Kopf.
Die Polizei hatte einen großen Bereich vor dem Haus, in dem Chalker die Geiseln genommen hatte, geräumt. Zwei mobile Einsatzkommandos waren in Stellung gegangen, das eine vorn, hinter einem gepanzerten Rettungsfahrzeug, das andere weiter hinten, hinter einer Reihe von Betonsperren. Gideon sah auf mehreren Häusern Scharfschützen, die von den Dächern spähten. In einiger Entfernung ertönte hin und wieder eine Stimme durch ein Megaphon, anscheinend ein Geiselnahmeexperte, der versuchte, beruhigend auf Chalker einzureden.
Als Garza sich nach vorn durchdrängte, hatte Gideon plötzlich eine Art Déjà-vu-Erlebnis, einen Anfall von Übelkeit. So war sein Vater getötet worden, genau so hatte es ausgesehen: Megaphone, mobile Einsatzkommandos, Scharfschützen und Absperrungen – kaltblütig erschossen, als er sich mit erhobenen Händen ergab … Nur mit Mühe konnte Gideon die Erinnerung verdrängen.
Garza und Gideon durchquerten eine weitere Sperre und gelangten zu einem FBI-Kommandoposten. Einer der Agenten löste sich aus der Gruppe und kam zu ihnen.
»Special Agent Stone Fordyce«, stellte Garza den Mann vor. »Stellvertretender Leiter des FBI-Teams vor Ort. Sie werden mit ihm zusammenarbeiten.«
Gideon musterte Fordyce mit instinktiver Feindseligkeit. Der Typ sah aus wie aus einer Fernsehserie: hochgewachsen, gutaussehend, arrogant, selbstsicher und geradezu lächerlich fit. Er trug einen blauen Anzug, ein gestärktes weißes Hemd und eine gestreifte Krawatte, der Ausweis baumelte ihm um den Hals. Mit seinen schmalen blauen Augen blickte er auf Gideon herab, als betrachtete er eine niedere Lebensform.
»Sie sind also der Freund?«, fragte Fordyce und musterte Gideon eindringlich, vor allem dessen Kleidung – schwarze Jeans, schwarze Sneakers ohne Schnürsenkel, weißes Secondhand-Smokinghemd, dünner Schal.
»Ich bin nicht die unverheiratete Tante, wenn Sie das meinen«, erwiderte Gideon.
»Es geht um Folgendes«, fuhr Fordyce nach kurzer Pause fort. »Ihr Freund, dieser Chalker, ist paranoid. Hat Wahnvorstellungen, eine klassische psychotische Episode. Er gibt einen Haufen Verschwörungstheorien von sich: Die Regierung habe ihn entführt und zu Strahlungsexperimenten missbraucht und ihm Strahlen in den Kopf gejagt – das Übliche. Er glaubt, dass seine Vermieter an der Verschwörung beteiligt sind, und hat sie deshalb als Geiseln genommen, zusammen mit ihren zwei Kindern.«
»Was will er?«, fragte Gideon.
»Ist nicht ganz klar. Er ist mit – wie wir vermuten – einem 45er Colt bewaffnet. Er hat damit ein-, zweimal in die Luft geballert. Wir sind nicht sicher, ob er wirklich weiß, wie man mit dem Ding umgeht. Wissen Sie etwas über seine früheren Erfahrungen im Umgang mit Waffen?«
»Ich denke, er hat keine«, sagte Gideon.
»Erzählen Sie mal, was Sie über ihn wissen.«
»Einzelgänger. Hatte kaum Freunde, hatte sich eine gestörte Frau erster Güte aufgehalst, die ihn total ausgequetscht hat. War unzufrieden mit seinem Job, hat davon geredet, er wolle Schriftsteller werden. Schließlich ist er dann religiös geworden.«
»War er gut in seinem Beruf? Intelligent?«
»Er beherrschte seine Arbeit, war aber nicht brillant. Was seinen IQ betrifft, so ist der weitaus höher als der, sagen wir, eines durchschnittlichen FBI-Agenten.«
Es entstand eine Stille, während Fordyce die Antwort auf sich wirken ließ, aber nicht reagierte. »In der Kurzdarstellung heißt es, dass der Mann in Los Alamos Atomwaffen mitentwickelt hat. Stimmt das?«
»Mehr oder weniger.«
»Glauben Sie, dass er in dem Haus da Sprengsätze zusammengebastelt haben könnte?«
»Er hat vielleicht an Atomwaffen gearbeitet, aber wenn er einen Knallfrosch gehört hätte, wäre er ausgerastet. Und was die Sprengsätze angeht – das bezweifle ich stark.«
Fordyce schaute ihn an und fuhr fort: »Er glaubt, dass alle hier was mit dem Staat zu tun haben und Agenten sind.«
»Womit er vermutlich recht hat.«
»Wir hoffen, dass er jemandem aus seiner Vergangenheit vertraut. Ihnen.«
Gideon hörte im Hintergrund weitere über Megaphon gerufene Sätze, dann eine verzerrte, gekreischte Antwort, die allerdings zu weit entfernt war, um sie verstehen zu können. Er drehte sich zu den Geräuschen um. »Ist er das?«, fragte er ungläubig.
»Leider.«
»Warum das Megaphon?«
»Er will weder per Handy noch Festnetz mit uns reden, weil wir das nur dazu benutzen würden, ihm noch mehr Strahlen in den Kopf zu jagen. Deswegen verwenden wir nur das Megaphon. Er ruft seine Antworten aus der Tür.«
Gideon drehte sich wieder in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. »Ich schätze mal, ich bin so weit, wenn Sie es sind.«
»Ich gebe Ihnen vorher noch einen Crashkurs in Geiselnahme-Verhandlungen«, sagte Fordyce. »Das Ganze beruht auf der Idee, ein Gefühl der Normalität zu erzeugen, den Erregungspegel zu senken, den Geiselnehmer zu beschäftigen, die Verhandlung zu verlängern. An sein Mitgefühl zu appellieren. Okay? Unser Ziel Nummer eins besteht darin, ihn dazu zu bringen, dass er die Kinder freilässt. Versuchen Sie, irgendetwas auszugraben, was er haben möchte, und tauschen Sie die Kinder dagegen ein. Konnten Sie mir so weit folgen?« Offenbar bezweifelte er, dass Gideon zu rationalem Denken fähig war.
Gideon nickte und verzog keine Miene.
»Sie sind nicht befugt, irgendetwas zu garantieren. Sie dürfen keine Versprechungen machen. Haben Sie verstanden? Alles muss mit dem Einsatzleiter abgesprochen werden. Worum der Mann auch bittet, gehen Sie darauf ein, aber sagen Sie, Sie müssten das erst mit dem Leiter abklären. Das ist der entscheidende Teil der Verhandlung. Dadurch wird die ganze Sache verlangsamt. Und wenn er etwas will, und die Antwort lautet nein, sind Sie nicht schuld. Es geht darum, ihn zu ermatten, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen.«
Gideon wunderte sich, dass er mit dem Vorgehen insgesamt einverstanden war.
Ein Polizist erschien mit einer kugelsicheren Weste. »Wir werden Sie ein bisschen einkleiden«, sagte Fordyce. »Aber egal, es dürfte kein Risiko bestehen. Wir stecken Sie hinter kugelsicheres Plexiglas.«
Sie halfen Gideon, sein Hemd auszuziehen und die kugelsichere Weste anzulegen, steckten ihm die Verlängerungen in die Hose, dann statteten sie ihn mit einem unsichtbaren Ohrhörer und einem Funkmikro aus. Während er sich das Hemd wieder anzog, hörte er im Hintergrund weitere Sätze aus einem Megaphon, unterbrochen von hysterischen, unverständlichen Antworten.
Fordyce warf einen Blick auf seine Armbanduhr und zuckte zusammen. »Irgendwelche neuen Entwicklungen?«, fragte er den Polizisten.
»Das Verhalten des Mannes wird schlimmer. Der Leiter glaubt, dass wir bald in die Endphase übergehen müssen.«
»Verdammt.« Fordyce schüttelte den Kopf und wandte sich wieder zu Gideon um. »Noch etwas: Sie werden nach einem Drehbuch vorgehen.«
»Einem Drehbuch?«
»Unsere Psychologen haben es geschrieben. Wir geben Ihnen jede Frage durch den Ohrhörer durch. Sie stellen die Frage, warten einen Moment, nachdem er geantwortet hat, und bekommen dann von uns die Antwort.«
»Das können Sie doch auch selber. Dazu brauchen Sie mich doch nicht.«
»Sie haben’s erfasst. Wir benutzen Sie nur als Sprachrohr.«
»Wieso dann der Vortrag über Geiselnahme-Verhandlungen?«
»Damit Sie verstehen, was vor sich geht und warum. Und wenn das Gespräch persönlich wird, könnte es sein, dass Sie ein wenig improvisieren müssen. Aber nehmen Sie den Mund nicht zu voll, und machen Sie keine Versprechungen. Sichern Sie sich sein Wohlwollen, erinnern Sie ihn an Ihre Freundschaft, versichern Sie ihm, dass alles gut wird, dass seine Sorgen ernst genommen werden. Bleiben Sie ruhig. Und streiten Sie um Himmels willen nicht mit ihm über seine Wahnvorstellungen.«
»Ergibt Sinn.«
Fordyce musterte ihn lange, wie prüfend; seine Feindseligkeit ließ ein wenig nach. »Wir machen so etwas schon ziemlich lange.« Kurze Pause. »Sind Sie bereit?«
Gideon nickte.
»Los geht’s.«
3
Fordyce ging Gideon voran durch eine letzte Reihe von Sperren zur vordersten Linie aus Betonbarrieren, gepanzerten Fahrzeugen und Plexiglas-Schutzschilden. Die schusssichere Weste fühlte sich ungewohnt und unförmig an. Jetzt konnte er das Megaphon klar und deutlich verstehen.
»Reed«, ließ sich die Megaphon-Stimme vernehmen, ruhig und onkelhaft, »ein alter Freund von Ihnen ist hier und möchte mit Ihnen reden. Sein Name ist Gideon Crew. Möchten Sie mit ihm sprechen?«
»Quatsch!«, ertönte die Antwort – es war ein kaum zu verstehender Schrei. »Ich will mit niemandem reden!«
Eine rauhe Stimme erklang in Gideons Ohrhörer. »Dr. Crew, hören Sie mich?«
»Ich höre.«
»Ich bin Jed Hammersmith. Ich sitze in einem der Vans, entschuldigen Sie, dass wir uns nicht persönlich begrüßen können. Ich werde Sie anleiten. Hören Sie genau zu. Wichtigste Regel: Sie dürfen mir nicht antworten, wenn ich mit Ihnen über den Ohrhörer spreche. Wenn Sie da draußen sind, darf man natürlich nicht sehen, dass Sie mit jemandem kommunizieren. Sie reden nur mit dem Geiselnehmer. Haben Sie mich verstanden?«
»Ja.«
»Ihr lügt! Ihr alle! Hört auf mit dem Theater!«
Gideon schrak zusammen. Es erschien ihm nahezu ausgeschlossen, dass es sich um den Chalker handelte, den er kannte. Und dennoch war das seine Stimme, verzerrt von Angst und Wahnsinn.
»Wir wollen Ihnen helfen«, ertönte es aus dem Megaphon. »Sagen Sie uns, was Sie wollen …«
»Ihr wisst genau, was ich will! Stoppt die Entführung. Hört auf mit den Experimenten!«
»Ich werde Ihnen die Fragen vorsprechen«, sagte Hammersmiths ruhige Stimme in Gideons Ohr. »Wir müssen jetzt schnell handeln; die Sache läuft nicht gut.«
»Das sehe ich.«
»Ich schwöre bei Gott, dass ich ihm das Hirn wegpuste, wenn ihr nicht aufhört, mich zu verarschen!«
Aus dem Haus drangen ein unartikulierter Schrei und die flehende Stimme einer Frau. Und davon überdeckt das hohe Wehklagen eines Kindes. Es traf Gideon bis ins Mark. Die Erinnerungen aus seiner eigenen Kindheit – sein Vater, der in einer Türöffnung stand, er selbst, wie er über einen grünen Rasen auf ihn zulief – kehrten stärker denn je zurück. Er bemühte sich verzweifelt, die Bilder zu verdrängen, doch jeder Ton aus dem Megaphon bewirkte nur, dass sie wieder zurückkamen.
»Du steckst doch mit denen unter einer Decke, du Miststück!«, schrie Chalker in die Richtung von jemandem, der neben ihm stand. »Du bist nicht mal seine Frau, du bist bloß eine Agentin! Das hier ist alles Quatsch, alles. Aber ich spiele da nicht mit! Ich lasse mir das nicht mehr gefallen!«
Die Megaphon-Stimme antwortete geradezu übernatürlich ruhig, so als spräche sie mit einem Kind. »Ihr Freund Gideon Crew möchte sich mit Ihnen unterhalten. Er kommt jetzt raus.«
Fordyce drückte ihm ein Mikrofon in die Hand. »Es ist drahtlos verbunden mit Lautsprechern am Van. Gehen Sie.«
Er deutete in Richtung eines Plexiglas-Unterstands, schmal und an drei Seiten und oben geschlossen, der hintere Teil offen. Nach kurzem Zögern trat Gideon hinter dem Van hervor und in den Glaskasten. Das Ding erinnerte ihn an einen Haifischkäfig.
Er sprach ins Mikro. »Reed?«
Jähes Schweigen.
»Reed? Ich bin’s, Gideon.«
Immer noch Schweigen. Und dann: »O mein Gott, Gideon, haben die dich auch geschnappt?«
In Gideons Ohrhörer ertönte Hammersmiths Stimme, und er wiederholte dessen Sätze. »Niemand hat mich geschnappt. Ich war in der Stadt, habe gehört, was los ist, bin hierhergekommen, um zu helfen. Ich stecke mit niemandem unter einer Decke.«
»Lügner!«, antwortete Chalker mit hoher, bebender Stimme. »Die haben auch dich geschnappt! Hast du schon Schmerzen? Steckt es dir im Kopf? Im Magen? Das kommt noch. O ja, ganz bestimmt …« Die Stimme brach plötzlich ab und wurde durch einen heftigen Würgelaut ersetzt.
»Nutzen Sie die Pause«, erklang Hammersmiths Stimme. »Sie müssen die Kontrolle über das Gespräch gewinnen. Fragen Sie ihn: Wie kann ich helfen?«
»Reed«, sagte Gideon. »Wie kann ich helfen?«
Wieder Würgen, dann Stille.
»Lass mich dir helfen, bitte. Wie kann ich dir helfen?«
»Du kannst nichts tun! Rette deinen eigenen Arsch, hau ab von hier. Diese Dreckschweine sind zu allem fähig – schau doch, was die mit mir gemacht haben. Ich verbrenne innerlich! O Scheiße, mein Magen –!«
»Bitten Sie ihn vorzutreten, so dass Sie ihn sehen können«, sagte Hammersmith in Gideons Ohr.
Gideon fielen die Scharfschützen ein. Er merkte, wie ihm kalt wurde; wenn einer von den Schützen freie Schussbahn hatte, würde er abdrücken. Genauso, wie sie’s bei meinem Vater gemacht haben … Gleichzeitig rief er sich aber auch in Erinnerung, dass Chalker in dem Haus eine Familie als Geisel genommen hatte und mit der Waffe bedrohte. Gideon sah mehrere Männer auf dem Dach des Reihenhauses. Sie machten sich bereit, etwas durch den Schornstein hinabzulassen; ein Gerät, das aussah wie eine Videokamera. Hoffentlich wussten die, was sie taten.
»Sag denen, sie sollen die Strahlen abschalten!«
»Sagen Sie ihm, dass Sie ihm wirklich helfen wollen, aber dass er Ihnen sagen muss, wie.«
»Reed, ich will dir wirklich helfen. Du musst nur sagen, wie.«
»Stoppt die Experimente!« Auf einmal sah Gideon, dass sich im Türrahmen etwas bewegte. »Die bringen mich um! Schaltet die Strahlung ab, oder ich puste ihm den Kopf weg!«
»Sagen Sie ihm, dass wir alles tun, was er möchte«, sprach Hammersmith in Gideons Ohr. »Aber er muss aus dem Haus kommen, damit Sie von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden können.«
Gideon schwieg. Sosehr er sich auch bemühte, das Bild seines Vaters ging ihm einfach nicht aus dem Kopf, seines Vaters, wie er die Hände hob und ihm mitten ins Gesicht geschossen wurde … Nein, darum würde er Chalker nicht bitten. Wenigstens jetzt noch nicht.
»Gideon«, sagte Hammersmith nach einer langen Pause, »ich weiß, dass Sie mich hören …«
»Reed«, sagte Gideon und schnitt Hammersmith das Wort ab. »Ich stecke mit diesen Leuten nicht unter einer Decke. Ich stecke mit niemandem unter einer Decke. Ich bin hier, um dir zu helfen.«
»Das glaube ich dir nicht!«
»Dann glaub es mir eben nicht. Aber hör mir wenigstens zu.«
Keine Reaktion.
»Du sagst, dein Vermieter steckt mit in der Sache drin?«
»Weichen Sie nicht vom Drehbuch ab«, warnte Hammersmith.
»Das sind nicht meine Vermieter«, erklang Chalkers Antwort, lauter nun, hysterisch. »Ich habe die noch nie gesehen! Das Ganze ist ein abgekartetes Spiel. Ich war noch nie im Leben hier, das sind Regierungsagenten! Ich bin entführt worden, wurde festgehalten, damit man Experimente –«
Gideon hielt eine Hand hoch. »Reed, Moment mal. Du sagst, dass die Vermieter da mit drinstecken und dass alles ein abgekartetes Spiel ist. Was ist dann mit den Kindern? Stecken die auch mit drin?«
»Das Ganze ist ein abgekartetes Spiel. Auuuh, diese Hitze! Diese Hitze!«
»Acht und zehn Jahre alt?«
Langes Schweigen.
»Reed, beantworte meine Frage. Sind die Kinder auch Verschwörer?«
»Bring mich nicht durcheinander!«
Wieder Stille. Er hörte Hammersmiths Stimme. »Okay, das ist gut. Machen Sie weiter.«
»Ich will dich nicht verwirren, Reed. Aber das sind Kinder. Unschuldige Kinder.«
Wieder Stille.
»Lass doch die Kinder frei. Schick sie raus zu mir. Du hast dann trotzdem noch zwei Geiseln.«
Das lange Schweigen dehnte sich, und dann sah man plötzlich eine jähe Bewegung, hörte einen gellenden Schrei, und eines der Kinder erschien im Türrahmen – der Junge. Ein kleiner Junge mit dichtem braunem Haar, er trug ein I LOVE MY GRANDMA-T-Shirt und machte, am ganzen Leib zitternd vor Angst, einen Schritt ins Freie.
Einen Augenblick lang glaubte Gideon, dass Chalker die Kinder freilassen wollte. Doch als er den vernickelten 45er sah, der gegen den Hals des Jungen gedrückt war, war ihm klar, dass er sich getäuscht hatte.
»Sehen Sie das! Ich mache keine Witze! Stoppen Sie die Strahlen, oder ich bringe den Jungen um! Ich zähle bis zehn! Eins, zwei …«
Die Mutter schrie hysterisch im Hintergrund. »Nicht, bitte nicht!«
»Halt’s Maul, verlogenes Miststück, das sind nicht mal deine Kinder!« Chalker drehte sich um und gab einen Schuss in die Dunkelheit im Haus hinter sich ab. Das Schreien der Frau brach jählings ab.
Mit einer entschlossenen Bewegung trat Gideon aus dem schusssicheren Unterstand und ging auf die offene Fläche vor dem Haus zu. Er hörte Rufe, Polizisten, die ihm hinterherschrien – zurück, runter, der Mann ist bewaffnet –, aber er ging weiter, bis er knapp fünfzig Meter von der Haustür entfernt stehen blieb.
»Was zum Teufel machen Sie da? Treten Sie zurück hinter die Barriere, er wird Sie abknallen!«, schrie Hammersmith durch den Ohrhörer.
Gideon zog den Hörer aus dem Ohr und hielt ihn hoch. »Reed? Siehst du das hier? Du hattest recht. Die haben mir gesagt, was ich sagen soll.« Er warf den Ohrhörer auf den Asphalt. »Aber jetzt nicht mehr. Von jetzt an reden wir offen und ehrlich.«
»Drei, vier, fünf …«
»Warte, um Gottes willen, bitte.« Gideon sprach laut. »Er ist doch noch ein Kind. Hör doch, wie er schreit. Glaubst du, er täuscht das nur vor?«
»Schnauze!«, schrie Chalker den Jungen an – worauf der erstaunlicherweise zu weinen aufhörte. Er stand da, zitternd und blass, seine Lippen bebten. »Mein Kopf!«, schrie Chalker. »Mein …«
»Weißt du noch, wie diese Schülergruppen kamen, um sich das Labor anzusehen?«, sagte Gideon und bemühte sich dabei, ganz ruhig zu klingen. »Du hast diese Kinder doch gemocht, du fandest es toll, ihnen alles zu zeigen. Und die Kinder fanden dich toll. Nicht mich. Nicht die anderen. Sondern dich. Weißt du das noch, Reed?«
»Ich verbrenne!«, rief Chalker. »Die haben wieder die Strahlen eingeschaltet. Ich bring den Jungen um, aber seinen Tod wirst du auf dem Gewissen haben, nicht ich! Hast du mich VERSTANDEN? SIEBEN, ACHT …«
»Lass den armen Jungen gehen«, sagte Gideon und trat einen weiteren Schritt vor. Es jagte ihm ungeheure Angst ein, dass Chalker nicht mal mehr richtig zählen konnte. »Lass ihn gehen. Du kannst stattdessen mich nehmen.«
Mit einer brüsken Bewegung drehte sich Chalker um und richtete seine Waffe auf Gideon. »Geh zurück, du bist einer von denen!«
Gideon streckte die Arme fast flehentlich in Richtung Chalker aus. »Glaubst du wirklich, ich gehöre zu den Verschwörern? Dann schieß doch. Aber bitte, bitte, lass den Jungen frei.«
»Du hast es so gewollt!« Chalker schoss.
4
Und verfehlte sein Ziel.
Gideon ließ sich auf den Asphalt fallen. Und jetzt klopfte sein Herz plötzlich so heftig, als schlüge es direkt gegen seine Rippen. Er kniff die Augen fest zusammen und wartete auf den nächsten Schuss, einen glühenden Schmerz und darauf, dass ringsum alles schwarz würde.
Doch der zweite Schuss blieb aus. Gideon hörte lautes Stimmengewirr und Gekrächze aus dem Megaphon. Langsam, ganz langsam öffnete er die Augen und blickte zum Haus. Da stand Chalker, kaum zu sehen in der Türöffnung, er hielt den Jungen vor sich fest. An der Art, wie der Mann die Waffe hielt, an seinen zitternden Händen und seiner ganzen Haltung ließ sich ablesen, dass er überhaupt keine Erfahrung mit Waffen hatte. Und die Distanz betrug fünfzig Meter.
»Das ist ein gemeiner Trick!«, kreischte Chalker. »Du bist nicht mal Gideon! Du sollst mich reinlegen!«
Gideon stand langsam auf und hielt die Hände so, dass Chalker sie sehen konnte. Sein Herz wollte immer noch nicht langsamer schlagen. »Reed, lass uns doch einfach den Tausch vornehmen. Nimm mich. Lass den kleinen Jungen frei.«
»Sag denen, sie sollen die Strahlen abschalten!«
Streiten Sie nicht mit ihm wegen seiner Wahnvorstellungen, hatte man Gideon eingeschärft. Ein guter Rat. Aber wie zum Teufel sollte er reagieren? »Reed, alles wird gut, wenn du den Jungen freilässt. Und das kleine Mädchen.«
»Schaltet die Strahlung ab!« Chalker hockte sich hinter den Jungen, nutzte ihn als Deckung. »Die bringen mich um. Schaltet die Strahlen ab, oder ich puste ihm den Kopf weg!«
»Wir kriegen das schon hin«, rief Gideon. »Alles wird gut. Aber du musst den Jungen freilassen.« Er machte noch einen Schritt, dann noch einen. Er musste nahe genug herankommen, um einen letzten Angriff zu starten – falls der notwendig war. Wenn er Chalker nicht angriff, sich nicht auf ihn warf, dann würde der Junge sterben, und die Scharfschützen würden Chalker erschießen. Und Gideon bezweifelte, dass er es ertragen würde, das mit anzusehen.
Chalker kreischte, als litte er Todesqualen. »Stoppt die Strahlung!« Sein ganzer Körper bebte, während er mit dem Revolver herumfuchtelte.
Wie reagierte man auf einen Wahnsinnigen? Verzweifelt versuchte sich Gideon an den Rat zu erinnern, den Fordyce ihm gegeben hatte. Verwickeln Sie den Geiselnehmer in ein Gespräch, appellieren Sie an sein Mitgefühl.
»Reed, schau dem Jungen doch ins Gesicht. Du wirst sehen, dass er völlig unschuldig ist …«
»Meine Haut brennt!«, schrie Chalker. »Ich habe gezählt! Wo war ich noch gleich? Sechs, acht …« Er zog eine Grimasse, seine Züge verzerrten sich vor Schmerz. »Die machen das schon wieder. Wie das brennt, wie das brennt!« Wieder drückte er dem Kind die Waffe an den Hals. Jetzt fing der Junge an, durchdringend zu wimmern – ein hoher, dünner Ton wie aus einer anderen Welt.
»Warte!«, schrie Gideon. »Nein, nicht!« Er beschleunigte seinen Schritt und ging mit erhobenen Händen auf Chalker zu. Vierzig Meter, dreißig Meter – eine Distanz, die er in wenigen Sekunden zurücklegen könnte …
»Neun, ZEHN! ZEHN! Ahhhhhh –!«
Gideon sah, dass sich Chalkers Finger am Abzug spannte, und spurtete direkt auf ihn zu. Gleichzeitig erschien plötzlich die männliche Geisel auf dem Flur und stürzte sich mit wüstem Gebrüll von hinten auf Chalker.
Chalker wirbelte herum, dabei löste sich aus seiner Waffe ein harmloser Schuss.
»Lauf!«, schrie Gideon den Jungen an, während er auf das Haus zurannte.
Aber der Junge lief nicht weg. Chalker rang mit der Geisel, die sich an seinen Rücken klammerte. Sie drehten sich gemeinsam im Kreis, und Chalker schleuderte den Mann gegen die Wand im Flur und riss sich los. Der Mann ging mit einem Wutschrei erneut auf Chalker los und holte zu einem Schlag aus, aber er war dicklich, in den Fünfzigern, und Chalker wich dem Hieb geschickt aus und schlug den anderen zu Boden.
»Lauf!«, rief Gideon dem Jungen noch einmal zu, während er selbst über den Bordstein auf den Fußweg sprang.
Doch als Chalker die Waffe herumschwenkte, um auf den Vater zu zielen, sprang der Junge ihm auf den Rücken und trommelte mit seinen kleinen Fäusten auf ihn ein.
»Dad! Lauf weg!«
Gideon stürmte die Auffahrt hinunter, auf die Vordertreppe zu.
»Du darfst nicht auf meinen Vater schießen!«, schrie der Junge und schlug weiter auf den Wissenschaftler ein.
»Schaltet die Strahlen ab!«, schrie Chalker, wirbelte herum, weil ihn das Kind ablenkte, und schwenkte den Revolver hin und her, als suche er ein Ziel.
Gideon warf sich mit einem Satz auf Chalker, doch der Schuss löste sich, ehe Gideon ihn überwältigen konnte. Er warf den Wissenschaftler zu Boden, packte seinen Unterarm und schlug ihn so gegen das Geländer, dass er brach wie ein Stück Feuerholz und ihm der Revolver aus der Hand fiel. Chalker schrie vor Schmerz. Hinter ihm ertönten die herzzerreißenden Rufe des Jungen, der sich über seinen Vater beugte, der flach ausgestreckt auf dem Boden lag; die eine Seite seines Kopfes war verschwunden.
Chalker wand sich unter Gideon wie eine Schlange, schrie wie am Spieß, seine Spucke flog …
… und dann kamen die Männer vom mobilen Einsatzkommando durch die Tür gestürmt und stießen Gideon unsanft zur Seite. Er spürte, wie ihm warmes Blut und Hautfetzen auf die eine Seite des Gesichts spritzten, während eine Gewehrsalve Chalkers irre Schreie zum Verstummen brachte.
Die folgende jähe, fürchterliche Stille währte nur einen Augenblick. Und dann begann irgendwo im Inneren des Hauses ein kleines Mädchen zu weinen. »Mami blutet! Mami blutet!«
Gideon setzte sich auf die Knie und erbrach sich.
5
Die Angehörigen des mobilen Einsatzkommandos, die Leute von der Spurensicherung und die Notfallmediziner stürmten ins Haus, und sofort war das ganze Areal voller Menschen. Gideon saß auf dem Boden und wischte sich geistesabwesend das Blut aus dem Gesicht. Er war fix und fertig. Keiner nahm Notiz von ihm. Die Szenerie hatte sich jäh verändert – von einer angespannten Pattsituation zu kontrolliertem Handeln. Alle spielten ihren Part, jeder hatte eine Aufgabe zu erledigen. Die beiden schreienden Kinder wurden eilig hinausgebracht; Notfallmediziner knieten über den drei Personen, die niedergeschossen worden waren; die Teams des mobilen Einsatzkommandos durchsuchten eilig das Haus; die Polizisten begannen, Absperrbänder anzubringen und den Tatort zu sichern.
Gideon erhob sich ein wenig unsicher und lehnte sich mit dem Rücken gegen eine Wand. Er konnte kaum stehen, atmete noch immer schwer. Einer der Sanitäter kam auf ihn zu. »Wo sind Sie verletzt?«
»Ist nicht mein Blut.«
Der Sanitäter untersuchte ihn dennoch und tastete den Bereich ab, auf den Chalkers Blut gespritzt war. »In Ordnung. Aber lassen Sie mich das ein wenig säubern.«
Gideon versuchte, sich auf die Worte des Sanitäters zu konzentrieren, die in den Gefühlen des Ekels und der Schuld, die ihn überwältigten, beinahe untergingen.
Wieder. O mein Gott, es ist wieder passiert. Die Präsenz der Vergangenheit, die schrecklich filmische und lebendige Erinnerung an den Tod seines Vaters war so stark, dass Gideon eine Art geistiger Lähmung verspürte, eine Unfähigkeit, etwas anderes als die hysterische Wiederholung des Wortes wieder zu denken.
»Wir müssen den Bereich hier frei räumen«, sagte einer der Polizisten und drängte sie zur Tür. Gleichzeitig legten die Mitglieder des Spurensicherungsteams eine Plane aus und begannen, ihre kleinen Sporttaschen darauf abzustellen, um ihre Gerätschaften auszupacken.
Der Sanitäter fasste Gideon am Arm. »Gehen wir.«
Gideon ließ sich führen. Die Leute vom Spurensicherungsteam öffneten ihre Taschen und holten Werkzeuge, kleine Wimpel, Klebeband, Teströhrchen und Beweismittelbeutel hervor, streiften sich Latexhandschuhe über, setzten sich Haarnetze auf und zogen Plastikfüßlinge über. Rings um Gideon herum beruhigte sich die Atmosphäre. Die Angespanntheit und die Hysterie ließen nach und wichen schlichtem Professionalismus. Was ein Drama auf Leben und Tod gewesen war, war nur mehr eine Reihe von Checklisten, die ausgefüllt werden mussten.
Fordyce erschien wie aus dem Nichts. »Gehen Sie nicht weit weg«, sagte er leise und fasste ihn am Arm. »Wir müssen noch den Einsatz nachbesprechen.«
Als Gideon das hörte, sah er Fordyce an, während seine Gedanken langsam klarer wurden. »Sie haben das alles mit angesehen – was gibt es da nachzubesprechen?« Gideon wollte nur eines: schleunigst von hier weg, zurück nach New Mexico, diese Horrorshow vergessen.
Fordyce hob die Schultern. »So machen wir das nun mal.«
Gideon fragte sich, ob man ihm wohl die Schuld am Tod der Geisel geben würde. Vermutlich. Und zu Recht. Er hatte es vermasselt. Plötzlich wurde ihm wieder übel. Wenn er nur etwas anderes gesagt hätte, das Richtige, oder vielleicht den Ohrhörer dringelassen, vielleicht hätten sie dann den Ausgang kommen sehen und ihm etwas gesagt, das geholfen hätte … Er war zu nah dran an der Situation gewesen, außerstande, sie von der Erschießung seines Vaters zu trennen. Er hätte sich niemals von Glinn zu diesem Auftrag überreden lassen dürfen. Zu seinem Entsetzen wurde ihm klar, dass ihm Tränen in die Augen stiegen.
»Hey«, sagte Fordyce. »Kein Problem. Machen Sie sich nichts draus. Sie haben zwei Kinder gerettet. Und die Frau wird durchkommen – ist nur eine Fleischwunde.« Gideon spürte, wie Fordyce seinen Arm fester drückte. »Wir müssen jetzt gehen, der Tatort wird gesichert.«
Gideon holte tief und erschauernd Luft. »Okay.«
Während sie langsam in Richtung Tür gingen, lag plötzlich etwas Seltsames in der Luft, so als sei gerade ein kühler Wind durchs Haus geweht. Aus dem Augenwinkel sah Gideon, wie eine Frau aus dem Spurensicherungsteam erschrocken innehielt. Zugleich hörte er ein lautes, seltsam vertrautes Klicken, doch in dem Nebel aus Schuld und Übelkeit, der in seinem Kopf herrschte, konnte er es nicht gleich unterbringen. Er blieb stehen, während die Spurenermittlerin zu ihrer Tasche hinüberging, darin herumkramte und ein gelbes Gerät mit einer Messanzeige und einem Handrohr an einem langen, spiraligen Draht hervorholte. Gideon erkannte es sofort.
Ein Geigerzähler.
Das Gerät klickte leise, aber regelmäßig, die Nadel sprang bei jedem Klicken nach oben. Die Frau warf ihrem Partner einen Blick zu. Im ganzen Raum war es still geworden. Gideon sah zu, sein Mund wurde trocken.
In der jähen Stille im Haus wurden die leisen Klickgeräusche seltsam verstärkt. Die Frau stand auf, hielt den Geigerzähler vor sich hin und schwenkte ihn langsam durch den Raum. Das Gerät zischte, das Klicken wurde abrupt schneller. Sie zuckte entsetzt zusammen. Dann beherrschte sie sich wieder, trat einen Schritt vor und begann – fast widerstrebend –, das Gerät in die Richtung von Chalkers Leiche zu drehen.
Während sich das Zählrohr dem Leichnam näherte, nahmen die Klickgeräusche an Lautstärke und Häufigkeit rapide zu, ein infernalisches Glissando, das zu einem Zischen, einem Dröhnen und schließlich einem Kreischen wurde, als die Nadel des Geräts ganz bis in den roten Bereich ausschlug.
»O mein Gott«, murmelte die Frau, trat zurück und blickte mit weit aufgerissenen Augen auf die Messanzeige. Plötzlich ließ sie das Gerät fallen, drehte sich um und rannte aus dem Haus. Das Gerät krachte zu Boden, das Dröhnen des Zählers erfüllte die Luft, wurde lauter und leiser, während das Rohr hin und her rollte.
Und dann war der ganze Raum in panischer Bewegung, jeder drängelte sich Richtung Haustür, schubste, stieß, versuchte, als Erster aus dem Haus zu kommen. Die Leute vom Spurensicherungsteam fielen in Laufschritt, gefolgt von den Fotografen, Polizisten und den Männern des mobilen Einsatzkommandos. Alle flohen planlos und drängten zur Tür hinaus, wobei jede Art geordneter Ablauf verlorenging. Gideon und Fordyce wurden mit der menschlichen Welle hinausgetragen. Im nächsten Augenblick fand sich Gideon auf der Straße vor dem Haus wieder.
Erst jetzt begann er zu begreifen. Er wandte sich zu Fordyce um. Der Agent war kreidebleich.
»Chalker war heiß, radioaktiv«, sagte Gideon. »Heißer als die Hölle.«
»So sieht es aus.«
Fast ohne nachzudenken, berührte Gideon das restliche Blut, das auf seiner einen Gesichtshälfte trocknete. »Und wir waren der Strahlung ausgesetzt.«
6
Eine dramatische Veränderung war in der Menge aus Polizisten und Einsatzkräften vor sich gegangen, die sich hinter den Barrikaden versammelt hatten. Der Eindruck konzentrierter Aktivität und zielstrebigen Kommen und Gehens der Uniformierten löste sich auf. Das erste Anzeichen dafür war eine Welle des Schweigens, die sich nach außen ausbreitete. Selbst Fordyce war still, und Gideon hörte, dass jemand durch den Ohrhörer mit ihm redete.
Fordyce drückte die Hand gegen den Ohrhörer und wurde beim Zuhören noch blasser. »Nein«, sagte er vehement. »Auf keinen Fall. Ich bin nicht nahe genug an den Typen herangekommen. Das können Sie nicht machen.«
Die Menge war ebenfalls reglos geworden. Selbst diejenigen, die aus dem Haus geflohen waren, hielten inne, stierten und lauschten, als seien sie kollektiv wie betäubt. Und dann setzte sich die Menge abrupt wieder in Bewegung – eine Gegenbewegung, fort vom Haus. Das Ganze glich weniger einem ungeordneten Rückzug als einem gesteuerten Rückstoß.
Gleichzeitig ertönten wieder Sirenen. Kurz darauf tauchten Hubschrauber am Himmel auf. Eine Reihe weißer, unbeschrifteter Lieferwagen traf vor den Absperrungen ein, eskortiert von zusätzlichen Streifenwagen. Die Hecktüren öffneten sich, und fremdartig gekleidete Gestalten stiegen heraus, in Schutzanzügen mit Biogefährdungs- und Radioaktivitäts-Warnzeichen darauf. Einige hatten Ausrüstung zur Aufruhrbekämpfung dabei: Schlagstöcke, Tränengasgewehre und Elektroschockwaffen. Dann begannen sie zu Gideons Bestürzung, vor der abziehenden Menge Absperrgitter aufzustellen und damit deren Rückzug zu blockieren. Sie riefen den Leuten zu, sie sollten sich nicht vom Fleck rühren, sondern dort bleiben, wo sie waren. Das hatte eine dramatische Wirkung: Als die Leute merkten, dass sie möglicherweise daran gehindert würden zu fliehen, setzte die Panik erst richtig ein.
»Was zum Teufel geht hier vor?«, fragte Gideon.
»Vorgeschriebenes Screening«, antwortete Fordyce.
Weitere Barrieren wurden errichtet. Gideon sah, wie ein Polizist zu streiten anfing und sich an einer Sperre vorbeizudrängen versuchte, nur um von mehreren Männern in Weiß zurückgedrängt zu werden. Unterdessen dirigierten die Neuankömmlinge alle Personen in einen Bereich, der hastig errichtet worden war, eine Art Pferch mit Maschendraht drum herum, in dem weitere Gestalten in Weiß die Leute mit tragbaren Geigerzählern abtasteten. Die meisten wurden freigelassen, doch ein paar wurden in die Lieferwagen gebracht.
Ein Lautsprecher ertönte: »Alle Mitarbeiter bleiben auf ihren Posten, bis sie andere Anweisungen erhalten. Leisten Sie den Anweisungen Folge. Bleiben Sie hinter den Absperrungen.«
»Was sind das für Leute?«, fragte Gideon.
Fordyce wirkte angewidert und verängstigt zugleich. »NEST.«
»NEST?«
»Das Nuclear Emergency Support Team. Es untersteht dem Energieministerium und kommt bei nuklearen oder radiologischen Terrorangriffen zum Einsatz.«
»Glauben Sie, das hier könnte einen terroristischen Hintergrund haben?«
»Dieser Chalker hat immerhin Atomwaffen mitentwickelt.«
»Selbst wenn, die Annahme ist ziemlich weit hergeholt.«
»Tatsächlich?«, sagte Fordyce, wandte sich langsam zu Gideon um und blickte ihn aus seinen blauen Augen an. »Vorhin haben Sie erwähnt, Chalker sei fromm geworden.« Er hielt inne. »Darf ich fragen, welcher Religion er sich angeschlossen hat?«
»Äh, dem Islam.«
7
Alle, bei denen die Geigerzähler ausschlugen, wurden wie Vieh in den Van getrieben. Die Schaulustigen hatten sich aus dem Staub gemacht, nur ihre Partyhütchen und Bierdosen lagen noch überall herum. Gruppen von Leuten in Schutzanzügen gingen von Tür zu Tür, holten die Leute aus ihren Häusern, manchmal mit Gewalt, und schufen dadurch ein chaotisches, aber auch mitleiderregendes Bild: weinende ältere Leute, die mit ihren Gehwagen umherschlurften, hysterische Mütter und schreiende Kinder. Aus Lautsprechern ertönte die Anweisung, man solle Ruhe bewahren und kooperieren, wobei allen versichert wurde, es sei zu ihrem eigenen Schutz. Kein Wort über Strahlung.
Gideon und die anderen saßen dichtgedrängt auf parallelen Sitzbänken. Die Türen knallten zu, und der Van fuhr an. Fordyce, ihm gegenüber, schwieg weiter grimmig, aber die meisten anderen Leute, die in dem Van eingepfercht waren, schienen Angst zu haben. Unter ihnen war ein Mann, den Fordyce als den Psychologen Hammersmith vorstellte und dessen Hemd blutverschmiert war, sowie ein Angehöriger des mobilen Einsatzkommandos, der Chalker auf kurze Entfernung erschossen hatte und nun ebenfalls mit seinem Blut dekoriert war. Radioaktivem Blut.
»Wir sind am Arsch«, sagte der Typ vom Einsatzkommando, ein großer, muskulöser Mann mit kräftigen Unterarmen und einer unpassend hohen Stimme. »Wir werden sterben. Die können nichts dagegen machen. Nicht, wenn wir verstrahlt sind.«
Gideon schwieg. Entsetzlich, wie wenig die Leute über Strahlung wussten.
Der Mann stöhnte. »Gott, mein Kopf hämmert. Es fängt schon an.«
»Hey, halten Sie den Mund«, sagte Fordyce.
»Fick dich, Mann«, brauste der andere auf. »Für diesen Scheiß habe ich nicht angeheuert.«
Fordyce schwieg, sein Kinn straffte sich.
»Hast du mich verstanden?« Der Mann hob die Stimme. »Für diesen Scheiß habe ich nicht angeheuert!«
Gideon warf dem Angehörigen des Einsatzkommandos einen kurzen Blick zu und sagte leise und deutlich: »Das Blut an Ihnen ist radioaktiv. Sie sollten sich lieber ausziehen. Und Sie auch.« Er warf Hammersmith einen kurzen Blick zu. »Jeder, der auf einem Kleidungsstück Blut des Geiselnehmers hat, sollte es ausziehen.«
Der Satz löste im Van hektische Aktivität aus, und die Panik verstärkte sich – eine lächerliche Szene. Alle zogen sich plötzlich aus und versuchten, Blut aus ihrem Haar und von ihrer Haut zu entfernen. Alle, bis auf den Typen vom Einsatzkommando. »Was spielt das noch für eine Rolle?«, sagte er. »Wir sind am Arsch. Fäule, Krebs, was ihr wollt. Wir sind sowieso schon so gut wie tot.«
»Niemand wird sterben«, sagte Gideon. »Alles hängt davon ab, wie stark Chalker kontaminiert war und mit welcher Art von Radioaktivität wir es hier zu tun haben.«
Der Typ vom Einsatzkommando hob den massigen Kopf und starrte ihn aus roten Augen an. »Was macht Sie eigentlich zu so einem spitzenmäßigen Atomwissenschaftler?«
»Dass ich zufällig ein spitzenmäßiger Atomwissenschaftler bin.«
»Schön für dich, du Pimpf. Dann weißt du ja auch, dass wir alle tot sind und du ein Scheißlügner bist.«
Gideon entschloss sich, den Mann zu ignorieren.
»Du lügnerischer Furz.«
Furz? Wieder betrachtete Gideon den Mann genervt. War er vielleicht auch durch die Strahlungsdosis verrückt geworden? Aber nein, das hier war schlicht blinde Panik.
»Ich rede mit dir, Bürschchen. Und lüg mich ja nicht an.«
Gideon strich sich mit den Fingern die Haare aus dem Gesicht und blickte wieder zu Boden. Er war müde, der Blödmann ging ihm auf die Nerven, alles ging ihm auf die Nerven, sogar das Leben selbst. Er hatte nicht mehr die Kraft, mit einer geistig minderbemittelten Person zu streiten.
Plötzlich stand der Kerl auf, packte Gideon am Hemd und hob ihn vom Sitz. »Ich habe dir eine Frage gestellt. Schau nicht weg.«
Gideon sah ihn an: das rote Gesicht, die Adern, die am Hals hervortraten, die Schweißperlen auf der Stirn, die bebenden Lippen. Der Mann sah dermaßen einfältig aus, dass er nicht umhinkonnte, zu lachen.
»Findest du das komisch?« Der Mann machte eine Faust, als wolle er gleich zuschlagen.
Fordyce’ Hieb in die Magengrube des Polizisten kam so schnell wie der Angriff einer Klapperschlange. Der Mann gab ein Uff! von sich und sackte auf die Knie. Eine Sekunde später hielt Fordyce ihn im Schwitzkasten. Er beugte sich vor und sagte ihm etwas ins Ohr, so leise, dass Gideon es nicht verstand. Dann ließ er den Mann los, der aufs Gesicht fiel, stöhnte und nach Luft schnappte. Schließlich richtete er sich mühsam wieder auf.
»Setzen Sie sich hin, und seien Sie still«, sagte Fordyce.
Der Mann nahm wortlos Platz. Kurz darauf begann er zu weinen.
Gideon zog sein Hemd glatt. »Danke, dass Sie mir das abgenommen haben.«
Fordyce schwieg.
»Na, jetzt wissen wir wenigstens Bescheid«, meinte Gideon nach einem Moment.
»Was?«
»Dass Chalker nicht völlig verrückt war. Er litt an einer Strahlungsvergiftung – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Gammastrahlen. Eine massive Dosis von Gammastrahlen bringt im Kopf alles durcheinander.«
Hammersmith hob den Kopf. »Woher wissen Sie das?«
»Jeder, der in Los Alamos mit Radionukliden arbeitet, muss sich mit den Kritikalitäts-Unfällen auskennen, die sich dort während der Anfangszeit ereignet haben. Cecil Kelly, Harry Daghlian, Louis Slotin, der Dämon-Kern.«
»Der Dämon-Kern?«, fragte Fordyce.
»Der Kern einer Plutoniumbombe, der zweimal falsch gehandhabt wurde. Er wurde jedes Mal kritisch, tötete die Wissenschaftler, die mit ihm hantierten, und verstrahlte einen Haufen andere. Er wurde schließlich neunzehnhundertsechsundvierzig beim Kernwaffentest ›Able‹ eingesetzt. Unter anderem erfuhr man anhand des Dämon-Kerns, dass eine hohe Dosis Gammastrahlung eine Person verrückt macht. Die Symptome sind dieselben wie die, die Sie eben bei Chalker erlebt haben – Geistesverwirrung, Raserei, Kopfschmerzen, Erbrechen und ein unerträglicher Schmerz im Bauch.«
»Das wirft ein völlig neues Licht auf die Sache«, sagte Hammersmith.
»Die wahre Frage«, sagte Gideon, »ist die Form, die diese Verrücktheit angenommen hat. Warum hat Chalker behauptet, dass man ihm Strahlen in den Kopf gejagt hat? Wurden Experimente an ihm durchgeführt?«
»Ich fürchte, dabei handelt es sich um das klassische Symptom einer Schizophrenie«, sagte Hammersmith.
»Ja, aber Chalker litt nicht an Schizophrenie. Und warum hat er gesagt, dass seine Vermieter Regierungsagenten sind?«
Fordyce hob den Kopf und blickte Gideon an. »Sie glauben doch wohl nicht, dass dieses arme Schwein von Vermieter tatsächlich ein Regierungsagent war, oder?«
»Nein. Aber ich frage mich, warum Chalker immer wieder von Experimenten gesprochen hat, warum er abgestritten hat, dass er in dem Apartment wohnte. Das ergibt keinen Sinn.«
Fordyce schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, für mich ergibt das alles allmählich doch einen Sinn. Sehr viel Sinn.«
»Wie das?«, fragte Gideon.
»Denken Sie doch mal nach. Der Mann arbeitet in Los Alamos. Er hat den höchsten Sicherheitsstatus. Entwickelt Atombomben. Konvertiert zum Islam. Verschwindet zwei Monate lang. Und als Nächstes taucht er verstrahlt in New York City auf.«
»Also?«
»Also hat sich der Dreckskerl einem Dschihad angeschlossen! Mit seiner Hilfe haben diese Leute einen Nuklearkern in die Finger bekommen. Den haben sie falsch behandelt, genauso wie den Dämon-Kern, von dem Sie gesprochen haben, und Chalker hat sich dabei den Arsch verstrahlt.«
»Chalker war kein Radikaler«, sagte Gideon. »Sondern eher ein stiller Typ. Er hat seinen Glauben für sich behalten.«
Fordyce lachte verbittert. »Es sind immer die Stillen.«
Im Van war es ruhig geworden. Jetzt hörten alle wie gebannt zu. Gideon beschlich ein Gefühl des Entsetzens. Was Fordyce gesagt hatte, klang irgendwie plausibel. Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr wurde ihm klar, dass der Mann vermutlich recht hatte. Chalker hatte wirklich die entsprechende Persönlichkeit. Er war genau die Art unsichere, verwirrte Person, die ihre Berufung in einem Dschihad findet. Und es gab keine andere Möglichkeit, die starke Dosis Gammastrahlen zu erklären, der er ausgesetzt gewesen sein musste, um so radioaktiv geworden zu sein.
»Wir sollten den Tatsachen ins Auge blicken«, sagte Fordyce, während der Van das Tempo drosselte. »Der ultimative Alptraum ist wahr geworden. Islamistische Terroristen haben sich eine Atombombe besorgt.«
8
Die Türen des Vans öffneten sich, und vor ihnen lag ein unterirdischer, garagenähnlicher Raum, in den sie durch einen mit Kunststoff ausgekleideten Tunnelgang getrieben wurden. Gideon, der wusste, dass ihre radioaktive Kontamination vermutlich zweitrangig und ziemlich gering war, kam das alles des Guten zu viel vor; die Maßnahme war eher dazu geeignet, irgendeine bürokratische Vorschrift einzuhalten als sonst etwas.
Sie wurden in einen Hightech-Warteraum gedrängt, in dem alles aus Chrom und Emaille und Edelstahl bestand und an allen Wänden Monitore und Computerdisplays blinkten. Alles war neu und offensichtlich noch nie benutzt worden. Sie wurden nach Geschlechtern getrennt, entkleidet, dreimal geduscht, gründlich untersucht, gebeten, Blutproben abzugeben, bekamen Spritzen, wurden mit sauberer Kleidung ausgestattet, nochmals getestet und durften dann schließlich einen zweiten Warteraum betreten.
Dieser war eine erstaunliche unterirdische Einrichtung, nagelneu und auf der Höhe der Zeit, also zweifellos nach dem elften September gebaut, als Maßnahme für den Fall eines radioaktiven Terrorangriffs auf die Stadt. Gideon erkannte verschiedene Geräte zum Testen und Dekontaminieren von Radioaktivität, wohl Neuentwicklungen, wie sie ihm in Los Alamos noch nicht begegnet waren. So außergewöhnlich der Ort war, so wenig wunderte sich Gideon: New York brauchte mit Sicherheit ein großes Dekontaminationszentrum wie dieses.
Ein Wissenschaftler betrat lächelnd den Warteraum, er trug einen normalen weißen Laborkittel. Er war die erste Person, mit der sie Kontakt hatten, die keinen Schutzanzug trug. Begleitet wurde er von einem kleinen, düster wirkenden Mann in dunklem Anzug, der trotz seiner geringen Körpergröße Macht zu verkörpern schien. Gideon erkannte ihn auf der Stelle: Das war Myron Dart, Vizedirektor von Los Alamos, als Gideon dort zu arbeiten angefangen hatte. Dart war von Los Alamos zu irgendeiner Regierungsbehörde versetzt worden. Gideon hatte ihn nicht gut gekannt, aber er war ihm stets kompetent und fair erschienen. Er fragte sich, wie Dart wohl mit diesem Notfall umgehen würde.
Der heitere Wissenschaftler ergriff das Wort. »Ich bin Dr. Berk, und Sie sind jetzt alle dekontaminiert«, sagte er und lächelte sie an, als hätten sie gerade ein Examen bestanden. »Wir werden Sie einzeln beraten, danach sind Sie frei, Ihr ganz normales Leben wieder aufzunehmen.«
»Wie stark war die Strahlenbelastung?«, fragte Hammersmith.
»Sehr gering. Der Berater wird mit jeder Person seine oder ihre tatsächlichen Strahlenwerte besprechen. Die Strahlenbelastung des Geiselnehmers ereignete sich woanders, nicht vor Ort, zudem unterscheiden sich Strahlenbelastungen von Erkältungen. Man kann sich damit nicht bei jemandem anstecken.«
Jetzt trat Dart vor. Er war älter, als Gideon ihn in Erinnerung hatte, das Gesicht lang und schmal, mit Hängeschultern. Seine Garderobe war wie üblich tadellos: grauer Anzug mit dezenten Nadelstreifen, sehr gute Passform, wobei ihm die lavendelfarbene Seidenkrawatte allerdings ein unerwartet modisches Aussehen verlieh. Er verströmte große Selbstsicherheit. »Mein Name ist Dr. Myron Dart, ich bin der Leiter des Nuclear Emergency Support Teams, kurz NEST. Es gibt da etwas sehr Wichtiges, was ich Ihnen allen sagen muss.« Dart verschränkte die Hände hinter dem Rücken; mit seinen grauen Augen musterte er die Gruppe, langsam und bewusst, so als wolle er gleich mit jedem Einzelnen sprechen. »Bisher ist die Nachricht, dass es sich hier um einen Atomunfall handelt, noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Sie können sich die Panik sicherlich vorstellen, wenn es dazu käme. Jeder von Ihnen muss absolutes Stillschweigen bewahren über das, was heute geschehen ist. Es gibt nur zwei Wörter, die Sie kennen müssen: kein Kommentar. Das gilt für jeden, der Sie fragt, was passiert ist, von Reportern bis zu Familienangehörigen. Und man wird Sie fragen.« Er machte eine Pause. »Sie alle werden vor Ihrer Entlassung eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Ich fürchte, Sie werden erst entlassen, wenn Sie diese Papiere unterschrieben haben. Es gibt strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen für die Verletzung der Bedingungen der Geheimhaltung, die in den Dokumenten im Einzelnen genannt werden. Tut mir leid, aber so muss es sein, und ich bin mir sicher, Sie haben Verständnis dafür.«
Niemand sagte ein Wort. Dart selbst hatte freundlich gesprochen, doch etwas an seinem gelassenen Tonfall verriet Gideon, dass er es ernst meinte.
»Ich entschuldige mich«, sagte Dart, »für die Unannehmlichkeiten und den Schreck. Zum Glück scheint es, dass Sie alle nur einer geringen bis gar keiner Strahlung ausgesetzt waren. Ich übergebe Sie nun in die sehr kompetenten Hände von Dr. Berk. Guten Tag.«
Und damit ging er.
Der Arzt warf einen Blick auf sein Klemmbrett. »Also. Wir werden alphabetisch vorgehen.« Jetzt gab er sich wie ein Betreuer im Camp. »Sergeant Adair und Officer Corley, würden Sie bitte mitkommen?«
Gideon blickte sich in der versammelten Gruppe um. Der Angehörige des mobilen Einsatzkommandos, der im Van ausgerastet war, befand sich nicht mehr unter ihnen; Gideon glaubte, den Mann leise irgendwo in dieser riesigen Anlage schreien und drohen zu hören.
Plötzlich ging die Tür auf, und Myron Dart betrat erneut den Raum, begleitet von Manuel Garza. Dart schien ernsthaft wütend zu sein. »Gideon Crew?« Sein Blick heftete sich auf Gideon, der glaubte, in den Augen ein Wiedererkennen zu entdecken.
Gideon erhob sich.
Garza kam herüber. »Gehen wir.«
»Aber …«
»Keine Diskussion.«
Garza ging rasch zur Tür, Gideon beeilte sich, Schritt zu halten. Als sie an Dart vorbeikamen, sah der ihn mit kühlem Lächeln an. »Sie haben ja interessante Freunde, Dr. Crew.«
9
Während der erwartungsgemäß langen Fahrt durch den stockenden Verkehr zur Little West 12th Street sagte Garza kein Wort. Er richtete den Blick stur geradeaus und konzentrierte sich aufs Fahren. Die nächtlichen Straßen von New York waren wie immer: ein Meer aus Licht, Betriebsamkeit, Lärm und Hektik. Gideon spürte Garzas Ablehnung, die von seinem Gesicht und seiner Körpersprache ausging. Gideon war das egal. Durch das Schweigen konnte er sich auf etwas vorbereiten, das, da war er ganz sicher, ein unangenehmes Gespräch werden würde. Er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, was Glinn jetzt von ihm wollte.
Im Alter von zwölf Jahren war er Zeuge geworden, wie sein Vater von Scharfschützen des FBI erschossen wurde. Sein Vater hatte als ziviler Kryptologie-Experte für INSCOM(United States Army Intelligence and Security Command) gearbeitet, als Mitglied der Gruppe, die Geheimcodes entwickelte. Die Sowjets knackten einen der Codes nur vier Monate nach seiner Einführung, und sechsundzwanzig Agenten und Doppelagenten waren in einer Nacht aufgeflogen, gefoltert und getötet worden. Es war eines der größten Spionage-Desaster des Kalten Krieges. Man hatte behauptet, sein Vater sei daran schuld gewesen. Dieser, der schon immer unter Depressionen gelitten hatte, war unter dem Druck der Anschuldigungen und Untersuchungen zerbrochen und hatte eine Geisel genommen. Daraufhin wurde er in der Eingangstür der Arlington Hall Station erschossen – und zwar, nachdem er sich ergeben hatte.
Gideon hatte das alles aus nächster Nähe miterlebt.
In den darauffolgenden Jahren war Gideons Leben aus den Fugen geraten. Seine Mutter fing an zu trinken. Männer gingen im Haus ein und aus. Gideon und seine Mutter zogen immer wieder von einer Stadt in die nächste, mal nach einer zerbrochenen Beziehung, mal nach einem Schulverweis. Während das Geld seines Vaters immer weniger wurde, lebten sie erst in Häusern, dann in Wohnungen, schließlich in Trailern, Motelzimmern und Pensionen. Seine stärkste Erinnerung an seine Mutter während dieser Jahre war, wie sie am Küchentisch saß, ein Glas Chardonnay in der Hand, umgeben von Zigarettenqualm, der sich vor ihrem verwüsteten Gesicht mit dem abwesenden Blick kräuselte. Im Hintergrund erklangen Chopins Nocturnes.
Gideon war ein Außenseiter und entwickelte die Interessen des Einzelgängers: Mathematik, Musik, Kunst und Lesen. Einer der Umzüge mit seiner Mutter – er war damals siebzehn – verschlug sie nach Laramie im Bundesstaat Wyoming. Eines Tages hatte er den örtlichen Kulturverein aufgesucht und den Tag damit zugebracht, die Zeit totzuschlagen, anstatt zur Schule zu gehen. Niemand würde ihn finden, denn wer käme schon darauf, hier nach ihm zu suchen? Der Kulturverein war in einem alten viktorianischen Gebäude untergebracht, ein verstaubtes Gewirr von Räumen mit dunklen Ecken, vollgestopft mit Erinnerungsstücken und Western-Tinnef – Revolver, mit denen Banditen erschossen worden waren, von denen niemand je gehört hatte, indianisches Kunsthandwerk, Kuriositäten aus der Pionierzeit, rostige Sporen, Bowie-Messer sowie eine bunte Sammlung von Gemälden und Zeichnungen.
Gideon fand Zuflucht in einem Zimmer im rückwärtigen Teil, wo er ungestört lesen konnte. Nach einer Weile wurde er auf einen kleinen Holzschnitt aufmerksam, einen von vielen Drucken, die ungeschickt plaziert und viel zu eng nebeneinander an einer Wand hingen. Der Druck stammte von einem Künstler, von dem er noch nie gehört hatte, Gustave Baumann, und trug den Titel Drei Kiefern. Eine schlichte Komposition, mit drei kleinen, krüppeligen Kiefern, die auf einem öden Gebirgskamm wuchsen. Aber je länger er das Blatt betrachtete, desto mehr fühlte er sich davon angezogen. Dem Künstler war es gelungen, den drei Bäumen ein Gefühl von Würde und Wert und so etwas wie eine fundamentale Baumheit zu verleihen.
Dieser hintere Raum im Kulturverein wurde zu Gideons Zufluchtsort. Nie fand man heraus, wo er steckte. Er hätte sogar auf seiner Gitarre spielen können, ohne dass die taube alte Dame, die am Eingangstresen döste, es je bemerkt hätte. Gideon wusste zwar nicht, wie oder warum, aber im Laufe der Zeit verliebte er sich in diese zerzausten Bäume.
Und dann wurde seine Mutter arbeitslos, und sie mussten mal wieder umziehen. Gideon hasste es, sich von dem Holzschnitt verabschieden zu müssen. Er konnte sich nicht vorstellen, das Bild nie wiederzusehen.
Und so stahl er es.
Dies stellte sich als eines der aufregendsten Dinge heraus, die er je getan hatte. Und dabei war es so leicht gewesen! Einige lässig gestellte Fragen enthüllten, dass der Kulturverein über so gut wie keine Sicherheitsvorrichtungen verfügte und dass der verstaubte Bestandskatalog nie überprüft wurde. So betrat Gideon also eines bitterkalten Wintertages das Gebäude, mit einem kleinen Schraubenzieher in der Gesäßtasche, nahm den Druck von der Wand und steckte ihn sich unter den Mantel. Bevor er ging, wischte er die Stelle an der Wand ab, an der der Druck gehangen hatte, um die Staubmarkierungen zu entfernen, und hängte zwei andere Drucke neu, um die Schraubenlöcher zu verdecken und die Lücke zu vertuschen. Das Ganze dauerte fünf Minuten, und als er fertig war, konnte niemand auch nur ahnen, dass ein Bild fehlte. Es war tatsächlich ein perfektes Verbrechen. Und Gideon sagte sich, dass es gerechtfertigt war – niemand liebte das Bild, niemand betrachtete das Bild, ja, niemand nahm es überhaupt wahr, und außerdem ließ es der Kulturverein einfach in einem dunklen Winkel verrotten. Er fühlte sich tugendhaft wie ein Vater, der ein ungeliebtes Waisenkind adoptiert.
Doch was für ein köstlicher Nervenkitzel es gewesen war! Eine geradezu körperliche Empfindung. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte er sich lebendig, sein Herz pochte, seine Sinne waren rasiermesserscharf. Die Farben wirkten heller; die Welt sah anders aus, wenigstens eine Zeitlang.
Er hängte das Bild über das Bett in seinem neuen Zimmer in Stockport im Bundesstaat Ohio. Seine Mutter bemerkte das Kunstwerk gar nicht und ließ nie eine Bemerkung darüber fallen.
Er war überzeugt, dass das Bild nahezu wertlos war. Doch einige Monate darauf, als er in einigen Auktionskatalogen blätterte, stellte er fest, dass es zwischen sechs- und siebentausend Dollar wert war. Zu der Zeit benötigte seine Mutter unbedingt Geld für die Miete, deshalb überlegte er, ob er den Druck verkaufen sollte. Doch er konnte sich nicht vorstellen, sich davon zu trennen.
Aber da brauchte er schon einen weiteren Nervenkitzel. Einen weiteren Schuss.
Und so fing er an, sich an der Muskingum Historical Site, einer nahegelegenen historischen Stätte, herumzutreiben, wo es eine kleine Sammlung von Radierungen, Stichen und Aquarellen gab. Er wählte eines seiner Lieblingsbilder aus, eine Lithographie von John Steuart Curry mit dem Titel Held der Prärie, und stahl das Kunstwerk.
Ein Kinderspiel.
Die Lithographie stammte aus einer Auflage von zweihundertfünfzig Blättern, deshalb war die Herkunft nicht zurückzuverfolgen. Auf dem offiziellen Markt war sie leicht zu verkaufen. Das Internet entstand gerade, was die Sache sehr viel leichter und anonymer machte. Gideon bekam achthundert Dollar für den Druck, und damit kam seine Karriere als Dieb – spezialisiert auf Kulturvereine und kleine Kunstmuseen – ins Rollen. Seine Mutter musste sich nie mehr wegen der Miete Sorgen machen. Er erfand vage Geschichten über Gelegenheitsjobs und dass er nach der Schule aushalf, und sie war zu benebelt und verzweifelt, um sich zu fragen, woher das Geld tatsächlich stammte.
Er stahl wegen des Geldes. Er stahl, weil er bestimmte Bilder liebte. Doch vor allem stahl er wegen des Nervenkitzels. Das Stehlen erzeugte ein Hochgefühl wie nichts sonst, ein Gefühl des Selbstwerts, des Schwebens über der engstirnigen, stupiden und bornierten Masse.
Er wusste, dass es keine noblen Gefühle waren, aber die Welt war ohnehin ein idiotischer Ort, warum also nicht die Regeln verletzen? Er schadete schließlich niemandem. Er kam sich vor wie Robin Hood, weil er Kunstwerke, die nicht genug geschätzt wurden, stahl und dafür sorgte, dass sie in die Hände von Menschen kamen, die sie wahrhaft liebten. Später dann ging er aufs College, schmiss schon bald das Studium und zog nach Kalifornien, wo er schließlich eine Vollzeitbeschäftigung daraus machte, kleine Museen, Büchereien und Kulturvereine heimzusuchen, zu verkaufen, was er musste, und den Rest zu behalten.
Und dann erhielt er den Anruf: Seine Mutter lag im Sterben, in einem Krankenhaus in Washington, D. C. Er fuhr zu ihr. Und auf dem Sterbebett erzählte sie ihm, dass sein Vater eben nicht