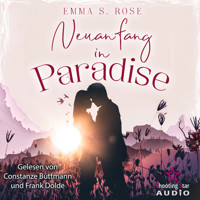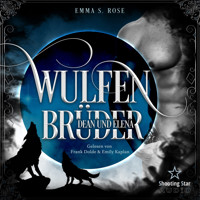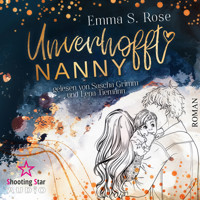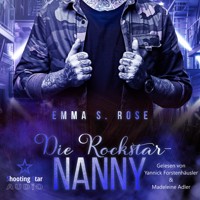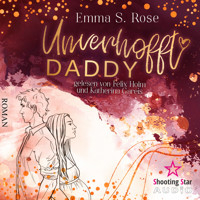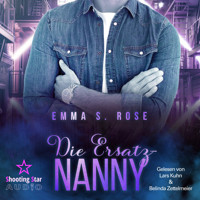3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felicia steht vor den Trümmern ihres Lebens. Nicht nur, dass ihre Eltern vor einigen Jahren bei einem Unfall starben und sie seitdem die Verantwortung für ihre jüngere Schwester trägt - jetzt hat sie auch noch ihren Job verloren und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Als sie in einer bedrohlichen Situation unerwartete Hilfe von dem gutaussehenden Chris bekommt, ahnt sie nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Dank ihm erhält sie kurz darauf eine Stelle im neuen It-Club Couture, und plötzlich scheint sich ihr Leben zum Guten zu wenden. Sie fühlt sich magisch zu Chris hingezogen, auch wenn er launisch ist und ständig andere Frauen an seiner Seite hat. Kann sie sich seiner Anziehungskraft erwehren? Und was stimmt nicht mit ihrer Schwester, die sich immer mehr von ihr abwendet? Teil 1 der Reihe rund um die Bar Couture. Es handelt sich um eine abgeschlossene Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
COUTURE
WENN LIEBE STÄRKER IST
EMMA S. ROSE
Couture – Wenn Liebe stärker ist
Emma S. Rose
1. Auflage
März 2017
© Emma S. Rose
Rogue Books, Inh. Carolin Veiland, Franz - Mehring - Str. 70, 08058 Zwickau
Umschlaggestaltung: Sarah Buhr, Covermanufaktur
Alle Rechte sind der Autorin vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Autorin gestattet.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung des Werkes in andere Sprachen, liegen alleine bei der Autorin. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu entsprechendem Schadensersatz.
Sämtliche Figuren und Orte in der Geschichte sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Orten entspringen dem Zufall und sind nicht von der Autorin beabsichtigt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Für meine Familie, die mich in einer schwierigen Zeit unterstützt hat, damit ich weitermachen kann.
Das vergesse ich euch nie.
Durch die Leidenschaften lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß.
NICOLAS CHAMFORT
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Danksagung
Newsletter
Über den Autor
1
»So eine verfluchte Scheiße!«
Entsetzt blickte ich in ein Paar äußerst wütender Augen. Es war, als würde jemand einen Eimer eiskalten Wassers direkt über meinem Kopf entleeren, immer und immer wieder, und gleichzeitig schoss heiße Scham in meine Wangen. Das hier war nicht gut, gar nicht gut.
»Sorry«, brachte ich hervor, krächzend und mit wackelnder Stimme, doch natürlich machte es das nicht besser.
»Sorry?«, keifte der Mann los. »Sorry? Ich glaub, ich spinne!«
»Beruhige dich, Mann!«, mischte sich ein anderer Typ ein - er stand direkt neben ihm und legte eine Hand auf seinen Oberarm, ganz so, als müsste er ihn zurückhalten. »Das geht wieder raus. War sicher nur ein Versehen.«
»Das geht wieder raus?«, äffte der Typ seinen Freund nach, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen. Eine steile Zornesfalte bildete sich auf seiner Stirn und entstellte sein Gesicht, das ich unter anderen Umständen sicherlich als hübsch empfunden hätte. Seine Stimme hatte einen schwer einzuordnenden Akzent. »Das hier ist ein verdammter Anzug von Armani, und ich habe gleich ein Meeting! Ich wollte hier nur meine Pause verbringen, nicht den Rest des Tages versauen!«
Ehe ich ein weiteres Wort über die Lippen bringen konnte, eilte schon eine Kollegin zu mir - eine, die in solchen Dingen wesentlich galanter sein konnte und wusste, was zu tun war, um den Kunden zu besänftigen. Nicht ganz freundlich schubste sie mich mit ihrem Ellenbogen beiseite, nur um dann mit eifriger Stimme auf den Mann einzureden, dessen Hemd ich soeben eindeutig ruiniert hatte.
Mein Magen verkrampfte sich, als ich den Rückzug antrat.
Es war schon das dritte Mal, dass mir ein derartiges Missgeschick geschah.
Sofort überrollte mich mit aller Macht die allumfassende Angst, die seit nunmehr vier Jahren immer und immer wieder mein ständiger Begleiter war. Keine Angst vor einem kleinen Rüffel oder vielleicht sogar einem handfesten Anschiss von meinem Chef, nein. Es war weitaus mehr.
Angst um die bloße Existenz.
Zögerlich warf ich einen Blick über meine Schulter - und erhaschte einen kurzen Blick auf das noch immer vor Wut verzerrte Gesicht des Mannes, dessen Outfit ich mit dunkelbraunen Kaffeeflecken verziert hatte. Er wirkte vielleicht ein kleines bisschen besänftigt, aber noch immer äußerst aufgebracht. Was auch immer meine Kollegin sagte, es schien eine Wirkung zu haben, wenn auch nur eine geringe.
»Du taugst echt zu gar nichts«, murmelte ich mir zu, als ich die letzten Schritte durch den Verkaufsraum hinter mich brachte, ehe ich durch die schwingende Holztür direkt in die Küche verschwand. »Verdammt nochmal!«
Mein Herz pochte schmerzhaft in meiner Brust.
Ich war mir sicher, dass ich nichts Falsches getan hatte. Nicht diesmal, nicht wie sonst. Seitdem ich in diesem kleinen Café arbeitete, hatte ich schon einige Male für Trubel gesorgt. Ein umgekipptes Tablett, vertauschte Rechnungen, Scherben, all so etwas. Heute hatte ich nun wirklich nicht verhindern können, mit diesem Mann zusammenzuprallen, der sich ganz plötzlich in meinen Weg gestellt hatte. Plötzlich wurde mir bewusst, dass dieser Typ nicht der Einzige war, dessen Outfit versaut wurde, und ein neuerlicher Fluch entkam meinen Lippen, als ich über die hellbraun verfärbte, feuchte, nach Kaffee duftende Bluse strich, die es unmöglich machte, wieder nach draußen in den überfüllten Verkaufsraum zu gehen. Natürlich hatte ich keinen Ersatz dabei. Ein weiterer Minuspunkt auf meiner langen Liste der Verfehlungen, die sich scheinbar nur allzu gerne fortführte.
»Verdammt nochmal, Felicia!«
Mit einem lauten Knall flog die Tür zur Küche auf - so schwungvoll, dass sie mit der Wand kollidierte, ehe sie wieder ins Schloss zurückfiel. Ich zuckte schuldbewusst zusammen, während ich mich meiner Kollegin zuwandte. »Ich habe das nicht extra gemacht!«, entfuhr es mir, ehe ich es verhindern konnte - eine wahrlich kindische Reaktion. Genervt biss ich mir auf die Wange.
Die leicht verbraucht aussehende Frau, die noch immer im Eingangsbereich stand und ihre Hände kampfeslustig in die Seiten gestemmt hatte, wirkte plötzlich sehr müde. »Das glaube ich dir sogar«, seufzte sie auf. Ihre Tonlage - fast schon mitleidig - hätte mich beruhigen müssen, doch meine Alarmglocken schrillten nur noch lauter. »Aber das ändert nichts daran, dass du einen sehr einflussreichen Kunden verärgert hast. Ich werde das dem Chef melden müssen, das weißt du, oder?«
Sofort preschte ich nach vorne. »Muss das wirklich sein? im Ernst, Brigitte, das war ein Unfall! Ich habe mich entschuldigt und du hast ihn beruhigt, reicht das nicht?«
Brigittes Blick wurde finster. Dann wedelte sie mit einem Zettel. »Die verdammte Reinigung des Hemdes geht auf unsere Kosten! Meinst du wirklich, das könnte ich verschweigen? Oder willst du es auf deine Kappe nehmen?«
Am liebsten hätte ich sofort »Ja« geschrien, doch die traurige Wahrheit war, dass ich nicht einmal für solch einen unerwarteten Posten genug Geld hatte. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Donnerschlag. »Du hast recht«, flüsterte ich mit leiser Stimme - und meine Arme sackten herab, kraftlos.
»Hoffen wir, dass er einen guten Tag hat.« Vermutlich wollte Brigitte mich damit lediglich aufbauen - doch das misslang ihr gehörig.
Mein Chef hatte selten gute Laune.
* * *
Zwei Stunden später stand ich auf der Straße. Ich konnte noch immer nicht glauben, dass mir das soeben passiert war. Mein Chef hatte mich tatsächlich vor die Tür gesetzt. Einfach so - als würde es keine Rolle spielen, dass ich mir in den vergangenen Monaten den Arsch aufgerissen hatte, als würde es niemanden interessieren, dass ich nicht nur mich selbst, sondern auch meine kleine Schwester über die Runden bringen musste. Scheiß auf die Probezeit! Scheiß auf meinen Chef und seine Prinzipien.
Und scheiß auf den Anzugträger!
Die Angst, die schon seit geraumer Zeit mein ständiger Begleiter war, sich immer wenige Zentimeter hinter mir befunden und kalten Atem in meinen Nacken gehaucht hatte, umfasste mich nun mit weit geöffneten Armen, ließ mein Herz schwer werden.
»Wie soll es nur weitergehen?«, wisperte ich in die Dämmerung, doch natürlich stand dort niemand, der mir antworten konnte.
Niemand, der mir antworten wollte.
Ein eiserner Ring legte sich um meine Brust und begann, sich immer enger zu schnüren. Ich wusste, dass ich mich am Rande einer Panikattacke befand, an einem äußerst bröckeligen Rand, der in ein tiefes Loch führte, doch in der Vergangenheit hatte ich solche Momente schon oft genug erlebt. Vielleicht nicht so heftig wie gerade, aber ich wusste, was zu tun war.
»Ruhig durchatmen«, presste ich durch zusammengebissene Zähne hervor. Jedes Wort kostete mich unglaublich viel Kraft, quälte sich mit Reißzähnen über meine Lippen, und meine Brust schien sich mehr und mehr zusammenkrampfen zu wollen ... doch dann bekam ich mich in den Griff. Es dauerte ein paar Minuten, in denen ich tief ein- und ausatmete, zittrig, dann immer fester werdend, und der Nebel vor meinem Auge zog sich langsam zurück.
»Du schaffst das schon«, murmelte ich mir zu, meine Stimme schon wieder fester, und fast, aber nur fast, glaubte ich meinen eigenen Worten. »Wir schaffen das schon.«
Ein Auto raste an der kleinen Gasse vorbei und riss mich urplötzlich aus meinen quälenden Gedanken. Lauter, aggressiver Hiphop strömte aus den geöffneten Fenstern und hüllte die Straße kurz in eine Kakofonie des Lärms.
Mehr brauchte ich nicht. Ich blinzelte, atmete noch ein letztes Mal tief durch und umfasste dann den Schulterriemen meiner kleinen, schwarzen Tasche fester. »Fick dich«, murmelte ich - an meinen Ex-Chef gerichtet, der mich mit diesen ausdruckslosen, kalten Augen angeschaut hatte. »Fickt euch alle!«
Wut nahm den Platz ein, den zuvor die Angst hatte einnehmen wollen, doch das hieß ich nur allzu gern willkommen. Wut kannte ich. Mit Wut konnte ich umgehen.
Die neue Energie brachte mich in Bewegung, und ich stolperte los - mir stand ein kleiner Fußmarsch bevor.
* * *
Ich lebte mit meiner kleinen Schwester in einem winzigen Ein-Zimmer-Apartment. Als wir die 35 Quadratmeter damals bezogen hatten, war es eigentlich nur eine Übergangslösung gewesen. Für gewöhnlich lebte in solchen Unterkünften eine einzelne Person, allerhöchstens ein Pärchen. Auch wenn Isabell und ich uns nahe standen - ein wenig mehr Privatsphäre hätte uns sicherlich gut getan. Doch wie so oft im Leben waren es nicht die persönlichen Wünsche, die eine Rolle spielten - nein. Es war das Geld, das darüber bestimmte, wie viel man sich leisten konnte, und von Geld hatten wir schon eine ganze Weile lang nicht mehr genug.
Aus der Übergangslösung war eine Dauerlösung geworden, derart zur Normalität, dass ich nur noch selten in Frage stellte, warum wir an solch einem Ort lebten - geschweige denn, dass wir Erinnerungen daran zuließen, wie es einmal gewesen war.
Was wir einmal hatten.
Was wir verloren hatten.
An diesem Abend fiel es mir schwer, nach Hause zu kommen. Die Wut, die mich wieder in Bewegung gebracht, die mich aus meiner Erstarrung gelöst hatte, hatte sich im Laufe des Weges nach und nach wieder verzogen und Platz geschaffen für eine so tiefe Müdigkeit, dass ich kurz davor gewesen war, mich auf einer Parkbank auszuruhen. Einzig die Angst, einzuschlafen und so zu einem leichten Opfer für Räuber zu werden, hatte mich vorangetrieben. Nun zitterte meine Hand, als ich mehrfach versuchte, den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür zu befördern. Immer wieder glitt ich ab, schaffte es nicht, den schmalen Schlitz zu treffen, und ein Gefühl von Enge breitete sich in meinem Hals aus - eines jener Art, das zum Vorboten eines Schreis werden konnte.
Es war einfach nur frustrierend.
Erneut flutete mich Wut, nur kurz und schwach, wie eine seichte Erinnerung an vorhin, und dann, endlich, glitt der Schlüssel mit einem leichten Kratzen ins Schloss und ich schaffte es, die verdammte Tür aufzusperren. Alles, was ich mir nun wünschte, war eine heiße Dusche. Danach dann mein Bett. Zu wissen, dass ich kurz davor war, all das zu erreichen, entlockte mir ein resignierendes Stöhnen. Kaum hatte ich die Tür aufgeschoben, sprang mir Isabell förmlich entgegen - mit fragendem Blick und erschrocken aufgerissenen Augen.
»Was suchst du denn hier, Feli?«
Ich brummte auf. »Bin wohl wieder daheim, was?«
»im Ernst, was machst du hier? Ich habe noch nicht mit dir gerechnet!«
Prüfend warf ich meiner kleinen Schwester einen Blick zu. Unter anderen Umständen hätte mich diese Fragerei vielleicht genervt - ich hatte einen nervenaufreibenden Nachmittag hinter mir. Derart gelöchert zu werden, war nicht gerade die Art von Begrüßung, die ich mir erhofft hatte. »Ich freue mich auch, dich zu sehen, Isabell«, erwiderte ich mit knurrender Stimme.
Vielleicht lag es an dem Tonfall, an der Art und Weise, wie meine Schultern herabgesackt waren, gepaart mit der Tatsache, dass ich früher als erwartet nach Hause gekommen war - doch plötzlich erhellte Erkenntnis die Züge meiner kleinen Schwester. Eine Erkenntnis, die nicht gerade positiv war.
»Du hast deinen Job verloren, oder?«, brachte sie hervor, und mit einem Schlag war der nervende Unterton aus ihrer Stimme verschwunden. Da war nichts mehr - nichts außer Angst und Unsicherheit.
Schuldgefühle fluteten mich, und sofort schossen Tränen in meine Augen. »Es ... es tut mir leid, Isa«, war alles, was ich hervorbringen konnte, ehe meine Stimme versagte. Als würde ein stillschweigendes Abkommen zwischen uns herrschen, fielen wir uns in die Arme, und für eine Weile hielten wir uns einfach nur - im Eingangsbereich des kleinen Apartments, ich immer noch in meine Jacke gehüllt und voller widersprüchlichster Gefühle.
Hilflos.
»Es tut mir leid«, wiederholte ich irgendwann, als die Schuldgefühle mich zu erdrücken drohten, doch fast im selben Augenblick fuhr meine Schwester mir über den Mund.
»Hör auf, ja?«, rief sie lauter als nötig. Sie rückte ein Stück von mir ab, blickte mich prüfend an. »Weißt du was? Ich habe eine Idee.« Dann zog sie mich in den Wohnraum und schubste mich auf die Couch - ganz gleich, dass ich noch in meinen Straßenklamotten steckte. »Fernsehen und Eis, das ist es, was du jetzt brauchst!«
* * *
Wir saßen eine gefühlte Ewigkeit beisammen, einfach so, ohne darüber zu reden, was uns nun bevorstand. Nach einer Weile hatte ich meine Schuhe von den Füßen gekickt und die Jacke von meinen Schultern geschüttelt, nur um mich tiefer in die abgewetzten Kissen unserer Couch zu kuscheln. Es war leichter als gedacht, sich von den Ereignissen des Tages zu lösen, um nicht mehr über das Drohende nachzudenken, sich stattdessen ganz auf den Moment zu konzentrieren.
Irgendwann bemerkte ich, wie müde ich war. Es wurde anstrengend, den flimmernden Bildern auf dem kleinen Fernseher zu folgen, weshalb ich gedankenverloren meine kleine Schwester betrachtete.
Vor wenigen Wochen war Isabell fünfzehn Jahre alt geworden. Sie machte eine sehr schwierige Zeit durch, was mir wieder einmal schmerzlich bewusst wurde, als ich die leicht unbeholfenen Schminkversuche betrachtete, die sich einen Weg in die kleinen Fältchen in ihren Augenwinkeln gegraben hatten. Reste von hellgrünem Lidschatten, etwas klumpige Mascara, ein zu weit gezogener Lidstrich. Offensichtlich hatte sie versucht, ihre hellgrauen Augen zu betonen, so wie ich es auch für gewöhnlich tat. Diese Tatsache versetzte mir einen Stich. Meine Schwester steckte mitten in der Pubertät, wollte sich nicht mehr verhätscheln lassen, zumindest die meiste Zeit. Und ganz offenbar versuchte sie, ihrer älteren Schwester nachzueifern. Es war kein gutes Gefühl, das zu sehen - nicht, weil es so offensichtlich unbeholfen aussah, sondern vielmehr, weil es mich daran erinnerte, dass meine kleine Schwester langsam aber sicher dem Bild entwuchs, das ich von ihr geschaffen hatte.
Sie wurde erwachsen, versuchte es zumindest.
Seufzend ließ ich meinen Kopf auf die Lehne fallen und schloss meine Augen. Nicht, dass sie nicht in den vergangenen Jahren bereits hatten lernen müssen, irgendwie erwachsen zu werden. Die Zeit war nicht spurlos an mir vorbeigegangen, wieso sollte es bei Isabell anders sein? So war das Leben, verdammt grausam ...
Und da war sie wieder. Die Erinnerung. Oder, noch besser, die Gewissheit. Ich hatte meinen Job verloren. Einen nicht gerade gut bezahlten und oftmals stressigen, aber einen zuverlässigen Job. Einen, mit dem ich in den vergangenen Monaten unseren Lebensunterhalt weitestgehend bestritten hatte. Der uns eine Sicherheit verschafft hatte.
Klar, wir hatten Isas Waisenrente. Sie war nicht volljährig, weshalb uns eine gewisse Unterstützung zukam. Doch das Geld reichte bei weitem nicht, um über die Runden zu kommen, nicht langfristig. Wir hatten die Miete, wir hatten laufende Kosten. Wir hatten Schulden abzubezahlen, die meine Eltern uns vererbt hatten.
Ja verdammt, man konnte auch rote Zahlen erben.
Und außerdem fiel es mir schwer, an Geld zu gehen, das ihr gehörte. Ich wollte so viel wie möglich davon für ihre Zukunft beiseitelegen.
Wie sollte es nun also weitergehen?
»Hey.« Isas Hand schob sich plötzlich über meine Faust, begann, beruhigend darüber zu streichen. »Du weißt schon, dass wir eine Lösung finden werden, oder?«
Ein Lachen platzte über meine Lippen, vermischt mit einem trockenen Schluchzer, als ich ein weiteres Mal meine Schwester in die Arme zog. Ich hoffte so sehr, dass sie Recht behielt - oh Gott, und wie sehr ich das hoffte!
2
Es sollte so einfach sein, einen neuen Job zu finden. Eigentlich hätte es einfach sein müssen. Immer wieder scannte ich die Annoncen in der Tageszeitung, suchte im Internet die Stellenbörsen ab und bewarb mich ein ums andere Mal auf alles, was mir einigermaßen passend erschien. Es gab genügend freie Stellen, doch leider gab es auch viele andere Bewerber, und so ergab sich auf die Schnelle kein Ersatz für mein verpatztes Café-Engagement. Dass ich nicht gerade mit der besten Qualifikation aufwarten konnte, erschwerte die Suche ungemein. Ich besaß keine Ausbildung in dem Sinne. Alles, was ich in meinen Lebenslauf schreiben konnte, war meine ausgiebige Schulbildung, die ich durchaus zufriedenstellend abgeschlossen hatte, und danach eine Reihe von Aushilfsjobs. Zuvor hatte ich schon bei einem Pizzabringdienst gearbeitet, in einer Tankstelle gejobbt, ein Büro geputzt und Zeitungen verteilt. Alles Stellen, mit denen ich, in unterschiedlichen Kombinationen, verzweifelt versucht hatte, mich und meine Schwester über Wasser zu halten. Alles nichts Langfristiges.
Und dabei brauchte ich genau das.
Die kommenden Tage waren bestimmt von meiner verzweifelten Suche nach einer neuen Alternative. Ich klapperte sogar die Stadt ab, in der Hoffnung, Aushänge in Schaufenstern zu finden, Aushänge, die einen Job versprachen. Doch alles, was ich fand, waren geringfügige Angebote. Nichts, womit wir hätten klarkommen können.
Und das war verdammt frustrierend.
In dieser Zeit dachte ich auch wieder häufiger daran, welcher Weg mir eigentlich von meinen Eltern geebnet worden war. Ich war mir sicher, dass die beiden sich im Grab umdrehen würden, wenn sie gewusst hätten, wie es nun um uns stand.
Dieser Gedanke trieb mir Tränen in die Augen.
Als meine Eltern vor einigen Jahren bei einem verdammten Unfall starben, war niemand auf diese Scheiße vorbereitet gewesen, wirklich niemand. Am allerwenigsten ich.
Viel zu schnell war ich erwachsen geworden, hatte keine andere Wahl, als mich von der Unbekümmertheit meiner Jugend zu verabschieden. Mit einem frischen Abitur in der Tasche und nicht viel mehr als einer Kostprobe des Uni-Lebens, musste ich dieser vielversprechenden Zukunftsperspektive wieder den Rücken kehren und der Tatsache ins Auge schauen, dass das Leben nur selten Wert darauf legte, es allen Beteiligten einfach zu machen. Keine zwanzig Jahre war ich alt, als ich zur Vollwaisen wurde, was für mich schon schlimm genug war, doch noch viel schlimmer für meine junge Schwester, die zu diesem Zeitpunkt kurz vor ihrem elften Geburtstag stand und sich mit vielen Dingen beschäftigte, aber ganz sicher nicht damit, dass unsere unverwundbaren Eltern plötzlich nicht mehr da sein könnten.
Und dann brach das Leben mit all seiner Brutalität über uns ein.
Ich dachte nicht gerne daran zurück. Es war schwierig, nicht in der Trauer zu ertrinken, wenn ich an unsere Eltern dachte, schwierig, nicht die schlimme Zeit vor Augen zu haben, die in der Zeit direkt nach diesem Vorfall unser Leben bestimmt hatte. All die Formalitäten, die zu erledigen waren, während uns die Trauer lähmte. All die Verpflichtungen. Das Elend.
Immer war ich mir sicher gewesen, dass es grausam war zu sterben. Heute wusste ich, dass es viel schlimmer war zurückzubleiben.
»Aber das alles hilft mir jetzt nicht weiter!«, murrte ich in die klamme Stille unseres Apartments und erschrak über meine raue Stimme. Doch natürlich hatte ich recht. Was nützte es, wenn ich mich traurigen Erinnerungen hingab, wenn ich mit dem Schicksal haderte und mich fragte, wie es hätte anders laufen sollen? Klar, ich hätte jetzt mitten im Studium stecken können. Ich hätte mitten drin sein können in meinen Bestrebungen, eine berufliche Perspektive zu erarbeiten. Ich hätte an den Wochenenden nach Hause pendeln, vielleicht einen Freund haben können, vielleicht auch nicht, ganz sicher aber hätte ich das Beste aus diesem Lebensabschnitt geholt.
Doch das hatte ich nicht. Ich konnte es nicht. Stattdessen musste ich. Ich musste Verantwortung übernehmen, musste zur Versorgerin werden, musste meine Träume zurückstecken und einfach funktionieren. Für mich, viel mehr jedoch für meine kleine Schwester, für Isabell, die noch viel mehr als ich selbst auf der Schwelle stand. Ich konnte eines Tages vielleicht mein Studium nachholen. Isabell hingegen musste überhaupt erst mal einen Schulabschluss schaffen.
Und so lange musste die große Schwester auch die große Verantwortung übernehmen.
Ein Klicken im Schloss ließ mich aufschrecken. Mein Blick huschte ungläubig zur Uhr. Hatte ich derart die Zeit vergessen?
Tatsächlich war das der Fall. Isabell kam von der Schule, an diesem Tag hatte sie lange Unterricht gehabt, bis vier, und ich hatte längst einkaufen und etwas kochen wollen. Das hatte ja herrlich geklappt.
»Hi Feli.« Isabell wirkte genervt, als sie den Wohnraum betrat, auch wenn sie das mit einem Lächeln zu kaschieren versuchte. »Etwas gefunden?«
Ich stand auf, um meine Schwester mit einer kurzen Umarmung zu begrüßen, ehe ich die kleine Küchenzeile ansteuerte, sie sich im Eingangsbereich der Wohnung befand. »Nein«, seufzte ich auf, und Schuldgefühle nahmen mich vollkommen ein. Sieht nicht so gut aus, wollte ich hinzufügen, doch das verkniff ich mir. Isabell machte sich auch so schon genug Sorgen. Stattdessen versuchte ich mich in einem Lächeln. »Aber bald, ich habe es im Gefühl.«
»Na dann.« Isabell pfefferte ihre Umhängetasche in die Ecke, mit einem Poltern rutschten ein paar der Schulbücher heraus und verteilten sich auf dem Boden. Ich fand es nicht gut, dass sie keinen Rucksack mehr tragen wollte - es wäre schonender für den Rücken gewesen -, doch ich konnte nichts sagen. In Isabells Alter hatte auch ich einen Rucksack für uncool befunden. Mein Gott, war ich spießig geworden.
»Wie war es in der Schule?«
»Falsche Frage«, knurrte Isa und griff nach einem Apfel, der schon einige Dellen aufwies. Sie schien kurz zu überlegen, biss dann jedoch schulterzuckend hinein und ließ sich mit einem Geräusch widersprechender Federn auf die Couch fallen.
»Okay. Wie war es in der Schule?«
Isabell stöhnte theatralisch auf. »Ist doch jetzt egal, oder nicht? Ich bin zuhause, ich will nicht darüber nachdenken!«
In letzter Zeit kam es immer häufiger vor, dass Isabell mit solch einer Laune heimkehrte.
»Isa.« Ich machte es nicht gerne und meist gelang es mir auch nicht gut, aber in den vergangenen Jahren hatte ich gelernt, dass ich eben manchmal in den sauren Apfel beißen und mehr sein musste als eine Schwester. Ich warf einen kurzen, gereizten Blick auf das Obst in Isas Hand. »Hör mir mal gut zu. Ich weiß, dass du darüber nicht reden willst. Ich kann es sogar sehr gut verstehen, immerhin ist es noch gar nicht lange her, dass ich in der gleichen Situation gesteckt habe wie du. Aber, um Gottes Willen, ich kann mir nicht auch noch Gedanken um dich machen, verstehst du?«
»Dann lass es doch einfach bleiben!«, erwiderte Isa gereizt. »Ist ja nicht so, als wenn ich drum gebeten habe.«
Ich seufzte auf. »Das weiß ich doch. Aber ich tue es nun mal. Ich will nicht nur hören, wenn es dir gut geht. Also, was ist los? Du bist nicht zum ersten Mal so schlecht drauf. Hast du Probleme mit dem Schulstoff? Stress mit einer Freundin?«
Zunächst hatte Isabell lediglich gereizt mit dem Kopf geschüttelt, bis ihr Pferdeschwanz hin und her geflogen war, doch als ich meine letzte Frage stellte, sprang sie so unvermittelt auf, dass ich zurückzuckte. »Es reicht, okay?«, schrie sie fast schon hinaus, und für einen winzigen Augenblick glaubte ich, etwas in ihren Augen glitzern zu sehen. »Lass mich in Ruhe!«
In Ermangelung eines weiteren Raumes, in den sie sich hätte zurückziehen können, stürmte sie geradewegs ins kleine Bad. Das Klicken des Schlüssels in der Tür war alles, was von ihr zurückblieb - und dann war es totenstill.
»Verdammt!«, rief ich aus und spürte, wie mir der Stress zu Kopfe stieg. »So ein Mist!«
Es reichte nicht, dass ich keinen Job mehr hatte und an das hart Ersparte gehen musste. Ich steckte auch noch mit einem vollpubertären Teenie unter einem Dach, einem Teenie, der irgendwelche Probleme zu haben schien, darüber aber nicht reden wollte.
Stöhnend bohrte ich meine Handballen in die Augen, rieb sie so fest, dass ich kleine Sternchen sah, und nahm den stechenden Kopfschmerz resignierend entgegen, der in den letzten Minuten immer stärker geworden war.
3
Eine Woche später ging ich das erste Mal zur Tafel. Es war ein lauer Sommertag, und das geblümte Kleid, für das ich mich an diesem Tag entschieden hatte, strafte meiner Laune Lügen. Nie zuvor hatte ich das machen müssen, auch wenn ich manches Mal kurz davor gestanden hatte, und die Tatsache, nun endgültig auf dieses Hilfsangebot zurückgreifen zu müssen, verdeutlichte mir in aller Klarheit, wie tief ich eigentlich tatsächlich in der Scheiße steckte. Der Bescheid, der mich dazu berechtigte, und mit dem ich mich zuvor bereits angemeldet hatte, steckte tief in meiner Tasche. Er fühlte sich heiß an, wie glühendes Feuer, und er passte sich so meinen Wangen an, die vor Scham und Wut erhitzt waren.
Niemand hatte mich darauf vorbereitet, wie erniedrigend es sein konnte, plötzlich kein Geld mehr zu haben, auf Leistungen anderer angewiesen zu sein. Niemand hatte mir gesagt, was es bedeutete, von einem auf den anderen Tag erwachsen werden zu müssen - ganz ohne eine herantastende Gewöhnungsphase, sondern schlagartig. Natürlich, ich war schon zwanzig gewesen, als meine Eltern umgekommen waren, aber noch in diesem typisch behüteten Zustand der gerade ausgezogenen Studentin, die sich in einer WG ausprobierte. Plötzlich die Verantwortung für die jüngere Schwester übernehmen zu müssen, sämtliche Rechnungen der Eltern, allerdings keine vorhandenen Ersparnisse, war der sprichwörtliche Schubs ins Wasser.
Ich dachte nicht gerne darüber nach und schon gar nicht oft. Ich hatte einfach immer funktioniert. Hatte die Mietwohnung, in der wir gelebt hatten, mit Isabells Hilfe und mit der von einigen Schulfreunden, zu denen ich heute keinen Kontakt mehr hatte, ausgeräumt und das kleine Apartment bezogen, in dem wir noch immer lebten. Ich hatte hohe Rechnungen gegen niedrigere getauscht, hatte mein Studium geschmissen und mich ganz der Jobberei verschrieben.
Ich seufzte auf, als das schlichte, flache Gebäude in der Ferne auftauchte, in dem sich die Tafel befand. Es war nie leicht gewesen, aber bisher hatte ich stets Jobs gehabt. In Verbindung mit der Waisenrente, die meine minderjährige Schwester erhielt, hatte es gereicht. Vielleicht hatten wir nie im Überfluss gelebt, aber wir waren klargekommen. Doch jetzt?
Es war eine andere Welt. Auch wenn man sah, dass die Mitarbeiter sich wirklich Mühe gaben, alles möglichst freundlich zu gestalten, konnte ich nicht den Eindruck abzuschütteln, eine schwache Bittstellerin zu sein. Ich zeigte ein weiteres Mal den Bescheid vor, zahlte einen Euro und erhielt ein Kärtchen, auf dem vermerkt war, dass ich in einem Zwei-Personen-Haushalt lebte.
Alles lief gesittet und geordnet ab, anders, als ich mir das immer vorgestellt hatte. In meinem Kopf waren stets Bilder gewesen von unsortierten Menschenmassen, die sich auf die ausgelegte Ware stürzten und alles durcheinanderbrachten, doch in Wirklichkeit gab es fest abgesteckte Zeitfenster, zu denen jeder seinen »Abholtermin« hatte, gemeinsam mit wenigen anderen Personen. Kein Gedränge, alles irgendwie übersichtlich, die Waren hell angestrahlt, sodass sie frisch und gut aussahen. Nicht, dass in einer Tafel nur Reste angeboten wurden, doch natürlich waren es in der Regel aussortierte Waren, und das musste man im Kopf erst einmal akzeptieren.
»Heute wird viel zu viel weggeschmissen«, murmelte ich leise vor mich hin, als ich die verschiedenen Stationen ablief. Freundliche Ehrenamtliche reichten mir nach Vorlage meiner Karte Lebensmittel aller Art - Obst und Gemüse, Dosen, Milchprodukte, sogar etwas Süßkram, den ich schon jetzt für meine Schwester bestimmte. Alles wirkte vielleicht ein bisschen zu hell, zu freundlich, und als ich schließlich wieder auf der Straße stand, eine doch recht gut gefüllte Tüte in der Hand, fühlte ich mich irgendwie durcheinander.
Für einen kleinen Moment gab ich mich der Orientierungslosigkeit hin, legte meine freie Hand über die Augen und versuchte, Fassung zu gewinnen - und dann wurde ich unsanft angerempelt.
»Steh nicht so im Weg rum, Schlampe!«, herrschte mich jemand an, und ich riss so schnell die Augen auf, dass meine Lider schmerzten.
»Was?«
Vor mir stand eine kleine Gruppe Frauen - und ohne von Vorurteilen geleitet sprechen zu wollen, wirkten sie doch alle wie eine klischeehafte Darstellung von Assi-Tussen. Sofort schoss mein Puls in die Höhe - eine Mischung aus Wut und Angst zugleich, denn die Frauen blitzten mich seltsam feindselig an.
»Weg da!«, rief eine andere, und eilig trat ich beiseite. Ehe ich ein weiteres Mal den Mund aufmachen, vielleicht meine Ehre retten konnte, trabte die kleine Gruppe weiter, geradewegs in die Tafel, und plötzlich waren sie weg. Einzig der Geruch von Qualm, billigem Parfüm und Haarspray bewies, dass das soeben Geschehene tatsächlich passiert war.
»Verdammter Mist«, murmelte ich leise, dann taumelte ich endlich los. Die Tasche wurde zu einem Bleigewicht, mein Herz schlug dumpf und schwer.
Nein, das hier war eindeutig nicht meine Welt.
* * *
An diesem Abend gab es ein kleines Festmahl. Ich hatte mich dazu entschieden, direkt einige von den Kartoffeln zu kochen, dazu Blumenkohl und ein Stück Hähnchen. Selbst Nachtisch gab es, wenn auch nur eine von diesen Fertigtüten Paradiescreme, die man mit Milch anrühren konnte, doch das war egal - ich freute mich und konnte mehr als deutlich die Gier in den Augen meiner Schwester sehen, die erst vor einer Stunde nach Hause gekommen war und merkwürdig still wirkte.
Ich hatte die negativen Gedanken des Nachmittags fast ganz vergessen. Auch dass dieses Abendessen auf den Umstand meiner Arbeitslosigkeit zurückzuführen war, verdrängte ich - alles, wonach mir war, war ein Stück Normalität. Ein nettes Abendessen mit meiner Schwester, ein bisschen plaudern. Vielleicht konnten wir im Anschluss ja sogar ein bisschen zusammen spielen?
Summend deckte ich den kleinen Tisch, der sich in einer Zimmerecke befand, direkt neben der winzigen Küchenzeile, und versuchte, das Lächeln in meinem Gesicht zu festigen.
Eine Weile später füllte ich die Teller für mich und meine Schwester, die nach wie vor still und irgendwie bedrückt wirkte.
»Lass es dir schmecken, Isa«, erklärte ich fröhlich, als sie mir gegenüber Platz nahm.
»Danke«, erwiderte sie einsilbig.
Die Fröhlichkeit in mir begann leicht zu wanken.
»Erzähl doch mal, wie war dein Tag heute?«
Falls möglich, verdüsterte sich Isas Miene, und ich bekam den Eindruck, dass ich mitten ins Wespennest gestochen hatte. Dummerweise blieb meine Schwester mir eine Antwort schuldig, denn als einzige Reaktion - neben dem sich verdüsternden Gesicht - schob sie sich eine große Portion Gemüse in den Mund und begann, energisch darauf zu kauen.
»Was macht die Schule?«, hakte ich nach, ganz so, als hätte ich den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden.
»Alles gut«, presste Isa mit vollem Mund heraus. »Wie immer.«
Eigentlich hätte ich nun zufrieden sein müssen, doch ich wurde mir immer sicherer, dass meine Schwester mich gerade angeflunkert hatte. Nachdenklich aß ich selbst einen Bissen, ehe ich einen neuerlichen Versuch startete. »Was nehmt ihr denn gerade in Deutsch durch?«
»Boah, Feli!« Isabell explodierte so plötzlich, dass ich erschrocken zurückzuckte. Ein paar Bröckchen Gemüse sprühten aus ihrem Mund, als Isabell ihrer Wut Raum schaffte. »Nerv mich doch nicht mit diesem blöden Thema, ja? Ich will auch irgendwann mal Feierabend haben!« Für einen Moment funkelten ihre dunklen Augen mich an, und ich rechnete fest damit, dass Isa ihren Teller beiseiteschieben und aufspringen würde, doch nach wenigen Augenblicken verpuffte sämtliche Energie aus meiner Schwester, und sie begann, erneut in ihrem Essen herumzustochern. »Wie war es in der Tafel?«, brachte sie leise hervor, ohne noch einmal den Kopf zu heben.
Es war mehr als deutlich. Isabell wollte nicht über die Schule reden, und obwohl ich nur ihre Schwester war, keine gluckende Mutter, hatte ich dennoch die Verantwortung, und ich fühlte mich automatisch schlecht. Der Knoten in meiner Brust verfestigte sich nur noch, als ich darüber nachdachte, wie lange die Laune meiner Schwester schon zu leiden schien. Noch hatte ich jedoch nichts gehört, nicht von ihr, nicht von irgendwelchen Lehrern, und bis zu den Zeugnissen dauerte es noch. Worin genau die schlechte Laune begründet war, konnte ich nur mutmaßen - und ich hasste diese Unsicherheit. Gleichzeitig musste ich diesen Themenwechsel akzeptieren, denn ich war mir sicher, so schnell nichts mehr zu erfahren. Nicht, wenn Isa es nicht wollte.
Ich seufzte leise auf.
»Beschissen«, gab ich schließlich zu, bereit, das Friedensangebot anzunehmen. »Es ist gut, dass es so etwas gibt, aber ich hasse jeden Augenblick, den ich dort verbringen muss. Ich will diese Hilfe nicht.« Plötzlich war mir der Appetit verflogen - wie sollte es auch anders sein? Ich konnte kaum gestehen, dass ich die Hilfe der Tafel verabscheute, gleichzeitig aber die Lebensmittel von dort genießen.
Isas Hand lag plötzlich auf meiner, kühl und feucht. »Hey, Schwesterherz, wir werden das schon nicht lange in Anspruch nehmen müssen!«
Unsere Blicke kreuzten sich, und ich erschrak einmal mehr, als ich sah, wie ernst und erwachsen meine Schwester bereits wirkte. »Na klar«, erwiderte ich mit wankender Stimme. »Ich werde schon einen neuen Job finden.«
»Ich suche nach einem Nachhilfeschüler«, bot Isa an. »Ich bin gut in der Schule, das weißt du. Ich könnte schauen, ob ich jemandem aus den unteren Klassen helfen könnte. Damit könnte ich ein bisschen Geld dazuverdienen.«
Eine Welle der Erleichterung durchfloss mich - wenn Isabell bereit war, Nachhilfe zu geben, konnte sie keine nennenswerten Probleme in der Schule haben - gleichzeitig jedoch verspürte ich auch bittere Entschlossenheit. »Nein, schon okay, Kleine. Erst einmal werde ich nach einem Job suchen. Danke für dein Angebot, aber das sollten wir wirklich erst machen, wenn es gar nicht anders geht. Du hast genug Stress.«
Isabell sagte nichts, ihr Blick sprach jedoch Bände. Du hast doch selber genug Stress. Also lass mich meinen Teil dazu beitragen.
Später, als wir beide im Bett lagen und Isa bereits leise schnarchte, dachte ich wieder über das Angebot nach. Ich verspürte tiefe Verwirrung, auch wenn ich im ersten Moment erleichtert gewesen war - bisher hatte ich Isas schlechte Laune auf Probleme in der Schule geschoben. Wenn dort aber alles gut lief, weshalb schien meine Schwester dann in letzter Zeit immer verschlossener zu werden?
»Vielleicht ist es einfach die Pubertät«, versuchte ich mich leise zu beruhigen. Gott, ich war so überfordert! Niemals hätte ich gedacht, dass es so schwer sein konnte, Verantwortung für jemand anderen zu übernehmen. Es blieb nur zu hoffen, dass ich nicht vollends die Kontrolle verlor - aktuell fühlte es sich verdammt danach an, als würde ich diesen dunklen Weg hinunterschreiten. Noch hatten wir beide uns, wir waren eng umschlungen, Verbündete. Doch Isa entfernte sich spürbar.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich meiner Schwester folgen sollte, wenn diese nicht mit mir redete.
4
»Jetzt guck nicht immer so bedröppelt!«, forderte Christina mich auf. Fast schon unnachgiebig deutete sie auf den Cocktail in meiner Hand und wedelte ungeduldig mit ihrem Finger hin und her. »Ich hab doch gesagt, der geht auf mich! Also genieß ihn gefälligst!«
Ich seufzte haltlos auf. »Du weißt genau, dass ich das nicht gut kann. Konnte ich noch nie!«, erklärte ich gereizt, hatte dann aber sofort ein schlechtes Gewissen und schloss meine Lippen um den bunten Strohhalm. Es war das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten, dass ich mit meiner Freundin ausging - die einzige Freundin, die mir noch geblieben war. Wir kannten uns bereits aus der Schule, und vermutlich kam sie dem am nächsten, was meine beste Freundin war. Christina wusste als einzige genau, wie es um uns stand, und immer wieder half sie aus, in welcher Art auch immer. Dass es an diesem Abend darauf hinauslief, dass sie mir mehr oder weniger den Abend finanzierte, passte mir zwar ganz und gar nicht, doch eine großartig andere Wahl hatte ich auch nicht: Christina und Isabell hatten sich verbündet und beide beschlossen, ich müsse mal wieder ausgehen. Ich hatte mich gegenüber dieser Mauer an Argumenten nicht durchsetzen können, doch mein Portmonee hatte das natürlich auch nicht gefüllt.
Eigentlich geschah es Christina also recht, dass sie doppelt zahlen musste, sie hatte mich immerhin auch mitgeschleppt.
»So ist es gut, Süße«, erklärte besagte Entführerin zufrieden und zog ebenfalls kräftig an ihrem eigenen Halm.
Wir konnten nicht gegensätzlicher sein. Während ich mich die meiste Zeit eher als durchschnittlich empfand, war Christina ein wirklicher Hingucker. Sie maß mindestens einen Meter achtzig, weshalb sie nur selten High-Heels trug. Immer wieder betonte sie mit einem bedauernden Seufzen, dass sie flache Schuhe nicht geeignet fand an solchen Abenden, aber Männer hatten meist ein Problem damit, wenn Frauen größer waren als sie. Vielleicht einer der Gründe, warum sie nach wie vor Single war, denn mit ihrer wallenden blonden Lockenpracht, ihren klaren, blauen Augen und diesem kirschroten Schmollmund musste sie reihenweise Männerherzen erlegen. Andere hätten womöglich vermuten können, dass es an Christinas Charakter lag - vielleicht war sie arrogant? - doch ich wusste es besser. Meine Freundin war gutmütig und lustig, ein interessanter Gesprächspartner und für alle möglichen Schandtaten zu haben - auch für Dinge, die manche Frauen mit einem gereizten Schulterzucken abtaten. Doch irgendetwas hatte ihrem Glück bisher immer im Wege gestanden.
Ich blickte an mir hinab. Ich war mindestens zehn Zentimeter kleiner als sie - ein Unterschied, den ich an diesem Abend durch Absätze etwas relativieren konnte. Mein eigenes, glattes Haar, das mir bis knapp über die Schultern reichte, empfand ich als ziemlich langweilig gegenüber der Lockenpracht Christinas, doch lustigerweise hätte diese gerne mit mir getauscht. Meine Augen waren grau und von langen, erstaunlich dunklen Wimpern umrandet, und das war vermutlich das hervorstechendste Merkmal in meinem Gesicht, zumindest empfand ich es so. Wenigstens hatte ich eine nicht zu verachtende Oberweite vorzuweisen, auf die ich recht stolz war, und die ich manchmal im Job auch eingesetzt hatte, um ein besseres Trinkgeld zu erhalten. Einfach ein Knopf weiter auf als nötig, weit genug, um etwas Haut zu zeigen, ohne jedoch obszön zu wirken. Die Waffen der Frau ...
»Hey, guck doch nicht so miesepetrig!«, rief Christina mir lachend zu. »Ich weiß, dass es gerade scheiße läuft, aber lass uns heute doch einfach nur den Abend genießen!«
Grummelnd verdrehte ich die Augen. »Das lässt sich leicht sagen ...« Den Rest verschluckte ich lieber. Ich hatte noch sagen wollen »... wenn man selbst einen sicheren Job und eine Eigentumswohnung hat«, doch es wäre unfair gewesen. Christina konnte nichts dafür, dass sie direkt nach der Schule ein lukratives duales Studium begonnen hatte und bereits gutes Geld verdiente, noch weniger konnte sie etwas dafür, dass es das Schicksal mit mir nicht gut gemeint hatte. Im Gegenteil - sie war immer noch hier, nicht wahr? Sie zahlte meine Cocktails und hielt meine Launen aus. Ich durfte sie nicht durch meine Grummelei verjagen. Mit einem Ruck richtete ich mich auf dem schmalen Barhocker auf und begann, im Takt der Musik mit meinem Fuß zu wippen. »Der Schuppen ist nicht schlecht, oder?«
Als hätte Christina nur darauf gewartet, dass ich mich dazu durchrang, nicht mehr im Selbstmitleid zu versinken, strahlte sie mich glücklich an. »Jep. Ich weiß, dass er noch nicht lange geöffnet hat, und so ein Ansturm kann dann ja durchaus passieren. Die Leute wollen wissen, ob der Laden was taugt. Aber ich sage dir - der wird sich halten.«
Sie spielte eindeutig darauf an, dass im Laufe der letzten Jahre in genau dieser Räumlichkeit insgesamt vier Bars gewesen waren, die alle nach und nach wieder hatten schließen müssen. Nun hatte vor wenigen Wochen das Couture seine Pforten eröffnet, und der Name war irgendwie Programm. Ich fühlte mich fast schon ein bisschen fehl am Platze, so edel und verrucht wirkte der Laden. Sämtliche Mitarbeiter waren ganz in Schwarz gekleidet, huschten durch die Menge oder standen hinter der Theke, strahlend lächelnd und total zufrieden. Das Interieur war größtenteils schlicht und ebenfalls schwarz gehalten, samtene Vorhänge, goldene Accessoires, ein großer Kristallleuchter in der Mitte und indirektes Licht unterstrichen den edlen Charakter. Zum Glück sah das Publikum, das sich hier tummelte, bis auf wenige Ausnahmen recht normal aus, sodass ich mich nicht völlig unwohl fühlte. Einzig an der Seite links vom Eingang befanden sich einige Sitznischen mit auffälligen Samtsofas, und auf denen drückten sich ein paar äußerst schick aussehende Anzugträger mit passenden Frauen herum. Wir hatten bewusst Abstand von dort gehalten.
»Siehst du den Typen dahinten?«, murmelte Christina kichernd und deutete unauffällig Richtung Theke.
Ich war noch nie ein wirklicher Held der Subtilität gewesen und wandte sofort meinen Kopf in die Richtung. Nachfragen, wen sie gemeint hatte, musste ich nicht, denn augenblicklich verschränkte sich mein Blick mit dem von einem äußerst attraktiv aussehenden Typen, der mich mit intensivem Blick anstarrte. Wenige Sekunden hielten wir diesen wortlosen Kontakt, dann hob der Typ eine Flasche Bier und prostete mir mit einem anzüglichen Grinsen zu.
Ich fiel fast vom Hocker.
»Na, na, na«, prustete Christina los. »Ist der echt so umwerfend?«
Peinlich berührt wagte ich noch einen letzten Blick und sah, dass der Typ nun offen lachte - dann wandte ich mich eilig ab. Na toll, so machte man sich also zum Affen. »Hör auf!«, fuhr ich meine Freundin an und verbarg mein Gesicht in den Händen. »Guckt er immer noch?«
»Oh, Babe«, begann Christina mit gedehnter, betont cooler Stimme, »der hat die ganze Zeit vorher auch schon gestarrt. Schätze, der ist auf der Suche. Schnapp ihn dir doch! Was spricht schon gegen eine kleine, heiße Nummer?«
Für eine Weile pochte der Puls in meinem Körper wie eine heiße Schlange - ich fühlte mich tatsächlich gut und begehrt - doch dann fiel ich in mir zusammen. In einem anderen Leben hätte ich das vielleicht sogar getan, aber nun? Ich würde niemals mit einem fremden Mann in dessen Wohnung gehen, aber genauso wenig konnte ich jemanden ins Apartment mitbringen. Nicht, wenn meine Schwester dort arglos schlief - im selben Raum! Und über die Möglichkeit, in ein Hotel zu gehen, würde ich gar nicht erst diskutieren.
Betont lässig wedelte ich mit der Hand. »Schon okay. Du kannst ihn dir schnappen, wenn du willst. Ich brauche das nicht.«
»Schon klar.« Christina verdrehte die Augen, und für einen winzigen Augenblick erwartete ich, dass sie der Aufforderung nachkommen würde, doch dann schüttelte diese den Kopf. »Vergiss es, das ist unser Abend, nicht wahr?« Ein neues Lied ertönte durch die Lautsprecher, ein aktueller Song, der das Potential hatte, zu einem mehrwöchigen Ohrwurm zu werden. Christina kreischte auf. »Komm, Miesepetra, lass uns tanzen!« Und mit diesen Worten zerrte sie mich auf die kleine Tanzfläche, ohne einen Widerspruch abzuwarten.
* * *
In dieser Nacht träumte ich von früher. Es gab Zeiten, da hätte ich mich vielleicht wirklich auf einen hübschen Unbekannten eingelassen. Ich war nicht unbedingt ein Unschuldsengel gewesen, als ich noch Zeit für so etwas gehabt hatte.
Ich spürte fremde Hände auf meinem Körper, tastende, warme Männerhände - wie lange hatte ich das schon nicht mehr gefühlt? Leise gemurmelte Worte, raschelnde Bettdecken, sanftes Stöhnen.
Und dann wechselte der Traum mit brutaler Grausamkeit, machte Platz für eine ganz andere Kulisse. Da war ich - in Tränen aufgelöst, vom plötzlichen und gewaltsamen Tod meiner Eltern unterrichtet worden, alleine im Flur der Uni, einer Sicherheit beraubt, der ich mich zu lange trügerisch hingegeben hatte. Da war meine Schwester - eigentlich noch viel zu jung, um so etwas mitmachen zu müssen. Jeder war zu jung dafür!
Lange, lange, einsame Abende, an denen ich versucht hatte, das alles zu begreifen, zwei Schwestern gegen den Rest der Welt, genauer gesagt gegen die Bürokratie, die nicht einmal Halt machte vor dem Trauerprozess einzelner, die keine Rücksicht darauf nahm, dass manche Menschen nicht dafür geschaffen waren zu funktionieren, die Zügel ohne Vorbereitung in die Hand zu nehmen.
Da waren gesichtslose Helfer, die zu Beginn da gewesen waren, sich aber mehr und mehr zurückgezogen hatten, denn mit diesem persönlichen Leid wollte niemand konfrontiert werden, schon gar kein Lover ...
Da waren sie wieder, die tastenden Männerhände, doch diesmal fühlten sie sich abweisend an, unwillig. Sie verschwanden, hinterließen eine bittere Kälte, die mich bis ins Mark durchdrang, die mich schaudern ließ, bis ...
»Aufwachen, Schwesterherz! Alles ist in Ordnung!«
Es war Isabells Stimme, die durch den Nebel direkt in mein Bewusstsein gelangte. Immer war sie da - im Zweifel waren es nur wir beide, aber das hatte bisher gut funktioniert. Noch gefangen von den tastenden Händen meines Traumes, konnte ich nicht richtig begreifen, wie mir geschah, aber als Isabell mich in den Arm nahm und mir ein weiteres Mal versicherte, dass alles in Ordnung war, entspannte ich mich merklich, sackte zurück in die Kissen und fiel erneut in einen tiefen Schlaf, diesmal jedoch traumlos.
5
Die nächsten Wochen brachten nicht viel Veränderung. Scheinbar war der Jobmarkt wirklich übersättigt - oder ich war für die Stellen nicht gut genug, denn ich konnte nur spärlich Bewerbungen verschicken, auf die nahezu keine Reaktion kam. Langsam aber sicher fragte ich mich, ob ich mich womöglich doch wieder auf eine Putzstelle bewerben sollte - ein Weg, den ich seit einer eher furchtbaren Erfahrung damals im Büro bisher tunlichst zu gehen vermieden hatte, aber ich begann, keine Alternativen zu sehen.
Also stand ich wenige Wochen nach dem ersten Mal wieder bei der Tafel vor der Tür.
Ich schluckte schwer, als mein Blick über die Fassade glitt.
Ein Auto fuhr vorbei, viel zu schnell, und bog mit quietschenden Reifen in eine Nebenstraße ein. Ich zuckte schmerzlich zusammen, schob mit zittrigen Fingern eine Strähne meines Haares hinter meine Ohren und eilte durch die Tür, ehe ich es mir anders überlegen konnte.
Einmal im Gebäude verschwunden, fiel es mir leichter, den Prozess zu durchlaufen - Karte abholen, die einzelnen Stationen abklappern, Essen von Ehrenamtlichen ausgehändigt bekommen. Die meisten waren ausgesprochen freundlich, lächelten mich an, gaben mir besonders gutaussehende Nahrungsmittel, als sie erfuhren, dass ich eine Schwester daheim hatte, um die ich mich kümmern musste. Niemand gab mir das Gefühl, ein Bittsteller zu sein, und die finanzielle Sorge - Wie sollte ich den nächsten Einkauf finanzieren? - wurde geringer.
Keine halbe Stunde später stand ich blinzelnd vor dem Gebäude, diesmal mit einer prall gefüllten Tasche voller Nahrungsmittel und dem bittersüßen Gefühl der Erleichterung. Ich beschloss, zu Fuß zu gehen, die zwanzig Minuten Fußweg konnte ich nun gebrauchen, auch wenn meine Schulter sich sicherlich irgendwann beschweren würde. Ich wollte mich gerade in Bewegung setzen, als eine Gruppe Frauen um die Ecke bog, die mir auf unangenehme Weise vom letzten Mal im Gedächtnis geblieben war.
»Oh, die Bitch ist wieder da«, höhnte eine von ihnen.
Ich senkte sofort meinen Blick zu Boden, wollte niemanden von ihnen provozieren und einfach nur schnell verschwinden, doch im Bruchteil einer Sekunde nahm mich die Gruppe in sich auf - allen voran die Frau, die mich angesprochen hatte. Ich sah ganz viel Leopardenprint, Nasenpiercings, verächtlich verzogene Mundwinkel.
»Was habe ich euch getan?«, wollte ich fragen, doch im letzten Moment konnte ich die Worte verschlucken, huschte einfach nur an ihnen vorbei. Eine von ihnen rempelte mich an, nicht fest genug, um mich umzuwerfen, aber ausreichend, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, und hämisches Gelächter bezeugte meine Ausfallschritte.
»Nimmst uns das ganze Essen weg, Schlampe«, rief eine von den anderen.
»Als wenn du nicht genug hättest. Guckt sie euch doch mal an, Ledertasche und alles. Bullshit!«
Die Worte taten weh, fürchterlich, und sie vermischten sich mit dem unguten Gefühl in meiner Magengrube. Zweimal hatte ich die Tafel aufgesucht, zweimal war ich dieser Gang begegnet. Zufall? Wohl kaum. In diesem Moment fasste ich den Entschluss, nicht mehr herzukommen. Egal wie knapp es werden würde, ich konnte mir das nicht noch einmal antun. Und wenn ich höchstpersönlich auf Mahlzeiten verzichten würde.
Das hier, das fühlte sich an, als wäre ich wirklich ganz am Boden angekommen, mehr noch als damals, kurz nach dem Tod unserer Eltern. Die brutale Realität.
* * *
Ich schaffte es einige Straßen weit, ehe ich in einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle auf einen kühlen Metallsitz zusammenbrach. Die Tasche setzte ich vorsichtig zwischen meinen Füßen ab, ganz so, als müsse ich ein wertvolles Gut bewachen, und dann streckte ich meine Hand aus. Sie zitterte, dicke Striemen hatten sich in die Haut gebohrt.
Dann bemerkte ich, wie aufgewühlt ich wirklich war. Einzig wegen der Begegnung mit den Frauen? Wohl kaum.
Es war der Stress der vergangenen Wochen, der langsam aber sicher an mir zu nagen begann. Jener Abend mit Christina, als ich mich fast schon normal gefühlt hatte, er schien plötzlich Jahre her zu sein. Jahrzehnte. Die Leichtigkeit war schon lange verzehrt und aufgebraucht, die Reserven leergeputzt. Und obwohl ich das wusste, war mir gleichzeitig bewusst, dass ich mir so schnell nicht wieder solch einen Abend würde stehlen können.
Es war zum Haare raufen.
Wie lange ich dort saß und einmal mehr in meinem Selbstmitleid versank, konnte ich nicht genau sagen - es konnten fünf Minuten gewesen sein oder fünfzig - doch irgendwann rappelte ich mich stöhnend wieder auf. Es hatte ja doch keinen Zweck, ich musste nach Hause, musste die Lebensmittel heimbringen und dafür sorgen, dass meine Schwester einen möglichst normalen Alltag erfahren konnte. Was auch immer geschah, Isabell stand für mich an erster Stelle, sie und ihre ganz persönliche Sicherheit.
Es grenzte wohl an Ironie, dass ich über Schutz und Sicherheit für meine Schwester nachdachte, aber gleichzeitig nicht ausreichend auf mein Umfeld achtete. Ich schaffte genau fünf Schritte, als Stimmen in meinem Rücken ertönten, die ich nicht wieder hatte hören wollen.
»Jo, schaut mal, da ist die Tussi wieder!«
»Alter, die ist aber lahmarschig!«
»Gut für uns!«
Im ersten Moment erstarrte alles in mir zu Eis, dann beschleunigte ich meine Schritte. Ich hatte nicht vor, auf das dumme Gerede dieser Frauen zu reagieren. Wenn die mich schon derart hochklassierten, dann konnte ich mich auch so verhalten, oder nicht?
»He, Schlampe, wir reden mit dir!