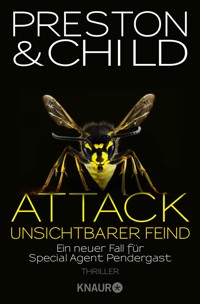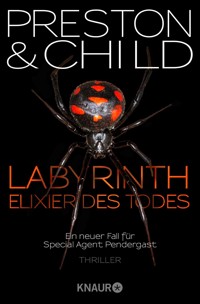9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Schock für Special Agent Pendergast: Einer seiner Freunde wird brutal ermordet – von einem Mann, der bereits vor einer Woche Selbstmord begangen hat. ZOMBIES IN NEW YORK – diese Schlagzeile sorgt in kürzester Zeit für Angst und Schrecken. Aber ist es wirklich möglich, dass die Toten sich aus ihren Gräbern erheben? Pendergast findet eine Spur, die ihn in die Katakomben unter einer alten Kirche führt – den Sitz einer Sekte, die dunkle Ziele verfolgt … Cult - Spiel der Toten von Douglas Preston · Lincoln Child: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Cult
SPIEL DER TOTEN. Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Schock für Special Agent Pendergast: Einer seiner Freunde wird brutal ermordet – von einem Mann, der bereits vor einer Woche Selbstmord begangen hat. ZOMBIES IN NEW YORK – diese Schlagzeile sorgt in kürzester Zeit für Angst und Schrecken. Aber ist es wirklich möglich, dass die Toten sich aus ihren Gräbern erheben? Pendergast findet eine Spur, die ihn in die Katakomben unter einer alten Kirche führt – den Sitz einer Sekte, die dunkle Ziele verfolgt …
Inhaltsübersicht
Widmungen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
Epilog
Danksagung
ANMERKUNGEN DER AUTOREN
DIE PENDERGAST-ROMANE
Unsere anderen Romane
Ein neuer Held: Gideon Crew
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Tochter Veronica
Douglas Preston widmet dieses Buch Karen Copeland
1
»Kannst du das glauben, Bill? Ich kann’s nämlich immer noch nicht. Sie haben es mir vor fast zwölf Stunden mitgeteilt, aber ich fasse es noch immer nicht.«
»Glaub’s nur, Süße.« William Smithback jr. reckte seine schlaksigen Glieder, streckte sich auf dem Sofa im Wohnzimmer aus und legte seiner Frau den Arm um die Schultern. »Gibt’s noch einen Schluck von dem Port für mich?«
Nora schenkte nach. Er hielt das Glas ins Licht und bewunderte die granatrote Farbe. Der gute Tropfen hatte ihn hundert Dollar gekostet – und er war es wert. Er nippte und atmete durch die Nase aus. »Du bist der neue Star im Museum. Wart’s ab. In fünf Jahren machen die dich zur Dekanin der naturwissenschaftlichen Abteilung.«
»Werd nicht albern.«
»Nora, in drei aufeinanderfolgenden Jahren wurde der Etat gekürzt, und trotzdem hat man deiner Forschungsreise grünes Licht gegeben. Dein neuer Chef ist doch kein Trottel.« Smithback schmiegte sein Gesicht an Noras Haar. Obwohl sie nun schon so lange verheiratet waren, fand er den Geruch – eine Spur Zimt, ein Hauch Wacholder – jedes Mal aufs Neue erregend.
»Stell dir mal vor, wir wären im kommenden Sommer wieder in Utah bei einer Ausgrabung! Das heißt, wenn du dir zu der Zeit freinehmen kannst.«
»Mir stehen für dieses Jahr noch vier Wochen Urlaub zu. Ich werde den Leuten bei der Times zwar wahnsinnig fehlen, aber dann müssen sie eben ohne mich klarkommen.« Er trank noch einen Schluck und schwenkte den Portwein im Mund. »Mit Nora Kelly auf Expedition Nummer drei gehen. Du hättest mir kein schöneres Geschenk zum Hochzeitstag machen können.«
Nora blickte ihn ironisch an. »Ich dachte eigentlich, du hättest mir das Abendessen heute geschenkt.«
»Stimmt. Das war mein Geschenk.«
»Und es war perfekt. Danke.«
Smithback erwiderte ihr Zwinkern. Er hatte Nora in sein Lieblingsrestaurant eingeladen, das Café des Artistes in der West 67. Straße. Es gab kein besseres Lokal für ein romantisches Dinner: die sanfte, verführerische Beleuchtung, die gemütlichen Polsterbänke, die pikanten Gemälde von Howard Chandler Christy an den Wänden und schließlich, als Krönung von allem, die exquisiten Speisen.
Er merkte, dass Nora ihn ansah. In ihren Augen und in dem schlauen Lächeln lag ein Versprechen, dass er sich auf noch ein Geschenk zum Hochzeitstag freuen könne. Er küsste sie auf die Wange und zog sie enger an sich.
Sie seufzte. »Sie haben mir jeden Penny bewilligt, um den ich gebeten habe.«
Smithback murmelte eine Antwort. Er war’s zufrieden, mit seiner Frau zu schmusen und das Menü, das er vorhin verzehrt hatte, Revue passieren zu lassen. Als Aperitif hatte er sich für zwei steife Martinis entschieden, als Vorspeise für den Charcuterie-Teller. Als Hauptgang konnte er dann dem Steak béarnaise nicht widerstehen, medium gebraten, mit Pommes frites und einer großen Portion Rahmspinat. Wobei er sich anschließend natürlich auch noch ordentlich bei Noras Rehrücken bedient hatte …
»Begreifst du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte meine Untersuchungen zur Verbreitung des Kachina-Kults im Südwesten abschließen.«
»Das wäre phantastisch.« Zum Dessert hatte es Schokoladen-Fondue für zwei gegeben und zum Abschluss verschiedene herrlich stinkige französische Käsesorten. Smithback ließ die freie Hand leicht auf seinem Bauch ruhen.
Auch Nora verfiel in Schweigen, und so blieben sie eine Weile ruhig liegen, zufrieden, die Gegenwart des anderen zu genießen. Smithback warf seiner Frau einen verstohlenen Blick zu. Ein Gefühl des Behagens breitete sich über ihm aus wie eine Decke. Er war kein religiöser Mensch, eigentlich nicht, und doch empfand er es als Segen Gottes, hier zu sein, in dieser schicken Wohnung in der großartigsten Stadt der Welt, und genau den Job zu haben, von dem er immer geträumt hatte. Und in Nora hatte er nicht weniger als die perfekte Partnerin gefunden. In den Jahren seit ihrem ersten Kennenlernen hatten sie viel gemeinsam durchgemacht, aber die Schwierigkeiten und Gefahren hatten sie einander nur noch näher gebracht. Nora war nicht nur schön und grazil, hatte nicht nur einen lukrativen Job, der ihr Spaß machte, und war gefeit gegen Nörgeleien, dazu einfühlsam und intelligent, sie hatte sich auch als ideale Seelengefährtin entpuppt. Und als er sie so ansah, musste er unwillkürlich lächeln. Nora war ganz einfach zu gut, um wahr zu sein.
Sie regte sich. »Ich darf es mir nicht allzu gemütlich machen. Jedenfalls noch nicht.«
»Wieso denn nicht?«
Sie löste sich von ihm und ging in die Küche, um ihre Handtasche zu holen. »Weil ich noch etwas besorgen muss.«
Er sah verdutzt drein. »So spät noch?«
»Ich bin in zehn Minuten wieder da.« Sie kehrte zum Sofa zurück und beugte sich über ihn, strich ihm die Haare aus der Stirn und gab ihm einen Kuss. »Rühr dich ja nicht vom Fleck, mein großer Junge«, sagte sie leise.
»Machst du Witze? Ich bin der Fels von Gibraltar.«
Sie lächelte, strich ihm noch einmal übers Haar und ging dann Richtung Wohnungstür.
»Gib auf dich acht«, rief er ihr hinterher. »Denk an die merkwürdigen Päckchen, die wir bekommen haben.«
»Keine Sorge. Ich bin ein großes Mädchen.« Kurz darauf fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
Smithback verschränkte die Hände hinterm Kopf und streckte sich seufzend auf dem Sofa aus. Er hörte, wie Noras Schritte auf dem Flur verhallten, dann das Klingeln des Aufzugs. Schließlich war alles still bis auf das leise Brausen des Stadtverkehrs draußen.
Er konnte sich schon denken, wohin sie gegangen war – zur Patisserie an der Ecke. Die hatte bis Mitternacht geöffnet, und dort gab es seine Lieblingstorten. Eine besondere Vorliebe hatte Smithback für die praline génoise mit Calvados-Buttercreme. Mit etwas Glück hatte Nora zur Feier des heutigen Tages genau diesen Kuchen bestellt.
Und so lag er auf dem Sofa in dem schwach erleuchteten Apartment und lauschte den Geräuschen Manhattans. Die Cocktails, die er getrunken hatte, verlangsamten seine Denkvorgänge ein klein bisschen. Ihm fiel eine Zeile aus einer Kurzgeschichte von James Thurber ein: auf eine schläfrige, umnebelte Weise glücklich und zufrieden. Er hatte schon immer eine fraglose, völlig unkritische Zuneigung zu den Texten seines Journalistenkollegen und Schriftstellers James Thurber empfunden. Wie auch für die Geschichten von Robert E. Howard, der großartige Schundromane geschrieben hatte. Der eine, fand Smithback, hatte sich immer zu sehr bemüht, der andere zu wenig.
Aus irgendeinem Grund kehrten seine Gedanken zu jenem Sommertag zurück, an dem er Nora kennengelernt hatte. Die vielen Erinnerungen tauchten wieder auf: Arizona, Lake Powell, der heiße Parkplatz, die große Limousine, in der er eingetroffen war. Er schüttelte den Kopf und lächelte. Nora Kelly war ihm zunächst wie eine ziemliche Zicke vorgekommen, eine frischgebackene Dr. phil. mit Komplexen. Andererseits hatte auch er keinen besonders guten Eindruck gemacht und sich wie ein Vollidiot aufgeführt, das stand mal fest. Doch das lag jetzt vier Jahre zurück, oder fünf … Herrje, war die Zeit wirklich so schnell vergangen?
Von draußen vor der Wohnungstür war ein Scharren zu hören, dann das Kratzen eines Schlüssels im Schloss. Nora? Schon zurück?
Er wartete darauf, dass sich die Tür öffnete, aber stattdessen kratzte der Schlüssel noch einmal, als habe Nora Schwierigkeiten mit dem Schloss. Vielleicht balancierte sie ja einen Kuchen auf dem Arm. Er wollte gerade aufstehen, um ihr zu öffnen, als die Tür plötzlich knarrend aufging und im Eingangsflur Schritte zu hören waren.
»Wie versprochen, ich bin immer noch da«, rief er. »Mr. Gibraltar persönlich.«
Er hörte noch einen Schritt. Irgendwie klang das aber nicht nach Nora. Er war zu langsam und schwer und hörte sich irgendwie watschelnd, unsicher an.
Smithback setzte sich auf dem Sofa auf. In der kleinen Diele zeichnete sich undeutlich eine Gestalt ab, erhellt vom Licht aus dem dahinterliegenden Korridor außerhalb der Wohnung. Die Gestalt war so groß und breitschultrig, dass es sich unmöglich um Nora handeln konnte.
»Wer zum Teufel sind Sie?«, rief Smithback.
Rasch griff er nach der Lampe auf dem Beistelltisch neben sich und knipste sie an. Er erkannte die Person fast auf Anhieb. Oder meinte doch, sie zu erkennen – aber irgendetwas stimmte mit dem Gesicht nicht. Es war aschfahl, aufgedunsen, fast breiig. Es wirkte krank … oder Schlimmeres.
»Colin?«, rief Smithback. »Sind Sie’s? Was zum Teufel machen Sie in meiner Wohnung?«
In diesem Augenblick sah er das Schlachtermesser.
Sofort sprang er auf. Die Gestalt schlurfte ein paar Schritte näher und versperrte ihm den Weg. Ein kurzer, furchtbarer Moment des Stillstands. Dann stach das Messer zu, mit furchterregender Geschwindigkeit sauste es durch die Luft, dorthin, wo Smithback vor weniger als einer Sekunde noch gestanden hatte.
»Was zum Teufel … ?«, brüllte Smithback.
Wieder stach das Messer zu. Verzweifelt versuchte er, dem Hieb auszuweichen, fiel über den Beistelltisch und stieß ihn dabei um. Er rappelte sich auf und schaute seinem Angreifer mitten ins Gesicht – tief in der Hocke, die Hände abwehrend geöffnet, die Finger gespreizt und bereit. Rasch blickte er sich nach einer Waffe um. Nichts. Der Kerl stand zwischen ihm und der Küche. Wenn er an ihm vorbeikam, könnte er sich ein Messer schnappen und Waffengleichheit herstellen.
Er zog leicht den Kopf ein, hielt einen Ellbogen nach vorn und griff an. Der Mann taumelte unter der Attacke zwar nach hinten, aber im letzten Augenblick zuckte die Hand mit dem Messer nach vorn und schlitzte Smithback den Arm auf, eine tiefe Wunde vom Ellbogen bis zur Schulter. Vor Überraschung und Schmerz schrie Smithback auf und drehte sich zu einer Seite weg – und empfand gleichzeitig einen extrem kalten Schmerz, als ihm das Messer tief ins Kreuz gerammt wurde.
Die Klinge schien endlos in ihn einzudringen und seine innersten Organe zu treffen, so dass ihn ein Schmerz durchzuckte, wie er ihn ähnlich nur einmal im Leben verspürt hatte. Smithback keuchte auf, stürzte zu Boden und versuchte zu fliehen. Er spürte, wie das Messer aus ihm herausgezogen, dann wieder hineingestoßen wurde. Plötzlich war da etwas Feuchtes auf seinem Rücken, als ob ihn jemand mit warmem Wasser übergießen würde.
Er mobilisierte all seine Kräfte und rappelte sich auf. Mit dem Mut der Verzweiflung ging er auf seinen Angreifer los und schlug mit den blanken Fäusten auf ihn ein. Wieder und wieder zerschnitt das Messer Smithbacks Handknöchel, aber das spürte er schon nicht mehr. Unter seinem wütenden Angriff taumelte der Mann nach hinten. Das war seine Chance! Blitzartig machte er kehrt, in der Absicht, sich in die Küche zurückzuziehen. Aber es kam ihm vor, als ob der Fußboden aus der Waagerechten kippte, außerdem verspürte er inzwischen bei jedem Atemzug ein merkwürdiges Brodeln in der Brust. Er wankte in die Küche. Keuchend und um sein Gleichgewicht ringend tastete er mit feuchten Händen nach der Schublade mit den Küchenmessern. Aber noch während er sie aufzog, sah er einen Schatten auf den Küchentresen fallen … und dann traf ihn nochmals ein furchtbar tiefer Messerstich, diesmal zwischen den Schulterblättern. Er versuchte sich fortzudrehen, aber immer wieder stieß das Messer zu, hob und senkte sich, bis die karmesinrote Klinge immer undeutlicher und es rings um ihn dunkel wurde …
So hebt mich auf den Scheiterhaufen – alles vergangen, getan; das Fest ist vorbei, und alle Lichter aus fortan …
Die Fahrstuhltüren glitten auseinander. Nora trat hinaus in den Flur. Sie hatte sich beeilt, und mit ein wenig Glück würde Bill noch auf dem Sofa liegen, vielleicht den Roman von Thackeray lesen, von dem er ihr schon die ganze Woche vorgeschwärmt hatte. Behutsam balancierte sie den Kuchen-Karton auf der Handfläche, während sie mit der anderen Hand nach dem Wohnungsschlüssel suchte. Bill hatte bestimmt schon erraten, wohin sie gegangen war, aber es war eben schwer, den Partner am ersten Hochzeitstag zu überraschen …
Irgendetwas stimmte nicht. Sie war so in Gedanken versunken, dass ihr erst nach einem Moment klar wurde, was sie störte: Die Wohnungstür stand sperrangelweit offen.
Jemand kam aus der Wohnung. Nora kannte den Mann. Seine Kleidung war blutdurchtränkt, in der Hand hielt er ein großes Messer. Und während er stehen blieb und zu ihr hinblickte, tropfte von seinem Messer Blut auf den Boden.
Instinktiv und ohne nachzudenken ließ Nora den Kuchen-Karton und den Schlüssel fallen und stürzte sich auf ihn. Gleichzeitig kamen Nachbarn aus ihren Wohnungen, riefen vor Angst und Schrecken laut durcheinander. Als sie auf den Mann losging, hob dieser das Messer, aber sie schlug seine Hand weg und versetzte ihm einen Schlag in den Solarplexus. Er holte aus und schleuderte sie gegen die gegenüberliegende Wand des Flurs, so dass sie mit dem Kopf auf den harten Verputz prallte. Nora sank zu Boden und sah nur noch Sternchen. Mit erhobenem Messer schlurfte er auf sie zu. Sie wich der Klinge aus, mit der er von oben auf sie einstechen wollte, dann versetzte er ihr einen brutalen Fußtritt gegen den Kopf und holte nochmals mit dem Messer aus. Schreie hallten auf dem Korridor wider. Doch Nora hörte sie nicht. Sie konnte nichts mehr erkennen, sondern sah nur noch verschwommene Bilder. Und dann verschwanden auch die.
2
Lieutenant Vincent D’Agosta stand in dem proppevollen Korridor vor der Tür zur Zweizimmerwohnung von Nora Kelly und Bill Smithback. Er zuckte in seinem braunen Anzug mit den Schultern und versuchte, die feuchten Arme von seinem Polyesterhemd zu lösen. Er war sehr zornig, was aber gar nicht gut war. Es würde nur seine Ermittlungen beeinflussen und ihn daran hindern, alles genau unter die Lupe zu nehmen.
Er holte tief Luft und stieß sie wieder aus, um seine Wut vielleicht auf diese Weise loszuwerden.
Die Wohnungstür ging auf. Ein hagerer, gebeugter Mann mit einem kleinen Haarbüschel auf der Glatze trat aus der Wohnung. Er schleppte einen Sack mit Gerätschaften und schob einen auf einem Kofferkuli festgezurrten Aluminiumkoffer vor sich her. »Wir sind fertig, Lieutenant.« Der Mann schnappte sich von einem anderen Beamten ein Klemmbrett und meldete sich ab, sein Assistent ebenso.
D’Agosta schaute auf die Uhr: 15 Uhr. Die Leute von der Spurensicherung hatten lange gebraucht. Sie waren besonders sorgfältig vorgegangen. Ihnen war klar, dass er und Smithback sich schon lange kannten. Es ärgerte ihn, dass sie sich mit gesenktem Kopf an ihm vorbeistahlen, ihn von der Seite ansahen und sich fragten, wie er mit der Sache wohl fertig werden würde. Ob er den Fall abgeben würde. Viele Detectives im Morddezernat würden das tun – und sei es nur deshalb, weil es im Gerichtssaal zu Fragen kommen würde. Es machte nämlich gar keinen guten Eindruck, wenn die Verteidigung einen in den Zeugenstand rief und fragte: »Der Verstorbene war ein Freund von Ihnen? Also finden Sie nicht, dass das ein ziemlich interessanter Zufall ist?« Auf derlei Komplikationen sollte man in Gerichtsverfahren tunlichst verzichten, außerdem konnte kein Bezirksstaatsanwalt es ausstehen, wenn sich so etwas ergab.
Aber D’Agosta dachte nicht daran, diesen Mordfall abzugeben. Niemals. Außerdem war die Sache glasklar. Der Täter war so gut wie verurteilt, sie hatten ihn praktisch auf frischer Tat ertappt. Jetzt mussten sie den Dreckskerl nur noch finden.
Der letzte Mitarbeiter des Spurensicherungsteams kam aus der Wohnung und checkte aus. D’Agosta blieb allein mit seinen Gedanken zurück. Eine Minute lang stand er auf dem inzwischen menschenleeren Flur und bemühte sich, seine angespannten Nerven zu beruhigen. Dann streifte er ein Paar Latexhandschuhe über, zog das Haarnetz über seine beginnende Glatze und ging zur offenen Wohnungstür. Ihm war leicht übel. Die Leiche war natürlich abtransportiert worden, aber sonst hatte man nichts angerührt. Dort, wo der Eingangsflur im rechten Winkel abbog, waren ein schmaler Streifen des dahinterliegenden Zimmers und eine Blutlache zu erkennen, zudem blutige Fußabdrücke und der Abdruck einer Hand, die an der cremefarbenen Wand hinuntergezogen worden war.
D’Agosta machte einen behutsamen Schritt über die Blutlache und blieb vor dem Wohnzimmer stehen. Ledersofa, zwei Sessel, umgestürzter Beistelltisch, weitere Blutflecken auf dem Perserteppich. Er ging langsam bis zur Zimmermitte, wobei er ganz vorsichtig mit seinen Schuhen mit den Kreppsohlen auftrat, blieb stehen, drehte sich um und versuchte, sich das Tatgeschehen zu vergegenwärtigen.
D’Agosta hatte das Team gebeten, umfangreiche Proben der Blutflecken zu nehmen; es gab da überlappende Muster von Blutspritzern, die er abklären wollte, Fußabdrücke, die sich durchs Blut zogen, übereinanderliegende Abdrücke von Händen. Smithback hatte sich wie ein Löwe gewehrt; ausgeschlossen, dass der Täter geflohen war, ohne DNA-Spuren hinterlassen zu haben.
Auf den ersten Blick handelte es sich um ein simples Verbrechen, einen schlecht geplanten, schmutzigen Mord. Der Täter hatte sich mit einem Hauptschlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft. Smithback hielt sich im Wohnzimmer auf. Der Mörder stach auf Smithback ein, was diesen sofort stark in die Defensive drängte. Dann hatten Täter und Opfer gekämpft. Der Kampf hatte sich in der Küche fortgesetzt – Smithback hatte versucht, sich zu bewaffnen: Die Messer-Schublade stand halb offen, am Griff und auf dem Küchentresen befanden sich blutige Abdrücke von Händen. Er hatte sich aber kein Messer schnappen können; verdammt schade. Hatte währenddessen einen Messerstich in den Rücken bekommen. Dann hatten sie noch einmal gekämpft. Inzwischen musste Smithback ziemlich übel verletzt gewesen sein, überall auf dem Boden waren Blut und Rutschflecken von nackten Füßen. Aber D’Agosta war sich ziemlich sicher, dass auch der Täter mittlerweile blutete. Blutete, Haare und Fasern verlor, keuchte und schnaufte vor Anstrengung, vielleicht Speichel und Schleim verspritzte. Es war alles da, und er war überzeugt davon, dass das Spurensicherungsteam nichts übersehen hatte. Die hatten sogar mehrere Dielenbretter ausgesägt und mitgenommen, darunter auch mehrere mit Messerspuren. Sie hatten Stücke aus der Trockenbauwand herausgeschnitten, Fingerabdrücke von allen Oberflächen genommen, jede Faser eingesammelt, die sie finden konnten, jede Fluse und jedes Fitzelchen Schmutz.
D’Agosta ließ den Blick weiter durch das Zimmer schweifen, während in seinem Kopf der Film über das Verbrechen weiter ablief. Schließlich hatte Smithback sehr viel Blut verloren und war so weit geschwächt gewesen, dass der Mörder ihm den Todesstoß versetzen konnte. Laut Aussage des Pathologen war das Messer mitten durchs Herz gestoßen worden und hatte sich mehr als einen Zentimeter tief in den Fußboden gebohrt. Der Täter hatte es, um es herauszuziehen, so heftig gedreht, dass das Holz gesplittert war. D’Agosta merkte, dass er wieder eine ungeheure Wut und Trauer empfand. Auch dieses Dielenbrett war herausgesägt worden.
Nicht, dass all die Aufmerksamkeit für Details einen großen Unterschied machte – sie wussten ja schon, wer der Täter war. Es konnte dennoch nie schaden, Beweismittel anzuhäufen. Man wusste ja nie, mit was für Geschworenen man es in dieser verrückten Stadt zu tun haben würde.
Und dann war da noch dieser bizarre Krempel, den der Mörder zurückgelassen hatte. Ein zermanschtes Gebinde aus Federn, verschnürt mit grünem Bindfaden. Ein Kleidungsstück, bestickt mit knallbunten Pailletten. Ein kleines Beutelchen aus Backpapier mit einer merkwürdigen Zeichnung darauf. Der Mörder hatte das alles in die Blutlache gelegt wie Opfergaben. Die Jungs von der Spurensicherung hatten die Sachen zwar alle mitgenommen, aber sie standen D’Agosta noch deutlich vor Augen.
Eine Sache hatten die Spurensicherungsleute allerdings nicht mitnehmen können: das eilig hingekritzelte Bild an der Wand. Zwei Schlangen, die sich um irgendein merkwürdiges, stacheliges, pflanzenähnliches Etwas wanden, dazu Sterne, Pfeile, komplizierte Linien und ein Wort, das aussah wie »Dambala«. Das Bild war ohne Zweifel mit Smithbacks Blut gemalt worden.
D’Agosta ging in das Schlafzimmer und nahm das Bett in Augenschein, die Kommode, den Spiegel, das Fenster mit Blick nach Südosten auf die West End Avenue, den Teppich, die Wände, die Decke. Am gegenüberliegenden Ende des Zimmers befand sich ein zweites Bad, die Tür war verschlossen.
Aus dem Bad drang ein Geräusch: der Wasserhahn, der auf- und zugedreht wurde. Jemand von der Spurensicherung befand sich also noch in der Wohnung. D’Agosta ging mit langen Schritten hin, packte den Türgriff und stellte fest, dass die Tür abgeschlossen war.
»He, Sie da drin! Was machen Sie da?«
»Nur einen Moment«, ließ sich eine gedämpfte Stimme vernehmen.
D’Agostas Erstaunen verwandelte sich in Verärgerung. Der Idiot war auf die Toilette gegangen. Und das an einem versiegelten Tatort. Irre. Unfassbar.
»Machen Sie die Tür auf, mein Freund. Sofort.«
Die Tür sprang auf – und vor ihm stand Special Agent A. X. L. Pendergast, Reagenzgläser in einem kleinen Gestell in der einen Hand, Pinzette in der anderen, eine Juwelierlupe an einem Stirnband auf dem Kopf.
»Vincent«, begann er in seinem vertrauten, seidenweichen Tonfall. »Es tut mir so leid, dass wir uns unter solch unglücklichen Umständen wiedersehen.«
D’Agosta starrte ihn entgeistert an. »Pendergast – ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie wieder in der Stadt sind.«
Pendergast steckte die Pinzette geschickt ein und legte das Gestell mit den Reagenzgläsern, dann die Lupe in seine altmodische Arzttasche. »Der Mörder war weder hier drin noch im Schlafzimmer. Eine recht offensichtliche Schlussfolgerung, aber ich wollte sichergehen.«
»Ist das jetzt ein Fall für das FBI?«, fragte D’Agosta und folgte Pendergast durch das Schlafzimmer ins Wohnzimmer.
»Streng genommen nicht.«
»Dann arbeiten Sie also wieder frei?«
»So könnte man das ausdrücken. Ich würde es allerdings sehr begrüßen, wenn wir meine Beteiligung vorerst für uns behielten.« Er drehte sich um. »Ihre Meinung, Vincent?«
D’Agosta legte seine Rekonstruktion des Verbrechens dar, während Pendergast zustimmend nickte. »Nicht, dass das einen großen Unterschied macht«, fasste D’Agosta zusammen. »Wir wissen ja bereits, wer der Dreckskerl ist. Wir müssen ihn nur noch finden.«
Pendergast hob fragend die Brauen.
»Er wohnt hier im Haus. Wir haben zwei Augenzeugen, die den Täter gesehen haben, als er das Gebäude betreten, und zwei, als er es verlassen hat, von oben bis unten mit Blut besudelt, ein Messer in der Hand. Er hat Nora Kelly attackiert, als er die Wohnung verließ – hat es versucht, sollte ich sagen, aber der Kampf hat die Nachbarn alarmiert, und da ist er geflüchtet. Sie haben ihn genau erkannt, die Nachbarn, meine ich. Nora liegt im Moment im Krankenhaus – eine kleine Gehirnerschütterung, es dürfte ihr aber gut gehen. Na ja, den Umständen entsprechend gut.«
Pendergast nickte kurz.
»Der Arsch heißt Fearing. Colin Fearing. Arbeitsloser britischer Schauspieler. Apartment zwei-eins-vier. Er hat Nora ein paarmal in der Lobby belästigt. Für mich sieht das nach einer Vergewaltigung aus, die außer Kontrolle geraten ist. Fearing hatte vermutlich gehofft, Nora allein in der Wohnung anzutreffen, aber stattdessen war Smithback da. Kann sein, dass er den Schlüssel aus dem Schlüsselschrank des Hausmeisters entwendet hat. Ich lasse das gerade von einem Beamten überprüfen.«
Diesmal nickte Pendergast allerdings nicht bestätigend. Nur der übliche undurchdringliche Ausdruck lag in seinen tiefliegenden, blassblauen Augen.
»Wie auch immer, der Fall ist glasklar«, sagte D’Agosta, der sich trotzdem irgendwie in die Defensive gedrängt fühlte. »Nicht nur Nora hat ihn identifiziert. Er ist auf den Videobändern der Security des Gebäudes zu sehen, eine oscarreife Darstellung. Kommt rein und geht raus. Von dem Moment, als er das Gebäude verließ, haben wir eine Frontalaufnahme, wie er, Messer in der Hand, von oben bis unten mit Blut besudelt, seinen bedauernswerten Hintern durch die Lobby schleppt, den Doorman bedroht und dann abhaut. Wird bei den Geschworenen einen klasse Eindruck hinterlassen. Da kann sich der Dreckskerl nicht rausreden.«
»Ein glasklarer Fall, sagten Sie?«
Wieder hörte D’Agosta einen leisen Zweifel in Pendergasts Stimme. »Ja«, sagte er bestimmt. »Glasklar.« Er sah auf die Uhr. »Der Doorman wird im Moment befragt, meine Leute warten auf mich. Er wird einen fabelhaften Zeugen abgeben, ein verlässlicher, solider Familienvater, der den Täter seit Jahren kannte. Möchten Sie ihm irgendwelche Fragen stellen, bevor wir ihn nach Hause schicken?«
»Mit dem größten Vergnügen. Aber bevor wir nach unten gehen …« Pendergast unterbrach sich. Mit seinen spinnedünnen weißen Fingern griff er in die Brusttasche seines schwarzen Anzugs und zog ein gefaltetes Dokument hervor. Mit eleganter, knapper Handbewegung hielt er es D’Agosta hin.
»Was ist das?« D’Agosta nahm das Schriftstück entgegen, faltete es auseinander und betrachtete den roten notariellen Stempel, das Große Siegel der Stadt New York, den edlen Druck, die Unterschriften.
»Colin Fearings Sterbeurkunde. Vor zehn Tagen unterschrieben und datiert.«
3
Gefolgt von der etwas gespenstischen Erscheinung Pendergasts betrat D’Agosta das kleine Security-Kabuff des Gebäudes 666 West End Avenue. Der Doorman, ein rundlicher Herr aus der Dominikanischen Republik namens Enrico Mosquea, saß mit gespreizten Beinen auf einem Metallhocker. Er trug einen schmalen Schnurrbart und eine gekräuselte Marcel-Welle zur Schau. Bei ihrem Eintritt sprang er erstaunlich behende auf.
»Sie diesen Sohn einer Hure finden«, sagte er leidenschaftlich. »Sie ihn finden. Mr. Smithback, er ein guter Mensch. Ich sage Ihnen …«
D’Agosta legte sanft eine Hand auf die adrette braune Uniform des Mannes. »Das hier ist Special Agent Pendergast vom FBI. Er wird uns helfen.«
Er musterte Pendergast. »Gut. Sehr gut.«
D’Agosta holte tief Luft. Er hatte noch nicht ganz begriffen, was das Dokument, das Pendergast ihm gezeigt hatte, bedeutete. Vielleicht hatten sie es hier ja mit einem Zwilling zu tun. Möglicherweise gab es zwei Colin Fearings. New York war eine große Stadt, und die Hälfte der Briten in der Stadt hieß mit Vornamen offenbar Colin. Womöglich war dem Rechtsmedizinischen Institut ein furchtbarer Fehler unterlaufen.
»Ich weiß, Sie haben schon sehr viele Fragen beantwortet, Mr. Mosquea«, fuhr D’Agosta fort, »aber Agent Pendergast hat noch ein paar.«
»Keine Schwierigkeit. Ich beantworte Fragen zehn-, zwanzigmal, wenn hilft, diesen Sohn einer Hure zu schnappen.«
D’Agosta zog ein Notizbuch hervor. Tatsächlich aber wollte er, dass Pendergast hörte, was Mosquea zu sagen hatte. Der Mann war ein absolut glaubwürdiger Zeuge.
Leise sagte Pendergast: »Mr. Mosquea, beschreiben Sie doch bitte einmal, was Sie gesehen haben. Von Anfang an.«
»Dieser Mann, Fearing, er kommt gerade an, als ich jemand zu Taxi bringe. Ich habe gesehen, wie er das Gebäude betreten. Er sah nicht besonders gut aus – als ob er sich geprügelt hätte. Das Gesicht geschwollen, vielleicht ein blaues Auge. Das Gesicht von einer komischen Farbe, zu blass. Er auch irgendwie komisch gegangen. Langsam.«
»Wann hatten Sie ihn das letzte Mal gesehen – vor diesem Mal?«
»Vielleicht zwei Wochen. Ich glaube, er waren verreist.«
»Fahren Sie fort.«
»Er gehen also an mir vorbei in den Fahrstuhl. Ein bisschen später kommen Mrs. Kelly zurück ins Gebäude. Vielleicht fünf Minuten vergehen. Dann er kommt wieder heraus. Unglaublich. Ist von oben bis unten mit Blut beschmiert, hält ein Messer in der Hand, taumelt, als ob verletzt.« Mosquea machte eine kurze Pause. »Ich versuche, ihn zu packen, aber er gehen mit Messer auf mich los, dann er sich umdrehen und rennt davon. Ich Polizei rufen.«
Pendergast strich sich mit seiner elfenbeinfarbenen Hand übers Kinn. »Ich stelle mir vor, dass Sie, als Sie die Person zum Taxi brachten – als Fearing das Gebäude betrat –, einen flüchtigen Blick auf ihn erhaschen konnten.«
»Ich einen langen, langen Blick erhaschen. Nicht flüchtig. Wie ich gesagt haben, er ist langsam gegangen.«
»Sie sagten, sein Gesicht sei geschwollen gewesen. Könnte es sich um jemand anderen gehandelt haben?«
»Fearing wohnen hier seit sechs Jahren. Ich öffnen dem Sohn einer Hure drei-, viermal am Tag die Tür.«
Pendergast hielt kurz inne. »Und dann, als er das Gebäude wieder verließ, war sein Gesicht blutverschmiert?«
»Nicht Gesicht. Kein Blut in Gesicht, oder vielleicht nur ein bisschen. Blut überall an Händen, Kleidern. Messer.«
Pendergast schwieg einen Augenblick. Dann sagte er: »Und wenn ich Ihnen nun sage, dass Colin Fearings Leichnam vor zehn Tagen im Harlem River gefunden wurde?«
Mosquea kniff die Augen zusammen. »Dann ich würden sagen, Sie irren sich!«
»Ich fürchte, dem ist nicht so, Mr. Mosquea. Die Leiche wurde identifiziert, eine Autopsie wurde vorgenommen, alles.«
Mosquea, einen Meter sechzig groß, reckte sich, seine Stimme klang ernst und würdevoll: »Wenn Sie mir nicht glauben, dann bitten ich Sie: Sehen Sie sich Video an. Der Mann auf dem Band ist Colin Fearing.« Er hielt inne und schaute Pendergast herausfordernd an. »Irgendeine Leiche in Fluss mich nicht interessieren. Der Mörder ist Colin Fearing. Ich weiß.«
»Haben Sie vielen Dank, Mr. Mosquea«, sagte Pendergast.
D’Agosta räusperte sich. »Wenn wir noch einmal mit Ihnen sprechen müssen, lasse ich es Sie wissen.«
Mosquea nickte, betrachtete Pendergast jedoch auch weiterhin mit Skepsis. »Der Mörder ist Colin Fearing. Sie den Sohn einer Hure finden.«
Als Pendergast und D’Agosta auf die West End Avenue hinaustraten, erfrischte die kühle Oktoberluft sie nach der stickigen Enge in der Wohnung. Pendergast deutete auf einen Rolls-Royce Silver Wraith, Baujahr 59, der mit laufendem Motor am Randstein parkte. D’Agosta sah den kräftigen Umriss von Proctor, Pendergasts Chauffeur, auf dem Fahrersitz. »Soll ich Sie in die Stadt mitnehmen?«
»Sehr gern. Es ist schon halb vier, ich muss wahrscheinlich bis tief in die Nacht arbeiten.«
D’Agosta stieg in den Rolls-Royce, in dem es angenehm nach Leder duftete; Pendergast setzte sich neben ihn. »Sehen wir uns mal das Security-Band an.« Er drückte einen Knopf in der Armlehne, und aus dem Wagenhimmel schwenkte ein LCD-Bildschirm.
D’Agosta holte eine DVD aus seiner Aktentasche. »Hier, das ist eine Kopie. Das Original ist schon auf dem Präsidium.«
Pendergast schob die DVD ins Laufwerk. Kurz darauf war die im Weitwinkel aufgenommene Lobby des Gebäudes 666 West End Avenue auf dem Bildschirm zu sehen, das Fischaugenobjektiv deckte den Bereich vom Fahrstuhl bis zur Eingangstür ab. Ein kleines Insert in der Ecke zeigte die ablaufenden Sekunden. D’Agosta sah sich – wohl zum zehnten Mal – an, wie der Doorman mit einem der Bewohner das Gebäude verließ, um offensichtlich ein Taxi herbeizuwinken. Während der Doorman draußen war, drückte eine Gestalt die Eingangstür auf und betrat das Gebäude. Die Art und Weise, wie der Mann ging, hatte etwas unaussprechlich Gruseliges – merkwürdig wankend, als hätte er fast keinen Halt, mit schweren Schritten, aber ohne die geringste Spur von Eile. Er sah einmal kurz zur Überwachungskamera hoch, mit glasigen, scheinbar blicklosen Augen. Er trug ein bizarres Outfit: ein knallbuntes, mit Pailletten besetztes Kleidungsstück, das er über dem Hemd trug, mit einem farbenfrohen Besatz aus rotem Stoff voller Schnörkel, Herzen und rasselförmiger Knochen. Das Gesicht wirkte aufgedunsen und missgestaltet.
Pendergast spulte die Aufnahme vor, bis eine weitere Person ins Blickfeld der Überwachungskamera kam: Nora Kelly, einen Kuchen-Karton tragend. Sie ging zum Fahrstuhl und verschwand wieder. Erneutes Vorspulen, dann wankte Fearing, plötzlich völlig außer Fassung, aus dem Fahrstuhl. Jetzt war seine Kleidung zerrissen und mit Blut beschmiert, die rechte Hand packte ein großes, etwa 25 Zentimeter langes Messer. Der Doorman trat auf ihn zu und versuchte, ihn festzuhalten; Fearing ging mit dem Messer auf ihn los, watschelte durch die doppelflügelige Tür und verschwand im Dunkel.
»Dieses Schwein«, sagte D’Agosta. »Ich würde ihm am liebsten die Eier abschneiden und ihm auf Toast servieren.«
Er sah zu Pendergast hinüber. Aber der schien tief in Gedanken versunken zu sein.
»Sie müssen zugeben, dass das Video ziemlich eindeutig ist. Sind Sie sicher, dass es sich bei der Leiche im Harlem River um Fearing handelt?«
»Seine Schwester hat den Toten identifiziert. Die Leiche wies mehrere Muttermale auf, Tätowierungen, die das bestätigen. Der für den Fall zuständige Rechtsmediziner ist verlässlich, wenngleich ein bisschen schwierig.«
»Wie ist Fearing gestorben?«
»Selbstmord.«
D’Agosta stöhnte auf. »Keine weiteren Familienangehörigen?«
»Die Mutter ist geistig verwirrt und lebt in einem Pflegeheim. Sonst niemand.«
»Und die Schwester?«
»Ist nach der Identifizierung der Leiche zurück nach England geflogen.« Pendergast verfiel in Schweigen. Plötzlich hörte D’Agosta, wie er sotto voce murmelte: »Sonderbar, sehr sonderbar.«
»Was?«
»Mein lieber Vincent, in diesem ohnehin schon verwirrenden Fall gibt es etwas, das mir ganz besonders rätselhaft erscheint – das Videoband. Ist Ihnen aufgefallen, was Fearing tut, als er die Lobby das erste Mal betritt – auf dem Weg ins Gebäude?«
»Ja, was denn?«
»Er hat nach oben in die Kamera gesehen.«
»Er wusste, dass sie dort installiert ist. Er wohnte in dem Haus.«
»Genau.« Und damit verfiel Pendergast abermals in nachdenkliches Schweigen.
4
Caitlyn Kidd saß auf dem Fahrersitz ihres RAV4 und balancierte in der einen Hand ein Frühstücks-Sandwich und in der anderen einen großen schwarzen Kaffee. Sie las in einer Ausgabe von Vanity Fair, die aufgeschlagen auf dem Lenkrad lag. Draußen auf der 79. Straße West quietschte und hupte der morgendliche Berufsverkehr ein unbehaglich stimmendes Ostinato.
Aus dem in das Armaturenbrett eingebauten Polizeifunkgerät kam eine Meldung, und sofort warf Caitlyn einen Blick auf das Gerät.
»… Zentrale an 2527, fahren Sie zu einem 10-50 an der Ecke 118. und Third …«
So rasch ihr Interesse geweckt worden war, so schnell erlosch es wieder. Sie biss noch einmal von ihrem Sandwich ab und blätterte mit einem freien Finger die Seiten der Zeitschrift um.
Caitlyn war Polizeireporterin, zuständig für Manhattan, und lungerte darum viel in ihrem Auto herum. Die Verbrechen trugen sich oft in entlegenen Ecken der Insel zu, und wenn man sich gut auskannte, war man mit dem eigenen Wagen verdammt viel schneller, als wenn man die U-Bahn oder ein Taxi nahm. In ihrer Branche bedeutete die große Exklusiv-Story alles, es kam auf jede Minute an. Und der Polizeifunk sorgte teilweise dafür, dass sie immer auf dem Laufenden war, was die interessantesten Geschichten anging. Einmal eine große Story rausbringen – darauf hoffte sie. Eine echt spitzenmäßige Exklusiv-Story.
Auf dem Beifahrersitz klingelte ihr Handy. Sie griff danach und klemmte es zwischen Kinn und Schulter, während sie eine ziemlich komplizierte Dreier-Jongliernummer mit Sandwich, Handy und Kaffeebecher vollführte. »Kidd.«
»Caitlyn. Wo bist du?«
Die Stimmte kannte sie: Larry Bassington, der beim West Sider, dem Boulevardblatt, für das sie beide arbeiteten, die Nachrufe schrieb. Er baggerte sie andauernd an. Sie hatte seine Einladung zum Lunch angenommen, hauptsächlich weil sie knapp bei Kasse war und erst Ende der Woche ihr Gehalt bekam.
»Im Einsatz«, sagte Kidd.
»So früh schon?«
»Die besten Anrufe kriege ich im Morgengrauen. Dann werden die Leichen gefunden.«
»Ich weiß nicht, warum du dir so viel Mühe gibst – der WestSider ist nicht gerade die Daily News. Hey, vergiss nicht –«
»… Zentrale an 3133, Berichte über einen 10-53 in 1579 Broadway, bitte hinfahren.«
»3133 an Zentrale, 10-4 …«
Sie stellte den Funk leiser und konzentrierte sich wieder aufs Telefon. »Entschuldige. Was hast du gesagt?«
»Ich sagte, du sollst unser Date nicht vergessen.«
»Das ist kein Date. Wir gehen Mittag essen.«
»Lass mir bitte meine Träume, ja? Wo möchtest du hin?«
»Du lädst mich ein, also bestimmst du.«
Eine Pause. »Wie wär’s mit dem Vietnamesen in der Zweiunddreißigsten?«
»Hm, nein danke. Hab da gestern gegessen und es den ganzen Nachmittag bereut.«
»Okay, wie wär’s mit Alfredo’s?«
Aber wieder lauschte Kidd dem Polizeifunk.
»… Einsatzzentrale, Einsatzzentrale, hier 7477, wir sind an dem 10-29-Mord dran. Das Opfer, Smithback, William, befindet sich im Moment auf dem Weg ins Rechtsmedizinische Institut zur Obduktion. Leitender Ermittlungsbeamter verlässt gerade den Tatort.«
»10-4, 7477 …«
Ihr wäre fast der Kaffeebecher aus der Hand gefallen. »Heiliger Bimbam! Hast du das gehört?«
»Was denn?«
»Die Meldung ist gerade über Polizeifunk gekommen. Es hat einen Mord gegeben. Und ich kenne das Opfer – Bill Smithback. Er schreibt für die Times. Ich hab ihn letzten Monat auf dieser Journalismus-Konferenz an der Columbia kennengelernt.«
»Und woher weißt du, dass es ein und derselbe Typ ist?«
»Wie viele Leute mit Namen Smithback kennst du? Tut mir leid, Larry, ich muss los.«
»Wow, wie furchtbar für ihn. Also, was unser Mittagessen angeht …«
»Kannste vergessen.« Sie klappte das Handy mit dem Kinn zu, ließ es auf den Schoß fallen und startete den Motor. Dann ließ sie die Kupplung kommen und fädelte sich in den Verkehr ein, während Salatblätter, Tomaten, Peperoni und Rührei in hohem Bogen durchs Auto flogen.
Es dauerte keine fünf Minuten, bis sie an der Ecke West End Avenue und 92. Straße eintraf. Caitlyn kannte sich gut aus in den Straßen Manhattans, und ihr Toyota hatte genügend Beulen und Kratzer, dass noch eine Delle auch keine große Rolle mehr spielte. Sie parkte vor einem Feuerhydranten – mit etwas Glück würde sie ihre Story im Kasten haben und wäre schon wieder weg, ehe ein Verkehrspolizist die Ordnungswidrigkeit entdeckt hatte. Und wenn nicht, na ja, sie hatte schon dermaßen viele Strafzettel kassiert, dass die beinahe mehr wert waren als der Wagen selbst.
Raschen Schritts ging sie am Häuserblock entlang und zog dabei ein digitales Aufzeichnungsgerät aus der Tasche. Vor der Adresse 666 West End Avenue parkten mehrere Fahrzeuge in zweiter Reihe: zwei Streifenwagen, ein ziviler Crown Vic und ein Rettungswagen. Ein Leichenwagen fuhr gerade vor. Auf den obersten Stufen zum Eingang des Gebäudes waren zwei uniformierte Polizisten postiert und ließen nur die Bewohner des Hauses hinein, aber unten auf dem Bürgersteig stand eine kleine Gruppe von Leuten, die leise und angespannt miteinander sprachen. Sie zogen lange, verkniffene Gesichter, fast so – wie Kidd sich trocken sagte –, als wäre ihnen gerade eben ein Gespenst erschienen.
Geübt und effektiv mischte sie sich unter die unruhigen Leutchen und lauschte einem halben Dutzend Gesprächen gleichzeitig, wobei sie gekonnt das nutzlose Geplapper überging und sich auf diejenigen konzentrierte, die offenbar etwas wussten. Sie wandte sich an einen glatzköpfigen, untersetzten Mann mit granatapfelroter Gesichtsfarbe. Obwohl es schon herbstlich kühl war, schwitzte er heftig.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie und trat auf den Mann zu. »Caitlyn Kidd, Presse. Stimmt es, dass William Smithback ermordet worden ist?«
Er nickte.
»Der Journalist?«
Wieder nickte der Mann. »Eine Tragödie. Er war ein netter Bursche, hat mir immer Gratisexemplare mitgebracht. Sind Sie eine Kollegin?«
»Ich arbeite als Polizeireporterin beim West Sider. Sie haben ihn also gut gekannt?«
»Hat weiter unten auf dem Flur gewohnt. Gestern habe ich ihn noch gesehen.« Er schüttelte den Kopf.
Genau das brauchte sie. »Was ist denn genau passiert?«
»Es war gestern spät am Abend. Ein Kerl mit einem Messer hat ihn übel zugerichtet. Ich habe das alles mitbekommen. Furchtbar.«
»Und der Mörder?«
»Ich habe ihn gesehen, sogar erkannt, der Kerl wohnt hier im Haus. Colin Fearing.«
»Colin Fearing.« Kidd wiederholte den Namen langsam für den Recorder.
Die Miene des Mannes veränderte sich. Jetzt konnte Kidd sie nicht mehr mühelos lesen. »Schauen Sie, es gibt da ein Problem.«
Sie stürzte sich sofort auf die Aussage. »Ja?«
»Wie es scheint, ist Fearing vor zwei Wochen gestorben.«
»Ach ja? Wie das?«
»Seine Leiche wurde im Harlem River gefunden, sie trieb im Wasser. Wurde identifiziert, obduziert, alles.«
»Sind Sie da ganz sicher?«
»Ein Polizist hat es dem Doorman gesagt. Dann hat der es uns erzählt.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Kidd.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich auch nicht.«
»Aber Sie sind sich sicher, dass es sich bei dem Mann, den Sie gestern Abend gesehen haben, ebenfalls um diesen Colin Fearing gehandelt hat?«
»Ich zweifle keine Sekunde daran. Fragen Sie Heidi hier, die hat ihn auch erkannt.« Und damit deutete der Mann auf eine etwas verängstigt aussehende Frau, die neben ihm stand. »Der Doorman hat ihn auch gesehen. Hat mit ihm gekämpft. Da ist er, kommt gerade aus dem Gebäude.« Er wies zur Eingangstür, in der gerade ein kleiner, adrett gekleideter Hispanic erschien.
Schnell notierte Caitlyn sich die Namen und ein paar weitere relevante Details. Ihr stand förmlich vor Augen, was der Schlagzeilen-Redakteur im West Sider aus dieser Geschichte machen würde.
Mittlerweile waren weitere Reporter eingetroffen; sie stürzten sich geradezu wie die Geier auf die Leute, stritten mit den Polizisten, die inzwischen allerdings wach geworden waren und die Bewohner zurück in das Gebäude scheuchten. Als Caitlyn an ihrem Wagen ankam, sah sie unter einem der Scheibenwischer einen Strafzettel.
Was ihr aber völlig schnuppe war. Sie hatte ihre große Story ja im Kasten.
5
Nora Kelly schlug die Augen auf. Es war Nacht, und alles war ruhig. Eine leichte Brise wehte aus der Stadt durchs Fenster ihres Krankenzimmers und ließ den zugezogenen Trennvorhang um das leere Bett neben ihr rascheln.
Der von den Schmerzmitteln verursachte Nebel in ihrem Kopf war verschwunden, und als ihr klar wurde, dass sie sicherlich nicht wieder einschlafen konnte, blieb sie völlig reglos liegen und versuchte, die Flut des Entsetzens und der Trauer einzudämmen, die sie zu überwältigen drohte. Das Leben war so grausam und launenhaft, dass es ihr völlig sinnlos vorkam. Trotzdem versuchte sie, ihre Trauer zu meistern, sich auf das leichte Pochen in ihrem bandagierten Kopf, die Geräusche in dem großen Krankenhaus um sie herum zu konzentrieren. Langsam ließ das Zittern in ihren Beinen nach.
Bill – ihr Ehemann, ihr Geliebter, ihr Freund – war tot. Und nicht nur, dass sie es gesehen hatte; sie spürte es körperlich in ihrem Inneren. Sie empfand eine Abwesenheit, eine Leere. Bill war von der Erde verschwunden.
Der Schrecken und das Entsetzen, die dieses Ereignis ausgelöst hatte, schienen mit jeder Stunde nur noch größer zu werden, und doch waren Noras Gedanken so klar, so schmerzlich, dass sie es kaum noch ertrug. Wie hatte das nur passieren können? Es war ein Albtraum, die grausame Tat eines erbarmungslosen Gottes. Erst gestern Abend hatten sie ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Und jetzt … jetzt …
Erneut bemühte sie sich, die Welle ihres unerträglichen Schmerzes zurückzudrängen. Sie streckte die Hand nach der Schwesternklingel aus, wollte um noch eine Dosis Morphium bitten, hielt jedoch inne. Das war keine Lösung. Wieder schloss sie die Augen, in der Hoffnung auf die wohltuende Umarmung des Schlafs, auch wenn sie wusste, dass sie sich nicht einstellen würde. Vielleicht niemals mehr.
Da hörte sie etwas; ein flüchtiges Déjà-vu-Gefühl sagte ihr, dass es der gleiche Laut war, der sie gerade eben geweckt hatte. Sie riss die Augen auf. Ein Grunzen, das vom anderen Bett in dem Doppelzimmer kam. Ihre jähe Panik legte sich; die Schwestern mussten, während sie geschlafen hatte, jemanden in das Nachbarbett gelegt haben.
Nora wandte den Kopf, um die Person auf der anderen Seite des Vorhangs zu sehen. Sie hörte ein leises Atmen, es kam stoßweise, röchelnd. Der Vorhang bewegte sich leicht, und da wurde ihr klar, dass dies nicht an dem Luftzug im Zimmer lag, sondern weil sich die Person im Bett bewegte. Ein Seufzen, ein Knistern von gestärkten Bettlaken. Der halb durchsichtige Vorhang wurde von hinten vom Fenster erhellt, so dass Nora gerade eben eine dunkle Silhouette erkannte. Während sie auf diesen Umriss blickte, erhob sich die Person unter weiterem Seufzen und mühsamem Keuchen.
Der undeutliche Schatten einer Hand kam zum Vorschein. Sie strich und glitt an dem durchscheinenden Stoff entlang und setzte den Vorhang in schwingende Bewegung. Schließlich fand die Hand eine Öffnung, schlüpfte hindurch und packte die Vorhangkante.
Nora starrte hin. Die Hand war schmutzig. Überzogen von dunklen, nassen Streifen, die fast so aussahen wie Blut. Je länger sie in dem trüben Licht hinschaute, desto sicherer war sie, dass es tatsächlich Blut war. Vielleicht handelte es sich um einen Patienten, der frisch aus dem Operationssaal gekommen oder dessen Operationsnarbe aufgeplatzt war. Um jemanden, der sehr krank war.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?« In der Stille klang ihre Stimme laut und heiser zugleich.
Noch ein Stöhnen. Ganz langsam zog sich die Hand wieder hinter den Vorhang zurück. Die Langsamkeit, mit der die Metallringe auf der Stange zurückglitten, hatte etwas Gruseliges. Sie klirrten mit einer klanglosen, lahmen Kadenz. Wieder tastete Nora am Gitter ihres Betts nach dem Klingelknopf.
Der Vorhang wurde zurückgezogen, und jetzt wurde eine dunkle Gestalt sichtbar, in Lumpen gekleidet und mit dunklen Flecken übersät. Die verfilzten, verklebten Haare standen wirr vom Kopf ab. Nora hielt den Atem an. Und während sie die Erscheinung anstarrte, wandte diese langsam den Kopf und sah sie an. Der Mund öffnete sich, und ein röchelnder Laut entrang sich ihrer Kehle, wie Wasser, das einen Abfluss hinabgesogen wurde.
Nora tastete fieberhaft nach dem Klingelknopf.
Die Gestalt glitt mit den Füßen auf den Boden, wartete einen Augenblick, als wolle sie verschnaufen, und stand dann unsicher da. Eine Minute schwankte sie hin und her in dem matten Licht. Dann trat sie einen kleinen, beinahe tastenden Schritt auf Nora zu. Im selben Moment fiel ein fahler Lichtstrahl durch den oberen Türschlitz auf das Gesicht, so dass Nora ganz kurz die schmutzbedeckten Gesichtszüge sehen konnte, aufgedunsen und feucht. Irgendetwas an diesem Gesicht und an den torkelnden Bewegungen weckte in ihr ein furchterregendes Gefühl der Vertrautheit. Noch ein unsicherer Schritt nach vorn, dann streckte sich ein zitternder Arm nach ihr aus …
Nora kreischte, verzweifelt schlug sie mit beiden Armen nach der Gestalt und versuchte, ihr kriechend auszuweichen. Dabei verfingen sich ihre Füße in der Bettdecke. Sie schrie auf, drückte wieder die Klingel und versuchte mit aller Kraft, die Bettdecke abzuschütteln. Warum brauchten die Schwestern so lange? Sie befreite sich mit einem gewaltsamen, kurzen Zerren, schwang sich aus dem Bett, stieß dabei den Infusionsständer um und stürzte von Panik und Schrecken erfüllt zu Boden …
Nach einem langen Augenblick der Benommenheit und der Verwirrung hörte sie eilige Schritte, Stimmen. Das Licht ging an; eine Schwester beugte sich über sie, hob sie sanft auf und sprach ihr beruhigend ins Ohr.
»Entspannen Sie sich«, ließ sich die Stimme vernehmen. »Sie hatten nur einen Albtraum …«
»Es war hier!«, schrie Nora und wehrte sich. »Hier drin!« Sie wollte die Hand heben, um auf die Stelle zu zeigen, aber die Schwester hatte schon die Arme um sie gelegt und hielt sie sanft, aber bestimmt fest.
»Kommen Sie, wir bringen Sie zurück ins Bett. Albträume sind nach einer Gehirnerschütterung etwas ganz Normales.«
»Nein. Die Erscheinung war wirklich, ich schwöre es!«
»Natürlich hat sie wirklich ausgesehen. Aber jetzt ist alles in Ordnung mit Ihnen.« Die Schwester half ihr behutsam zurück ins Bett und legte ihr die Bettdecke über.
»Schauen Sie nach! Hinter dem Vorhang!« Nora hatte derart pochende Kopfschmerzen, dass sie kaum einen klaren Gedanken fassen konnte.
Noch eine Schwester kam ins Zimmer gelaufen, mit gezückter Spritze.
»Ich weiß, ich weiß. Aber Sie sind jetzt in Sicherheit …« Sie betupfte Nora die Stirn mit einem kühlen Tuch. Nora spürte, wie ihr eine Nadel in den Oberarm stach. Eine dritte Schwester erschien im Zimmer und richtete den Infusionsständer auf.
»Hinter dem Vorhang … in dem Bett …« Nora wehrte sich zwar dagegen, doch sie spürte, dass ihr Körper immer schlaffer wurde.
»Hier drin?«, fragte die Schwester und stand auf. Sie zog den Vorhang zurück – und ein penibel gemachtes Bett kam zum Vorschein. »Sehen Sie? Es war nur ein Traum.«
Nora legte sich zurück, ihre Glieder wurden schwer. Es war doch nicht Realität gewesen.
Die Schwester beugte sich über sie, strich die Bettdecke glatt und deckte sie fester zu. Verschwommen sah Nora, wie die zweite Schwester eine neue Flasche mit einer Nährlösung an den Infusionsständer hängte und den Schlauch wieder anbrachte. Alles schien in weite Ferne zu entschwinden. Nora war müde, so müde. Natürlich war es ein Traum gewesen. Und plötzlich interessierte sie das alles nicht mehr, sondern sie fand ihn herrlich, diesen Zustand, wenn einem alles egal ist …
6
Vincent D’Agosta blieb vor der offenen Tür von Nora Kellys Krankenhauszimmer stehen und klopfte zaghaft an. Das Licht der Morgensonne strömte den Flur hinunter und tauchte die metallisch schimmernden medizinischen Geräte, die an den gekachelten Wänden aufgereiht standen, in ein goldenes Licht.
Er hatte nicht damit gerechnet, dass ihm eine so kräftige Stimme antworten würde. »Herein.«
Er trat ein und fühlte sich unbehaglich, legte seinen Hut auf den einzigen Stuhl, musste ihn dann wieder in die Hand nehmen, um sich setzen zu können. Er hatte so etwas noch nie gut gekonnt. Er betrachtete sie etwas zögernd und wunderte sich über das, was er sah. Statt einer verletzten, verzweifelten, trauernden Witwe saß da eine Frau vor ihm, die erstaunlich gefasst wirkte. Ihre Augen waren rotgerändert, blickten aber klar und entschlossen. Ein Verband, der einen Teil ihres Kopfs bedeckte, und eine leicht bläuliche Verfärbung unter dem rechten Auge waren die einzigen Anzeichen der Attacke zwei Tage zuvor.
»Nora, es tut mir leid, so verdammt leid …« Er stockte.
»Bill hat Sie als guten Freund betrachtet.« Sie sprach langsam und mit Bedacht, als wüsste sie irgendwie, was gesagt werden musste, ohne im Grunde etwas davon zu begreifen.
Pause. »Wie geht es Ihnen?« Dabei wusste er, noch während er das sagte, wie lahm die Frage klang.
Nora schüttelte nur den Kopf und gab die Frage zurück. »Und wie geht es Ihnen?«
D’Agosta antwortete ehrlich. »Beschissen.«
»Bill hätte sich darüber gefreut, dass Sie … das hier übernehmen.«
Er nickte.
»Gegen Mittag kommt der Arzt, und wenn alles in Ordnung ist, werde ich entlassen.«
»Nora, es gibt da etwas, das Sie wissen müssen: Wir werden diesen Scheißkerl finden. Wir werden ihn finden und einsperren und den Schlüssel wegwerfen.«
Sie gab ihm keine Antwort darauf.
Er rieb sich mit der Hand über die kahle Stelle auf dem Kopf. »Und zu diesem Zweck werde ich Ihnen noch einige weitere Fragen stellen müssen.«
»Nur zu. Reden … Reden hilft tatsächlich.«
»Gut.« Er zögerte. »Sind Sie sich sicher, dass es Colin Fearing war?«
Sie blickte ihm fest in die Augen. »So sicher, wie ich hier liege, in diesem Moment, in diesem Bett. Es war Fearing, garantiert.«
»Wie gut kannten Sie ihn?«
»Er hat mich des Öfteren angegafft, in der Lobby. Einmal hat er mich um ein Date gebeten – obwohl er wusste, dass ich verheiratet bin.« Sie schüttelte sich. »Ein echtes Schwein.«
»Hatten Sie irgendwie den Eindruck, dass er psychisch labil ist?«
»Nein.«
»Erzählen Sie doch mal, wie er Sie, äh, um ein Date gebeten hat.«
»Wir sind zufällig in den gleichen Fahrstuhl gestiegen. Er hat sich zu mir umgedreht, mit den Händen in den Hosentaschen, und mich in seinem schnöseligen britischen Akzent gefragt, ob ich mit zu ihm in die Wohnung kommen und mir seine Stiche ansehen möchte.«
»Das hat er wirklich gesagt? Stiche?«
»Er hat das wohl für witzig gehalten.«
D’Agosta schüttelte den Kopf. »Haben Sie ihn in den, sagen wir, letzten zwei Wochen gesehen?«
Nora antwortete nicht gleich. Offenbar fiel es ihr schwer, sich zu erinnern, und D’Agosta empfand Mitleid mit ihr. »Nein. Warum fragen Sie?«
Er war noch nicht so weit, sie darauf anzusprechen. »Hatte er eine Freundin?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Haben Sie mal Fearings Schwester kennengelernt?«
»Ich wusste nicht einmal, dass er eine Schwester hat.«
»Hatte er gute Freunde? Andere Verwandte?«
»Um das sagen zu können, kannte ich ihn nicht gut genug. Er hat auf mich ein bisschen wie ein Einzelgänger gewirkt. Er hatte keinen geregelten Tagesablauf, er war eben so ein Schauspielertyp, hat fürs Theater gearbeitet.«
D’Agosta blickte auf seinen Notizblock, auf den er einige Routinefragen gekritzelt hatte. »Nur noch ein paar Formalitäten, der Ordnung halber. Wie lange sind Sie und Bill verheiratet?« Er brachte es einfach nicht über sich, die Frage in der Vergangenheitsform zu stellen.
»Es war unser erster Hochzeitstag.«
D’Agosta versuchte, seine Stimme ruhig und neutral klingen zu lassen, aber es gab da eine Art Blockade in seiner Kehle. Er schluckte. »Wie lange war er bei der Times beschäftigt?«
»Vier Jahre. Davor war er bei der Post. Und davor wiederum hat er freiberuflich gearbeitet, hat Bücher über das Museum und das Boston Aquarium geschrieben. Ich schicke Ihnen eine Kopie seines Lebenslaufs …« Jetzt klang ihre Stimme sehr leise. »Wenn Sie das möchten.«
»Danke, das wäre sehr hilfreich.« Er machte sich eine Notiz. Dann blickte er wieder sie an. »Nora, entschuldigen Sie bitte, aber ich muss das fragen: Haben Sie irgendeine Idee, warum Fearing das getan hat?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Keine Streitereien? Kein böses Blut?«
»Nicht, dass ich wüsste. Fearing war nur jemand, der im selben Haus wohnte.«
»Sicher, diese Fragen sind schwierig, und ich weiß es sehr zu schätzen –«
»Was ich schwierig finde, Lieutenant, ist, dass Fearing noch immer auf freiem Fuß ist. Fragen Sie, was Sie wissen müssen.«
»Gut. Glauben Sie, dass er vorhatte, Sie zu vergewaltigen?«
»Kann sein. Sein Timing war allerdings schlecht. Er ist in die Wohnung gekommen, kurz nachdem ich gegangen war.« Sie hielt einen Augenblick inne. »Darf ich Sie etwas fragen, Lieutenant?«
»Natürlich.«
»So spät am Abend musste er doch damit rechnen, dass wir beide zu Hause sind. Aber er hatte nur ein Messer bei sich.«
»Das ist richtig, nur ein Messer.«
»Kein Mensch bricht mit einem Messer bewaffnet in die Wohnung von jemandem ein, wenn er damit rechnet, zwei Personen gegenüberzustehen. Jeder kann sich heutzutage eine Schusswaffe besorgen.«
»Ganz recht.«
»Was glauben Sie also?«
D’Agosta hatte lange darüber nachgedacht. »Das ist eine gute Frage. Und Sie sind sicher, dass es Fearing war?«
»Die Frage stellen Sie mir nun schon zum zweiten Mal.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich wollte mich nur vergewissern, mehr nicht.«
»Aber Sie suchen doch wirklich nach ihm?«
»Das tun wir. Darauf können Sie sich verlassen.« Ja, zum Beispiel suchen wir in seinem Grab. Die für eine Exhumierung nötigen Papiere wurden schon ausgestellt. »Nur noch ein paar weitere Fragen. Hatte Bill Feinde?«
Zum ersten und einzigen Mal lachte Nora. Aber es lag kein Humor darin; es war nur ein leises, freudloses Schnauben. »Er war Reporter bei der New York Times. Natürlich hatte er da Feinde.«
»Jemand im Besonderen?«
Sie überlegte einen Moment. »Lucas Kline.«
»Wer ist das?«
»Er leitet eine hier in der Stadt ansässige Softwareentwicklungsfirma. Legt gern seine Sekretärinnen flach und schüchtert sie anschließend ein, damit sie den Mund halten. Bill hat einen Artikel über ihn geschrieben.«
»Und warum ragt er heraus?«
»Weil er Bill einen Brief geschrieben hat. Einen Drohbrief.«
»Den würde ich gern mal sehen, wenn es möglich wäre.«
»Kein Problem. Kline ist allerdings nicht der Einzige, den er sich zum Feind gemacht hat. Da war zum Beispiel diese Artikelserie über den Tierschutz, an der Bill gearbeitet hat. Und dann waren da diese merkwürdigen Päckchen …«
»Was für merkwürdige Päckchen?«
»Bill hat im vergangenen Monat zwei davon bekommen. Kleine Schachteln mit seltsamen Dingen darin. Winzige aus Flanell genähte Puppen. Tierknochen, Moos, Pailletten. Wenn ich nach Hause komme …« Ihre Stimme brach, sie räusperte sich und sagte mit fester Stimme: »Wenn ich nach Hause komme, sehe ich Bills ausgeschnittene Zeitungsartikel durch und stelle die zusammen, die jemanden verärgert haben könnten. Sie sollten auch mit seinem Redakteur bei der Times sprechen, er kann Ihnen sagen, woran Bill gerade gearbeitet hat.«
»Steht schon auf meiner Liste.«
Nora schwieg eine Zeitlang und sah ihn aus ihren rotgeränderten Augen an, die so entschlossen blickten. »Lieutenant, kommt es Ihnen nicht auch so vor, als handelte es sich hier um ein besonders stümperhaftes Verbrechen? Fearing ist in das Gebäude hinein- und wieder herausspaziert, ohne auf Zeugen zu achten, ohne zu versuchen, sich zu verbergen oder der Überwachungskamera auszuweichen.«
Das war noch so ein Punkt, über den D’Agosta nachgegrübelt hatte. War Fearing wirklich so blöd? Mal unterstellt, dass es sich bei dem Täter überhaupt um ihn handelte. »Es bleibt noch viel aufzuklären.«
Sie sah ihn noch einen Moment an, dann senkte sie den Blick auf die Bettdecke. »Ist die Wohnung noch versiegelt?«
»Nein. Seit heute Morgen zehn Uhr nicht mehr.«
Sie zögerte. »Ich werde heute Nachmittag entlassen, und ich … möchte möglichst rasch zurück in meine Wohnung.«
D’Agosta verstand sie. »Ich habe bereits alles … für Ihre Rückkehr veranlasst. Es gibt da eine Firma, die solche Aufträge kurzfristig übernimmt.«
Nora nickte und wandte sich ab.
Das war der Hinweis, dass er sie allein lassen sollte. D’Agosta erhob sich. »Vielen Dank, Nora. Ich halte Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden. Wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt – könnten Sie es mich wissen lassen?«
Wieder nickte sie, ohne ihn dabei anzusehen.
»Und vergessen Sie nicht, was ich gesagt habe. Wir werden Fearing finden. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf.«
7
Schweigend schritt Special Agent Pendergast durch den langen, schwach beleuchteten zentralen Flur in seiner Wohnung in der 72. Straße. Er ging durch eine elegante Bibliothek, ein Zimmer mit Ölgemälden aus Renaissance und Barock, einen temperaturregulierten Lagerraum, der vom Boden bis zur Decke mit alten Weinen in Teakholz-Regalen angefüllt war, und einen Salon mit Ledersesseln, kostbaren Seidenteppichen und Computerterminals, die mit den Datenbanken eines halben Dutzends Strafverfolgungsbehörden verkabelt waren.
Dies waren die öffentlich zugänglichen Räume in Pendergasts Wohnung, auch wenn wohl kaum mehr als ein Dutzend Personen sie je zu Gesicht bekommen hatten. Pendergast begab sich jetzt in Richtung seiner Privaträume, die nur ihm und Kyoko Ishimura bekannt waren, der taubstummen Haushälterin, die hier wohnte und sich um alles im Apartment kümmerte.
Im Laufe mehrerer Jahre hatte Pendergast diskret zwei angrenzende Wohnungen, sobald diese zum Verkauf standen, hinzu erworben und in seine eigene integriert. Nun erstreckte sich seine Residenz im Dakota-Gebäude über einen großen Teil der Front zur 72. Straße und sogar über einen Teil der Front zum Central Park. Ein riesiges, weitläufiges, doch ungemein privates Refugium.
Als er das Ende des Flurs erreicht hatte, öffnete er die Tür zu einem – wie es schien – Wandschrank. Tatsächlich war der kleine dahinterliegende Raum leer, bis auf eine weitere Tür in der gegenüberliegenden Wand. Pendergast löste die Sicherheitsvorkehrung der Tür, öffnete sie und betrat seine Privatgemächer. Rasch durchschritt er auch diese und nickte dabei Miss Ishimura zu, die in der geräumigen Küche stand und auf einem riesigen Restaurant-Herd eine Suppe aus Fischinnereien zubereitete. Wie alle Räume im Dakota-Gebäude verfügte auch die Küche über ungewöhnlich hohe Decken. Schließlich gelangte Pendergast an das Ende eines weiteren Flurs, an eine weitere unauffällig aussehende Tür. Dahinter lag sein Ziel: die dritte Wohnung, das Allerheiligste, das selbst Miss Ishimura kaum einmal betrat.
Er öffnete die Tür, die in einen zweiten wandschrankgroßen Raum führte. Dieses Mal befand sich am anderen Ende nicht eine weitere Tür, sondern vielmehr ein shoji, eine leichte Schiebetür aus Holz mit Reispapierbespannung. Pendergast schloss die Tür hinter sich, dann machte er ein paar Schritte und schob die shoji sanft zur Seite.
Dahinter lag ein beschaulicher Garten. Die Klänge von sanft tröpfelndem Wasser und Vogelgesang erfüllten die Luft, die bereits nach Fichtennadeln und Eukalyptus duftete. Das schwache, indirekte Licht ließ an einen späten Nachmittag oder frühen Abend denken. Irgendwo in der grünen Weite gurrte eine Taube.
Vor Pendergast lag ein schmaler Weg aus flachen Steinen, der von Steinlaternen gesäumt war und sich zwischen immergrünen Gewächsen hindurchschlängelte. Pendergast zog die shoji zu, überquerte das Kieselbankett und schritt den Weg hinunter. Es handelte sich um den uchi-roji, den inneren Garten eines Teehauses. Der ausgesprochen private, geradezu geheime Ort verströmte eine große Ruhe und regte den Geist zur Kontemplation an. Pendergast lebte inzwischen schon so lange damit, dass er beinahe seine Wertschätzung für diese Seltsamkeit eingebüßt hatte: ein vollständiger, in sich abgeschlossener Garten tief in einem riesigen Apartmenthaus in Manhattan.
Vor ihm kam, durch die Sträucher und Bonsaibäume hindurch, ein niedriges Bauwerk aus Holz in Sicht, schlicht und schmucklos. Pendergast begab sich am zeremoniellen Waschbecken vorbei zum Eingang des Teehauses und schob die dortige shoji langsam zur Seite.
Dahinter lag der eigentliche Teeraum, elegant und sparsam eingerichtet. Pendergast blieb einen Moment im Eingang stehen und ließ den Blick schweifen, über die hängende Schriftrolle im Alkoven, die strengen Ikebana-Blumenarrangements, die Regale mit den penibel sauberen Bambusbesen und -löffeln, Teeschalen und anderen Gegenständen. Dann zog er die Schiebetür hinter sich zu, setzte sich nach Geisha-Art auf die Tatami-Matte und begann die anspruchsvollen Rituale der eigentlichen Zeremonie auszuführen.
Eine Teezeremonie ist im Kern ein Ritual der Anmut und Vollkommenheit, bei dem es darum geht, einer Gruppe von Gästen Tee zu servieren. Pendergast war allein, führte die Zeremonie aber dennoch aus, und zwar für einen Gast, der nicht anwesend sein konnte.