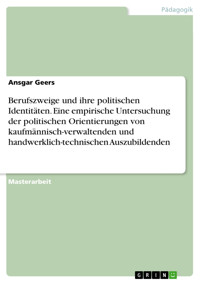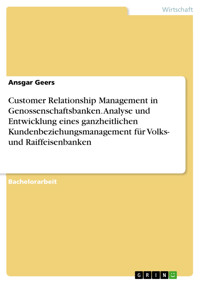
Customer Relationship Management in Genossenschaftsbanken. Analyse und Entwicklung eines ganzheitlichen Kundenbeziehungsmanagement für Volks- und Raiffeisenbanken E-Book
Ansgar Geers
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Berufsakademie für Bankwirtschaft, Hannover, Sprache: Deutsch, Abstract: Mangelndes Vertrauen von Kunden gegenüber Banken ist nicht erst seit der Finanzkrise von 2008 zu beobachten. Dieses schwächer werdende Vertrauen der Kunden zu den Banken ist eine Kettenreaktion aus deregulierenden Maßnahmen der Wirtschafts- und Bankenpolitik. Der einheitliche Zahlungsraum, die Einführung des Euro und die rechtliche Homogenisierung des europäischen Bankensektors führten dazu, dass ausländische Institute, Non-Banks und sonstige Finanzdienstleister auf den deutschen Bankenmarkt drangen. Zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten, wie das Online-Banking, Mobile-Banking und das Aufkommen der Direktbanken, haben die Konkurrenzsituation zudem noch weiter verschärft. Das Resultat des Over-Bankings ist ein enorm dynamischer Markt, welcher eine hohe Angebotsvielfalt besitzt. Die Produktvielfalt ist jedoch auch dringend notwendig, da Bankprodukte aufgrund ihrer Ähnlichkeit recht einfach austauschbar sind. Um sich auf dem Markt behaupten zu können, haben die Banken ihre Kosteneffizienz gesteigert, was jedoch zu Lasten der Kundenbeziehungen und des Services ging. Das Ergebnis dieser Geschäftspolitik war die Abnahme der Kundenloyalität und des Vertrauens gegenüber der Bank. Speziell für Universalbanken, wie es Genossenschaftsbanken sind, eignen sich nicht alle Strategien im Wettbewerb mit anderen Banken. Für sie gilt die Wettbwerbsstrategie der Differenzierung als die wichtigste, um über differenzierte Bankdienstleistungen Alleinstellungsmerkmale zu erzielen. Doch Unternehmen und Banken sind sich ebenso bewusst, dass Kundenzufriedenheit für den langfristigen Erfolg entscheidend ist. An dieser Stelle knüpft das Customer Relationship Management (CRM) an. Diese Art der Unternehmensstrategie befasst sich mit der Neugewinnung von Kunden, der Bestandskundenpflege und der Kundenrückgewinnungsstrategie. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, eine CRM-Konzeption in Banken darzustellen und zu zeigen, welche Veränderungen auf Unternehmensebene notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei werden die Herausforderungen des Veränderungsprozesses für die Bankleitung und die Mitarbeiter dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau und Ziel dieser Arbeit
2. Theoretische Grundlagen und Entstehung des Customer Relationship Management
2.1. Abgrenzung des CRM zu verwandten Termini
2.2 Definition
2.3 Entstehungsgeschichte des CRM
2.4 Der Kunde als Subjekt der Kundenbindung
2.4.1 Kundenbedarfslebenszyklus
2.4.2 Kundenbeziehungslebenszyklus
2.4.3 Kundenwert
2.5. Ziele des CRM
3. Genossenschaftsbanken
3.1 Genossenschaftsbanken und der FinanzVerbund
3.2 Einordnung in den deutschen Bankenmarkt
3.3 Bedeutung der Genossenschaftsbanken
4. Instrumente und Aufgaben eines CRM-Projekts
4.1 Analytisches CRM
4.2 Operatives CRM
4.3 Kommunikatives CRM
5. CRM bei Banken
5.1. Bedeutung von CRM für Banken
5.2. Vergleich von Banken die eine CRM-Strategie verfolgen und anderen Banken
5.3. Mögliche Widerstandsfaktoren bei CRM-Projekten in Banken
6. Implementierung eines CRM-Konzepts unter Anwendung eines strategischen Phasenmodells in Genossenschaftsbanken
6.1. Planungsphase
6.2. Analysephase
6.2.1. Segmentierung des Kundenstamms
6.2.2. Ermittlung des Kundenwerts
6.2.3. Mitarbeiteranalyse
6.3. Auswahl der CRM-Strategie
6.4. Konzeptionsphase
6.4.1. Instrumente des Marketings-Mix
6.4.2. Nutzung gegebener Kontaktkanäle
6.4.3. Kundenkontaktmanagement auf Basis des Kundenbeziehungslebenszyklusmodells
6.4.4. One-to-One-Marketing als individualisierte Kundenansprache
6.5. Umsetzungsphase des CRM-Konzepts
6.5.1. Veränderung der Unternehmenskultur
6.5.2. Einsetzung von IT-Lösungen
6.5.3. Förderung und Schulung der Mitarbeiter
6.6. Kontrollphase - Monitoring und Bewertung
6.6.1. Bewertung anhand objektiver Kennzahlen
6.6.2. Erfolgskontrolle der Kundenorientierung aus Kundensicht
6.6.3. Erfolgskontrolle der Kundenorientierung aus Unternehmenssicht
7. Handlungsempfehlung und Bewertung
8. Fazit und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Abgrenzung des Customer Relationship Managements von verwandten Termini
Abb. 2: Kundenbedarfslebenszyklus
Abb. 3: Kundenbeziehungslebenszyklus
Abb. 4: OLAP – Würfel mit dreidimensionaler Datenausrichtung
Abb. 5: Data Mining im Kundenbeziehungslebenszyklus
Abb. 6: Wert aller Kundenbeziehungen
Abb. 7: CRM-Vorgehensmodell
Abb. 8 Modelle der Kundenwertermittlung
Abb. 9: ABC-Analyse mit dreigeteilter Segmentierung
Abb. 10: Deckungsbeitragsrechnung bei Banken im Aktivgeschäft
Abb.11: Dienstleistungsmarketing-Mix
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Administrative Aufgaben der Sales-Automation
Tab. 2: Beispiele für einmalige und laufende Kosten des CRM
Tab. 3: Customer Lifetime Value-Verfahren zur Kundenwertermittlung mit dem Kapitalwertverfahren
Tab. 4: Verfahren zur Ermittlung einer Kundenzufriedenheit als Schulnote
Tab. 5: Empfehlung für Privatkundensegmentierung
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Die im Jahr 2008 eingetretene Finanzkrise hat die Bankenwelt schwer erschüttert. Die daraus resultierende Eurostaatenkrise und vor allem der massive Vertrauensverlust der Kunden haben der Finanzbranche neue Probleme bereitet.[1] Das mangelnde Vertrauen der Kunden zu den Banken ist jedoch schon länger zu beobachten gewesen.[2] Dieses schwächer werdende Vertrauen der Kunden zu den Banken ist eine Kettenreaktion aus deregulierenden Maßnahmen der Wirtschafts- und Bankenpolitik. Der einheitliche Zahlungsraum, die Einführung des Euro und die rechtliche Homogenisierung des europäischen Bankensektors führten dazu, dass ausländische Institute, Non-Banks und sonstige Finanzdienstleister aus dem deutschen Bankenmarkt drangen. Zu den Non-Banks gehören Unternehmen, die keinen Bezug zur Kreditbranche haben. Damit sind zum Beispiel Einzelhandelsunternehmen gemeint, die standardisierte Bankgeschäfte betreiben.[3] Dies könnten Auszahlungen an der Warenkasse oder auch Kontoeröffnungen an der Postfiliale über Post Ident sein.[4] Zu den sonstigen Finanzdienstleistern gehören Unternehmen, die mit der Bankenbranche verwandt sind, wie z.B. Versicherungsgesellschaften und Vermögensdienstleister.[5]
Zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten, wie das Online-Banking, Mobile-Banking und das Aufkommen der Direktbanken hat die Konkurrenzsituation zudem noch weiter verschärft. Das Resultat des Over-Bankings ist ein enorm dynamischer Markt, welcher eine hohe Angebotsvielfalt besitzt. Die Produktvielfalt ist jedoch auch dringend notwendig, da Bankprodukte aufgrund ihrer Ähnlichkeit recht einfach austauschbar sind.[6] Um sich auf dem Markt behaupten zu können, haben die Banken ihre Kosteneffizienz gesteigert, was jedoch zu Lasten der Kundenbeziehungen und des Services ging. Das Ergebnis dieser Geschäftspolitik war die Abnahme der Kundenloyalität und des Vertrauens gegenüber der Bank.[7]
Nach Michael E. Porter ist eine kostenorientierte Geschäftspolitik für Universalbanken, sprich Genossenschaftsbanken, nicht möglich.[8] Porter sieht die Geschäftspolitik einer Bank als Wettbewerbspolitik zu anderen Banken. Dabei wird zwischen drei Strategietypen unterschieden:
1. Strategie der Kostenführerschaft
2. Strategie der Differenzierung
3. Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte
Wie bereits erwähnt, gelang es den Universalbanken nicht, ihre Unternehmensziele mithilfe der Strategie der Kostenführerschaft zu erlangen, da sie aufgrund der dadurch mangelnden Kundenloyalität, ihre Kunden an die Konkurrenz verloren. Die Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte gilt für Universalbanken, wie bspw. Genossenschaftsbanken, als eher ungeeignet, da sie traditionell mit einem breiten Produktangebot aufgestellt sind. Die Konzentration auf Schwerpunkte eignet sich dagegen sehr gut für Direkt- oder Spezialbanken, da diese Kreditinstitute ein bestimmtes Segment im Markt nutzen, um ihre Unternehmensziele zu erreichen.[9]
Die Genossenschaftsbanken müssen daher die Wettbewerbsstrategie der Differenzierung nutzen und Bankdienstleistungen so differenzieren, dass Alleinstellungsmerkmale entstehen, die sie von der Konkurrenz abheben lässt.[10] Aufgrund der Austauschbarkeit der Bankprodukte sind sich Unternehmen und Banken jedoch bewusst geworden, dass Kundenzufriedenheit für den langfristigen Erfolg entscheidend ist.[11]
An dieser Stelle knüpft das Customer Relationship Management (CRM) an. Diese Art der Unternehmensstrategie befasst sich mit der Neugewinnung, Bestandskundenpflege und der Kundenrückgewinnungsstrategie. Der Fokus liegt jedoch bei der Intensivierung der Bestandskundenpflege.[12] Beim CRM stellt das Unternehmen die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt und richtet alle unternehmerischen Maßnahmen darauf aus. Um eine Sonderstellung in der Differenzierungsstrategie zu erlangen, muss die Bank zunächst möglichst viele Informationen über ihre Kunden erhalten. Dafür sollten sämtliche Prozesse und Strukturen in der Bank auf die Kunden ausgerichtet werden. Die vorliegende Arbeit hat daher als Leitziel, eine CRM-Konzeption in Banken darzustellen und zu zeigen, welche Veränderungen auf Unternehmensebene notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei werden die Herausforderungen des Veränderungsprozesses für die Bankleitung und die Mitarbeiter dargestellt.[13]
1.2 Aufbau und Ziel dieser Arbeit
Die vorliegende Arbeit untergliedert sich in sechs Abschnitte, wobei der Schwerpunkt die Implementierung einer CRM-Konzeption bei Genossenschaftsbanken darstellt. Dabei werden zudem Handlungsempfehlungen für Volks- und Raiffeisenbanken gegeben, um erfolgreich CRM in der Bank zu nutzen.
In Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen des CRM erläutert. Dazu gehört die Definition und Abgrenzung zu verwandten Begriffen des CRM. Darauf folgend wird die Entwicklungsgeschichte des CRM beleuchtet und auf die Ziele des Kundenbeziehungsmanagements näher eingegangen. Zudem wird dabei die Bedeutung des Kunden für die Bank dargestellt. Theoretische Modelle, wie das Kundenbedarfslebenszyklusmodell, das Kundenbeziehungslebenszyklusmodell und der Kundenwert werden dabei vorgestellt.
Im Anschluss daran wird das Modell der Genossenschaftsbanken verdeutlicht und deren Stellung im deutschen Bankenmarkt dargelegt.
Im folgenden Kapitel werden die Instrumente der CRM-Konzeption vorgestellt. Diese Bestandteile verfolgen verschiedene Aufgaben, die mittels unterschiedlicher Maßnahmen erfüllt werden. Die in Kapitel 4 behandelten Bestandteile dienen als Grundlage zur Implementierung einer CRM-Konzeption im Bankbereich.
Vor dem Hauptteil der Arbeit wird speziell auf die besonderen Gegebenheiten des Bankensektors hingewiesen. Dabei wird noch auf mögliche Störfaktoren bei einem CRM-Projekt eingegangen.
Im nun folgenden Hauptteil der Arbeit erfolgt die Beschreibung der Umsetzung einer CRM-Konzeption für Genossenschaftsbanken. Die Implementierung erfolgt dabei gemäß dem strategischen Phasenmodell, wobei zunächst Vorkehrungen zur Durchführung eines CRM-Projekts beschrieben werden. So gilt es aufbauend aus der Analysephase eine geeignete CRM-Strategie auszuwählen. In der Konzeptionsphase werden verschiedene Instrumente des CRM vorgestellt und wie sie praktisch genutzt werden können. Die Umsetzung und Kontrolle der CRM-Konzeption beschreibt den letzten Teilbereich des Hauptteils.
Aufbauend auf den Ergebnissen des Hauptteils werden in Kapitel 7 konkrete Handlungsempfehlungen für Volks- und Raiffeisenbanken gegeben. Dabei werden beispielhaft Maßnahmen erläutert, um bestimmte Kundensegmente anzusprechen. Zudem wird auf die CRM-Bedeutung bestimmter Bankprodukte eingegangen und wie Volks- und Raiffeisenbanken diese Bankprodukte nutzen können. Es wird auch auf Großprojekte des BVR hingewiesen, welche als Beispiel für gelungene CRM-Projekte gelten. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird ausschließlich auf Maßnahmen des Privatkundensektors hingewiesen.
Zum Ende der Arbeit folgen ein Resümee und ein Ausblick in die zukünftige Entwicklung von Banken mit einer CRM-Strategie.
2. Theoretische Grundlagen und Entstehung des Customer Relationship Management
2.1. Abgrenzung des CRM zu verwandten Termini
In der relevanten Literatur beherrschen im zunehmenden Maße Begriffe wie "Kundenbindungsmanagement" (Customer Retention Management), "Kundenbeziehungsmanagement" (Customer Relationship Management), "Beziehungsmarketing" (Relationship Marketing) oder auch "Beziehungsmanagement" (Relationship Management) das Themenfeld "Kundenbindung". In der Praxis werden diese Begriffe oft nicht ausreichend voneinander getrennt und sogar synonym verwendet.[14] Aus diesem Grund wird nachfolgend eine Abgrenzung der einzelnen verwandten Termini dargelegt und ihre Beziehung zueinander erläutert.