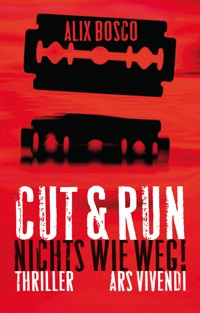
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auckland, Neuseeland 2008. Als der Rugby-Star Alex Solona mitten im Liebesakt mit einer attraktiven Prominenten brutal erschossen wird, scheint alles auf einen schiefgelaufenen Drogendeal hinzudeuten, denn der Sportler hatte jede Menge frisch gekauftes Crystal im Blut. Ein Täter ist schnell gefunden - zu schnell! Anna Markunas gehört zum juristischen Team, das für die Verteidigung des Hauptverdächtigen zusammengestellt wird. Sie erkennt in dem jungen Mann das Kind wieder, das sie während ihrer früheren Tätigkeit als Sozialarbeiterin aus einer äußerst heiklen Familiensituation gerettet hat. Nichts passt zusammen, und am allerwenigsten kann sich Anna einen Reim auf die merkwürdige Haltung des Angeklagten zu den Vorwürfen machen. Schritt für Schritt kommt sie der Wahrheit näher - einer Wahrheit so unheilvoll und bedrohlich, dass sie ihr selbst und allem, was ihr lieb und teuer ist, zum Verhängnis werden könnte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alix Bosco
Cut & Run
Nichts wie weg
Thriller
Aus dem Englischen von Gottfried Röckelein
ars vivendi
Diese Übersetzung wurde angefertigt mit freundlicher Unterstützung des New Zealand Literature Translation Grant Programms.
Wir bedanken uns herzlich bei der Publishers Association of New Zealand (PANZ).
Titel der Originalausgabe: »Cut & Run«
First published by Penguin Books in New zealand, 2009
Copyright © Alix Bosco, 2009
all rights reserved
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Deutsche Erstausgabe , 1. Auflage Juli 2012)
© 2012 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Johanna Cattus-Reif
Umschlaggestaltung: Philipp Starke, Hamburg unter Verwendung eines Bildes von © plainpicture/BY
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-189-4
Für M
Ich beginne mit dem, was ich sicher weiß.
Ich heiße Anna P. Markunas.
Ich kann meine gegenwärtige Adresse nicht preisgeben, weil ich um mein Leben fürchte.
Ich muss zwar von Berufs wegen Texte verfassen, aber so etwas wie das hier habe ich noch nie geschrieben.
Ich weiß, dass das, was ich schreibe, gegen mich verwendet werden kann.
Ich verzichte auf mein Recht auf juristischen Beistand.
Ich werde versuchen, alles akkurat wiederzugeben. Exakt das, was geschehen ist. Und was gesprochen wurde.
|1|
»Ich würde gar zu gern die Schlampe in dir herauskitzeln«, hat er gesagt.
Mein erster Gedanke war: ganz schön krass. Mein zweiter: Seh ich so betrunken aus?
Kronanwalt Paul Malone starrt mich an und will eine Reaktion. Seine opakgrünen Augen haben schon tausend Polizisten, Straftäter und unschuldige Zeugen in Kreuzverhören durchbohrt und deren Blicke niedergezwungen; jetzt fixieren sie mich über den Rand eines Glases Pinot noir hinweg.
Ich versuche, mit zusammengepressten Lippen zu lächeln; meine Zähne sind wahrscheinlich dunkelrot. Zwar wäre ich lieber beim Weißwein geblieben, was auch immer das für einer war, doch er hatte darauf bestanden: Ein Pinot noir sei der Heilige Gral der Weinherstellung. Ja, hätte ich beinahe gesagt, diesen Film habe ich auch gesehen. Anschließend hat er die Qualitäten der Region Central Otago gerühmt, wohin er immer höchstpersönlich fliege. Nach Wanaka selbstverständlich, wo er ein Haus habe; Queenstown sei ja völlig kaputt. »Am Arsch«, so hat er sich ausgedrückt, »fucked«. Wahrscheinlich gebraucht er das Wort selten; für einen Kronanwalt wäre es ein gefährliches Wort, sollte es sich in seinem Sprachgebrauch etablieren; es könnte ihm bei Gericht herausrutschen. Es mir gegenüber zu benutzen fand er offensichtlich erregend. »Die Mutter in mir hat mich hierher gebracht«, sage ich.
»Die Sache ist unter Dach und Fach«, beruhigt er mich. »Jamie bekommt eine Starthilfe in meinem Büro, die Vergütung handeln wir aus. Obwohl wir beide wissen, dass eigentlich er mich dafür bezahlen müsste.«
»Ich danke dir.« Was sollte ich sonst sagen?
»Das musst du nicht«, sagt er. »Er ist ein aufgewecktes Bürschchen. Vielleicht hilft ihm das ja, mal ein paar Erfahrungen auf der Seite der Guten zu sammeln. Mir hat es geholfen.«
»Wann willst du denn jemals nicht auf der Seite der Guten gestanden haben, Paul?« Ich sage das wirklich in einem freundlichen Ton, aber ich sehe, wie sein Gesicht sofort raubvogelhafte Züge annimmt und wünschte, ich hätte ihn nicht provoziert. Aber da ist der Moment schon vorbei, und rasch machen sich Gelassenheit und ein Lächeln breit.
»Eigentlich nur indirekt«, erwidert er.
»Bei Jamie war das schon ein bisschen direkter, aber ich hoffe, du hast recht. Ich bin dir sehr dankbar.«
»Wie gesagt, das musst du nicht sein.« Dieser Blick, mit dem er mich wieder betrachtet. Selbstsicher. Verlegenes Schweigen.
»Aber du würdest mir noch immer gern helfen, die Schlampe in meinem Innern zu finden.«
Die Andeutung eines Lächelns. Er stellt sein Glas ab, streckt dann die Hände mit den Handflächen nach oben aus wie ein Priester, der einen Segen spricht.
»Das hat nichts miteinander zu tun, Anna«, sagt er. »Ich finde dich einfach sehr attraktiv.« Er beugt sich näher über den Tisch. »Du reizt mich. Sexuell.«
Nicht etwa intellektuell. »Ich fühle mich sehr geschmeichelt.«
Pauls Stimme klingt überraschend hell und hat etwas Silbriges, Fließendes an sich. Würde er singen, wäre er ein Tenor. Jede Menge Hell und Dunkel darin. Verführerisch, gerade in diesem Moment.
»Du hast mich schon immer gereizt. Sogar im Jurastudium, aber da warst du ja unerreichbar.«
»Ich war verheiratet.«
»Mit einem Hippie.« Die Verachtung ist geradezu greifbar.
»Mit einem Sozialisten.«
»Was für eine Vergeudung.«
Lieber Graham, kein Wunder, dass du bei diesen Haifischen nicht mitschwimmen konntest. »Da hätte er nicht widersprochen, gegen Ende.«
»Tut mir leid.«
Tut es ihm nicht. Gibt es ein Wort für so was, frage ich mich? Dafür, dass man jetzt jemanden ficken will, den man früher nicht ficken konnte, als man es unbedingt wollte? Internetseiten machen ein Heidengeld mit diesem latenten Verlangen nach irgendeiner Art von retrospektiver Erfüllung. Warum sonst würde er sich mit mir abgeben, wo es doch bestimmt so viele andere gibt, die bereit und willens sind, ihre grazilen Körper für finanzielle Vorteile oder beruflichen Aufstieg hinzulegen?
Derzeit ist es leicht, Paul zu bewundern. Er hat diese magnetische, staranwaltliche Präsenz, die er zweifellos gewissenhaft kultiviert, und er hat Erfolg, Geld und Macht. Es ist schwer, diesen Löwen des Gerichtssaals in Einklang zu bringen mit dem geistlosen Jurastudenten von damals, dessen Versuch, mich eines Freitagnachts im Gluepot anzuquatschen, so zaghaft gewesen war, dass ich vor lauter Überraschung loslachte, als ich begriff, dass er genau das versuchte. Damals schien auch sein Kopf zu groß für seinen spindeldürren Körper zu sein, der nur eckig und peinlich war. Inzwischen ist er, nun ja, beeindruckend geworden. Seine Mähne ist in der Mitte etwas lichter und an den Rändern silbrig. Aber er ist, seit dem heutigen Nachmittag, der Chef meines Sohnes. Das Ganze würde zu chaotisch werden, und ich könnte mir wer weiß was einbilden bezüglich seiner wahren Motive, Jamie »eine Starthilfe« zu geben. Ich beschließe, Paul genau das zu sagen, ihm den Ball zurückzuspielen. Er nickt mit dem großen Kopf, mit der zerfurchten Intellektuellenstirn, als bedenke er gerade eine juristische Feinheit.
»Ich gestehe zu, dass das, oberflächlich betrachtet, problematisch erscheinen könnte«, sagt er. »Solange du zugestehst«, fährt er fort, »dass du dich von mir angezogen fühlst.«
Erwischt. Eitelkeit und Ego. Damit kann ich leben. »Zugestanden«, sage ich.
»Sag es«, lächelt er.
Plötzlich bin ich wütend. Ich habe ihn falsch gedeutet. Es sind nicht bloß Eitelkeit und Ego, es ist Macht. »Ich finde dich«, beginne ich, hole mein Lächeln hervor, knipse es an, stelle die Augen auf kalt, »sehr attraktiv, Paul.« Hier hätte ich abbrechen sollen. »Für einen Kronanwalt.«
Auf meinem Weg durch die High Street in Richtung Shortland Street, wo ich hoffentlich ein Taxi bekomme, registriere ich erfreut, dass der Einbruch der Dämmerung einen Rückgang der Temperaturen gebracht hat – kühlender Balsam für die Haut.
Als ich die Ecke zur Shortland Street erreiche, wage ich einen Blick zurück, aber Paul ist verschwunden, verschluckt von all den Anzügen und High Heels, die jetzt aus den diversen Weinbars strömen, ganz so, als hätte eine Sirene zum Ende der Arbeitswoche geheult, sie alle heim zu ihren Wohnungen in den Außenbezirken gerufen und damit diesen ältesten Innenstadtbezirk fürs Wochenende den Kauflustigen und Touristen ausgeliefert.
Paul Malone weiß um die Macht der Worte. Gesagt ist schon fast getan, sogar als er mich aus dem Lokal führte, seine Hand auf meinem Hintern. Eine Berührung meiner Schulter, als er mich zu sich zog. Gerade noch, dass es mir gelungen ist, mit meiner Wange das Kraftfeld abzuwehren. Ich hätte ohne Weiteres mit ihm mitgehen können. Ob er wohl der Versuchung widerstanden hätte, mich im Auto mitzunehmen, nach einer halben Flasche Rotwein? Wahrscheinlich wäre er eher mit mir direkt den Hügel hinaufgegangen, zum diskreten Hintereingang seines efeuumrankten Clubs. Eine jähe Aufwallung von Leidenschaft, während er mich durch die Tür geleitet, und schon fallen die Hüllen, und ich werde in eines der Zimmer im Untergeschoss gedrängt, die jenen Clubmitgliedern zur Verfügung stehen, die für die Dauer eines nächtlichen Sturms oder für ein, zwei Stunden diskreter Vergnügungen einen sicheren Hafen brauchen, bei Tag oder Nacht.
Ich hätte es vielleicht genossen, es hätte vielleicht meine Blockaden gelöst, die Hormone mal wieder auf Touren gebracht. Aber ich habe zu viel Fantasie, wenn es um mein eigenes Wohlergehen geht. Ich blicke zu weit voraus, kann sehen, wie alles enden würde. Wie ich mich danach fühlen würde, verkatert, gleichermaßen voll Reue wie voll schalen Alkohols, wie ich mich aus derselben Hintertür stehle, zu mitternächtlicher Stunde, wenn es noch nicht zu spät für ihn ist, fürs Wochenende zu seiner Frau und zu seinem Leben zurückzukehren.
Der Kronanwalt Paul Malone, der mich unbedingt ficken will, ist kein Mann, der sich verarschen lässt.
Im Taxi dirigiere ich den Fahrer – Ahmed steht auf seinem Namensschild –, dessen Ortskenntnisse von Auckland nur geringfügig schlechter sind als seine Englischkenntnisse, zur Franklin Road. In unserer Spur geht es nur im Kriechtempo voran, und wir begaffen die Gerippe der alten Häuser, die mit bunter Weihnachtsbeleuchtung verunziert sind. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als diese Straße unter dem Namen »Snake Alley« bekannt war, ein Rutsch den Hügel vom berüchtigten Künstlerviertel Ponsonby hinunter zu den Slums von Freemans Bay.
Ich sollte mir jetzt eigentlich clever vorkommen, wenn nicht gar als Siegerin, weil ich mich einer sinnlosen Bumserei mit dem neuen Boss meines Sohnes entzogen habe. Stattdessen stehe ich kurz davor, ein Lamento über meine wunden Punkte anzufangen: eine Frau in einem gewissen Alter, sogar etwas darüber, wenn ich ehrlich bin, mit ungewissem Einkommen, alleinstehend, mit einem erwachsenen Sohn, der noch zur Hälfte unterhaltsberechtigt ist. Ich muss mich mit aller Gewalt zusammennehmen, um nicht schwermütig zu werden und aus dem Gleichgewicht zu geraten, während ich Ahmed sage, dass er nach links in die Ponsonby Road einbiegen soll, und wir gemächlich die goldene Achse zwischen dem Prego und dem SPQR entlangfahren, diesen beiden Stützpfeilern, zwischen denen sich jüngere und kurzlebigere Bars und Restaurants reihen, dazu Boutiquen mit Designermoden, Imbissbuden, Immobilienmakler, eine Bank, Cafés, die Feuerwehr und Möbelgeschäfte, die verkitschte Replikate aus garantiert altem Holz verkaufen.
Ich bitte Ahmed, links ranzufahren, und kann im Rückspiegel aus seiner Miene lesen, dass er befürchtet, ich steige wegen seiner navigatorischen Defizite vorzeitig aus. Unwillkürlich beruhige ich ihn, ich hätte mich anders entschieden, müsse noch ein paar Zutaten fürs Abendessen kaufen und würde dann zu Fuß heimgehen. Ich gebe Ahmed zu viel Trinkgeld und bin im selben Augenblick stinksauer auf mich, nicht so sehr wegen der paar Dollar, die ich rausgeschmissen habe, sondern weil ich mich, im Namen des ganzen Landes, immer gleich verpflichtet fühle, einem neuen Immigranten das Gefühl zu geben, dass er willkommen sei. Wie Sarah sagen würde: »Also bit-te!«
Ich gönne mir eine Pause, gehe in den Fish-and-Chips-Laden, begrüße Kam-lin und ihre hübsche, gertenschlanke Tochter Emily und bestelle aus der Kühltheke zwei frische Filets vom Knurrhahn. Der Knurrhahn ist ein putziger kleiner Fisch, orange mit auffälligen, segelförmigen Flossen, im Vergleich zum Schnapper unterbewertet und zu billig. Während mein Knurrhahn und die Pommes zubereitet werden, kaufe ich mir den Listener beim Zeitschriftenhändler zwei Türen weiter und lasse mich dann an einem der kleinen Chromtische draußen nieder. Ich bin noch angenehm beschwingt vom Wein, sitze einfach da, tue so, als läse ich die Zeitschrift, lasse meine Brille in der Handtasche und betrachte stattdessen auf der anderen Straßenseite die Tische, die auf dem Gehsteig längs der Fassade des SPQR aufgestellt sind.
Das Lokal war früher einmal eine Werkstatt für russische Motorräder, sogar damals bestenfalls ein Nischenmarkt, noch vor der Flut der Yamahas, Kawasakis und Suzukis. Die Tatsache, dass es sich um russische Maschinen handelte, war für Graham Grund genug gewesen, als gläubiger Sozialist seine alte BSA dort hinzubringen. Doch der Betrieb stand unter keinem guten Stern – noch so eine gescheiterte gute Sache, für die Graham sich so gern engagierte; genau wie BSA. Ein berühmter Filmschaffender machte aus dem Betonbunker ein Restaurant mit Bar, und obwohl es seit noch nicht einmal 20 Jahren existiert, ist es heute ein ehrwürdiges und bleibendes Wahrzeichen in einer Umgebung, in der die Geschäfte mit darwinscher Unerbittlichkeit kommen und gehen.
Während ich dasitze, halb betrunken, zu fein angezogen und mit rapide schwächelndem Make-up, eine Beobachterin des Treibens direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, aber Lichtjahre vom Mittelpunkt des Geschehens entfernt, überkommt mich jäh ein Glücksgefühl. Eine unbeschreibliche Freude, eine Empfindung, wie ich sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Konzentrische Wellen der Zufriedenheit strömen von meinem tiefsten Innern nach außen. Ich will das Gefühl nicht dadurch abtöten, dass ich es analysiere, aber ich weiß, womit es zu tun hat. Ich bin aus dem Rennen. Ich bin gern Beobachter. Ich habe gern viel Raum um mich herum. Mich durch die große weite Welt treiben zu lassen macht mir keine Angst mehr. Die Welt scheint dieser Tage ein freundlicherer Ort zu sein.
Es ist so warm, dass die Tische auf der anderen Straßenseite voll besetzt sind. Schwer zu sagen, wie lange manche dieser Gäste schon auf ihren Stühlen sitzen, bis sie schließlich versuchen aufzustehen. Zumeist sind es stämmige Kerle mit rasierten Köpfen und weiten Hemden mit offenen Kragen, längs gestreift im Gefängnislook und in allen Variationen, und Frauen in ausgesprochen körperbetonten Hemden und Blusen, Mitte bis Ende zwanzig. Sie haben gerade Feierabend und sind nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Alkohol gut Freund, kontrollieren mit wachsamen Blicken die Umgebung, denn dies hier ist eine Promitränke, und man weiß nie im Voraus, welches berühmte Gesicht man zu sehen bekommt, vorzugsweise sternhagelvoll. Meine Aussicht wird vorübergehend von einem schwarzen Porsche blockiert, der direkt vor dem Lokal ein stümperhaftes Einparkmanöver versucht.
Ich würde mich das nie getrauen, genau vor dem SPQR einzuparken, doch diese Frau schreckt offensichtlich vor nichts zurück. Als sie es endgültig vermasselt hat – das Hinterrad am Bordstein eingeklemmt, während die Haifischnase weiterhin den vorbeifließenden Verkehr beschnüffelt –, stellt sie einfach den Motor ab und steigt aus. Vermutlich ist das sinnvoller, als noch einmal in den Verkehr zu stoßen, das Manöver zu wiederholen und die Aufmerksamkeit aller aufs eigene Ungeschick zu lenken. Die Fahrerin ist Anfang dreißig und kommt mir irgendwie bekannt vor – ich bin mir sicher, ihr Gesicht schon einmal gesehen zu haben –, aber die Frau, die auf der Beifahrerseite des Porsche aussteigt, erkenne ich sofort, genau wie alle anderen an den Tischen vor dem Café. Obwohl ich ihr noch nie zuvor leibhaftig begegnet bin, will es der Zufall, dass ich mehr über Mikky St Clairs jüngste Vergangenheit weiß als jeder der Gäste des SPQR, erheblich mehr sogar als ihre Freundin – auch wenn diese ihre beste und engste sein sollte –, die sie jetzt fürsorglich an den gaffenden Außentischen entlang geleitet, vorbei an jungen Burschen, deren Gesichter über ihren Gläsern schwebend verharren und die statt des Getränks den letzten Tropfen ihres Anblicks einsaugen. Ich habe Hunderte von Schnappschüssen von ihr auf den früher so genannten Gesellschaftsseiten gesehen. Die habe ich zwar immer bloß durchgeblättert, wenn ich zu irgendwelchen Terminen unterwegs war, aber Mikkys Gesicht war so allgegenwärtig, dass ich es jetzt gleich wiedererkenne, über einem abgrundtiefen Ausschnitt und mit den zwei oder drei für die Öffentlichkeit bestimmten Mienen: schmollend, lächelnd und, sehr selten, verwundert.
Es ist schwer, diese Mienen mit dem Horror in Einklang zu bringen, den sie vor drei Wochen erlebt haben muss, als ihr 20-jähriger Lover Alex Solona, ein vielversprechender Rugby-Superstar, in ihrem Apartment erschossen wurde. In den unmittelbar darauf folgenden Tagen, in denen die Polizei nichts verlauten ließ, den Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchungen abwartete und nach Zeugen suchte, waren die Zeitungen voll mit Lobeshymnen auf Alex, einen »aufgehenden Stern, in der Blüte seiner Jahre aus dem Leben gerissen«, und den unvermeidlichen Vergleichen mit einem anderen strammen jungen Giganten, der es aus den Armenvierteln von South Auckland herausgeschafft hatte. Jonah wurde persönlich mit der Aussage zitiert, Vergleiche seien zwar »ungerecht« – hat er das tatsächlich so gesagt? –, aber Alex Solona sei auf jeden Fall »ein großer Verlust für den Rugbysport«. Es gab Fotos von seiner tränenüberströmten Verlobten Suanita Laga’aia auf der Beerdigung, bei welcher die Abwesenheit Mikkys auffiel.
Irgendwie sickerte trotz des Schweigens der Polizei in der Szene durch, dass Mikky mit Alex zum Zeitpunkt seines Todes in flagrante delicto zugange gewesen sei. Von da war es nur ein kleiner Sprung in den Sunday Inquirer und zur unabwendbaren Überschrift: »Alex – sein letzter Bums«. Schon am Montag berichtete die alte Tante Herald hämisch, Mikky »erwäge ihre Optionen« hinsichtlich juristischer Schritte gegenüber dem Inquirer. Und tatsächlich verkündete Mikky am Donnerstag in der Frauenillustrierten, welche die Bieterkonkurrenz für »Mikky exklusiv!« gewonnen hatte, »Ich erhebe Klage«, erklärte ihre Unschuld und beschrieb ihren Zustand als »zutiefst entsetzt und traumatisiert« durch das Geschehene, wobei sie allerdings »wegen der laufenden Ermittlungen« nicht mehr sagen könne.
Für eine Frau, die ihr Leben in den Medien ausbreitet, dürfte dies wohl das Naheliegendste gewesen sein: Leg deine Sicht der Dinge dar und kassier dafür das Honorar. Damit öffnete sie jedoch die Schleusen, was ihr auch klar gewesen sein musste. Nach ihrer Einlassung hatte sie sich zum Zeitpunkt des Verbrechens in ihrem Apartment aufgehalten und ließ damit der Polizei keine Wahl als zuzugeben, dass »Ms. St Clair uns bei unseren Ermittlungen behilflich ist«. Dies wiederum bot der vergrämten Konkurrenz, die beim Exklusivbericht das Nachsehen hatte, eine günstige Gelegenheit, gebührend pikiert mit der Mutmaßung an die Öffentlichkeit zu treten, laut »einer Quelle aus dem Polizeipräsidium« werde Mikky der Komplizenschaft beim Mord verdächtigt.
Und so ging es weiter, und Mikky wurde zum Spielball im Pingpong der Medien. Immer wilder wurde spekuliert, was Alex und Mikky getrieben haben mochten und ob Alex vielleicht im Verlauf ausgefallener Sexspielchen verstorben sei wie weiland der Sänger Michael Hutchence …
Nachdem die ersten beiden Wochen verstrichen, ohne dass jemand verhaftet worden wäre, begann sich die Perspektive zu verschieben. Die Presse schoss sich auf Mikkys Unvermögen ein, der Polizei den Namen des Mörders zu nennen, und suggerierte, dass Mikky, falls sie nicht selbst die Mörderin war, gesehen haben musste, wer es war. Ich persönlich glaube allerdings, dass Mikky St Clair vermutlich die Wahrheit sagt, und ich bin besser informiert als die meisten.
In ihrer Aussage bei der Polizei gab sie zu, dass Alex zum Tatzeitpunkt Sex mit ihr hatte, und zwar in der Missionarsstellung (was durch die Analyse der von Mikkys Gesicht und Haaren genommenen Blut- und Gewebeproben bestätigt wurde). Womit sich erkläre, sagte sie, warum sie nichts von dem Angreifer gesehen habe, weil Alex ihr die Sicht versperrte. Das forensische Gutachten bestätigte, dass Alex einmal in den Hinterkopf geschossen wurde und die Kugel genau im Nackenansatz eingetreten sei. Tatortfotos in der Ermittlungsakte zeigen ihn mit dem Gesicht nach unten auf dem ansonsten leeren Bett; der Kopf liegt in einer teilweise absorbierten Lache aus Blut und Gewebefragmenten. Drei große Geschosssplitter, die man aus den Überresten von Alex’ Gehirn geborgen hatte, belegten, dass es sich bei der Tatwaffe um einen Revolver vom Kaliber .38 handelte, anscheinend ein geläufiges Modell. Die perkussorische Wucht des kupfernen Hohlmantelprojektils, das in sein Cranium eindrang, hatte beide Augen aus dem Kopf gesprengt.
Mikky war auf keinem der Fotos zu sehen, aber da, wo sie der Polizeibericht mit »Ich habe nichts gesehen« zitiert, hat sie mit Sicherheit nur vom Täter gesprochen. Was sie sah, hörte, fühlte, als dieser Junge in ihren Armen und zwischen ihren Beinen starb, als seine Augäpfel auf sie fielen und Alex’ Blut, Knochensplitter und Hirngewebe über ihr Gesicht spritzten, dürfte sich jedem Versuch einer Beschreibung entziehen. Dies alles wurde im Befund des Pathologen und im Bericht des Arztes, der sie am Tatort behandelte, eher nüchtern abgehandelt statt beschrieben. Selbst wenn ihr die Sicht nicht vollständig versperrt gewesen sein sollte, dann hatte vielleicht der Schock ihre Fähigkeit blockiert, irgendetwas anderes wahrzunehmen.
Nach ihrer raschen Beförderung von den Klatschspalten auf die Titelseite tauchte Mikky schließlich unter, und mangels aktueller Fotos bediente sich die Presse früherer Bilder, auf denen man ihr alterndes Kleinmädchengesicht sah, zwar noch immer schmollend und lächelnd, aber in diesem gänzlich anderen Kontext glaubte man nun, etwas irgendwie Boshaftes oder Wissendes darin zu erkennen.
Dass sie heute hier an dieser exponierten Promitränke auftaucht, ist vielleicht ihr erster Versuch, sich ihr altes Leben zurückzuholen. Der Zeitpunkt ist genau richtig gewählt: Zu Wochenbeginn wurde Kamal Fifita verhaftet und des Mordes an Alex Solona beschuldigt.
Ich hole mir meine Portion Fischfilets und die Pommes ab, gehe über die Straße zur Brown Street und bahne mir meinen Weg durch den schnuckeligen Miniaturpark, reiße dann oben ein Loch in das Päckchen aus Zeitungspapier und beginne, die Fritten zu essen, während ich die sinnlichen Kurven der Richmond Road entlangschlendere, die von der Ponsonby Road zur einstigen Wildnis von Grey Lynn führt.
Die Erinnerung an die Polizeifotos von Alex Solona hat sich auf meine euphorische Stimmung nicht gerade positiv ausgewirkt. Aber ich fühle mich sicher. Dies ist mein Revier, ich kenne seine Geschichte. Auch wenn sich die Gegend in den letzten Jahren verändert hat, könnte ich noch immer an die eine oder andere Türe klopfen, an der ich vorbeikomme, und zumindest das Gesicht der Person wiedererkennen, die öffnet, auch wenn mir der Name nicht mehr einfallen würde. Ich habe endgültig das Gefühl dazuzugehören.
Ich überquere die Straße und komme an einem Eckgebäude vorbei, das früher eine kleine Gießerei war und danach die unterschiedlichsten Inkarnationen durchmachte, von einer Kabelfabrik bis zum Vertriebszentrum für Pornomagazine. Ich hatte eine Freundin bei Domestic Purposes Benefit, der Unterhaltsbehörde, die dort zwei Nachmittage pro Woche schwarzarbeitete, die Hefte in braune Umschläge steckte und die Adressaufkleber anbrachte. Ihrer Ansicht nach kannte sie die Adresse jedes alten Ferkels im Großraum Auckland. Als das Internet den Markt für Pornohefte trockenlegte, setzte das Gebäude seine Entwicklung vom Eisen- und Stahlwerk zur Produktionsstätte von Eintagsfliegen fort: Es mutierte zum Bürokomplex einer trendigen Werbeagentur und danach zu seiner aktuellen Erscheinungsform, einer TV-Produktionsgesellschaft, bei der meine Tochter gerade angestellt ist.
Die Straße macht eine Kurve nach Norden, vorbei an dem ehrwürdigen zerfallenden gotischen Steinhaufen, der jetzt immer mittwochs von einer tongaischen Glaubensgemeinschaft zum Verkauf von Tapa-Tuchen genutzt wird, und hin zu Pippas Antiquitätenladen. Wenn ich mir gelegentlich das Leben anderer Menschen vorstelle, das ich gern leben würde, dann ist das von Pippa mein Favorit: dreimonatige Fischzüge durch Europas Hinterhöfe während des Sommers auf der Nordhalbkugel, und dann kehrt man heim zu einem Laden, der wie ein Wohnzimmer aussieht, ist umgeben von schönen alten Möbeln, wartet auf sachverständige Kundschaft, die sich in die Stücke verliebt … und dir dafür Geld bezahlt.
Wahrscheinlich kommt mir Pippas Leben deshalb so erstrebenswert vor, weil ich so wenig darüber weiß, im Gegensatz zu dem der Frau um die Vierzig – jenseits der Vierzig, um ehrlich zu sein –, deren Spiegelbild ich in Pippas Fenster sehe, deren Gesicht teilweise von einem dunklen Haarvorhang verdeckt wird, die ein elegantes Brokattop und einen Zigeunerrock über nackten Beinen trägt, dabei auf einem Fuß balanciert, um dem anderen eine Erholungspause von den zwickenden und wenig getragenen High Heels zu gewähren, während sie aus einem aufgerissenen Zeitungspäckchen Pommes zupft. Von dieser Frau weiß ich mehr als genug.
Bergab kommt dann gleich das Take-away Peaches, das eine seltene Mischung aus Delikatessen und traditioneller Hausmannskost anbietet – Seelenfutter, allerdings in viel zu bequemer Reichweite für mich, um als Trostspender zu dienen. Mir gefällt die Vorstellung, wie meine beste Freundin Maeve diese kulinarische Verknüpfung aus dem Nichts erschaffen hat und dass bloß wir beide wissen, dass ihr Lokal nach mir benannt ist. Aber es ist nur schwach beleuchtet, die schimmernden gläsernen Auslagen mit den angebotenen Gerichten sind leer, und die Tafel, auf der die täglich wechselnden küchenfertigen Speisen zum Mitnehmen für müde Arbeiter auf dem Heimweg annonciert werden, ist bis morgen entfernt worden.
Ich biege links in eine Straße ein, die auf der Westseite hinten um den Hügel herum und zu meinem leeren Haus führt, das ich liebe, um mich dankbar meines Glücks zu erfreuen und das Unglück außen vor zu lassen.
»Wie ein gemauertes Scheißhaus«, sagte Graham, als er es fand. Es handelt sich um ein von der Regierung errichtetes Haus mit Schindelfassade, Ziegeldach, großem Giebel und Dachvorsprüngen, Nut- und Federdielen aus Kauriholz als Fußböden, zwei Schlafzimmern und einem Bad. Die abgeteilte Küche und das Esszimmer sind jetzt offen angelegt und führen auf eine ausgedehnte Terrasse nach Westen, was die einzige konstruktive Veränderung des ursprünglichen, vom Arbeitsministerium entworfenen Grundrisses darstellt. Solche Häuser wurden in den Fünfzigerjahren hier in die Gegend gestreut, und dieses hier ist Grahams Vermächtnis. Es war der Typ von Haus, den ein guter Sozialist reinen Gewissens kaufen konnte, ohne sich wegen eines möglichen Kapitalgewinns schuldig fühlen zu müssen.
Innen ist es sauber und zweckmäßig eingerichtet; der goldene Glanz der gebohnerten Kauriböden wird von Wänden wieder aufgenommen, die zart ockerfarben sind, ein Ton, den zu treffen mich viel Zeit kostete, weil er auf keiner Farbskala zu finden war. Die meisten Dinge, die ich in meinem Haus habe – Fotos, Bücher, hier und da eine Keramik, ein Holzschnitt oder Kupferstich, dazu jede Menge Meeresmuscheln und kleine Stücke Treibholz –, sind nur für mich kostbar. Lediglich zwei Gegenstände haben einen mehr als sentimentalen Wert: Mitten in dem Bücherregal, das eine Wand bedeckt, steht eine bläulich-grün schimmernde Vase aus Gussglas, deren Farbe und Form die Tönung und die kinetische Energie des tiefen, klaren Ozeans eingefangen zu haben scheinen. Sie ist ein Geschenk von Ann Robinson aus der Zeit, als ihre Berühmtheit noch allein auf der Tatsache beruhte, dass sie die Tochter von »Robbie« war, dem legendären früheren Bürgermeister von Auckland. Damals sah es so aus, als wäre sie auch nur eine dieser verlotterten Dilettanten mit Kunstanspruch. Es war schwer zu erkennen, wodurch sie sich von den anderen abhob, bis ich diese Vase sah, und da wusste ich es.
Direkt gegenüber der Vase hängt ein Gemälde mit einem polynesischen Atlas, der auf eckigen Schultern und stämmigen Beinen die Welt in Gestalt eines Kindes trägt. »Das bist du, Kumpel«, hatte Tony Fomison zu Graham gesagt, als er es ihm schenkte. Da war er betrunken – und Graham ebenfalls, ausnahmsweise. Tony war ein gefährlicher Nachbar. Betrachtete er dich als Freund, war sein Haus, eine winzige Souterrainwohnung weiter unten in der Straße, auch dein Haus, ebenso sein Geld, Essen, Schnaps und seine Drogen, was auch umgekehrt galt, bloß dass er selbst zu dem Zeitpunkt rein gar nichts von alldem hatte. Es war hauptsächlich seine Trinkerei, die uns auf Distanz zwang; wir hatten zwei kleine Kinder, um die wir uns kümmern mussten. Er hörte auf, uns zu besuchen, hegte aber deswegen nie einen Groll, wollte nie sein Bild zurückhaben, nicht einmal, als kurz vor seinem Tod der Wert seiner Arbeiten in die Höhe schoss. Dennoch sahen wir ihn von Zeit zu Zeit. Beim letzten Mal tauchte er in nahezu komatösem Zustand an unserer Haustür auf, und Graham und ich trugen ihn in seine Wohnung zurück. Da war schon nicht mehr viel von ihm übrig: ein drahtiger kleiner Mann mit einem verschrumpelten, kummervollen Gesicht, und als Graham und ich ihn zu Bett brachten, gewahrte ich einen unpassend großen Schwanz, der herausploppte, als wir ihm seine dreckigen Jeans auszogen. Er starb kurz darauf, 1990, ein paar Jahre, bevor die letzten Nägel in den sozialistischen Sarg gehämmert wurden und Graham anfing, sich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen.
Als ich das Zeitungspäckchen aufmache, sind nur noch die beiden Filets übrig. Ich überlege, ob ich ein weiteres Glas Wein trinken soll, und um mir bei der Entscheidung zu helfen, wühle ich in meiner Handtasche und finde mein Handy, das dort schon seit drei Stunden schlummert, seit ich die Weinbar betrat und auf Paul Malone und seinen kalkuliert verspäteten Auftritt wartete.
Mein Handy loggt sich im Netz ein und meldet piepsend eine Nachricht, während ich wähle. Die Met-Phone-Wettervorhersage für morgen früh empfiehlt mir, den Wein besser zu vergessen: schönes, klares Wetter für die Auckland Küstenregion, zunächst leichter Wind aus westlicher Richtung, der ab Mitte des Vormittags stetig zunimmt, bis auf Windstärke vier.
Ich wähle meine Sprachbox an; vielleicht hat mich ja jemand lieb. »Hey, Mum«, sagt Jamie. »Malone gibt mir den Job. Er will dich auf einen Drink treffen. Um Himmels willen, bau bloß keinen Scheiß.« Die Stimme des elektronischen Faktotums betet die Optionen herunter, und ich drücke die Fünf zum Löschen. Love is, where you find it.
Die zweite Nachricht stammt von meinem Chef, Rory Sanderson. »Ester erinnert sich an dich und freut sich auf ein Gespräch. Unter der Woche scheint sie Tag und Nacht zu arbeiten, weshalb sie uns nur die Wochenenden anbieten kann. Morgen Nachmittag wäre prima. Pressiert aber nicht.«
Noch ein Grund, die Flasche Wein zuzulassen. Ester ist Ester Fifita, die Mutter von Kamal, der wegen Mordes an Alex Solona verhaftet wurde. Kamal Fifita ist unser Klient.
|2|
Die Wettervorhersage traf genau zu, und frühmorgens um sechs ist der Inner Harbour ein Mühlteich. Als ich das Kajak vom Auto zum Ufer trage und zu Wasser lasse, bilden die Ruten der Angler schon Girlanden längs des Westhaven-Uferdamms, der aus Lavagesteinsbrocken besteht und sich bis zur Harbour Bridge erstreckt. Die Angler sind Einheimische von den Pazifischen Inseln und Asiaten, halten ihre Ruten sorgfältig nach vorn und den Joggern in Lycrabekleidung aus dem Weg, die mit ihren Plastikwasserflaschen und Oakley-Sonnenbrillen von Herne Bay hergetrippelt kommen.
Ich paddle Lily hinaus Kurs Watchman Island, umfahre dabei den versteckten Finger des Meola Reef, indem ich auf die Tiefenströmung zusteuere, die nahe des Nordstrandes verläuft und mich vorbei an dem warmen Orange der Chelsea Zuckerraffinerie führt. Die Flut scheint mich wie mit einem gigantischen Atemzug mit sich zu ziehen. Von der Rückseite von Watchman sehe ich, wie sich das niedrig gelegene Land und der weite Himmel nach Süden bis zum Mount Eden und One Tree Hill erstrecken, und mir kommt es so vor, als triebe ich auf gleicher Höhe wie diese alten Vulkane dahin.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























