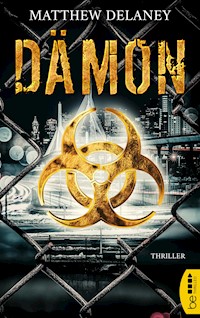
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Grauen schien für immer im Meer begraben - bis jetzt!
Südpazifik, 1943: Als die amerikanischen Soldaten auf der Insel Bougainville landen, sind sie bereit für den Kampf. Doch auf diesen Feind konnte sie niemand vorbereiten ...
Boston, viele Jahre später: Meeresforscher bergen ein im Zweiten Weltkrieg gesunkenes Schiff und überführen es in die Metropole an der amerikanischen Ostküste. Kurz darauf beginnt für die Bewohner der Stadt ein wahrer Albtraum. Bizarre Morde, verstümmelte Leichen und kryptische Zeichen halten die Polizei in Atem. Alles weist auf eine Verbindung zwischen den Gewalttaten und dem Wrack hin. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kriminalbeamten auf ein uraltes Geheimnis um ein Wesen, das nur ein Ziel kennt: zu töten!
"Kein Roman hat mir mehr Furcht eingeflößt als dieser." Los Angeles Times
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1019
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumZitatBougainville, Nördliche Salomoninseln, Pazifischer Kriegsschauplatz, 11. November 1943, MorgendämmerungZwei Tage späterSeptember 2007 Pazifischer Ozean, 100 Seemeilen vor der Küste von Bougainville, Amerikanisches Forschungsschiff Sea LionJuli 2008 Boston, MassachusettsBoston Common. In der gleichen Nacht20. Juli 1996Über dieses Buch
Das Grauen schien für immer im Meer begraben – bis jetzt!
Südpazifik, 1943: Als die amerikanischen Soldaten auf der Insel Bougainville landen, sind sie bereit für den Kampf. Doch auf diesen Feind konnte sie niemand vorbereiten …
Boston, viele Jahre später: Meeresforscher bergen ein im Zweiten Weltkrieg gesunkenes Schiff und überführen es in die Metropole an der amerikanischen Ostküste. Kurz darauf beginnt für die Bewohner der Stadt ein wahrer Albtraum. Bizarre Morde, verstümmelte Leichen und kryptische Zeichen halten die Polizei in Atem. Alles weist auf eine Verbindung zwischen den Gewalttaten und dem Wrack hin. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kriminalbeamten auf ein uraltes Geheimnis um ein Wesen, das nur ein Ziel kennt: zu töten!
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Matthew Delaney ist Absolvent des Dartmouth College, New Hampshire. Dämon, sein erster Roman, fand begeisterten Anklang bei Publikum und Kritikern. Die Filmrechte wurden noch vor der Fertigstellung des Buches an Touchstone Pictures verkauft. Matthew Delaney lebt in Somerville, Massachusetts.
MATTHEW DELANEY
Aus dem amerikanischen Englisch von Axel Merz
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2003 by Matthew B. J. Delaney
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Jinn«
Published by arrangement with St. Martin’s Publishing Group. All rights reserved.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Publishing Group durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2015/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven von © Kan Kankavee/shutterstock; © Rendermom/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1763-2
be-thrilled.de
lesejury.de
Gütiger Gott, unser Krieg ist vorüber.
Wir alle sind tot
– und das Königreich ist am Ende.
DER GRAF VON TRIPOLISNACH DER SCHLACHT VON HATTIN, A. D. 1187
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt,
was ich gesehen habe,
weil keiner mir geglaubt hätte.
MARCO POLOAUF DEM STERBEBETT
Bougainville, Nördliche SalomoninselnPazifischer Kriegsschauplatz,11. November 1943, Morgendämmerung
Die acht Landefahrzeuge bildeten auf dem aufgewühlten Pazifik eine unregelmäßige Linie aus grauem Schiffsstahl. Die kleinen Boote hoben und senkten sich mit dem Wellengang, und die leuchtend grüne Phosphoreszenz der See schlug gegen die eisernen Schiffswände, bevor sie zu Nebel zerstob, der über die behelmten Köpfe der F-Kompanie gischtete. Private Eric Davis stand eingezwängt zwischen anderen Marines mit nassen, dunklen Kampfanzügen und Helmen, von denen Salzwasser troff. Er zog die Schultern ein, als das Landefahrzeug über den Kamm einer weiteren Welle tanzte und mit Übelkeit erregendem Schwung in die Tiefe schoss, während unablässig Wasser über die Männer gischtete.
Zwei Monate zuvor war Davis noch in Boston gewesen. Dann war die Einberufung gekommen. Einen Monat Ausbildung in Mississippi, anschließend die Stationierung im Pazifik – der Rest war eine verschwommene Abfolge schlafloser Nächte an Bord schwankender Schiffe, in Segeltuchpritschen, eine über der anderen, während Davis den gelegentlichen Fliegeralarmen lauschte, sobald japanische Zero-Kampfmaschinen über ihnen auftauchten und sie umkreisten wie hungrige Geier ihre Beute.
Das Landungsboot stürzte in ein weiteres Wellental und zwang Eric, die Beine noch breiter zu spreizen, während wieder Wasser auf ihn herabgischtete. Sie umkreisten die Insel seit zehn Minuten, während die Sonne heiß auf ihre Helme brannte und das Salz auf ihrer Haut trocknete, bis sie spannte. Über die Süllwände des Landungsboots hinweg starrten die Männer auf die dichte Vegetation hinter dem Strand, wo der Boden von Granaten umgepflügt wurde.
Plötzlich änderte das Boot den Kurs und lief in Richtung Ufer. Ein Torpedobomber der Marine Air Group flog mit tiefem Brummen über sie hinweg und überflog ein letztes Mal den vorgesehenen Landeplatz.
Rings um Davis würgten Männer und übergaben sich. Einige beugten die Köpfe über die Süllwände des Landungsboots und erbrachen sich ins Meer, andere hielten sich die kleinen Papiertüten vor den Mund, die man ihnen vor dem Borden ausgehändigt hatte. Davis beobachtete den Mann direkt neben sich, der vornübergebeugt stand und vergeblich mit der Hand vor dem Mund das Erbrochene festzuhalten versuchte, das ihm zwischen den Fingern hindurchquoll.
An diesem Morgen waren die Soldaten um drei Uhr geweckt worden. Die Jungs in der Messe der ussPennsylvania hatten frisch gebügelte weiße Jacken getragen und Berge von Rührei mit Speck serviert, während aus den Bordlautsprechern Jazzmusik erklungen war. Wenn es beim Militär eine gute Mahlzeit gab, bedeutete dies üblicherweise, dass die Japse den Männern an dem betreffenden Tag mächtig einheizen würden. Erics Schiffskamerad Alabama pflegte zu sagen, dass eine anständige Mahlzeit immer nah bei einer letzten lag, ähnlich wie bei einem zum Tode verurteilten Gefangenen, der seine Henkersmahlzeit bekam, bevor er zum Galgen geführt wurde.
Ein Stück abseits auf See hielt die ussGalla Kurs, ein Truppentransporter aus Neuguinea. Sie hatte neun Leichen in Säcken dabei, die nach Hause verschifft und dort beigesetzt werden sollten. Jemand hatte vergessen, die Säcke weit genug hinten zu verstauen, sodass die Männer an Bord die Verwesung bis in ihre Quartiere riechen konnten.
Die meisten Marines hatten ihr Frühstück an den Metalltischen der Messe unter den nackten Glühbirnen schweigend eingenommen, während sie dem Dröhnen der Maschinen und dem dumpfen Geräusch der Wellen gelauscht hatten, die gegen den Rumpf schlugen. Nacht für Nacht lag Eric Davis in seiner Koje, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, während der Gedanke an den Tod auf irgendeiner gottverlassenen Insel fern der Heimat stärker in ihm geworden war. Eric, der an Bord der Galla gewesen war, bevor er auf die Pennsylvania gewechselt hatte, konnte den Tod schon wieder riechen. Er schien aus den Frühstückseiern aufzusteigen.
Eric dachte an zu Hause, und seine Gedanken wanderten zu Jessica. Am Kopfende seiner Koje hingen die drei Briefe, die er von ihr bekommen hatte, eng zusammengerollt in einer seiner Bandolieren. Er empfand ihre Handschrift als etwas Tröstliches, nicht so sehr wegen dem, was sie schrieb, sondern wegen ihrer Weiblichkeit, wegen der Form der Wörter selbst. Der vertrauten Art und Weise, wie jeder Buchstabe mit dem nächsten verbunden war.
Früher, vor dem Geruch der Toten, hatte er scheinbar nie bemerkt, wenn eine Trennung drohte. Heute jedoch war es ihr Gesicht, das in der Dunkelheit hinter seinen geschlossenen Lidern zu ihm kam. Vielleicht gefiel ihm einfach die Vorstellung, dass ein hübsches Mädchen sich etwas aus ihm machte – doch aus welchem Grund auch immer, Eric musste oft an sie denken. Ganz besonders an den Geruch ihres Haares. Er hatte sein Gesicht in ihr Haar gedrückt, hatte es tief zwischen den glänzenden Locken vergraben. Dieser süße Duft. Gott, wie habe ich den geliebt.
Eine ohrenbetäubende Explosion riss ihn aus seinen Gedanken. Der Helm vibrierte gegen seinen Schädel. Der Kinnriemen, der locker herabbaumelte, peitschte ihm kalt und nass ins Gesicht. Der Helm rutschte ihm über die Augen nach vorn und versperrte ihm für einen Moment die Sicht. Er schob ihn gerade rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie voraus ein Abschnitt des Strandes in einer roten Wolke aus Sand und zerfetztem Gehölz verschwand. Die Granaten von der Missouri schlugen zwischen den hohen Palmen ein, die den Strand säumten, und wirbelten zersplittertes Holz in die Luft, das aufspritzend in der rollenden Brandung landete.
Eric wandte den Kopf und sah zur Seite, blickte auf das Meer hinaus. Hinter ihnen, in sicherer Entfernung vom Ufer, feuerten die ussMissouri und die Nebraska ihre letzten Sperrfeuersalven ab. Fern am Horizont, in der endlosen Weite des Ozeans, wirkten die Kanonen der Schlachtschiffe beinahe harmlos, und der Rauch aus den Geschützrohren sah aus wie Sporenwölkchen, die aus geplatzten Pilzköpfen stoben.
Der Vergleich wurde rasch relativiert angesichts der Geschosse von der Größe eines Automobils, die mit wütendem Kreischen über ihren Köpfen vorbeirauschten, bevor sie in den Strand vor ihnen einschlugen.
Das Landungsboot setzte seinen Weg fort und näherte sich stetig dem Chaos aus brennendem Dschungel und schäumendem Sand. Es sackte erneut in ein Wellental. Wasser spritzte gegen die Seiten und schoss in weißen Fontänen empor. Hinter Eric röhrten die Schiffsdiesel unablässig weiter, ein pulsierendes, metallisches Geräusch, das in Höhe und Lautstärke mit den Wogen des Ozeans stieg und fiel. Manchmal höher, manchmal tiefer, doch stets das gleiche monotone Dröhnen. Der Steuermann stand über dem Motor, das Gesicht unter dem Helm angespannt und nass von Seewasser, der Körper geschützt von einer Metallwand, die bis zu seiner Brust reichte.
Eric spürte, wie jemand an seinem Ärmel zupfte.
»Zigarette?« Jimmy Scotti hielt ihm ein dünnes weißes Stäbchen hin, während eine zweite, nicht angezündete Zigarette im Mundwinkel klebte. Seine Stimme klang verzerrt, und seine Lippen waren schmal.
»Nein, danke.« Eric schüttelte den Kopf.
Scotti zuckte die Schultern und steckte die Zigarette vorsichtig in seine Brusttasche zurück, wo sie vor der Nässe einigermaßen sicher war.
»Das ist vielleicht eine Sauerei, was?«, sagte er unvermittelt, und seine Stimme klang nervös.
»Was meinst du?«, fragte Eric.
»Das hier«, antwortete Scotti einsilbig. »Diese ganze beschissene Operation. Hier draußen auf den Wellen, unterwegs zu einer mit Japsen verseuchten Insel am Arsch der Welt.«
Eric nickte nachdenklich. Nach einem Augenblick sagte er: »Weißt du, ich hab in meinem ganzen Leben noch keinen Japs gesehen.«
»Was?«
»Ich hab noch nie einen Japaner zu Gesicht gekriegt.«
»Du willst mich verarschen.«
»Nein.« Eric schüttelte den Kopf. »Ich schwör’s. In unserer Straße wohnte ein Typ, von dem ich dachte, er wäre ein Japs, aber dann hat sich rausgestellt, dass er aus China war.«
Scotti drehte sich überrascht um und hob den Kopf. »He, Leonard!«, brüllte er zu jemandem weiter vorn im Landungsboot.
»Was denn?«, kam die gedämpfte Antwort durch das Rauschen des Ozeans und das Dröhnen der Motoren von einem der behelmten Köpfe.
»Davis hat noch nie einen Japs gesehen.«
Einige Helme drehten sich neugierig nach ihnen um.
»Wirklich? Na, dann hat er jetzt Gelegenheit – da vorn wartet eine ganze verdammte Bande Japse auf uns.«
Scotti nickte zu Leonards Antwort. »Noch nie ’nen Japs gesehen, tsss … verdammte Japse!«, flüsterte er staunend zu sich selbst und schüttelte den Kopf, die Zigarette noch immer im Mundwinkel. Scotti rückte sie zurecht und zog ein silbernes Feuerzeug hervor, um sie anzustecken.
Eric beobachtete ihn bei seinen Bemühungen. Die Flamme tanzte um das Ende des Glimmstängels, doch das Boot schaukelte zu sehr und seine Hand war zu unruhig, um das Feuerzeug an die richtige Stelle zu führen. »Ich krieg das beschissene Ding nicht an!«, schimpfte er ärgerlich. »Ist verdammt nass hier draußen!« Mürrisch warf er die Zigarette über Bord, wo sie augenblicklich von einer Welle überrollt wurde.
Eric blickte nach vorn, wo sich das Ufer unaufhaltsam näherte. Sie waren inzwischen nahe genug, dass er die einzelnen Bäume unterscheiden konnte, die den Strand säumten, majestätisch geschwungene Palmen, die sich erhoben wie Wächter, die den Eingang zum Dschungel bewachten, der sich dahinter ausbreitete.
Vom Strand her ertönte ein dumpfer Schlag, gefolgt von einem pfeifenden Geräusch, als hätte jemand einen Wasserkessel zu lange auf dem Herd stehen lassen. Rings um ihn her duckten sich die Männer und zogen die behelmten Köpfe ein wie Schildkröten. Eric folgte ihrem Beispiel und packte sein Gewehr fester.
Das Pfeifen wurde lauter und wuchs zu einem regelrechten Kreischen an. Dann eine kurze Pause, und das Wasser neben ihnen explodierte in einer weißen Wolke, als die japanische 75-Millimeter-Granate dicht neben dem Boot einschlug. Die Männer vergaßen das näher kommende Ufer und duckten sich tief an den voll gekotzten Boden des Landungsboots.
»Drei Minuten!«, rief der Steuermann, der über ihnen in dem stahlgepanzerten Ruderhaus kauerte.
»Bereitmachen!«, befahl der Captain über den Lärm der schweren See hinweg. Er war ein Mann von vielleicht fünfunddreißig Jahren mit blassem Gesicht, das von Stoppeln und Aknenarben übersät war. Ringsum explodierten nun die Granaten im Wasser und sandten weiße Fontänen in die Luft. Alle hielten die Köpfe tief gesenkt.
»Zieht die Helmriemen straff!«, befahl der Captain. »Und haltet die Waffen trocken!«
Eric zog den losen Riemen unterm Kinn fest, bis der Helm gegen seinen Kopf drückte. Ringsum taten andere Männer es ihm gleich.
»Sobald wir am Ufer sind, bleibt in Bewegung. Niemals anhalten.« Der Captain hielt sich gegen die wogende See an der Süllwand des Landungsboots fest.
Die Männer murmelten und nickten. Der Captain rückte seinen Helm zurecht. »Wenn euch schlecht ist, dann kotzt jetzt und schafft den Mist aus dem Weg.« Er sah seine Leute an. »Wer euch erzählt, dass er keine Scheiß-Angst hat, ist verrückt. Glaubt den Schwachsinn nicht.«
Eine weitere Explosion wirbelte das Wasser vor ihnen auf und besprühte die Männer mit Gischt. Eric rümpfte die Nase – es roch, als hätte sich jemand bereits in die Hosen gemacht. Der Gestank kam von irgendwo weiter vorn im Boot.
»Ich hab keinen Schiss!«, murmelte Scotti vor sich hin, während er vor und zurück schaukelte. »Verdammt, mir passiert schon nichts …« Er wiederholte die Worte wieder und wieder, dass es wie ein Sprechgesang klang. Er strich sich mit der Hand übers Gesicht, rieb sich die feuchten Augen und fummelte nervös am Helmriemen. »Dieses beschissene Ding sitzt zu eng! Ich kann überhaupt nicht atmen!«
»Sechzig Meter!«, rief der Steuermann von hinten und hob einen Finger.
Eric bekreuzigte sich. Neben ihm wickelte ein Typ, der gerade erst zu der Einheit versetzt worden war, einen Kaugummi aus. Er steckte sich den Streifen in den Mund und begann nervös zu kauen, während er das Papier zerknitterte und in die Tasche steckte.
Plötzlich überkam Eric das dringende Bedürfnis, Wasser zu lassen. Er überkreuzte seine Beine und versuchte das Gefühl zu verdrängen. Der Himmel war inzwischen bewölkt, und dünner Regen rieselte in grauen Schleiern aufs Meer.
Der Strand war grau-schwarz und erstreckte sich auf einer Tiefe von vielleicht siebzig Metern, bevor der unglaublich dichte Dschungel begann. Über dem Blätterdach erhob sich ein steiler Bergrücken, eingehüllt in Nebelschwaden. Die Brandung rollte in langen weißen Wellen auf den Sand. Aus dem Mount Bagana, einem großen, von Dschungel umgebenen Vulkan, stieg ein dünner Rauchfaden in den Himmel. Die Missouri und die Nebraska draußen auf dem Meer hatten das Sperrfeuer eingestellt, und die Landeboote rückten in unheimlicher Stille vor. Die Gespräche der Männer waren verstummt. Jeder starrte in nervöser Erwartung nach vorn, während der Regen Hunderte winziger Kreise auf dem grauen Wasser ringsum malte.
Durch den dünnen Wasserschleier bemerkte Eric plötzlich einen roten Blitz am Ufer. Dann einen zweiten, und einen dritten. Einen Augenblick lang herrschte Stille – ein letzter Augenblick der Ruhe, bevor japanische Kugeln auf die Stahlseiten des Landungsboots prasselten. Pa-ching, pling, pling. Dann ein neues Geräusch, anders als das harte Klingeln von Metall auf Metall. Es war weicher, wie von einem Besenstiel, der auf ein federgefülltes Kissen geschlagen wurde. Im Augenblick des Geräuschs wurde ein Soldat nach hinten gerissen. Er stieß einen kurzen Schrei aus, bevor er zusammenbrach und auf dem Boden des Landungsboots aufschlug.
»Es geht los, Männer!«, rief der Captain. »Haltet euch bereit!«
Ringsum prasselten Kugeln in unglaublicher Schussfolge gegen die Wände des Landungsboots. Im Dschungel flackerten Hunderte roter Mündungsblitze auf, wie Leuchtkäfer in einem dunklen Wald. Eric duckte sich unter den Rand des Bootes, so tief er konnte, während er auf das Prasseln lauschte. Plötzlich war er froh, hinten im Boot zu stehen, zehn Reihen Männer vor sich, die einen schützenden Wall bildeten.
Ein schwerer Donnerschlag ertönte, und sengende Hitze strich über Erics Gesicht. Das Landungsboot direkt neben ihnen hatte einen Volltreffer von einer japanischen Granate abgekriegt. Flammen schossen aus dem Heck, und Eric hörte die Schreie der Männer, die in der glühenden Hitze verbrannten. Das Wrack fuhr blind weiter dem grau-schwarzen Strand entgegen, wobei es dichte Rauchwolken wie kleine Zyklone hinter sich herzog.
»Allmächtiger«, murmelte Scotti.
Ein plötzlicher Ruck ging durch das Landungsboot und ließ den Rumpf erzittern. Die Motoren heulten protestierend auf.
»Ein Riff!«, rief der Steuermann von hinten.
»Scheiße, wir sollten doch während der verdammten Flut landen!«
Das Boot erzitterte noch einmal und kippte gefährlich nach rechts. Einen Augenblick drohte es in der rauen See zu kentern. Sie waren noch immer zehn Meter vom Ufer entfernt. Falls sie kenterten, mussten sie die restliche Strecke schwimmen. Einer der Männer neben Eric ließ den Minensucher fallen, den er getragen hatte, hielt sich den Leib und brach zusammen. Ein anderer Mann betete in leisem Singsang immer wieder das Ave-Maria.
Der Private neben Eric spuckte seinen Kaugummi aus. Hinter Eric murmelte Scotti irgendetwas vor sich hin. Eric packte seinen Karabiner fester und rief sich ins Gedächtnis, die Waffe über dem Kopf zu halten, falls er durchs Wasser ans Ufer waten musste.
Dann war der Strand plötzlich vor ihnen, und das Landungsboot erzitterte von neuem. Die Maschinen brüllten auf und schoben das schwere Boot weiter.
Rings um Eric zerfetzte das Zischen von Kugeln die Luft. Er hörte, wie sie auf ihn zu- und an ihm vorbeipfiffen, um fast im gleichen Augenblick laut gegen Stahl zu prasseln oder manchmal mit einem widerlichen leisen Schlag menschliches Fleisch zu durchbohren.
Das Landungsboot kam ein zweites Mal zum Halten, als es über den sandigen Untergrund streifte. Die Männer wurden nach vorn geworfen. Ein Teil der Soldaten stieß ein Furcht erfülltes, zorniges Brüllen aus, während sie sich in den letzten Augenblicken, bevor die Klappe fiel, innerlich auf den Kampf vorbereiteten. Eric schloss für einen Moment die Augen und atmete tief durch. Immer noch kämpfte er dagegen an, sich in die Hose zu machen.
Dann ertönte das Rasseln von Eisenketten, die über Rollen liefen. Die schwere Klappe fiel spritzend ins Wasser und gab den Weg zum Strand frei.
Es hatte angefangen.
Jemand brüllte: »Los, los, los!«, und ein hektisches Drängen nach vorn setzte ein.
Im gleichen Augenblick fielen mit betäubender Geschwindigkeit die ersten Männer, durchlöchert, zerrissen und blutig, während andere wild und panisch vom Landungsboot das Ufer hinaufrannten. Vor ihnen erstreckte sich der graue Strand, von tiefen Einschlaglöchern mit schwarzen Rändern übersät, die vom schweren Beschuss der Navy stammten. X-förmige Panzersperren aus Stahl ragten aus dem Boden, umspült von der Flut, die bis an den Rand des Dschungels brandete. Aus dem Unterholz zischten vielfarbige Leuchtspurgeschosse und griffen nach den heranstürmenden Soldaten und ihren Landungsbooten.
Überall am Strand rannten nun Landungsboote auf Grund, und Männer strömten in geducktem Laufschritt heraus. Eric scharrte mit den Füßen, während er zwischen den anderen Soldaten wartete. Ein schriller Schrei ertönte, und plötzlich war die Luft voll mit Federn. Es war surreal, fast wie in einem Traum; die Schreie von Männern, die herabschwebenden Federn, das Hämmern von Gewehrschüssen, alles gleichzeitig.
Einer der Soldaten war von einer Kugel getroffen worden. Sie hatte die Rettungsweste zerfetzt, die alle Soldaten trugen. Eric stürzte durch den Vorhang aus Federn nach vorn, und einige blieben in feuchten Klumpen an seinem Gesicht und seiner Kleidung hängen.
Als er die herabgesenkte Landungsklappe erreichte, trat er auf jemanden, der am Boden des Bootes lag, verlor das Gleichgewicht und fiel aufs Gesicht. Er stieß sich ab und sprang von der Rampe, um sogleich bis zu den Knöcheln im nassen Sand zu versinken. Das Wasser war kalt. Erics Hose saugte sich augenblicklich voll und zog ihn nach unten. Er stampfte vorwärts, erfüllt von nervöser Erwartung, während er auf den zerschmetternden, brennenden Einschlag von Metall in seinen Körper wartete. Wie würde es sich anfühlen? Wo würde die Kugel ihn treffen? Im Gesicht? In den Beinen? Oder in der Brust?
Seine Stiefel sanken tief in die Nässe, die an ihm saugte wie Treibsand. Albträume kamen ihm in den Sinn, Szenen, in denen er gejagt wurde, während er sich immer schwerer gefühlt hatte, seine Bewegungen langsamer und langsamer geworden waren und Kälte das Rückgrat hochgekrochen war.
Überall ringsum brachen Männer ohne Vorwarnung von Kugeln getroffen zusammen, und ihre Leiber bildeten dunkle, nasse Klumpen auf dem Sand. Eine Welle brandete von hinten heran. Eric verlor das Gleichgewicht und stolperte ein paar Schritte vor, während er verzweifelt bemüht war, die Stiefel aus dem Sand zu ziehen und unter den Körper zu bringen. Es gelang ihm nicht, und er fiel mit dem Gesicht voran in den nassen Sand. Dort lag er, und Wasser rauschte an ihm vorbei, salzig, warm und blutig rot gefärbt.
Für einen Augenblick erstarrte er, vergrub das Gesicht im Sand und lauschte den Schreien und Schüssen ringsum. Etwas Schweres fiel auf seine Beine, und als er sich umwandte, sah er Rafuse, der ihn mit entsetzlich verzerrtem Gesicht anstarrte, während er einen dumpfen Seufzer ausstieß und Eric am Bein gepackt hielt.
Erics Blick fiel auf Rafuses Leib und verharrte dort, wo der Magen gewesen war; jetzt war dort bloß noch eine Masse aus Blut und hervorquellendem Rot zu sehen.
Rafuse streckte die Hand nach Erics Gesicht aus. Entsetzt befreite Eric sich vom Gewicht auf seinen Beinen und kroch rückwärts den Strand hinauf wie eine Krabbe. Er stieß gegen etwas Weiches. Als er sich umblickte, sah er das Bein eines toten Kameraden.
Im nächsten Augenblick war er auf und rannte los, so schnell er konnte, weg von den roten Schlangen, die aus seinem Freund quollen. Voraus lag ein umgestürzter Baum, gefällt vom Sperrfeuer der Schiffe draußen auf dem Meer. Mit rhythmisch stampfenden Schritten im feuchten Sand rannte er darauf zu.
Beinahe erstaunt, dass es ihn nicht erwischt hatte, erreichte er den schützenden Stamm und warf sich dahinter in Deckung. Er presste sich dicht gegen das Holz und starrte auf die abgeschälten Rindenstücke und Steinsplitter, die unter ihm lagen. Hinter ihm krochen verwundete Männer über den Strand oder lagen hilflos auf dem Rücken, während sie stöhnend Namen riefen, die nur ihnen allein bekannt waren.
Das schwere Abwehrfeuer aus dem Dschungel ließ keine Sekunde nach. Leuchtspurgeschosse fegten kreuz und quer über den Strand und verbreiteten unsichtbaren Tod. Nach und nach kamen weitere Männer zu ihm und warfen sich hinter dem umgestürzten Baum in Deckung. Sie lagen auf dem Sand, Fassungslosigkeit auf den Gesichtern, dass sie noch immer am Leben waren.
Der umgestürzte Baum schützte Eric und die anderen Männer vor den wütenden Geschossen, die in das splitternde Holz schlugen und versuchten, sich einen Weg zu den Männern zu fressen, die dahinter lagen.
Die Soldaten rings um Eric lösten ihre Spaten aus den Gürteln und gruben flache Schutzlöcher in den Sand. Eric blickte zurück über den Strand. Der glatte Sand war übersät von menschlichen Gestalten, die es nicht bis zum Baum geschafft hatten. Ihre Leiber schwankten in den Wogen der anrollenden Wellen. Ein Landungsboot ritt mit dröhnenden Motoren auf einer der Wellen heran. Es glitt auf den Strand, und die Klappe fiel herab. Sanitäter mit roten Kreuzen auf den Helmen und Taschen voller Verbandsmaterial strömten heraus.
Eine japanische Granate schlug auf dem Strand unmittelbar hinter dem Drahtverhau ein. Sie zischte einen Augenblick lang im Sand vor sich hin, dann explodierte sie und sandte heißes Schrapnell in die Leiber der Verwundeten und Toten. Ein Sanitäter wurde getroffen und stürzte wie vom Blitz gefällt zu Boden, die Hände vor der breiig roten Masse, die einmal sein Gesicht gewesen war.
Eric riskierte einen Blick über den Stamm hinweg zum Rand des Dschungels. Im dunklen Schatten unter den Bäumen konnte er zwei Unterstände ausmachen, massive Konstruktionen aus Kokosstämmen und Erde und durch eine Reihe von Gräben untereinander mit Gewehrnestern verbunden. Er duckte sich wieder und zerrte eine Handgranate aus dem Gürtel. Er zog den Stift, wartete eine Sekunde und schleuderte das Metallei in Richtung eines Unterstands. Andere Marines um ihn herum folgten seinem Beispiel, und in rascher Folge segelten Granaten durch die Luft.
Eine Reihe von Explosionen, die sich wie zerplatzende Papiertüten anhörten, rollte über den Strand, und das feindliche Gewehrfeuer wurde schwächer. »Los, schnappen wir sie!«, rief jemand. Keiner bewegte sich. Eric blickte zur Seite und sah, dass die Stimme einem unbekannten Soldaten mit Captainsstreifen auf dem Helm gehörte.
Rings um ihn herum streiften die Männer Ausrüstungsteile ab, um sich beweglicher zu machen. Eric zerrte sich die sperrige Schwimmweste herunter, zwei aufblasbare Schläuche, die um seine Brust geschnallt waren.
»Reißt euch zusammen, Männer!«, rief ein anderer Captain zusammenhanglos und mit hervortretenden Adern an den Schläfen.
Rings um Eric herum lagen Marines flach an den Boden oder in kleine Vertiefungen gepresst und hoben gelegentlich die Köpfe, um in den Dschungel zu feuern. Ihre Gewehre bockten vom Rückstoß, und Patronenhülsen segelten in den Sand, glänzendes Messing im schwarzen Dreck.
Das schwere Abwehrfeuer ließ nicht nach. Überall schlugen Geschosse ein und wirbelten Sand und Schmutz in die Luft. Regen fiel in schrägen Bahnen und durchweichte die Ausrüstung der Soldaten. Wasser tropfte in kleinen Bächen von Erics Helm.
Dann schwärmten die ersten Männer über den Baum hinweg und rannten gebeugt auf den Rand des Dschungels zu, in Richtung der gegnerischen Unterstände aus Holz und Erde. Eric stützte sein Gewehr auf den umgestürzten Stamm und nahm die japanischen Stellungen unter Feuer. Die letzte Patrone wurde ausgeworfen, und er riss das Magazin aus der Waffe und tastete an seinem Gürtel nach dem nächsten. Er rammte es ins Gewehr und pumpte blind Kugeln in den Dschungel. Die Garand gab Geräusche von sich wie ein Luftgewehr an einem Jahrmarktstand.
Als auch das zweite Magazin leer war, stand Eric auf und wollte über den Stamm springen, doch er verfing sich mit dem Fuß in der gefurchten Rinde und landete bäuchlings vor dem Baum im Dreck. Er rappelte sich auf und wollte weiterstürmen, doch plötzlich fuhr sengende Hitze über seinen Arm, und wieder stürzte er. Erics Schulter blutete durch einen Riss in der Kampfjacke. Der Anblick seines eigenen Blutes verwirrte ihn. Irgendetwas in ihm wollte, dass er in Bewegung blieb, und ohne weiter nachzudenken, stürzte er vorwärts. Eric nahm die anderen Männer kaum wahr, die in der gleichen geduckten Haltung wie er über den Strand huschten.
Plötzlich sah er eine Gestalt durch den Dschungel in Richtung eines Unterstands flitzen, hob das Gewehr und schoss auf den ersten Japaner, den er in seinem Leben zu Gesicht bekam. Ein Ruck ging durch den Körper des feindlichen Soldaten, er wurde herumgewirbelt und stürzte zu Boden.
Jetzt kamen weitere Japaner aus ihren Unterständen. Ihre Kampfschreie hallten durch den Dschungel, als sie sich den vorrückenden Amerikanern entgegenwarfen. Unvermittelt erschien ein Mann mit dünnem Bart und dunklen Augen vor Eric. Der riss das Gewehr hoch und drückte ab. Der Mann fiel rücklings in den Dreck und verschwand außer Sicht. Eric rückte vor, ohne einen weiteren Gedanken an den gefallenen Gegner zu verschwenden.
Die Männer waren inzwischen so nah am Feind, dass es zu Handgemengen kam. Das Blut der Sterbenden bespritzte die Lebenden. Amerikanische Soldaten hatten die Unterstände eingekreist und schwärmten umher wie Ameisen.
»Räucher sie aus!«, brüllte jemand, als sich ein Marine mit einem langen, silberfarbenen Treibstoffkanister auf dem Rücken vor dem Eingang eines der Unterstände postierte. Ein Flammenstrom schoss aus der Waffe des Soldaten und füllte den gesamten Unterstand mit Feuer.
»Steck ihn an!«, drängte ein zweiter Mann neben ihm.
Ein japanischer Soldat ohne Hemd und Jacke und mit dreckverschmierter Brust sprang aus einem der Laufgräben und rannte verwirrt auf die amerikanischen Soldaten zu. Ein Marine versetzte ihm mit dem Kolben seines Gewehrs einen Schlag ins Gesicht, und der Mann brach bewusstlos und mit heftig blutender Nase zusammen.
Ohne ein Wort schlug der Marine weiter mit dem Kolben der schweren Waffe auf den Bewusstlosen ein und zertrümmerte ihm dem Schädel. Anschließend richtete er sich auf und streckte sich, während er sich mit dem Jackenärmel über die Stirn wischte, als hätte er eine schwere Arbeit verrichtet.
Die schlimmsten Kämpfe waren vorüber, doch im Dschungel ringsum verbargen sich immer noch einzelne Japaner. Die Marines bewegten sich vorsichtig durch das Unterholz, sandten Flammenstöße zwischen die Bäume und warfen Granaten in Fuchsbauten.
Eric ließ sich erschöpft in den Sand fallen; zugleich berauschte das Adrenalin ihn wie eine Droge. Er beugte sich vor und erbrach sein Frühstück. Als er fertig war, spie er ein letztes Mal aus, wischte sich den Mund ab und stützte sich auf den Lauf seines Gewehrs.
Einer der Kameraden hatte eine herrenlose japanische Flagge gefunden. Er schwenkte sie triumphierend und rief: »Seht her, eine aufgehende Sonne!«
Eric drehte den Kopf nach dem Rufer um und sah, dass es Scotti war. Er stand auf einem der Bunker und schwenkte die Fahne über dem Kopf. »He, ich bin ein verdammter Japs!«, rief er den Männern zu und lachte schrill.
Irgendwo im Unterholz krachte ein Gewehrschuss. Scotti ließ die Flagge fallen und hielt sich den Hals. Sein Gesicht lief rot an, als hätte er sich verschluckt, dann sanken seine Hände herab, und Eric sah ein dollargroßes Loch an der Stelle, wo sein Adamsapfel gewesen war. Scotti brach zusammen.
Nach und nach verebbte das Gewehrfeuer, bis nur noch vereinzelt Schüsse erklangen, die mit der Zeit ebenfalls verstummten. Eric lag auf dem Rücken und hatte die Augen geschlossen. Er hörte die Wellen den Strand hinaufrollen und das Knistern der brennenden japanischen Unterstände. Gelegentlich stöhnte ein Verwundeter. Eric öffnete die Augen und blickte zum Himmel, als ein Schwarm bunter Sittiche in perfekter Formation über ihn hinwegstrich.
Er ließ den Blick über die Toten schweifen, die vielen Männer, die so sinnlos gestorben waren. Japanische und amerikanische Soldaten lagen in wildem Durcheinander auf dem Dschungelboden, einige in seltsamen Umarmungen verfangen, während das Blut aus ihren Wunden sich vermischte. Der Regen hatte inzwischen mit Macht eingesetzt und prasselte auf das Blätterdach über ihnen. Der gesamte Dschungel glitzerte wie mit nasser Farbe überzogen.
Am Boden neben Eric lag etwas, das einmal ein Mensch gewesen war. Der Soldat war so stark verbrannt, dass Eric nicht zu sagen vermochte, ob er ein Japaner oder ein Amerikaner war. Seine Augen waren klaffende Höhlen, seine Lippen schwarz verkohlt, und die Zähne leuchteten weiß durch das verbrannte Fleisch. Wassertropfen von den Blättern fielen in sein Gesicht und verdampften zischend von der Hitze, die noch immer in dem Leichnam schwelte.
Zwei Stunden später saß Eric mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt im Sand. Einer der Sanitäter bandagierte seine Armwunde. Eric starrte hinaus aufs Meer, das in sanften Wogen auf den Strand rollte. Das Ufer war übersät mit stumpfgrünen Ausrüstungsgegenständen. Große Landungsboote hatten die ersten leichten Panzer und Halbkettenfahrzeuge abgesetzt, die nun am Rand des Dschungels patrouillierten und Dieselgestank verbreiteten. Die Honeys – M3A1-Panzer, bewaffnet mit 37-mm-Kanonen – rumpelten und ratterten auf ihren Ketten durch den feinen Sand und stießen schwarze Abgaswolken aus.
Zwischen zwei Palmen war eine Zeltplane gespannt, und die meisten Verwundeten und Sterbenden waren unter das dunkelgrüne Gewebe getragen worden. Die Luft unter dem Sonnensegel war erstickend. Eric schwitzte lieber draußen in der Sonne am Strand, als mit all den Verwundeten und vor Schmerzen halb Wahnsinnigen unter dem behelfsmäßigen Dach zu bleiben.
Die Toten waren inzwischen fast ausnahmslos geborgen. Sie lagen in einer langen Reihe am Rand des Dschungels, wo sie der schweren Ausrüstung nicht im Weg waren. Später würde man sie nach persönlichen Briefen durchsuchen, die anschließend mit der Feldpost an ihre Adressaten versandt wurden. Dann würden die Leichen in Säcke gepackt und mit dem nächsten Schiff in die Heimat geschickt werden.
Das erste Feldlager wurde etwa einen halben Kilometer vom Strand entfernt aufgeschlagen. Die Bäume, nach dem schweren Beschuss durch die Navy nur noch verkohlte, zersplitterte Stümpfe, wurden ausgerissen, der Boden eingeebnet und Zelte errichtet. Männer mit nackten Oberkörpern und in der Sonne glitzernden Erkennungsmarken mühten sich mit dem dichten Unterholz ab.
»War wohl ziemlich rau, was?«, fragte der Sanitäter, der Eric Davis’ Arm versorgte.
»Ja, ziemlich«, entgegnete Eric.
»Verdammt, es ist immer das Gleiche mit diesen Japsen, wohin wir auch kommen«, schimpfte der Sanitäter, beendete seine Arbeit und erhob sich, um sich zu strecken und den Rücken durchzubiegen.
»Sie kommen wieder in Ordnung. Holen Sie sich ein Verwundetenabzeichen ab, bringen Sie’s nach Hause und zeigen Sie’s Ihrem Mädchen.«
»Danke«, erwiderte Eric und stand ebenfalls auf.
Der Sanitäter nickte und schlurfte zum Sanitätszelt. Unter der Plane schrie ein Verwundeter und strampelte wild, während zwei Sanitäter ihn festhielten, damit ein dritter ihm eine lange Nadel in den Arm schieben konnte.
Eric wandte sich ab und schlenderte über den Strand davon. Sein Arm fühlte sich taub an. Drei der Kameraden, die er von Bord der Pennsylvania kannte, lungerten im Schatten einer Kokospalme, rauchten Zigaretten und beobachteten die Halbkettenfahrzeuge, die rasselnd und klirrend über den Strand fuhren.
Eric ging zu den Männern, lehnte sich gegen die raue Rinde der Palme und glitt daran zu Boden.
»Was denn, willst du mich vielleicht auf den Arm nehmen?«, sagte Jersey Walker, ein vierundzwanzig Jahre alter Bursche, zu einem anderen Marine. »Scheiße, ich wäre hundertmal lieber drüben in Europa als hier im Pazifik! Besseres Klima, keine Wanzen, besseres Essen.«
»Und die Nazis sind nicht so verrückt wie die Japse. Hast du schon mal gesehen, dass sich ein Japse ergeben hätte?«, stimmte Kelly Keaveney aus New York ihm zu. Keaveney besaß scheinbar unerschöpfliche Energien, die ihn den ganzen Tag antrieben. Seine Bewegungen waren flink, sein Lachen explosiv und von noch schnelleren Bewegungen untermalt, und selbst sein Haar, das hellrot und lockig vom Kopf abstand, schien energetisch geladen zu sein.
»Nicht zu vergessen die französischen Frauen«, erwiderte Jersey. »Wir hingegen, wie oft sehen wir eine Frau? Einmal im Monat? Und das auch nur, wenn wir einen Hafen anlaufen.«
»Das seht ihr alles ganz richtig«, sagte ein anderer Mann namens J. J. Mulry, der seinem Heimatstaat entsprechend den Spitznamen »Alabama« trug. Alabama war ein hagerer Bursche mit eingefallenen Wangen und tief liegenden Augen. Er erinnerte Eric an Bilder von halb verhungerten Soldaten der Konföderiertenarmee, die er im Geschichtsunterricht gesehen hatte. Alabama besaß etwas Phlegmatisches, beinahe Schwerfälliges in seinen Bewegungen; bei ihm schien alles wie in Zeitlupe abzulaufen.
»Ich weiß nicht mal, um was wir überhaupt kämpfen. Meinetwegen können die Japse diese verdammten Inseln haben. Ich brauch sie nicht, nichts auf der Welt könnte mir gleichgültiger sein. Sollen sie den ganzen beschissenen Pazifik behalten. Ich bin aus New York, und ich will verdammt sein, wenn mich was anderes interessiert«, sagte Keaveney.
»Amen«, pflichtete Alabama ihm bei. »Und diese Hitze! Mann, bei so einer Hitze sollte man eisgekühlte Drinks auf einer schattigen Veranda nehmen. Sobald ich …«
Keaveney beugte sich zur Seite und unterbrach ihn mit einem hastigen Schlag auf die Schulter, bevor er zum Strand deutete. Durch den Sand kam Alexander Seals herangestapft, ihr Staff Sergeant.
»Ach du Scheiße, da haben wir den Salat«, murmelte Alabama, nahm sein Gewehr zur Hand und tat, als inspiziere er die Waffe.
»Seht euch das an!«, witzelte Seals, als er näher kam. »Sie müssen das sauberste Gewehr der gesamten amerikanischen Streitkräfte haben, Private!«
Er blieb stehen und musterte Mulry von oben bis unten. »Ich könnte schwören, dass Sie jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, dieses verdammte Ding in die Hand nehmen und so tun, als würden Sie’s reinigen.«
»Das tue ich wirklich«, sagte Alabama leise.
»Ja.«
»He, Sir!«, sagte Keaveney. »Wir haben uns unterhalten, und wir haben gedacht, wir würden lieber gegen die Deutschen kämpfen als gegen die Japse. Wir haben abgestimmt, wissen Sie, wie bei ’ner Versammlung vom Stadtrat.«
»Ach ja?«
»Ja.«
»Und was glauben Sie, was das hier ist? Ein beschissenes Reisebüro?«, fragte Seals. »Das nächste Mal, wenn wir in den Krieg ziehen, kann ich Sie ja irgendwohin schicken, wo es Ihnen gefällt.«
»Ich war noch nie in Europa«, sagte Keaveney.
»Und? Ich war noch nie in Atlantic City«, antwortete Seals. »Sollen wir vielleicht New Jersey den Krieg erklären, damit ich mal hinkomme?«
Alabama kicherte.
»Also schön, ihr Esel, hört zu!«, wandte Seals sich an die Gruppe. »Vor zwölf Tagen ist die B-Kompanie auf der nördlichen Nachbarinsel gelandet. Sie hat ihr Lager etwa zehn Kilometer oberhalb unserer Position. Eine Gruppe von vierzig Mann der B-Kompanie ist nach Südwesten in den Dschungel marschiert, aber seit einer Woche hat niemand mehr ein Wort von ihnen gehört.«
»Und?«, fragte Keaveney.
»Und da wir ihnen am nächsten sind, möchte der General, dass wir einen kleinen Aufklärungstrupp losschicken, um nach ihnen zu suchen.«
»Kommen Sie, Sarge!«, maulte Alabama. »Hier kriechen überall verdammte Japse rum wie die Ameisen! Wenn wir in den Dschungel marschieren, stehen unsere Chancen auch nicht gerade gut, dass wir wiederkommen!«
»Ich nehme Ihre Beschwerde zu den Akten«, sagte Seals. »Zusammen mit Keaveneys Bitte um Versetzung nach Europa. In die Rundablage.«
»Und keiner weiß, was aus den vierzig Mann geworden ist?«, fragte Eric.
Seals schüttelte den Kopf, während er ein Stück Papier aus der Brusttasche zog. »Die letzte Nachricht von ihnen ist ungefähr eine Woche alt. War eine fremde Stimme. Niemand kannte sie.«
»Was besagt sie?«
Seals las vom Papier ab. »Mea est ultio.«
»Was soll das denn heißen?«, fragte Alabama.
Seals musterte ihn sekundenlang, dann blickte er hinaus aufs Meer.
»Es ist Latein«, sagte er schließlich. »Mein ist die Rache.«
Sie verließen den Strand am Nachmittag, und als die Abenddämmerung hereinbrach, hatte der sechzehn Mann starke Trupp sich fast fünf Kilometer tief in den Dschungel vorgearbeitet. Es waren die härtesten fünf Kilometer, die Eric Davis je marschiert war. Alles im Dschungel schien ihn zu hassen. Entweder biss es nach ihm, zerkratzte ihn oder troff auf ihn herab. Hüfthoher Schlamm, in dem sich fünf Zentimeter lange, widerliche Egel wanden, Wespen von der Größe eines Kinderfingers, Riesenschlangen, die sich an den Ästen über ihren Köpfen entlangbewegten – alles war lebendig, und alles war feindselig. Sie waren durch Mangrovensümpfe gewatet, durch schier undurchdringliches Unterholz und durch Wälder, in denen riesige Bäume voller Ranken und Lianen wuchsen. Als die Sonne unterging, hatten sie noch keinen anderen lebenden Menschen gesehen.
Auf einer kleinen Lichtung befahl Seals, das Nachtlager aufzuschlagen. Die Marines sanken zu Boden, wo sie gerade standen. Eric saß auf seinem Rucksack, während die Dunkelheit hereinbrach. Rings um ihn her errichteten erschöpfte Männer ihre Schlafzelte. Eric teilte ein Zelt mit Alabama, Keaveney und Jersey Walker. Jerseys echter Name lautete Joe, doch er war vor dem Krieg Boxer gewesen und unter dem Namen Jersey Joe Walker aufgetreten, genau wie Jersey Joe Walcott, der zurzeit für Furore sorgte. Walkers Körper war muskelbepackt, und sein dicker Hals war so kurz, dass der Kopf fast auf den breiten Schultern aufzusitzen schien. In den Staaten war er für seine Gewaltausbrüche berüchtigt gewesen; immer wieder hatte er wegen der Frauen anderer Kneipenschlägereien angezettelt. Es hieß, er habe sich nur deswegen bei den Marines gemeldet, um nicht ins Gefängnis zu müssen.
Alabama befand sich bereits im Zelt. Er hatte die Stiefel ausgezogen und spielte mit den nackten Zehen. »Das war kein Spaziergang heute«, sagte er und rieb sich die schmerzenden Stellen. »Es kam mir vor, als wären wir durch ein Treibhaus voller nasser grüner Blätter gelaufen.«
Keaveney hob den Wassergraben rings um das Zelt aus. Der Graben war noch keine fünfzehn Zentimeter tief, als er den Spaten erschöpft zur Seite warf.
»Das war wirklich kein Spaziergang«, meinte auch Eric, während er sich in die Höhe stemmte und seinen Rucksack aufnahm. »Hast du heute Nacht Wache?«
»Nein«, antwortete Alabama und legte sich nach hinten ins Zelt. »Du?«
»Ja. Die Zwei-Uhr-Schicht. Bis vier in der Frühe.«
Keaveney und drei andere Männer richteten die Nahverteidigung des Lagers ein. Eric beobachtete, wie sie Schützenlöcher aushoben und die beiden Maschinengewehre in Stellung brachten. Sie hatten einen Hund dabei, einen Dobermann-Mischling namens Pete, der versteckte japanische Soldaten aufspüren sollte. Der Hund schnüffelte beiläufig am Boden und wühlte im feuchten Laub, bevor er winselte, sich einmal um die eigene Achse drehte und zum Schlafen zusammenrollte.
Das Grün des Dschungels wurde schwärzer, je mehr das Licht schwand, und die riesigen Blätter wurden zu dunklen Schatten vor dem grauen Himmel. Am Tag hatte es fast ununterbrochen genieselt. Die Feuchtigkeit hatte das dichte Blätterdach überwunden und nach und nach die Monturen der Männer durchnässt, bis nahezu jedes Körperteil nass zu sein schien und Eric sich kaum mehr daran erinnern konnte, jemals trocken gewesen zu sein.
Mit Einbruch der Nacht wurde es allmählich kühler, und der Regen hörte auf. Nur noch vereinzelte Schauer fielen. In der Ferne vernahmen die Männer das rumpelnde Geräusch von schwerem Mörserfeuer. Eric hatte gehört, dass die Streitkräfte auf einem der Bergrücken zehn Kilometer entfernt auf massiven Widerstand gestoßen waren. Er schloss die Augen und lauschte. Das Rumpeln wirkte beruhigend, beinahe so, als würde man einem fernen Gewitter lauschen.
Irgendjemand räusperte sich, ein feuchtes, abgehacktes Geräusch, gefolgt von Ausspucken. Ein anderer Marine spannte ein Seil zwischen zwei Bäumen, um Wäsche daran aufzuhängen.
Die Unterhaltungen waren gedämpft, so erschöpft waren die Männer.
Alabama lag bereits schlafend im Zelt, die nackten Füße draußen im Eingang. Keaveney wischte sich die Hände ab, legte sein Gewehr auf den Boden und kroch neben Alabama ins Innere.
»Kommst du auch?«, rief er Eric zu.
»Ja.« Eric streifte seine Ausrüstung ab und ging vor den Klappen in die Hocke. Die Männer im Innern lagen dicht gedrängt, fast aufeinander. Das Stoffgewebe des Zelts war feucht und roch nach Schimmel, was die Luft noch stickiger machte.
»Meine Güte, stinkt das hier drin!«, sagte Eric, als er sich ins Zelt quetschte und neben Keaveney auf den Rücken legte.
»Nasse Socken und Fürze«, erwiderte Keaveney und lachte auf.
»Das liegt an den Fruchtriegeln aus den Rationen«, sagte Jersey. »Sie bilden Gase in meinem Darm.«
Eric stützte den Kopf auf die Hand und starrte durch den dreieckigen Zelteingang hinaus in den nächtlichen Himmel. Ringsum im Dschungel leuchteten rote Punkte: Die glühenden Spitzen von Zigaretten, die einige Männer draußen rauchten. Die Punkte schienen in der Luft zu schweben und sich von einer Stelle zur anderen zu bewegen, wenn ihre unsichtbaren Besitzer durchs Lager gingen. Eric legte sich wieder zurück und fühlte sich überraschend behaglich.
»Sarge?«, flüsterte eine Stimme irgendwo draußen vor dem Zelt.
»Was ist?«
»Ich muss auf den Lokus.«
»Wer spricht?«
»Anderson, Sir.«
»In Ordnung, Anderson, aber nehmen Sie jemanden mit.«
»Jawohl, Sir.« Andersons Stimme wurde ein wenig lauter, als er in die Runde fragte: »Wer will mitkommen?«
»Ich komme.« Ein weiteres gedämpftes Flüstern zur Linken von Eric. Dann flüsterten ringsum Stimmen, ohne dass Eric sie in der Dunkelheit ihren Besitzern hätte zuordnen können.
Er hörte ein Rascheln, als jemand in seinem Rucksack kramte. »Scheiße, kann mir jemand Toilettenpapier borgen? Meins ist klatschnass vom Regen«, flüsterte Anderson, an die Gruppe gewandt.
Eric lachte leise auf. Ringsum kicherten Männer, und die roten Punkte von Zigarettenspitzen tanzten auf und ab.
»Nimm einfach Blätter«, empfahl jemand. »Irgendwo da drüben hab ich ziemlich große gesehen. Die sind wie ’ne riesige Windel.«
»Sehr witzig. Was hältst du davon, wenn ich dir auf den Kopf scheiße?«
Erneutes Kichern.
»Also schön, ich hab eine trockene Rolle hier. Wenn du sie auf den Boden fallen lässt und sie nass wird, Anderson, benutze ich beim nächsten Mal dein Hemd, um mir den Arsch abzuwischen.«
Eric hörte, wie jemand über feuchtes Laub ging, als Anderson das Toilettenpapier abholte.
»He?«
»Ja?«
»Fertig? Gehen wir?«
»Jepp.«
Die beiden Marines entfernten sich von der Lichtung und drangen ein Stück weit in den Dschungel vor. Eric legte sich zurück und blickte einmal mehr zu den Sternen hinauf. Er erinnerte sich an die Nacht zu Hause, bevor er ins Ausbildungslager gefahren war … seine Freundin Jessica, das hastige Fummeln unter den Tribünen des leeren, dunklen Football-Stadions. Der Geschmack der Cola, die sie getrunken hatten, das Gefühl des harten Grases auf der nackten Haut, und wie er hinterher auf dem Rücken gelegen und zu den Sternen des nächtlichen Sommerhimmels hinaufgesehen hatte. Er hatte nach den gleichen Sternen gesucht, als sie auf den Philippinen angekommen waren, doch er hatte sie nicht finden können. Nun suchte er erneut, während er auf dem Rücken lag und durch die Zeltklappe blickte. Der Himmel sah anders aus als zu Hause, die Sternbilder waren nicht die gleichen.
Alles war fremdartig hier im Südpazifik, sogar die Sterne. Irgendwo, unsichtbar von seiner Position aus, leuchtete der Vollmond und erhellte den Himmel, eine dunkle, wenngleich nicht vollkommen schwarze Palette für die Sterne.
Über ihm wogten die Zweige hoher Palmen in der sanften Brise; ihre Umrisse hoben sich schwarz vor dem Nachthimmel ab. Irgendwo tief im Dschungel kreischte ein Affe. Eine kurze Pause, dann ertönte ein Antwortschrei, als die beiden Tiere sich in der Dunkelheit verständigten. Eric starrte weiter zum Nachthimmel empor und lauschte dem Wind, der in den Zweigen rauschte. Ringsum tanzten Insekten in der Luft, dass es klang, als würden tausend Bögen über die Saiten von Violinen gezogen.
Er schloss die Augen. Sekunden später war er eingeschlafen.
Irgendwo in der Dunkelheit des Dschungels ertönte ein lautes Knacken, und Holz splitterte. Eric war schlagartig wach und starrte auf einen großen dunklen Schemen, der dicht vor seinem Gesicht vorbeihuschte. Eine riesige Fledermaus auf der Jagd zwischen den Bäumen.
Es dauerte einen Augenblick, bis Eric seine Schlaftrunkenheit abgeschüttelt und festgestellt hatte, dass es keine Fledermaus, sondern die Zeltklappe war, die sich im Wind bewegte. Müde schloss er die Augen und lauschte dem schweren Atmen von Keaveney, Jersey und Alabama, die neben ihm im Zelt schliefen, während er sich fragte, was ihn geweckt hatte. Er erinnerte sich vage an das Geräusch von irgendetwas, das sich lautstark jenseits des Perimeters durch das Unterholz des Dschungels bewegt hatte.
Er vernahm ein Geräusch und riss erneut die Augen auf. Es war ein schweres, rasselndes Atmen, das von irgendwo draußen vor dem Zelt kam. Ein gehetztes Flüstern folgte, dann ein leises Lachen aus dem Dschungel.
»He!« Er schüttelte Keaveney.
»Was ist?« Keaveney rollte herum.
»Wach auf!«, drängte Eric und schüttelte ihn fester. »Ich hab was gehört!«
»Was denn?«
Beide lagen schweigend im Zelt und lauschten. Draußen ging ein leichter Wind und raschelte in den Zweigen. Die nächtlichen Insekten summten und zirpten immer noch ohne Pause.
»Ich hör nur die Blätter im Wind. Du hast es dir wahrscheinlich bloß …«
»Nein, ich habe es mir nicht eingebildet!«, zischte Eric.
Das Flüstern hatte erneut eingesetzt, gefolgt von einem Kichern. Es klang, als stünden zwei, drei Männer vor dem Zelt, ungefähr zwanzig Meter entfernt im Dschungel. Eric beugte sich vor und spähte durch die Zeltklappe nach draußen. Mitten im Lager erhob sich eine Gestalt. Sie gab ein dumpfes Knurren von sich und streckte sich. Es war Pete, der Dobermann-Mischling, der mit gespitzten Ohren und gebleckten Zähnen dastand und in den Dschungel lauschte.
Das seltsame, leise Kichern hielt an. Eric versuchte sich auf die Worte zu konzentrieren, doch das Flüstern war so undeutlich, dass er nichts verstand.
»Meinst du, es sind Japse?«, flüsterte Keaveney, der schlagartig hellwach geworden war.
Eric schüttelte den Kopf. »Hört sich nicht nach Japsen an.«
»Wer soll sich sonst um diese Zeit da draußen rumtreiben?«
»Vielleicht ein paar von unseren Jungs.«
»Sollen wir nachsehen?«
»Bist du verrückt? Ich gehe nicht aus dem Zelt!«, sagte Eric.
»Wer hat denn jetzt Wache?«
»Sadlon und Hartmere.«
Das Flüstern wurde lauter, bis es sich anhörte, als würde jeden Augenblick ein Streit losbrechen. Die Stimmen erhoben sich zu einem hektischen, zischenden Geräusch, und die Worte wurden noch unverständlicher. Dann weiteres Kichern, gefolgt von einem Kreischen.
»Meine Güte, das ist vielleicht unheimlich!«, flüsterte Keaveney und bemühte sich, unbekümmert zu klingen, doch er hatte Recht. Die Geräusche waren entnervend.
Eric setzte sich auf, schlug die Zeltklappe zurück und starrte angestrengt in die Dunkelheit, doch er sah nichts weiter als die dunklen Umrisse von Zweigen, die sich leicht im Wind wiegten. Auf der Lichtung standen die Zelte der anderen Männer. Alles lag still. Niemand außer ihnen schien wach zu sein.
Er starrte zum Rand der Lichtung, wo er die Wachtposten vermutete, doch in der Dunkelheit waren die Maschinengewehrstellungen nicht zu erkennen. Erneut vernahm er die unterdrückten Stimmen.
»Hallo?«, rief er laut in den Dschungel.
Augenblicklich verstummte das Flüstern. Stattdessen hörte er nun Blätterrascheln, als würde sich jemand durchs Unterholz bewegen. Irgendjemand war dort draußen, kein Zweifel. Er lauschte dem sich entfernenden Geräusch, bis es verklang. Dann setzte das Flüstern wieder ein, diesmal weiter entfernt. Was immer es war – es schien sich vom Lager wegzubewegen.
Eric drehte sich um. »Es entfernt sich von uns«, sagte er ins Zelt hinein.
»Na bitte«, erwiderte Keaveney zuversichtlich. »Dann leg ich mich jetzt wieder schlafen.«
»Meinst du nicht, wir sollten nachsehen?«
»Willst du etwa nachsehen? Also, ich gehe ganz bestimmt nicht raus. So neugierig bin ich nicht. Wir haben schließlich Leute auf Wache, die sich darum kümmern müssen.« Keaveney drehte sich auf die Seite. »Ich tu einfach so, als hätte ich nichts gehört.«
»Meinst du das im Ernst?«
»Hör mal, falls es Japse waren, dann gehe ich ganz bestimmt nicht raus und leg mich mit denen an.«
»Und wenn es keine waren? Ich glaub nicht, dass sie Japanisch geredet haben.«
»Ist mir gleich. Ich hab nicht die geringste Lust, in der Nacht durch den Dschungel zu laufen. Es ist am Tag schon schlimm genug, wenn man sehen kann, was rings um einen ist.«
Eric blickte auf seine Uhr. Kurz vor eins in der Frühe. Er hatte noch eine Stunde, bevor er selbst mit der Wache an der Reihe war. Eine plötzliche Woge der Müdigkeit überschwemmte ihn. Ich schlafe noch ein bisschen, sagte er sich, bis ich um zwei geweckt werde.
Eric legte sich ins Zelt zurück. Es dauerte nicht lange, bis er eingeschlafen war.
Erneut riss er die Augen auf. Das Flüstern war wieder da, unmittelbar draußen vor dem dünnen Stoff des Zelts … viel näher diesmal. Was immer es war, es war zu ihnen zurückgekehrt und schien sich nun mitten im Lager aufzuhalten. Eric war auf der Stelle hellwach und lauschte. Die Geräusche waren eine seltsame Mischung aus Flüstern und hohem Lachen; es klang, als würde eine Gruppe von Menschen sich in einer unbekannten Sprache unterhalten.
Ein eisiger Schauer lief Eric über den Rücken. Sie waren kilometerweit in den Dschungel vorgedrungen. Wer also kann das da draußen sein? Eric drehte den Kopf, starrte durch die dreieckige Öffnung des Zelts. Die Nacht war klar. Der Mond stand tief über den Bäumen; das Licht fiel durchs Blätterdach und tauchte die Lichtung in bleiche Helligkeit. Eric suchte nach vertrauten Umrissen, nach einem anderen Zelt, einem Baumstumpf, nach irgendetwas, das er wiedererkannte.
Ein Schemen huschte durch sein Sichtfeld. Es war kaum mehr als ein Eindruck von etwas Hellem, das sich auf zwei Beinen bewegte, aber gebeugt, tief am Boden. Es war so groß wie ein Mann, doch sein Körper war eigenartig gekrümmt oder entstellt. Eric erschauerte unwillkürlich.
Wie spät war es überhaupt? Er spähte auf seine Uhr und bemühte sich, die Zeiger in der Dunkelheit zu lesen. Scheiße.
Es war kurz nach halb drei morgens.
Sadlon und Hartmere hätten ihn schon vor einer halben Stunde zum Beginn seiner Wache wecken sollen. Mit zusammengebissenen Zähnen dachte er nach. Er war mit der Wache an der Reihe. Falls er nicht nach draußen ging, würde Seals ihm am Morgen Feuer unterm Hintern machen. Auf der anderen Seite verspürte er keine Lust, die behagliche Wärme des Zelts zu verlassen und von sich aus nach draußen zu gehen. Neben ihm schliefen Alabama und Keaveney geräuschvoll.
Langsam schlich Eric aus dem Zelt und griff nach seinen Stiefeln. Er schüttelte sie aus, um sie von Insekten zu befreien, die vielleicht hineingekrochen waren. Dann saß er im Eingang und schnürte die Stiefel zu, während seine Blicke immer wieder über das Lager schweiften.
Alles war ruhig, bis auf das ständige Brummen und Zirpen der Insekten. Die flüsternden Stimmen waren verstummt. Die fünf Zelte standen willkürlich verstreut auf der Lichtung; die Stoffseiten bewegten sich leicht im Wind. Eine weitere Bö wehte heran und brachte den Geruch des fünf Kilometer entfernten Meeres mit sich. Eric drehte den Kopf in den Wind, um den salzigen Duft einzuatmen.
Als er die Stiefel geschnürt hatte, nahm er seine Garand und bewegte sich langsam durchs Lager zum Maschinengewehrnest. Er konnte sehen, wo der Stacheldraht gespannt war und ein behelfsmäßiges Hindernis bildete. Unmittelbar davor befanden sich zwei dunkle Flecken am Boden, rechteckig im Umriss, jeder so groß wie ein Mann, in die Erde gegraben. Es waren Schützenlöcher, doch im Mondlicht erinnerten sie eher an Gräber.
Beide waren leer.
Neben einem der Löcher lag etwas Dunkles. Eric stieß es mit dem Fuß an. Es war weich und gab unter der Berührung nach, doch Eric konnte in der Dunkelheit lediglich einen unförmigen Umriss erkennen. Er beugte sich vor, nahm sein Feuerzeug heraus, schlug es an und hielt die Flamme über den Boden.
Übelkeit stieg in ihm auf, und er hatte Mühe, sich nicht zu übergeben. Es war der Hund Pete. Der Dobermann-Mischling lag mit gebrochenem Genick und schlaff heraushängender Zunge neben dem Schützenloch.
»O Gott«, flüsterte Eric, über den toten Hund gebeugt. Die Schatten der kleinen Flamme tanzten über das matte schwarze Fell.
Plötzlich wurde ihm die Dunkelheit ringsum bewusst, und hastig schlug er das Feuerzeug zu. Bleiche Farben tanzten in seinem Sichtfeld, während seine Augen sich mühsam wieder an die Dunkelheit gewöhnten. Das leichte Maschinengewehr stand auf einer Lafette direkt vor dem Schützenloch. In der Dunkelheit besaß es ein merkwürdiges Aussehen, wie die Silhouette eines sitzenden Mannes.
Jenseits des Maschinengewehrs herrschte die ungewisse Schwärze des Dschungels, wo Zweige sich in heranstürmende feindliche Soldaten zu verwandeln schienen und umgestürzte Stämme in kauernde Japse. Insekten veranstalteten einen infernalischen Lärm. Wasser fiel in dicken Tropfen vom Blätterdach und platschte auf Erics Helm. Und ständig gab es raschelnde Geräusche, wie von einem Lebewesen, das sich einen Weg durch dichtes Gehölz bahnte.
Eric hatte gehört, dass sich die Japaner, wenn sie in der Nacht angriffen, mit Hörnern verständigten und laute Kriegsrufe ausstießen, um die Amerikaner abzulenken. Ein knackender Ast in einiger Entfernung ließ Eric erschrocken zusammenzucken. Irgendetwas war dort draußen im Dschungel. Langsam hob er seinen Karabiner und duckte sich tiefer an den Boden. Sein Knie berührte etwas Warmes, und er wich entsetzt zurück, als ihm bewusst wurde, dass er fast auf dem toten Hund kauerte.
Er hörte ein neuerliches Geräusch, merkwürdig unpassend, und spitzte die Ohren, bis er es erkannte.
Ein Lachen.
Langsam schob er sich vorwärts, bis er sich unmittelbar hinter dem Maschinengewehr befand. Im Dreck neben ihm lag eine silberne Metallkiste. Er klappte den Deckel auf und nahm eine schwere Leuchtpistole hervor, öffnete den Knicklauf und schob eine Leuchtpatrone in die Kammer.
Das Lachen vor ihm war verklungen und einem verstohlenen Flüstern gewichen, wie zwei Menschen, die miteinander stritten. Eric lauschte angestrengt, versuchte, einzelne Worte zu verstehen, doch es war eine fremde Sprache, und die Laute flossen ineinander wie bei einem Sprechgesang. Er hob die Leuchtpistole und legte den Finger an den Abzug. Aus dem Dschungel vor ihm drangen weitere Geräusche. Das Knacken von morschen Ästen am Boden, die unter schweren Schritten brachen, zischendes Flüstern, gefolgt von einem Ruf, der ähnlich klang wie der Schrei einer Eule.
Eric hielt die Leuchtpistole nach oben und betätigte den Abzug.
Ein Geräusch erklang, als hätte man den Korken aus einer Flasche gezogen, und die leuchtende Kugel jagte in die Höhe. Augenblicke später war der Dschungel ringsum in rotes Licht getaucht; Schatten tanzten über den Boden, als die brennende Kugel langsam wieder zu Boden sank. Die dunklen Schemen vor den Bäumen lösten sich auf, und die Zwischenräume füllten sich mit Licht. Endlich sah Eric, was sich vor ihm befand.
Ein Mann stand dort im Dschungel, zwanzig Meter jenseits der Lichtung, hinter dichtem Blätterwerk. Er war an einen Baum gefesselt, die Arme ausgebreitet, die Beine zusammengebunden. Sein Kopf lag abgetrennt vom Rumpf zu seinen Füßen. Der Mund war weit aufgerissen und voll gestopft mit Erde, Blättern und nassen Zweigen zwischen blauen Lippen. Auf den Schultern des Mannes, wo sein Kopf gewesen war, befand sich nun der Kopf eines Affen, der irgendwie am Rumpf des Toten befestigt war. Es war ein Schimpansenkopf. Die Augen des Tieres waren glasig und leer.
Eric erkannte den Toten. Es war James Sadlon, einer der beiden Marines, die vor ihm Wache gehabt hatten.
»O Gott!«, rief Eric laut.
Die Leuchtkugel sank zwischen die Bäume, und die Helligkeit verblasste. Rasch kehrten die Schatten unter die Bäume zurück. Dann war die Kugel ausgebrannt, und der Dschungel war erneut in Dunkelheit getaucht.
Hinter sich hörte Eric das wilde, panische Rascheln von Zeltstoff, als Männer hervorstürzten und nach ihren Waffen griffen. Ein Schuss fiel, ein orangefarbener Mündungsblitz zuckte, und draußen im Dschungel ertönte ein schriller Schrei. Eric hob verwirrt den eigenen Karabiner und feuerte blindlings eine Salve ins Dickicht. Der Rückstoß der Waffe schüttelte ihm heftig die Schulter durch.
Irgendetwas Dunkles schoss aus der nächtlichen Schwärze heran und traf Eric schwer an der Stirn, unmittelbar unter dem Rand des Helms. Er stöhnte schmerzerfüllt auf und fiel rücklings zu Boden, während die Lichtung hinter ihm schlagartig von Schüssen und dem Geräusch schwerer Schritte erfüllt war.
Eric lag im Bett, hatte die Augen geöffnet und sah durch die offene Zeltklappe hinaus in die morgendliche Dämmerung. Nebelschwaden zogen dicht über den Boden und hüllten alles ein, Pflanzen und Männer, ohne Unterschied. Eric hörte, wie das Lager langsam zum Leben erwachte. Männer krochen aus den Zelten, streckten sich und rieben sich den Schlaf aus den Augen. Eric hörte jemanden dumpf husten und nass ausspucken.
Er rollte sich auf die Seite, zog seine Feldflasche aus dem Marschgepäck, schraubte den Deckel ab, setzte die Flasche an die Lippen und bemühte sich, das metallisch schmeckende warme Wasser ohne Würgen herunterzuschlucken. Der Metallbehälter war feucht beschlagen. Er wischte mit den Händen darüber, um ihn von einem Teil des Drecks zu befreien, der sich darauf angesammelt hatte.
Sein Verstand kam nur langsam und träge in Gang. Sein Schädel schmerzte, und auf seiner Stirn hatte sich ein dicker blauer Fleck gebildet, wo er in der Nacht zuvor getroffen worden war. Er tastete mit den Fingern über die empfindliche Haut. Keaveney drehte sich zu ihm um, stützte sich auf einen Ellbogen und stieß einen leisen Pfiff aus, als er die Beule bemerkte.
»Du hast ein ganz schönes Ding verpasst bekommen.«
»Ja, tut scheußlich weh«, antwortete Eric.
Keaveney bedachte die Schwellung noch einmal mit einem anerkennenden Blick, bevor er sich umwandte. Eric rieb sich den Schlaf aus den Augen. Neben ihm lag Alabama auf seinem Schlafsack. Er war bereits wach und aß einen Fruchtriegel aus der Provianttasche, die jeder Marine mit sich trug. Er wirkte angespannt, schlang jeden Bissen schnell und gierig herunter und schien über irgendetwas nachzudenken. Schließlich sprach er Eric an.
»Meinst du, das waren Japse gestern Nacht, die du gesehen hast?«
»Ich nehm’s an.«
Alabama schwieg und dachte nach.
»Ich weiß nicht«, sagte er schließlich und schüttelte den Kopf. »Irgendwie kommt mir das alles spanisch vor. Wie haben sie zwei von unseren Jungs erwischen können, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist?«
»Sie haben die Jungs fast lautlos beseitigt.«
»Kein Mensch kann so leise sein.«
»Du glaubst, es war etwas anderes?«, fragte Eric.
»Nein, das hab ich nicht gesagt«, erwiderte Alabama. »Ich weiß nicht genau, was das letzte Nacht war. Ich hab es selbst nicht gesehen, deshalb kann ich’s auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit ein ungutes Gefühl hatte, dass irgendetwas Übles in der Luft liegt. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Dschungel. Irgendwas Böses hat es auf uns abgesehen. Ich kann es spüren. Und es wird nicht mehr lange dauern, bevor wir es finden.«
Er drehte sich wieder auf den Rücken und starrte auf die Zeltklappe. »Es wird nicht mehr lange dauern.«
Seals, der Staff Sergeant, war bereits auf und marschierte durchs Lager. Eric hörte ihn brüllen.
»Schaff deinen Arsch aus dem beschissenen Zelt, Keaveney, bevor ich’s über deinem hässlichen Schädel einreiße!«
Keaveney murmelte eine undeutliche Antwort.
»Was haben Sie gesagt?«, brüllte Seals.
Eric Davis trocknete sich die Hände an der Hose ab, setzte sich auf und streckte die Arme über den Kopf. Ringsum war alles in graues Weiß getaucht, eingehüllt in einen Schleier aus Dunst.
»Los, wir brechen das Lager ab. Wir müssen heute ein gutes Stück schaffen!« Seals marschierte von einem Zelt zum anderen und trat nach den Männern, die noch schliefen. Die Soldaten öffneten die Augen nur zögerlich und ließen ihre Träume von warmen Betten und Freundinnen zurück, um sich einer Realität aus Dreck und Tod zu stellen.
»Los, alles aus den Federn! Ihr habt zwei Minuten, bevor ihr meinen Stiefel ins Kreuz kriegt! Hoch mit euch!«
Hastig sammelte Eric seine Ausrüstung zusammen. Alles war feucht: sein Rucksack, seine Kleidung, selbst sein Gewehr fühlte sich kalt und feucht an. Seals zugewandt, nahmen die Männer in einer unordentlichen Reihe vor den Zelten Aufstellung – dreizehn Marines. Die meisten Männer wirkten erschöpft und unsicher und hatten dunkle Ringe unter den Augen wie verlaufene Schminke.
Alabama hielt seinen Helm in der Hand und kratzte sich am Kopf. Keaveney kaute auf einem Kaugummi; die weiße Masse leuchtete immer wieder zwischen seinen Zähnen auf. Leichter Regen hatte eingesetzt, sammelte sich auf den Blättern, fiel in großen Tropfen wie durch ein Sieb auf die Männer und tauchte sie in kühle Nässe.
Eric wischte sich den Regen aus den Augen und wartete darauf, dass Seals begann.





























