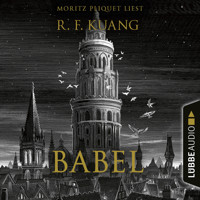7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Dorina Basarab – die sexieste Halbdämonin alive – ist wieder auf der Jagd. Trotz ihrer heftigen Abneigung gegen Vampire muss sie gemeinsame Sache mit dem attraktiven Louis-Césare machen. Denn irgendjemand tötet die Mitglieder des Senats, und er ist sehr mächtig. Werden Dorina und Louis-Césare ihn stoppen? Bald muss Dorina jedoch feststellen, dass der Auftrag selbst an ihren übernatürlichen Kräften zehrt. Und dann wäre da auch noch die ungeheure Anziehung, die der Vampir auf sie ausübt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Übersetzung aus dem Amerikanischen
von Andreas Brandhorst
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-96215-5
© Karen Chance 2010 »Death's Mistress«, ROC, Penguin Group (USA) Inc., New York 2010 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2011 Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Larry Rostant Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Es hing kein Schild an der verlassenen Kirche, aber jemand hatte »Hier wird gebechert, nicht gebetet« an die Tür gemalt. Als Katholikin konnte ich das nicht gutheißen. Als jemand, der einen guten Tropfen zu schätzen wusste, erschien es mir durchaus angemessen.
Ich drückte die schwere Holztür auf und trat ein. Bei der Vorbereitung auf diesen Abend hatte ich mich für Chefetageneleganz entschieden und damit offenbar richtig gewählt. Einige Gruftis und Touristen befanden sich in der zum Nachtclub umgebauten Kirche, aber die Mehrheit bestand aus Angestellten, die der Bürohölle entflohen waren.
Mit meinem Tanktop aus blauer Seide, das ich innerhalb weniger Minuten durchschwitzte, und dem kurzen schwarzen Rock fiel ich nicht weiter auf. Das Oberteil passte zu den neuen Strähnen in meinem kurzen braunen Haar und der Rock zu den Augen. An der Theke bestellte ich mir ein Bier, wanderte umher und suchte Ärger.
Ich fand ihn schon nach kurzer Zeit. Die meisten Besucher des Clubs waren Menschen, aber er gehörte einem Vampir. Eine Gruppe modischer Untoter kam jeden Abend zum Flatrate-Büfett, und wie’s aussah, gönnte sich der Inhaber eine Vorspeise.
Er saß mit einer hübschen Brünetten in der Ecke, hatte eine Hand unter ihrem Kleid und seine Reißzähne an ihrem Hals. Der Vampirsenat, die Regierung der nordamerikanischen Vampire, sah so etwas nicht gern. Ihm war es lieber, wenn die Nahrungsaufnahme ohne großes Aufsehen erfolgte, gewissermaßen hinter den menschlichen Kulissen. Aber dieser Bursche hatte bereits gezeigt, dass ihn die Meinung des Senats, in welcher Hinsicht auch immer, nicht sonderlich interessierte. Deshalb war ich hier. Ich sollte dem Burschen eine Lektion erteilen, und eine recht nachhaltige noch dazu.
Die Frau war der Menge im Club zugewandt, und als ich die beiden erreichte, hatte es der Typ geschafft, ihr ganz das Kleid zu öffnen. Darunter trug sie nicht viel, nur ein bisschen schwarze Spitze, in der er seine Hand hatte. Er stellte etwas an, das die Brünette veranlasste, kurz nach Luft zu schnappen und die Hüften zu bewegen. Einer der Zuschauer lachte.
Es waren etwa ein Dutzend, alles Vampire, und einige von ihnen Meister. Ich hatte gehofft, ihn allein zu erwischen oder schlimmstenfalls mit zwei oder drei anderen. Eine Show hatte ich gewiss nicht geplant; das machte alles komplizierter.
Er zog ihr das Kleid über die Schultern, und es glitt zu Boden, über eine bereits so sehr sensibilisierte Haut, dass jede Berührung eine Qual war. Die Brünette atmete schwer durch die Nase und zitterte wie im Fieber. Der Bursche hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie zu betäuben, denn ohne Angst beim Opfer machte es keinen Spaß.
Vampire verfügten über die begrenzte Fähigkeit, ihre Gedanken zu projizieren, und aufgrund meiner besonderen Abstammung konnte ich sie besser empfangen als viele andere. Die Brünette hielt den Kopf gesenkt und sah den Zuschauern nicht in die Augen. Aber die Bilder, die sie von ihnen empfing, wiesen deutlich darauf hin, was sie sahen.
Aus einem Dutzend Blickwinkeln wurde sie mit Bildern von ihrem Körper bombardiert: wie er im Licht der Lampen schweißfeucht glänzte, wie ihr das letzte Kleidungsstück die Schenkel heruntergerissen wurde. Und die Bilder kamen in Stereo, zusammen mit den Geräuschen aus ihrer Kehle, ein Dutzend Mal verstärkt. Und auch die Gefühle der Zuschauer erreichten sie. Erregung, Erwartung und vor allem wachsende Blutgier.
Das galt insbesondere für das Ungeheuer, das ihr Blut trank. Erstaunlicherweise versuchte sie noch immer, Widerstand zu leisten, wandte sich ein wenig hin und her. Sie stöhnte verzweifelt, als seine Hände über ihre schweißnasse Haut glitten. Eine Rückkopplungsschleife aus Emotionen, die die Nahrungsaufnahme begleiteten, hielt sie gefangen. Die Wirkung war stärker als bei jeder Droge. Ihre Brustwarzen verhärteten sich, und sie atmete schneller und flacher, als er ihr das Leben aus dem Leib saugte.
Ich hatte angenommen, dass er sie angesichts so vieler anwesender Spender nicht ganz leeren wollte. Die Beseitigung einer Leiche war immer problematisch und zeitaufwendig, und es forderte Ermittlungen heraus, die zu meiden er allen Grund hatte. Aber offenbar gefiel ihm der Geschmack der Brünetten, denn als ihre Beine nachgaben und sie zusammenbrach, folgte er ihr nach unten.
Es war alles andere als ratsam, einen Vampir zu stören, wenn er Blut trank – dann war er besonders verletzlich und damit auch überaus gefährlich. Doch um solche Dinge hatte ich mich noch nie geschert. Meine Stiefelspitze traf seine Hand und stieß sie von der Frau fort.
»Möchtest du mit mir tanzen?«, fragte ich laut, als er sich mir knurrend zuwandte.
Mit ziemlicher Sicherheit hatte ihn noch nie ein Mensch so herablassend behandelt, und ganz offensichtlich gefiel es ihm nicht. Noch weniger gefiel es ihm, dass einige seiner Vamps es gesehen hatten. Aber er war auch fasziniert. Plötzlich hielt er mich für leckerer als die Frau, die vor ihm lag, mit dem Samtkleid unter ihr, und wie ein Fisch auf dem Trocknen nach Luft japste.
»Warum nicht?«, erwiderte er und schenkte mir ein gewinnendes Lächeln, das auf eine gehörige Portion Macht hindeutete.
Ich achtete nicht darauf und grub die Finger in sein Hemd, damit ich ihn nicht berühren musste. Dann zerrte ich ihn zur Tanzfläche, und er versuchte nicht zu entkommen. Mit einem besonderen, Schmerz versprechenden Glitzern in den Augen folgte er mir.
Er hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand.
Er lächelte erneut, und sein Blick glitt zu meinen Hüften, als ich mich im Takt der Musik bewegte. »Du siehst heiß aus.«
Was ich von ihm leider nicht behaupten konnte. Er starrte auf meine Brust, vielleicht deshalb, weil sie ihm so nahe war. Ich war knapp eins sechzig groß, und die Stiefel fügten etwa acht Zentimeter hinzu, und es bedeutete, dass ihm ein wichtiges Element des großen, dunklen und attraktiven Stereotyps fehlte. Es spielte kaum eine Rolle, weil der Rest ebenfalls nicht vorhanden war.
Was ihm allerdings nicht klar zu sein schien.
»Danke«, sagte ich.
Er lachte. »Ich meine, du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen.«
»Wenn wir dabei allein sein können.«
Eine blonde Braue kam nach oben. »Das lässt sich arrangieren.«
Er nahm meine Hand und zog mich über die Tanzfläche – vor ihm wichen die Leute beiseite wie Bauern vor ihrem König. Der Vergleich amüsierte mich; immerhin war er als unehelicher Sohn eines Schweinezüchters geboren. Aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen: Ich war die uneheliche Tochter eines Dienstmädchens und eines Vampirs. Trashiger ging’s kaum.
Natürlich hatten wir beide seit unserem wenig verheißungsvollen Anfang einen weiten Weg zurückgelegt. Heutzutage nannte er sich Hugo Vleck und leitete einen erfolgreichen Club, wenn er nicht gerade illegale Elfendrogen verkaufte. Und was mich betraf … Ich löste Probleme von der Vampirart, und Vleck machte meinen Auftraggeber sehr unglücklich. Meine Aufgabe bestand darin, ihn aufzuheitern. Der Umstand, dass es mir Spaß machen würde, war ein zusätzlicher Bonus.
An der Theke standen die Leute in fünf Reihen, aber wir wurden trotzdem sofort bedient. Was mich kaum überraschte, denn schließlich gehörte der Club meinem Begleiter. Über die Schulter hinweg warf er mir einen Blick zu, um festzustellen, ob ich angemessen beeindruckt war. Ich lächelte, und er legte mir die Hand auf den Hintern.
»Cristal für die Dame«, teilte er dem jungen Vampir-Barkeeper hinter der Theke mit und zwickte mich in meine Kehrseite.
»Möchten Sie ebenfalls etwas trinken, Sir?«
Vleck grinste und zeigte dabei seine spitzen Eckzähne. »Später.«
Er und der Barkeeper wechselten einen Blick, und ich versuchte wie jemand auszusehen, der nicht wusste, dass Vamps ihren Alkohol am liebsten aus den Adern eines Opfers tranken – angeblich gab es ihnen einen besonderen Kick. Vleck überlegte vermutlich, wie viel ich brauchte, um betrunken zu werden. Ich hätte ihm sagen können, dass mir Alk selbst literweise keinen Rausch bescherte, aber warum seinen Abend ruinieren?
Er hatte so wenig davon übrig.
Der Barkeeper stellte ein Sektglas auf die Theke, doch Vleck schüttelte den Kopf. »Ich nehme die Flasche. Wickel sie ein.«
»Wohin gehen wir?«, fragte ich.
»Zu mir. Es ist nicht weit.«
Wow. Offenbar wollte er es richtig abgehen lassen. Ich legte ihm den Arm um die Taille und stützte das Kinn an seine Schulter. »Ich möchte nicht warten. Können wir nicht hier in der Nähe allein sein?«
»Nein. Das Büro ist zu klein – darin kann man sich kaum umdrehen.«
»Ach? Du bist der Boss. Sorg für Platz«, sagte ich, lächelte verführerisch und zog ihn von der Theke weg. Wie bei den meisten Schuppen dieser Art führte der Weg zum Klo durch einen dunklen Flur. Ich zerrte den Burschen auf die Männertoilette und öffnete sein Hemd.
Er lachte leise und machte sich lange genug frei, um zwei Typen aus einer Kabine zu werfen, einer von ihnen mit der Hose auf den Knien. Ich lehnte mich ans Waschbecken, während er einen der Vampire, die als Rausschmeißer fungierten, anwies, allen Interessierten mitzuteilen, dass die Toilette derzeit nicht benutzt werden konnte. Dann drehte er sich um und packte mich am Rockbund.
»Mal sehen, was du zu bieten hast.«
»Wird auch langsam Zeit.« Ich lächelte und stieß die Tür mit dem Fuß zu.
Fünf Minuten später verließ ich die Toilette, ein wenig außer Atem, aber in recht guter Verfassung, wenn man alles bedachte.
Auf dem Weg nach draußen begegnete ich dem Blick des Rausschmeißers. Es schien ihn zu überraschen, dass ich noch lebte. Aber dann grinste er. »Spaß gehabt?«
»Ich hab ihn um Kopf und Kragen gebumst.«
Ich machte einen Abstecher zur Vampirzentrale beziehungsweise zum Ostküstenbüro des Nordamerikanischen Vampirsenats, um meinen Scheck abzuholen. Normalerweise kümmerten sich die Vamps selbst um Armleuchter wie Vleck, denn jeder Meister war für das Verhalten seiner Diener verantwortlich. Aber das System war nicht so perfekt, wie viele Leute glaubten.
Vampire konnten sich von der Kontrolle durch ihren Herrn befreien, wenn sie ein gewisses Machtniveau erreichten – dann waren sie nicht mehr zu absolutem Gehorsam gezwungen. Andere wurden von ranghohen Meistern anderer Senate kontrolliert, die sich nicht immer an die Regeln ihres nordamerikanischen Pendants hielten. Und dann gab es noch die Wiedergänger, bei deren Verwandlung etwas schiefgegangen war und die abgesehen von ihrem eigenen verdrehten Selbst niemandem Rechenschaft ablegen mussten.
Wenn einer von diesen Vamps Ärger machte, griff der Senat ein. Zum Glück für mich bedeutete der gegenwärtige Krieg, dass die Ressourcen der übernatürlichen Gemeinschaft wichtigeren Dingen vorbehalten bleiben mussten. Sie waren so knapp geworden, dass der Senat sogar einen Dhampir – die verhasste Kreuzung zwischen Vampir und Mensch – in seine Dienste nahm, um die Drecksarbeit zu erledigen. Allerdings bekam ich immer den Eindruck, dass sie das Büro desinfizierten, wenn ich gegangen war.
Eine Szene altertümlicher Eleganz erwartete mich, als sich die Tür des Lifts öffnete. Glänzende Kirschholzsäulen umgaben einen polierten, mit exotischen Blumen geschmückten Tisch, auf den das Licht eines exquisiten Kronleuchters fiel. Der Boden bestand aus Marmor und wies Sonnenradmuster auf, in warmen goldenen und bernsteinfarbenen Tönen. Vielleicht hätte das Zimmer einladend gewirkt, wenn nicht die in Form mehrerer Gestalten präsente bleiche Gemeinheit an den Wänden gestanden hätte.
Eine dieser Gestalten stieß sich von der Wand ab und trat mir in den Weg. Der Typ war eher zierlich, trug eine knapp sitzende Jacke und eine Kniehose aus mitternachtsblauem Samt. Die Absätze seiner Schuhe waren noch höher als die meiner Stiefel. Sein langes, vollkommen glattes Haar bildete einen Zopf, und eine Krawatte vervollständigte seine Aufmachung. Er wirkte wie jemand aus einem Historienfilm – von jener Art, die nicht bei den Kostümen spart –, und er schien Schlimmes zu ahnen.
»Wer hat Sie hereingelassen?«, fragte er.
So ging das jedes Mal, wenn die Wächter wechselten, und mit den betagteren gab’s mehr Ärger. Sie erinnerten sich an die gute alte Zeit, als man Dhampire sofort getötet hatte, vorzugsweise langsam. Ihre Einstellung ging mir gegen den Strich, denn schließlich arbeitete ich schon seit über einem Monat für den Senat, und nach der Sache im Nachtclub war ich streitlustig. Vleck war kaum eine Herausforderung gewesen.
Aber verdammt, ich hatte einem gewissen Jemand versprochen, mich zu benehmen. »Ich bin gekommen, um mit Mircea zu reden«, sagte ich, anstatt den Vampir durch die hübsche Brokattapete zu rammen.
»Lord Mircea.«
»Wie auch immer. Ich habe eine Lieferung für ihn.« Ich schob mich an dem Burschen vorbei.
Er schloss seine Hand ziemlich fest um meinen Arm. »Sie können in der Gasse beim Müll warten, bis ich Sie rufe.«
»Ich bin müde, ich bin hungrig, und ich habe einen Kopf in der Reisetasche«, warnte ich ihn. »Kommen Sie mir nicht quer.«
Er schlug mich mit so viel Kraft, dass mein Kopf nach hinten ruckte, also nagelte ich seine Hand mit einem Messer an die Wand. Er zog sie frei, und die Schnittwunde heilte sofort. Eine halbe Sekunde später stürzte er sich auf mich – und endete damit, dass er über dem Boden baumelte.
»Wolltest du dich nicht benehmen?«, fragte jemand. Ich sah auf, und mein Blick fand das angenehme, spitzbärtige Gesicht, das lockige dunkle Haar und die glänzenden braunen Augen von Senator Kit Marlowe. Seine freundliche Miene hinderte ihn nicht daran, die Hand so fest um den Hals des Mannes zu schließen, dass ihm die Augen aus den Höhlen traten.
Da mich Marlowe nur etwas weniger hasste als zum Beispiel die Beulenpest, machte mich sein Lächeln nervös. Wahrscheinlich lächelte er genau deshalb, aber es klappte jedes Mal. Ich zuckte mit den Schultern. »Ich hab ihm das Messer nicht ins Herz gestoßen.«
»Vielleicht hättest du das tun sollen«, sagte er ruhig und öffnete die Hand. Der Vampir fiel zu Boden, sprang sofort auf und griff mich an. Ich packte ihn am Nacken und stieß seinen Kopf durch die Wand.
»Bring sie rein, Mikhail!«, rief jemand von rechts.
Vermutlich war Mikhail derjenige mit der Rübe in der Wand, denn niemand rührte sich. Ich ließ ihn los, woraufhin er den Kopf ins Zimmer zurückzog. Hass glitzerte in seinen hellen Augen. Ich lächelte. Es war immer sehr viel einfacher, wenn die Vamps, mit denen ich zu tun hatte, mich verachteten. Ich kam durcheinander, wenn sie andere Gefühle zeigten. Mikhail und ich verstanden uns bestens: Er würde mich töten, wenn er Gelegenheit dazu erhielt, und ich würde dafür sorgen, dass er keine Gelegenheit dazu bekam. So einfach war das.
»Ich übernehme sie«, sagte Marlowe, als Mikhail ihn anstarrte.
»Herr … Sie hat mich angegriffen!«
»Wenn Sie dumm genug sind, sich mit Lord Mirceas Tochter auf eine Auseinandersetzung einzulassen, während er in der Nähe ist, verdienen Sie es nicht anders«, erwiderte Marlowe.
Ich folgte Marlowe durch die offene Tür. Wir kamen durch ein Wohnzimmer und erreichten ein hübsch eingerichtetes Arbeitszimmer: handgeschnitzte Holzverzierungen, eine hohe Decke und ein Wandbild, das dicke Putten zeigte, die mit selbstgefälliger Überlegenheit auf Besucher herabblickten.
Der Schreibtisch bestand aus massivem Mahagoniholz und war ein wahres Meisterwerk, weckte jedoch nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit wie der Mann dahinter. Im Gegensatz zu Vleck verstand sich Senator Mircea Basarab sehr gut auf die Groß-dunkel-und-attraktiv-Sache, und an diesem Abend trug er vollen Ornat mit weißer Krawatte. Er glänzte vom Haar bis zu den Spitzen seiner perfekt geputzten Schuhe.
»Du brauchst nur noch einen rot abgesetzten Umhang«, sagte ich säuerlich und stellte meine Reisetasche auf den Tisch. Ein schmatzendes Geräusch kam aus ihrem Innern. Mircea verzog andeutungsweise das Gesicht.
»Dein Wort genügt mir, Dorina«, teilte er mir mit, als ich die Reisetasche öffnete und den Inhalt herausnahm. »Ich brauche keinen physischen Beweis, es sei denn, ich möchte einige Fragen an den Betreffenden richten.«
»Ich werde in Zukunft daran denken.« Vlecks Kopf tropfte auf den Marmorboden, und deshalb setzte ich ihn auf den Tisch. Doch dort blieb er nicht liegen. Er rollte, und Marlowe sprang vor und rettete einige Papiere vor dem blutigen Ruin. Ich sah mich um, hielt jedoch vergeblich nach Papierkörben Ausschau, und so spießte ich ihn auf den Zettelhalter. Er tropfte weiterhin, aber wenigstens rollte er nicht mehr.
Als ich den Blick hob, sah ich zwei unglückliche Vampire. »Na schön«, sagte ich. »Für mich ist es gleich. Ich möchte nur meinen Scheck.«
Mircea holte ein in Leder gefasstes Scheckheft hervor und begann zu schreiben, während Marlowe nachdenklich auf Vleck herabsah. »Ich habe mich immer gefragt … Wie kommst du davon?«
»Was?«
»Wie verlässt du anschließend den Club oder das Haus, was auch immer?« Er winkte mit der einen Hand. »Wenn ein Meistervampir stirbt, wissen seine Kinder sofort Bescheid. Selbst wenn sie alt und mächtig genug sind, Freiheit gewonnen zu haben – sie fühlen es hier …«, er klopfte sich an die Brust, »… wie einen Schlag. Aber du bringst immer wieder solche Vampire um und gehst anschließend, ohne dass dein Kopf auf einem Spieß endet. Ich frage erneut: Wie kommst du davon?«
»Ich gehe einfach weg.«
Marlowe legte die Stirn in Falten. »Ich meine es ernst. Ich würde es gern wissen.«
»Kann ich mir denken«, erwiderte ich sarkastisch, als Mircea den Scheck abriss. Marlowe leitete den Geheimdienst des Senats, und sicher wäre es ihm viel lieber gewesen, wenn sich seine tödliche kleine Truppe um Angelegenheiten wie Vleck gekümmert hätte. Aber in Kriegszeiten konnte er es sich nicht leisten, sie bei nicht unbedingt nötigen Missionen zu riskieren.
Der Konflikt zwischen dem Silbernen Kreis der hellen Magier und ihren dunklen Pendants dauerte schon seit einer ganzen Weile, und zur großen allgemeinen Verwirrung hatten sich die Vampire mit den Hellen verbündet. Aber es belastete ihre Manpower, und sie schienen größere Schwierigkeiten als ich zu haben, mit den Vlecks dieser Welt fertigzuwerden.
Von mir aus konnte es so bleiben. So viel Geld hatte ich seit Jahren nicht verdient.
»Jeder Vampir in dem Nachtclub wusste sofort vom Tod des Meisters, aber du bist einfach gegangen«, sagte Marlowe vorwurfsvoll. Offenbar wollte er das Thema nicht einfach so fallen lassen.
Ich machte ein unschuldiges Gesicht, was ihn ebenso zu ärgern schien wie mich sein verdammtes Lächeln. »Ja. Ich schätze, ich hatte Glück.«
»Du gehst jedes Mal einfach so weg!«
»Was bedeutet, dass ich richtig viel Glück habe«, sagte ich und versuchte, den Scheck entgegenzunehmen. Aber Mircea hielt ihn fest.
»Hast du in letzter Zeit Louis-Cesare gesehen?«
»Warum?«
Er seufzte. »Warum kannst du nie eine einfache Frage beantworten?«
»Weil du nie eine stellst. Und was hat der Liebling des Europäischen Senats mit mir zu tun?«
Louis-Cesare und ich hatten uns erst vor kurzer Zeit kennengelernt, obwohl wir dem gleichen zerrütteten Clan angehörten. Eigentlich war es keine große Überraschung, denn wir kamen aus verschiedenen Winkeln der Vampirwelt. Ich war die Dhampir-Tochter des Familienpatriarchen, der kaum bekannte Fleck auf dem ansonsten reinen Stammbaum. Vampire fürchteten und hassten Dhampire, aus offensichtlichen Gründen, und die meisten Familien, die plötzlich einen bekamen, begruben den Fehler schnell. Warum Mircea das nicht getan hatte, war mir noch immer ein Rätsel. Vielleicht hatte er sich dagegen entschieden, weil ich mich gelegentlich als nützlich erwies.
Louis-Cesare hingegen gehörte zum Vampiradel. Als einziges gemachtes Kind von Mirceas jüngerem und viel seltsamerem Bruder Radu hatte er fast von Geburt an Rekorde gebrochen. Sein Tod lag noch nicht einmal ein halbes Jahrhundert zurück, als er zum Meister geworden war, ein Rang, den die meisten Vampire nie erreichten. Das nächste Jahrhundert hob ihn auf die erste Stufe, und damit war er den Topspielern in der Welt der Vampire ebenbürtig. Ein weiteres Jahrzehnt machte ihn zum Liebling des Europäischen Senats, bewundert für sein Aussehen, seinen Reichtum und sein Geschick beim Duell, das ihm aus so mancher brenzligen Situation geholfen hatte.
Vor einem Monat hatten sich die Wege von Prinz und Paria gekreuzt, denn etwas verband uns: Wir verstanden uns beide gut aufs Töten. Und Mirceas absolut irrer und völlig durchgeknallter Bruder Vlad hatte dringend getötet werden müssen. Doch gleich zu Beginn unserer Zusammenarbeit gab es Schwierigkeiten, denn Louis-Cesare nahm nicht gern Befehle von einem Dhampir entgegen, und ich mochte es nicht, einen Partner zu haben. Aber schließlich rauften wir uns zusammen und erledigten den Auftrag. Wir lernten sogar, recht gut miteinander zurechtzukommen, und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass es eigentlich ganz nett war, jemanden zu haben, der mir den Rücken freihielt.
Manchmal konnte ich wirklich dämlich sein.
»Radu hat erwähnt, ihr beiden wärt euch recht … nahe gekommen«, sagte Mircea vorsichtig.
»Da hat sich Radu geirrt.«
»Du hast die Frage nicht beantwortet«, warf Marlowe ein. »Hattest du in den letzten Wochen Kontakt mit Louis-Cesare? Hast du ihn irgendwo gesehen?«
»Warum? Was hat er getan?«
»Nichts. Noch nicht.«
»Na schön. Was könnte er eurer Meinung nach tun? Was befürchtet ihr?«
Marlowe sah Mircea an, und zwischen ihnen kam es zu einem der stillen, wortlosen Gespräche, die Vampire manchmal miteinander führten und von denen ich nichts wissen sollte. »Ich möchte ihn nur in Hinsicht auf eine Familienangelegenheit befragen«, sagte Mircea nach einem Moment.
»Da du mich immer wieder daran erinnerst, dass ich zur Familie gehöre … Erzähl mir davon, dann kann ich dir vielleicht helfen. Oder funktioniert das mit der Familie nur, wenn du etwas brauchst?«
Mircea atmete tief durch, obwohl er gar nicht atmen musste – er wollte mir nur zeigen, was für eine Nervensäge ich war. »Es geht um seine Familie, Dorina, und ich kann nicht für ihn sprechen. Hast du ihn gesehen oder nicht?«
»Seit einem Monat habe ich nichts von ihm gehört«, sagte ich und hatte die Sache plötzlich satt. Ich brauchte keine zusätzliche Erinnerung daran, dass mein Status in der Familie immer zweitklassig sein würde.
»Wenn sich das ändern sollte, wüsste ich es sehr zu schätzen, von dir zu hören«, sagte Mircea.
»Und ich wüsste es zu schätzen, wenn ich meinen Scheck bekäme«, erwiderte ich. »Oder willst du ihn den ganzen Abend festhalten?«
Mircea hob eine Braue, ließ den Scheck aber nicht los. »Morgen habe ich vielleicht einen weiteren Auftrag für dich.« Er schob einen Aktendeckel über den Schreibtisch und achtete darauf, dass er dem Blut nicht zu nahe kam.
»Vielleicht?«
»Es muss noch darüber entschieden werden. Stehst du zur Verfügung?«
»Ich werde sehen, was ich tun kann.«
»Und noch etwas, Dorina … Wenn ich mich dazu entschließe, so möchte ich die betreffende Person in diesem Fall lebend.«
»Genügt die tragbare Größe?« Wenn ich nicht das Herz durchbohrte, konnte ein Vampir des Meisterniveaus auch in Stücken überleben, von einer Woche bis zu einem Monat – es hing vom Ausmaß seiner Macht ab. Außerdem war es viel leichter, einen Kopf in einer Tasche hinauszuschmuggeln als einen ganzen Körper. Es gab noch einen weiteren Pluspunkt: Die Enthauptung machte selbst den hartnäckigsten Vamp redselig.
»Das genügt«, sagte Mircea und richtete einen zynischen Blick auf Vleck. Der Mund des Ex-Vamps hatte sich geöffnet, und die Zunge hing heraus. Wenigstens sabberte er nicht, dachte ich und nahm den Scheck.
Wie sehr ich leicht verdientes Geld liebte!
2
Das graue Wetter, das wir in den letzten Tagen gehabt hatten, gab eine Zugabe, aber ich schaffte es nach Hause, bevor es zu regnen begann. Ich parkte meine neueste Klapperkiste – einen Camaro, der einmal blau gewesen war und jetzt eine Art geflecktes Grau zeigte – auf der überwucherten Zufahrt an der Seite des Hauses. Mein Schlüssel drehte sich im Schloss, als die ersten Regentropfen fielen.
Der bleigraue Himmel ließ das alte viktorianische Haus noch verfallener aussehen. Es war in den Achtzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts von einem ehemaligen Kapitän erbaut worden, damals, als Flatbush Brooklyns angesagter neuer Vorort gewesen war. Es stand noch immer auf einem recht großen Grundstück mit alten, ehrwürdigen Bäumen, doch die glorreichen Zeiten waren vorbei. Die Farbe bröckelte von den Wänden, die Veranda sackte durch, und den Pfefferkuchen-Verzierungen fehlten viele Stücke – das Haus wirkte dadurch wie ein greiser Mensch mit Zahnlücken. Aber es war mein Zuhause, und es freute sich, mich wiederzusehen.
Nach einem Moment breitete sich ein Prickeln des Willkommens in meinem Arm aus, und die Tür öffnete sich. Ich sprang über ein Loch im Boden, setzte in der Küche zwei Tüten ab und zündete eine altmodische Sturmlaterne an. Wenn die Schutzzauber mit voller Kraft liefen, drehte die Elektrizität durch. Größeren Geräten machte das nicht viel aus, aber ständig blinkendes Licht störte mich.
Ich nahm ein Bier aus dem Kühlschrank, lehnte mich an die Arbeitsplatte und ging die Post durch. Jemand hatte sie aufmerksamerweise auf dem Tisch liegen lassen, vielleicht deshalb, weil sie größtenteils aus Rechnungen bestand. Meine einstige Mitbewohnerin Claire hatte das Haus von ihrem Onkel geerbt und es meiner Obhut überlassen, als sie aufgebrochen war, um sich größeren und besseren Dingen zu widmen. Eins stand fest: Es brauchte jede Menge Obhut.
Ganz oben auf dieser Liste stand das Dach: Es musste erneuert werden. An der Decke meines Schlafzimmers gab es einen beunruhigenden Fleck, der mit der ungefähren Form von Rhode Island begonnen hatte, inzwischen aber eher wie North Carolina aussah. Noch ein paar Tage Regen, und es wurde Texas daraus. Und dann dauerte es bestimmt nicht mehr lange, bis mir die verwitterten alten Schindeln auf den Kopf fielen.
Ich legte die Rechnungen am üblichen Ort ab – im Brotkasten –, griff nach den Tüten und begann damit, das mitgenommene Essen auszupacken, als es direkt über dem Haus donnerte. Es klang nach einer explodierenden Granate und war so nahe, dass das Haus erbebte. Ich erstarrte und wagte kaum zu atmen.
O bitte, o bitte, flehte ich und lauschte angestrengt.
Für einen langen Moment hörte ich nichts, abgesehen vom grollenden Nachhall des Donners und dem Rauschen des Blutes in meinen Ohren. Dann kam ein dünnes, zittriges Heulen von oben und jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken.
Innerhalb weniger Sekunden schwoll das Heulen zu einem orchesterartigen Crescendo an. Ein Glas in der Küchenspüle zitterte und zersprang, zusammen mit dem, was von meinen Trommelfellen übrig war. Ich beugte mich vor, ließ den Kopf hängen und dachte daran, zu schluchzen.
In meinem recht langen Leben hatte ich Krieg, Hunger und Krankheit kennengelernt. Ich war eine starke Frau. Ich war eine Kriegerin. Aber mit so etwas hatte ich nie zuvor fertigwerden müssen. Es war das Geschrei meines Duergar. Offenbar hatte irgendetwas ihn gestört, das gerade eingedrungen war.
Ich verspürte den innigen Wunsch, etwas zu töten, aber es bot sich mir nichts an.
Ich nahm die Scherben des Glases und warf sie in den Müll. Das schreckliche Heulen, das alle Fenster im Haus bedrohte, verstummte erst für eine Sekunde und dann für zwei, und ich holte vorsichtig Luft – bevor das Kreischen erneut begann, mit noch mehr Elan. Ich stellte das Bier auf die Arbeitsplatte und ging zum Getränkeschrank, um mir einen Whiskey zu holen.
Ich verfluchte die anderen Bewohner des Hauses, die in meiner Abwesenheit alle Spirituosen entfernt hatten, als ich das leise Kratzen von Schritten im Flur hörte. Angesichts des Kreischens hätte es selbst mir unmöglich sein sollen, etwas anderes zu hören, aber irgendein verzweifelter Instinkt richtete meine Aufmerksamkeit darauf. Vielleicht lag es daran, dass das Geräusch so ungewöhnlich war.
In letzter Zeit trieben sich recht viele Geschöpfe im Haus herum – sie trampelten und stapften Tag und Nacht über die alten Dielen. Aber ich hatte gerade einen Schritt gehört, und geladene Gäste gab es nicht.
Ich spürte, wie sich meine Muskeln spannten und auf plötzliche, schnelle Bewegung vorbereiteten. Mein Atmen wurde schneller, und ein Schweißtropfen lief mir ins Auge. Vielleicht war es nur das Haus, das sich setzte, dachte ich und streckte die Hand nach einem Hackbeil aus. Dreh nicht gleich durch.
Dann wiederholte sich das leise Geräusch, zusammen mit einem quietschenden Protest von einer der alten Dielen im Flur. Meine Stimmung verbesserte sich. Vielleicht bekam ich doch noch etwas, das ich töten konnte.
Ich huschte zur Tür und ergriff den grünen, gläsernen Knauf, ohne ihn zu drehen. Normalerweise wurde die Küchentür offen gelassen, weil ihre Angeln laut quietschten. Aber jemand hatte sie geschlossen, und ich konnte sie nicht öffnen, ohne das Etwas dort draußen auf meine Präsenz hinzuweisen. Ich musste warten, bis der Besucher, wer oder was auch immer er war, noch etwas näher kam.
Ich rechnete damit, eine ganze Menge über ihn herauszufinden, auch ohne ihn zu sehen. Die Schwere des Schritts bot Hinweis auf das Gewicht, das Zischen des Atems auf die Größe. Ich konnte sogar Rückschlüsse auf das Geschlecht ziehen, wenn ich ein Duftwasser oder dergleichen roch. Doch als ich meine Sinne erweiterte und mit ihnen das Etwas im Flur berührte, kam der Kontakt einem Schock gleich.
Meine Hand zuckte vom Knauf zurück, aber ich fühlte es noch immer: eine Art elektrisches Prickeln, das mir durch den Arm floss. Es war nicht schmerzhaft, scharf oder heiß. Es fühlte sich an wie die sachte Berührung durch einen Finger aus Wasser, wie eine sanfte Liebkosung, die beruhigte und besänftigte.
Ich bekam eine Gänsehaut.
Ich wollte nicht beruhigt und besänftigt werden, wenn es im Haus eine Gefahr gab. Meine Wachsamkeit durfte nicht nachlassen. Doch ich spürte, wie sie sich aufzulösen begann, wie mein Herz langsamer schlug und ich ruhiger atmete, wie der Schweiß, der eben noch auf meiner Haut entstanden war, in der Nachtluft kühlte.
Noch bedenklicher erschien mir, dass das Haus nicht reagierte. Normalerweise gefiel es den Schutzzaubern sehr, scheußliche Dinge mit Eindringlingen anzustellen. Aber in der Küche blieb es halbdunkel und still; die einzige Bewegung stammte von der flackernden Flamme im Innern der Laterne.
Das Licht tanzte über einige Messer an der Wand, mehrere an Haken hängende verbeulte Kupflertöpfe und in der Ecke einen Besen mit dickem Stiel. Jeder dieser Gegenstände wäre eine nützliche Waffe gegen viele Wesen gewesen, aber wahrscheinlich nicht gegen etwas, das die Schutzzauber des Hauses überlistete. Was auch für die Gegenstände galt, die ich bei mir hatte.
Ich dachte daran, durch die Hintertür nach draußen zu schleichen, eine Spiderman-Nummer abzuziehen und zu meinem Zimmer hochzuklettern, wo ich einen Vorrat weitaus wirkungsvollerer Waffen hatte. Doch dann hörte das von oben kommende Heulen auf. Es wurde nicht allmählich leiser, sondern verschwand einfach, zwischen einem Atemzug und dem nächsten, als hätte sich eine Hand um einen kleinen Hals gelegt. Und plötzlich vergaß ich alles in Hinsicht auf subtile Taktik und Strategie. Ich riss die Tür auf und stürmte in den Flur, ein Messer erhoben und einen Kampfschrei auf den Lippen.
Einen Sekundenbruchteil später wurde ich an die Wand geschleudert, mit solcher Kraft, dass meine Rippen klapperten.
Sofort kam ich wieder auf die Beine, warf einen kleinen Tisch nach meinem Gegner und versuchte, etwas Zeit zu gewinnen, um festzustellen, gegen was ich eigentlich kämpfte. Für einen Moment sah ich große, leuchtende Augen mit horizontalen Pupillen wie bei einer Ziege, und dann kam eine Feuerkugel aus dem Nichts, verbrannte den Tisch zu Asche und schickte sich kräuselnde Schatten über die Wände. Ich sprang vor, suchte nach einer verwundbaren Stelle, doch ein riesiger Krallenfuß, von glänzenden Schuppen bedeckt, schmetterte mit der Wucht eines Presslufthammers auf mich herab.
Ich prallte mit dem Rücken auf den Boden und stellte fest, dass mein Hals zwischen zwei Klauen in der Größe von Dolchen eingeklemmt war. Mein Messer steckte in der großen Tatze, aber ich bezweifelte, ob es für das riesige Geschöpf mehr bedeutete als einen winzigen Dornenstich. Zwei oder drei der sich überlappenden Schuppen hielten mich am Boden fest. Ich trat und versuchte, meine Waffe aus der Tatze zu ziehen, schaffte es aber nur, das Messer noch etwas tiefer in die dicke Haut zu schieben.
Und irgendwo über meinem Kopf fluchte das Wesen und rief: »Hör auf damit!«
Die Stimme klang menschlich und ließ mich innehalten, aber ich konnte noch immer nicht viel sehen. Plötzlich kam eine dünne Flamme aus der Dunkelheit und zündete einige Kerzen an der Wand an, alle auf einmal. Es war ein guter Trick, doch meine besondere Situation hinderte mich daran, ihn gebührend zu bewundern. Ich war zu sehr damit beschäftigt, zu dem Drachen emporzustarren, der im schmalen Flur eingezwängt war.
Sehr bequem schien er es nicht zu haben. Die kleinen schwarzen Flügel waren an die Decke gepresst, die großen Beine reichten bis zum Hals, und die längliche Schnauze ragte zwischen ihnen hervor. Das einzige Körperteil, das der Drache bewegen konnte, war die Tatze, und aus ihr quoll dunkles Blut.
»Das tut verdammt weh!« Das Ungetüm neigte seinen großen Kopf nach unten, um sich den Schaden aus der Nähe anzusehen.
Ich gaffte.
Ein ganzer Hektar zinngrauer Schuppen erstreckte sich vor und über mir, am Rücken unterbrochen von einem Höcker aus glitzernden Amethysten. Zwei Hörner in der Farbe von geschmolzenem Glas ragten aus dem Kopf, umgeben von einem Schopf aus absurd wirkendem lavendelblauem Haar. Die Farbe passte zu den Augen, die kaum gespenstischer sein konnten, trotz oder vielleicht gerade wegen der Pupillen, die aussahen wie die Blütenblätter von Stiefmütterchen.
Eine Membran schob sich erst über das eine Auge und dann das andere, als der Drache seinen verletzten Fuß betrachtete. Nach einem Moment richtete er den Blick seiner sonderbaren Augen auf mich, und die Schuppenkringel seiner Wangen gewannen eine leicht violette Tönung. »Du hast mich mit einem Messer gestochen!«
»Du bist hier eingebrochen«, sagte ich langsam und konnte es kaum fassen. Ich hatte in Brooklyn viele seltsame Dinge gesehen, aber ein Drache zählte nicht zu ihnen.
»Von einem Einbruch kann keine Rede sein!« Das Geschöpf verzog das Gesicht, wodurch sich die lange Schnauze öffnete und ziemlich viele Zähne sichtbar wurden. Doch die Stimme war melodisch, fast hypnotisch, wie eine Droge, die in meinem Blut langsam ihre Wirkung entfaltete. Sie verlangsamte meinen Puls auf ein normales Niveau, obwohl ich mich dagegen sträubte. Ich brauchte die Energie des Zorns für den Kampf, doch plötzlich dachte mein Körper daran, ein Nickerchen zu machen, und meine Muskeln erschlafften.
»Normalerweise streite ich nicht mit jemandem, der mich zerquetschen kann«, sagte ich und unterdrückte ein Gähnen. »Aber ich muss dir widersprechen: Du bist ganz klar eingebrochen.«
»Es ist mein Haus!« Ein Hautlappen, der bisher flach am Rücken des Wesens gelegen hatte, breitete sich wie ein durchsichtiger Fächer aus und neigte sich der Schnauze entgegen. »Worauf wartest du?«, fragte das Geschöpf. »Zieh es raus!«
Ich vermutete, dass mit »es« das Messer gemeint war, und deshalb zog ich wieder daran. »Es würde helfen, wenn du mich aufstehen lässt«, sagte ich nach einer Weile.
»Hast du vor, noch andere Dinge nach mir zu werfen?«
»Hast du vor, mich zu fressen?«
Die Augen wiederholten das seltsame seitliche Blinzeln. Ich begann mich zu fragen, ob es das Drachen-Äquivalent eines Augenrollens war. »Mach dich nicht lächerlich, Dory! Du weißt genau, dass ich Vegetarierin bin.«
Die Tatze kam nach oben, und ich glitt zwischen den riesigen Zehennägeln hervor. Sie waren schwarz an der Wurzel, wurden dann grau und am Ende so durchsichtig wie die Hörner. An einigen Stellen zeigten sich rote Flecken, die verdächtig wie Nagellack aussahen. Als ich sie bemerkte, schob ich alle Gedanken beiseite.
Schließlich löste sich das Messer aus der Tatze. Als die Klinge ganz aus der ledrigen Haut kam, drang auf einmal blauweißes Licht zwischen den Schuppen hervor, als platzte der Körper an Verwerfungslinien. Und dann traf mich eine Explosion aus Licht wie eine Faust und warf mich ein oder zwei Meter zurück. Ich stieß an die verblichene Tapete, woraufhin ein Spiegel wackelte und fiel. Er zersplitterte auf dem Boden, und oben begann erneut das Heulen.
»Meine Güte, ich brauche einen Drink«, sagte jemand mit Nachdruck.
Die Worte hätten von mir stammen können.
Ich setzte mich auf, als dieser Jemand die Küche betrat und geradewegs zum Getränkeschrank ging. Auf Händen und Knien sah ich um die Ecke und bemerkte im Laternenlicht eine nackte Rothaarige, die enttäuscht in den leeren Schrank sah. »Sag bloß nicht, dass du Abstinenzlerin geworden bist!«
»Nein«, erwiderte ich vorsichtig und musterte die neue Gestalt.
Sie sah wie meine frühere Mitbewohnerin Claire aus. Die Illusion war perfekt, bis hin zu den winzigen Details, die Verwandlungszauber normalerweise übersahen. Das Haar des Wesens bildete eine rote Flaumkugel, was typisch war für Claire, wenn’s regnete. Über der Nase zeigte sich ein vertrautes Sommersprossenmuster, und in oft zur Schau gestelltem Ärger waren die Arme unter den Brüsten verschränkt.
Aber es gab auch störende, unpassende Elemente. Diese Claire hatte dunkle Ringe unter den Augen und einen unsteten, schnell hin und her wandernden Blick. Hinzu kam eine auffallende Blässe unter den Sommersprossen. Die Lippen waren zusammengepresst und blutleer, und sie erweckte den Eindruck, schon seit einer ganzen Weile nicht mehr geschlafen zu haben. Ihre Nerven schienen recht blank zu liegen.
Aber den Ausschlag gab: Claire würde niemals mitten in der Nacht ohne Begleitung, barfuß – vom Rest des Körpers ganz zu schweigen – und mit irrem Blick erscheinen. Als wir uns kennengelernt hatten, war sie in einem magischen Auktionshaus tätig gewesen, ein sehr schlecht bezahlter Job, der dazu führte, dass sie meine Miete gut gebrauchen konnte. Aber dann war ein waschechter Elfenprinz bei einer der Auktionen erschienen, hatte ihr Herz im Sturm erobert und sie ins Feenland gebracht. Dort war sie bis heute geblieben und führte vermutlich das glückliche Wenn-sie-nicht-gestorben-sind-Leben, von dem wir anderen träumten.
»Es ist ein verdammt guter Glamourzauber«, sagte ich und fragte mich, wie man einen Drachen, wenn auch in menschlicher Gestalt, aus der eigenen Küche entfernte. »Aber zum späteren Nachschlagen: Claire hatte nicht die Angewohnheit, nackt herumzulaufen, nicht einmal in ihrem Haus.«
»Ich hatte was an!«, erwiderte das Geschöpf und zog eine Schürze aus einer Schublade. Sie gehörte zur altmodischen Art, die fast einem Kleid gleichkam und sie anständig aussehen ließ, solange sie sich nicht umdrehte. »Aber ich verliere die Kleidung bei jeder Verwandlung. Mein Drachenselbst ist in die Pubertät gekommen und wächst wie verrückt.«
Ich sah von der Schublade mit den Schürzen – ich wusste gar nicht, dass wir welche hatten – zu der Frau, die jetzt eine davon trug. »Dein Drachenselbst?«
Mit dem Handrücken strich sie sich rote Strähnen aus der Stirn. »Ich bin eine halbe Dunkelelfin, Dory. Das weißt du doch!«
»Ja, aber … Du hast nie gesagt, was für eine Art von Dunkelelfin!«
»Bis vor Kurzem wusste ich es gar nicht, und außerdem ist es nicht unbedingt etwas, über das man gern redet.« In einer anderen Schublade entdeckte die Frau mit der Schürze eine Schachtel Aspirin und blickte kurzsichtig darauf hinab. Diese hübschen grünen Augen waren immer kurzsichtig gewesen, und ich schätzte, als Drache fiel einem das Tragen von Brillen schwer.
Ich stand langsam auf und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. »Claire?«
»Wen hast du erwartet?«, erwiderte sie. »Attila, den Hunnen?«
Ihr Blick richtete sich auf das Messer, das ich noch immer in der Hand hielt und von dem Blut, nichtmenschlich schwarz, auf die Fliesen des Küchenbodens tropfte. Drachenblut war korrosiv, was vermutlich erklärte, warum die halbe Klinge fehlte und die Fliesen wie von Mäusen angeknabbert aussahen. Ich ging zur Spüle, wusch die Reste des Messers ab und hängte es zu den anderen an der Wand.
Das schien die Rothaarige zu beruhigen, denn sie zog etwas hinter ihren Beinen hervor und setzte es auf einen Küchenstuhl. Es musste im Flur hinter ihr gewesen sein, denn ich sah es jetzt zum ersten Mal. Langsam näherte ich mich dem Tisch und betrachtete das neue Problem.
Das kleine flachsköpfige Geschöpf schien menschlich zu sein. Er – ich nahm an, dass es ein Knabe war, wegen der schicken, tunikaartigen blauen Kleidung, die er trug – schien etwa ein Jahr alt zu sein. Dennoch erwiderte er meinen Blick mit ruhiger Gelassenheit und wirkte erstaunlich gefasst, wenn man bedachte, was gerade geschehen war.
»Was ist das?«, fragte ich, als er ein bisschen Speichel auf seinen hübschen blauen Dress sabberte.
Claire schluckte eine Aspirin, ohne nachzuspülen. »Der Erbe des Throns im Feenland.«
»Der Erbe des Feenlandthrons hat gerade gesabbert.«
»Das macht er oft. Weil er Zähne kriegt.«
Ich blinzelte. »Er kriegt Zähne und spuckt?«
»Was hast du erwartet?«
Ich winkte mit beiden Armen. »Das!«
»Du meinst dieses Geräusch?«
»Ja! Das schreckliche Kreischen, das einfach kein Ende nimmt und …«
»Es stammt von einem Baby?«
»Von einem kleinen Duergar. Beziehungsweise von einem halben kleinen Duergar«, sagte ich. »Die andere Hälfte ist ein Brownie. Angeblich. Inzwischen vermute ich, dass es mehr ein Banshee sein dürfte.«
»Du meinst das kleine Ding, das du bei der Auktion an dich genommen hast?« Die Frau fand eine Schachtel mit Heftpflastern und klebte sich eins auf den Zeh.
Na schön, dass sie wusste, wo die Schürzen und der andere Kram lagen … Vielleicht war es einfach nur Dusel gewesen. Aber es gab nicht viele Leute, die Kenntnis davon hatten, woher der Duergar stammte. Die magische Auktion war ausgesprochen illegal und sehr geheim gewesen. Kein Wunder, immerhin waren verbotene Kreuzungen übernatürlicher Geschöpfe versteigert worden, einige von ihnen sehr gefährlich. Ich hatte überhaupt nichts davon geahnt, bis ich mitten hineingeplatzt war.
So seltsam es auch sein mochte, das war tatsächlich Claire.
»Ja«, antwortete ich, den Kopf voller Fragen. Über einen Monat hatte ich sie nicht gesehen. Seit ihrem Verschwinden schien sie einige neue Fähigkeiten entwickelt zu haben.
»Aber der Duergar hatte doch schon Zähne«, wandte Claire ein und sah mit gerunzelter Stirn in den leeren Kühlschrank.
»Das waren seine Milchzähne. Ich hab sie überall im Haus gefunden. Jetzt wachsen ihm die richtigen Zähne, und … Claire, ich glaube, ich werde verrückt.«
»Du wirst nicht verrückt.«
»Eben habe ich dich als Drachen gesehen!«
»Du hättest mich nicht erschrecken sollen!« Sie öffnete den Brotkasten und starrte auf die vielen Rechnungen darin. »Hast du nichts zu essen im Haus?«
»Ich hab was mitgebracht.«
Claires Blick ging zu den beiden großen Tüten, die den Duft von Sesamhähnchen, Gemüse-Chow-mein und gebratenem Reis verströmten. »Das scheint genug für drei zu sein«, sagte sie hoffnungsvoll.
»Ja. Aber wer weiß, wann wir dazu kommen, den ganzen Kram zu essen, bei diesem Lärm.«
Claire kniff die Augen zusammen, und für einen Moment hatte sie große Ähnlichkeit mit ihrem Alter Ego. »Wo ist dein Baby?«
Ich lächelte.
3
Ich ging nach oben, und Claire folgte mir mit ihrem eigenen stillen, braven Bündel. Die Lautstärke nahm mit jedem Schritt zu, bis ich befürchtete, das Kreischen könnte Risse in die Wände reißen. Wir öffneten die Tür meines alten Arbeitszimmers, und selbst Claire, die bisher erstaunlich gefasst gewesen war, schnitt eine Grimasse.
Dann trat sie ein, und das Heulen hörte sofort auf. Ein kleiner, haariger Kopf erschien in einem Nest aus Decken unterm Bett und sah sie aus großen grauen Augen an. Ihr Eigentümer wirkte wie eine Mischung aus Affe und kleinem alten Mann: lange, pelzige Gliedmaßen, ein kleines, wie zerdrücktes Gesicht und wildes Muppet-Haar.
Die Tränen an den Wimpern schienen den Mondschein einzufangen, der durch eine Lücke zwischen den Vorhängen kam und seine Pupillen für ein oder zwei Sekunden wie poliertes Metall glänzen ließ. Dann blinzelte er, und die Tränen lösten sich von den Wimpern, rannen über die Wangen … und das Kreischen ging erneut los. Bis Claire mit ruhigen Schritten zu ihm ging und ihn hochhob.
Der Duergar öffnete den Mund zu einem weiteren Schrei und klappte ihn wieder zu. Eine kleine Hand mit langen, dünnen Fingern griff nach dem Schürzenträger, und er richtete einen flehentlichen Blick auf Claire, als hätte ich ihn geschlagen oder so. »Warum liegt er unterm Bett?«, fragte sie.
»Weil es ihm da unten gefällt«, verteidigte ich mich. »Duergars leben unterirdisch, und vermutlich fühlt er sich ungeschützt, wenn er im Freien und Offenen schläft. Ich habe versucht, ihn ins Bett zu legen, aber er zieht immer wieder alles dort unten hin.«
Claire schien nicht viel von dieser Erklärung zu halten, ließ es aber dabei bewenden. »Was gibst du ihm gegen die Schmerzen?«
»Alles. Aber er ist wie ich: Arzneien wirken nicht, und Whiskey dämpfte den Schmerz nur für kurze Zeit …«
»Whiskey?« Claire sah mich entsetzt an. »Soll das etwa heißen, dass du versuchst hast, dein Baby betrunken zu machen?«
»Ich hab ihm ein bisschen was aufs Zahnfleisch gestrichen!«, erwiderte ich beleidigt. »Er war es, der nach der Flasche gegriffen hat!«
»Er ist doch nur ein Baby, armer kleiner Kerl!«
»Ich weiß«, sagte ich kummervoll. »Und der Alkohol nützte ohnehin kaum etwas …«
»Dory!«
»Ich kann mir denken, was dir jetzt durch den Kopf geht. Mit dem Muttersein komme ich einfach nicht klar!« Es half nicht, dass Stinky für mich kein Baby gewesen war, als ich ihn zu mir genommen hatte. Jemand hatte ihn töten wollen, ich hatte etwas dagegen gehabt, und dann war der kleine Kerl plötzlich bei mir gewesen.
Zu jenem Zeitpunkt hatte ich mir darüber kaum Gedanken gemacht, weil er für mich mehr in die Kategorie »Haustier« gefallen war. Doch die Erfahrung lehrte mich, dass Intelligenz in dem Pelzbündel wohnte. Wie viel Intelligenz, daran wagte ich nicht zu denken, weil es mich zu sehr erschreckte.
»Unsinn«, widersprach Claire. »Du hast ihm das Leben gerettet und ihm ein Zuhause gegeben. Du brauchst nur etwas Zeit, dich an die neue Situation zu gewöhnen, das ist alles.«
»Ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalte.«
Claire lächelte. »Zuerst denken das alle. Da sind diese kleinen Leute, die uns mit großen, vertrauensvollen Augen ansehen, in der absoluten Überzeugung, dass wir alles wissen, obwohl wir meistens überhaupt keine Ahnung haben.«
Ja, genau das beunruhigte mich. Ich hatte mich selbst großgezogen, mehr oder weniger, aber man siehe nur, was daraus geworden war. Ich wollte nicht auch den Duergar ruinieren, doch es schien keine Alternative zu geben.
Es existierten nur sehr wenige Dhampire, da es nach der Verwandlung eines Mannes nur ein sehr schmales Zeitfenster für unsere Erschaffung gab. Und was auch immer Filme behaupteten: Leute, die gerade zu Vampiren geworden waren, dachten nicht an Sex, sondern an Blut.
Bei Mircea hatte die Sache etwas anders ausgesehen, da er verflucht und nicht verwandelt worden war. Er hatte nicht sofort begriffen, dass hinter der Schimpfkanonade jener alten Zigeunerin mehr steckte als nur leere Worte – bis nach einer Woche einige Adlige versuchten, ihn zu töten, und er nicht starb. Im Verlauf besagter Woche hatte er weiterhin den Playboy gespielt, mit dem Ergebnis, dass neun Monate später ein monströses Kind zur Welt gekommen war.
Ich konnte an zwei Händen die derzeit lebenden Dhampire zählen, und dabei brauchte ich nicht einmal alle Finger. Aber soweit ich wusste gab es keine anderen Duergar-Brownie-Mischlinge. Stinky bildete eine eigene Kategorie, und ich wusste aus persönlicher Erfahrung, worauf das für ihn hinauslaufen würde.
Auf nichts Gutes.
Claire klopfte mir auf die Schulter. »Hast du wenigstens einen Babysitter?«
Ich nickte der kleinen, in der Ecke zusammengekauerten Gestalt zu, die versuchte, sich hinter dem Schaukelstuhl zu verbergen. »Schon gut, Gessa. Du kannst gehen.«
Zwei kleine braune Augen schauten kurzsichtig unter einem Vorhang aus braunen Locken hervor. Dann sprang die Besitzerin zu ihrer vollen Größe von knapp einem Meter auf und flitzte durch die Tür. Eine Extraeinladung brauchte sie nie.
»Zuerst hat sich Olga um den Duergar gekümmert«, sagte ich und meinte damit die überaus tüchtige Sekretärin, die ich seit kurzer Zeit hatte. »Aber sie versucht, ihr Geschäft wieder in Gang zu bringen, und deshalb kann sie nicht die ganze Nacht bleiben. Und die Trittbrettfahrer unten zerstreuen sich in alle vier Winde, wenn ich sie auch nur …«
»Welche Trittbrettfahrer?«
Ups. »Oh, nun, als sie davon hörten, dass Olga hierhergekommen war, beschlossen einige ihrer alten Angestellten, ihrem Beispiel zu folgen. Und da es auch Verwandte sind, brachte es Olga nicht fertig, Nein zu sagen …«
»Willst du damit andeuten, dass eine Schar Trolle im Keller wohnt?«
»Ich hätte es dir vielleicht etwas schonender beibringen sollen.«
»Es erklärt wenigstens den Geruch.«
»Das ist Stinky«, sagte ich. »Er fühlt sich verpflichtet, seinem Namen gerecht zu werden.«
»Vielleicht solltest du ihm einen besseren geben!«
»Ich hab’s versucht. Es gibt keine Brownie-Kolonien in der Nähe, aber ich habe einige Duergars gefunden, die drüben in Queens wohnen. Sie meinten, ich hätte ihm einen durchaus passenden Namen gegeben!«
»Er ist ein Mischling«, sagte Claire traurig und strich ihm mit den Fingern durchs Haar. »Wahrscheinlich mochten sie ihn nicht.«
»Die Duergars wiesen mich darauf hin, dass die Angehörigen ihres Volkes sich den eigenen Namen verdienen müssen. Vorher wird nur eine Art Spitzname verwendet.«
»Wie verdienen?«
»Das haben sie nicht gesagt. Offenbar müssen die Ältesten den Namen verleihen, und du kannst dir vielleicht vorstellen, was Stinky zu erwarten hätte. Wenn er älter wird, lasse ich ihn selbst entscheiden, wie er genannt werden möchte.« Ich öffnete das Fenster und ließ die abendliche Brise herein. »Außerdem ist es gar nicht so schlimm, wenn man …«
Ich unterbrach mich. Zum zweiten Mal an diesem Abend sah ich etwas, das mich an meinem gesunden Verstand zweifeln ließ. Noch mehr als sonst, meine ich.
Die Bäume auf dem Grundstück waren alt, und der älteste von ihnen wuchs vor dem Fenster: eine große Pappel, die schon mehr als ein Schössling gewesen sein musste, als das Haus erbaut worden war. Ihre tränenförmigen Blätter tanzten, als der Wind an der Seite des Hauses entlangstrich, und dadurch entstand ein raschelndes, sich ständig veränderndes Kaleidoskop aus Dunkelgrün, Silber und Rabenschwarz. In dem Nebeneinander aus Licht und Schatten sah ich für einen Moment …
»Dory.« Claire berührte mich an der Schulter, und ich zuckte zusammen. Falten entstanden in ihrer Stirn. »Was ist los?«
»Hast du … etwas … in dem Baum gesehen?«, fragte ich und versuchte, ruhig zu sprechen.
Claire spähte nach draußen. »Was? Meinst du das Eichhörnchennest?«
Ich schluckte. »Ich brauche einen Drink.«
»Meine Worte.« Claire seufzte. »Gibt es denn überhaupt keinen Alkohol in diesem Haus?«
»Vielleicht kann ich welchen auftreiben.«
»Wundervoll. Lass uns auf der Veranda Platz nehmen. Ich brauche frische Luft.«
Claire ging in ihr altes Zimmer, um sich anzuziehen, und ich holte zwei Gläser aus der Küche. Ich zog gerade die Falltür im Flur hoch, unter der das gute Zeug lagerte, als Claire die Treppe herunterkam. Sie trug ein grünes Wickel-Shirt, das zu ihren Augen und der alten Jeans passte, und an jeder Hüfte hatte sie ein artiges Kind.
»Ich weiß nicht, wie lange wir draußen bleiben können. Es sieht nach einem Gewitter aus«, sagte sie, bevor sie meinen Gesichtsausdruck bemerkte. »Was ist?«
»Du hast es geschafft, Stinky anzuziehen?« Das pelzige Bündel an ihrer linken Hüfte trug hellblaue Laufshorts, als sei das überhaupt keine große Sache. Bei meinem letzten Versuch, ihn mit Kleidung vertraut zu machen, hatte sich Olga praktisch auf ihn setzen müssen.
»Er hat es selbst gemacht.«
Ich warf ihm einen bösen Blick zu. Jetzt versuchte er, mich schlecht dastehen zu lassen.
Ich nahm zwei Flaschen aus dem Fach, schloss die Falltür und zog den Läufer darüber.
»Ich wusste gar nicht, dass wir hier ein Schmugglerloch haben«, sagte Claire und folgte mir durch den Flur.
»Es gibt hier überall Geheimfächer. Ich schätze, dein Großvater hat sie benutzt, um Dinge zu verstecken.«
Claires verstorbener Onkel Pip war ein Schmuggler gewesen, und noch dazu ein sehr erfolgreicher. Er hatte das Haus nach dem Tod des Kapitäns gekauft und schnell begriffen, damit das große Los gezogen zu haben. Zwei Ley-Linien – Energieströme, die dort entstanden, wo sich Welten auf einem metaphysischen Niveau berührten – verliefen direkt unter dem Fundament. Das Ergebnis war eine sogenannte Ley-Linien-Senke, die ungeheure Mengen magischer Kraft produzierte.
Es war das Äquivalent von lebenslangem Gratis-Strom. Aber Pip hatte die Energie nicht für Lampen und Kühlschränke verwendet, sondern für Schutzzauber und Portale, darunter ein durch und durch illegales Portal zum Feenland. Es erlaubte ihm, das streng regulierte – und mit hohen Steuern belegte – Interwelt-Handelssystem zu umgehen. Und dabei war es ihm nicht nur um den alten Handel gegangen. Onkel Pip war aufs Ganze gegangen und hatte mit einer sehr gefährlichen Substanz Geschäfte gemacht: mit Elfenwein.
Die Polizei der magischen Welt erwischte ihn nicht, weil er keins der offiziellen Portale benutzte. Die Elfen schenkten ihm keine Beachtung, weil er den Wein nicht direkt erwarb, sondern nur die Ingredienzien, wahrscheinlich aus vielen unterschiedlichen Quellen. Als er sie alle beschafft hatte, richtete er in seinem Keller eine Brennerei ein und begann mit einer Magie der ganz besonderen Art.
»Aber warum brauchst du ein Geheimfach?«, fragte Claire. »In den Schränken ist genug Platz.«
Ich sah über die Schulter. »Hast du jemals trinkende Trolle gesehen?«
Sie lachte und sah plötzlich ganz wie die echte Claire aus, nicht wie diese mir immer noch seltsam erscheinende Fremde. »Sie erscheinen nicht besonders oft am Hofe!«
»Wenn sie dort jemals auftauchen, solltest du besser alles Alkoholische verstecken.« Mit der Hüfte stieß ich die Hintertür auf und trat nach draußen. Das Zirpen von Grillen und der Geruch von bevorstehendem Regen erwarteten mich.
Ich blieb stehen und sah argwöhnisch über den Hof, denn normalerweise neigte ich nicht zu Halluzinationen. Doch das einzige Außergewöhnliche war das Wetter. An dem Teil des Himmels, der über den Bäumen am rechten und hinteren Rand des Hofes zu sehen war, hingen dunkle, unheilvoll wirkende Wolken, in denen es zu glühen schien. Und über dem Sichtschutzzaun des Nachbarn auf der linken Seite zeigte sich ein grauer Regenschleier über dem Horizont und wogte wie ein Vorhang im Wind.
»Was ist das?« Claire starrte mit mir in die Dunkelheit. Rote Locken umwehten ihr Gesicht und strichen über die Gläser der Brille, die sie irgendwo aufgetrieben hatte.
»Du brauchst noch immer eine Brille, obwohl du …« Ich machte eine Geste, die der ganzen Sache im Flur galt.
Claire wandte sich ein wenig zur Seite, und in ihrem Gesicht erschien ein Hauch von Unbehagen. »Ja. Zumindest in dieser Gestalt. Mein anderes Selbst … Nun, es sieht besser in der Nacht.«
Plötzlich sah ich ebenfalls besser, was mir aber nicht sonderlich viel half. Ich beugte mich über das Geländer der Veranda und blickte ins Geäst der großen Pappel. Einige lange Zweige ragten über die Veranda hinweg, aber ich sah nur raschelnde Blätter. Ich konzentrierte mich auf das empfindlichere periphere Sehen und hielt nach Veränderungen im Licht Ausschau, nach Bewegungen abgesehen von denen der Blätter. Aber das Ergebnis war das gleiche: nichts.
»Wonach suchst du?«, fragte Claire erneut und mit etwas mehr Nachdruck.
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Wir können ins Haus zurückkehren, wenn du glaubst, es gäbe ein Problem.«
»Die Zauber schützen die Veranda ebenso wie das Haus. Drinnen ist es nicht sicherer.«
»Es ist nirgends sicherer«, erwiderte Claire bitter.
»Vorsichtig. Du fängst an, wie ich zu klingen.« Ich zögerte und lauschte, aber auch meine Ohren ließen mich im Stich. Ich hörte, wie der Wind an der Plane zerrte, mit der wir das Loch im Dach abgedeckt hatten. Ich hörte das Quietschen der Wetterfahne und das Knarren der Ketten, an denen die Schaukel auf der Veranda hing. Aber sonst hörte ich nichts.
Claire schlang die Arme um sich. »Manchmal machst du mir Angst.«
»Das sagt die Frau, die mich eben zu Tode erschreckt hat.«
»Ich meine nicht, dass ich Angst vor dir bekomme«, sagte Claire ungeduldig. »Ich habe Angst um dich. Du siehst aus, als wolltest du es allein mit einer ganzen Armee aufnehmen.«
»Erwartest du eine?«
»Noch nicht«, murmelte sie.
»Na, das ist doch was.« Ich beschloss, die Schutzzauber ihrer Arbeit zu überlassen, konzentrierte mich dann darauf, die Veranda in einen zivilisierten Ort zu verwandeln.
Bei ihrer Ausstattung war mehr an Komfort als an Stil gedacht worden. Links befand sich eine alte Hollywoodschaukel mit abblätternder weißer Farbe und rostigen Ketten. Auf der rechten Seite stand ein kleines Sofa, das Claire aus ihrer alten Wohnung mitgebracht hatte – das Haus duldete es nicht in seinem Innern. Neben der Tür schmiegte sich eine Blumentopfbank an die Wand.
Ich stellte Flaschen und Gläser auf die Bank und kehrte ins Haus zurück, um die Tüten mit dem Essen zu holen. Als ich wieder nach draußen trat, sah ich, wie Claire mit gerunzelter Stirn auf eine kleine blaue Flasche und die Jungen herabsah, die ein von meinen Mitbewohnern zurückgelassenes Schachbrett entdeckt hatten. Sie lagen unweit der Treppe auf dem Bauch und beobachteten mit großem Interesse, wie die Schachfiguren gegeneinander kämpften.
Das Spiel gehörte Olga, und die Figuren darauf waren Trolle auf der einen Seite und Oger auf der anderen, alle mit Miniaturwaffen ausgestattet: Schwerter, Äxte und etwas, das nach einem kleinen Katapult aussah, halb verborgen hinter einigen Bäumen. Das Spiel fand auf einem komplexen Brett statt, das Wälder, Höhlen und Wasserfälle aufwies, und es hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit menschlichem Schach, soweit ich das bisher feststellen konnte. Olga behauptete, dass ich das bloß sagte, weil ich immer verlor.
»Ich könnte uns Tee kochen«, bot sich Claire an, als ich die Tüten auf die improvisierte Theke setzte. »Ich hab welchen im Schrank gesehen.«
»Ich mag keinen Tee.«
»Aber du magst das hier?« Sie hob die rundliche Flasche mit dem Gebräu ihres Onkels.
»Ich mag einige der Dinge, die es mit mir anstellt«, entgegnete ich, nahm ihr die Flasche aus der Hand und schenkte mir ein.
»Ich dachte, du gehörst zu einer Gruppe, deren Aufgabe darin besteht, dieses Zeug von den Straßen fernzuhalten«, sagte Claire vorwurfsvoll.
Ich lächelte. »Ich bin sehr bestrebt, nichts davon auf die Straße geraten zu lassen, das versichere ich dir.«
»Es war bestimmt nicht vorgesehen, dass du das Zeug für dich hortest. Es ist verboten, weil es die Leute verrückt macht, Dory!«
»Und es bringt diejenigen von uns, die bereits verrückt sind, ein wenig der Vernunft näher.«
Claire blinzelte. »Wie bitte?«
Ich hob das Glas. Der kristallklare Inhalt reflektierte das Licht vom Flur, schickte Strahlen über die Veranda und veranlasste Stinky, sich die Augen zuzuhalten. »Dies ist das beste Gegenmittel für meine Anfälle, das ich je gefunden habe.«
Einer der Spaßfaktoren meines Lebens bestand aus von Wutanfällen bewirkten Ausrastern. Diese Blackouts konnten nur wenige Minuten oder auch einige Tage dauern, aber das Ergebnis war immer gleich: Blut, Zerstörung und meistens ziemlich viele Leichen. So etwas galt für meine Art als normal – das Resultat der Verbindung eines menschlichen Stoffwechsels mit dem Tötungsinstinkt eines Vampirs –, und es war einer der Gründe, warum es nur so wenige von uns gab. Da es sich um ein genetisches Problem handelte, existierte kein Heilmittel.
Nicht dass man lange und gründlich danach gesucht hätte. Wie die meisten Arzneimittelhersteller machten die auf Heilung spezialisierten magischen Familien gern Gewinn. Und mit etwas, das nur einer Handvoll Personen half, ließ sich kaum Geld verdienen.
Claire starrte auf mein Glas, und ihre Augen wurden groß. »Das hilft dir bei deinen Anfällen?«
»Es verhindert sie. Und im Gegensatz zu menschlichen Mitteln funktioniert’s jedes Mal.«
Claire nahm die Flasche, schnupperte versuchsweise daran und verzog das Gesicht. »Es ist noch schlimmer als in meiner Erinnerung.«
»Das Zeug hat’s in sich«, sagte ich, als Claires Augen zu tränen begannen. Man konnte es als Farbverdünner verwenden, was der Grund sein mochte, warum es normalerweise Teil von Mixgetränken war. Aber ich trank es nicht wegen des Geschmacks.
»Es ist nicht einmal richtiger Wein«, sagte Claire und setzte sich. »Es ist ein Destillat Dutzender von Kräutern, Beeren und Blumen, von denen die meisten nie wissenschaftlich untersucht wurden. Und die Vorstellung von dir als Versuchskaninchen gefällt mir nicht.«
»Habe ich mich nicht freiwillig gemeldet?« Claire stammte aus einer der ältesten magischen Familien auf der Erde, einem auf die Heilkünste spezialisierten Haus. Sie hatte nur deshalb bei den Auktionen gearbeitet, weil es zu einem Streit über ihr Erbe gekommen war – sie hatte vor ihrem habgierigen Cousin fliehen müssen. Vorher waren Forschungen ihr Spezialgebiet gewesen, und in letzter Zeit hatte sie mit Elfenpflanzen experimentiert, in der Hoffnung, etwas zu entdecken, das mir helfen konnte.
»Das ist etwas anderes! Ich kenne alle Zutaten der Dinge, die ich dir geschickt habe. Sie waren sicher …«
»Und wirkungslos.«
Sie runzelte die Stirn. »Wer weiß, was da drin ist? Ich habe keine Ahnung, welche Ingredienzien Onkel Pip verwendete. Die Rezepte unterscheiden sich stark von Familie zu Familie; deshalb gibt es so viele unterschiedliche Arten von dem Zeug. Und Pip hat keine Notizen hinterlassen.«
»Gott sei’s geklagt.«
»Du verstehst nicht, Dory. Solche Drogen – und das hier verdient es zweifellos, ›Droge‹ genannt zu werden – haben eine kumulative Wirkung. Selbst bei den Elfen kommt es im Lauf der Zeit zu geringen Nebenwirkungen …«
Ich lachte. »Gering vielleicht für die Elfen. Aber ich gehöre nicht zu ihnen.«
»Das meine ich ja! Auf der Erde ist dies eine verbotene Substanz, weil sie in Menschen latente magische Fähigkeiten weckt. Bevor sie sie süchtig macht und in den Wahnsinn treibt!«
»Ich bin auch kein Mensch.«
»Du bist es zur Hälfte.«
»Und deshalb bin ich vorsichtig.«
Claire kniff die Augen zusammen. Offenbar hatte meine Stimme etwas verraten. »Was hast du erlebt?«
»Wie du eben gesagt hast: geringe Nebenwirkungen.«
»Als da wären?«
»Vor allem verstärkte Erinnerungen. Mit intensiveren Empfindungen, Dolby Surround und so weiter, der ganze Krempel.«
»Wie zum Beispiel Halluzinationen?«
»Wie zum Beispiel verstärkte Erinnerungen, Claire. Keine große Sache.«
Sie wirkte nicht überzeugt. »Und du kannst sie kontrollieren? Bist du in der Lage, die Erinnerungen ganz nach Belieben beiseitezuschieben?«
»Ja«, sagte ich schlicht. »Möchtest du nun was essen, oder hast du weitere Belehrungen für mich geplant?«
Claires Gesichtsausdruck teilte mir mit, dass es noch nicht vorbei war. Aber ihr Magen knurrte und setzte sich dem Kopf gegenüber durch. Ich sank aufs Sofa und verteilte Pappteller und Stäbchen. Dann legten wir los.
»Meine Güte, das hat mir wirklich gefehlt«, sagte Claire einige Minuten später, den Mund voller Chow-mein.
»Was?«
»Ölige menschliche Mitnehm-Spezialitäten.«
»Gibt es so etwas im Feenland nicht?«
»Nein. Dort fehlen auch Fernsehen, Kino, iPods und Jeans.« Mit der einen Hand strich Claire über das dünne Denim auf ihrem Knie. »Ich habe Jeans vermisst, verdammt.«
Ich lachte. »Ich dachte, du würdest von vorne bis hinten bedient …«
»Und Diener folgen mir überallhin, und ich muss mich jeden Tag in Schale werfen, und alle verbeugen sich, aber niemand redet mit mir!« Claire rollte mit den Augen. »O ja, wirklich toll.«
»Heidar redet mit dir, oder nicht? Und Caedmon?« Heidar war Claires großer blonder Verlobter. Und Caedmon war sein Vater, der König eines Teils der Lichtelfen.
»Ja, aber Heidar ist die meiste Zeit unterwegs und kontrolliert die Grenzen, und Caedmon steckt dauernd in irgendwelchen wichtigen Besprechungen, bei denen weiß Gott was beschlossen wird, während man von mir erwartet, dass ich einfach nur rumsitze und, was weiß ich, stricke.«
»Du strickst nicht.«
»Die Langeweile war so groß, dass ich daran gedacht habe, stricken zu lernen.«
»Klingt, als ob du Urlaub brauchst.«
Claire aß Nudeln und schwieg.
Ich streifte meine Stiefel ab, stellte sie neben die Tür und genoss das Gefühl der glatten alten Dielen unter den Füßen. Tagsüber hatten sie viel Wärme aufgenommen, und jetzt gaben sie sie ab, was einen angenehmen Kontrast zur kühleren Luft bot. Einige Motten umflatterten die alte, in der leichten Brise schaukelnde Schiffslaterne an der Verandadecke.
»Willst du mir sagen, was los ist?«, fragte ich schließlich, als Claire den größten Teil ihres Whiskeys getrunken hatte und noch immer schwieg.
Sie hatte in die Nacht hinaus geschaut, doch jetzt richtete sich der Blick ihrer smaragdgrünen Augen auf mich. »Woher willst du wissen, ob irgendwas ›los‹ ist? Vielleicht habe ich einfach nur beschlossen, mir eine kleine Auszeit zu nehmen.«
»Mitten in der Nacht?«
»Du bleibst manchmal lange auf …«
»Ohne Schuhe, ohne Gepäck und ohne Eskorte?«
Claire runzelte die Stirn und gab auf. »Ich wollte dich nicht in diese Sache verwickeln und bin nur hierhergekommen, weil ich keine andere Wahl hatte. Seit dem Beginn des Krieges werden alle offiziellen Portale bewacht.«
»Du meinst die Portale, von denen wir wissen«, warf ich ein.
»Ich meine die auf der Elfenseite«, sagte Claire, als hielte sie es für offensichtlich, dass ihre eigenen Leute versuchen würden, sie aufzuhalten.
»Na schön. Du bist also durch das Portal im Keller gekommen …«
»Weil niemand davon weiß. Onkel Pip benutzte es für den Schmuggel, und deshalb ließ er nichts darüber verlauten.«
»Und du hast dich still und heimlich davongemacht, weil …?«
»Wie ich schon sagte, ich möchte dich nicht in diese Sache …«
»Ich bin bereits in sie verwickelt«, betonte ich. »Du bist hier. Und offenbar steckst du in Schwierigkeiten. Ich werde dir helfen, ob du willst oder nicht, also kannst du mir ruhig alles sagen.«
»Ich will deine Hilfe nicht!«
»Und wenn schon.«
Claire funkelte mich an. Sie hatte eins von diesen Gesichtern, die ihre wahre Pracht erst im Ärger entfalten. Elfenbeinfarbene Haut, dazu eine von Sommersprossen bedeckte Adlernase und ein vorspringendes Kinn. Schon im Ruhezustand hatte es seinen Reiz. Aber mit blitzenden grünen Augen, geröteten Wangen und der Wolke aus zerzaustem Haar war Claire wunderschön.
Sie gehörte auch zu den wenigen mir bekannten Personen, die mindestens ebenso schnell aus der Haut fuhren wie ich. Man konnte immer die Wahrheit aus ihr herausholen, wenn man sie zornig genug machte. »Ich bin hier, um das Leben meines Sohns zu retten, klar?«, schnappte sie.
4
Ich sah zu dem kleinen Jungen. Er war das übliche rotwangige, pummelige Baby, soweit ich das feststellen konnte. Derzeit war er damit beschäftigt, zwei Schachfiguren anzustoßen, um sie dazu zu bringen, gegeneinander zu kämpfen.