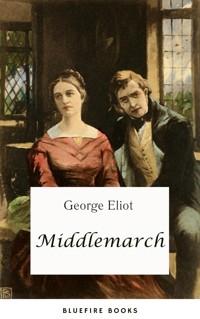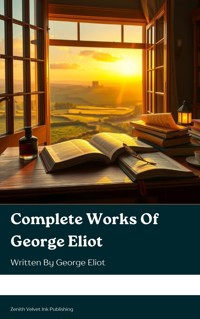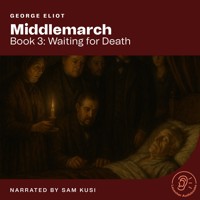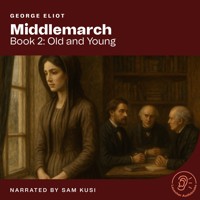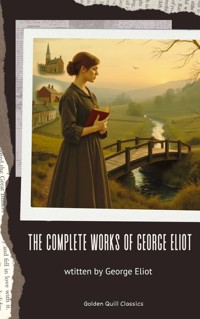0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Daniel Deronda" entführt George Eliot die Leser in die komplexe Welt der Identität, Ethik und zwischenmenschlichen Beziehungen im viktorianischen England. Der Roman folgt dem Leben von Daniel Deronda, einem idealistischen jungen Mann, der zwischen den sozialen Erwartungen seiner Umgebung und seiner eigenen Suche nach Sinn und Identität hin- und hergerissen ist. Eliot kombiniert psychologische Tiefe mit einer eindrucksvollen Erzählweise und beleuchtet die Herausforderungen ihrer Protagonisten mit einer bemerkenswerten Empathie und sozialen Sensibilität. Das Werk hebt sich durch seine Darstellung jüdischer Identität und die kritische Reflexion über Nationalismus und kulturelle Zugehörigkeit hervor – Themen, die auch in der modernen Welt von Bedeutung sind. George Eliot, geboren als Mary Ann Evans, war eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts und setzte sich zeit ihres Lebens für soziale Reformen und weibliche Bildung ein. Ihre persönlichen Erfahrungen und ihr intellektuelles Umfeld prägten ihre Sicht auf die gesellschaftlichen Normen und Werte ihrer Zeit. Eliot brach mit vielen traditionellen Geschlechterrollen und schuf starke, komplexe Charaktere, die für ihre Zeit und darüber hinaus bemerkenswert sind. "Daniel Deronda" ist Ausdruck ihrer Philosophie von Mitgefühl und Verständnis gegenüber verschiedenen Kulturen. Leserinnen und Leser, die Interesse an tiefgründigen Charakterstudien und den zeitgenössischen gesellschaftlichen Themen haben, finden in "Daniel Deronda" ein faszinierendes und bereicherndes Leseerlebnis. Dieses Meisterwerk lädt ein zum Nachdenken über Identität, Zugehörigkeit und die ethischen Fragestellungen, die das Menschsein auszeichnen. Gewöhnliche Leser und Studierende der Literatur gleichermaßen werden von Elisots geschickter Prosa und den philosophischen Fragestellungen, die im Zentrum des Romans stehen, begeistert sein. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniel Deronda
Inhaltsverzeichnis
Buch I. Das verwöhnte Kind.
Kapitel I.
Ohne die Einbildung eines Anfangs können Menschen nichts tun. Selbst die Wissenschaft, die strenge Messerin, ist gezwungen, mit einer Einbildungseinheit zu beginnen, und muss einen Punkt auf der unaufhörlichen Reise der Sterne festlegen, an dem ihre siderische Uhr vorgeben soll, dass die Zeit bei Null ist. Seine weniger genaue Großmutter Poesie wurde schon immer so verstanden, dass sie in der Mitte beginnt; aber wenn man es sich vor Augen hält, scheint es, dass ihr Vorgehen nicht sehr anders ist als seins; denn auch die Wissenschaft rechnet sowohl rückwärts als auch vorwärts, teilt seine Einheit in Milliarden und setzt mit seinem Uhrzeiger bei Null wirklich in medias res ein. Kein Rückblick wird uns zum wahren Anfang führen; und ob unser Prolog im Himmel oder auf Erden stattfindet, er ist nur ein Bruchteil jener alles voraussetzenden Tatsache, mit der unsere Geschichte beginnt.
War sie schön oder nicht schön? Und was war das Geheimnis der Form oder des Ausdrucks, das ihrem Blick diese Dynamik verlieh? Dominierte in diesen Strahlen der gute oder der böse Geist? Wahrscheinlich der böse; denn warum war die Wirkung eher die von Unruhe als von ungestörtem Charme? Warum wurde der Wunsch, wieder hinzusehen, als Zwang empfunden und nicht als Sehnsucht, der das ganze Wesen zustimmt?
Sie, die Daniel Deronda diese Fragen in den Sinn brachte, war mit Glücksspiel beschäftigt: nicht unter freiem Himmel unter südlichem Himmel, mit Kupfermünzen auf eine Mauer werfend, mit Lumpen um ihre Glieder; sondern in einem dieser prächtigen Resorts, die die Aufklärung der Jahrhunderte für die gleiche Art von Vergnügen zu einem hohen Preis an Schuldgefühlen, dunklen Farbtönen und molligen Nacktheiten vorbereitet hat, die alle entsprechend schwer sind – und einen geeigneten Kondensator für den menschlichen Atem bilden, der zum größten Teil der höchsten Mode angehören und nicht leicht zu bekommen sind, um sie in ähnlichem Maße einzuatmen, zumindest von Personen mit wenig Mode.
Es war fast vier Uhr an einem Septembertag, sodass die Atmosphäre zu einem sichtbaren Dunst gebraut war. Es herrschte tiefe Stille, die nur durch ein leichtes Rasseln, ein leichtes Knarren, ein leises Kehren und gelegentliche Monotöne auf Französisch unterbrochen wurde, wie sie von einem raffiniert konstruierten Automaten stammen könnten. An zwei runden, langen Tischen drängten sich zwei Menschenmengen, die alle bis auf eine Person ihre Gesichter und Aufmerksamkeit auf die Tische gerichtet hatten. Die einzige Ausnahme war ein melancholischer kleiner Junge, dessen Knie und Waden einfach in ihrer natürlichen Kleidung aus Epidermis steckten, während der Rest seiner Person ein Kostüm trug. Er allein hatte sein Gesicht dem Eingang zugewandt und fixierte ihn mit dem leeren Blick eines geschmückten Kindes, das als Maskerade auf der Tribüne einer Wanderausstellung stand, dicht hinter einer Dame, die sich intensiv dem Roulette-Tisch widmete.
An diesem Tisch waren fünfzig oder sechzig Personen versammelt, viele in den äußeren Reihen, wo sich gelegentlich Neuankömmlinge niederließen, die nur Zuschauer waren, nur dass man ab und zu beobachten konnte, wie einer von ihnen, normalerweise eine Frau, mit einem albernen Gesichtsausdruck einen Fünf-Franc-Schein hinlegte, nur um zu sehen, was die Leidenschaft des Glücksspiels wirklich war. Diejenigen, die sich an einer höheren Stärke erfreuten und in das Spiel vertieft waren, zeigten sehr unterschiedliche Varianten des europäischen Typs: livländische und spanische, griechisch-italienische und verschiedene deutsche, englische aristokratische und englische plebejische. Hier war sicherlich ein eindrucksvolles Eingeständnis der menschlichen Gleichheit zu sehen. Die weißen, mit Juwelen besetzten Finger einer englischen Gräfin berührten beinahe eine knochige, gelbe, krabbenartige Hand, die ein entblößtes Handgelenk ausstreckte, um einen Haufen Münzen zu ergreifen – eine Hand, die sich leicht mit dem eckigen, hageren Gesicht, den tiefliegenden Augen, den ergrauten Augenbrauen und dem schlecht gekämmten, schütteren Haar in Einklang bringen ließ, das wie eine leichte Metamorphose des Geiers wirkte. Und wo sonst hätte ihre Ladyschaft gnädigerweise eingewilligt, neben dieser trockenen, weiblichen Gestalt zu sitzen, die vorzeitig alt und nach kurzer Blüte verwelkt war wie ihre künstlichen Blumen, und die ein schäbiges Samtnetz vor sich hielt und gelegentlich die Spitze, mit der sie ihre Karte stach, in den Mund steckte? Dort, ganz in der Nähe der schönen Gräfin, befand sich auch ein angesehener Londoner Geschäftsmann, blond und mit weichen Händen, dessen glattes Haar sorgfältig nach hinten gescheitelt war, der sich der Rundschreiben an den Adel und den Landadel bewusst war, deren vornehme Schirmherrschaft es ihm ermöglichte, seinen Urlaub auf modische Weise und bis zu einem gewissen Grad in ihrer vornehmen Gesellschaft zu verbringen. Nicht seine Spielerleidenschaft, die den Appetit zunichte macht, sondern eine wohlgenährte Muße, die in den Pausen, in denen sie Geld im Geschäft gewinnt und es auffällig ausgibt, keine bessere Möglichkeit sieht, als Geld im Spiel zu gewinnen und es noch auffälliger auszugeben – immer vor Augen haltend, dass die Vorsehung nie irgendeine Missbilligung seiner Vergnügungen zum Ausdruck gebracht hat, und leidenschaftslos genug, um aufzuhören, wenn die Süße, viel zu gewinnen und andere verlieren zu sehen, sich in die Säure verwandelt hat, viel zu verlieren und andere gewinnen zu sehen. Denn das Laster des Glücksspiels lag darin, dabei Geld zu verlieren. In seiner Haltung könnte etwas vom Kaufmann stecken, aber in seinen Vergnügungen konnte er es mit den Inhabern der ältesten Titel aufnehmen. Neben seinem Stuhl stand ein gutaussehender Italiener, ruhig, statuenhaft, und reichte über ihn hinweg, um den ersten Stapel Napoleons aus einem neuen Sack voller Napoleons zu platzieren, den ihm gerade ein Bote mit einem Schnurrbart gebracht hatte. Der Stapel wurde in einer halben Minute zu einer alten Frau mit Perücke und Brille, die sich die Nase zuhielt, herübergeschoben. Ein leichter Schimmer, ein leises murmelndes Lächeln umspielte die Lippen der alten Frau; aber der statuenhafte Italiener blieb ungerührt und – wahrscheinlich in der Gewissheit eines unfehlbaren Systems, das seinen Fuß auf den Hals des Zufalls setzte – bereitete er sofort einen neuen Stapel vor. So auch ein Mann mit der Ausstrahlung eines abgemagerten Schönlings oder eines ausgelaugten Wüstlings, der das Leben durch eine Brille betrachtete und seine Hand zitternd ausstreckte, wenn er um Wechselgeld bat. Es konnte sicherlich nicht die Strenge seines Systems sein, sondern eher ein Traum von weißen Krähen oder die Annahme, dass der achte Tag des Monats Glück bringe, die die heftige, aber schwankende Impulsivität seines Spiels inspirierte.
Aber obwohl sich jeder einzelne Spieler deutlich von den anderen unterschied, gab es eine gewisse einheitliche Negativität des Ausdrucks, die wie eine Maske wirkte – als hätten sie alle von einer Wurzel gegessen, die das Gehirn jedes Einzelnen für eine gewisse Zeit zu der gleichen engen Monotonie des Handelns zwang.
Derondas erster Gedanke, als sein Blick auf diese Szene dumpfer, gasvergifteter Absorption fiel, war, dass ihm das Glücksspiel spanischer Hirtenjungen beneidenswerter erschienen war: – bis hierhin könnte Rousseau zu Recht behaupten, dass Kunst und Wissenschaft der Menschheit einen schlechten Dienst erwiesen haben. Aber plötzlich spürte er, wie der Moment dramatisch wurde. Seine Aufmerksamkeit wurde von einer jungen Dame gefesselt, die in einem Winkel nicht weit von ihm stand und die als Letzte seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie beugte sich vor und sprach Englisch mit einer Dame mittleren Alters, die neben ihr saß und spielte: aber im nächsten Moment kehrte sie zu ihrem Spiel zurück und zeigte die volle Größe einer anmutigen Gestalt, mit einem Gesicht, das man vielleicht ohne Bewunderung betrachten konnte, aber kaum mit Gleichgültigkeit.
Die innere Debatte, die sie in Deronda auslöste, verlieh seinen Augen einen immer prüfenderen Ausdruck, der sich immer weiter von dem Glanz gemischter, undefinierter Empfindungen entfernte, die Bewunderung ausmachen. In einem Moment folgten sie den Bewegungen der Figur, der Arme und Hände, als diese problematische Sylphide sich vorbeugte, um ihren Einsatz mit einer Miene fester Entschlossenheit abzulegen; und im nächsten kehrten sie zu dem Gesicht zurück, das, derzeit unbeeinflusst von den Betrachtern, fest auf das Spiel gerichtet war. Die Sylphide war eine Gewinnerin; und als ihre zarten, in hellgraue Handschuhe gehüllten Finger die Münzen zurechtrückten, die ihr zugeschoben worden waren, um sie wieder auf den Gewinnpunkt zu bringen, blickte sie sich mit einem Blick um, der zu deutlich kalt und neutral war, um nicht ein wenig von der Art zu haben, die wir als Kunst bezeichnen, die eine innere Freude verbirgt.
Aber im Verlauf dieser Besichtigung trafen ihre Augen auf die von Deronda, und anstatt sie abzuwenden, wie sie es sich gewünscht hätte, wurde ihr unangenehm bewusst, dass sie festgehalten wurden – wie lange? Das flüchtige Gefühl, dass er sie maß und auf sie herabblickte, als wäre sie minderwertig, dass er von anderer Qualität war als der menschliche Abschaum um sie herum, dass er sich in einer Region außerhalb und über ihr fühlte und sie als ein Exemplar einer niedrigeren Ordnung untersuchte, weckte einen prickelnden Groll, der den Moment mit Konflikt erfüllte. Es ließ ihr nicht das Blut in die Wangen steigen, sondern es trieb es von ihren Lippen weg. Sie beherrschte sich mit der Hilfe eines inneren Trotzes und wandte sich ohne ein anderes Zeichen von Emotion als dieser Lippenblässe ihrem Spiel zu. Aber Derondas Blick schien wie ein böser Blick gewirkt zu haben. Ihr Einsatz war weg. Aber das machte nichts; sie hatte gewonnen, seit sie mit ein paar Napoleons zum Einsatz Roulette spielte, und hatte eine beträchtliche Reserve. Sie hatte begonnen, an ihr Glück zu glauben, und andere hatten begonnen, daran zu glauben: Sie hatte die Vision, von einem Gefolge verfolgt zu werden, das sie als Glücksgöttin verehren und ihr beim Spielen als richtungsweisende Weissagung zuschauen würde. Solche Dinge waren von männlichen Spielern bekannt; warum sollte eine Frau nicht eine ähnliche Vormachtstellung haben? Ihre Freundin und Anstandsdame, die ihr das Spielen zunächst nicht gewünscht hatte, begann, es zu billigen, gab aber den klugen Rat, im richtigen Moment aufzuhören und Geld nach England zurückzubringen – ein Rat, auf den Gwendolen geantwortet hatte, dass sie sich für die Spannung des Spiels interessiere, nicht für die Gewinne. Unter dieser Voraussetzung hätte der gegenwärtige Moment die Flut in ihrer eifrigen Erfahrung des Glücksspiels auslösen müssen. Doch als ihr nächster Einsatz weggespült wurde, spürte sie, wie ihre Augen heiß wurden, und die Gewissheit, dass dieser Mann sie immer noch beobachtete (ohne hinzusehen), war wie ein Druck, der langsam zur Qual wurde. Ein Grund mehr für sie, nicht zurückzuschrecken, sondern weiterzuspielen, als wäre ihr Verlust oder Gewinn gleichgültig. Ihre Freundin berührte ihren Ellbogen und schlug vor, den Tisch zu verlassen. Als Antwort legte Gwendolen zehn Louis auf dieselbe Stelle: Sie war in einer Trotzstimmung, in der der Verstand jedes Ziel außer der Befriedigung durch wütenden Widerstand aus den Augen verliert; und mit der kindlichen Dummheit eines dominanten Impulses schließt sie auch das Glück in ihre Trotzobjekte ein. Da sie nicht auffallend gewann, war es das Nächstbeste, auffallend zu verlieren. Sie kontrollierte ihre Muskeln und zeigte kein Zittern im Mund oder in den Händen. Jedes Mal, wenn ihr Einsatz abgeräumt wurde, verdoppelte sie ihn. Viele beobachteten sie jetzt, aber die einzige Beobachtung, derer sie sich bewusst war, war die von Deronda, der, obwohl sie nie zu ihm hinschaute, sich sicher nicht von ihr entfernt hatte. Ein solches Drama dauert nicht lange: Entwicklung und Katastrophe lassen sich oft an nichts Ungeschickterem messen als am Minutenzeiger. „Faites votre jeu, mesdames et messieurs“, sagte die automatische Stimme des Schicksals zwischen Schnurrbart und Kaiserkrone des Croupiers, und Gwendolens Arm wurde ausgestreckt, um ihren letzten armseligen Haufen Napoleons abzulegen. „Le jeu ne va plus“, sagte das Schicksal. Und in fünf Sekunden wandte sich Gwendolen vom Tisch ab, aber sie wandte sich entschlossen mit dem Gesicht zu Deronda und sah ihn an. In seinen Augen lag ein ironisches Lächeln, als sich ihre Blicke trafen; aber es war zumindest besser, dass er sie als eines der Individuen eines Insektenschwarms betrachtete, das keine individuelle Physiognomie hatte. Außerdem war es trotz seiner Überheblichkeit und Ironie schwer zu glauben, dass er nicht auch ihren Geist bewunderte: Er war jung, gutaussehend und von vornehmer Erscheinung – nicht einer dieser lächerlichen und altmodischen Spießer, die es für ihre Pflicht hielten, den Spieltisch mit einem sauren Protestblick zu verunstalten, wenn sie daran vorbeigingen. Die allgemeine Überzeugung, dass wir bewundernswert sind, gibt nicht so leicht einem einzigen Negativum nach; vielmehr neigen diejenigen aus Vanitas' großer Familie, ob Mann oder Frau, die feststellen, dass ihre Leistung auf Kälte stößt, dazu zu glauben, dass ein wenig mehr davon den unerklärlichen Abweichler überzeugen wird. In Gwendolens Denkgewohnheiten war es selbstverständlich gewesen, dass sie wusste, was bewundernswert war, und dass sie selbst bewundert wurde. Diese Grundlage ihres Denkens hatte eine unangenehme Erschütterung erlitten und schwankte ein wenig, war aber nicht leicht zu erschüttern.
Am Abend war derselbe Raum noch stickiger beheizt, erstrahlte im Glanz von Gas und den Kostümen der Damen, die ihre Schleppen durch den Raum schweben ließen oder auf den Polstern saßen.
Die Nereide in meergrünen Gewändern und silbernen Ornamenten, mit einer blassen, meergrünen Feder, die in Silber befestigt war und nach hinten über ihren grünen Hut und ihr hellbraunes Haar fiel, war Gwendolen Harleth. Sie stand unter der Fittiche oder besser gesagt auf der Schulter der Dame, die neben ihr am Roulettetisch gesessen hatte; und bei ihnen war ein Herr mit weißem Schnurrbart und kurz geschnittenem Haar: mit festen Augenbrauen, steif und deutsch. Sie liefen herum oder standen, um mit Bekannten zu plaudern, und Gwendolen wurde von den sitzenden Gruppen viel beachtet.
„Ein auffälliges Mädchen – dieses Fräulein Harleth – anders als die anderen.“
„Ja, sie hat sich jetzt als eine Art Schlange verkleidet – ganz in Grün und Silber, und sie windet ihren Hals etwas mehr als sonst.“
„Oh, sie muss immer etwas Außergewöhnliches tun. Sie ist so ein Mädchen, denke ich. Finden Sie sie hübsch, Herr Vandernoodt?“
„Sehr. Ein Mann könnte für sie hängen – ich meine, ein Narr könnte das.“
„Magst du also eine schmale Nase und lange schmale Augen?“
„Wenn sie zu einem solchen Ensemble passen.“
„Das Ensemble du serpent?“
„Wenn du so willst. Die Frau wurde von einer Schlange verführt; warum nicht auch der Mann?“
„Sie ist sicherlich sehr anmutig, aber sie braucht etwas Farbe auf den Wangen. Sie hat eine Art Lamia-Schönheit.“
„Im Gegenteil, ich finde, ihr Teint ist einer ihrer größten Reize. Es ist eine warme Blässe, die durch und durch gesund aussieht. Und diese zarte Nase mit ihrer allmählichen kleinen Aufwärtskurve ist ablenkend. Und dann ihr Mund – es gab noch nie einen schöneren Mund, die Lippen so fein nach hinten geschwungen, nicht wahr, Mackworth?“
„Meinst du? Ich kann diese Art von Mund nicht ertragen. Er sieht so selbstgefällig aus, als ob er seine eigene Schönheit kennt – die Kurven sind zu unbeweglich. Ich mag einen Mund, der mehr zittert.“
„Ich für meinen Teil finde sie abscheulich“, sagte eine Witwe. „Es ist schon erstaunlich, welche unangenehmen Mädchen in Mode kommen. Wer sind diese Langens? Kennt sie jemand?“
„Sie sind durchaus comme il faut. Ich habe mehrmals mit ihnen im Russie zu Abend gegessen. Die Baronin ist Engländerin. Fräulein Harleth nennt sie ihre Cousine. Das Mädchen selbst ist durch und durch wohlerzogen und so klug wie möglich.“
„Ach du meine Güte! Und der Baron?“
„Ein sehr gutes Bild von den Möbeln.“
„Eure Baronin ist immer am Roulettetisch“, sagte Mackworth. „Ich vermute, sie hat dem Mädchen das Spielen beigebracht.“
„Oh, die alte Frau spielt sehr nüchtern; lässt hier und da ein Zehn-Franc-Stück fallen. Das Mädchen ist eher draufgängerisch. Aber das ist nur eine Laune.“
„Ich habe gehört, dass sie heute all ihre Gewinne verloren hat. Sind sie reich? Wer weiß?“
„Ach, wer weiß? Wer weiß das schon von irgendjemandem?“, sagte Herr Vandernoodt und ging zu den Langens.
Die Bemerkung, dass Gwendolen sich an diesem Abend mehr als sonst den Hals verdrehte, stimmte. Aber nicht, weil sie die Idee der Schlange vielleicht noch vollständiger ausführen könnte: Sie hielt nach einer Gelegenheit Ausschau, Deronda zu sehen, um sich nach diesem Fremden zu erkundigen, unter dessen prüfendem Blick sie immer noch zusammenzuckte. Endlich kam ihre Gelegenheit.
„Herr Vandernoodt, Sie kennen ja jeden“, sagte Gwendolen nicht allzu eifrig, sondern mit einer gewissen Trägheit in der Stimme, die sie manchmal ihrem klaren Sopran verlieh. „Wer ist das da an der Tür?“
„Da sind ein halbes Dutzend in der Nähe der Tür. Meinst du den alten Adonis mit der George-the-Fourth-Perücke?“
„Nein, nein; der dunkelhaarige junge Mann rechts mit dem schrecklichen Gesichtsausdruck.“
„Gefürchtet, nennst du das? Ich finde, er ist ein ungewöhnlich guter Kerl.“
„Aber wer ist er?“
„Er ist kürzlich mit Herrn Hugo Mallinger in unser Hotel gekommen.“
„Herr Hugo Mallinger?“
„Ja. Kennst du ihn?“
„Nein.“ (Gwendolen errötete leicht.) „Er hat ein Haus in unserer Nähe, aber er kommt nie dorthin. Wie war doch gleich der Name des Herrn an der Tür?“
„Deronda – Herr Deronda.“
„Was für ein entzückender Name! Ist er Engländer?“
„Ja. Er soll mit dem Baronet ziemlich eng verwandt sein. Interessierst du dich für ihn?“
„Ja. Ich denke, er ist nicht wie die jungen Männer im Allgemeinen.“
„Und du bewunderst junge Männer im Allgemeinen nicht?“
„Nicht im Geringsten. Ich weiß immer, was sie sagen werden. Ich kann überhaupt nicht erraten, was dieser Herr Deronda sagen würde. Was sagt er denn?“
„Nicht viel. Ich saß gestern Abend eine gute Stunde lang mit seiner Gruppe auf der Terrasse, und er hat nie gesprochen – und auch nicht geraucht. Er sah gelangweilt aus.“
„Ein weiterer Grund, warum ich ihn kennenlernen möchte. Ich langweile mich immer.“
„Ich könnte mir vorstellen, dass er sich über eine Einleitung freuen würde. Soll ich das in die Wege leiten? Werdet Ihr es erlauben, Baronin?“
„Warum nicht? – Da er mit Herrn Hugo Mallinger verwandt ist. Es ist eine neue Rolle von dir, Gwendolen, immer gelangweilt zu sein“, fuhr Madame von Langen fort, nachdem Herr Vandernoodt gegangen war. „Bisher schienst du von morgens bis abends immer auf etwas erpicht zu sein.“
„Das liegt nur daran, dass ich mich zu Tode langweile. Wenn ich mit dem Spielen aufhören soll, muss ich mir den Arm oder das Schlüsselbein brechen. Ich muss etwas unternehmen, es sei denn, du gehst in die Schweiz und nimmst mich mit auf den Matterhorn.“
„Vielleicht tut es auch die Bekanntschaft dieses Herrn Deronda statt des Matterhorns.“
„Vielleicht.“
Aber Gwendolen machte bei dieser Gelegenheit nicht die Bekanntschaft von Deronda. Herr Vandernoodt gelang es nicht, ihn an diesem Abend mit ihr bekannt zu machen, und als sie ihr eigenes Zimmer wieder betrat, fand sie einen Brief, der sie an ihr Zuhause erinnerte.
Kapitel II.
Dieser Mann ersinnt ein Geheimnis "zwischen uns beiden,
Damit er mich mit seinen treffenden Blicken bezwingen kann
Wie jemand, der eine Löwin in Schach hält.
Diesen Brief fand Gwendolen auf ihrem Tisch:
LIEBES KIND – Ich erwarte seit einer Woche, von dir zu hören. In deinem letzten Brief hast du geschrieben, dass die Langens darüber nachdenken, Leubronn zu verlassen und nach Baden zu ziehen. Wie konntest du so gedankenlos sein, mich in Ungewissheit über deine Adresse zu lassen? Ich bin in größter Sorge, dass dieser Brief dich nicht erreichen könnte. Auf jeden Fall solltest du Ende September nach Hause kommen, und ich muss dich nun bitten, so schnell wie möglich zurückzukehren, denn wenn du dein ganzes Geld ausgibst, wäre es mir nicht möglich, dir noch mehr zu schicken, und du darfst dir nichts von den Langens leihen, denn ich könnte es ihnen nicht zurückzahlen. Das ist die traurige Wahrheit, mein Kind – ich wünschte, ich könnte dich besser darauf vorbereiten –, aber ein schreckliches Unglück ist über uns alle hereingebrochen. Du weißt nichts über Geschäfte und wirst es nicht verstehen; aber Grapnell & Co. sind mit einer Million gescheitert, und wir sind völlig ruiniert – deine Tante Gascoigne ebenso wie ich, nur dass dein Onkel sein Pfründneramt hat, sodass die Familie weitermachen kann, indem sie ihre Kutsche abstellt und Zinsen für die Jungen bekommt. Das gesamte Vermögen, das unser armer Vater für uns gespart hat, wird zur Begleichung der Verbindlichkeiten verwendet. Es gibt nichts, was ich mein Eigen nennen kann. Es ist besser, du solltest das sofort wissen, auch wenn es mir das Herz bricht, dir das sagen zu müssen. Natürlich denken wir, wie schade es war, dass du gerade zu diesem Zeitpunkt weggegangen bist. Aber ich werde dir nie Vorwürfe machen, mein liebes Kind; ich würde dich vor allen Schwierigkeiten bewahren, wenn ich könnte. Auf dem Heimweg wirst du Zeit haben, dich auf die Veränderungen vorzubereiten, die du vorfinden wirst. Wir werden Offendene vielleicht sofort verlassen, denn wir hoffen, dass Herr Haynes, der es vorher wollte, bereit ist, es mir abzunehmen. Natürlich können wir nicht ins Pfarrhaus gehen – dort ist kein Platz mehr frei. Wir müssen uns irgendeine Hütte besorgen, um uns zu schützen, und wir müssen von der Wohltätigkeit deines Onkels Gascoigne leben, bis ich sehe, was sonst noch getan werden kann. Ich werde nicht in der Lage sein, die Schulden bei den Handwerkern zu bezahlen, ganz zu schweigen von den Löhnen der Bediensteten. Nimm all deinen Mut zusammen, mein liebes Kind; wir müssen uns in Gottes Willen ergeben. Aber es ist schwer, sich mit Herrn Lassmans bösartiger Rücksichtslosigkeit abzufinden, die, wie man sagt, die Ursache des Scheiterns war. Deine armen Schwestern können nur mit mir weinen und mir keine Hilfe geben. Wenn du einmal hier wärst, könnte es einen Riss in der Wolke geben – ich halte es immer für unmöglich, dass du für Armut bestimmt sein könntest. Wenn die Langens im Ausland bleiben wollen, kannst du dich vielleicht für die Reise in die Obhut eines anderen begeben. Aber komm so schnell du kannst zu deiner leidgeprüften und dich liebenden Mama,
Fanny Davilow.
Die erste Wirkung dieses Briefes auf Gwendolen war halb betäubend. Das unausgesprochene Vertrauen, dass ihr Schicksal ein Leben in luxuriöser Leichtigkeit sein müsse, in dem jeder auftretende Ärger gut gekleidet und versorgt wäre, war in ihrem eigenen Kopf stärker gewesen als in dem ihrer Mutter, genährt durch ihr jugendliches Blut und das Gefühl überlegener Ansprüche, das einen großen Teil ihres Bewusstseins ausmachte. Es war fast genauso schwer für sie, plötzlich zu glauben, dass ihre Position von Armut und demütigender Abhängigkeit geprägt war, wie es gewesen wäre, in den starken Strom ihres blühenden Lebens das kalte Gefühl zu bekommen, dass ihr Tod wirklich kommen würde. Sie stand ein paar Minuten lang regungslos da, nahm dann ihren Hut ab und warf automatisch einen Blick in den Spiegel. Die Locken ihres glatten hellbraunen Haares waren immer noch so perfekt frisiert, dass sie für einen Ballsaal gereicht hätten; und wie an anderen Abenden hätte Gwendolen sich vielleicht genüsslich betrachten können (sicherlich eine zulässige Schwäche); aber jetzt nahm sie ihre Schönheit, die ihr vor Augen gehalten wurde, nicht bewusst wahr und starrte einfach geradeaus, als wäre sie von einem hasserfüllten Geräusch erschüttert worden und wartete auf ein Zeichen für dessen Ursache. Nach einer Weile warf sie sich in die Ecke des roten Samtsofas, nahm den Brief wieder zur Hand, las ihn zweimal ganz bewusst und ließ ihn schließlich auf den Boden fallen, während sie ihre gefalteten Hände auf den Schoß legte und vollkommen still saß, ohne eine Träne zu vergießen. Ihr Impuls war es, die Situation zu überblicken und sich ihr zu widersetzen, anstatt darüber zu jammern. Es gab kein innerliches Ausrufen von „Arme Mama!“ Ihre Mama schien nie viel Freude am Leben zu haben, und wenn Gwendolen in diesem Moment Mitleid empfunden hätte, hätte sie es sich selbst gegönnt – denn war sie nicht von Natur aus und zu Recht auch das Hauptanliegen der Sorge ihrer Mutter? Aber es war Wut, es war Widerstand, der sie beherrschte; es war bittere Verärgerung darüber, dass sie beim Roulette verloren hatte, während sie, wenn ihr Glück an diesem einen Tag angehalten hätte, eine ansehnliche Summe mit nach Hause hätte nehmen können, oder sie hätte weiter spielen und genug gewinnen können, um sie alle zu unterstützen. War das nicht auch jetzt noch möglich? Sie hatte nur noch vier Napoleons in ihrer Handtasche, aber sie besaß einige Schmuckstücke, die sie verkaufen konnte: eine Praxis, die in der eleganten Gesellschaft in deutschen Bädern so üblich war, dass es keinen Grund gab, sich dafür zu schämen; und selbst wenn sie den Brief ihrer Mutter nicht erhalten hätte, hätte sie sich wahrscheinlich dafür entschieden, Geld für eine etruskische Halskette zu bekommen, die sie seit ihrer Ankunft nicht mehr getragen hatte; nein, sie hätte es vielleicht sogar mit dem angenehmen Gefühl getan, dass sie intensiv lebte und dem Alltag entfloh. Mit zehn Louis zu ihrer Verfügung und einer Rückkehr ihres früheren Glücks, was wahrscheinlich schien, was könnte sie Besseres tun, als noch ein paar Tage weiterzuspielen? Wenn ihre Freunde zu Hause die Art und Weise missbilligten, wie sie an das Geld gekommen war, was sie sicherlich taten, dann wäre das Geld immer noch da. Gwendolens Fantasie spielte mit diesem Gedanken und malte sich die angenehmen Folgen aus, aber nicht mit ungebrochenem Vertrauen und wachsender Gewissheit, wie es der Fall gewesen wäre, wenn sie von der Manie eines Spielers befallen worden wäre. Sie war nicht aus Leidenschaft an den Roulettetisch gegangen, sondern auf der Suche danach: Ihr Verstand war noch in der Lage, sich ausgewogene Wahrscheinlichkeiten vorzustellen, und während die Chance zu gewinnen sie lockte, drängte sich die Chance zu verlieren mit wechselnder Stärke auf und ließ eine Vision entstehen, von der ihr Stolz empfindlich getroffen wurde. Denn sie war entschlossen, den Langens nicht zu sagen, dass ihrer Familie ein Unglück widerfahren war, oder sich in irgendeiner Weise von ihrem Mitgefühl abhängig zu machen; und wenn sie sich in einem erkennbaren Ausmaß von ihrem Schmuck trennen würde, würden sie sich mit Fragen und Vorhaltungen einmischen. Der Weg, der das geringste Risiko für unerträgliche Belästigungen barg, bestand darin, früh am Morgen Geld für ihre Halskette zu sammeln, den Langens zu sagen, dass ihre Mutter ihre sofortige Rückkehr wünsche, ohne einen Grund anzugeben, und am Abend den Zug nach Brüssel zu nehmen. Sie hatte kein Dienstmädchen bei sich, und die Langens könnten Schwierigkeiten machen, wenn sie nach Hause zurückkehrte, aber ihr Wille war unerschütterlich.
Anstatt ins Bett zu gehen, machte sie so helles Licht, wie sie konnte, und begann zu packen. Sie arbeitete fleißig, obwohl sie die ganze Zeit von den Szenen heimgesucht wurde, die am kommenden Tag stattfinden könnten – jetzt von den lästigen Erklärungen und Abschieden und der rasenden Reise in ein verändertes Zuhause, jetzt von der Alternative, noch einen Tag zu bleiben und wieder am Roulettetisch zu stehen. Aber in dieser zweiten Szene war immer dieser Deronda anwesend, der sie mit ärgerlicher Ironie beobachtete und – die beiden scharfen Erfahrungen wurden unweigerlich zusammen wieder lebendig – sie wieder vom Glück verlassen sah. Dieses aufdringliche Bild half ihr sicherlich dabei, ihre Entschlossenheit zugunsten einer sofortigen Abreise zu ändern und sie so sehr zum Packen zu drängen, dass ein Sinneswandel unpraktisch wurde. Es hatte zwölf geschlagen, als sie in ihr Zimmer kam, und als sie sich versicherte, dass sie nur das Nötigste ausgelassen hatte, schlich sich die schwache Morgendämmerung durch die weißen Jalousien und ließ ihre Kerzen verblassen. Was hatte es für einen Sinn, ins Bett zu gehen? Ihr kaltes Bad war Erfrischung genug, und sie sah, dass eine leichte Spur von Müdigkeit um die Augen sie nur noch interessanter aussehen ließ. Vor sechs Uhr war sie vollständig in ihrem grauen Reisekleid gekleidet, sogar mit ihrem Filzhut, denn sie wollte hinausgehen, sobald sie damit rechnen konnte, andere Damen auf dem Weg zu den Quellen zu sehen. Und da sie zufällig seitlich vor dem langen Spiegelstreifen zwischen ihren beiden Fenstern saß, drehte sie sich um, um sich selbst anzusehen, und stützte den Ellbogen auf die Stuhllehne, in einer Haltung, die für ihr Porträt gewählt worden sein könnte. Es ist möglich, eine starke Selbstliebe ohne Selbstzufriedenheit zu haben, eher mit einer Selbstunzufriedenheit, die umso intensiver ist, weil der eigene kleine Kern egoistischer Empfindsamkeit die oberste Priorität hat; aber Gwendolen kannte solche inneren Konflikte nicht. Sie hatte eine naive Freude an ihrem glücklichen Selbst, für die jeder, außer den härtesten Heiligen, Verständnis haben wird, bei einem Mädchen, das jeden Tag ein angenehmes Spiegelbild dieses Selbst in der Schmeichelei ihrer Freunde sowie im Spiegel gesehen hatte. Und selbst als die Probleme begannen und sie, da sie nichts anderes zu tun hatte, im wachsenden Licht ihr Spiegelbild betrachtete, nahm ihr Gesicht allmählich eine Selbstgefälligkeit an, die der Heiterkeit des Morgens entsprach. Ihre schönen Lippen verzogen sich zu einem immer entschlosseneren Lächeln, bis sie schließlich ihren Hut abnahm, sich vorbeugte und das kalte Glas küsste, das so warm ausgesehen hatte. Wie konnte sie an Kummer glauben? Wenn es sie befiel, spürte sie die Kraft, es zu zerschmettern, ihm zu trotzen oder vor ihm davonzulaufen, wie sie es bereits getan hatte. Alles schien möglicher, als dass sie weiterhin großes oder kleines Leid ertragen könnte.
Madame von Langen ging nie vor dem Frühstück aus dem Haus, sodass Gwendolen ihren frühen Spaziergang gefahrlos beenden konnte, indem sie den Heimweg durch die Obere Straße nahm, in der sich der benötigte Laden befand, der sicher nach sieben Uhr geöffnet hatte. Zu dieser Stunde waren alle Beobachter, die sie störten, entweder auf ihren Spaziergängen in der Gegend der Quellen oder noch in ihren Schlafzimmern; aber es gab sicherlich ein großes Hotel, das Czarina, von dem aus man sie bis zur Tür von Herrn Wiener verfolgen konnte. Dies war eine Chance, die man riskieren sollte: Könnte sie nicht hineingehen, um etwas zu kaufen, das ihr gefallen hat? Dieser unausgesprochene Gedanke schoss ihr durch den Kopf, als sie sich daran erinnerte, dass die „Czarina“ das Hotel von Deronda war; aber da war sie schon weit oben in der Oberen Straße, und sie ging mit ihrer gewohnten schwebenden Bewegung weiter, jede Linie ihrer Gestalt und ihrer Gewänder fiel in sanften Kurven, die für alle Augen attraktiv waren, außer für diejenigen, die darin eine zu große Ähnlichkeit mit der Schlange erkannten und gegen die Wiederbelebung der Schlangenverehrung protestierten. Sie schaute weder nach rechts noch nach links und erledigte ihre Geschäfte im Laden mit einer Gelassenheit, die dem kleinen Herrn Weiner nichts weiter auffiel als ihre stolze Anmut und die überlegene Größe und Qualität der drei zentralen Türkise in der Halskette, die sie ihm anbot. Sie hatten einst zu einer Kette ihres Vaters gehört, aber sie hatte ihren Vater nie kennengelernt, und die Halskette war in jeder Hinsicht der Schmuck, von dem sie sich am bequemsten trennen konnte. Wer glaubt, es sei ein unmöglicher Widerspruch, gleichzeitig abergläubisch und rational zu sein? Roulette fördert einen romantischen Aberglauben in Bezug auf die Chancen des Spiels und den nüchternsten Rationalismus in Bezug auf menschliche Gefühle, die der Beschaffung des benötigten Geldes im Wege stehen. Gwendolens größtes Bedauern war, dass sie zu den vier Louis in ihrer Handtasche nur noch neun hinzufügen konnte: Diese jüdischen Händler nutzten die Unglücksspieler unter den Christen so skrupellos aus! Aber sie war der Gast der Langens in ihrer gemieteten Wohnung und hatte dort nichts zu bezahlen: Dreizehn Louis würden mehr sein, als sie für die Heimreise brauchte; selbst wenn sie beschloss, drei zu riskieren, würden die restlichen zehn mehr als ausreichen, da sie vorhatte, Tag und Nacht weiterzureisen. Als sie sich auf den Heimweg machte, ja, das Haus betrat und sich in den Salon setzte, um auf ihre Freunde und das Frühstück zu warten, schwankte sie immer noch, ob sie sofort abreisen sollte, oder besser gesagt, sie hatte beschlossen, den Langens einfach zu sagen, dass sie einen Brief von ihrer Mutter erhalten hatte, in dem sie um ihre Rückkehr gebeten wurde, und dass sie sich noch nicht entscheiden konnte, wann sie aufbrechen sollte. Es war bereits die übliche Frühstückszeit, und als sie sich mit geschlossenen Augen müde und hungrig zurücklehnte und hörte, wie jemand hereinkam, stand sie auf und erwartete, den einen oder anderen der Langens zu sehen – die Worte, die ihr Verweilen um mindestens einen weiteren Tag bestimmen könnten, waren ihr bereits auf den Lippen. Aber es war der Diener, der ein kleines Päckchen für Fräulein Harleth hereinbrachte, das in diesem Moment an der Tür abgestellt worden war. Gwendolen nahm es in die Hand und eilte sofort in ihr eigenes Zimmer. Sie sah blasser und aufgeregter aus als bei der ersten Lektüre des Briefes ihrer Mutter. Etwas – sie wusste nie genau, was – verriet ihr, bevor sie das Päckchen öffnete, dass es das Kollier enthielt, von dem sie sich gerade getrennt hatte. Unter dem Papier war es in ein kambrisches Taschentuch gewickelt, und darin befand sich ein Stück abgerissenes Notizpapier, auf das mit Bleistift in klarer, aber schneller Handschrift geschrieben war: „Ein Fremder, der Fräulein Harleths Halskette gefunden hat, gibt sie ihr zurück, in der Hoffnung, dass sie nicht wieder riskiert, sie zu verlieren. “
Gwendolen errötete vor Ärger über den verletzten Stolz. Ein großer Teil des Taschentuchs schien achtlos abgerissen worden zu sein, um einen Fleck zu entfernen; aber sie glaubte sofort an das erste Bild des „Fremden“, das sich ihr in den Sinn drängte. Es war Deronda; er musste gesehen haben, wie sie in den Laden ging; er muss unmittelbar danach hineingegangen sein und die Kette zurückgekauft haben. Er hatte sich eine unverzeihliche Freiheit herausgenommen und es gewagt, sie in eine durch und durch verhasste Lage zu bringen. Was konnte sie tun? – Sicherlich nicht ihrer Überzeugung nach handeln, dass er es war, der ihr die Kette geschickt hatte, und sie ihm sofort zurückschicken: Das würde bedeuten, sich der Möglichkeit zu stellen, dass sie sich geirrt hatte; nein, selbst wenn der „Fremde“ er und kein anderer wäre, wäre es etwas zu Grobes, als dass sie ihn wissen lassen könnte, dass sie dies geahnt hatte, und ihm wieder mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf begegnen könnte. Er wusste sehr wohl, dass er sie in hilflose Demütigung verstrickte: Es war eine andere Art, sie ironisch anzulächeln und die Miene eines hochmütigen Mentors anzunehmen. Gwendolen spürte, wie die bitteren Tränen der Demütigung aufstiegen und über ihre Wangen rollten. Niemand hatte es je zuvor gewagt, sie mit Ironie und Verachtung zu behandeln. Eines war klar: Sie musste ihren Entschluss, diesen Ort sofort zu verlassen, in die Tat umsetzen; es war unmöglich für sie, wieder im öffentlichen Salon zu erscheinen, geschweige denn am Spieltisch zu stehen, mit dem Risiko, Deronda zu sehen. Jetzt klopfte es aufdringlich an der Tür: Das Frühstück war fertig. Gwendolen steckte mit einer leidenschaftlichen Bewegung Halskette, Musselin, einen Fetzen Papier und alles andere in ihr Necessaire, drückte ihr Taschentuch gegen das Gesicht und ging, nachdem sie ein oder zwei Minuten inne gehalten hatte, um ihre stolze Selbstbeherrschung wiederzufinden, zu ihren Freunden. Die Spuren von Tränen und Erschöpfung, die noch zu sehen waren, schienen mit ihrer sofortigen Erklärung übereinzustimmen, dass sie aufgeblieben war, um zu packen, anstatt auf die Hilfe der Zofe ihrer Freundin zu warten. Wie sie erwartet hatte, gab es viel Protest dagegen, dass sie allein reisen wollte, aber sie bestand darauf, keine Begleitung zu akzeptieren. Sie würde in das Damenabteil gesetzt werden und direkt weiterfahren. Sie könne im Zug sehr gut schlafen und fürchte sich vor nichts.
So kam es, dass Gwendolen nie wieder am Roulettetisch auftauchte, sondern am Donnerstagabend Leubronn in Richtung Brüssel verließ und am Samstagmorgen in Offendene ankam, dem Haus, von dem sie und ihre Familie sich bald ein letztes Mal verabschieden sollten.
Kapitel III.
„Lasst keine Blume des Frühlings an uns vorübergehen; lasst uns uns mit Rosenknospen krönen, bevor sie verwelken.“ – Buch der Weisheit.
Schade, dass Offendene nicht der Ort war, an dem Fräulein Harleth ihre Kindheit verbracht hat, oder dass sie durch Familienerinnerungen mit diesem Ort verbunden war! Ich denke, ein menschliches Leben sollte an einem Ort in der Heimat gut verwurzelt sein, wo es die Liebe einer zärtlichen Verwandtschaft für das Antlitz der Erde, für die Arbeit, für die Geräusche und Akzente, die sie heimsuchen, für alles, was dieser frühen Heimat einen vertrauten, unverwechselbaren Unterschied inmitten der zukünftigen Erweiterung des Wissens verleiht, erfahren kann: ein Ort, an dem die Bestimmtheit früher Erinnerungen mit Zuneigung verbunden werden kann und an dem eine freundschaftliche Bekanntschaft mit allen Nachbarn, sogar mit den Hunden und Eseln, sich nicht durch sentimentale Anstrengung und Reflexion, sondern als eine süße Gewohnheit des Blutes ausbreiten kann. Mit fünf Jahren sind Sterbliche nicht darauf vorbereitet, Bürger der Welt zu sein, sich von abstrakten Substantiven anregen zu lassen, sich über Vorlieben hinwegzusetzen und unparteiisch zu werden; und das Vorurteil zugunsten von Milch, mit dem wir blind beginnen, ist ein Beispiel dafür, wie Körper und Seele zumindest für eine gewisse Zeit ernährt werden müssen. Die beste Einleitung in die Astronomie ist, sich den nächtlichen Himmel als ein kleines Feld von Sternen vorzustellen, die zum eigenen Grundstück gehören.
Aber diese gesegnete Beharrlichkeit, mit der Zuneigung Wurzeln schlagen kann, hatte in Gwendolens Leben gefehlt. Nur ein Jahr vor ihrer Rückkehr aus Leubronn war Offendene als Zuhause für ihre Mutter ausgewählt worden, einfach wegen der Nähe zum Pfarrhaus von Pennicote, und Frau Davilow, Gwendolen und ihre vier Halbschwestern (die Gouvernante und das Dienstmädchen in einem anderen Fahrzeug) zum ersten Mal die Allee entlanggefahren worden waren, an einem späten Oktobernachmittag, als die Saatkrähen laut über ihnen krabbelten und die gelben Ulmenblätter wirbelten.
Die Jahreszeit passte zum Aussehen des alten, länglichen Hauses aus rotem Backstein, das an jeder Linie etwas zu ängstlich mit Stein verziert war, nicht ausgenommen die doppelte Reihe schmaler Fenster und der große quadratische Portikus. Der Stein begünstigte eine grünliche Flechte, der Ziegelstein ein pudriges Grau, sodass das Gebäude zwar streng rechteckig war, aber keine Härte in der Physiognomie aufwies, die es den drei Alleen zuwandte, die im Abstand von hundert Metern in Ost-, West- und Südrichtung in die hundert Meter breite alte Plantage führten, die das unmittelbare Gelände umgab. Man hätte sich gewünscht, das Haus wäre auf einer Anhöhe gelegen, sodass man über sein eigenes kleines Grundstück hinaus auf die langen Strohdächer der entfernten Dörfer, die Kirchtürme, die verstreuten Gehöfte, den allmählichen Anstieg der wogenden Wälder und die grünen Weiten des hügeligen Parks hätte blicken können, die das schöne Antlitz der Erde in diesem Teil von Wessex ausmachten. Aber obwohl es so im Hintergrund stand, wie eine Tribüne inmitten flacher Weiden, erhaschte es auf der einen Seite einen Blick auf die weite Welt in den hohen Kurven der Kreidefelsen, großartige, unveränderliche Formen, die von den wechselnden Tagen bespielt wurden.
Das Haus war gerade groß genug, um als Herrenhaus zu gelten, und war zu einem mäßigen Preis gemietet, da kein Gutshof damit verbunden war und es sich mit seinem düsteren Mobiliar und den verblichenen Polstermöbeln nur schwer vermieten ließ. Doch innen wie außen war es von einer Art, die keinem Betrachter den Gedanken nahelegte, es könne von zurückgezogenen Kaufleuten bewohnt sein – eine Gewissheit, die für Mieter, die nicht nur einen Geschmack hatten, der sich vor neuem Prunk scheute, sondern sich auch in jenem Grenzgebiet des gesellschaftlichen Ranges bewegten, wo jede Annexion ein heißes Thema war, viele Annehmlichkeiten aufwog. Und in ein Haus einzuziehen, das einst für verwitwete Gräfinnen genügt hatte, verlieh Frau Davilows Genugtuung, ein eigenes Heim zu besitzen, einen spürbaren Anstrich von Stolz. Dass dies plötzlich möglich wurde, war Gwendolen ein Rätsel, und es schien mit dem Tod ihres Stiefvaters, Hauptmann Davilow, zusammenzuhängen, der in den letzten neun Jahren seine Familie nur flüchtig und unregelmäßig aufgesucht hatte – gerade oft genug, um sie mit seinen langen Abwesenheiten zu versöhnen. Doch Gwendolen kümmerte sich weit mehr um die Tatsache als um deren Erklärung. All ihre Aussichten hatten sich dadurch angenehmer gestaltet. Sie hatte die frühere Lebensweise missbilligt, das Umherziehen von einem ausländischen Badeort oder Pariser Appartement zum nächsten, stets neue Abneigungen gegen neue Suiten gemieteter Möbel empfindend und neue Menschen unter Umständen kennenlernend, die sie wenig bedeutend erscheinen ließen. Und die Abwechslung, zwei Jahre an einer prunkvollen Schule verbracht zu haben, wo sie bei jeder Gelegenheit zur Schau gestellt wurde, hatte nur ihr Empfinden vertieft, dass eine so außergewöhnliche Person wie sie kaum in gewöhnlichen Verhältnissen oder in einer weniger vorteilhaften gesellschaftlichen Stellung verbleiben könne. Jede Furcht vor letzterem Übel war nun verflogen, da ihre Mama ein eigenes Heim haben sollte; denn was die Herkunft betraf, war Gwendolen völlig unbesorgt. Sie hatte keine Vorstellung davon, wie ihr mütterlicher Großvater zu dem Vermögen gekommen war, das seine beiden Töchter geerbt hatten; aber er war ein Westindier gewesen – was offenbar keine weiteren Fragen zuließ. Und sie wusste, dass die Familie ihres Vaters so hochgestellt war, dass sie von ihrer Mama keinerlei Notiz nahm, die dennoch mit großem Stolz das Miniaturporträt einer Lady Molly aus jener Verbindung bewahrte. Wahrscheinlich hätte sie viel mehr über ihren Vater gewusst, wäre da nicht ein kleines Ereignis gewesen, das sich ereignete, als sie zwölf Jahre alt war. Frau Davilow hatte, wie sie es nur in weiten Abständen tat, verschiedene Erinnerungsstücke an ihren ersten Ehemann hervorgeholt, und während sie Gwendolen dessen Miniatur zeigte, erinnerte sie mit einer Inbrunst, die auf eine besondere kindliche Anteilnahme zu zählen schien, daran, dass der liebe Papa gestorben sei, als seine kleine Tochter noch in langen Windeln lag. Gwendolen, die sogleich an den wenig liebenswerten Stiefvater dachte, den sie den größten Teil ihres Lebens gekannt hatte, während ihre Röcke noch kurz gewesen waren, sagte –
„Warum hast du wieder geheiratet, Mama? Es wäre schöner gewesen, wenn du es nicht getan hättest.“
Frau Davilow errötete tief, eine leichte, zuckende Bewegung ging über ihr Gesicht, und sie schloss die Gedenkreden sofort mit einer für sie ungewöhnlichen Heftigkeit –
„Du hast kein Gefühl, Kind!“
Gwendolen, die ihre Mutter liebte, fühlte sich verletzt und beschämt und hatte es seitdem nie wieder gewagt, eine Frage über ihren Vater zu stellen.
Dies war nicht der einzige Fall, in dem sie sich selbst den Schmerz kindlicher Gewissensbisse zugefügt hatte. Wenn möglich, wurde immer dafür gesorgt, dass sie ein kleines Bett im Zimmer ihrer Mutter hatte; denn die mütterliche Zärtlichkeit von Frau Davilow galt vor allem ihrem ältesten Mädchen, das in ihrer glücklicheren Zeit geboren worden war. Eines Nachts, als sie von Schmerzen geplagt wurde, stellte sie fest, dass das regelmäßig neben ihr Bett gestellte Medikament vergessen worden war, und bat Gwendolen, aus dem Bett zu steigen und es für sie zu holen. Die gesunde junge Dame, die es auf ihrer kleinen Couch kuschelig warm wie ein rosiges Kleinkind hatte, weigerte sich, in die Kälte hinauszugehen, und blieb murrend völlig still liegen. Frau Davilow verzichtete auf die Medizin und machte ihrer Tochter nie Vorwürfe; aber am nächsten Tag war Gwendolen sehr bewusst, was ihre Mutter denken musste, und versuchte, es durch Liebkosungen wiedergutzumachen, die ihr keine Mühe bereiteten. Da sie immer das Nesthäkchen und der Stolz des Haushalts gewesen war, umsorgt von Mutter, Schwestern, Gouvernante und Dienstmädchen, als wäre sie eine Prinzessin im Exil, fiel es ihr natürlich schwer, ihr eigenes Vergnügen als weniger wichtig zu betrachten als das der anderen, und als es ihr verwehrt wurde, verspürte sie einen erstaunlichen Groll, der sich in ihren raueren Tagen in einer jener leidenschaftlichen Handlungen entlud, die wie ein Widerspruch zu den gewohnten Neigungen aussehen. Obwohl sie selbst als Kind nie gedankenlos grausam war, nein, es bereitete ihr Freude, ertrinkende Insekten zu retten und zu beobachten, wie sie sich erholten, gab es eine unangenehme stille Erinnerung daran, dass sie den Kanarienvogel ihrer Schwester in einem letzten Anfall von Verzweiflung wegen seines schrillen Gesangs erwürgt hatte, der ihren eigenen immer wieder störend unterbrochen hatte. Sie hatte sich die größte Mühe gegeben, ihrer Schwester als Vergeltung eine weiße Maus zu kaufen, und obwohl sie sich innerlich mit einer besonderen Empfindlichkeit entschuldigte, die ein Zeichen ihrer allgemeinen Überlegenheit war, hatte der Gedanke an diesen heimtückischen Mord sie immer zusammenzucken lassen. Gwendolens Natur war nicht unbarmherzig, aber sie machte sich das Leben gern leicht, und jetzt, wo sie zwanzig und älter war, hatte sich ein Teil ihrer ursprünglichen Kraft in Selbstbeherrschung verwandelt, mit der sie sich vor demütigender Reue schützte. Sie zeigte mehr Feuer und Willen als je zuvor, aber dahinter steckte mehr Berechnung.
An diesem Tag der Ankunft in Offendene, den nicht einmal Frau Davilow zuvor gesehen hatte – der Ort wurde ihr von ihrem Schwager, Herrn Gascoigne, gezeigt –, als alle aus dem Wagen gestiegen waren und unter dem Vordach vor der offenen Tür standen, so dass sie einen allgemeinen Überblick über den Ort und einen Blick auf die steinerne Halle und die Treppe mit den düsteren Bildern werfen konnten, Gascoigne – gezeigt worden war, als alle aus dem Wagen gestiegen waren und unter der Veranda vor der offenen Tür standen, so dass sie einen allgemeinen Überblick über den Ort und einen Blick auf die steinerne Halle und die Treppe werfen konnten, die mit düsteren Bildern behängt, aber durch ein helles Holzfeuer belebt waren, sprach niemand; Mama, die vier Schwestern und die Gouvernante schauten alle Gwendolen an, als ob ihre Gefühle ganz von ihrer Entscheidung abhingen. Von den Mädchen, von Alice im Alter von sechzehn Jahren bis Isabel im Alter von zehn Jahren, konnte man auf den ersten Blick kaum etwas anderes sagen, als dass sie mädchenhaft waren und dass ihre schwarzen Kleider schon ziemlich abgetragen aussahen. Fräulein Merry war älter und wirkte insgesamt neutral. Frau Davilows abgenutzte Schönheit wirkte umso erbärmlicher durch den Blick, mit dem sie Gwendolen anhimmelte, die sich mit einem Ausdruck schnellen Urteilsvermögens im Haus, in der Landschaft und in der Eingangshalle umsah. Stell dir ein junges Rennpferd auf der Koppel zwischen ungepflegten Ponys und geduldigen Arbeitspferden vor.
„Na, Liebes, was hältst du von dem Ort?“, fragte Frau Davilow schließlich in einem sanften, abwertenden Ton.
„Ich finde es bezaubernd“, sagte Gwendolen schnell. „Ein romantischer Ort; hier kann alles Mögliche Wunderbares geschehen; es wäre eine gute Kulisse für alles. Niemand muss sich schämen, hier zu leben.“
„Es ist sicherlich nichts Gewöhnliches daran.“
„Oh, es würde für gefallene Adelige oder jede Art von großer Armut reichen. Wir hätten eigentlich in Pracht leben sollen und sind auf diesen Stand herabgekommen. Es wäre so romantisch wie nur möglich gewesen. Aber ich dachte, mein Onkel und meine Tante Gascoigne würden hier sein, um uns zu treffen, und meine Cousine Anna“, fügte Gwendolen hinzu, und ihr Tonfall änderte sich zu scharfer Überraschung.
„Wir sind zu früh dran“, sagte Frau Davilow und betrat den Flur. Sie wandte sich an die Haushälterin, die auf sie zukam, und fragte: „Erwarten Sie Herrn und Frau Gascoigne?“
"Ja, Madam; sie waren gestern hier, um besondere Anweisungen bezüglich der Feuer und des Abendessens zu geben. Aber was die Feuer angeht, so habe ich sie in der letzten Woche in allen Räumen brennen lassen, und alles ist gut gelüftet. Ich könnte mir wünschen, dass einige der Möbel für all die Reinigung, die sie hatten, besser bezahlt würden, aber ich denke, du wirst sehen, dass die golden glänzenden Teile in Ordnung gebracht wurden. Ich denke, wenn Herr und Frau Gascoigne kommen, werden sie dir sagen, dass nichts vernachlässigt wurde. Sie werden sicher um fünf hier sein.
Damit war Gwendolen zufrieden, die nicht bereit war, ihre Ankunft mit Gleichgültigkeit zu behandeln; und nachdem sie ein Stück die verfilzte Steintreppe hinaufgestolpert war, um sich dort umzusehen, stolperte sie wieder hinunter und schaute, gefolgt von allen Mädchen, in jedes der vom Flur aus zugänglichen Zimmer – das Esszimmer ganz in dunkler Eiche und abgenutztem rotem Satin-Damast, mit einer Kopie knurrender, besorgter Hunde von Snyders über dem Sideboard und ein Christus, der das Brot bricht, über dem Kaminsims; die Bibliothek mit einem allgemeinen Aussehen und Geruch von altem braunem Leder; und schließlich der Salon, der durch einen kleinen Vorraum betreten wurde, der mit ehrwürdigem Schnickschnack überfüllt war.
„Mamma, Mamma, komm bitte her!“, sagte Gwendolen, während Frau Davilow langsam im Gespräch mit der Haushälterin folgte. „Hier ist eine Orgel. Ich werde die Heilige Cäcilia sein: Jemand soll mich als Heilige Cäcilia malen. Jocosa (so nannte sie Fräulein Merry), lass mein Haar herunter. Siehst du, Mamma?“
Sie hatte Hut und Handschuhe abgelegt und setzte sich in einer bewundernswerten Pose vor die Orgel, den Blick nach oben gerichtet; während die unterwürfige und traurige Jocosa den einen Kamm herausnahm, mit dem die Haarsträhne befestigt war, und dann die Masse so lange schüttelte, bis sie in einem glatten hellbraunen Strom weit unter die schlanke Taille ihrer Besitzerin fiel.
Frau Davilow lächelte und sagte: „Ein bezauberndes Bild, meine Liebe!“ Ihr gefiel die Zurschaustellung ihres Haustiers, selbst in Anwesenheit einer Haushälterin. Gwendolen stand auf und lachte vor Freude. All dies schien genau richtig zu sein, um ein neues Haus zu betreten, das einen so hervorragenden Hintergrund abgab.
„Was für ein seltsames, malerisches Zimmer!“, fuhr sie fort und sah sich um. „Ich mag diese alten bestickten Stühle, die Girlanden an der Wandverkleidung und die Bilder, die alles Mögliche sein könnten. Das mit den Rippen – nichts als Rippen und Dunkelheit – ich würde sagen, das ist spanisch, Mama.“
„Oh, Gwendolen!“, sagte die kleine Isabel in einem Ton der Verwunderung, während sie eine aufklappbare Verkleidung der Täfelung am anderen Ende des Raumes offenhielt.
Alle, Gwendolen zuerst, gingen hin, um nachzusehen. Die geöffnete Verkleidung hatte das Bild eines toten, nach oben gerichteten Gesichts freigegeben, von dem eine undurchsichtige Gestalt mit ausgestreckten Armen zu fliehen schien. „Wie schrecklich!“, sagte Frau Davilow mit einem Ausdruck puren Ekels; aber Gwendolen schauderte still, und Isabel, ein schlichtes und insgesamt unbequemes Kind mit einem beunruhigenden Gedächtnis, sagte:
„Du wirst dich niemals allein in diesem Zimmer aufhalten, Gwendolen.“
„Wie kannst du es wagen, Dinge zu öffnen, die verschlossen bleiben sollten, du perverse kleine Kreatur?“, sagte Gwendolen in ihrem ärgerlichsten Ton. Dann riss sie dem Übeltäter die Platte aus der Hand, schloss sie hastig und sagte: „Es gibt ein Schloss – wo ist der Schlüssel? Lass den Schlüssel finden oder lass einen anfertigen und lass ihn niemanden wieder öffnen; oder besser, lass den Schlüssel zu mir bringen.“
Auf diesen Befehl an alle im Allgemeinen drehte sich Gwendolen mit einem Gesicht um, das von ihrem kalten Schauder gerötet war, und sagte: „Lass uns in unser eigenes Zimmer gehen, Mama.“
Die Haushälterin fand den Schlüssel in der Schublade des Schranks in der Nähe der Verkleidung und reichte ihn kurz darauf Bugle, der Zofe, mit der bedeutungsvollen Anweisung, ihn ihrer Königlichen Hoheit zu geben.
„Ich weiß nicht, was Sie meinen, Frau Startin“, sagte Bugle, die während der Szene im Salon oben beschäftigt gewesen war und sich über diese Ironie einer neuen Bediensteten ziemlich beleidigt fühlte.
„Ich meine die junge Dame, die uns alle befehligen soll – und die in Aussehen und Figur durchaus würdig ist“, antwortete Frau Startin versöhnlich. „Sie wird wissen, welcher Schlüssel es ist.“
„Wenn du alles vorbereitet hast, was wir wollen, dann sieh nach den anderen, Bugle“, hatte Gwendolen gesagt, als sie und Frau Davilow ihr schwarz-gelbes Schlafzimmer betraten, in dem eine hübsche kleine weiße Couch neben dem schwarz-gelben Katafalk, der als das beste Bett bekannt war, stand. „Ich werde Mama helfen.“
Aber ihr erster Gang führte sie zu dem großen Spiegel zwischen den Fenstern, der sie und den Raum vollständig vor Augen hielt, während ihre Mutter sich hinsetzte und ebenfalls das Spiegelbild betrachtete.
„Das ist ein schönes Glas, Gwendolen; oder ist es die schwarz-goldene Farbe, die dich zur Geltung bringt?“, sagte Frau Davilow, als Gwendolen schräg stand, ihr Gesicht zu drei Vierteln dem Spiegel zugewandt und ihre linke Hand ihr Haar zurückstrich.
„Ich sollte eine leidliche Heilige Cäcilie abgeben, mit ein paar weißen Rosen auf dem Kopf“, sagte Gwendolen, „nur was ist mit meiner Nase, Mama? Ich glaube, die Nasen von Heiligen sind nie im Geringsten nach oben gebogen. Ich wünschte, du hättest mir deine vollkommen gerade Nase gegeben; sie hätte für jede Art von Charakter gepasst – eine Allround-Nase. Meine ist nur eine fröhliche Nase; sie würde sich nicht so gut für eine Tragödie eignen.“
„Oh, meine Liebe, jede Nase ist gut genug, um sich in dieser Welt mit ihr elend zu fühlen“, sagte Frau Davilow mit einem tiefen, müden Seufzer, warf ihre schwarze Haube auf den Tisch und stützte ihren Ellbogen in der Nähe davon ab.
„Aber Mama“, sagte Gwendolen in einem nachdrücklich mahnenden Tonfall und wandte sich mit einem verärgerten Gesichtsausdruck vom Spiegel ab, „fang jetzt nicht an, trübsinnig zu werden. Das verdirbt mir die ganze Freude, und jetzt könnte alles so glücklich sein. Was hast du denn jetzt, worüber du dich grämen müsstest?“
„Nichts, Liebes“, sagte Frau Davilow, schien sich zu sammeln und begann, ihr Kleid auszuziehen. „Es genügt mir immer, dich glücklich zu sehen.“
„Aber du solltest selbst glücklich sein“, sagte Gwendolen immer noch unzufrieden, obwohl sie ihrer Mutter mit streichelnden Berührungen helfen wollte. „Kann niemand glücklich sein, wenn er noch ganz jung ist? Du hast mir manchmal das Gefühl gegeben, als wäre nichts von Nutzen. Mit den Mädchen, die so lästig sind, und Jocosa, die so gefürchtet hölzern und hässlich ist, und alles, was an uns provisorisch ist, und du, der so langweilig aussieht – wozu war es gut, dass ich überhaupt etwas bin? Aber jetzt könntest du glücklich sein.“
„Das werde ich, Liebes“, sagte Frau Davilow und tätschelte die Wange, die sich ihr zuneigte.
„Ja, aber wirklich. Nicht mit einer Art Scheinwelt“, sagte Gwendolen mit entschlossener Beharrlichkeit. „Sieh nur, was für eine Hand und ein Arm! – viel schöner als meine. Jeder kann sehen, dass du insgesamt schöner warst.“
„Nein, nein, Liebes; ich war immer schwerer. Nie halb so charmant wie du.“
„Nun, aber was nützt es mir, charmant zu sein, wenn es damit endet, dass ich langweilig werde und mich um nichts mehr kümmere? Ist es das, was die Ehe immer bringt?“
„Nein, Kind, ganz sicher nicht. Die Ehe ist der einzige glückliche Zustand für eine Frau, und ich vertraue darauf, dass du das beweisen wirst.“
„Ich werde es nicht hinnehmen, wenn es kein glücklicher Zustand ist. Ich bin entschlossen, glücklich zu sein – zumindest nicht mein Leben weiter so zu vergeuden wie andere Leute, indem ich nichts Bemerkenswertes bin und tue. Ich habe mich entschieden, mich nicht mehr von anderen Leuten stören zu lassen, wie sie es getan haben. Hier ist etwas warmes Wasser für dich, Mama“, endete Gwendolen, zog ihr eigenes Kleid aus und wartete dann darauf, dass ihre Mutter ihr die Haare aufwickelte.
Es herrschte ein oder zwei Minuten lang Stille, bis Frau Davilow, während sie die Haare der Tochter aufwickelte, sagte: „Ich bin sicher, dass ich dich nie gekränkt habe, Gwendolen.“
„Du verlangst oft von mir, etwas zu tun, was ich nicht mag.“
„Du meinst, Alice Nachhilfe zu geben?“
„Ja. Und ich habe es getan, weil du mich darum gebeten hast. Aber ich sehe nicht, warum ich es sonst tun sollte. Es langweilt mich zu Tode, sie ist so langsam. Sie hat kein Ohr für Musik, Sprache oder irgendetwas anderes. Es wäre viel besser für sie, unwissend zu sein, Mama: Das ist ihre Rolle, sie würde es gut machen.“
„Das ist schwer zu sagen, bei deiner armen Schwester Gwendolen, die so gut zu dir ist und dich von Kopf bis Fuß bedient.“
„Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, die Dinge beim Namen zu nennen und sie an ihren richtigen Platz zu rücken. Die Not besteht für mich darin, dass ich meine Zeit mit ihr verschwenden muss. Lass mich jetzt deine Haare hochstecken, Mama.“
„Wir müssen uns beeilen; dein Onkel und deine Tante werden bald hier sein. Um Himmels willen, sei nicht abfällig gegenüber ihnen, mein liebes Kind! Oder gegenüber deiner Cousine Anna, mit der du immer ausgehen wirst. Versprich es mir, Gwendolen. Du weißt, dass du nicht erwarten kannst, dass Anna dir ebenbürtig ist.“
„Ich will nicht, dass sie mir ebenbürtig ist“, sagte Gwendolen mit einem Kopfschütteln und einem Lächeln, und damit endete die Diskussion.
Als Herr und Frau Gascoigne mit ihrer Tochter kamen, verhielt sich Gwendolen ihnen gegenüber alles andere als verächtlich, sondern so anmutig wie möglich. Sie stellte sich Verwandten neu vor, die sie seit ihrem vergleichsweise unfertigen Alter von sechzehn Jahren nicht mehr gesehen hatten, und sie war besorgt – nein, nicht besorgt, sondern entschlossen, dass sie sie bewundern sollten.
Frau Gascoigne ähnelte ihrer Schwester. Aber sie war dunkler und schlanker, ihr Gesicht war nicht von Kummer gezeichnet, ihre Bewegungen waren weniger träge, ihr Ausdruck wacher und kritischer als der einer Rektorin, die eine wohltätige Autorität ausüben sollte. Ihre größte Ähnlichkeit lag in ihrer nicht widerstrebenden Art, die zur Nachahmung und zum Gehorsam neigte; aber dies hatte sie aufgrund der unterschiedlichen Umstände zu sehr unterschiedlichen Themen geführt. Die jüngere Schwester war in ihren Ehen indiskret oder zumindest unglücklich gewesen; die ältere Schwester glaubte, die beneidenswerteste aller Ehefrauen zu sein, und ihre Nachgiebigkeit hatte dazu geführt, dass sie manchmal Formen von überraschender Bestimmtheit annahm. Viele ihrer Ansichten, wie die über die Kirchenregierung und den Charakter von Erzbischof Laud, schienen bei jeder Änderung zu entschieden, um auf andere Weise als durch die Empfänglichkeit einer Ehefrau zustande gekommen zu sein. Und es gab viel, was das Vertrauen in die Autorität ihres Mannes förderte. Er hatte einige angenehme Tugenden, einige bemerkenswerte Vorteile, und die ihm zugeschriebenen Schwächen neigten alle zur Seite des Erfolgs.
Einer seiner Vorzüge war ein stattliches Äußeres, das mit siebenundfünfzig Jahren vielleicht noch eindrucksvoller wirkte als in früheren Lebensjahren. In seinem Gesicht fanden sich keine ausgeprägt geistlichen Züge, keine Spur von steifer Förmlichkeit oder gesuchter Lässigkeit: in seinem Inverness-Mantel hätte man ihn nicht anders erkannt als als einen Gentleman mit markanten dunklen Gesichtszügen, einer Nase, die zunächst den Anschein hatte, gebogen zu sein, dann aber plötzlich gerade wurde, und eisengrauem Haar. Vielleicht verdankte er diese Freiheit von jener Art beruflicher Maske, die Haut, Tonfall und Gebärden durchdringt und sich durch kein Gewand verbergen lässt, der Tatsache, dass er einst Hauptmann Gaskin gewesen war und erst kurz vor seiner Verlobung mit Fräulein Armyn in den geistlichen Stand getreten war – samt dem dazugehörigen Diphthong. Hätte jemand eingewendet, seine Vorbereitung auf das geistliche Amt sei unzureichend gewesen, so hätten seine Freunde fragen können, wer denn eine bessere Figur darin abgebe, wer besser predige oder mehr Autorität in seiner Gemeinde besitze? Er hatte ein angeborenes Talent zur Verwaltung, war nachsichtig gegenüber Meinungen wie auch gegenüber dem Verhalten anderer, weil er sich imstande fühlte, beides zu überstimmen, und frei war von den Reizbarkeiten bewusster Schwäche. Mit einem wohlwollenden Lächeln begegnete er den Schwächen eines Geschmacks, den er nicht teilte – etwa der Blumenzucht oder der Altertumskunde, die unter seinen Amtsbrüdern in der Diözese sehr in Mode waren: er selbst zog es vor, den Verlauf eines Feldzugs zu verfolgen oder aus seiner Kenntnis von Nesselrodes Beweggründen zu erschließen, wie dessen Verhalten wohl gewesen wäre, hätte sich unser Kabinett anders entschieden. Herr Gascoignes Denkweise war nach einigen längst abgeklungenen Schwankungen eher kirchlich als theologisch geworden; nicht im Sinne des modernen Anglikanismus, sondern in dem, was er als solide englische Haltung bezeichnet hätte, frei von Unsinn – wie es einem Mann anstand, der eine Nationalkirche bei Tageslicht betrachtete und sie in ihrem Verhältnis zu anderen Dingen sah. Kein geistlicher Friedensrichter hatte größeres Gewicht bei den Sitzungen oder zeigte weniger von jener schädlichen Unpraktikabilität im Umgang mit weltlichen Angelegenheiten. In der Tat war der schlimmste Vorwurf, der gegen ihn erhoben wurde, der der Weltlichkeit: es ließ sich nicht beweisen, dass er die weniger Begünstigten im Stich ließ, doch war nicht zu leugnen, dass die Freundschaften, die er pflegte, von einer Art waren, die dem Vater von sechs Söhnen und zwei Töchtern nützlich sein konnten; und boshafte Beobachter – denn in Wessex gab es vor zehn Jahren noch Menschen, deren Bitterkeit heute kaum mehr glaubhaft erscheint – bemerkten, dass sich die Färbung seiner Ansichten im Einklang mit diesem Handlungsprinzip verändert habe. Doch fröhliche, erfolgreiche Weltlichkeit hat den trügerischen Anschein, selbstsüchtiger zu sein als die beißende, erfolglose Art, deren geheime Geschichte sich in den schrecklichen Worten zusammenfassen lässt: „Verkauft, aber nicht bezahlt.“