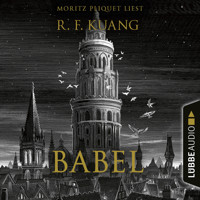8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Autumn Rose ist anders. Da sie über magische Kräfte verfügt, ist ihr Leben voller Verpflichtungen - worunter auch die Aufsicht über ihre Mitschüler fällt. Das macht es nicht gerade einfach, Freundschaften zu schließen. Und als der gut aussehende Prinz Fallon in ihrer Schule auftaucht und ihr größtes Geheimnis verrät, wird alles nur noch schlimmer. Doch das wird bedeutungslos, als Autumn düstere Visionen heimsuchen. Eine Prophezeiung beginnt sich zu erfüllen. Neun dunkle Heldinnen sollen die Menschheit vor finsteren Mächten bewahren. Und die erste dunkle Heldin, Violet Lee, ist gerade erwacht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Lesen was ich will!
www.lesen-was-ich-will.de
Übersetzung aus dem Englischen von Diana Bürgel
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96727-3© 2014 Abigail GibbsDie englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Autumn Rose« bei Harper Collins Publishers, New York.Deutschsprachige Ausgabe:© ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenCovermotiv: FinePic, MünchenDatenkonvertierung: psb, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
O Engel, verführe mich in meiner Jugend!Raube mir den VerstandUnd lasse mir nur die ursprünglichste aller Freuden,Denn ich gehöre dir,Bis zu jenem Tag, an dem Gott mich zu sich ruft.
Ich habe wohl immer gewusst, dass ich anders bin;
dass mein Schicksal in Stein geschrieben ist und dass ein kalter, harter Thron einst der meine sein würde.
Ein Symbol dessen, was ich bin. Eine Königin meines Volkes.
Eine Göttin unter vielen.
Ich schlief. Eine grüne Wiese breitete sich vor mir aus, und ich rannte, schrie ihren Namen in einer Sprache, deren Klang mir ebenso vertraut war wie der dunkle Umriss des vor mir aufragenden grauen Steingebäudes. Tränen liefen mir über die Wangen, während ich mich die Eingangstreppe emporkämpfte und das Stimmengewirr vernahm, das durch die geschlossene Flügeltür herausdrang. Ein monotones Plätschern wie das des Baches, der am Haus vorbeifloss und während der winterlichen Regenfälle anschwoll. Meine polierten, klobigen Schuluniformschuhe gaben ein protestierendes Quietschen von sich, als ich die Türen aufstieß und mich jenem Anblick stellte, den ich schon tausendmal gesehen hatte. Hunderte von Gesichtern wandten sich mir zu. Dann senkte sich Schwärze über alles. Atemlos wartete ich darauf, dass alles wieder von vorn beginnen würde, wie schon so oft.
Aber dieses Mal geschah etwas anderes. Statt schweißgebadet und mit tränennassen Wangen in einem zerwühlten Bett zu erwachen, glitt ich in eine andere Szene hinüber. Jetzt ragte eine riesige Statue vor mir empor. Sonnenlicht ließ das helle Pflaster des Platzes, auf dem ich stand, erstrahlen und glitzerte auf dem Wasser der beiden vollkommen identischen Brunnen neben mir. Als hätte jemand die Vorspultaste gedrückt, beschleunigte sich plötzlich das Geschehen um mich herum, und starr beobachtete ich, wie Tausende von Geschäftsleuten und mit Fotoapparaten bewaffnete Touristen den Platz überquerten. Die Wolken segelten über den grauen Himmel, bis er schließlich dunkel wurde und sich die Nacht über den Platz senkte. Die Statue von Admiral Nelson erstrahlte auf ihrer Säule im Scheinwerferlicht, und die Menschenmassen verloren sich. Schließlich war der Trafalgar Square vollkommen verlassen, abgesehen von ein paar Tauben und einem einsamen Mädchen.
Die Szene verlangsamte sich wieder und konzentrierte sich jetzt auf jenes Mädchen. Dunkles Haar umrahmte ihr Gesicht, und sie trug einen halb aufgeknöpften Mantel, der den Blick auf ein tiefes Dekolleté freigab. Immer wieder versuchte sie, den Rocksaum ihres schwarzen Kleides herunterzuziehen, um mehr Haut zu bedecken. Sie war weder besonders blass noch gebräunt, und das Auffälligste an ihr waren eindeutig ihre Augen. Violett leuchteten sie im Schein ihres Handydisplays.
Sie schob ihr Telefon in die Manteltasche und setzte sich auf eine der langen Steinbänke unter den Bäumen, die den Platz säumten. Kurz darauf zuckte sie zusammen und hob alarmiert den Kopf.
Plötzlich wechselte die Szene erneut, und ich sah eine dunkle, gerinnende Flüssigkeit, die das Pflaster bedeckte und das Wasser der Brunnen rot färbte. Überall lagen Tote und Sterbende, deren letzte Lebenskraft aus klaffenden Wunden an ihren Hälsen sickerte und die Steine der Stadt tränkte, jener Stadt, die ich so gut kannte und so sehr liebte. Die Stadt, aus der man mich vertrieben hat …
Ich fuhr hoch und erwachte aufrecht sitzend im Bett. Überrascht tastete ich nach dem Lichtschalter meines Weckers. Es war gerade ein Uhr morgens.
Schweißgebadet und schwer atmend drückte ich den Wecker an mich, dessen Licht nun das Zimmer erhellte. Hier war nichts, aber jedes Mal wenn ich blinzelte, sah ich es wieder: das Blut, die Leichen und die violetten Augen …
Stöhnend griff ich nach einem Stift, streckte mich nach dem Kalender, der über meinem Bett hing, und strich ein weiteres Kästchen durch. Der nächste Tag der geradezu vorüberfliegenden Sommerferien hatte begonnen. Heute war der 31. Juli.
»Seht nur, wer da kommt: unsere Lieblingseinsiedlerin.« Eine Schürze segelte auf mich zu. Ich fing sie auf, faltete sie auseinander und band sie mir um.
»Guten Morgen, Nathan.«
»Hast du das gehört, Sophie?«, fragte er und wandte sich der neuen, jungen Kellnerin zu, auf deren Armen ein Stapel sauberer weißer Teller wuchs, während der viel ältere Nathan die Spülmaschine ausräumte. »Heute ist ein guter Morgen. Wie ungewöhnlich.«
Ich musterte Sophie und versuchte zu entscheiden, ob ich sie zuvor schon einmal gesehen hatte oder ob sie nur einfach nicht von den anderen dürren Mädchen zu unterscheiden war, die hier an den Wochenenden arbeiteten.
»Und was meinst du mit Einsiedlerin?«, fragte ich Nathan, ohne den Blick von ihr zu lösen.
Sie starrte mich aus großen Augen an und tippte nervös mit dem Finger auf den Tellerrändern herum. Als ich einen Schritt zur Seite machte und nach einem Stapel Speisekarten hinter ihr griff, kiekste sie schrill und stolperte zurück. Die Teller fielen ihr aus den Händen.
Dann kennen wir uns also noch nicht.
Eine Bewegung mit meinem Finger, und schon erstarrten die Teller mitten in der Luft, glitten dann elegant zur Arbeitsplatte und stapelten sich darauf. Bevor das Mädchen reagieren konnte, hatte ich die vollgestopfte Küche bereits wieder verlassen und trat in den Hauptraum des Harbour Cafés hinaus. An der Eingangstür drehte ich das »Geschlossen«-Schild um, sodass nun von außen »Geöffnet« zu lesen war. Es war Ende August, und obwohl es noch immer sehr früh war, bevölkerten bereits erste Touristen den viel benutzten Fußgängerweg zwischen den Docks und dem exklusiveren Jachthafen. In der Ferne drängten sich Fischdampfer zwischen den Stegen und brachten den Geruch ihres Tagesfangs mit sich. Das Glas der Frontscheibe hielt auch das Klirren der Masten und die Schreie der Möwen nicht ab, die ausgeschwärmt waren, um sich ihren Anteil am Fisch zu holen. Dies war der Soundtrack, der unabdingbar zu einem Morgen im geschäftigen Brixham gehörte.
Nathan kam hinter dem Tresen hervor und durchquerte das Café mit wenigen großen Schritten, was ihm aufgrund seiner langen, schlaksigen Gestalt nicht schwerfiel. Mit entschuldigender Miene legte er den Kopf schief.
»Bevor du gekommen bist, hat sie mir erzählt, sie habe noch nie eine Sage gesehen«, erklärte er leise.
Ich zuckte mit den Schultern. Ihre Reaktion war keine Überraschung. In den Monaten, die ich nun schon im Café arbeitete, war Nathan der Einzige gewesen, der keinen großen Bogen um mich gemacht und kurz darauf wieder gekündigt hatte. Ich hatte meinen Job nur deshalb noch, weil es sich meine Chefin aus diesem Grund leisten konnte, mich nicht anständig zu bezahlen. Allerdings war sie die Einzige in der ganzen Stadt, die überhaupt bereit gewesen war, mich einzustellen, also beklagte ich mich nicht.
Als ich mich an ihm vorbeischieben wollte, legte mir Nathan seine tätowierte linke Hand auf den Arm. »Und Einsiedlerin deshalb, weil du seit einem Monat nicht mehr auf meine SMS antwortest.«
»Du warst in Island und ich in London.«
»Trotzdem hättest du antworten können.«
Ich griff nach dem Ärmel seines Kochkittels – der nicht weiß, sondern schwarz war – und zog seine Hand fort. Dann verteilte ich die Tageskarten auf die Tische. Nathan folgte mir, während ich mich durchs Café arbeitete.
»Wie war’s in Island?«, fragte ich endlich, um die Stille zu brechen.
»Schön. Demokratisch.«
Ich seufzte und rollte mit den Augen, hielt ihm jedoch weiterhin den Rücken zugewandt.
»Menschen und Sage leben dort zusammen in einer Gemeinschaft, nicht getrennt voneinander wie hier.« Ich drehte mich zu ihm um, und er deutete mit dem Daumen in Richtung Küche, aus der sich Sophie noch immer nicht herausgetraut hatte. »Oder überall sonst«, fügte er dann noch hinzu.
Ich hatte mir seine Theorien über die Beziehungen zwischen Menschen und Sage schon oft angehört, aber er hatte so lange für diesen Urlaub gespart, dass ich seine rosa Seifenblase eigentlich nicht platzen lassen wollte. Trotzdem …
»Sage? Dort leben doch nur Extermino.«
Ich konnte seine Augen nicht sehen, weil ihm seine braunen, fast schulterlangen Locken tief in die Stirn fielen, aber ich war mir sicher, dass er den Blick senkte.
»Extermino sind auch Sage, sie glauben nur an andere Dinge.«
»Ja klar, und ihre Narben sind nur deshalb grau, weil sie mit den Menschen Friede, Freude, Eierkuchen spielen«, spottete ich, obwohl an der Sache eigentlich gar nichts lustig war. »Sie sind gewalttätige, extremistische Rebellen, Nathan. Sie sind Feinde der Monarchie in Athenea und aller anderen dunklen Wesen. Vergiss das nicht.«
Er sah zu Boden und schob seine aufgerollten Ärmel zurecht. »Ich meine doch nur, dass die Dinge, so wie sie stehen, nicht unbedingt ideal sind, solange du und deinesgleichen ausgegrenzt werden …«
Das Klingeln eines Glöckchens unterbrach ihn, und wir wandten uns überrascht der Tür zu, als wäre es bemerkenswert, dass tatsächlich Kundschaft im Anmarsch war. Drei Mädchen blieben im Türrahmen stehen, offenbar ebenso stutzig wie wir, dann steuerten sie den Tisch am Fenster an.
»Viel Glück«, murmelte mir Nathan zu und zog sich in die Küche zurück.
Ich atmete tief durch, holte meinen Notizblock hervor und näherte mich dem Tisch.
»Guten Morgen, was darf’s sein?«, zwitscherte ich und tat dabei so, als würde ich die Mädchen nicht kennen.
Eine von ihnen warf sich ihr langes schwarzes Haar über die Schulter und funkelte mich unter ihrem schweren Pony hervor an. Sie war groß und breitschultrig und musste nicht einmal den Kopf in den Nacken legen, um mich anzusehen.
»Das Übliche, Hexe.«
Mein Griff um den Stift verkrampfte sich, und ich versuchte, mich auf das stetige Schlagen der Wellen gegen die Hafenmauer zu konzentrieren, das durch die Glasscheibe hereindrang.
»Ich war einen Monat nicht hier und weiß leider nicht mehr, was du und deine Freundinnen immer bestellt, Valerie«, knurrte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen.
Valerie Danvers war das, was man landläufig eine Tyrannin nannte. Meine persönliche Schultyrannin.
Der verdammte Kaffee war nicht mein Problem, sondern eher das, was sie sich immer zu essen bestellte.
Sie murmelte irgendetwas, aus dem ich das Wort »Sage« heraushörte, und orderte dann ein Gericht, strich dabei aber mindestens die Hälfte der Zutaten. Ihre Freundinnen waren kaum weniger unangenehm.
Ich brachte ihnen die Getränke, was mit dem üblichen geknurrten Dank quittiert wurde. Kurz darauf lehnte ich mich im Toilettenraum mit dem Rücken gegen die Tür und zwang mich dazu, tief durchzuatmen. Dieses Samstagmorgenritual bestand bereits, seitdem Valerie Danvers herausgefunden hatte, dass dieses Café der perfekte Ort war, um mich zu foltern.
Mit geschlossenen Augen konnte ich beinahe den Umriss jener zierlichen Frau – meiner Großmutter – vor mir sehen, die zwar nicht mehr die Jüngste, aber trotzdem noch in den besten Jahren war. Sie beugte sich zu einem kleinen Mädchen hinab und sprach. Immer sprach sie.
Sage-Kinder sind wie Efeu. Sie wachsen schnell und leben sehr lang. Menschenkinder sind eher wie Schmetterlinge. Als Larven sind sie hässlich, bis sie sich verpuppen und als Erwachsene wieder zum Vorschein kommen. Und die hässlichen Larven sind natürlich eifersüchtig auf den Efeu, verstehst du?
Ich kniff die Augen noch fester zusammen. Atmen …
Ein Hämmern an der Tür hinter mir riss mich in die Wirklichkeit zurück. Es war noch immer dunkel in dem kleinen Raum, und rasch zog ich an der Lampenschnur, woraufhin sich grelles, künstliches Licht ausbreitete.
»Autumn, ich weiß, dass du da drin bist. Komm sofort raus!«
»Nathan«, stöhnte ich. Er wusste doch genau, wie furchtbar Valerie war, warum ging er mir dann auf die Nerven?
»Da draußen stimmt etwas nicht!«
Meine Haut wurde heiß und prickelte, als Blut und Magie in meine Hände rauschten. Die Wände wurden durchlässig … aus weiter Ferne konnte ich einen Herzschlag hören, der immer schneller heranraste … und es war kein menschliches Herz.
Ich öffnete die Tür und lugte hinaus. Nathan stand blass davor, ansonsten war das Café leer. Ich trat hinaus und erkannte, dass sich Valerie und ihre Freundinnen über die Hafenmauer beugten und einen Tumult draußen auf dem Wasser beobachteten.
Ich rannte auf die Straße, und eine kalte Meeresbrise vertrieb die Hitze auf meiner Haut. Auch mein Herz schien einzufrieren. Einer der Stege vor mir war in eine dichte Nebelwolke gehüllt. Es sah aus, als hätte man ein Feuer entzündet, dessen Rauch den Steg vollständig verschluckte. Lichtblitze tanzten in der Wolke, und Schreie drangen heraus. Schreie um Gnade.
Ich erstarrte. Der rationale Teil meines Gehirns wusste, dass ich irgendwie helfen musste, aber meine Beine wollten sich nicht rühren.
Plötzlich rannte Nathan an mir vorbei, an der Hafenmauer entlang auf die Schreie zu. Das zerriss die Fesseln aus Angst, und ich warf mich in die Luft und flog über den Hafen, bis ich hart neben der Wolke landete.
Ich wusste nicht, was das für ein Nebel war, aber ich wagte es nicht, einen Magiestoß hineinzuschicken, weil er genauso gut einen der Menschen darin treffen konnte … also streckte ich stattdessen vorsichtig eine Hand aus, während hinter der anderen ein Feuerball lauerte.
Von Nahem sah es aus wie feiner Sprühregen, aber als ich es berührte, fühlte ich keine Feuchtigkeit …
Da spürte ich, wie sich die Grenze zwischen den Dimensionen öffnete, als würde ein Laken zerrissen. Diese Grenze konnte man nur mit Magie überwinden – mit starker Magie. Schwächere dunkle Wesen und Menschen konnten sie nicht durchdringen.
Die Furcht in meinem Herzen verdoppelte sich, als ich begriff, mit was für Feinden ich es hier zu tun hatte. Dagegen war ich machtlos.
Der Sog der Grenze riss mich nach vorn, und ich stolperte, wehrte mich dagegen, bis die weiße Wolke plötzlich in einem sich rasch schließenden schwarzen Loch verschwand. Es ging so schnell, dass ich nicht erkennen konnte, wer dies alles heraufbeschworen hatte.
Die Szene, die sich nun offenbarte, war furchtbar. Etwa zehn Menschen kauerten dort, einige lagen auf dem Boden, und ein paar von ihnen bluteten. Verwirrt und orientierungslos sahen sie sich um und blinzelten im hellen Sonnenlicht. Zwischen ihnen lag ein Mann auf dem Rücken. Um seinen Kopf sammelte sich eine Blutlache, doch ansonsten wirkte er unversehrt.
Eine Frau beugte sich über ihn und rüttelte an seiner Schulter, eine weitere Frau presste die Finger an sein Handgelenk. Dann legte sie der anderen eine blasse Hand auf den Arm und schüttelte den Kopf.
»Autumn, tu doch was!«, verlangte Nathan, der mich inzwischen eingeholt hatte.
Jetzt erst bemerkten mich die Menschen.
»Nein, Nathan, es ist zu spät für ihn. Ich kann nicht …«
Mit zornig funkelnden Augen schob mich Nathan vor. »Du bist eine Sage, natürlich kannst du. Sage können alles.«
Ich sah auf den Mann am Boden hinab und schüttelte mit Tränen in den Augen den Kopf. Warum tut er das? Nathan weiß doch, dass ich die Toten nicht zurückholen kann!
»Es ist deine Pflicht«, fuhr Nathan unbarmherzig fort.
Die Frau konnte gerade lange genug aufhören zu weinen, um ein paar Worte hervorzustoßen. »Sie hatten graue Narben … es waren zwei. Sie haben ihn mit einem schwarzen Lichtblitz getroffen.«
Graue Narben – Extermino! Und schwarzes Licht … Das war ein Todesfluch!
»Es tut mir leid, ich kann wirklich nicht …«
Ich wich zurück. Es gab nichts, was ich tun konnte, selbst wenn ich nicht wie gelähmt vor Angst vor den Extermino gewesen wäre … in Brixham. Sie haben Menschen angegriffen. Es ergab keinen Sinn. Irgendetwas sagte mir, dass sie es in Wahrheit auf einen Sage abgesehen hatten … und die einzige Sage hier weit und breit war ich.
Die Frau schrie auf und schüttelte den Mann an den Schultern. Ich konnte es nicht mehr ertragen und wandte mich ab. Den fassungslosen Nathan hinter mir lassend, schwang ich mich in die Luft hinauf und floh vor all dem Grauen.
Hausarbeit: »Mein Leben und meine Aufgabe«
Ich heiße Autumn Rose Al-Summers. Ich bin fast sechzehn Jahre alt und eine Sage. Als Wächterin besteht mein einziger Lebenszweck darin, die Menschen – genauer gesagt, die Schüler des Kable Community College – vor den Extermino zu beschützen. Die Extermino sind eine Gruppe von Sage, die nicht nach den Regeln unseres Königs leben und deren Narben wegen ihrer furchtbaren Verbrechen grau geworden sind.
Meine Großmutter, bei der ich acht Jahre lang in der St. Sapphire’s School in London gelebt habe, ist tot. Deshalb und weil ich nach dem Menschengesetz noch minderjährig bin, muss ich nun bei meinen Eltern in einer verschlafenen Kleinstadt an der Südküste Devons leben. Es gibt wohl nirgendwo sonst auf der Welt so wenige Sage wie hier.
Mein Volk wird von den Menschen dieser Dimension gefürchtet, verachtet und gleichzeitig mit Ehrfurcht betrachtet, was in erster Linie daran liegt, dass sie aus eigener Schuld rein gar nichts über unsere Kultur wissen – was meine Erfahrungen als Wächterin auf treffendste Weise demonstrieren. Vor einem Jahr habe ich in Kable angefangen und bin seither Opfer unablässiger Sticheleien geworden. Freunde habe ich nur wenige.
Dankenswerterweise endet nach dem kommenden Jahr die Schulpflicht für mich, was bedeutet, dass ich nur noch zehn weitere Monate der Folter ertragen muss, bis ich frei bin und die vorgeschriebenen zwei Jahre als Wächterin hinter mich gebracht habe. Obwohl ich diese Schule verabscheue, drängen Sie mich fortwährend, bis zum Abschluss zu bleiben. Aber ich kann Ihnen versichern: Eher legen die Verdammten ihre Messer nieder, als dass es so weit kommt.
Fahren wir fort. Ich habe blondes Haar mit kastanienfarbenen Strähnchen. Alles Natur, wie ich anmerken möchte. Bernsteinfarbene Augen. Meine Beine sind zu kurz. Ich kriege leicht Sonnenbrand. (Dies hier sind, wie ich betonen darf, die kurzen Sätze, die mein Schreibstil Ihrer Meinung nach vermissen lässt.)
Und was ist das Schlimmste von allem? (Sogar eine rhetorische Frage habe ich eingefügt. Ist es so richtig?) Das, was mich sofort als Sage kennzeichnet und zur öffentlichen Zielscheibe macht? Das, was mich grundlegend von den Menschen unterscheidet?
Meine Narben.
Alle Sage tragen sie auf der rechten Körperseite. Sie sind so individuell wie ein Fingerabdruck und dienen als Erinnerung an das, was wir sind, was wir besitzen und was wir beherrschen.
Bitte schön. Das ist mein Leben.
PS: Ich weigere mich, diese Arbeit abzutippen, also wird Ihnen – und dem Zweitprüfer, sollte er denn zurate gezogen werden – nichts anderes übrig bleiben, als meine elegante, verschlungene Handschrift, die ich im Alter von sechs Jahren erlernt habe, zu entziffern, wie Sie es nennen. Darüber hinaus empfinde ich diese Hausarbeit als eine Beleidigung meiner Intelligenz. Sie hätte in einer halben Schulstunde bewältigt werden können. Als Hausarbeit über den Sommer ist sie also vollkommen unnötig.
Ich überflog die Seite noch einmal und presste die Lippen aufeinander. Gefasel. Es war ein einziges Gefasel – wahres Gefasel zwar, aber diese Schimpftirade würde mir sicher Nachsitzen eintragen oder zumindest eine Verwarnung. Trotzdem konnte ich es mir einfach nicht verkneifen. Also schob ich das Blatt in eine Klarsichthülle und legte es auf meine Tasche, bereit für den ersten Tag des neuen Schuljahres.
Dann wandte ich mich wieder dem Spiegel zu und begann grob meine Haare zu bürsten. Es ziepte schmerzhaft, und ich zuckte zusammen. Ich beschloss, dass ich mich damit nicht weiter herumschlagen würde, murmelte ein paar Worte und sah zu, wie sich meine Locken von selbst glätteten. Nachdem ich meine Augen mit einem Kajalstift umrandet hatte, griff ich mir meine Tasche und sprang die Treppe mit einem Satz hinunter. Ich war spät dran.
»Mum! Ich fliege zur Schule, du musst mich also nicht an der Fähre absetzen.«
Da ich keine Antwort bekam, betrat ich die Küche, die jedoch leer war. Ich schnappte mir einen frisch gerösteten Toast und stopfte ihn mir in den Mund.
»Mum!« Das Wort kam durch das hastige Frühstück nur sehr gedämpft aus meinem Mund.
Da hörte ich jemanden »Wohnzimmer!« rufen und eilte durch den Flur. Als ich die Wohnzimmertür aufstieß, fand ich sie auf dem Diwan sitzend, den Laptop auf dem Schoß und eifrig tippend. Merkwürdige Zeichen und Symbole füllten den Bildschirm, und ich runzelte die Stirn.
»Ich fliege zur Schule.«
Sie seufzte, stellte den Laptop beiseite und stand auf, um mir einen Kuss auf die Wange zu geben. Als sie meinen Gesichtsausdruck bemerkte, klappte sie den Computer zu. »Nur etwas für die Arbeit. Apropos, du weißt doch noch, dass du fast die ganze Woche allein hier sein wirst, weil dein Vater und ich in London sind? Also keine wilden Partys. Verstanden?«
Entnervt seufzte ich auf, was in Gegenwart meiner Mutter häufiger vorkam. »Hätte sowieso keinen Sinn, Leute einzuladen, weil ja doch niemand kommen würde.«
»Hm«, machte sie und musterte mich kritisch. »Sei trotzdem brav. Wenn du heimkommst, sind wir wahrscheinlich schon weg, aber der Kühlschrank ist voll, und ich habe auch Pizzen geholt, falls du eine Freundin einladen willst, okay? Du musst also nicht einkaufen gehen, und am Donnerstag sind wir wieder da. Autumn, hörst du mir überhaupt zu?«
Ich war damit beschäftigt, einen Zauberspruch zusammenzureimen, um meine Tasche zur Schule zu transportieren, also hörte ich eindeutig nicht zu. »Ich schaffe es bestimmt irgendwie, die vier Tage zu überleben. Ist ja nicht so, als wärt ihr noch nie weg gewesen.«
Meine Tasche löste sich in Luft auf, und ich trat wieder hinaus in den Flur, wo ich mein Schwert samt Scheide von der Garderobe nahm und es mir um die Hüfte band. Normalerweise nahm ich zwar weder Schwert noch Messer mit zur Schule, aber heute war immerhin der erste Tag, da konnte es nicht schaden, den Schein zu wahren und die neuen Schüler zu beeindrucken. Ich zupfte meine Bluse zurecht und rollte meinen Rock ein gutes Stück hoch, dann schlüpfte ich in meine Ballerinas und strich mir eine Haarsträhne zurück.
»O Autumn, ich weiß wirklich nicht, warum du das tust«, sagte meine Mutter, die ebenfalls in den Flur getreten war und mich betrachtete. »Du bist auch ohne das ganze Make-up schön, und wenn du deine Locken nicht glatt ziehst, siehst du genau wie deine Großmutter aus.« Sie legte mir die Hände auf die Schultern und massierte sie leicht. Ich schüttelte sie ab.
Gegen ihre strahlende Eleganz und Feinheit bin ich gerade mal ein Streichholz im Dunkeln.
»Das machen alle Mädchen, also reg dich ab.«
Sie trat zurück. »Du musst keine kurzen Röcke und Eyeliner tragen, um dazuzugehören, Autumn. Sei einfach du selbst, dann werden sie dich schon akzeptieren.«
Ich schnaubte und vermied es, in den Spiegel zu sehen, denn er würde mir nur die Narben zeigen, die meine gesamte rechte Körperhälfte bedeckten. Unter meiner Strumpfhose wanden sie sich in kräftigem Rot und wurden zu den Spitzen hin immer dunkler. Wie bei dem Blutgras im Garten, hatte meine Großmutter immer gesagt. Imperata cylindrica. Latein ist wichtig. Auf meinen Armen verblassten sie zu Ocker und Gelb, und in meinem Gesicht schimmerten sie nur noch in einem blassen Goldton.
»Nur dass ich eben eine Sage bin und niemand hier die Sage besonders mag.«
Daraufhin rollte ich meinen Rock noch ein Stück weiter hoch, nur um meinen Standpunkt zu unterstreichen, und griff nach der Türklinke.
»Dann nimm wenigstens einen Mantel mit, heute soll es regnen.« Sie nahm einen von der Garderobe und streckte ihn mir hin. Ich starrte ihn nur an, als könnte er jeden Moment explodieren, bis sie die Hand schließlich wieder sinken ließ.
»Es wird aber nicht regnen.«
»Du solltest trotzdem einen mitnehmen.«
»Aber es wird nicht regnen«, wiederholte ich und funkelte sie an.
»Aber in der Wettervorhersage …«
»Mum, meine Magie kommt von den Elementen, ich weiß, ob es regnen wird oder nicht!«, fauchte ich, und über meine Fingerspitzen tanzten Funken. Meine Mutter, die an meine Launenhaftigkeit gewöhnt war, stemmte nur die Hände in die Hüften, und ich wusste, dass mir eine weitere Lektion über Brandschutz drohte. Um ihr zu entgehen, öffnete ich rasch die Tür und bahnte mir einen Weg durch die in letzter Zeit vernachlässigten, wuchernden Fuchsien.
»So ein Benehmen dulde ich in meinem Haus nicht, Autumn Rose Summers! Ich bin deine Respektlosigkeit leid!«
Ich schloss das kleine, weiß gestrichene Gartentor und trat auf die von Eichen und Ahornbäumen gesäumte Straße. Die Blätter waren schon gezeichnet vom nahenden Herbst. Ich hielt doch noch einmal inne.
»Mein Name ist Al-Summers, nicht Summers.«
Dann verschwand sie aus meinem Blickfeld, aber die zuknallende Tür verriet mir, dass sie mich gehört hatte.
Deine Mutter ist nicht wie wir, Autumn. Sie ist ein Mensch. In ihren Adern fließt kein Sage-Blut wie in unseren oder in denen deines Vaters.
Aber Vater kann keine Magie rufen, Großmutter.
Während ich den Gehweg entlanglief, sank meine Stimmung immer weiter. Die Aussicht auf den kommenden Schultag war nicht besonders erhebend.
Manchmal überspringt die Magie ein paar Generationen.
In Kable herrschte Zucht und Ordnung, und ich hasste jede einzelne spottbeladene Stunde, die ich dort verbringen und mich begaffen lassen musste, während mir das Getuschel folgte wie Wind dem Regen.
Aber warum, Großmutter?
Auch der Lehrplan war langweilig, aber eines hatte ich trotzdem gelernt: Um zu überleben, musste man sich anpassen.
Dafür gibt es gute Gründe, mein Kind.
»Morgenrot mit Regen droht«, rief mir unser vertrottelter Nachbar Mr. Wovarly über seinen Gartenzaun hinweg zu und deutete auf den pfirsichfarbenen Himmel. »Später wird es nass. Pass ja auf, dass du dich nicht erkältest, Liebes!«
Ich zwang mich zu einem Lächeln und nickte betont übertrieben. »Mache ich, Mr. Wovarly.«
Ich machte einen Bogen um seinen winzigen Terrier, der am Zaun hochsprang und wie verrückt kläffte. Dann ließ ich das Lächeln verblassen und rannte das letzte Stück die Straße hinunter, bevor ich mich in die Luft schwang und das vertraute Hochgefühl genoss. Während ich immer weiter aufstieg, zerzauste mir der Wind das Haar, doch ich rauschte höher und höher und ließ die Bäume der Straße weit unter mir zurück.
Ich landete auf dem Schulparkplatz, sank in die Hocke und gewann taumelnd mein Gleichgewicht zurück – nicht gerade besonders elegant. Dann richtete ich mich auf, strich meine Schuluniform glatt und blickte zur Eingangstür hinüber. Ich musste schnell gewesen sein, denn in der Schule war es noch ziemlich ruhig. Ich beschloss, lieber nachzusehen, wie sehr der Wind meinen Haaren zugesetzt hatte, und steuerte die Mädchentoilette an. Fassungslose Blicke folgten mir von ein paar der neuen Schülerinnen. Ihre geringe Körpergröße, die weißen Rüschensöckchen und die braven Haarknoten wiesen sie eindeutig als Frischlinge aus. Sie starrten mich an und wichen vor mir zurück, als hätte ich eine ansteckende Krankheit, aber ich wusste es besser. Wahrscheinlich hatten sie einfach noch nie eine Sage gesehen. Und schon gar nicht beim Fliegen.
Noch so jung und unschuldig.
Doch als ich am Schulgebäude entlangging, beschlich mich ein ungutes Gefühl. All der aufgestaute Widerwillen, den ich den ganzen Sommer über verdrängt hatte, kochte hoch und erinnerte mich daran, was mir bevorstand. Außerdem erregte ich immer mehr ungewollte Aufmerksamkeit. Mädchen, fast immer waren es Mädchen, betrachteten mich voller Abscheu, als ich vorüberging. Dann wandten sie sich rasch einander zu, tuschelten eifrig und starrten mich weiter an, wenn sie glaubten, ich würde es nicht merken.
Ich fühlte mich befangen, und mir war leicht übel. Ich schlang die Arme um meinen Körper und wusste, dass mich auch das Schwert an meiner Hüfte, die Schutzschilde um meinen Geist und die Magie in meinem Blut nicht vor den drohenden Beschimpfungen schützen konnten.
Als ich die Mädchentoilette erblickte, eilte ich hinein und bemerkte, dass es hier drinnen ausnahmsweise mal nicht wie in einem Aschenbecher roch. Ich nahm auch keinen Geruch von Blut wahr, wozu ich als Sage in der Lage gewesen wäre. Stattdessen stank es nach Bleichmittel, was auch nicht viel besser war.
Ich umklammerte den Rand des Waschbeckens und starrte in den Spiegel, überprüfte den Sitz meiner Haare und mein Make-up. Wenn nicht alles perfekt war, würde es ihnen auffallen. Es fiel ihnen immer auf. Die Pickel auf Christys Stirn oder den Sonnenbrand auf Gwens Dekolleté bemerkten sie nicht, aber bei mir genügte eine lose Wimper, ein abgesplittertes Stück Nagellack an meinem Daumen oder der Duft des billigen Parfums, das ich jetzt trug, weil ich all mein Erspartes in London ausgegeben hatte.
Ich seufzte. Ich musste mich zusammenreißen, und zwar schnell. Das neue Schuljahr hatte begonnen, und es war meine Pflicht, die Menschen hier zu beschützen, aller gegenseitigen Abneigung zum Trotz.
Ich musste wachsam sein. Die geflüsterten Gerüchte, die ich in London gehört hatte, gingen mir nicht aus dem Kopf. Wir alle hatten davon gehört. Die Extermino wurden stärker und dreister, und ihr Angriff auf meine Kleinstadt bewies das … Was für ein Interesse hatten sie bloß an diesem winzigen ländlichen Außenposten?
Und was war mit dem Gerede über die dunklen Wesen der zweiten Dimension? Man munkelte, die königliche Familie der Vampire hätte ein Menschenmädchen gekidnappt. Die zweite Dimension war die einzige, in der die Menschen nichts von der Existenz der dunklen Wesen wussten. Ein Mädchen zu entführen brachte uns alle in Gefahr. Ein Krieg drohte, und was dann? Auch in den anderen Dimensionen hatten es die dunklen Wesen nicht leicht. Das Volk der Verdammten war jahrelang von den Menschen verfolgt und ermordet worden, nur weil sie Blutmagie praktizierten. Es gab nur noch sehr wenige von ihnen. Die Elven Fae litten unter dem Klimawandel, den die Menschen verursacht hatten. Und wir, die Sage, mussten uns dauernd darum kümmern, anderen dunklen Wesen aus der Patsche zu helfen, nur weil irgendein Diplomat wieder irgendwelche Dummheiten von sich gegeben hatte.
Doch jetzt war etwas in Bewegung gekommen, das die dunklen Wesen stärker in Unruhe versetzte als jemals zuvor in meinem kurzen Leben.
Ich seufzte und legte meine Stirn an den Spiegel, der ausnahmsweise mal nicht mit Lippenstiftgekritzel beschmiert war. Die Dinge veränderten sich, und jedes einzelne dunkle Wesen fühlte es. Wir verloren uns, gingen unter in Traditionen und neuen Technologien, gefangen zwischen den Welten.
Der Wandel war in vollem Gange, und ich fürchtete, dass dies nur die Ruhe vor dem Sturm war. Wenn es zum Schlimmsten kam, würden uns noch so viele Verträge nicht vor unseren Feinden schützen können … vor den Extermino … vor den Menschen.
Als mir bewusst wurde, was ich da dachte, verscheuchte ich die düsteren Bilder mit einem Kopfschütteln, wie es mich meine Großmutter gelehrt hatte.
Wer der Vergangenheit nachsinnt oder sich den Kopf darüber zerbricht, was kommen mag, raubt sich selbst die Zukunft, hatte sie immer gesagt.
Da die Schulbusse bald ankommen mussten, trug ich rasch noch eine Schicht Mascara auf und verließ die Toilette dann wieder. Ich verfluchte mich dafür, dass ich nicht daran gedacht hatte, mein Handy aus der Tasche zu nehmen, bevor ich sie ins Klassenzimmer vorausgeschickt hatte. Gern hätte ich Jo jetzt wenigstens eine SMS geschickt.
Während ich die Gänge entlanglief, teilte sich die Menge vor mir, und ich tat mein Bestes, das Starren der jüngeren Schüler zu ignorieren, bis ich mich plötzlich vor einer Bronzeplakette unter einem großen Kirschbaum wiederfand, der in der Mitte des Hofes thronte. Die klar zu lesenden Worte erinnerten mich daran, warum es in dieser Gegend keine Sage gab.
Dieser Baum wurde in liebevoller Erinnerung an Kurt Holden gepflanzt.
Gestorben am 23. April 1999.
Mitschüler, Freund und Bruder.
Durch Magie zu früh von uns genommen.
Natürlich kannte ich die Geschichte. Jeder kannte sie. Kurt war durch einen Unfall ums Leben gekommen, als der damalige Wächter gezaubert und dabei nicht die notwendigen Schilde hochgezogen hatte. Danach hatte sich die Schule jahrelang geweigert, einen Sage aufzunehmen, bis die Gerüchte über die Extermino aufkamen und ein neuer Wächter unabdingbar wurde. Sechs Monate später, frisch aus der St. Sapphire’s School der Sage und noch immer um den Verlust meiner Großmutter trauernd, war ich gekommen.
Aber natürlich hatte niemand vergessen, was mein Vorgänger getan hatte, und sie nahmen einfach an, ich wäre genauso.
»Du kannst nicht ändern, was passiert ist, weißt du.«
Ich seufzte, aber an meinen Mundwinkeln zupfte ein Lächeln. »Aber es schadet ja auch nicht, es sich trotzdem zu wünschen.«
Ich drehte mich um. Vor mir stand eine der wenigen Personen hier, die niemals ein böses Wort über mich gesagt hatten: Tammy. Allerdings widersprach sie mir in jedem Punkt, konnte weder meinen Musikgeschmack noch meine Vorlieben bei Jungs verstehen und fand es grässlich, dass ich ihre Gedanken lesen konnte. Wir waren grundverschieden, aber sie verurteilte niemanden, und das schätzte ich so an ihr.
Ich umarmte sie knapp.
»Wie war dein Sommer?«, fragte ich reumütig, weil ich es wüsste, wenn ich mich auch nur ein einziges Mal bei ihr gemeldet hätte.
»Ich muss dir ja so viel erzählen.« Sie wartete meine Erwiderung gar nicht erst ab, sondern plapperte sofort drauflos. »Ich habe einen Jungen geküsst.« Sie zog mich am Ärmel hinter sich her in den Schutz des Baumes und sprach mit gedämpfter Stimme weiter. »Aber dabei ist es nicht geblieben.« Sie deutete auf den obersten Knopf ihrer Bluse, die ihre zierliche Gestalt und die noch vollkommen flache Brust verhüllte.
Scharf holte ich Luft, als ich Bilder aus ihrem Gedächtnis auffing, die deutlich zeigten, was sie und dieser Typ noch so alles miteinander angestellt hatten.
»Und schau mal.« Sie schob ihre dichten braunen Locken zur Seite und entblößte mehrere dunkelrote Flecken an ihrem Hals, die äußerst unwirksam mit einer Puderschicht überdeckt worden waren.
»Ich hab versucht, sie zu überschminken, hat aber nicht besonders gut geklappt, oder? Es hat sich irgendwie so, na ja, gut angefühlt, als er meinen Hals geküsst hat, und ich wollte nicht, dass er damit aufhört.«
»Bist du sicher, dass er kein Vampir ist?«, fragte ich scherzhaft.
Sie strafte die Bemerkung mit einem ihrer bösen Blicke und einem sarkastischen Lächeln ab. »Wenn er ein Vampir wäre, hätte ich das ja wohl bemerkt.«
»Nicht unbedingt«, gab ich zurück, ließ das Thema dann aber fallen, weil Gwens schrilles Gekicher und das etwas dezentere Lachen von Tee und Christy zu uns herüberdrangen, die sich ihren Weg zu uns bahnten. Gwens dunkles Haar schimmerte in der Spätsommersonne, und ein breites Grinsen lag auf ihrem Gesicht, während sie mit beiden Händen eine sehr rüde – und sehr eindeutige – Geste vollführte.
»Na, wie geht es unserem frisch entjungferten Mädchen denn heute so?«
Tammy wurde knallrot. »Ich habe es nicht mit ihm gemacht! Echt nicht!«
»Ja klar.« Gwen nickte, wiederholte die Geste dabei jedoch. Hoffentlich sahen die jüngeren Schüler alle gerade woandershin.
»Ich hab’s nicht getan. Hör auf damit, Gwendolen!«
Gwen hörte tatsächlich auf und funkelte Tammy wütend an. Sie konnte es nicht leiden, wenn jemand ihren vollen Namen aussprach.
Dann begann ein munterer Schlagabtausch zwischen den beiden, und ich trat erleichtert einen Schritt zurück. Jetzt konnte ich mich immerhin darauf konzentrieren, Ordnung in das Chaos aus den Gedanken Hunderter Schüler zu bringen und die Schutzschilde um meinen Geist wieder aufzubauen, die ich während der Sommerferien vernachlässigt hatte. Ich bemerkte nicht einmal, dass ich die Augen schloss, während sich mein Bewusstsein klärte und über das aufgeregte Geschnatter der Schüler und die koffeinbefeuerte Entschlossenheit der Lehrer emporschwang. Mein Geist ließ die grünen Wiesen, die unsere Schule umgaben, hinter sich und rollte wie eine Welle über die Hügel und den Fluss dahin, der mich von meinem Zuhause trennte. In unserer Kleinstadt an der Flussmündung waren die Straßen von Touristen überfüllt, und eine zweite Fähre hatte den Dienst aufgenommen, um den Ansturm zu bewältigen. Auf den Geländern, die das Ufer säumten, saßen Möwen wie Geier, die auf leichte Beute warteten.
Der Klang meines Namens holte mich zurück ins Hier und Jetzt, und ich schlug die Augen auf.
Eine dunkle Hand hatte sich auf meine gelegt, und braune Augen sahen unter einem mit Zöpfchen durchflochtenen Lockenschopf zu mir auf.
»Tee«, rief ich und begrüßte das jüngere Mädchen neben mir. Sie war gerade erst zwölf geworden und schlang die dünnen Arme so fest um mich, als wäre ich ihre ältere Schwester. Tatsächlich fühlte ich mich manchmal auch so. Zwar schaffte ich es einfach nie, mich gegen die Lästereien der anderen zu wehren, aber bei Tee sah das anders aus: Als ich einmal ein paar rassistische Kommentare über sie mit angehört hatte, war ich echt sauer geworden. Daraufhin hatte mich Tees Cousine Tammy prompt zur Freundin auserkoren und mich auch mit Christy und Gwen bekannt gemacht.
»Wie war dein Sommer?«, fragte ich, als nun auch Christy um die beiden zankenden Mädchen herumtrat und sich zu mir stellte.
»Langweilig und verregnet«, antwortete sie. Es war wirklich ein außergewöhnlich mieser Sommer gewesen, endlose Stürme, nur gelegentlich von Sonnentagen wie heute unterbrochen. Vielleicht wollte uns das Wetter ja den Schulbeginn ein wenig versüßen. Tee nickte zustimmend.
»Ich hab doch gesagt, ich habe es nicht getan!«
Ein Schauer kroch mir den Rücken herauf. Mein Blick flog zu dem herbstblühenden Kirschbaum und ich sah, wie einige der zarten rosa Blütenblätter langsam kreiselnd zu Boden fielen. Eine Brise strich mir durchs Haar.
»Gwen, ich will nicht darüber reden.«
Ich schlang die Arme um mich und fühlte, wie mich eine Gänsehaut überkam. Die Sonne wurde von einer tief hängenden, dräuenden Wolkendecke ausgelöscht, die grau und regenschwer vom Meer herangetrieben kam.
Tee schauderte, und Tammy band den Pulli los, den sie sich um die Hüfte geschlungen hatte, und zog ihn an.
»Tammy, du musst nicht …«
»Gwen, halt die Klappe!«
»Ich wollte doch nur …«
»Nein, schau dir mal Autumn an!«
Die Umrisse des Baumes und der Menschen um mich herum verschwammen, nur die fallenden Blütenblätter blieben klar und deutlich. Ein zu Boden sinkender Schleier, immer langsamer, so langsam, dass ich die Hand ausstrecken und jedes Blütenblatt einzeln aus der Luft hätte pflücken können.
»Scheiße! Autumn, sag doch was!«
Ich konnte sämtliche Schritte auf dem Schulhof hören, die sich zu einem Rhythmus vereinten. Das Heben und Senken meiner Brust füllte die Pausen im Takt, während ich darum rang, ruhig weiter zu atmen. Langsam schlossen sich meine Finger um den Griff meines Schwertes, der sich glatt und blank poliert vom jahrelangen Training perfekt in meine Handfläche schmiegte. Zwischen dem Metall und meiner Haut sprangen Funken, und auf meinen Lippen formten sich bereits Worte.
»Autumn!«
In meiner freien Hand fühlte ich ein Herz schlagen. Ich wusste, dass es der Puls eines nicht menschlichen Wesens war – eines Wesens, das sich rasch näherte.
Der Tod tanzte auf meinen Lippen, und ich gestattete der Magie, aus meinem Körper zu fließen und Schilde um so viele Schüler wie möglich zu errichten. Dann, ohne den Blick von den Blütenblättern zu lösen, ließ ich das Schwert los und zog stattdessen mit der rechten Hand das Messer, während ich in der linken den Fluch bereithielt. Dann wartete ich.
Das ängstliche Geplapper erstarb, und ich hörte nur noch den Herzschlag desjenigen, der sich mir näherte – wer auch immer er war.
Ich musste nicht lange warten. Ich hörte ihn hinter mir atmen, fühlte eine fremde Magie und hörte eine Stimme.
»Herzogin.«
Ich fuhr herum und riss das Messer hoch. Die Schneide lag am Kiefer eines jungen Mannes, der nicht viel älter sein konnte als ich. Weiter kam ich nicht.
Der Wind riss mir den halb geformten Todesfluch von den Lippen, und ich schnappte nach Luft. Dann ließ ich das Messer los, das klappernd auf dem Boden landete.
Die Hand noch immer erhoben, schürzte ich die Lippen, und allmählich löste langsames Begreifen den Schrecken ab. Es vergingen einige Sekunden, in denen sich niemand rührte, dann endlich fiel mir ein, dass ich mich wohl besser auf ein Knie sinken lassen sollte – wobei mein kurzer Rock gefährlich hochrutschte. »Verrat«, wisperte der Wind in den Zweigen.
»Euer Hoheit«, brachte ich schließlich heraus, den Blick fest auf eines der Blütenblätter am Boden gerichtet.
»Herzogin«, wiederholte er so leise, dass nur ich es hören konnte. Kurz hob ich den Blick, wagte aber nicht, ihn anzusehen.
Vergiss nie, wo dein Platz ist, Autumn. Etikette ist alles, mein Kind.
Meine Gedanken verknoteten sich. Er sollte nicht hier sein. Er hat keinen Grund dazu. Aber ich konnte weder die lederne Schultasche übersehen, die er bei sich trug, noch den Ordner mit dem Kable-Logo, den er in der Hand hielt. Er hatte zwar keine Schuluniform an, aber das mussten die oberen Klassen ja auch nicht mehr. Ein Kloß formte sich in meiner Kehle.
»Begrüßt Ihr alle Leute so, oder bin ich eine Ausnahme?«
Er hatte einen kanadischen Akzent und musste die Stimme heben, um das Getuschel der Schüler um uns herum zu übertönen. Sie waren nicht dumm. Sie lasen Zeitschriften und sahen Nachrichten, und deshalb wussten sie genau, wer da vor ihnen stand.
»Verzeiht mir, Euer Hoheit, ich habe Euch nicht erwartet.«
»Nein, mir tut es leid, ich wollte Euch nicht erschrecken.«
Ich nickte und starrte weiter zu Boden. Gern hätte ich mein Messer wieder aufgehoben, aber das ließ ich wohl besser sein.
Die Glocke schrillte, aber niemand rührte sich. Die Atheneas. Nicht jetzt. Nicht hier. Erst als die Lehrer auftauchten, kam Bewegung in die Menge. Wenn sie überrascht waren, was sich hier abspielte, ließen sie es sich nicht anmerken.
»Gut, wie ich sehe, seid ihr euch schon begegnet.«
Die Stimme des Rektors brachte mich endlich dazu aufzustehen, wobei ich mir die Fingernägel in die Handflächen bohrte, um ruhig zu bleiben.
»Autumn, das hier ist …«
»Ich glaube, die beiden müssen einander nicht vorgestellt werden, Herr Direktor«, warf ein zweiter Lehrer ein. Es war Mr. Sylaeia, mein Englisch- und Literaturlehrer, der gleichzeitig auch mein Betreuer war. Jeder Schüler hier bekam einen Lehrer zugewiesen, der sich persönlich um ihn kümmern sollte. »Sie haben sich bestimmt bei Hof kennengelernt.«
Anders als die anderen Lehrer verbarg Mr. Sylaeia seine Überraschung nicht. Er hob die Brauen, als sein Blick von dem Messer am Boden zu mir und dann zu dem jungen Mann wanderte, der in verwaschenen Jeans und einem weißen T-Shirt vor mir stand.
»Ich fürchte, das Wetter hier ist nicht ganz mit dem in Australien zu vergleichen, Euer Hoheit. Ich würde Euch in Zukunft zu einer Jacke raten«, erklärte Mr. Sylaeia schließlich.
»Bitte nennen Sie mich Fallon«, entgegnete der Prinz, jedoch ohne dabei den Blick von mir zu lösen. Meine Gedanken rasten, ich begriff einfach nicht, was hier vorging. Ich starrte Mr. Sylaeia an und ließ die Schutzmauern gerade weit genug sinken, um ihn hereinzulassen. Er war ein Halbblut, nur zum Teil ein Sage, und obwohl er keine Narben hatte, verfügte er doch über viele unserer Fähigkeiten.
»Du weißt doch, was das zu bedeuten hat«, sagte er. Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Warum?«, fragte ich. Furcht bohrte sich durch meine Rippen und machte mir das Atmen schwer.
»Seine Eltern wollen, dass er ein Jahr als Wächter an einer britischen Schule verbringt. Und er hat um eine öffentliche Schule gebeten.«
»Aber es gibt Tausende von öffentlichen Schulen. Und Hunderte davon haben überhaupt keinen Wächter.«
Er erwiderte meinen Blick, und sein Schweigen verriet mir, dass es da noch mehr gab – was er mir allerdings nicht mitteilen würde.
»Autumn, Fallon wird ein Jahr hier verbringen und die Prüfungskurse besuchen«, erklärte der Rektor. »Ich möchte, dass du ihn während der ersten Wochen betreust und dafür sorgst, dass er sich bei uns in Kable wohlfühlt.«
Das kann ich nicht, dachte ich. Aber ich nickte mit fest aufeinandergepressten Lippen, um nicht aus Versehen etwas Falsches zu sagen.
»Tja. wenn Sie uns entschuldigen würden, Direktor, ich glaube, meine Schüler warten auf mich. Autumn, Fallon, nach euch, bitte.« Mr. Sylaeia deutete auf das zweistöckige Gebäude, in dem Englisch unterrichtet wurde, und ich hastete voraus, damit sie meine verzweifelte Miene nicht sehen konnten. Wie in Trance erklomm ich die düstere Treppe, die zum Klassenraum hinaufführte, ohne darauf zu achten, wohin ich die Füße setzte, unfähig zu glauben, dass dies hier nicht einfach nur ein Albtraum war.
Aber es war die Wirklichkeit: Ein Mitglied der königlichen Familie der Sage war hier, ein Prinz aus Athenea, hier in Kable, um Prüfungskurse zu belegen.
Irgendwo hinter mir erklang lautes Kichern, als uns Christy, Gwen, Tammy und Tee einholten. Man brauchte nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, worüber sie sich so amüsierten. Es gab einen Grund dafür, warum gerade dieser Abkömmling Atheneas so oft in den Zeitschriften erschien.
Ich rauschte in den Klassenraum und ignorierte die verdutzten Blicke der anderen Schüler, die ängstlich zwischen mir und dem Prinzen hin und her schauten. Ein Mädchen, das noch viel zu jung aussah, um auf der weiterführenden Schule zu sein, sprang sogar auf und hastete um einen Tisch herum zu ihrer Freundin.
Die älteren Mädchen reagierten allerdings komplett anders. Ich beobachtete, wie ihre Blicke über seine burgunderroten Narben, sein T-Shirt und die muskulösen Arme strichen. Dann sahen sie mich an. Ich setzte mich rasch an meinen Tisch und gab dem Prinzen einen Wink, dasselbe zu tun. Er nahm mir gegenüber Platz. Christy witterte ihre Chance und ließ sich neben ihm nieder. Tammy setzte sich zu mir, und um nicht außen vor zu sein, schnappte sich Gwen rasch einen Stuhl vom Nebentisch und gesellte sich dazu. Sogar Tee winkte eine ihrer Freundinnen heran, und schließlich saßen wir zu siebt an einem Tisch, der eigentlich für vier gedacht war. Ich war ein bisschen erschrocken und außerdem beleidigt. Meinetwegen unternahmen sie diese Anstrengungen jedenfalls nicht.
Erst waren sie alle noch etwas schüchtern, aber schon bald schnatterten sie über die Sommerferien, stellten sich Prinz Fallon vor und fielen sich schließlich sogar gegenseitig ins Wort, um ihm Fragen zu stellen.
»Du kommst doch aus Kanada, stimmt’s?«, wollte Christy wissen, »Euer Hoheit«, fügte sie dann rasch hinzu.
»Bitte, einfach Fallon. Und nicht direkt. Athenea ist ein Teil von Vancouver Island, aber es ist ein eigener Staat und gehört nicht zu Kanada.«
»Dann sprichst du also … Kanadisch?«, fragte Gwen und wickelte sich eine Strähne ihres dunkel gefärbten Haars um den Finger. Verblüfft sah er sie an, und ich konnte nicht verhindern, dass sich ein Lächeln auf meine Lippen stahl. Um es zu verbergen, tat ich rasch so, als würde ich in meiner Tasche nach meinem Spindschlüssel suchen.
»Ähm, nein, wir sprechen Sagean und Englisch; nur diejenigen, die aus dem Osten Kanadas stammen, sprechen Französisch«, hörte ich ihn sagen, während ich die Spinde in der Ecke des Raums ansteuerte.
Du musst geduldig sein mit denen, die nicht mit deiner Intelligenz gesegnet sind.
Aber Großmutter, sie stellen so dumme Fragen! Ich sterbe noch vor Langeweile.
»Ich habe noch nie jemanden Sagean sprechen hören«, fuhr Gwen deutlich kleinlauter fort.
»So’yea tol ton shir yeari mother ithan entha, Herzogin?«
Ich erstarrte, als ich meine Muttersprache zum ersten Mal seit Langem wieder hörte. Über die geöffnete Spindtür hinweg sah ich ihn an. Er erwiderte meinen Blick, einen Finger nachdenklich an die Lippen gelegt.
Warum fragt er mich das? Weiß er denn nicht, wie es hier ist? Ich spreche meine Muttersprache nie, weil es hier niemanden gibt, der sie versteht.
Ich wandte mich wieder meinem Spind zu. »Arna ar hla shir arn mother ithan entha, Euer Hoheit.«
Ich wusste, dass es abgehackt und holprig klang. Sagean fühlte sich inzwischen fast falsch für mich an, wie eine Fremdsprache, die ich mühsam zu erlernen versuchte.
»Natürlich«, erwiderte er, als ich meine Tasche hervorholte und den Spind wieder verschloss. Als ich mich zu ihm umdrehte, ruhte der Blick seiner kobaltblauen Augen noch immer auf mir. Ich stellte die Tasche auf meinem Stuhl ab, sah ihn an und zog die Schutzschilde um meinen Geist noch höher, um zu verhindern, dass er meine Gedanken las.
Ich weiß, dass du es weißt, dachte ich. Ich weiß, dass du von ihr weißt. Und dafür hasse ich dich.
Dann bat mich Mr. Sylaeia, ihm beim Verteilen der Stundenpläne zu helfen, und ich entfernte mich von dem Tisch, an dem die Mädchen mit ihren Haaren spielten und Übersetzungen ins Sagean verlangten. Sie kicherten und machten dumme Bemerkungen über seinen Akzent. Die Tatsache, dass er ein Sage war und dass sie Angst vor den Sage hatten, war längst vergessen.
Während ich die Blätter verteilte, verglichen Freunde und Freundinnen sie untereinander, und angewidertes Stöhnen kam von denjenigen, die einen der unbeliebteren Lehrer erwischt hatten. Zwei Jungs aus der Zehnten freuten sich darüber, dass sie kein Geschichte mehr hatten, und drei Mädchen aus der Elften verglichen ihre Freistunden und besprachen ausgiebig, dass sie in dieser Zeit, sobald die Älteste von ihnen den Führerschein hatte, nicht mehr lernen, sondern in die Stadt fahren würden.
Ganz unten im Stapel stieß ich auf den randvollen Stundenplan von »Haus von Athenea, Prinz Fallon«, worauf eine lange Liste von Abkürzungen und Titeln folgte. Der erste davon war »S.K.H.A.«: Seine Königliche Hoheit von Athenea.
Warum hat mir die Schule nicht gesagt, dass er kommt? Aber diese Frage beantwortete ich mir sofort selbst. Weil ich dann niemals zurückgekommen wäre.
Er hatte kaum Freistunden, was für einen Schüler der dreizehnten Klasse ungewöhnlich war. Nach einem Blick auf seine Fächer verstand ich es allerdings.
Englische Literatur, Französisch, Geschichte, Mathematik und Chemie. Fünf. Aber niemand wählt gleich fünf Prüfungskurse. Entweder war er verrückt oder versessen auf richtig harte Arbeit.
Da auch die anderen auf ihre Stundenpläne warteten, legte ich das Blatt rasch vor ihm ab. Darunter kam mein eigener Plan zum Vorschein, den ich ebenfalls auf den Tisch legte, bevor ich den Rest austeilte. Aber ehe der Zettel richtig lag, hatte ihn sich Tammy schon geschnappt, um ihn mit ihrem eigenen zu vergleichen.
»Wir haben alles zusammen«, informierte sie mich, sobald ich mich wieder hingesetzt hatte. Ich fühlte mich irgendwie bedrängt, und als ich umherblickte, erkannte ich, dass fast alle Schüler plötzlich näher bei uns saßen; näher bei ihm.
»Außer im Prüfungskurs Französisch und im Prüfungskurs Englische Literatur.« Sie seufzte. »Du bist doch verrückt, gleich zwei Kurse zu belegen.«
Ich nahm dies mit einem Nicken zur Kenntnis und beschäftigte mich damit, meinen Namen auf den Hausaufgabenplaner zu schreiben, den Mr. Sylaeia gerade vor mich hingelegt hatte.
»Ihr belegt den Prüfungskurs in Literatur, Lady Autumn?«, fragte der Prinz.
Tammy reichte ihm meinen Stundenplan. Ich war noch immer mit meinem Hausaufgabenplaner beschäftigt, beobachtete ihn aber unter gesenkten Lidern hervor. Ich hatte sehr wohl registriert, dass er nicht mehr meinen Titel, sondern die formelle Anrede gebraucht hatte.
»In diesem Fall haben wir den Kurs wohl zusammen.«
Mein Stift hing reglos über dem Papier. Ich sah auf und zwang mich zu einem desinteressierten Lächeln, als wäre es absolut nichts Besonderes, dass ein Prinz eine winzige Schule auf dem Land besuchte. Dann vervollständigte ich meine Adresse auf der Innenseite des Hausaufgabenplaners und holte mir meinen Stundenplan zurück, um ihn abzuschreiben.
»Du hast aber nicht besonders viele Freistunden, was?«, kommentierte Gwen und beugte sich so tief über seine Schulter, wie es nur ging, ohne ihn direkt zu berühren. Ihr Haar fiel ihm auf die Schulter, woraufhin er ein Stück von ihr abrückte und sich sein eigenes, blondes Haar zurückstrich.
Das hatte ich nicht erwartet. Gwen schien zwar getroffen, aber sie verbarg es meisterlich, indem sie sich zu drei Zwölftklässlerinnen umdrehte, die fortwährend den Prinzen anstarrten, und mit ihnen plauderte. Bewundernswert.
Dann richtete sich meine Aufmerksamkeit allerdings auf Mr. Sylaeia, der hinter das Pult trat und seinen Namen an die Tafel schrieb. »Guten Morgen, Ladys und Gentlemen, willkommen und willkommen zurück in Kable. Ich bin dieses Jahr euer Betreuer, und ich werde euch jeden Morgen hier begrüßen, das heißt, wir werden uns wohl gut kennenlernen. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen: Ich bin Mr. Sylaeia, und das schreibt man so.« Der Filzstift quietschte über die Plastiktafel. »Ich bin zur Hälfte ein Sage, und wie man mir versichert hat, ist mein Name ein echter Zungenbrecher, ihr dürft mich also Mr. S. nennen, wenn ihr wollt.«
Er legte den Stift ab und griff nach der Namensliste. »Wir haben einige neue Schüler dieses Jahr, fangen wir am besten bei ›A‹ an. Ja, einige von euch kennen den Ersten hier auf der Liste vielleicht sogar. Er heißt … ähm … A-athana? Athena? Keine Ahnung, echt schwierig auszusprechen.« Er ließ das Blatt sinken und sah den Prinzen an. »Und da sind eine ganze Menge merkwürdiger Buchstaben vor deinem Namen. S.K.H.A., kann damit jemand etwas anfangen? Was soll das denn bedeuten?«
Inzwischen konnte die Klasse ihre Heiterkeit kaum noch im Zaum halten und brach in schallendes Gelächter aus, in das der Prinz ein wenig verlegen einstimmte, wobei er den Blick senkte und errötete.
»Kleiner Scherz. Aber, ja, Fallon wird dieses Jahr als weiterer Wächter an unserer Schule weilen, und wir alle können uns außerordentlich glücklich schätzen, gleich zwei so mächtige junge Sage bei uns zu haben, die in diesen gefährlichen Zeiten über uns wachen.« Das Lachen erstarb, und eine ernste Stille breitete sich aus. »Einige von euch haben sicher von dem kürzlich erfolgten Angriff der Extermino gehört. Im ganzen Land gab es solche Angriffe. Und zweifellos wissen die meisten von euch von den Gerüchten über das entführte Menschenmädchen, Violet Lee. Vielleicht habt ihr Angst oder seid verunsichert, was das für euch bedeuten könnte. Das ist nur allzu verständlich, aber es bedeutet jedenfalls nicht, dass Ausschweifungen toleriert werden. Benehmt euch einfach weiterhin wie die vernünftigen Menschen, die ihr, wie ich weiß, alle seid. Und bitte, respektiert die Privatsphäre unserer Wächter und seht sie nicht nur im Licht der vielen Buchstaben vor ihren Namen. Sie sind nicht so viel anders als ihr. Wenn ihr sie einfach ihren Job machen lasst, werden wir alle mit ein bisschen Glück ein tolles Schuljahr haben.«
Mit ein bisschen Glück, dachte ich, werden wir alle dieses Schuljahr überleben.
Ich zog die Riemen meiner Tasche straff und hielt dabei sorgsam den Blick gesenkt. Die Wirklichkeit war noch immer nicht ganz bis zu mir durchgedrungen, und meinetwegen konnte sie sich auch ruhig noch Zeit damit lassen. Ich bildete mir ein, dass er, wenn ich aufblickte, einfach verschwunden sein würde, dass alles wieder normal sein und sich dieses ungute Gefühl in meinem Magen gelegt haben würde.
»Autumn, Fallon, auf ein Wort, bitte.«
Dieses Mal hatte ich kaum eine andere Wahl, als aufzusehen, und sofort fiel mein Blick auf den Prinzen, der sich die Schultasche bereits auf den Rücken geschwungen hatte. Mr. Sylaeia stand hinter seinem Pult.
»Wir warten im Hof«, murmelte mir Tammy zu und trieb die anderen hinaus. Mr. Sylaeia winkte uns zu sich.
Ich umklammerte den Riemen meiner Tasche so fest, dass meine Knöchel weiß wurden, und mir kam der Gedanke, dass ich diesem Jungen zuletzt bei der Beerdigung so nah gewesen war.
Warst du da noch ahnungslos?
Mr. Sylaeia wandte sich ab und wischte die Tafel mit einem Lappen sauber. »Wie Autumn weiß, bin ich an dieser Schule für alle Sage verantwortlich. Deswegen, Fallon, möchte ich dich dringend darum bitten, Schilde zu benutzen, wann immer du Magie einsetzt, und darüber hinaus die Privatsphäre der Gedanken aller Menschen hier zu respektieren. Die Menge an Papierkram, den ich im Falle eines Unfalls ausfüllen muss, würde genügen, um jeden Menschen oder Sage frühzeitig ins Grab zu bringen, und ich würde meinen vierzigsten Geburtstag gern noch erleben.« Der Prinz nickte. Ich verstärkte meinen Griff um den Riemen. »Und, Autumn, das hier habe ich im Sommer gelesen. Ich dachte, es könnte dich interessieren. Eine äußerst anschauliche Interpretation der Frauenfeindlichkeit in Die Zähmung des Biests.« Er reichte mir ein dickes Taschenbuch, das schon reichlich zerlesen aussah. Ich murmelte einen Dank und schob es in meine noch fast leere Schultasche.
Da dies offenbar alles war, wandte ich mich zum Gehen. Aber als ich die Tür erreichte, hallte Mr. Sylaeias Stimme in meinem Kopf. »Es wird schon nicht so schlimm werden, wie du glaubst.«
Ich zwang mich dazu weiterzugehen, warf aber einen Blick über die Schulter zurück zu ihm. Doch er sah mich nicht an, sondern tippte etwas in seinen Computer. Ich wandte mich wieder um und durchquerte den kurzen Korridor, bis ich die Tür zum Treppenhaus erreichte.
Er ist ein kluger Mann, aber dieses Mal kann er es einfach nicht verstehen.
»Herzogin!«
Ich unterdrückte ein Seufzen und stieß die Tür auf. Sie fiel hinter mir ins Schloss, wurde jedoch sofort wieder geöffnet.
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass alles sogar noch viel schlimmer wird, als ich glaube.
»Lady Autumn?«
Ich konnte ihn sowieso nicht lange ignorieren, also drehte ich mich zu ihm um, allerdings so langsam, dass mir genug Zeit blieb, eine einigermaßen höflich interessierte Miene aufzusetzen.
»Euer Hoheit?«
Er schüttelte leicht verwirrt den Kopf. »Auf Eurem Stundenplan wird nirgendwo Euer Titel erwähnt, und vor Eurem Vornamen fehlt das Lady ebenso wie das Haus vor Eurem Nachnamen. Ist dies vielleicht ein Fehler, den Ihr noch korrigieren lassen wollt?«
Während dieser kurzen Rüge – denn sein verärgerter Tonfall machte es eindeutig zu einer solchen – starrte ich stur auf einen Fleck auf dem verblichenen braunen Teppich, den Tausende von Schülerschuhen abgenutzt hatten.
»Es ist kein Fehler, Euer Hoheit.« Ich zwang mich dazu, ihn anzusehen, um diese Aussage zu unterstreichen.
»Kein … Fehler?« Die Worte rollten über seine Zunge, als gehörten sie zu einer fremden Sprache.
»Nein. Ich ziehe es vor, meinen Titel nicht zu gebrauchen, und ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr es auch nicht tun würdet.«
Damit wandte ich mich ab und eilte weiter die Treppe hinunter, während ich ihn hinter mir »Sehr verbunden?« murmeln hörte. Als ich den Absatz auf halber Strecke erreicht hatte, sprang er plötzlich vor und lehnte sich über das Geländer.
»Wollt Ihr damit etwa sagen, dass niemand hier weiß, wer Ihr seid? Wie können sie es nur nicht wissen?«
Ich ruckte den Riemen über meiner Schulter zurecht und wählte meine Worte mit Sorgfalt. »Die Klatschblätter haben nie etwas darüber gebracht, also kennt mich hier jeder als Autumn, Euer Hoheit. Nur als Autumn.« Dann machte ich einen raschen Knicks und floh, wobei ich die anderen draußen geflissentlich ignorierte. Sicher würde es eine ganze Menge anderer Mädchen geben, die mit Freuden meine Aufgabe übernehmen und ihn herumführen würden.
Die Atmosphäre im Nähzimmer knisterte fast vor Spannung. Kable war eine kleine, ländliche Schule, was bedeutete, dass sich Neuigkeiten in Rekordzeit verbreiteten. Und natürlich drehten sich zurzeit alle Unterhaltungen um den Prinzen. Falls irgendjemand vor dieser Stunde noch nichts von seiner Ankunft gewusst hatte, war er spätestens sechzig Sekunden, nachdem er diese Tür durchquert hatte, auf dem Laufenden. Die beiden Mädchen, die am Tisch direkt neben dem Eingang saßen, stürzten sich auf jeden Neuankömmling und bettelten um frische Details. Ich betete darum, dass niemandem einfallen würde, dass meine Wenigkeit wohl am ehesten über solche Details verfügte. Es half, dass ich mit voller Absicht den allerhintersten Tisch gewählt hatte, mich hinter meinem dichten Haar versteckte und mich tief über den Skizzenblock beugte. Ich zeichnete den Entwurf eines Kleides, das ich im Laufe dieses Schuljahres schneidern sollte.
»Autumn, du müsstest das doch wissen.« Christy wirbelte auf ihrem Stuhl herum und schob den Stoffhaufen, den sie sich zuvor aus den Schulvorräten geholt hatte, beiseite, um sich weiter zu mir vorbeugen zu können. »Er ist drei Jahre lang in Australien zur Schule gegangen, stimmt’s? Muss er ja wohl, bei der braunen Haut.«
Ich drückte den Bleistift unwillkürlich so fest auf, dass die Spitze abbrach. Ich schnippte sie beiseite und schlug einen vollkommen unbeteiligten Ton an. »Wer?«
Sie hob eine Braue. »Das weißt du genau.«
»Ja, ist er.«
»Und er hatte dort eine Freundin, richtig? Aber sie haben sich getrennt.«
Die Stuhlbeine scharrten über den Boden, als ich mich abrupt erhob und mit Bleistift und Spitzer zum Mülleimer hinüberging. »Christy, warum liest du nicht einfach die Quaintrelle oder irgendein anderes Klatschheftchen, wenn du seine Lebensgeschichte wissen willst?«
»Meine Güte, komm wieder runter, war doch nur eine Frage.«
»Aber du kennst ihn doch besser als die Klatschheftchen, oder?«, fragte Tammy, und ich war überrascht angesichts ihrer Scharfsinnigkeit – ich hatte nicht erwartet, dass jemand bemerken würde, dass wir mehr waren als flüchtige Bekannte.
»Wir haben als Kinder miteinander gespielt, wenn ich bei Hof zu Besuch war. Aber das ist lange her, deshalb will ich also nicht so tun, als wären wir die besten Freunde.«
Wieder brach die Bleistiftspitze ab, diesmal, weil ich den Spitzer etwas zu heftig gedreht hatte.
»Und müssen wir jetzt vor ihm knicksen oder so?«, fragte Gwen, und der plötzlichen Stille nach zu urteilen schien mittlerweile die halbe Klasse zuzuhören.
»Kannst du, wenn du möchtest, aber zwingend ist es nicht.«
»Okay, also, sagen wir mal, ich heirate ihn. Wie reich bin ich dann?«
Angesichts dieser für Gwen so typisch unbekümmerten Frage konnte ich mir ein Lächeln nicht verbeißen. »Unglaublich reich.«
»Tja, Gwen«, rief Mrs. Lloyd, die in diesem Augenblick in der Tür erschien, eine große mit Deckel versehene Teetasse in der Hand. »Wenn du dich dieses Jahr nur ein bisschen mehr anstrengen würdest, könntest du dir gleich dein Hochzeitskleid selbst schneidern.«
»Ich denke da an so eins, wie es Kate Middleton getragen hat, nur in Schwarz«, sinnierte Gwen und hielt eine spitzenbesetzte Stoffprobe hoch, die sie mitgebracht hatte.
»Du kannst doch bei deiner Hochzeit kein Schwarz tragen!«, protestierte Christy, und schon ging die Kabbelei los.