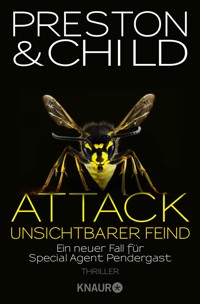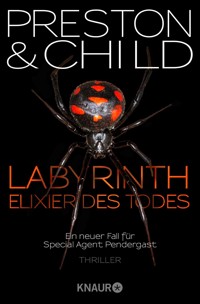9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Ein gnadenloser Mörder sucht sich ein Opfer nach dem anderen. Ihre Gemeinsamkeit: Sie waren Freunde des verschollenen Special Agent Pendergast. Doch wer könnte ein Interesse daran haben, sie auszuschalten? Detective D'Agosta beginnt unter Hochdruck zu ermitteln. Er weiß, dass auch er und seine Frau im Visier des Killers stehen. Unerwartete Hilfe bekommt D'Agosta von niemand anderem als Pendergast selbst. Dieser hat sein Verschwinden nur vorgetäuscht, um unbemerkt nach seinem größten Feind suchen zu können: seinem Bruder Diogenes, den er für den Mörder hält. Das FBI verfolgt allerdings eine andere Theorie. Ist es möglich, dass Pendergast sich Diogenes nur einbildet – und selbst ein eiskalter Killer ist? Dark Secret von Lincoln Child, Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Dark Secret
Mörderische Jagd Roman
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
Epilog
Dank
Lincoln Child
widmet dieses Buch seiner Tochter Veronica.
Douglas Preston
widmet dieses Buch seiner Tochter Aletheia.
1
Dewayne Michaels saß im Hörsaal in der zweiten Reihe und starrte den Professor mit einer, wie er hoffte, interessierten Miene an. Seine Lider waren bleischwer. Sein Schädel pochte im selben Rhythmus wie sein Herz, und er hatte einen Geschmack im Mund, als wäre irgendetwas auf seiner Zunge verendet. Er war spät dran gewesen und hatte feststellen müssen, dass in dem großen Hörsaal nur noch ein einziger Platz frei gewesen war: zweite Reihe Mitte, genau vor dem Rednerpult.
Einfach toll.
Dewaynes Hauptfach war Elektrotechnik. Er belegte die Vorlesung aus dem gleichen Grund wie alle Studenten der Ingenieurwissenschaften seit drei Jahrzehnten – man musste nichts dafür tun. »Die englische Literatur – Eine humanistische Sichtweise« war schon immer eine Veranstaltung gewesen, die man auch dann mit Erfolg bestand, wenn man fast kein Buch aufgeschlagen hatte. Professor Mayhew, der verknöcherte alte Sack, der normalerweise die Vorlesung hielt, redete monoton wie ein Hypnotiseur, blickte fast nie von seinem vierzig Jahre alten Vorlesungsskript auf, und seine Stimme war das reinste Schlafmittel. Der alte Langweiler änderte noch nicht mal seine Prüfungsfragen, und überall in Dewaynes Studentenwohnheim lagen Kopien davon herum. Aber Pech gehabt! Denn ausgerechnet in diesem Semester hielt eine so genannte Koryphäe, ein gewisser Dr. Torrance Hamilton, die Vorlesung. Und um diesen Hamilton wurde ein derartiger Rummel veranstaltet, als hätte sich Eric Clapton bereit erklärt, auf der Semesterabschlussfete aufzutreten.
Dewayne rutschte genervt auf seinem Sitz herum. Wegen des kalten Kunststoffs war ihm schon der Hintern eingeschlafen. Er schielte nach links und rechts. Ringsherum machten sich die anderen – hauptsächlich höhere Semester – Notizen, ließen ihre Minirecorder mitlaufen, hingen geradezu an den Lippen des Professors. Es war das erste Mal, dass die Vorlesung so gut besucht war. Aber weit und breit kein Student der Ingenieurwissenschaften.
So ein Scheiß.
Wenigstens hatte er noch eine Woche Zeit, um wieder auszusteigen. Aber er brauchte den Schein, außerdem war es ja möglich, dass man den auch bei Professor Hamilton ohne großen Aufwand kriegte. Trotzdem, die Studenten hätten sich doch nicht an einem Samstagmorgen in solchen Massen blicken lassen, wenn sie glaubten, veralbert zu werden, oder?
Jedenfalls saß er nun ganz vorn in der Mitte, und da war es sicher besser, sich um einen aufgeweckten Eindruck zu bemühen.
Hamilton schritt auf dem Podium hin und her, während seine tiefe Stimme durch den Hörsaal hallte. Er sah aus wie ein ergrauter Löwe, die Haare zu einer Mähne nach hinten gekämmt, und trug statt der üblichen abgewetzten Tweedklamotten einen feinen grauen Anzug. Sein Akzent war ungewöhnlich, keiner, den man hier in New Orleans sprach, bestimmt auch kein Ostküstenakzent. Es schien allerdings auch kein britischer zu sein. Hamiltons Assistent saß in einem Stuhl hinter ihm und schrieb fleißig mit.
»Und deshalb«, sagte Professor Hamilton gerade, »behandeln wir heute Eliots Gedicht Das wüste Land, in dem sich das 20. Jahrhundert in seiner ganzen Entfremdung und Hohlheit spiegelt. Es gehört zu den bedeutendsten Gedichten, die je geschrieben wurden.«
Das wüste Land. Ach ja, jetzt fiel es ihm wieder ein. Was für ein Titel! Natürlich hatte er das Gedicht nicht gelesen. Warum auch? War ja schließlich kein Roman: Ein Gedicht konnte man auch schnell während der Vorlesung überfliegen.
Er nahm den Gedichtband von T.S. Eliot in die Hand, den er sich von einem Freund geliehen hatte – wieso Geld für ein Buch verplempern, das man sowieso nie wieder angucken würde? –, und schlug ihn auf. Neben dem Titelblatt war ein Foto des Autors abgebildet. Der Typ sah aus wie ein echtes Weichei: Hornbrille und eine verdruckste Miene, als hätte er einen Besenstiel verschluckt. Dewayne schnaubte verächtlich und blätterte weiter. Wüstes Land. Wüstes Land … ah, da war’s!
Scheiße. Das sollte ein Gedicht sein? Das ging ja Seite um Seite!
»Die Anfangsverse sind inzwischen so bekannt, dass wir uns kaum noch vorstellen können, welche Sensation – welchen Schock – sie auslösten, als das Gedicht 1922 in The Dial erschien. So etwas hielt man damals nicht für Dichtung, sondern für eine Art von Antidichtung. Die Persona des Dichters war ausgelöscht. Zu wem gehören also diese düsteren, beunruhigenden Gedanken? Im ersten Vers findet sich natürlich die berühmte sarkastische Anspielung auf Chaucer. Aber es steckt noch viel mehr darin. Denken Sie mal über die Metaphern am Anfang nach: ›Flieder aus toter Erde‹, ›dumpfe Wurzeln‹, ›Schnee des Vergessens‹. Liebe Freunde, bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein Dichter in der Geschichte der Weltliteratur je auf diese Weise über den Frühling geschrieben.«
Als Dewayne bis zum Schluss des Gedichts vorgeblättert hatte, stellte er fest, dass es mehr als vierhundert Verse umfasste. O nein. Nein …
»Faszinierend ist, dass Eliot im zweiten Vers von Flieder spricht und nicht von Mohn, obwohl Letzteres naheliegender gewesen wäre. Mohn wuchs damals in Europa in einem Maße, wie man es seit Jahrhunderten nicht mehr erlebt hatte; denn nach dem Ersten Weltkrieg düngten zahllose verwesende Leichen die Erde. Wichtiger aber ist, dass der Mohn – mit seinen Anklängen an narkotischen Schlaf – besser in Eliots Bildsprache gepasst hätte. Warum also hat der Autor den Flieder gewählt? Betrachten wir kurz, auf welche Weise er sich auf die literarischen Vorläufer bezieht, hier vor allem Whitmans Als Flieder jüngst mir im Garten blühte.«
O mein Gott, das hier war der reine Albtraum: Da saß man ganz vorn im Hörsaal und begriff kein Wort von dem, was der Professor redete. Aber wer hätte denn gedacht, dass man ein vierhundert Zeilen langes Gedicht über ein verdammtes »wüstes Land« schreiben konnte? Apropos wüst, gestern Abend, das war ein ziemlich wüstes Gelage gewesen. Aber geschah ihm ganz recht, er hätte ja nicht bis vier Uhr morgens abhängen und sich einen Grey Goose nach dem anderen reinkippen müssen; dann hätte er jetzt auch keinen dicken Kopf.
Plötzlich war es ringsum still; die Stimme hinter dem Pult war verstummt. Dewayne blickte auf: Dr. Hamilton stand reglos da, mit einem merkwürdigen Ausdruck im Gesicht. So elegant der alte Knabe auch gekleidet war, jetzt sah er eher so aus, als hätte er sich in die Hose gemacht. Seine Gesichtszüge waren mit einem Mal merkwürdig schlaff. Unter Dewaynes Blicken zog er langsam ein Taschentuch hervor und betupfte sich sorgfältig die Stirn, dann faltete er es fein säuberlich zusammen, steckte es zurück in die Brusttasche und räusperte sich.
»Verzeihen Sie.« Er griff nach dem Glas Wasser, das auf dem Pult stand, und trank einen kleinen Schluck. »Wie gesagt, betrachten wir einmal das Metrum, das Eliot im ersten Abschnitt verwendet. Sein freies Versmaß weist ein aggressives Enjambement auf: die einzigen Zäsuren gibt es in den Versen, in denen ein Satz endet. Achten Sie auch auf die starke Betonung der ersten Silbe der Verben: brüten, mischen, sich regen. Das hört sich wie das unheilvolle, vereinzelte Schlagen einer Trommel an; es ist hässlich, es zerstört die Bedeutung des Satzes und erzeugt ein Gefühl der Beunruhigung. Und es bereitet uns darauf vor, dass etwas in diesem Gedicht geschehen wird, und zwar etwas Unschönes.«
Die Neugier, die durch die unerwartete Pause in Dewayne geweckt worden war, legte sich wieder. Die sonderbare Leidensmiene des Professors war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war, und auch sein Gesicht war zwar immer noch blass, aber nicht mehr so aschfahl.
Dewayne widmete sich wieder seiner Lektüre. Um herauszufinden, was es bedeutete, konnte er das Gedicht ja mal rasch überfliegen. Er las den Titel, dann wanderte sein Blick nach unten, zum Epigramm oder Epigraph oder wie immer man das nannte.
Er stutzte. Was war das denn? Nam Sibyllam quidem … Also Englisch war das jedenfalls nicht. Und dort, mittendrin, waren irgendwelche unentzifferbaren Schnörkel, die nicht mal Teil des normalen Alphabets waren. Er blickte auf die Anmerkungen unten auf der Seite und las, dass der erste Teil Lateinisch und der zweite Teil Griechisch war. Darunter stand die Widmung: Für Ezra Pound, il miglior fabbro. In den Anmerkungen hieß es, der letzte Teil sei Italienisch.
Lateinisch, Griechisch, Italienisch. Und dabei hatte das dämliche Gedicht noch nicht einmal angefangen. Und was kam als Nächstes, Hieroglyphisch?
Es war wirklich ein Albtraum.
Dewayne überflog die erste, dann die zweite Seite. Ein einziges Gefasel. »Ich zeige dir die Angst in einer Hand voll Staub.« Was sollte das denn heißen? Sein Blick fiel auf die nächste Zeile. Frisch weht der Wind – schon wieder kein Englisch!
Dewayne klappte das Buch zu. Er hielt das einfach nicht mehr aus. Schon in den ersten dreißig Zeilen hatte der Typ fünf verschiedene Sprachen verwendet, zum Kotzen. Gleich morgen früh würde er sich im Geschäftszimmer melden und aus dieser beknackten Vorlesung aussteigen.
Mit dröhnendem Kopf lehnte er sich zurück. Jetzt, da er sich entschieden hatte, stellte sich nur noch die Frage, wie er die nächsten vierzig Minuten durchstehen sollte, ohne die Wand hochzugehen. Wäre doch bloß hinten noch etwas frei gewesen, dann hätte er sich unauffällig rausschleichen können …
Oben auf dem Podium redete der Professor weiter. »Beginnen wir also nach dieser kurzen Einführung mit der Untersuchung der …«
Plötzlich hielt Hamilton abermals inne. »Entschuldigen Sie.« Seine Gesichtszüge erschlafften erneut. Er wirkte – ja, wie? Durcheinander? Benebelt? Nein: Er sah verängstigt aus.
Dewayne richtete sich in seinem Sitz auf, das interessierte ihn.
Professor Hamilton griff nach seinem Taschentuch und fummelte es aus der Brusttasche, ließ es dann aber fallen, als er es an die Stirn halten wollte. Er blickte sich ziellos um und wedelte mit der Hand durch die Luft, als wollte er eine Fliege abwehren. Schließlich fand die zittrige Hand sein Gesicht und er betastete es wie ein Blinder. Hamilton berührte seine Lippen, dann die Augen, die Nase, das Haar, schließlich fuchtelte er wieder mit der Hand herum.
Im Hörsaal war es still geworden. Der Assistent hinter Professor Hamilton legte mit besorgter Miene den Kugelschreiber hin. Was war los?, überlegte Wayne. Hatte der Professor einen Herzinfarkt?
Hamilton trat einen kleinen, unsicheren Schritt vor und taumelte gegen das Podium. Und nun flog auch die andere Hand zum Gesicht, befingerte es überall, nur fester jetzt, sie drückte und dehnte die Haut, zog die Unterlippe nach unten, dann verabreichte sich der Professor selbst ein paar leichte Schläge.
Plötzlich hielt er inne, ließ den Blick durch den Saal schweifen und fragte: »Stimmt irgendetwas mit meinem Gesicht nicht?«
Totenstille.
Langsam, sehr langsam entspannte sich Dr. Hamilton. Er holte mühsam Luft, dann noch einmal, und nach und nach normalisierten sich seine Gesichtszüge wieder. Er räusperte sich.
»Wie ich soeben sagte …«
Aber die Finger der einen Hand fingen wieder an zu zappeln, sie zuckten und zitterten. Die Hand kehrte zum Gesicht zurück, die Finger zupften und rupften an der Haut.
Das war einfach zu irre.
»Ich …«, begann Hamilton, aber die Hand störte ihn beim Sprechen. Sein Mund öffnete und schloss sich, aber er brachte nur ein pfeifendes Geräusch heraus. Dann machte er wieder einen schlurfenden Schritt, wie ein Roboter, und stieß noch einmal gegen das Podium.
»Was sind das für Dinger?« Hamiltons Stimme brach.
O Gott, jetzt zerrte er auch noch so stark an seiner Gesichtshaut, dass sich die Augenlider grotesk verzogen, und wühlte mit beiden Händen im Gesicht herum. Und dann hörte man das lange, gleichmäßige Kratzen eines Fingernagels, und auf Hamiltons Wange erschien ein blutiger Strich.
Eine Art befangenes Kichern breitete sich im Hörsaal aus.
»Ist Ihnen nicht gut, Herr Professor?«, fragte der Assistent.
»Ich … habe eine … Frage gestellt«, stieß Hamilton widerwillig knurrend hervor, und dabei hatte seine Stimme einen gedämpften, verzerrten Klang, weil er mit den Händen weiter an seinem Gesicht herumzerrte.
Noch ein torkelnder Schritt, dann ein plötzlicher Aufschrei: »Mein Gesicht! Warum sagt mir niemand, was mit meinem Gesicht los ist?«
Immer noch Totenstille im Publikum.
Hamilton grub die Fingernägel in seine Wangen, dann schlug er mit der Faust so heftig auf seine Nase ein, dass ein leises Knacken zu hören war.
»Holt die Biester von mir runter! Die zerfressen mir das Gesicht!«
Scheiße! Jetzt schoss Hamilton Blut aus der Nase und spritzte auf das weiße Hemd und den grauen Anzug. Die Finger rissen wie Klauen an seiner Haut; und jetzt krümmte sich einer von ihnen zu einem Haken und bohrte sich – Dewayne sah es mit ungeheurem Entsetzen – immer tiefer in eine der Augenhöhlen.
»Raus! Schafft die Biester hier raus!«
Hamilton vollführte eine jähe Drehbewegung mit der Hand, die Dewayne an das Portionieren von Eiscreme erinnerte, und plötzlich sprang der Augapfel heraus. Grotesk groß baumelte er aus der Augenhöhle und starrte Dewayne aus einem schlechterdings unmöglichen Winkel mitten ins Gesicht.
Schreie hallten durch den Hörsaal. Die Studenten in den ersten Reihe wichen entsetzt zurück. Der Assistent sprang von seinem Stuhl auf und rannte zu Hamilton hin, der ihn jedoch mit aller Kraft zurückstieß. Dewayne blieb wie angewurzelt sitzen, er konnte keinen klaren Gedanken fassen, und seine Beine waren wie gelähmt.
Jetzt machte Professor Hamilton einen Schritt und dann noch einen, er zerfetzte dabei sein Gesicht, riss sich das Haar büschelweise aus und torkelte, als würde er im nächsten Augenblick auf Dewayne herunterfallen.
»Einen Arzt!«, schrie der Assistent. »Holt einen Arzt!«
Der Bann war gebrochen, es entstand ein plötzlicher Tumult. Alle schossen gleichzeitig von ihren Sitzen, Bücher klatschten auf den Boden, panikerfüllte Rufe erfüllten den Hörsaal.
»Mein Gesicht!«, kreischte der Professor. »Wo ist es?«
Chaos brach aus, die Studenten rannten zur Tür, manche weinten. Andere stürzten nach vorn zu dem Professor, der inzwischen vollkommen die Kontrolle über sich verloren hatte, sie sprangen aufs Podium und versuchten, dessen selbstzerstörerische Attacke zu unterbinden. Hamilton schlug blindlings nach ihnen und stieß dabei einen hohen, schrillen Laut aus. Sein Gesicht war eine blutige Fratze. Irgendjemand, der sich aus der Sitzreihe hinausdrängelte, trat Dewayne auf den Fuß. Blutstropfen spritzten ihm ins Gesicht, er spürte ihre Wärme auf seiner Haut. Dennoch blieb er immer noch wie angewurzelt sitzen. Er war außerstande, den Blick von dem Geschehen zu wenden und diesem Albtraum zu entfliehen.
Mehrere Studenten hatten den Professor zu Boden gerungen, jetzt rutschten sie in seinem Blut herum und versuchten seine wild um sich schlagenden Arme und den sich aufbäumenden Körper festzuhalten. Direkt vor Dewaynes Augen riss sich Hamilton mit dämonischer Kraft von den Studenten los und griff nach seinem Wasserglas, brach es mit einem Schlag gegen das Podium in Stücke und begann laut kreischend sich die Scherben in den Hals zu drücken, mit drehenden und aushöhlenden Bewegungen, als wollte er etwas ausgraben.
Und dann, ganz plötzlich, merkte Dewayne, dass er doch aufstehen konnte. Er rappelte sich auf, schlitterte und rannte die Sitzreihe entlang zum Mittelgang und spurtete die Treppe hinauf zum Hinterausgang des Hörsaals. Er war von einem einzigen Gedanken beherrscht – so schnell wie möglich diesem gruseligen Schauspiel zu entfliehen, dem er soeben beigewohnt hatte. Aber während er zur Tür hinausschoss und über den Flur rannte, wiederholte sich ein Satz gebetsmühlenartig in seinem Kopf: Ich zeige dir die Angst in einer Hand voll Staub.
2
Vinnie? Vin? Bist du ganz sicher, dass du keine Hilfe da drin brauchst?«
»Danke, ich komm schon klar!« Lieutenant Vincent D’Agosta bemühte sich, seine Stimme ganz locker und gelassen klingen zu lassen. »Alles in Ordnung. Dauert nur noch ein paar Minuten.«
Er warf einen Blick auf die Küchenuhr: fast neun. Nur noch ein paar Minuten. Aber sicher. Er konnte von Glück reden, wenn das Essen um zehn auf dem Tisch stand.
Normalerweise war Laura Haywards Küche – er betrachtete sie immer noch als die ihre, schließlich war er erst vor sechs Wochen eingezogen – eine Oase der Ordnung. So ruhig und blitzsauber wie Hayward selbst. Jetzt sah es hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Spüle quoll förmlich über von schmutzigen Töpfen. In und um den Abfalleimer herum lagen ein halbes Dutzend Dosen, aus denen Reste von Tomatensauce und Olivenöl tropften. Auf dem Küchentresen befanden sich fast ebenso viele aufgeschlagene Kochbücher, deren Seiten dank verstreuten Semmelbröseln und Mehlhäufchen nahezu unleserlich waren. Das einzige Fenster, das auf die schneebedeckte Kreuzung der Siebenundsiebzigsten und der First hinausging, war mit dem Bratfett der Würste bespritzt. Obwohl der Abzug auf höchster Stufe lief, hielt sich der Geruch nach Angebranntem hartnäckig in der Luft.
Immer wenn es ihnen ihre Terminpläne in den letzten Wochen erlaubt hatten, hatte Laura ein köstliches Mahl nach dem anderen zubereitet, scheinbar fast im Handumdrehen. D’Agosta hatte nicht schlecht gestaunt. Für seine Frau (bald Exfrau), die mittlerweile in Kanada lebte, war Kochen immer eine Qual gewesen, stets von theatralischen Seufzern, lautem Pfannengeklapper und meist wenig überzeugenden Ergebnissen begleitet. Laura war das genaue Gegenteil.
Aber D’Agosta wunderte sich nicht nur über Laura, sie machte ihm auch ein wenig Angst. Sie war Detective Captain bei der New Yorker Polizei und bekleidete damit einen höheren Rang als er. Und in der Küche war sie ihm auch weit überlegen. Dabei wusste doch wirklich jeder, dass Männer die besseren Köche waren, insbesondere Italiener. Die kochten die Franzosen glatt an die Wand. Und deshalb hatte er Laura immer wieder versprochen, ein typisch italienisches Essen für sie beide zuzubereiten, genauso wie es früher seine Großmutter gemacht hatte. Aber mit jedem Mal, wenn er sein Versprechen erneuert hatte, waren seine Pläne komplizierter und spektakulärer geworden. Und heute war der Tag gekommen, an dem er die Lasagna napoletana seiner Großmutter kochen wollte.
Aber kaum hatte er die Küche betreten, war ihm klar geworden, dass er sich nicht mehr genau daran erinnerte, wie seine Großmutter die Lasagna napoletana zubereitet hatte. O ja, er hatte ihr Dutzende Male zugeschaut und war ihr oft zur Hand gegangen. Aber was genau kam in das ragù, das sie auf die Pasta häufte? Und was tat sie in die kleinen Fleischbällchen, die neben der Wurst und verschiedenen Käsesorten die Füllung ergaben? Vor lauter Verzweiflung hatte D’Agosta Hilfe in Lauras Kochbüchern gesucht, die ihm jedoch lauter widersprüchliche Vorschläge machten. Und so stand er Stunden später immer noch ratlos da, während sich die einzelnen Bestandteile der Lasagne in unterschiedlichen Stadien der Vollendung befanden und sein Frust sekündlich wuchs.
Laura rief ihm etwas aus dem Wohnzimmer zu, in das er sie verbannt hatte. Er holte tief Luft und fragte: »Was hast du gesagt, Schatz?«
»Dass ich morgen später nach Hause komme. Rocker hat für den 22. Januar eine Lagebesprechung angesetzt. Deshalb habe ich nur Montagabend Zeit, um die Statusberichte und die Belegschaftsdaten auf den neuesten Stand zu bringen.«
»Rocker und sein Papierkrieg. Wie geht’s übrigens deinem Kumpel, dem Commissioner?«
»Er ist nicht mein Kumpel.«
D’Agosta wandte sich wieder dem ragù zu, das auf der Herdplatte köchelte. Er war nach wie vor davon überzeugt, dass es allein Laura zu verdanken war, dass er seinen alten Job zurückbekommen hatte und sein befristeter Vertrag verlängert worden war. Die Vorstellung, dass Laura bei Rocker ein gutes Wort für ihn eingelegt hatte, gefiel ihm zwar überhaupt nicht, aber so war es nun einmal.
Im Topf mit dem ragù platzte eine Riesenblase, als handelte es sich um einen Vulkanausbruch, und spuckte Sauce auf seine Hand. »Aua!«, rief er, kühlte seine Hand im Abwaschwasser und drehte gleichzeitig die Herdplatte kleiner.
»Schatz, was ist denn?«
»Nichts. Alles okay.« D’Agosta rührte mit dem Kochlöffel in der Sauce, merkte, dass sie angebrannt war, und schob den Topf hastig auf die hintere Platte. Dann hob er etwas zögernd den Löffel an die Lippen. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das Ragout hatte eine anständige Konsistenz und fühlte sich gut im Mund an, auch wenn es ein klein wenig angebrannt schmeckte. Seiner Großmutter wäre das natürlich nie passiert.
»Was kommt sonst noch in das ragù, Nonna?«, murmelte er vor sich hin, ohne auf Antwort zu hoffen.
Plötzlich zischte es. Der große Topf mit Salzwasser kochte über. D’Agosta unterdrückte einen Fluch, stellte auch diese Platte kleiner, riss eine Packung Pasta auf und versenkte ein Pfund Lasagne im sprudelnden Wasser.
Aus dem Wohnzimmer drang Musik: Laura hatte eine CD von Steely Dan eingeschoben. »Ich schwöre dir, wegen des Portiers spreche ich noch mit dem Vermieter«, sagte sie durch die Tür.
»Welcher Portier?«
»Der neue, der vor ein paar Wochen eingestellt wurde. Er ist der sturste Kerl, dem ich je begegnet bin. Der hält einem noch nicht einmal die Tür auf! Und heute Morgen wollte er mir kein Taxi rufen. Er hat nur den Kopf geschüttelt und ist weggegangen. Ich glaube, er kann kein Englisch. Wenigstens tut er so.«
Was erwartest du denn für 2500 im Monat?, dachte D’Agosta. Aber es war ja Lauras Wohnung, also hielt er besser den Mund. Außerdem bezahlte sie die Miete – zumindest im Augenblick. Aber das wollte er so bald wie möglich ändern.
Ohne irgendwelche Erwartungen war er bei ihr eingezogen. Er hatte gerade die schlimmsten Wochen seines Lebens hinter sich und weigerte sich, über den Tag hinaus zu denken. Außerdem befand er sich im Frühstadium seiner Scheidung, und die versprach keine angenehme Sache zu werden. Eine neue Beziehung einzugehen war deshalb zum damaligen Zeitpunkt vermutlich nicht die intelligenteste Entscheidung. Doch die Sache mit Laura Hayward hatte sich viel besser entwickelt, als er es sich je erträumt hätte. Inzwischen war sie mehr als nur eine Freundin oder Geliebte – sie war eine Seelenverwandte. Er hatte befürchtet, es könnte problematisch sein, dass sie beide bei der Polizei arbeiteten und sie in der Hierarchie über ihm stand. Das genaue Gegenteil war der Fall: Durch die Arbeit hatten sie etwas Gemeinsames und sie konnten sich gegenseitig helfen, indem sie einzelne Fälle besprachen, ohne sich über Fragen der Vertraulichkeit den Kopf zerbrechen zu müssen.
»Gibt’s neue Spuren im Fall Baumelmann?«, hörte er Laura aus dem Wohnzimmer fragen.
Der »Baumelmann«, so lautete in der Abteilung der Spitzname eines Täters, der seit einiger Zeit mit einer manipulierten Kreditkarte Geld aus Bankautomaten klaute und hinterher seinen Schwengel in die Überwachungskamera hielt. Die meisten dieser Überfälle hatten sich in D’Agostas Revier ereignet.
»Ich hab vielleicht eine Augenzeugin für das Ding gestern.«
»Augenzeugin wovon?«, fragte Laura anzüglich.
»Vom Gesicht natürlich.« D’Agosta rührte kurz die Pasta um, regulierte die Hitze, warf einen kurzen Blick auf den Herd und vergewisserte sich, dass die Temperatur stimmte. Dann wandte er sich zu dem chaotischen Küchentresen um und ging im Kopf noch einmal alles durch. Bratwurst: war da. Fleischbällchen: auch. Ricotta, Parmesan und Mozzarella fiordilatte ebenso. Sieht ganz so aus, als könnte ich doch was aus dem Hut zaubern …
Verdammt. Er musste noch den Parmesan reiben.
D’Agosta riss eine Schublade auf und kramte hektisch darin herum. Im selben Moment war ihm, als hätte er es an der Tür läuten hören.
Aber wahrscheinlich hatte er sich das nur eingebildet. Laura bekam nicht allzu oft Besuch, und ihn suchte erst recht niemand auf. Schon gar nicht zu dieser späten Stunde. Vermutlich hatte sich der Bote aus dem vietnamesischen Restaurant im Erdgeschoss in der Tür geirrt.
Seine Hand schloss sich um die Parmesanreibe. Er zog sie aus der Schublade, stellte sie auf den Küchentresen und griff sich ein Stück Käse. Nachdem er sich für die Seite mit der feineren Reibe entschieden hatte, legte er den Parmesan darauf.
»Vinnie?«, rief Laura. »Komm mal, bitte.«
D’Agosta zögerte nur einen Augenblick. Etwas an Lauras Ton brachte ihn dazu, alles auf den Tresen zu legen und aus der Küche zu treten.
Laura stand vorn im Flur der Wohnung und sprach mit einem Wildfremden. Das Gesicht des Mannes, der einen teuren Trenchcoat trug, lag im Schatten. Irgendwie kam er ihm bekannt vor. Plötzlich trat der Mann einen Schritt vor, ins Licht. D’Agosta stockte der Atem. »Sie!«
Der Mann verbeugte sich. »Und Sie sind Vincent D’Agosta.«
Laura warf ihm einen Blick zu. Wer ist das?, fragte ihr Gesichtsausdruck.
D’Agosta atmete auf. »Laura, darf ich dir Proctor vorstellen. Den Fahrer von Agent Pendergast.«
Sie sah ihn überrascht an.
Proctor verneigte sich. »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Ma’am.«
Sie nickte einfach nur.
Proctor wandte sich wieder an D’Agosta. »Nun, Sir, würden Sie bitte mit mir kommen?«
»Wohin?« Aber D’Agosta kannte die Antwort schon.
»Zum Riverside Drive 891.«
»Und warum?«
»Weil dort jemand auf Sie wartet. Jemand, der nach Ihrer Anwesenheit verlangt.«
»Jetzt sofort?«
Proctor verbeugte sich ein weiteres Mal stumm.
3
D’Agosta saß im Fonds des Rolls-Royce Silver Wraith, Baujahr 1959, und blickte aus dem Fenster, ohne wirklich etwas zu erkennen. Proctor war mit ihm in Richtung Westen gefahren, durch den Central Park, und jetzt jagte der große Wagen den Broadway hinauf.
D’Agosta rutschte auf dem weißen Ledersitz herum und konnte seine Neugier und Ungeduld kaum bezähmen. Am liebsten hätte er den Fahrer mit Fragen gelöchert, aber der würde ihm mit Sicherheit keine Antwort geben.
891 Riverside Drive. Die Adresse – eine der Adressen – von Special Agent Aloysius Pendergast, D’Agostas Freund und Partner in mehreren außergewöhnlichen Fällen. Der geheimnisumwitterte FBI-Agent, den D’Agosta kannte und doch nicht kannte und der offenbar mindestens so viele Leben hatte wie eine Katze …
Bis zu jenem Tag vor zwei Monaten, als er Pendergast das letzte Mal gesehen hatte.
Es war an der steilen Flanke eines Berges südlich von Florenz gewesen. Pendergast war weiter unten am Hang gewesen, umringt von einer geifernden Meute von Jagdhunden, während ein Dutzend bewaffneter Männer im Hintergrund gelauert hatte. Pendergast hatte sich geopfert, damit D’Agosta ihren Verfolgern entkam.
Und D’Agosta hatte es zugelassen.
D’Agosta rutschte unruhig auf dem Sitz hin und her, als er sich daran erinnerte. Jemand, der nach Ihrer Anwesenheit verlangt, hatte Proctor gesagt. Konnte es sein, dass Pendergast – trotz allem – die Flucht gelungen war? Es wäre nicht das erste Mal. Er unterdrückte die aufkeimende Hoffnung …
Aber nein, das konnte nicht sein. Tief im Inneren wusste er, dass Pendergast tot war.
Jetzt glitt der Rolls den Riverside Drive hinauf. D’Agosta verlagerte nochmals sein Gewicht und blickte auf die vorbeihuschenden Straßenschilder: 125th Street, 130th Street. Sehr schnell traten an die Stelle des gepflegten Viertels bei der Columbia University heruntergekommene Häuser aus braunem Sandstein und leer stehende Mietskasernen. Die Januarkälte hatte die üblichen Herumtreiber nach drinnen getrieben, und im trüben Abendlicht sahen die Straßen verlassen aus.
Weiter vorn, gleich nach der 137th Street, erkannte D’Agosta jetzt die mit Brettern vernagelte Fassade und das kleine, von einem schmiedeeisernen Geländer eingerahmte Podest auf dem Dach von Pendergasts Villa. Beim Anblick der düsteren Umrisse des Riesenkastens lief ihm ein Schauder über den Rücken.
Der Rolls fuhr durch das Tor in dem schmiedeeisernen, mit Spitzen versehenen Zaun und blieb in der überdachten Wagenauffahrt stehen. Ohne auf Proctor zu warten, stieg D’Agosta aus und sah zu den vertrauten Umrissen des weitläufigen Gebäudes hinauf, dessen Fenster mit Blechplatten verdeckt waren und das nach außen hin genauso wirkte wie die anderen verlassenen Villen am Riverside Drive. Drinnen beherbergte es allerdings geradezu unvorstellbare Wunder und Geheimnisse. D’Agosta bekam Herzklopfen. Vielleicht war Pendergast ja doch da und saß in seinem unvermeidlichen schwarzen Anzug in der Bibliothek vor dem prasselnden Kamin, während die tanzenden Flammen merkwürdige Schatten auf sein bleiches Gesicht warfen. Und dann würde er sagen: »Mein lieber Vincent, danke, dass Sie gekommen sind. Darf ich Ihnen ein Glas Armagnac anbieten?«
D’Agosta wartete, bis Proctor die schwere Tür entriegelt und geöffnet hatte. Fahles Licht fiel auf die verwitterte Backsteinfassade. D’Agosta trat vor, während Proctor die Tür sorgfältig hinter ihm verschloss. Sein Herz schlug schneller. Schon allein die Tatsache, wieder in dem herrschaftlichen Haus zu sein, weckte in ihm eine merkwürdige Mischung von Gefühlen: Erregung, Angst, Bedauern.
Proctor wandte sich zu ihm um. »Hier entlang, Sir, wenn ich bitten darf.«
Der Chauffeur ging durch den langen Flur voraus in die Empfangshalle mit der blauen Kuppel. Hier war in Dutzenden Glasvitrinen eine Reihe von sagenumwobenen Sammlerstücken ausgestellt: Meteoriten, Edelsteine, Fossilien, Schmetterlinge. D’Agostas Blick schweifte verstohlen über den Parkettboden bis zum anderen Ende der Lobby, wo die Doppeltür zur Bibliothek offen stand. Falls Pendergast auf ihn wartete, dann dort: Mit einem leisen Lächeln auf den Lippen würde er in einem bequemen Ohrensessel sitzen und die Wirkung seiner kleinen Inszenierung auf seinen Freund auskosten.
Proctor ging voran in Richtung Bibliothek. Mit klopfendem Herzen betrat D’Agosta den prächtigen Raum, der genauso roch, wie er ihn Erinnerung hatte: nach Leder, Steifleinen und einer Spur von Holzrauch. Allerdings brannte kein fröhlich knisterndes Feuer im Kamin. Es war kühl im Zimmer. Die mit Intarsien geschmückten Bücherwände voller ledergebundener Bände mit Goldschnitt waren im Halbdunkel nur undeutlich zu erkennen. Es brannte nur ein Licht – eine Tiffany-Lampe warf ihren kleinen Lichtkegel von einem Seitentisch in ein Meer der Dunkelheit.
Nach einem Augenblick, in dem sich seine Augen an das Halbdunkel gewöhnten, erblickte D’Agosta neben dem Tisch eine Gestalt, die gerade außerhalb des Lichtkreises gestanden hatte und jetzt über den Teppich auf ihn zuschritt. Der Lieutenant erkannte die junge Frau sofort. Es war Constance Greene, Pendergasts Mündel und Assistentin. Sie war um die zwanzig und trug ein langes, altmodisches Samtkleid, das ihre schmale Taille betonte und fast bis zum Boden reichte. Obgleich unverkennbar jung, hatte Constance die Haltung einer Frau vorgerückten Alters. Und auch der Blick ihrer Augen wirkte merkwürdig alt – D’Agosta erinnerte sich an diese Augen voller Erfahrung und Bildung und an ihre altmodische, ja altertümliche Sprache. Und dann war da noch dieses Andere gewesen, etwas so gerade außerhalb des Normalen, das ebenso an ihr zu haften schien wie das antike Flair, das ihre Kleidung verströmte.
Heute wirkten ihre Augen anders als sonst. Gequält und dunkel, kam in ihnen irgendeine Art Verlust zum Ausdruck … vielleicht auch Angst?
Constance streckte ihm ihre Rechte entgegen und sagte in gemessenem Tonfall: »Lieutenant D’Agosta.«
D’Agosta ergriff ihre Hand, unsicher wie immer, ob er diese nun schütteln oder küssen sollte. Er tat weder das eine noch das andere, und nach einem Augenblick entzog Constance sie ihm.
Normalerweise war sie die Höflichkeit in Person. Heute blieb sie aber einfach vor D’Agosta stehen, ohne ihm einen Stuhl anzubieten oder sich nach seiner Gesundheit zu erkundigen. Sie wirkte unsicher. Und D’Agosta ahnte auch, warum. »Haben Sie etwas gehört?«, fragte sie mit einer Stimme, die kaum zu hören war. »Irgendetwas?«
D’Agosta schüttelte den Kopf, die Hoffnung, die sich in ihm geregt hatte, erlosch.
Constance hielt seinem Blick einen Moment länger stand. Dann nickte sie verständnisvoll und senkte die Lider. So standen sie eine Weile da und schwiegen.
Constance hob den Kopf. »Es ist töricht, weiter zu hoffen. Über sechs Wochen sind ohne eine Nachricht vergangen.«
»Ich weiß.«
»Er ist tot«, sagte sie mit noch leiserer Stimme.
D’Agosta erwiderte nichts.
Sie gab sich einen Ruck. »Das heißt, es ist an der Zeit, Ihnen das hier zu geben.« Sie ging zum Kaminsims und nahm ein kleines, mit Perlmuttintarsien versehenes Sandelholzkästchen herunter. Mit einem kleinen Schlüssel, der bereits in ihrer Hand lag, schloss sie das Kästchen auf und hielt es, ohne es zu öffnen, D’Agosta entgegen. »Ich habe diesen Augenblick schon viel zu lange hinausgeschoben. Aber ich hatte gehofft, dass mein Vormund vielleicht doch noch auftaucht.«
D’Agosta blickte auf das Kästchen. Es kam ihm bekannt vor, aber einen Augenblick lang konnte er sich nicht entsinnen, wo er es schon einmal gesehen hatte. Dann fiel es ihm ein: Es war in diesem Haus gewesen, genau in diesem Zimmer, im vergangenen Oktober. Er hatte die Bibliothek betreten und Pendergast beim Schreiben eines Briefes gestört. Der Agent hatte den Brief in dieses Kästchen gelegt. Das war am Abend gewesen, als sie zu ihrer verhängnisvollen Reise nach Italien aufgebrochen waren – der Abend, als Pendergast ihm von seinem Bruder Diogenes erzählt hatte.
»Nehmen Sie es.« Constances Stimme zitterte. »Bitte ziehen Sie das hier nicht in die Länge.«
»Verzeihen Sie.« D’Agosta nahm das Kästchen vorsichtig entgegen und öffnete es. Darin lag ein einzelner Bogen schweren cremefarbenen Papiers, einmal gefaltet. Höchst ungern zog D’Agosta das Blatt Papier heraus. Böses ahnend faltete er es auseinander und begann zu lesen.
Mein lieber Vincent,
wenn Sie diesen Brief lesen, bedeutet dies, dass ich tot bin. Es bedeutet zudem, dass ich gestorben bin, ehe ich eine Aufgabe erfüllen konnte, deren Durchführung rechtmäßig mir und keinem anderen obliegt, nämlich meinen Bruder Diogenes davon abzuhalten, das zu begehen, was er einmal prahlerisch als das »perfekte« Verbrechen bezeichnet hat.
Ich wollte, ich könnte Ihnen mehr über dieses Verbrechen berichten, aber ich weiß darüber nur, dass er es seit vielen Jahren plant und dass er es als die Erfüllung seines Lebens betrachtet. Was immer dieses »perfekte« Verbrechen sein mag, es wird ruchlos sein. Die Welt wird dadurch zu einem dunkleren Ort werden. Diogenes ist ein Mann mit außergewöhnlichen Maßstäben. Er würde sich nicht mit weniger zufrieden geben.
Ich fürchte, Vincent, dass die Aufgabe, Diogenes Einhalt zu gebieten, nun an Sie fallen muss. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich dies bedauere. Es ist etwas, das ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche und erst recht nicht einem, den ich inzwischen als treuen Freund betrachte. Aber es ist etwas, von dem ich glaube, dass Sie es besonders gut bewältigen können. Diogenes’ Androhung ist zu vage, als dass ich mich an das FBI oder eine andere Strafverfolgungsbehörde wenden kann, denn er hat vor einigen Jahren seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Eine einzelne, engagierte Person hat die größten Chancen, meinen Bruder von der Durchführung dieses Verbrechens abzuhalten. Und diese Person sind Sie.
Diogenes hat mir einen Brief geschrieben, der nur eines enthält, ein Datum: den 28. Januar. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Verbrechen an diesem Tag verübt werden. Ich möchte jedoch keine Mutmaßungen anstellen – das Datum kann alles Mögliche bedeuten. Diogenes ist vor allem eines – unberechenbar.
Sie müssen sich von der Polizei von Southampton oder wo immer Sie derzeit angestellt sind, eine Zeit lang beurlauben lassen. Das lässt sich nicht vermeiden. Besorgen Sie sich alle hierzu nötigen Informationen von Detective Captain Laura Hayward, aber halten Sie sie weitestgehend aus der Sache heraus – um ihretwillen. Diogenes kennt sich in kriminaltechnischen und polizeilichen Verfahren hervorragend aus, und sollten Sie, was Gott verhüten möge, das Verbrechen nicht mehr rechtzeitig verhindern können, wird er diese Kenntnisse ohne Zweifel geschickt nutzen, um die Polizei in die Irre zu führen. So gut Hayward als Kommissarin ist, sie ist meinem Bruder nicht gewachsen.
Ich habe Constance ein separates Schreiben hinterlassen, die zu diesem Zeitpunkt in sämtliche Einzelheiten dieser Angelegenheit eingeweiht sein wird. Sie wird Ihnen mein Haus, meine Finanzen und alle meine Ressourcen zur Verfügung stellen. Außerdem wird Sie Ihnen umgehend ein auf Ihren Namen lautendes Bankkonto mit einem Guthaben von 500000 Dollar einrichten, über das Sie nach Gutdünken verfügen können. Ich empfehle, dass Sie sich der unschätzbaren Recherchefähigkeiten Constances bedienen, möchte Sie allerdings aus offensichtlichen Gründen darum bitten, sie aus Ihren direkten Ermittlungen herauszuhalten. Sie darf das Haus nicht verlassen – niemals. Und Sie müssen sehr, sehr gut auf sie Acht geben. Sie ist noch immer labil, psychisch wie körperlich.
Als ersten Schritt sollten Sie meiner Großtante Cornelia einen Besuch abstatten, die ihr Leben in einem Krankenhaus auf Little Governors Island fristet. Sie kannte Diogenes als Jungen und kann Ihnen jene persönlichen und familiären Informationen liefern, die Sie zweifellos benötigen werden. Behandeln Sie diese Informationen – und Cornelia – mit großer Umsicht.
Ein letztes Wort. Diogenes ist höchst gefährlich. Er ist mir intellektuell ebenbürtig, doch kennt er auch nicht die leisesten moralischen Skrupel. Überdies hat er nach einer schweren Erkrankung eine körperliche Behinderung zurückbehalten. Ihn treibt ein unbändiger Hass auf mich und eine absolute Verachtung für die Menschheit an. Machen Sie ihn erst auf sich aufmerksam, wenn Sie es unbedingt müssen. Seien Sie stets auf der Hut.
Leben Sie wohl, mein Freund – und viel Glück.
Aloysius Pendergast.
D’Agosta sah hoch. »Am 28. Januar? Mein Gott, das ist ja in einer Woche.«
Constance neigte nur leicht den Kopf.
4
Es muss an dem Geruch hier liegen, dachte sie, der bringt mir erst wirklich zu Bewusstsein, dass ich wieder im Museum bin: dieses Gemisch aus Mottenkugeln, Staub, altem Lack und einem Anflug von Verfall. Sie ging über den breiten Flur im fünften Stock, vorbei an den eichenen Bürotüren, auf denen in Goldlettern mit schwarzem Rand die Namen der einzelnen Kuratoren prangten. Sie wunderte sich, dass ihr nur weniges unbekannt war. In sechs Jahren hatte sich viel verändert, aber hier im Museum schienen die Uhren langsamer zu gehen.
Sie hatte sich Sorgen gemacht – mehr als sie sich eingestehen wollte. Was würde es wohl für ein Gefühl sein, mehrere Jahre nach dem furchterregendsten Erlebnis in ihrem Leben in das Museum zurückzukehren? Diese Besorgnis hatte ihren Entschluss zurückzukehren hinausgezögert. Doch nach den etwas schwierigen ersten Tagen musste sie zugeben, dass das Museum kaum noch etwas von seinem alten Schrecken barg. Ihre Albträume, das fortwährende Gefühl ihrer eigenen Verwundbarkeit, waren mit den Jahren verblasst und schließlich ganz verschwunden. Die Ereignisse von damals, ihre schlimmen Erlebnisse, waren nur noch Schnee von gestern. Aber das Museum war weiterhin ein herrlicher alter Schuppen, ein Spukschloss von wahrhaft gigantischen Ausmaßen, in dem viele wunderbare, exzentrische Leute arbeiteten. Und es war randvoll mit seltsamen, faszinierenden Objekten – die weltweit umfangreichste Sammlung von Trilobiten; »Luzifers Herz«, der kostbarste Diamant, der je gefunden wurde; »Wackelzahn«, das größte und am besten erhaltene Skelett eines Tyrannosaurus Rex.
Allerdings hatte sie sich vom Untergeschoss des Museums fern gehalten. Und sie hatte auch nicht aus Faulheit die Anzahl der Tage begrenzt, an denen sie nach Ende der Öffnungszeit arbeitete.
Sie konnte sich noch gut an die Zeit erinnern, als sie als unbedeutende Studentin zum ersten Mal über diesen Flur mit seinen erlauchten Mitarbeitern hinter den Türen gewandert war. Studenten standen in der Hierarchie des Museums so weit unten, dass man sie noch nicht einmal verachtete – sie wurden ganz einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Nicht, dass sie das geärgert hätte: Das war eben der Initiationsritus, den alle durchliefen. Damals war sie ein Niemand gewesen – eine »Sie« oder bestenfalls eine »Miss«.
Wie sich das alles geändert hatte. Jetzt war sie eine »Frau Doktor«, manchmal sogar eine »Frau Professor«, und wenn ihr Name gedruckt wurde, standen dahinter eine ganze Reihe akademischer Titel: Pierpont Research Fellow (bei »Fellow«, »Bursche«, musste sie immer unwillkürlich lächeln); außerordentliche Professorin für Ethnopharmakologie; und ihr neuester, erst drei Wochen alter Titel: Chefredakteurin von Museology. Zwar hatte sie sich immer eingeredet, dass Titel nichts bedeuteten, doch zu ihrem eigenen Erstaunen musste sie feststellen, dass sie – hatte man sie erst einmal erworben – höchst befriedigend waren. Professorin, das hatte einen hübschen, runden Klang, zumal von den Lippen jener verknöcherten alten Kuratoren, die ihr vor sechs Jahren nicht einmal gesagt hätten, wie spät es war. Inzwischen gaben sie sich besondere Mühe, sie um ihre Meinung zu bitten, oder drängten ihr ihre wissenschaftlichen Publikationen auf. Erst am Morgen hatte kein Geringerer als der Dekan der Ethnologischen Fakultät, ihr nomineller Chef, Hugo Menzies, sie beflissen nach dem Thema der von ihr geleiteten Podiumsdiskussion auf der bevorstehenden Konferenz der Society of American Anthropologists gefragt.
Ja, das war in der Tat eine erfrischende Abwechslung.
Das Büro des Museumsdirektors lag am Ende des Gangs, in einem der heißbegehrten Turmbüros. Sie blieb vor der mächtigen, von der Patina eines Jahrhunderts verdunkelten Eichentür stehen. Sie hob die Hand und ließ sie wieder fallen, denn mit einem Mal fühlte sie sich ein wenig nervös. Sie atmete tief durch. Sie freute sich, wieder im Museum zu sein, und fragte sich einmal mehr, ob die Kontroverse, in die sie sich zu stürzen gedachte, nicht doch ein schwerer Fehler war. Sie rief sich in Erinnerung, dass man ihr die Kontroverse aufgedrängt hatte und dass sie als Chefredakteurin von Museology Position beziehen musste. Wenn sie sich jetzt drückte, würde sie im Nu ihre Glaubwürdigkeit als Verfechterin ethischer Grundsätze und als Vorkämpferin der Meinungsfreiheit verlieren. Schlimmer noch, sie würde sich selbst nicht mehr in die Augen sehen können. Also gab sie sich einen Ruck und klopfte an, einmal, zweimal, dreimal, jedes Mal fester als zuvor.
Einen Augenblick war es still, dann öffnete ihr Mrs Sturd, die etwas nüchterne, aber tüchtige Sekretärin des Museumsdirektors. Sie trat einen Schritt zur Seite und musterte Margo aus durchdringend blauen Augen.
»Dr. Green? Dr. Collopy erwartet Sie schon. Sie können gleich zu ihm reingehen.«
Margo ging auf die innere Tür zu, die womöglich noch dunkler und massiver als die äußere wirkte, legte die Hand auf den eiskalten Messingknopf, drehte ihn und drückte die Tür mit ihren gutgeölten Türangeln auf.
Dort, hinter dem großen viktorianischen Schreibtisch, unter einem riesigen Gemälde der Victoriafälle von De Clefisse, saß Frederick Watson Collopy, Direktor des New York Museum of Natural History. Der gutaussehende Mann erhob sich entgegenkommend und lächelte sie an. Er trug einen dunkelgrauen, altmodisch geschnittenen Anzug. Eine Fliege aus hellroter Seide belebte die gestärkte weiße Hemdbrust.
»Ah, Margo. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Wie schön, dass Sie gekommen sind. Der Brief, den sie erhalten hatte, war ihr eher wie eine Vorladung denn als Einladung vorgekommen.
Collopy kam um den Schreibtisch herum und deutete auf einen bequemen Ledersessel, der zu der Sitzgruppe vor dem Kamin aus rosa Marmor gehörte. Margo setzte sich und Collopy ließ sich ihr gegenüber nieder.
»Was möchten Sie? Kaffee, Tee, Mineralwasser?«
»Nichts, danke, Dr. Collopy.«
Er lehnte sich zurück und schlug die Beine lässig übereinander. »Wir freuen uns sehr, Sie wieder im Museum zu haben, Margo«, sagte er in seinem New Yorker Upperclass-Akzent. »Ich war hoch erfreut über Ihre Zustimmung, die Stelle als Chefredakteurin von Museology zu übernehmen. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir Sie von GeneDyne abwerben konnten. Ihre wissenschaftlichen Forschungsergebnisse haben uns wirklich imponiert, und weil Sie ja schon als Ethnopharmakologin hier bei uns gearbeitet haben, waren Sie die ideale Kandidatin.«
»Vielen Dank, Dr. Collopy.«
»Und, wie gefällt Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz? Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?« Seine vornehme Stimme klang geradezu gütig.
»Alles ist gut, vielen Dank.«
»Das freut mich zu hören. Museology ist die älteste Zeitschrift auf ihrem Fachgebiet, sie ist seit 1892 ohne Unterbrechung erschienen und genießt nach wie vor höchstes Ansehen. Sie haben da eine große Verantwortung und Herausforderung angenommen, Margo.«
»Ich hoffe, diese Tradition fortführen zu können.«
»Das ist ganz in unserem Sinne.« Collopy strich sich nachdenklich über den kurz geschnittenen, eisgrauen Vollbart. »Zu den Dingen, auf die wir stolz sind, gehört die absolut unabhängige redaktionelle Stimme von Museology.«
»Ja.« Margo ahnte, worauf das Ganze hinauslief, und war innerlich gewappnet.
»Das Museum hat sich nie in die redaktionellen Standpunkte, die in Museology eingenommen wurden, eingemischt und wir werden das auch in Zukunft nicht tun. Wir halten die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitschrift für geradezu heilig.«
»Das freut mich zu hören.«
»Andererseits möchten wir nicht erleben, dass sich Museology zu einem … wie soll ich sagen? … zu einem Organ zurückentwickelt, in dem jeder schreiben darf, was er will.« Die Art, wie Collopy das Wort aussprach, schien auf ein gänzlich anderes Organ zu deuten. »Mit Unabhängigkeit geht Verantwortung einher. Schließlich trägt Museology den Namen des New York Museums of Natural History.«
Collopys Stimme blieb zwar freundlich, hatte jedoch eine gewisse Schärfe angenommen. Margo wartete. Sie würde sich weiterhin cool und professionell geben. Genau genommen hatte sie sich ihre Antwort schon zurechtgelegt – sie hatte sie sogar niedergeschrieben und auswendig gelernt, um sicherer auftreten zu können. Aber es war wichtig, erst Collopy zu Wort kommen zu lassen.
»Deswegen haben die bisherigen Chefredakteure von Museology sehr darauf geachtet, wie sie ihre redaktionelle Freiheit ausübten.« Er ließ den Satz in der Luft hängen.
»Ich nehme an, Sie spielen auf das Editorial an, das ich über das Rückführungsersuchen der Tano-Indianer zu veröffentlichen gedenke.«
»Genau. Das Schreiben des Stammes, in dem die Rückgabe der Masken aus der Großen Kiva gefordert wird, ist erst vergangene Woche bei uns eingegangen. Das Kuratorium hat es noch nicht erörtert. Das Museum hatte noch nicht einmal Zeit, seine Anwälte zu Rate zu ziehen. Ist es da nicht etwas voreilig, die eigene Meinung über etwas kundzutun, das noch nicht einmal ansatzweise bewertet worden ist? Zumal wenn man noch so neu auf dem Posten ist wie Sie?«
»Mir scheint, die Sachlage ist eindeutig«, sagte Margo seelenruhig.
Daraufhin lehnte sich Collopy mit einem herablassenden Lächeln in seinem Sessel zurück. »Die Sachlage ist ganz und gar nicht eindeutig, Margo. Die Masken befinden sich seit einhundertfünfunddreißig Jahren in der Sammlung des Museums. Und sie sind das Kernstück der Ausstellung Bildnisse des Heiligen, der größten in unserem Hause seit Aberglauben vor sechs Jahren.«
Wieder wurde es sehr still.
»Selbstverständlich werde ich Sie nicht bitten, Ihre Haltung als Chefredakteurin zu ändern«, fuhr Collopy fort. »Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass es möglicherweise einige Fakten gibt, die Ihnen unbekannt sind.« Er drückte einen kaum sichtbaren Knopf auf seinem Schreibtisch und sagte in ein ebenso kaum sichtbares Mikrofon: »Die Akte, Mrs Sturd.«
Kurz darauf erschien die Sekretärin mit einer alten Aktenmappe in der Hand. Collopy dankte ihr und reichte sie Margo.
Margo nahm die Mappe in die Hand. Sie war uralt und brüchig und verströmte einen geradezu beängstigenden Geruch nach Staub und Trockenfäule. Margo öffnete sie vorsichtig. Darin befanden sich mehrere Dokumente, die in der gestochenen Schrift verfasst waren, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts üblich war, ein Vertrag sowie einige Zeichnungen.
»Das ist die originale Neuerwerbungsakte der Masken aus der Großen Kiva, die Sie unbedingt den Tano-Indianern zurückgeben wollen. Kennen Sie die Unterlagen?«
»Nein, aber …«
»Vielleicht hätten Sie sich die ansehen sollen, ehe Sie Ihr Editorial formulierten. Das erste Schriftstück ist eine Kaufurkunde, wonach die Masken für zweihundert Dollar erworben wurden – nicht gerade eine geringe Summe im Jahre 1870. Das Museum hat die Masken nicht mit Plunder und bunten Glasperlen bezahlt. Das zweite Schriftstück ist der Vertrag. Das X ist die Unterschrift des Häuptlings der Great Kiva Society – des Mannes, der die Masken an Kendall Swope, den Ethnologen des Museums, verkaufte. Das dritte Schriftstück, dort, ist das Dankesschreiben des Museums an den Häuptling, es wurde dem Indianeragenten zugesandt, der es dem Häuptling vorgelesen hat. Außerdem wird in dem Schreiben dem Häuptling zugesagt, dass wir die Masken sorgfältig aufbewahren werden.«
Margo betrachte die alten Schriftstücke. Es wunderte sie immer wieder, mit welcher Sorgfalt das Museum alles – vor allem alte Dokumente – aufbewahrte.
»Der springende Punkt ist, Margo, dass das Museum die Masken in gutem Glauben erwarb. Wir haben einen exzellenten Preis dafür bezahlt. Sie befinden sich inzwischen seit fast anderthalb Jahrhunderten in unserem Besitz. Wir haben sie gehegt und gepflegt. Überdies gehören sie zu den bedeutendsten Stücken in unserer gesamten Sammlung über die amerikanischen Ureinwohner. Jede Woche betrachten Tausende von Menschen die Masken – erlangen Bildung durch sie, schlagen ihretwegen vielleicht sogar eine Laufbahn in Ethnologie oder Archäologie ein. Kein einziges Mal im Laufe von einhundertfünfunddreißig Jahren hat irgendein Angehöriger des Tano-Stammes sich beschwert oder das Museum beschuldigt, sie illegal erworben zu haben. Also, erscheint es da nicht ein ganz klein wenig unfair, dass die Tano die Masken plötzlich zurückfordern? Und zwar unmittelbar vor einer besonders publikumswirksam konzipierten Ausstellung, in der die Masken als Hauptattraktion fungieren?«
In dem großen Turmbüro, dessen hohe Fenster den Blick auf den Museum Drive freigaben und dessen dunkle holzvertäfelte Wände Zeichnungen von Audubon schmückten, wurde es still.
»Es erscheint tatsächlich ein wenig unfair«, sagte Margo gelassen.
Ein breites Lächeln huschte über Collopys Gesicht. »Ich habe doch gewusst, dass Sie das verstehen.«
»Aber es wird nichts an meiner Haltung als Chefredakteurin ändern.«
Die Atmosphäre kühlte sich merklich ab. »Wie bitte?«
Margo fand, dass es an der Zeit war, ihrerseits das Wort zu ergreifen. »Nichts in der Neuerwerbungsakte ändert etwas an den Tatsachen. Es ist ganz einfach. Zunächst einmal haben sich die Masken nicht im Besitz des Häuptlings der Great Kiva Society befunden. Sie waren nicht sein Eigentum, sondern gehörten dem gesamten Stamm. Das ist etwa so, als wollte ein Priester Kirchenreliquien verkaufen. Nach dem Gesetz kann man nicht etwas verkaufen, das einem nicht gehört. Die Kaufurkunde und der Vertrag in der Akte sind nicht rechtskräftig. Mehr noch, als wir die Masken kauften, hat Kendall Swope das gewusst, was aus seinem Buch Die Zeremonien der Tano auch eindeutig hervorgeht. Er war sich völlig im Klaren darüber, dass der Häuptling nicht das Recht hatte, die Masken zu verkaufen. Ihm war bewusst, dass sie ein geheiligter Teil der Zeremonie in der Großen Kiva waren und dass sie die Kiva nie hätten verlassen dürfen. Swope gibt sogar zu, dass der Häuptling ein Betrüger war. Das alles schreibt er in Die Zeremonien der Tano.«
»Margo …«
»Bitte lassen Sie mich ausreden, Dr. Collopy. Es steht hier ein noch wichtigerer Grundsatz auf dem Spiel. Die Masken sind den Tano-Indianern heilig. Jeder erkennt das an. Sie können weder ersetzt noch neu hergestellt werden. Die Tano glauben, dass jede Maske einen Geist birgt und lebendig ist. Es handelte sich hier nicht um x-beliebige religiöse Vorstellungen, sondern um aufrichtige und tief verwurzelte Glaubensüberzeugungen.«
»Aber nach hundertfünfunddreißig Jahren? Ich bitte Sie. Warum haben wir dann von diesen Leuten in der ganzen Zeit keinen Piep gehört?«
»Die Tano hatten keine Ahnung, wohin die Masken verschwunden waren – bis sie von der bevorstehenden Ausstellung lasen.«
»Ich kann einfach nicht glauben, dass sie den Verlust dieser Masken die ganze Zeit betrauert haben. Die Masken waren längst vergessen. Das Ganze ist doch sehr durchsichtig, Margo. Die Masken sind fünf, vielleicht zehn Millionen Dollar wert. Es geht hier um Geld, nicht um Religion.«
»Nein, das stimmt nicht. Ich habe mit ihnen gesprochen.«
»Sie haben mit den Leuten gesprochen?«
»Selbstverständlich. Ich habe sie angerufen und mit dem Gouverneur des Tano Pueblo gesprochen.«
Collopy ließ kurz die Maske der Unnachgiebigkeit fallen. »Margo, Ihr Vorgehen kann unabsehbare rechtliche Folgen nach sich ziehen.«
»Ich bin nur meiner Pflicht als Chefredakteurin von Museology, mich über den Sachverhalt zu informieren, nachgekommen. Die Tano erinnern sich, sie haben sich die ganze Zeit über erinnert – die Masken waren, wie Ihre eigene Kohlenstoffdatierung beweist, zum Zeitpunkt des Erwerbs fast siebenhundert Jahre alt. Glauben Sie mir, die Tano erinnern sich an ihren Verlust.«
»Die Tano werden die Masken nicht museumsgerecht aufbewahren – sie verfügen nicht über die notwendigen Einrichtungen, um die Masken dauerhaft zu erhalten.«
»Zunächst einmal hätten die Masken nie die Kiva verlassen dürfen. Sie sind keine ›Museumsstücke‹, sondern ein lebendiger Teil der Religion der Tano. Meinen Sie etwa, die Gebeine des heiligen Petrus unter dem Vatikan werden ›museumsgerecht aufbewahrt‹? Die Masken gehören in jene Kiva, ob die nun klimatisiert ist oder nicht.«
»Wenn wir die Masken zurückgeben, schüfe das einen schrecklichen Präzedenzfall. Wir würden mit Forderungen von Stämmen aus ganz Amerika förmlich überschwemmt.«
»Mag sein. Aber das Argument zieht nicht. Die Masken zurückzugeben ist die einzige moralisch und ethisch richtige Handlungsweise. Sie wissen das genau, und ich werde ein Editorial schreiben, in dem ich es ausspreche.«
Margo hielt inne und musste schlucken. Sie hatte ihre Vorsätze vergessen und immer lauter gesprochen.
»Und das ist mein letztes und unabhängiges Wort als Chefredakteurin«, fügte sie mit ruhigerer Stimme hinzu.
5
Vor Glen Singletons Büro saßen weder Sekretärinnen noch Empfangsdamen noch irgendwelche Polizisten mit niedrigem Dienstgrad. Der Raum war nicht größer als alle anderen der Dutzenden von Büros, die in den beengten und staubigen Räumlichkeiten des Polizeireviers untergebracht waren. Kein Schild an der Tür wies darauf hin, dass dahinter ein Vorgesetzter saß. Nur wer selbst Polizist war, konnte ahnen, dass es sich hier um das Büro vom Oberboss handelte.
Aber das ist eben der Stil des Captains, dachte D’Agosta, als er darauf zuging. Captain Singleton war ein ganz seltenes Exemplar in der Polizeihierarchie – ein Mann, der sich ehrenhaft nach oben gearbeitet und sich seinen guten Ruf nicht durch Arschkriecherei erworben hatte, sondern weil er schwierige Fälle mit Hilfe solider polizeilicher Ermittlungsarbeit gelöst hatte. Singleton verfolgte in seinem Leben ein einziges Ziel und das hieß: Verbrecher von der Straßen zu holen. Er war der wohl am härtesten arbeitende Cop, dem D’Agosta je begegnet war – bis auf Laura Hayward. D’Agosta fand, dass er für genügend unfähige Schreibtischhengste gearbeitet hatte, und empfand deshalb umso größere Hochachtung für Singletons Professionalität. Und er spürte, dass umgekehrt Singleton auch ihn achtete, und das bedeutete ihm sehr viel.
All dies zusammengenommen machte das, was er jetzt vorhatte, nur noch schwieriger.
Singletons Tür stand, wie üblich, weit offen. Zugangsbeschränkungen waren nicht seine Art. Jeder Cop, der mit ihm sprechen wollte, konnte das tun – jederzeit. D’Agosta klopfte an und streckte den Oberkörper durch die Türöffnung. Singleton war da, er stand hinter seinem Schreibtisch und telefonierte. Selbst im Büro setzte sich Singleton anscheinend nie hin. Er war Ende vierzig, groß und schlank und hatte die Figur eines Schwimmers – jeden Morgen um sechs zog er seine Bahnen. Er hatte ein schmales Gesicht mit einem Raubvogelprofil. Alle zwei Wochen ließ er sich die graumelierten Haare vom lachhaft teuren Frisör unten im Carlyle schneiden, so dass er immer so gepflegt aussah wie ein Präsidentschaftskandidat.
Singleton lächelte D’Agosta kurz zu und bedeutete ihm, doch hereinzukommen. D’Agosta trat ein. Singleton deutete auf einen Stuhl, aber D’Agosta schüttelte den Kopf: die rastlose Energie des Captains bewirkte, dass er sich im Stehen wohler fühlte.
Singleton unterhielt sich offenbar mit jemandem aus der PR-Abteilung der New Yorker Polizei. Seine Stimme klang höflich, aber D’Agosta ahnte, dass Singleton innerlich kochte: Ihn interessierte die polizeiliche Ermittlungsarbeit, nicht PR. Schon allein der Begriff war ihm ein Gräuel, und einmal hatte er D’Agosta seine Auffassung erläutert: »Entweder du schnappst den Täter oder nicht. Was gibt’s da also zu verkaufen?«
D’Agosta blickte sich um. Das Büro war so minimalistisch eingerichtet, dass es fast schon anonym wirkte. Keine Familienfotos; kein obligatorisches Bild des Captains, wie er mit dem Bürgermeister oder dem Commissioner Hände schüttelte. Zwar war Singleton einer der am höchsten dekorierten Cops im aktiven Dienst, dennoch gab es in seinem Büro keine Tapferkeitsauszeichnungen, hübsch gerahmte Gedenktafeln oder ehrenvolle Erwähnungen an den Wänden. Stattdessen lag auf der einen Seite des Schreibtischs ein Stapel Papiere und daneben auf einem Regal fünfzehn oder zwanzig braune Aktenhefter. Auf einem zweiten Regal sah D’Agosta Handbücher über gerichtsmedizinische Verfahren und die Untersuchung von Tatorten sowie ein halbes Dutzend zerlesener Bücher zu juristischen Fragen.
Aufseufzend legte Singleton den Hörer auf die Gabel. »Verdammt, ich habe das Gefühl, ich befasse mich mehr mit irgendwelchen Initiativen von Stadtteilgruppen als damit, die bösen Buben zu fassen. Wenn das nicht bald aufhört, würde ich am liebsten wieder Streife gehen.« Er wandte sich D’Agosta zu und lächelte ihn noch einmal kurz an. »Na, Vinnie, wie läuft’s denn so?«
»Ganz gut«, antwortete D’Agosta – und fühlte sich gar nicht wohl dabei. Singletons Freundlichkeit und Zugänglichkeit machten diesen kleinen Besuch umso schwieriger.
Der Captain hatte D’Agosta nicht angefordert: Er war seiner Abteilung durch das Büro des Commissioners zugewiesen worden. Das hätte D’Agosta von anderen hohen Tieren, die er kannte, einen misstrauischen, feindseligen Empfang garantiert. Jack Waxie etwa hätte sich bedroht gefühlt, er hätte D’Agosta auf Abstand gehalten und dafür gesorgt, dass er nur die eher unwichtigen Fälle bekam. Singleton war das genaue Gegenteil. Er hatte D’Agosta willkommen geheißen, ihn persönlich in die Details und Verfahrensweisen eingeweiht, denen man in seinem Büro folgte, hatte ihm sogar die Ermittlungen im Fall Baumelmann übertragen – und dabei war im Augenblick der Öffentlichkeit kein Fall wichtiger als dieser.
Der Baumelmann hatte zwar niemanden umgebracht, er hatte nicht einmal eine Schusswaffe benutzt. Aber er hatte etwas fast genauso Schlimmes getan: Er hatte das New York Police Department lächerlich gemacht. Ein Dieb, der Geldautomaten plünderte und anschließend vor laufenden Überwachungskameras sein Geschlechtsteil herausholte, war ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Bislang hatte der Baumelmann elf Geldautomaten einen Besuch abgestattet. Jeder neue Raub bedeutete weitere süffisante, anspielungsreiche Schlagzeilen. Und jedes Mal hatte man der New Yorker Polizei eins ausgewischt. Die Spur des Baumelmanns wird länger, hatte die Post nach dem letzten Geldraub vor drei Tagen hinausposaunt. Polizei zieht den Kürzeren.
»Was macht denn unsere Zeugin?«, fragte Singleton. »Kann man was anfangen mit ihr?« Er stand hinter seinem Schreibtisch und sah D’Agosta an. Wenn er einen mit seinen durchdringenden blauen Augen musterte, hatte man das Gefühl, als wäre man der Mittelpunkt der Welt, und zumindest für diesen kurzen Augenblick genoss man seine vollständige, ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber das kostete auch Nerven.
»Die Aussage der Zeugin stimmt mit den Aufnahmen der Videokamera überein.«
»Gut, gut. Verdammt, man möchte meinen, dass in unserem digitalen Zeitalter die Banken mit ihren Überwachungskameras bessere Bilder hinbekommen müssten. Der Typ kennt offenbar deren Aufnahmewinkel und Reichweite – glauben Sie, dass er früher vielleicht mal bei einem Sicherheitsdienst tätig war?«
»Wir untersuchen das.«
»Elf Einbrüche, und wir wissen nur, dass es sich um einen Weißen handelt.«
Der beschnitten ist, dachte D’Agosta freudlos. »Ich habe unsere Detectives gebeten, alle Filialleiter auf der Liste anzurufen. Die installieren jetzt zusätzliche versteckte Kameras.«
»Der Täter könnte für die Sicherheitsfirma arbeiten, die die Kameras liefert.«
»Das untersuchen wir auch.«
»Immer einen Schritt weiter als ich. So etwas hört man gern.« Singleton trat an den Stapel mit Unterlagen und kramte darin herum. »Der Bursche ist ziemlich bodenständig. Sämtliche Brüche haben sich in einem überschaubaren Gebiet ereignet. Der nächste Schritt besteht also darin, die in Frage kommenden Automaten zu überwachen, die er noch nicht ausgeraubt hat. Wir müssen die Liste der potenziellen Automaten verringern, sonst können wir nicht konzentriert vor Ort sein. Gott sei Dank ermitteln wir im Augenblick nicht in aktiven Mordfällen. Vinnie, ich überlass es Ihnen, sich mit der Einsatzgruppe zusammenzusetzen, auf Grundlage der früheren Einbrüche eine Liste der am meisten gefährdeten Automaten aufzustellen und die Leute für die Überwachungen einzuteilen. Wer weiß? Vielleicht haben wir ja Glück.«
Jetzt kommt’s, dachte D’Agosta. »Genau genommen wollte ich darüber gar nicht mit Ihnen sprechen.«
Singleton hielt inne und fixierte ihn abermals mit prüfendem Blick. Er ging so sehr in seiner Arbeit auf, dass ihm gar nicht in den Sinn gekommen war, dass D’Agosta ihn vielleicht wegen etwas ganz anderem aufgesucht hatte. »Worum geht’s?«
»Ich weiß wirklich nicht, wie ich es sagen soll, aber … Sir, ich möchte um eine Beurlaubung bitten.«
Singleton hob überrascht die Brauen. »Sie wollen sich freinehmen?«
»Ja, Sir.« D’Agosta wusste selbst, wie das klang. Aber ganz egal, wie oft er den Satz in seiner Vorstellung geprobt hatte – irgendwie hörte er sich immer falsch an.
Singleton blickte ihn weiter unverwandt an und sagte nichts; das musste er auch nicht. Eine Beurlaubung? Sie sind erst seit sechs Wochen bei uns, und da wollen Sie sich bereits freinehmen? »Gibt es da etwas, das ich wissen sollte, Vinnie?«, fragte Singleton leise.
»Es ist eine Familienangelegenheit«, antwortete D’Agosta nach kurzer Pause. Er hasste sich selbst, weil er unter Singletons Blick stotterte, und er hasste sich noch mehr dafür, dass er log. Aber was zum Teufel sollte er denn sagen? Tut mir Leid, Cap, aber ich nehme mir Urlaub, um einen Mann zu jagen, der offiziell tot und dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, und zwar wegen eines Verbrechens, das noch gar nicht begangen wurde? Aber er musste sich freinehmen, das war keine Frage, überhaupt keine Frage. Die Sache war Pendergast so wichtig gewesen, dass er Anweisungen hinterlassen hatte, was nach seinem Tod geschehen sollte. Das war mehr als genug. Aber das machte das Ganze weder leichter noch kam ihm sein Ansinnen deshalb vertretbarer vor.
Singleton fixierte ihn mit einer Miene, die ebenso sorgenvoll wie nachdenklich war. »Vinnie, Sie wissen genau, dass ich das nicht befürworten kann.«
Mit einem flauen Gefühl im Magen erkannte D’Agosta, dass das Ganze noch schwieriger werden würde, als er es vorausgesehen hatte. Ja, er würde es tun, selbst wenn er kündigen müsste – aber das wäre das Ende seiner Karriere. Ein Cop durfte einmal kündigen, aber nicht zweimal.
»Es geht um meine Mutter. Sie hat Krebs. Die Ärzte sagen, es geht mit ihr zu Ende.«
Singleton stand einen Augenblick reglos da und dachte nach. Dann wippte er leicht auf den Hacken. »Das tut mir sehr, sehr Leid.« Noch ein Schweigen. D’Agosta wünschte, jemand würde anklopfen, das Telefon würde klingeln oder ein Meteor würde ins Gebäude einschlagen – irgendetwas, das Singletons Aufmerksamkeit von ihm lenkte.