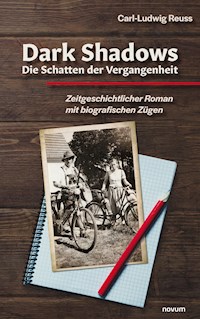
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Kriegsverbrecher gefasst, Veterinärrat Dr. Lutz Reuss verhaftet" Eine Überschrift in der regionalen Zeitung im Januar 1962 verändert alles. 17 Jahre nach Kriegsende wird Lutz Reuss von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. In der Untersuchungshaft in Ravensburg beginnt er, sein Leben zu überdenken. Der gedankliche Film lässt für Lutz schließlich auch Erlebnisse aus der Kriegszeit lebendig werden, die tiefe Narben auf seiner Seele hinterlassen haben. Geschehnisse, die er lieber vergessen hätte. Tiefes Schweigen beginnt zu bröckeln und Reuss stellt sich den Fragen, die ihm am meisten Angst machen: Warum war er 1934 freiwillig Mitglied der Allgemeinen SS geworden? Warum hatte er den Nationalsozialismus begeistert unterstützt? War er nur ein naiver Mitläufer gewesen, oder ist er ein Täter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Impressum 4
Vorwort 5
Dr. Lutz Reuss 6
Die Vorgeschichte 9
Frühlingsanfang, Dienstag, der 21. März 1978 9
Warum schreibe ich das alles? 11
Danksagung 17
Personen der Familie 18
Jeder Tag ist ein neues Leben 19
Die Verhaftung 19
Kindheit und Jugend in Dessau 25
Studium und Corps Ratisbonia 36
Das Stiftungsfest 39
Meine erste große Liebe 47
Trennungsgründe 53
Auf der Suche nach dem WARUM 56
Erfurt 58
Auf Wanderschaft 64
Gewitter 65
Eva-Marie 70
Jagd in Ratzeburg 78
Rückblick 80
Verlobt 87
Hochzeit in Dresden 91
Zurück in Pommern 95
Anna-Lena schreibt 102
Arbeit in der JVA Ravensburg 104
Leben in Pommern 106
Im Mai 1943 am Asowschen Meer 119
Im Lazarett 127
Zurück in Naugard 128
Ludwigslust, Pferdelazarett 136
Wiedersehen mit Katharina und Erwin 138
Der Befehl 143
Im Internierungslager, Garmisch Camp 8 147
Leben im Garmisch-Camp 8 155
Das Lager 159
Das geistige Lagerleben 164
Zu den Personen 165
Widerspruch von Wissenschaft und Moral 173
Garmisch, September 1945 178
Garmisch, Oktober 1945 183
Beim Kartenspiel 187
Jagd 190
Die Gesprächsrunde 193
Landwirt Sander widmet sich der Kartoffelzucht 194
Pastor Johannes Hoheisel wählt das Thema „Bienen“ 195
Tierarzt Volkmann und die Dackelzucht 197
Hermann Otto Hoyer über Kunst 199
Carlos von Wagner über die Schweinezucht 200
Hugo Spatz über Sperlinge 202
Wintersemester 204
Die Frage nach der Schuld 221
Auswandern nach Brasilien 224
Entnazifiziert und in Freiheit, Abschied aus dem Lager 227
Familienzusammenführung – Der Ost-West-Zug rollt 242
Ein neuer Anfang 258
Jagdfieber 260
Hausschlachtung 263
Auf dem Holzweg 265
Wechsel in den Staatsdienst 267
Ortswechsel 271
Bau der Mauer 278
Das Ende meiner Träume 279
Ravensburger Briefe 281
Reiz-Reaktions-Schema 286
Brief an meinen Sohn 319
Die Anklage 349
Freiheit 352
Warten auf eine Entscheidung 365
Nachwort zu Riedhausen 371
Literatur 372
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-093-8
ISBN e-book: 978-3-99131-094-5
Lektorat: Hannah Lackner
Umschlagfoto: Carl-Ludwig Reuss; Konstantin Kolosov, Photoeuphoria, Zoryen | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Carl-Ludwig Reuss
Autorenfoto: XXXXXXXXXXX
www.novumverlag.com
Vorwort
„Kriegsverbrecher Veterinärrat Dr. Lutz Reuss verhaftet“,diese Schlagzeile aus der lokalen Presse verfolgt mich, seit ich 15 Jahre alt bin. Diese Schlagzeile hat mein Leben beeinflusst. Eben noch der nette Junge von nebenan, bin ich plötzlich der Lümmel von Nazi und Kriegsverbrecher Dr. Lutz Reuss. Wenn ich jugendlichen Quatsch mache, der für andere normal wäre und jemanden damit verärgere, heißt es nun „Was soll man auch vom Sohn eines Kriegsverbrechers erwarten.“
Auch am Gymnasium wird mir vermittelt, dass ich da nicht hingehöre. Eine Realschule sei für mich völlig ausreichend. Was ich damals nicht begreife, ist die spontane Sippenhaft von allen, die schon immer dagegen waren oder jenen, die sich als Opfer des Nationalsozialismus fühlen. Besonders sensibel reagieren die Sozialdemokraten, die im Dritten Reich bekanntermaßen bekämpft wurden und nun die Oberhand haben.
Was ich hier schreibe, ist nicht nur die Geschichte meines Vaters. Es ist auch meine Geschichte. Sein Leben, sein Verhalten, seine Taten wirken direkt auf mein eigenes Leben.
Dr. Lutz Reuss
Der Tierarzt Dr. Lutz Reuss wird am 24.November 1908 in Dessau geboren. Er wächst in einer gutbürgerlichen Familie auf. Sein Großvater ist der Landesforstmeister von ganz Anhalt, mit Dienstsitz in Dessau. Sein Vater ist Forstgeometer in den anhaltinischen Forsten. Die Eltern und Großeltern wohnen im selben großen Haus – die Großeltern im ersten Stock, in der „Beletage“ und die Eltern im Parterre. Die Mutter von Lutz ist bestimmend und herrisch, der Sohn fühlt sich ständig gemaßregelt und in seiner Person nicht hinreichend anerkannt. Der Vater aber ist ein herzenswarmer Mensch, er kann sich jedoch nicht gegen die dominante Mutter durchsetzen. Lutz fühlt sich zerrissen zwischen seiner kindlichen Liebe zum Vater und der Liebe zur Mutter, die ihm die Nestwärme nicht bietet, nach der er sich sehnt. Dieser Mutter-Sohn-Vater-Konflikt zieht sich durch Lutz’ gesamtes Leben. Er beherrscht seine Psyche, sein Denken und sein Handeln.
Als Lutz in München mit dem Studium der Tiermedizin beginnt, wird er, wie auch viele seiner Vorfahren, Mitglied in einer studentischen Verbindung. Sehr früh begeistert er sich für den Nationalsozialismus und wird bereits 1934 Mitglied der „allgemeinen SS“. Als Soldat ist er später beim 125. Infanterie-Regiment der Wehrmacht an der Ostfront mit einer Veterinäreinheit unterwegs. Diese Einheit ist dafür verantwortlich, die Pferde zu pflegen, die die Flak in die vorderste Stellung bringen. Lutz Reuss wird durch einen Granatsplitter am Bein verwundet, in den letzten Kriegstagen kommt er noch für die Waffen-SS in Süddeutschland zum Einsatz. Das wird ihm zum Verhängnis. Er gibt den Befehl, einen Spion erschießen zu lassen und gerät kurz danach in amerikanische Gefangenschaft.
Ende April 1945 wird Lutz in Garmisch im Internierungslager festgesetzt. Hier trifft er mit vielen bekannten Persönlichkeiten der NS-Zeit zusammen. Von nun an aber sind sie nur noch Personen. Personen ohne Dienstgrad, die alle auf die gleiche Weise hungern und frieren. Dennoch entsteht im Lager ein reges geistiges Leben. Die Begegnungen und intellektuellen Gespräche beeinflussen sein Denken und verändern seine bisherige Betrachtungsweise. Er beginnt, die politische und seine persönliche Vergangenheit zu reflektieren. Er fragt sich, welche Schuld er trägt. Er denkt schließlich, dass er nur einer Mehrheit gefolgt sei. Er ist sich einer persönlichen Schuld nicht bewusst. Er wollte doch nur Karriere machen, sagt er sich, in einem System, an das er anfangs geglaubt und an das er viele Hoffnungen geknüpft hatte. Diese Auseinandersetzung mit sich selbst lässt ihn schlussendlich den Versuch wagen, sein spezielles Verhältnis zu Mutter und Vater zu ergründen.
Im Internierungslager 1945/1946 ist Lutz täglich im engen Kontakt mit dem später sehr erfolgreichen Schriftsteller Hans Hellmut Kirst. Der spätere Politiker Franz Josef Strauß und Hans Hellmut Kirst waren beide an der Flak-Artillerie-Schule IV als nationalsozialistische Führungsoffiziere tätig. In dieser Zeit entstand zwischen den beiden ganz offensichtlich ein Konflikt.
Franz Josef Strauß verrät und verleumdet Hans Hellmut Kirst bei den Amerikanern und verschafft sich selbst dadurch einen sogenannten „Persilschein“. Als Landrat und Vorsitzender der Entnazifizierungskommission erwirkt Strauß nach Kirsts Entlassung aus dem Lager 1946 ein zweijähriges Schreibverbot für den Schriftsteller. Die Frage nach dem Warum bleibt offen. Weiß Kirst Geheimes über Strauß oder ist es eine Anweisung der Amerikaner, die fürchten, er könne die Missstände im Internierungslager an die Presse bringen? Über den glorreichen Sieger schlecht zu sprechen oder zu schreiben, ist damals nicht erwünscht. Der Heiligenschein der Sieger soll unbeschädigt bleiben.
Im Gegensatz zum Opportunisten Strauß, stellt sich Kirst seiner Vergangenheit und arbeitet sie in vielen Romanen auf. Kirst ist für meinen Vater eine geistige Inspiration und wichtiger Gesprächspartner. Beide hinterfragen ihre Vergangenheit und ihre Verantwortung. Wie können sie mit dieser Schuld umgehen? Gibt es Sühne und Vergebung für das, was in der NS-Zeit geschah und an dem sie sich beteiligt haben?
Im Januar 1962, 17 Jahre nach Kriegsende, wird Lutz plötzlich als Kriegsverbrecher verhaftet. In Ravensburg sitzt er bis Ende Juli 1962 in Untersuchungshaft. Mit 54 Jahren steht er also erneut vor einem Scherbenhaufen. In dieser Zeit schreibt er vieles aus seinem Leben auf. Durch die einfühlsamen Briefe seiner Frau beginnt er, sich mit dem Neuen Testament und ganz besonders mit den Schriften von Dietrich Bonhoeffer zu beschäftigen. Er findet zu seinem Glauben an Gott zurück. Sein Leitsatz wird ein Vers von Bonhoeffer:
„In Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit.
In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart.“
Die Vorgeschichte
Frühlingsanfang, Dienstag, der 21. März 1978
Es ist früh um 6 Uhr, das Telefon klingelt. Der schrille Ton reißt mich aus den Träumen, die im Halbschlaf mitunter sehr spannend sein können. Ich bin kein geborener Frühaufsteher und als Student sowieso nicht. Noch etwas benommen höre ich die Stimme meines Vaters: „Du musst sofort kommen, mein Leben geht zu Ende und ich will dir noch einige Unterlagen geben.“ Koffer gepackt, Auto betankt und los geht’s – mit unguten Gefühlen und Gedanken im Kopf. Vor einem halben Jahr hatte er einmal so merkwürdige Andeutungen gemacht, dass er nicht mehr lange leben würde. Das hielt ich damals für eine Spinnerei, eine depressive Stimmung.
Gegen 13 Uhr bin ich dort. Nach kurzer Begrüßung meiner Mutter gehe ich zu ihm. In seinem etwas düsteren Herrenzimmer sitzt er am Schreibtisch, umringt von all seinen Jagdtrophäen und raucht Pfeife. Das ganze Zimmer ist erfüllt von würzigem Tabakduft. Vor ihm liegt ein Stapel Akten. Endzeitstimmung liegt schwer im Raum. Aufrecht sitzend, mit klarer Stimme, die keine Frage zulässt, erklärt er mir seinen Nachlass. Er schenkt mir seine goldenen Manschettenknöpfe mit den Grandeln des stärksten Hirsches, den er in seinem Leben erlegt hat. Den goldenen Ring mit einem blauen Saphir nimmt er von seinem Ringfinger. Dieser Ring war ein Heiligtum für ihn, er trug ihn immer voller Stolz und nur zu besonderen Gelegenheiten. Nach dem Tod seiner Großmutter Anna hatte sein Großvater Carl erneut geheiratet. Seine zweite Frau stammte aus einer adeligen Familie aus dem Baltikum. Sie hatte meinem Vater dieses Familienerbstück ihres Vaters vermacht.
Als große Überraschung übergibt er mir noch ein kleines Schmuckkästchen. Darin befinden sich ebenfalls goldene Manschettenknöpfe mit den Grandeln meines ersten Hirsches, seinem Abschieds-Hirsch, wie ich jetzt verstehe. Vor einem halben Jahr hatte er mich zur Hirschjagd in den Schwarzwald eingeladen, wo sein Cousin Forstamtsleiter war. Er sagte damals: „Bevor mein Leben zu Ende geht, will ich dir den Abschuss eines Hirsches schenken.“ Nun erkenne ich die Wahrheit seiner Ankündigung. Mein Vater hatte im vorherigen Jahr mehrere kleine Gehirnschläge gehabt und es war ihm klar gewesen, dass diese sich steigern würden.
Nach circa einer Stunde steht er auf und sagt mit leiser Stimme: „So, mein lieber Sohn, das ist genug, mehr kann ich dir nicht sagen, bring mich ins Krankenhaus. Deine Mutter soll vorerst zuhause bleiben. Ich will, dass Du mich alleine begleitest.“ Drei Tage später, am Donnerstag, dem 23. März 1978, stirbt mein Vater.
Warum schreibe ich das alles?
Als im Februar 2020 die Corona-Pandemie ausbricht, weltweit die Wirtschaft zusammenbricht, Ausgangsbeschränkungen unsere Beweglichkeit einschränken und das ganze soziale Leben auf den Nullpunkt gefahren wird, kehrt auch Ruhe und Besinnlichkeit ein. Keine auswärtigen Termine, keine sozialen Verpflichtungen, nur zu Hause bleiben und sich mit sich selbst beschäftigen. Das kann Fluch oder Segen sein. Meine Frau und ich beschließen, dass diese Zeit ein Segen für uns ist. Es ist eine Zeit der inneren Einkehr und der intensiven Gemeinsamkeit.
Ich mache etwas, das mir schon seit Langem im Kopf herumgeistert. Ich sortiere die Unterlagen meines Vaters. Er hatte viele davon. Er war anscheinend nicht nur Jäger, sondern auch intensiver Sammler gewesen. Ich finde Tagebücher seiner Jagderlebnisse, Aufzeichnungen aus dem Internierungslager, Aufzeichnungen aus dem Gefängnis in Ravensburg, Unmengen an Briefen, umfangreiche Notizen, ein Buch von Karl Vogel, einem Lagerkommandant in Garmisch sowie ein Buch von Hans Hellmut Kirst, in dem er das Leben im Internierungslager beschreibt.
Die Zeitungen sind im Moment voll mit Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Man berichtet über das großartige Verhalten der alliierten Truppen und über unsere Dankbarkeit für die Befreiung aus der Nazi-Diktatur. Die Amerikaner sind gekommen, um uns Demokratie und Menschlichkeit zu bringen. Die Amerikaner haben uns beim Aufbau einer neuen Ordnung geholfen. Die Kehrseite darf aber dennoch nicht verschwiegen werden, einige Soldaten haben die Amerikaner im Internierungslager in Garmisch-Partenkirchen auch ganz anders erlebt.
Die volle öffentliche Aufmerksamkeit gilt und galt schon immer den Opfern des Nationalsozialismus. Sie stehen im Zentrum der Betrachtung. Das ist richtig, das ist wichtig, das Leid und das Unrecht dürfen nicht vergessen werden.
Auch für mich, den Autor, ist es wichtig, herauszufinden: Wie kommen die Täter zurecht mit dem, was sie getan haben? Inwieweit können die Täter ihre Taten ausblenden oder verleugnen? Wie gehen sie mit ihrer Schuld um? Gelingt es ihnen, sich mit sich selbst zu versöhnen? Die hauptverantwortlichen Täter wurden in Nürnberg verurteilt. Was aber ist mit den „Nebentätern“? Denen, die sich darauf berufen, nach geltendem Recht gehandelt zu haben? Oder wie steht es um die Soldaten, die im Befehlsnotstand handelten, obwohl sie das Unrecht erkannten? Sind diese Soldaten Kriegsverbrecher?
War mein Vater ein Täter, ein Verbrecher? Wenn ja, inwieweit fühlte er sich schuldig und bereute seine Taten? Inwieweit werde ich, als sein Sohn, mit der Schuld meines Vaters fertig? Wie wirken sich diese Schmach und die gesellschaftliche Sippenhaftung auf mein Leben aus?
Auch im Jahr 2020 gibt es noch immer viele Vorurteile in der Gesellschaft. Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Akteure und Akteurinnen, Schicksale und Hintergründe findet in der Öffentlichkeit kaum statt. Alles wird undifferenziert in einen braunen Topf geworfen und mit einem Deckel verschlossen. Eine ganze Generation wird kollektiv verurteilt. Dabei wäre es doch gerade heute enorm wichtig, sich – ohne das Furchtbare leugnen zu wollen – differenziert mit Motiven und Hintergründen der Nebentäter zu befassen. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt.
Ich habe unter dieser kollektiven Verurteilung sehr gelitten. Sie hat mein eigenes Leben nachhaltig beeinflusst. Kann und darf es eine Vergebung für unsere Väter geben? Reicht es aus, dass der Vater seine Taten bereut? Ist ihm bewusst geworden, dass seine Taten auch auf seine Kinder und Enkel Auswirkungen haben können?
Ich sage jetzt in Gedanken zu meinem Vater: „Ich verstecke dich nicht mehr. Was auch immer du getan hast und was auch immer dein Grund dafür waren, es bleibt deine Sache. Du musst selbst dafür einstehen. Ich will frei sein von deiner Schuld.“ Diese neu gewonnene Haltung ermuntert mich, sein Leben zu beschreiben.
Heute leben wir in einem Rechtsstaat, in dem vor der Verurteilung eines Menschen immer auch nach Gründen, Motiven und Vorgeschichte gefragt wird. Rückblickend frage ich mich: Welche Rolle spielte die familiäre Prägung und der damals herrschende Zeitgeist beim Handeln meines Vaters? Wie wird ein junger Mensch damit fertig, wenn er als Soldat sein Leben riskiert, im Glauben, Volk und Vaterland zu verteidigen, und alle Ideale plötzlich nichts mehr wert sind und er sich für politisch und menschlich verwerfliche Ziele hatte missbrauchen lassen?
Wie kann ich mich selbst lieben, wenn ein Teil meines Wesens dem meines Vaters gleicht? Die Neigung zur Herrschsucht von meiner Großmutter und meinem Vaters finde ich auch in mir. Die Lust, schnell Entscheidungen zu treffen, ohne sie vorher zu kommunizieren, kann eine Stärke aber auch eine Gefahr sein. Ich wollte nie wie mein Vater werden. Zur Beruhigung versicherte meine Mutter mir, ich würde im Wesen ihrem Vater gleichen. Mein Großvater mütterlicherseits ist mir ein Vorbild. Er gibt mir Orientierung im Denken und Handeln.
Immer wieder frage ich mich, wie sich gebildete Menschen von einem psychopathischen Menschen verführen lassen konnten und ihm bedingungslos gefolgt waren? Einem Menschen, der mit einem Programm der Arbeiterklasse gestartet hatte, der den deutschen Nationalismus gepredigt und unbedingten Gehorsam gefordert hatte, sich für die „Arische Rasse“ begeisterte, obwohl er selbst nicht Deutscher war und auch in keiner Weise „arisch“ ausgesehen hatte?
Sind die Antworten vielleicht ansatzweise in den heutigen USA, Brasilien oder gar in den rechtsgerichteten politischen und gesellschaftlichen Strömungen europäischer Demokratien einschließlich Deutschland zu suchen? Müssen wir versuchen, die aktuellen Entwicklungen zu verstehen, um die Motive von Nebentätern und Mitläufern der Nazizeit rückwirkend zu begreifen? Oder eher umgekehrt?
In meinem Zuhause wurde nie über die Kriegszeit gesprochen. Auch persönliche Probleme wurden vor den Kindern nie erörtert. Das machte man nicht, man hat einfach nur funktioniert. Es herrschte Schweigen über die Vergangenheit. Aus Angst, vor Scham? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber: Das Verschweigen der Vergangenheit ist genauso eine Lüge, wie das Schönreden ebendieser.
Der Vater meiner Mutter war ab Oktober 1939 Oberstabsveterinär der Wehrmacht und in Warschau tätig gewesen. Das ist ein gehobener Dienstgrad und ich denke, dass man diesen nur erlangt, wenn man systemtreu war. Also dem Nationalsozialismus nahestand. Bereits 1935 hielt er in Pommern einen Familientag ab. Es gab dazu einen ausführlichen Pressebericht mit der Aussage: „Aus dem Wissen um das eigene Werden der Sippe wächst die Kraft der rassischen Verwurzelung und der Tradition. Daraus lässt sich erkennen, wie das Schicksal der Sippe mit dem Schicksal des Volkes verbunden ist.“ Die Wurzeln dieser Bauernfamilie gehen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Presseartikel und eine Einladung zum Familientreffen, die mit „Heil Hitler“ unterschrieben war, fand ich erst später im Nachlass. Über die Vergangenheit meines Großvaters wurde nicht gesprochen, alle Fragen an meine Mutter oder meinen Vater blieben ohne Antwort.
Warum konnte mein Vater keine Gefühle zeigen? Sein Abschied von mir und seinem Leben war geschäftsmäßig organisiert. Warum hatte er meine Schwestern nicht informiert? Warum bekam ich kein anerkennendes herzliches Wort zum Abschied zu hören? Wo hatte diese Kriegsgeneration ihre Gefühle verloren? Aus den Unterlagen geht hervor, dass mein Vater vor dem Krieg scheinbar ein ganz anderer Mensch war.
Warum erzählen meine Schwestern ihren Kindern, der Großvater sei ein Kriegsverbrecher gewesen? War er das wirklich? Wenn ja, warum wurde auch nach der Inhaftierung und Rückkehr aus Ravensburg nicht offen über die Anklage und die Aufhebung von dieser Anklage gesprochen? Ein Gerichtsverfahren wurde offensichtlich nie eröffnet. Daher gab es weder eine Verurteilung noch einen Freispruch. Nach dem damals geltenden Recht war sein Handeln legitimiert, wenn auch moralisch und ethisch inakzeptabel. Mit seiner moralischen Schuld musste er selbst fertig werden. Wie ist es aber mit uns, den Kindern? Wir bekommen einen Teil seiner Schuld aufgebürdet, weil wir kollektiv mit ihm verurteilt werden. Hat er das je begriffen? Eine Entschuldigung meines Vaters habe ich nie vernommen.
Warum schweigen die Eltern? Das Schweigen führt zu Vermutungen, die uns Kinder in der Ungewissheit zurücklässt, da könnte etwas ganz Schlimmes gewesen sein. Wir drei Kinder hatten denselben Vater gehabt, aber nicht den gleichen erlebt. Jeder hat seine speziellen Erlebnisse in der Familie anders verarbeitet. Wenn ich mit meinem Vater beim Jagen auf der Jagdhütte war, kam er manchmal aus sich heraus und erzählte mir fragmentarisch einige Erlebnisse seiner Vergangenheit. Er berichtete aus der Jugend, aus der Studentenzeit, von seinen wilden Liebesabenteuern und natürlich von den vielen Jagderlebnissen. Aber niemals sprach er über die Kriegszeit. Krieg war tabu, jede Frage danach war verboten, ohne, dass das Verbot jemals laut ausgesprochen wurde. Die Mauer des Schweigens war laut genug.
Durch die gemeinsame Zeit bei der Jagd habe ich ein tieferes Verständnis für meinen Vater entwickelt als meine Schwestern, die ihn nur als autoritär und jähzornig erlebt hatten. Als er, wie sich später zeigen wird, gewandelt und geläutert aus Ravensburg zurückkam, waren meine Schwestern bereits außer Haus und wohnten an ihren jeweiligen Studienorten. Sie kamen nur noch zu Kurzbesuchen nach Hause.
75 Jahre nach Kriegsende und 42 Jahre nach seinem Tod ist es nun für mich an der Zeit, dass ich über das Leben meines Vaters schreibe. Ich orientiere mich beim Schreiben stark an seinen gesammelten Unterlagen, die ich zum ersten Mal sichte. Zugegeben, ich hatte zunächst ein wenig Angst, etwas zu entdecken, was ich lieber nicht entdecken möchte.
Durch diese Arbeit veränderte sich mein bisheriges getrübtes Bild von meinem Vater und besonders auch von meiner Mutter. Ihre seelische Stärke und die enorme Liebe zu meinem Vater habe ich früher nicht bewusst wahrgenommen. Eine Liebe, die so stark war, dass sie es schaffte, alle Schicksalsschläge zu ertragen, nicht zu zerbrechen, sondern sich in ihrer Liebe noch zu festigen. Beide entdecken sich in ihrer Verbindung neu. Sie erkannten, dass sie zu lange geschwiegen und zu wenig miteinander gesprochen hatten. Erst in den Briefen aus dem Gefängnis finden sie wieder zueinander. Mein Vater hat sich in der Haft ganz offensichtlich zum Positiven entwickelt.
Was mein Vater nicht aufgeschrieben hat, versuche ich, in seinem Sinn zu schreiben. Ich als sein Sohn habe das Gefühl, manches nachvollziehen zu können, was er empfunden und was ihn bewegt hat. Doch in einer dokumentarischen Wahrheit mit einem Anteil von etwa zwei Dritteln überwiegt eindeutig die Dichtung. Vielleicht aber kommt die Dichtung der Wahrheit sehr nahe. Es hätte ja schließlich so sein können.
Danksagung
Ich danke meiner Frau Elisabeth, die in vielen Gesprächen und mit kritischen Fragen wertvolle Anregungen gab.
Personen der Familie
Autor: Carl-Ludwig Reuss
Ich-Erzähler: Dr. Lutz Reuss
Ehefrau: Anna-Lena
Töchter: Anna und Carina
Sohn: Carl
Jeder Tag ist ein neues Leben
Späte Einsicht, späte Reue, späte Versöhnung
Die Verhaftung
Es ist Winter. Samstag der 20. Januar 1962, ich sitze in Ravensburg im Gefängnis. Der Vollmond scheint durch die Gitterstäbe und wirft lange Schatten auf den Steinboden, als wollten sie mir nochmals verdeutlichen: „Du bist eingesperrt, hinter schwedischen Gardinen, ohne Chance, zu entkommen.“
Ich bin zutiefst deprimiert, mein Leben rauscht an mir vorbei. In Fragmenten, ohne erkennbaren direkten Zusammenhang. Ich versuche, meine Gedanken zu sortieren. Warum bin ich hier? Warum bin ich so, wie ich bin? Was ist in meinem Leben falsch gelaufen?
Bei Vollmond konnte ich noch nie richtig schlafen. Ich denke, dass ein Mond, der Weltmeere bewegen kann, auch in mir etwas auslöst. So waren die Tage vor und nach Vollmond für mich seit jeher sehr inspirierend für geistige Arbeiten. Auch jetzt sitze ich in meiner Gefängniszelle am Tisch mit einer kleinen 25-Watt-Lampe. Der dunkelgelbe Schirm, der kaum Licht durchlässt, bescheint nur eine eng begrenzte Schreibfläche. Aber immerhin, ich kann schreiben.
Ich schreibe alles auf, was mir in den Sinn kommt. Ich schreibe und schreibe mein ganzes Leben auf, so, als könnte ich mich damit reinwaschen von all der Schuld, die ich auf mich geladen habe. Ich suche nach Gründen für mein Handeln. Warum ließ ich mich verführen, um einem mörderischen System zu dienen? Warum wollte ich das nicht früher erkennen? Vielleicht hilft mir das Schreiben, mich in mein Inneres zu vertiefen und mein Tun ebenso wie mein Nicht-Tun zu reflektieren.
Donnerstag, der 4. Januar 1962.
Ich wache früh auf. Es ist kurz nach 5 Uhr morgens und noch sehr dunkel. Nur das Mondlicht erhellt die Landschaft ein wenig. Ich freue mich auf den Spaziergang mit meinem Hund. Ich will die Morgenstimmung genießen, die ich so sehr liebe. Ein verheißungsvoller Vormittag, der einen unerwarteten Verlauf nehmen sollte.
Obwohl es Winterzeit ist, liegt kein Schnee und die Temperaturen schwanken um plus-minus Null. Wir wohnen am Dorfrand, am Ende eines Weges, kurz vor dem Acker. Danach gibt es nur noch landwirtschaftliche Fläche bis zum nächsten Dorf in circa 4 Kilometer Entfernung.
Meine vierjährige Deutsch Langhaar Hündin hat in meinem Arbeitszimmer ihren Korb und Schlafplatz. Sie registriert die Bewegung in meinem Schlafzimmer im ersten Stock und im Bad sehr genau. Sie wird unruhig und fiept leise, als Signal, dass sie mit mir raus will. Die Kinder haben Ferien und dürfen sich ausschlafen. Ich schleiche leise hinunter und bemühe mich, die Hündin ruhig zu halten. Es ist nicht einfach, ihre Freude zu zügeln, denn sie weiß genau, was kommen wird. Mantel überwerfen, Leine mitnehmen, Hundepfeife und Hut. Nun geht es los. Die Hündin ist von mir erzogen worden und sehr diszipliniert. Sie läuft stets frei bei Fuß. Wenn ich pfeife, kommt sie sofort – fast immer jedenfalls. Ist die Fährte richtig heiß, kommt sie nicht. Benutze ich die andere Seite der Hundepfeife, ertönt ein lautes Trillern. Dann muss sie unverzüglich stoppen und sich hinlegen. Dazu rufe ich das Kommando „Down!“, auf Englisch. Darf sie wieder laufen, rufe ich „Aller!“, auf Französisch. Warum ich gerade diese Befehle benutze, kann ich gar nicht sagen. Vermutlich, weil ihr Klang besondere Wirkung zeigt oder, weil bereits Vater und Großvater diese Kommandos verwendet haben.
Kurz vor acht bin ich zurück und bereite das Frühstück vor. In den Ferien frühstücken wir nicht in der Küche, sondern alle zusammen im Esszimmer, mit schön gedecktem Tisch, Wurst, Käse, Ei, Kaffee und Tee. Anna-Lena, meine Frau, trinkt mit Vorliebe Mate-Tee. Der schmeckt für mich wie ein Heuhaufen ganz unten und ist nicht genießbar. Anna-Lena isst zudem bevorzugt Roggenbrot, etwas abgelagert, weil das gesund sein soll. Das ist nicht genau das, was ich unter einem genussvollen schönen Frühstück verstehe.
Heute aber ist meine Frau zu Besuch bei einer Schulfreundin, die nach der Flucht in Malente hängengeblieben ist. So tische ich also alles auf, was ich und die Kinder gerne essen. Weißbrot, Graubrot, frische Brötchen, die ich auf dem Rückweg beim Bäcker besorgt habe, Marmelade und Konfitüre, Gouda, durchwachsenen geräucherten Schinken und mehr.
Um halb neun erscheint Anna mit einem fröhlichen „Guten Morgen, Papa“, es folgt, etwas verträumt, Carina und zum Schluss, ungewaschen und mangelhaft bekleidet, mein Sohn Carl. Wir genießen unsere Gemeinsamkeit und ein entspanntes Ferienfrühstück.
Die Wettervorhersage ist vielversprechend und wir überlegen, wie wir die nächsten mutterlosen Tage gemeinsam gestalten könnten.
Nach dem Frühstück räumen die Kinder alles in die Küche und machen den Abwasch. Inzwischen ist auch meine Sekretärin eingetroffen und es kommt Leben ins Haus. Das Veterinärbüro hatte ich bei mir im Haus einrichten können, da die Kreisverwaltung räumlich beengt ist.
Es ist Viertel vor zwölf, als es an der Tür klingelt. Ich denke, dass es jemand für das Veterinärbüro sein muss. Die Sekretärin öffnet die Tür und ruft: „Herr Doktor, da sind zwei Herren, die Sie sprechen wollen.“ Ich gehe zur Tür und sehe zwei Männer mit Schlapphut und langen Kleppermänteln, die nach dem Krieg als Regenmantel sehr modern geworden waren.
Ich denke spontan: GESTAPO. Sie sahen aus wie zu Nazi-Zeiten. Ein gehöriger Schreck durchfährt mich und Bilder der Vergangenheit schießen unkontrolliert durch meinen Kopf. Ich schaue sie entgeistert an und sage nichts. Mit rauer Stimme sagt eine der Gestalten: „Kriminalpolizei, Sie sind verhaftet.“
Es ist der 4. Januar und ich denke plötzlich, dass zwei der Heiligen Drei Könige sich einen Scherz erlauben. Bei uns im Dorf ist es in dieser Zeit üblich, in der Nachbarschaft Geld zu sammeln und an die katholische Kirche zu spenden. Eigentlich ist die Gegend rein evangelisch, aber durch die Flucht hat sich eine katholische Gemeinde gebildet. Nichts zu geben, wäre unklug, da im Dorf alle über alle reden und den Nimbus, dass der Doktor geizig sei, möchte ich gewiss nicht verbreiten.
Aber nein. Sie sind echt. Sie zeigen ihre Ausweise und ich muss sie in die Wohnung lassen. Ich frage nach dem Grund für die Verhaftung. „Das werden Sie noch früh genug in Osnabrück erfahren. Wir haben nur den Auftrag, Sie zu verhaften. Packen Sie einen kleinen Koffer und kommen Sie mit!“, sagt eine dieser äußerst unsympathischen Erscheinungen.
Der zweite ebenso unhöfliche Flegel begleitet mich bis ins Schlafzimmer. Das Bett ist noch ungemacht und diverse Dinge liegen locker verteilt herum. Das ist mir jetzt aber egal. Sollen diese Typen denken, was sie wollen.
Der andere Kommissar steht unten neben meinen Kindern und der Sekretärin. Diese sind fassungslos und wissen nicht, was geschieht. Sie stehen bewegungslos da und schauen wie paralysiert, was für ein Film da gerade abläuft. Wer weiß, wann ich wiederkomme oder Anna-Lena zurück sein wird, denke ich. Irgendwer muss sich doch um die Kinder kümmern. Ich bitte um Erlaubnis, ein Telefonat führen zu dürfen. Das wird schroff abgelehnt. Darauf sage ich der Sekretärin: „Rufen Sie bitte meine Frau an, wenn ich fort bin. Und, ach ja, machen Sie für die Kinder einen Scheck über 50 Mark fertig.“ Der Typ neben mir sagt laut und geringschätzig: „Da können Sie gleich noch eine Null dranhängen, so schnell kommt der nicht wieder.“ Ich hätte ihm eines in die Visage hauen mögen. Aber mein Respekt vor der Staatsgewalt hindert mich daran. Ein Abschied wird nicht erlaubt. Mit Handschellen, wie bei einem Schwerverbrecher, werde ich abgeführt. Vor dem Haus steht ein hässlicher grauer VW Käfer. Ich sehe meine Kinder oben im Badezimmer, das ein großes Fenster zum Hof hat, mit verweinten Augen und zaghaft winkend. Ein letzter Blick und ich werde von einem der Kerle wie ein Wurstpaket auf die hintere Bank gepresst.
Das sind Gestapo-Methoden. Bei diesem Gedanken läuft es mir wieder eiskalt den Rücken herunter. Mein Herz rast, ich bekomme einen Schweißausbruch und zittrige Hände. Die Erinnerung an die letzten Kriegstage ist wieder da. Ich glaubte, mit meiner Familie in Ludwigslust, im Pferdelazarett, in Sicherheit zu sein. Dann kam der unerwartete Marschbefehl, einen Veterinärtrupp in Süddeutschland zu übernehmen. Jeder wusste, dass das Kriegsende nahe war. Meine Angst vor einem erneuten Einsatz war riesig. Sich dem Befehl zu widersetzen wäre aber tödlich gewesen. Die Gesetze waren nach dem Attentat auf Hitler verschärft worden. Jede „wehrkraftzersetzende“ Äußerung oder „Feigheit vor dem Feind“ wurde sofort mit dem Tod durch Erschießen bestraft. Ich sehe meine Verhaftung durch die Amerikaner vor mir, die anschließende Gefangenschaft im Internierungslager mit allen Schrecken kommt wieder hoch. Nun bin ich hier, eingeklemmt in dieser Büchse, und werde zum Tribunal gefahren. Warum? Was wollen die von mir?
In Osnabrück erklärt man mir, ich hätte in den letzten Tagen des Krieges in der Gegend von Ravensburg ein Verbrechen begangen. Ich hätte einen unschuldigen jungen Mann erschießen lassen. Ja, ich hatte den Befehl dazu gegeben. Es war aber nicht irgendein junger Mann, sondern für uns ganz offensichtlich ein Spion. Er hatte Lageskizzen in der Hand, die für die vordringenden alliierten Truppen interessant gewesen wären. Er war für uns eine Gefahr. Die Gerichtsbarkeit war bereits auf der Flucht in Richtung Kempten, und das Feldgericht hatte mich aufgefordert, selbständig zu entscheiden.
Am Montag, dem 8. Januar geht es mit der „grünen Minna“, einem Gefangenentransporter, in Richtung Süden. Es folgen Zwischenaufenthalte in Kassel, Fulda und Würzburg. Gefangene werden entladen und neue zugeladen.
Nach einer Zwischenübernachtung in Würzburg geht es am 09. Januar weiter. Aus den Gitterfenstern des Transporters ist außer Himmel fast nichts zu sehen, selbst im Stehen bleibt der Blick in die Landschaft begrenzt. Ich studiere innerlich die Kriminellen, mit denen ich unterwegs bin. Wir sind zwischen 6 und 8 Personen und die Unterhaltungen verlaufen recht lebhaft. Über die Gründe, warum sie im Transporter sitzen, will keiner reden. Alle sind sich einig, dass sie gute Kumpel und die anderen Kameraden schuld an ihren Miseren waren und sie im entscheidenden Moment hängen gelassen hatten. Ein Mitreisender ist Wilddieb. Das aber ist nicht der Grund seiner Verhaftung. Der Bursche war als landwirtschaftlicher Arbeiter und Melker tätig. Er hatte einen Raubüberfall begangen und seinen Herrn mit der Axt erschlagen. Warum er das getan hatte, sagt er nicht. Auf den ersten Blick wirkt er eigentlich wie ein bodenständiger sympathischer Mensch. Ungeachtet seiner Vergangenheit können wir uns stundenlang über Jagderfolge und Missgeschicke unterhalten. So vergeht die Fahrzeit unbemerkt schnell.
Am späten Nachmittag ab 16 Uhr ist es bereits dunkel. Wir kommen gegen 18 Uhr in Ravensburg an. Es ist Januar, ein grauer Wintertag mit grauem Himmel, einem grauen Gefängnis und einer grauenhaften Zelle. Alles ist nur zum Gruseln, hoffnungslos und deprimierend.
Wie konnte es dazu kommen? Gab es irgendeinen Punkt in meinem Leben, an dem wer-auch-immer die Weichen hätte anders stellen können?
Kindheit und Jugend in Dessau
1908 geboren, fiel meine Kindheit in den Untergang des Kaiserreichs und den Ersten Weltkrieg. Die Hungersnot quälte unsere Mägen, die Schmach von Versailles drückte auf das Gemüt meiner Eltern.
Ich erinnere mich an eine heftige Auseinandersetzung meiner Eltern. Mein Vater hatte gegen den erbitterten Widerstand meiner Mutter eine wertvolle goldene Taschenuhr der Aktion „Gold gab ich für Eisen“ geopfert. Als Dank für sein patriotisches Handeln erhielt er eine Uhrenkette – mit der entsprechenden Aufschrift „Gold gab ich für Eisen“. Diese Kette und die schlichte Arbeiteruhr liegen heute in meinem Schreibtisch. Bei jedem Blick darauf verstehe ich den Zorn meiner Mutter, und frage mich, wie jemand so dämlich hatte sein können, einen wertvollen Familienbesitz für den Krieg zu verschleudern. Meine Mutter stammte aus einer ehrwürdigen, aber mit wenig Wohlstand gesegneten Hugenotten-Familie. Sparsamkeit war ihr das höchste Gebot.
Heute, nach all meinen persönlichen Erfahrungen und dem Missbrauch meiner eigenen Ideale, kann ich den Begriff „Patriot“ nur noch als Wortverbindung von Patria und Idiot betrachten.
Ich war zu früh geboren worden, um den Schrecknissen des Ersten Weltkriegs entgehen zu können, doch spät genug, um wenigstens eine unbeschwerte Jugend erlebt haben zu dürfen. An die Jahre in Dessau und mein enges Verhältnis zu meinem Freund Alex denke ich gern zurück. Wir sitzen bereits als 7-Jährige in der Schule zusammen und sind einander emotional eng verbunden. Blutsbrüder, wie Winnetou und Old Shatterhand. Eine echte Knabenliebe.
Alex’ Familie besitzt landwirtschaftliche Ländereien, die von der Mulde durchflossen werden. Im Sommer schwimmen wir nackt durch den Fluss. Mit 12 Jahren teilen wir all unsere Gedanken und besprechen unsere pubertären Gefühle. Wir spüren die Männlichkeit, die sich in uns entwickelt und die uns verwirrt. Wir vertrauen einander Dinge an, wie es sonst wohl nur Mädchen tun. Unser gegenseitiges Vertrauen und unsere Zuneigung zueinander sind grenzenlos.
An einem dieser warmen Sommertage an der Mulde liegen wir nach dem Baden zum Trocknen nackt in der Sonne. Handtücher haben wir nicht dabei. Wozu auch? Wir dösen mit geschlossenen Augen. Offensichtlich träumen wir beide einen erotischen Traum, der uns eine starke Erektion beschert. Wir schauen uns an und machen einen „Waffenvergleich“. Alex gewinnt. Wir spielen diverse pubertäre Spiele – es wächst zusammen, was zusammen wächst.
Das Thema männliche Sexualität beschäftigt mich lange. Ich lese später Literatur über männliche Freundschaften und will ergründen, ob ich „richtig gepolt“ bin. Ein Psychologe schrieb, dass eine echte Männerfreundschaft neben Sympathie auch immer eine erotische Komponente hätte. Gerade in der Pubertät seien gleichgeschlechtliche Erlebnisse normal. Es bedeute nicht, dass man deswegen eine homosexuelle Veranlagung habe. Das beruhigt mich. Das weibliche Geschlecht war uns in dem Alter noch fremd und fern. Es regt jedoch unsere Fantasie an.
Es gibt da ein kleines süßes Mädchen, das mich fasziniert. Ich fühle mich wie ein großer Bruder. Sie ist die Freundin meiner Schwester Margot. Meine Schwester wurde am 18. Februar 1912 geboren, ihre Freundin Ursula ist genau drei Wochen älter. Beide sitzen in derselben Schulklasse. Immer, wenn ich Ursula sehe, leuchten ihre dunklen, fast schwarzen Augen auf und sie strahlt mich an. Drei Tage vor ihrem 10. Geburtstag geschieht das Drama.
Am Mittwoch, 25. Januar 1922, brennt das Theater in Dessau während einer Vorstellung nieder. Alle können sich retten, bis auf Ursulas Mutter und eine weitere Person, die es aus der Garderobe nicht mehr nach draußen schaffen und grausam zu Tode kommen.
Meine Schwester und ich sind zutiefst betroffen und vollkommen sprachlos. Warum passierte so etwas? Ich stelle mir vor, was ich empfinden würde, wäre meine Mutter in dem Feuer umgekommen. Die Gedanken, die mir dabei entgegenfliegen, erschrecken mich. Ich schiebe sie schnellstens von mir.
Am Samstag, dem 4. Februar, sehe ich Ursula die Kaiserstraße entlang gehen. Es ist ein feuchtkalter Tag. Als ich das Haus verlassen hatte, hatte das Thermometer minus 1,5 Grad angezeigt. Die vergangenen Tage waren von Schneeregen beherrscht worden, jetzt gesellt sich zur hohen Luftfeuchtigkeit noch ein eisiger Wind, der um die Ecken pfeift. Ursula hat sich in ihren Wintermantel gehüllt und die Wollmütze tief in die Stirn gezogen. Ich rufe ihr hinterher: „Ursula, warte mal!“. Mit wenigen Schritten bin ich bei ihr. „Du Ursula, das mit deiner Mutter tut mir unendlich leid. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, brauchst du es nur zu sagen. Du kannst dich auf meine brüderliche Hilfe verlassen.“ Sie schaut mich herzzerreißend traurig an, zieht die Mütze noch tiefer in die Stirn, dreht sich wortlos um und geht. Hatte ich etwas falsch gemacht? Ich hatte es doch lieb gemeint. Warum hat sie nichts gesagt?
Im März 1920 führt der Kapp-Putsch die Weimarer Republik an den Rand eines Bürgerkrieges. Ich bin gerade einmal 12 Jahre alt. Meine Eltern verbieten mir, alleine auf die Straße zu gehen, denn auch in Dessau kommt es zu bewaffneten Zusammenstößen. Am 16. März gibt es in der Fürstenstraße mehrere Todesopfer. Die Aufregung ist groß und in der Schule ist es das Hauptthema unter uns Schülern. Die Lehrer halten sich mit Kommentaren zurück. Angesichts des schnellen Wechsels der vorherrschenden politischen Strömungen bezieht man lieber keine klare Position.
Die Inflation schreitet ab Januar 1922 merklich voran und wird immer schneller. Meine Eltern wissen nicht mehr, wie sie mit ihrem Einkommen auskommen sollen. Ich merke es daran, dass bei Essen und Kleidung extrem gespart wird. Im Juli 1923 ist der Dollar bereits eine Million Mark wert, im Oktober werden es einige Milliarden sein. Geld ist praktisch wertlos. Im November 1923 wird die Rentenmark eingeführt. Viele Menschen verlieren bei dieser Reform ihr gesamtes Vermögen. Es folgt ein wirtschaftlicher Aufschwung. Das ist die Zeit, die wir heute als die „Goldenen Zwanziger“ bezeichnen. Die Arbeitslosigkeit geht zurück und die Wirtschaft blüht, bis zum großen Börsencrash im Oktober 1929. Unternehmen werden zahlungsunfähig, massenhafte Entlassungen führen zu Arbeitslosigkeit und sozialem Elend. Das ist Wasser auf den Mühlen des Nationalsozialismus.
Mit einem Transport über See werden meine Schwester und ich im Jahr 1923 mit dem „Verein für das Deutschtum im Ausland“ nach Reval (das heutige Tallin) geschickt. Wir leben dort von Mitte Juni bis zum 17. September bei der Familie Borchard. Frau Borchard ist die Schwester von Minna von Scheele, der zweiten Frau meines Großvaters. Das Ehepaar Borchard betreibt in Reval eine Holzhandlung und ein Sägewerk. Insgesamt sind sie sehr nett zu uns, doch meine 11-Jährige Schwester Margot und ich mit meinen 15 Jahren wissen nicht so recht, wie wir die Zeit bei dem alten Ehepaar ohne Kinder verbringen sollen. Uns ist stinklangweilig und mich beschleicht das Gefühl, dass meine Mutter uns gar nicht mehr haben will und uns zu fremden Menschen abschiebt. In der Zwischenzeit reist meine Mutter für einen Verwandtenbesuch und eine Kur nach Bad Wiessee am Tegernsee. Sie reist wie meistens ohne meinen Vater. Angeblich ist sie mal wieder sehr erschöpft und hat Herzattacken. Damit hat sie sich schon immer in Szene gesetzt und viele Kuren gemacht. Sie ist mit dieser Masche erfolgreich 74 Jahre alt geworden, obwohl sie ja angeblich immer sterbenskrank war.
Im Oktober 1923 wird der Aufstand der KPD in Hamburg blutig niedergeschlagen.
Am 8. und 9. November scheitert ein Putschversuch durch General von Ludendorff und Adolf Hitler. Die NSDAP wird als Partei verboten. Hitler wird zu 5 Jahre Haft verurteilt, jedoch vorzeitig entlassen. Ludendorff wird freigesprochen.
Es sind äußerst unruhige und wirtschaftlich bedrohliche Zeiten. Das begreife ich auch schon in meinem jugendlichen Alter.
1924 wird die Jugendorganisation der NSDAP verboten, die Polizei beschlagnahmt in Dessau ausgestelltes Propagandamaterial im Fürstenhof. Die Funktionäre der Ausstellung werden verhaftet.
Die SPD gründet ihren Kampfverband „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ und die KPD den „Roten Frontkämpferbund“. Beides waren paramilitärische Verbände, die ihre politische Ausrichtung lautstark und aggressiv vertraten. Sie sollten den frustrierten Frontkämpfern aus dem Ersten Weltkrieg eine politische Heimat geben. Die NSDAP bildet mit ihrer SA, der Sturmabteilung, den Gegenpol zu linken Kräften. Alle Zeichen stehen auf Kampf.
Am 13. April 1924 wird bis zur herbstlichen Sonnenwende am 21.September auf Sommerzeit umgestellt.
Ostern ist in diesem Jahr sehr spät. Am Ostermontag, dem 21. April1924 treffe ich mit Alex zusammen. Alex strahlt und ist voller Enthusiasmus: „Stell dir vor, gestern waren zwei Cousinen zu Besuch. Sie schäumten über vor Begeisterung, als sie von ihren Erlebnissen mit den Pfadfindern erzählten. Was meinst du, sollen wir uns nicht auch den ‚Allgemeinen Pfadfindern‘ anschließen?“ „Tolle Idee! Ich habe auch schon viel Gutes darüber gehört. Lass uns das zusammen machen“, antworte ich. Gesagt, getan. Alex und ich werden Mitglied bei den Allgemeinen Pfadfindern. Hier sind nur Jungs aus gutbürgerlichen konservativen Familien versammelt, alles was uns „rot“ oder kommunistisch vorkommt, ist uns nun zuwider.
1926 vereinigen wir uns mit dem Stamm „Goten“ in Dessau. Jetzt gehören wir zum Bund der „Sturmtrupp-Pfadfinder“, eine „Deutsche Waldritterschaft“, die sich an die Gedanken des „Urpfadfindertums“ anlehnt. Wir folgen der Idee vom einfachen und geistigen Leben. Neben den üblichen Abenteuerspielen ist auch das soziale Lernen gefordert. Wir leisten gemeinnützige Arbeit, sind besonders im Bereich von Umwelt- und Naturschutz aktiv und helfen auch bei Pflanzaktionen in der Forstwirtschaft.
Bei einer Aktion im Harz, zwischen Blankenburg und Gernrode, werden wir einmal von den anarchistischen Anhängern der kommunistischen Kampfgruppe attackiert und mit Steinen beworfen. Für diese gelten wir als bürgerlich und stehen damit auf der Seite des Kapitalismus. Das war Grund genug für sie, uns zu beschimpfen. Es wird zwar niemand verletzt, aber unsere Wut auf diese Chaoten steigert sich maßlos. Kommunisten zählen fortan zu unseren natürlichen Feinden. Unsere politische Neutralität bekommt Grenzen gesetzt.
In der Albrechtstraße 109 ist immer etwas los. Es gibt viele Kinder in allen Altersstufen. Eberhardt Junkers ist ebenfalls 1908 geboren und wir gehen zur selben Schule. Alex und ich sind mit ihm freundschaftlich verbunden und gemeinsam im Ruderverein aktiv. Die Familie Junkers ist eine etablierte Unternehmerfamilie in Dessau. Der Vater, Hugo Junkers, baut Flugzeugmotoren und Flugzeuge. Die Ju 52 wurde später als militärische Transportmaschine sehr berühmt.
Immer, wenn ich bei der Familie Junkers zu Besuch bin, spüre ich die dort herrschende liberale offene Stimmung. Freunde sind jederzeit willkommen und müssen sich in dem Familienchaos von zwölf Kindern selbst zurechtfinden. Manchmal ist in dem Gewusel nicht ganz klar, wer Familienmitglied oder Familienfreund ist. Hier geht alles ganz anders zu, als bei mir zu Hause, wo alles beamtenmäßig ordentlich, konservativ und streng reglementiert ist. Im Hause Junkers herrscht ein freier Geist, mit starkem Interesse an Kunst und Kultur.
Ab 1926 werden hier Verbindungen zu Walter Gropius, dem Bauhaus sowie zu Lyonel Feininger geknüpft und entsprechende Projekte unterstützt. Die Kinder haben viel Freiraum, um sich zu entfalten. Jeder Besuch dort beflügelt mich.
Am Freitag, dem 25. Mai 1928, gibt es Anlass für eine große Feier in Dessau. Alles, was Rang und Namen hat, kommt zusammen. Die Junkerswerke haben das 1000ste Flugzeug gebaut. Hugo Junkers wird Ehrenbürger der Stadt und ein Teil der Köthener Straße, in der das Werk liegt, wird in Junkersstraße umbenannt. Als Freund von Erhardt bin ich bei der Feier ebenfalls dabei.
Auf dem Heimweg, gegen 17 Uhr, herrscht leichter Nieselregen. Trotzdem gehe ich in Richtung Mulde. Ich will noch durch die Wiesen laufen und die schöne frische Luft genießen. Wie durch eine göttliche Fügung steht Ursula an einer Straßenecke und unterhält sich mit anderen Mädchen. Als ich näherkomme, verabschieden sich die anderen und ich winke Ursula zu, sie möge warten. Ursula ist mit ihren mittlerweile 16 Jahren eine attraktive junge Frau geworden.
Zusammen gehen wir in die Flussauen und plaudern über dieses und jenes. Natürlich interessiert sie sich auch für meine Eindrücke von der soeben erlebten Feierlichkeit. Ich erzähle ihr auch von meinem Leid und dem Ärger mit meiner Mutter. Plötzlich hält sie mich am Ärmel fest: „Sag mal Lutz, worüber beklagst du dich eigentlich? Soweit ich es von Margot mitbekommen habe, geht eure Mutter sehr fürsorglich mit euch um.“
Verwundert sehe ich sie an: „Fürsorglich nennst du das? Nichts mache ich richtig, nichts ist gut genug für sie. Im Übrigen kann zu viel Fürsorge einen auch erdrücken. Sie lässt mir keine Freiheit, um eigene Entscheidungen zu treffen und mich selbst zu entwickeln. Ihre Fürsorge besteht aus einer Summe von Anweisungen, die ich zu befolgen habe.“
„Du bist undankbar“, erwidert Ursula. „Sei froh, dass du eine Mutter hast. Ich wollte, ich wäre an deiner Stelle. Weißt du eigentlich, wie schmerzlich es ist, ohne Mutter zu sein?“ Die letzten Worte klingen halb erstickt, ein paar Tränen laufen ihr lautlos über die Wangen. Sie weint, ohne wirklich zu weinen. Ihr Seelenschmerz überwältigt sie, sie wendet sich mir zu, sie legt ihre Arme um mich und schmiegt ihren Kopf an meine Schulter. Ich erwidere ihre Umarmung und halte sie fest an mich gedrückt. Ich fühle ihre Wärme, ihren jungen sich noch entwickelnden Busen an meiner Brust. Ihre Haare und ihr ganzer Körper riechen sehr fraulich. Ich atme tief durch und genieße diesen Moment der besonderen Zuwendung. Zärtlich küsse ich ihr die salzigen Tränen von der Wange. Meine Lippen spüren ihre junge glatte Gesichtshaut. Was für ein wunderbares hübsches Mädchen, denke ich. Ursula strafft ihren Körper, richtet sich auf, macht sich aus der Umklammerung frei und sagt: „Du bist so groß und stark. Im Ruderverein habe ich dich einige Male gesehen und deine kraftvolle Bewegung bewundert.“ „Danke für das Kompliment. Ich fühle mich sehr geschmeichelt“, antworte ich. Es ist ein wunderbares Gefühl, von einer jungen, hübschen Frau so bewundert zu werden. Sie bestätigt mich in dem, was auch ich selbst an mir wahrnehme: In den vergangenen drei Jahren, in denen ich mich in der Rudervereinigung Dessau betätige, sind meine Schultern breiter und die Muskeln an Armen und Beinen stärker geworden.
Der Nieselregen hat aufgehört. Die abendliche Kühle schleicht von unten aus der Wiese an unserem Körper empor. Ursula schaut mich noch einmal bewundernd an und sagt: „Mir wird kalt, lass uns nach Hause gehen.“
Die Weimarer Republik beschert uns eine sexuelle Revolution. Die Soldaten, die an Ost- oder Westfront gekämpft, den Totentanz am Hardmansweiler Kopf in den Vogesen und die mörderische Schlacht an der Somme überlebt hatten, die zwischen Leichen und verblutenden Kameraden bei Verdun im Schützengraben gelegen hatten, sie waren paralysiert, zu seelischen Krüppeln geworden. Sie wollten nichts weiter als das Leben. Mehr als zwei Millionen deutsche Soldaten hatten dieses indes bereits verloren.
Fragen zu stellen wie „Wofür?“, oder „War es das wert?“ führen zu nichts. Jedenfalls nicht jetzt, nicht nach dem Krieg. Später, wenn diese Fragen zu etwas führen könnten, sind sie vergessen. Das Leid wiederholt sich, schlimmer als je zuvor.
Jetzt aber gibt es einen erheblichen Frauenüberschuss. Die nun modernen Verhütungsmittel erlauben Geschlechtsverkehr ohne Angst vor Schwangerschaft oder Geschlechtskrankheiten. Lesben und Schwule werden gesellschaftlich mehr und mehr akzeptiert, offene Ablehnung oder gar Verurteilungen auf der Basis des § 175 wie im Kaiserreich scheinen der Vergangenheit anzugehören. Forderungen, den § 175 abzuschaffen, werden breit diskutiert.
Doch der Rückschritt lässt nicht lange auf sich warten. Mit Hitlers Machtergreifung 1933 werden alle gleichgeschlechtlichen Handlungen jeglicher Art unter strenge Strafe gestellt. Homosexualität wird als „entartetes“ Verhalten gebrandmarkt, als Bedrohung der Leistungsfähigkeit des Staates und des männlichen Charakters des deutschen Volkes betrachtet und geächtet.
Doch zunächst gewinnt die Freizügigkeit. Die bereits 1901 gegründete Freikörperkultur (FKK) blüht in der Weimarer Republik wieder auf. Es gilt die These: „Die Gewohnheit, sich zu bekleiden, fördert unnatürliche Prüderie und falsche Moralgesetze.“ Auf den abgesperrten FKK-Geländen bewegt man sich nackt, treibt nackt Sport und tanzt sogar nackt. Wie impotent muss man sein, denke ich, um bei einem Tango, bei dem die Körper sich berühren, keine Erektion zu bekommen? Allein bei dem Gedanken daran spannt sich schon meine Hose.
Es gibt Zeitschriften für FKK-Freunde mit zahlreichen Nacktbildern. Eine solche Zeitschrift wird bei uns unter der Schulbank zu Höchstpreisen gehandelt. 1933 werden alle FKK-Vereine verboten, die Gelände aufgelöst und die Vereinsvermögen eingezogen. Als Ersatz wird der „Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen“ als NS-Organisation geschaffen. Erst 1942 eröffnet Heinrich Himmler mit der „Polizeiordnung zur Regelung des Badewesen“ wieder die Möglichkeit, sich nackt zu bewegen beziehungsweise nackt zu baden, ohne sich strafbar zu machen.
Alex und ich besitzen bereits mit 16 Jahren eine Jagderlaubnis und schießen Enten an der Mulde. Ich benutze eine Suhler Doppelflinte von meinem Vater. Dieser verlangt von mir eine konsequente Schussdisziplin. Das bedeutet, dass ich nur jeweils eine einzige Patrone laden darf. Vater erklärte mir den Grund dafür: „Wenn du nur einen Schuss hast, musst du ihn konzentriert setzen. Dadurch verleitest du dich nicht zum leichtfertigen Draufhalten und erzielst ein besseres Trefferergebnis. Du verringerst das Risiko, die Ente nur zu verwunden, ohne sie zu töten. Also, sei weidmännisch umsichtig und bedenke, dass du mit jedem chuss ein Lebewesen tötest. Erlege nur das, was du auch wirklich essen oder verwerten willst.“ Diese kluge Einstellung werde ich später an meinen Sohn weitergeben.
Waffen faszinieren mich. Schon während der Schulzeit besorge ich mir in Suhl eine Liliput, eine halbautomatische Taschenpistole, Kaliber 4,25 Millimeter, womit man höchstens eine Ratte erschießen aber niemanden ernsthaft gefährden kann. Trotzdem macht mich allein das Wissen stark, eine echte Waffe zu tragen. Es gibt mir das Gefühl von Männlich- und Wehrhaftigkeit. Peinlicherweise rutscht mir die Pistole während des Unterrichts einmal aus der Hosentasche und trifft mit einem unüberhörbar hellen und metallischen Geräusch den Steinboden. Der Lehrer ist genauso erschrocken wie ich, die Kameraden biegen sich vor Lachen. Ich bekomme einen Tadel und mir ist es fortan verboten, die Pistole mit zur Schule zu bringen. So großzügig und selbstverständlich war damals der Umgang mit Waffen.
Ich wohne mit meinen Eltern und den Großeltern zusammen in einem großen Haus in der Kaiserstraße. In den Nachbarhäusern wohnen weitere Kinder und Jugendliche in unserer Altersstufe, mit denen wir uns auf der Straße oder auf einem Bolzplatz treffen. Wir sind alle sehr lebhaft. So lebhaft, dass eine ältere Dame einmal bemerkt: „Ihr seid wohl die Jungs von der Krachmacherstraße!“ Für uns ist das keine Kritik, sondern Lob und Auszeichnung. Richtig, wir haben kein Gefühl für die Lautstärke, die wir erzeugen, aber viel Freude dabei.
Der einzige Sohn von Lehrerehepaar Helmbrecht ist wegen seines Down-Syndroms optisch auffällig und auch geistig etwas beeinträchtigt. Ich sage bewusst „etwas“, weil es für uns Jungs auf den ersten Blick gar nicht offensichtlich war. Erst beim Sprechen merken wir, dass er nicht ganz helle ist. Er, Karl-Heinz, ist ein guter Fußballspieler. Wir nennen ihn nur „Heini“. Beim Fußballspiel ist er mitunter etwas hart im Einsatz und die Regeln legt er manchmal recht großzügig aus. Wir durchschauen nicht, ob er die Regeln tatsächlich nicht ganz versteht oder sie bewusst ignoriert, wenn sie ihn bei seinem Spiel behindern.
Als wir eines Tages wie gewohnt auf der Straße spielen, mache ich einen gewaltigen Schuss. Zu gewaltig. Der Ball zersplittert in der unteren Etage des Hauses ein Fenster. Während wir noch überlegen und diskutieren, wie wir den Ball wiederbekommen könnten, sagt Heini: „Ich mach das, ich habe ja einen Dachschaden, mich bestrafen die bestimmt nicht.“ Gesagt, geklingelt, getan. Wir anderen verstecken uns etwas feige hinter den Straßenbäumen. Heini kommt nach fünf Minuten strahlend aus dem Haus, unter seinem Arm klemmt der Ball. Ob seine Eltern dafür zur Kasse gebeten wurden, weiß ich nicht. Heini jedenfalls war ab sofort unser Held und Ausputzer für besondere Gelegenheiten. Er wird in den „Club der Krachmacher“ aufgenommen.
Studium und Corps Ratisbonia
Die Corps-Studenten sehen sich im völkischen Verbund, halten deutsches Brauchtum und die deutsche Art hoch und pflegen sie. Sie betrachten sich als die Wurzel des deutschen Idealismus. Die Verbindungen waren 1815 unter dem Motto „Ehre, Freiheit, Vaterland“ gegründet worden. Sie wandten sich damals gegen den moralischen Verfall des Studententums und die nationale Zerrissenheit des deutschen Reiches. Um die Jahrhundertwende wurden die Corps immer elitärer. Wer Akademiker werden wollte, galt nur etwas, wenn er Verbindungsstudent war. Kaiser Wilhelm, Bismarck und viele später bedeutende Persönlichkeiten waren Verbindungsbrüder. Mein Vater war in einer Verbindung, mein Großvater war in einer Verbindung, also gehe auch ich in eine Verbindung.
„Es gab Nichts, was mehr verband, als der Corps farbige Band“, war ein gängiger Ausspruch von Verbindungsbrüdern. Couleur-Bänder-Studentenmützen mit den Farben der Verbindung werden mit Stolz getragen. Verbindungen schaffen ein bedeutendes Netzwerk für spätere Erfolge. Somit ist es klar und vorbestimmt, dass ich auch Mitglied in einer Verbindung werde. Mit Beginn meines Studiums der Tiermedizin in München im Jahr 1932 werde ich Mitglied in der studentischen Verbindung „Ratisbonia“ – eine Verbindung im Kösener-Senioren-Convent-Verband“. Es ist eine schlagende Verbindung mit den Farben Weiß-Rot-Hellblau mit silberner Perkussion. Dazu gehört eine hellblaue Studentenmütze. Unser Wahlspruch ist „VIRTUS ET HONOS ‒ Tapferkeit und Ehre“.
In der schlagenden Verbindung ist es Pflicht, Mensuren zu fechten. Die Mensur bezeichnet den Abstand der Paukanten zueinander. Die Paukanten sind mit Körper- und Kopfschutz und auch an Gesicht, Augen und Nase weitgehend geschützt. Mensuren fechten, das ist weder Sport noch Duell. Es gibt weder Gewinner noch Verlierer. Wichtig sind aufrechte Teilnahme, Durchhaltevermögen und die Beherrschung von Affekten. Der Mensur Convent bewertet Stand, Moral und Technik. In diesem Zweikampf von Männern, bei dem man verletzt werden kann, wird Disziplin verlangt. Disziplin, den Kampf ohne sichtbare Furcht durchzustehen.
Ich bin mit Herz und Seele dabei, mit allen Verpflichtungen einer studentischen Gemeinschaft, deren Mitglieder lebenslang verbunden bleiben und ein verlässliches Netzwerk bilden.
Später, mit etwas Abstand und in meiner Gefängniszelle sitzend, denke ich an das klassische aber schwachsinnige Kampftrinken und andere Männerspiele, in denen ich mir und anderen beweisen musste, was für ein toller Kerl ich war. Ich denke an merk- und fragwürdige Rituale, die ich heute albern finde. Aber um welchen Preis hätte ich mich damals davon distanzieren können? Welche Alternative hätte ich gehabt? Abgesehen davon, bin ich damals ja gar nicht auf die Idee gekommen, es anders machen zu wollen.
Ich bin nun im dritten Semester und habe auf dem Paukboden bereits viele Mensuren gefochten. Mein Gesicht ist mit mehreren einschlägigen Narben gezeichnet. Meine Kameraden Dinkelmeyer (Medizin), Ammon (Medizin), Einecker (Pharmazie), Bunse (Architektur), Lepp (Zahnmedizin), Weber (Jura), Schönen (Pharmazie) und ich (Tiermedizin) treten zur selben Zeit in die Verbindung ein. Wir unterstützen uns gegenseitig beim Lernen und pflegen eine enge studentische Freundschaft untereinander. Überhaupt ist die Hilfsbereitschaft in der Verbindung sehr ausgeprägt. Die höheren Semester greifen uns unter die Arme, wenn wir mal durchhängen oder etwas nicht verstehen.
Das Leben in der Verbindung gibt mir das Gefühl von Freiheit, Kameradschaft, Zugehörigkeit und die Gewissheit, wichtig und akzeptiert zu sein. Mit Stolz trage ich die Farben der Verbindung. Die Narben in meinem Gesicht weisen mich für jeden erkennbar als Akademiker aus. Das steigert mein Selbstbewusstsein. Das schmeichelt meiner Seele und macht mich für die Mädchen interessant.
Aber wie in jeder Gemeinschaft gibt es auch hier Typen, die ich nicht mag. Ein Verbindungsbruder ist mir besonders zuwider. Carlos von Wagner, ein arroganter Pinsel, wie er im Buche steht. Er weiß alles, er kann alles, aber er tut nichts für die Gemeinschaft. Innerhalb der Verbindung benimmt er sich wie ein Schmarotzer. Ein echter Stinkstiefel eben. Carlos studiert Jura, ist zwei Semester über mir und Fuchsmajor. Als Erstsemestriger muss ich ihm als Fuchs dienen. Ein Fuchsmajor hat das Recht, sich bedienen zu lassen. Ich muss Bier zapfen und es ihm bringen sowie andere allgemeine Assistenztätigkeiten leisten. Mit anderen Worten beschrieb es den Prozess von klein anfangen und sich hochdienen. Erniedrigungen sind allerdings nicht vorgesehen, diese widersprechen dem Anstand. Carlos lässt mich deutlich spüren, dass er von adeliger Herkunft ist und sich deshalb für etwas Besseres hält.
An einem Abend diskutieren wir sehr intensiv über politische Themen, gesellschaftliche Normen, die Entwicklung des Nationalsozialismus und die Abschaffung der Privilegien des Adels nach dem Ersten Weltkrieg. Carlos ist ein unangenehmer und sehr empfindlicher Gesprächspartner, er verträgt keinen Widerspruch. Seine Meinung gilt, alle anderen denken falsch. Er agiert zunehmend emotional und wird immer aufgebrachter in unserer Debatte. Seine Lautstärke nimmt zu, seine Stimme wird immer heftiger, als wäre die Lautstärke ein überzeugendes Argument dafür, dass er im Recht ist. Er steht auf, donnert den Bierkrug auf den Tisch, brüllt mir zu: „Sozial bist du ein Nichts!“, und stürmt türknallend aus dem Raum.
Diese wenigen Worte treffen mich tief in meinem Ehrgefühl. Innerlich bebend und mit zittriger Hand leere ich mein Bierglas und gehe auf mein Zimmer. An Schlaf ist nicht zu denken. Seine Worte wühlen in mir. Ich habe keine Idee davon, wie ich mit diesem Erlebnis und meinem inneren Aufruhr umgehen soll.
Das Stiftungsfest
Die Mittsommernacht am 21. Juni ist immer ein bedeutendes Ereignis in der Verbindung. Am ersten Wochenende danach, am Johannistag, feiern wir traditionell das jährliche Stiftungsfest. Zu diesem Fest sind nicht nur die „Alten Herren“ mit ihren Damen geladen, auch wir, die jungen Studenten, laden Mädchen ein, bevorzugt von der Pädagogischen Hochschule. Dort gibt es viele hübsche und auch zum Mitkommen gewillte junge Frauen. So geschieht es auch in meinem dritten Semester, am Samstag, dem 25. Juni 1932. Der Abend verläuft unterhaltsam mit Tanzen, Reden und Biertrinken. Wein ist zu teuer und Schnaps nicht gesellschaftsfähig. Außerdem leben wir in München, der Wiege der Braukunst. Da es keine festen Bindungen zu bestimmten Mädchen gibt, tanzen wir mit allen, die uns gefallen. Die Nacht ist wunderbar lau, daher ereignet sich so manches auch im Garten hinter dem Haus. Wobei das Haus vielmehr eine Villa ist, denn die Verbindung ist nicht arm und kann sich diese Immobilie in Schwabing in der Nähe zum Englischen Garten leisten. Ich stehe mit einigen Freunden im Garten zusammen und rauche meine Pfeife. Es ist eine studentische krumme Pfeife mit hängendem Kopf, die mein Vater schon als Student rauchte. Der Knaster, den ich gestopft habe, stinkt wie ein Wald- und Wiesenbrand, schmeckt aber irgendwie männlich. Die Pfeife sieht etwas verwegen aus und macht mich interessant.
Da kommt Heidrun auf mich zu, mit ihr hatte ich zweimal getanzt. Ein nettes Mädchen aus gutem Haus. Ihr Vater ist Lehrer am Alten Gymnasium in Bremen. Das hatte sie mir beim Tanzen voller Stolz erzählt. Es sei ein ehrwürdiges Gymnasium, das schon Anfang 1500 als Lateinschule berühmt gewesen war und heute noch ein großes Renommee in Norddeutschland hätte. Der Vater sei allerdings sehr genervt von der Disziplinlosigkeit der Schüler aus der Nachkriegsgeneration. Sie seien undiszipliniert, frech und ohne Respekt vor Autoritäten.
Der Leiter der Schule, ein Dr. Schaal, sei dagegen ein Pfundskerl. Er habe jetzt erlaubt, dass man in der Schule alle Embleme der Nationalsozialisten tragen dürfe. Zwei Lehrer, die nicht passend seien, habe er wegen rassistischen und politischen Gründen entlassen. Der Senator von Hoff habe ihm Rückendeckung gegeben und die Maßnahmen sehr unterstützt. Heidruns Vater sei froh, dass an der Schule nur sieben jüdische Schüler seien, die zudem bald ihren Abschluss machen würden. Neue Juden würden nicht aufgenommen werden.
Heidrun ist sehr national eingestellt. Ihre Tanzbewegungen sind schwungvoll, dynamisch und gekonnt. Es ist eine Freude, mit ihr zu tanzen. Vom Typ her ist sie allerdings nicht das, was ich mir für heute eigentlich wünschen würde. Sie wirkt recht konservativ und bieder.
Heidrun kommt also zu uns in den Garten. Sie wirkt verängstigt, zieht mich beiseite und sagt leise, so dass die anderen es nicht hören können: „Der Carlos macht mir Angst. Beim Tanzen wurde er zudringlich, er will mich nun unbedingt nach Hause bringen. Da Carlos mich persönlich eingeladen hat, ist das ja auch normal und eigentlich gebietet es der Anstand. Ich habe aber furchtbare Angst vor ihm. Kannst du mich begleiten?“
Es ist zwei Uhr morgens, einige Biere habe ich schon getrunken, aber ich bin nicht betrunken. Das Vertrauen von Heidrun zu mir ehrt mich. Mit stolzgeschwellter Brust versichere ich: „Natürlich mache ich das. Es ist mir eine große Ehre, dich zu begleiten. Ich garantiere dir deine Sicherheit.“
Wir suchen unsere Jacken, treffen uns im Flur an der Ausgangstür und schleichen uns davon, damit Carlos nichts bemerkt. Von der Villa in der Ungererstraße bis zu ihrer Heimatadresse, der Augustenstraße, sind es rund 60 Minuten Fußweg. Wir gehen am Siegestor, dann an der Ludwig-Maximilian-Universität vorbei, die Arcisstraße hoch, dann nach rechts in die Schellingstraße bis zur Augustenstraße.
Heidrun wohnt direkt über der Bäckerei und Konditorei Hölzl, ein Traditionsbetrieb seit 1919, wie eine Aufschrift an der Tür vermerkt. Der Eingang zu ihrer Wohnung, in der sie mit zwei anderen Mädchen wohnt, ist vom Hinterhof aus zu erreichen.
Im Hinterhof befindet sich auch die Backstube. Es ist 20 Minuten nach 3 Uhr früh, es duftet nach frischen Brötchen und Brot. Heidrun, die alle Gesellen dort kennt, fragt, ob wir vielleicht ein paar Brötchen haben könnten.
Der Bäckermeister hat offensichtlich ein Herz für Heidrun und schenkt ihr sechs Brötchen. Zwei davon bekomme ich, eines wandert noch warm in die Hosentasche, das andere gleich in den Mund.
Ich verabschiede mich, wünsche eine gute Nacht, obwohl diese ja eigentlich schon vorbei ist und ich bekomme ein zartes Küsschen auf die Wange, ein Dankeschön und sie verschwindet in der Tür. Noch nicht ganz drinnen, sagt sie noch: „Obwohl mein Vater sich mit der Schulleitung gut versteht, will er demnächst zur Wehrmacht und eine Offizierslaufbahn einschlagen. Ist das nicht toll?“ „Ja“, sage ich mit wenig Begeisterung, „ich drücke alle Daumen, dass es klappt.“





























