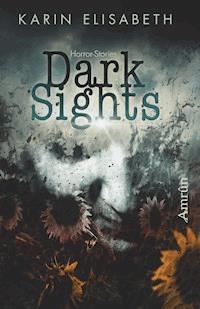
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Unheimliche hat viele Gesichter. Oft ist es nur ein unbehaglicher Hauch im Nacken, wie eine Ahnung von etwas, das im Dunkeln lauern könnte. Aber manchmal kommt es näher, nimmt Gestalt an. Dann ist es vielleicht der Junge, der nur dann in dein Zimmer kommt, wenn du allein bist. Oder das Grauen auf dem Grund der Jauchegrube. Die Menschenfresserin, die in deiner dunkelsten Stunde im Wald auf dich wartet. Oder auch die böse Fratze hinter dem Gesicht, das du so lange kennst. Acht unheimliche Erzählungen – mal kommen sie aus den Tiefen jener gespenstischen Welt, die uns verborgen liegt, mal kriechen sie aus kranken Hirnen ans Licht, um das Grauen in die Welt zu tragen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DARK SIGHTS
KARIN ELISABETH
Karin Elisabeth distanziert sich hiermit persönlich von der in diesem Buch dargestellten Gewalt und der teils gewalttätigen Sprache, die ihre Figuren verwenden. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder toten Personen wären rein zufällig.
© 2018 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Lektorat: Simona Turini | Lektorat TuriniUmschlaggestaltung: Mark Freier | freierstein.deIllustrationen: Svart MyrRedaktion: Piper Marou
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-95869-307-4
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
INHALT
DIE BLUMEN
KAIN
DIE MADCHEN
DIE GABE
JOHNNY
DAS NEST
BABA JAGA
DER WECHSELBALG
DIE BLUMEN
Mit Mama war etwas nicht in Ordnung. Jakob und Miriam, genannt Mimi, bemerkten es an einem strahlend hellen Morgen im Mai.
Mama, so nannten die Kinder die 35-jährige Isabel K., die an jenem Morgen reglos am Küchenfenster stand und verloren in das leere, dunkle Sonnenblumenbeet starrte. Das allein war noch nicht allzu beunruhigend. Seltsam war aber, dass Mama weder das verschlafene »Guten Morgen« der Kinder erwiderte, noch sich nach ihnen umdrehte, als sie die Stühle mit einem Quietschen zurückzogen und sich an den Tisch setzten.
»Mama, was ist mit dem Frühstück?«, fragte Mimi schließlich laut, wie um einen Bann zu brechen.
Sie erntete einen strengen Blick ihres älteren Bruders, aber auch Jakob wunderte sich über den leeren Tisch und über Mama, die einfach so dastand wie eine Schaufensterpuppe und in das Beet blickte, das sie vor Kurzem erst zusammen mit den Kindern bepflanzt hatte. Auch auf Mimis Frage reagierte Isabel nicht. Die Kinder scheuten sich davor, Mama in diesem Zustand zu nahezukommen, und weckten ihren Vater, Raimund K., der normalerweise bis halb acht schlief.
In der Küche fand Raimund seine Frau noch immer in demselben Zustand, den die Kinder ihm in zusammenhanglosem Geschrei zu schildern versucht hatten. Als er Isabel mit ihrem Namen ansprach, reagierte sie zunächst nicht. Erst, als er dabei ihre Schulter berührte, antwortete ihr Körper wie mit einer Art verlangsamtem Zusammenfahren aller Muskeln. Seine folgenden Fragen »Geht es dir gut?« und »Willst du ins Krankenhaus?« beantwortete sie mit einem mechanischen »Ja ... nein ...«.
Dem Anschein nach war sie bei Bewusstsein. Widerstandslos ließ sie sich von Raimund die Treppe hoch und in ihr Schlafzimmer führen, wo sie versprach, sich hinzulegen, während er den Kindern Frühstück machte und sie anschließend mit dem Auto zur Schule fuhr.
Als er zurückkam, schien Isabel fest zu schlafen. Kein Wunder, dieser Zusammenbruch, dachte er. Zermürbende Wochen lagen hinter der Familie; erst der »nach kurzer Krankheit« überraschende Tod von Isabels Mutter Hedi, dann der Umzug in Isabels nun verlassenes Elternhaus. Und mit den Kindern, beide in jeweils kritischen Entwicklungsphasen, war es auch nicht immer leicht. Isabels wie immer resolutes und fröhliches Wesen hatte ihn wohl über ihre tatsächliche Erschöpfung hinweggetäuscht. Also beschloss Raimund K., erst mal abzuwarten und sie ausruhen zu lassen, anstatt einen Arzt zu konsultieren, und fuhr zur Arbeit.
Am Abend fand er Isabel schweißgebadet in ihrem Bett, zitternd und nach Luft ringend. Blut rann als dünner Faden aus ihrer Nase. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo nach langer Wartezeit und hastiger Untersuchung der Lunge und der Lymphknoten auf einen »wahrscheinlich bakteriellen Infekt« geschlossen wurde. Es wurde ein Antibiotikum verschrieben. Sollte sich innerhalb von sieben Tagen keine Besserung einstellen, so sollte Isabel sich noch einmal beim Hausarzt vorstellen.
Tatsächlich ging es Isabel nach einer Woche besser. Das jedenfalls nahm Raimund K. an, nachdem das Fieber abgeklungen war. Aber die Müdigkeit und eine gewisse geistige Abwesenheit blieben. Und auch wenn Isabel ihr Bett nun wieder verließ, war sie kaum dazu imstande, Haushalt und Kinder verlässlich zu versorgen, geschweige denn zur Arbeit zu gehen.
Eines Mittags ließ sie das Fett auf dem Herd so lange anbrennen, bis die Pfanne ganz schwarz wurde. Der Rauchmelder schrillte wohl schon eine Weile, aber Isabel blickte immer noch still aus dem Fenster in das Beet, wo die Sonnenblumen schon durch die Erde brachen und sich mit aller Wucht dem Licht entgegendrängten.
Niemand konnte ahnen, dass Isabel nicht einfach dastand, sondern sich erinnerte. An etwas, das sie ihrem Mann und den Kindern nie erzählt und das sie selbst schon lange vergessen hatte. Sie erinnerte sich an den Komposthaufen hinter dem Feld, wo damals keine Sonnenblumen, sondern Erbsenstöcke gestanden hatten. Es war ein Gemüsegarten gewesen, in dem sie herumspaziert war, um zu sehen, wie weit die Möhren gewachsen waren, während sie mit den Eltern am Meer gewesen war, und ob sich die Himbeeren hinter dem Komposthaufen schon rot färbten.
Es war ein schwüler Tag, die ersten Regentropfen fielen, und die Würmer wühlten sich aus der dampfenden Erde. In der Nähe des Komposts roch es seltsam süßlich, beißend, und hinter den Sträuchern surrte und summte es wie von einem ganzen Insektenschwarm. Genau da hinten, auf die andere Seite des Zauns, musste Isabel gehen, um nach den Himbeeren zu sehen, denn auf dieser Seite des Strauchs bekamen sie das meiste Sonnenlicht ab. Was die kleine Isabel dahinten sah, im hellen Nachmittagslicht, waren aber nicht die überreifen Himbeeren. Es war zuerst ein Schuh, dann ein Bein und dann ein toter Mensch, der im Gras lag und von aberhundert glänzenden Fliegen und Käfern zerfressen wurde.
»Oma liegt tot hinten beim Komposthaufen«, hatte sie dann ihren Eltern erzählt, die gerade in der Küche die dreckige Wäsche aus den Koffern sortierten.
Von diesen Erinnerungen ahnte Raimund K. nichts, als er Isabel zum Arzt fuhr. Dieser behandelte ihre Rauchvergiftung und schloss, weil er durch Ultraschall und Blutuntersuchungen keine Erklärung für Isabel K.s geistigen Zustand fand, auf eine Depression, wohl ausgelöst durch den kürzlichen Tod ihrer Mutter. Er verschrieb ein Antidepressivum und versicherte Raimund K., man müsse diesem und der natürlichen Resilienz nur etwas Zeit geben. Tatsächlich bemühte sich Isabel nach einigen Wochen wieder, den Haushalt und die Kinder zu versorgen, was Raimund zu der Annahme veranlasste, es ginge ihr dank der Medikamente deutlich besser. Also ging er wieder zur gewohnten Zeit ins Büro, was ihn die weiteren, fatalen Veränderungen, die mit seiner Frau vorgingen, lange nicht bemerken ließ.
Nur Jakob und Mimi sahen, wie Mamas Haltung die einer alten Frau wurde, wie seltsam sie jetzt ihre zitternden Hände hielt, wenn sie das Brot schnitt. Nur Jakob und Mimi bemerkten, dass Mama immer wieder in ihren Haushaltsroutinen innehielt und still aus dem Fenster in das Beet blickte, wo die Sonnenblumen inzwischen mannshoch in den Himmel ragten und mit dunklen Gesichtern in das Fenster lugten. Nur den Kindern fiel auf, dass ihre Mutter, obwohl sie oft lange am Fenster stand, die Tür zum Garten mied, als ob dahinter etwas Schreckliches lauerte.
Eines Nachts, schon spät im Sommer, kam Mimi noch einmal runter in die Küche, um sich etwas zu Trinken zu holen. Als sie die Kühlschranktür öffnete, bemerkte sie aus dem Augenwinkel ein seltsames, unnatürliches Leuchten, das durch das Küchenfenster fiel. Mimi fuhr herum und sah, dass das Leuchten von den Sonnenblumen kam. Wie tückisch sie durch das Fenster blickten mit ihren dunklen Gesichtern! Und dann sah sie auch ihre Mutter, draußen, ganz nah am Feld, wo sie mit den Blumen zu sprechen schien.
Schnell lief Mimi nach oben und sagte Jakob Bescheid. Als sie wieder in die Küche kamen, war Mama vom Fenster aus nicht mehr zu sehen. Mimi weckte den Vater, Jakob rannte hinaus in den Garten. Er fand Mama erstarrt mitten im Sonnenblumenfeld und führte sie auf den Rasen. Dort saß sie schweigend, immer noch auf dieselbe Stelle hinten im Feld blickend, als sein Vater endlich kam.
»Isabel!«, rief Raimund, erschrocken über ihren Anblick und überfordert mit den ängstlichen Kindern, die selbst nicht hätten sagen können, wovor sie sich genau fürchteten: Vor dem, was Mama Angst gemacht hatte oder vor Mama selbst. »Was machst du denn hier draußen?«
»Wir müssen sie abschneiden«, flüsterte Isabel verzweifelt.
Raimund runzelte die Stirn und schickte die Kinder nach oben, um sie nicht noch mehr zu verstören.
»Hörst du nicht!«, schrie Isabel. »Wir müssen sie ABSCHNEIDEN!«
»Die Sonnenblumen abschneiden?«
Isabel antwortete nicht, sondern flehte ihn nur mit ihren dunklen, weit aufgerissenen Augen an.
»Aber die Kinder werden traurig sein, Isabel ...«
Noch in derselben Nacht riss Raimund K. alle Sonnenblumen aus der Erde. Nun lag da, mitten im blühenden Sommer, ein kahles, dunkles Stück Erde im Garten. Ein Anblick, der Raimund und die Kinder schaudern ließ, wenn sie aus dem Küchenfenster blickten. Auch Isabels Zustand schien sich trotz der radikalen Maßnahme nicht zum Besseren verändert zu haben. Seit jener Nacht wurde allerdings die Tür zum Garten und auch die Haustür immer verschlossen gehalten, damit sich ein solches Schauspiel nicht noch einmal ereignen konnte.
Doch Isabels Verhalten blieb auch innerhalb des Hauses sonderbar und gefährlich, und selbst Raimund konnte bald nicht mehr verdrängen, dass sie den Kindern Angst machte. In einem ihrer letzten klaren Momente erklärte Isabel K. sich freiwillig dazu bereit, in ihrem Zimmer zu bleiben, bis das neue Medikament anschlug.
Eines Morgens wachte Mimi auf und fand in ihrem Zimmer die Wände mit furchtbaren, wie mit wüst krakelnder Kinderhand gezeichneten Bildern behangen. Sie alle zeigten Sonnenblumen in schrillem, schreiendem Gelb, Rot und Violett, die mit bösen Gesichtern in den Raum starrten. Mimi rannte zu Jakob, der ihr nicht glauben wollte, dass sie die Bilder nicht selbst gemacht hatte. Dennoch erschrak er, als er die grausigen Zeichnungen an den Wänden sah und konnte nicht so recht glauben, dass sie wirklich der Fantasie seiner kleinen Schwester entsprungen sein sollten. Schnell nahmen sie die Bilder ab und versteckten sie, denn sie wollten nicht, dass Mama eingesperrt wurde.
Dann kam der Tag, an dem sich Raimund K. zum Wohl und zur Sicherheit der Kinder doch dazu entscheiden musste, seine Frau in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. An jenem Morgen stürmte er in die Küche, da er von oben die beiden Kinder in panischem Entsetzen nach ihm schreien gehört hatte.
Unten fand er Isabel am Fenster, den Blick in das leere Beet gerichtet, mit schlaffen Gliedern und grausig eingefallenem Gesicht. Ein blutiger Speichelfaden hing aus ihrem Mundwinkel. Sie hatte sich wohl auf die Zunge gebissen, vermutete Raimund.
Mimi saß in ihrem Zimmer und weinte, als Mama abgeholt wurde. Sie weinte, weil Mama weggebracht werden musste und weil sie Angst hatte. Vor den Sonnenblumen, obwohl die jetzt abgeschnitten auf dem Kompost lagen. Denn auch Mimi hatte sie gesehen, die dunklen Gesichter in der Nacht, die schwarzen Fratzen, alle auf sie gerichtet, umlodert von giftigem Gelb, Orange und Violett. Sie hatte sie miteinander flüstern gehört, als sie durch das Feld gegangen war, und sie hatte es gefühlt, wie sie atmeten und wie sie die Köpfe, wenn Mimi vorbeiging, ganz langsam nach unten beugten, als würden sie etwas wittern.
Wenige Wochen später starb Isabel K. in der Klinik an einem multiplen Organversagen, für das die Mediziner zunächst keine Erklärung fanden. Um äußere Einflüsse und eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Überdosierung ihrer Medikamente auszuschließen, wurde eine Obduktion veranlasst.
Dabei konnte zwar ein Tod durch Fremdeinwirkung oder Suizid ausgeschlossen werden, doch die Ursache des Organversagens blieb weiter unklar. Dennoch sorgte die Öffnung des Körpers für einiges an echter medizinischer Aufregung im sonst so unterkühlten Pathologietrakt. Nahezu alle lebenswichtigen Organe Isabel K.s waren von einem ominösen Virus, Parasiten oder Krebs fast vollständig zersetzt, die Reste von Leber, Milz und Nieren befanden sich in einem absurd fortgeschrittenen Stadium des Zellverfalls.
All das gab den Ärzten eine Weile Rätsel auf, bis sie schließlich den Fall mit der Diagnose »Hirnblutung aufgrund von Tumorwachstum« zu den Akten legten und die Leiche von Isabel K. zur Beerdigung freigegeben werden konnte.
Nach den freudlosen Feierlichkeiten brachte Raimund K. die Kinder nach Hause. Er bat sie, den Tisch fürs Abendessen zu decken, während er oben duschte. Als er zurück in die Küche kam, fand er den Küchentisch nur zum Teil gedeckt, den Orangensaft verschüttet und die beiden Kinder wie im Schock erstarrt, die Münder verzerrt und die Blicke durch das Küchenfenster ins kahle Sonnenblumenfeld gerichtet.
Mit einem Mal verwandelte sich sein Schrecken in Wut. Raimund rannte in den Garten, quer über den leeren Acker, und verfluchte wie von Sinnen den Boden, der ihm bis zu seinem und der Kinder Tod die Antwort schuldig bleiben würde.
Er hätte sie vielleicht gefunden, hätte er gegraben. Gleich hinter dem Feld, da, wo früher der heute zugeschüttete Komposthaufen und dahinter die Himbeersträucher gestanden hatten. Dann hätte er vielleicht den beißend-fauligen Geruch bemerkt, der hier seit Jahr und Tag als feines, für das menschliche Auge kaum wahrnehmbares Gas über dem verdorbenen Grundwasser stand.
Und vielleicht hätte er sich erinnert, dass Hedi, Isabels Mutter, mit der Gartenarbeit erst wenige Monate vor ihrem Tod begonnen hatte. Weil sie, bewusst oder unbewusst, schon immer etwas an dem Garten geängstigt hatte.
So hatte sie es ihm erzählt, beim Kaffee nach der Beerdigung ihres Mannes. Vielleicht hatte Raimund K. damals nicht zugehört, vielleicht hatte er es aber auch einfach vergessen.
KAIN
Die neuen Shirts sind scheiße, aber das Wort darauf sieht gut aus. Ein Wort, das von mir stammt und eine große, dunkle Kraft ausströmt. KAIN. Weiß auf Schwarz. Henri sieht gut aus in dem Shirt, die schimmernden Narben auf seinen Unterarmen bilden eine ästhetische Einheit mit dem Schriftzug.
Das Problem ist, dass sie alle nicht verstehen, worum es wirklich geht.
Noch nicht.
Henri nicht, Sandra nicht und Mark schon gar nicht. Mark legt jetzt eine Platte auf, die wir schon zweimal gehört haben, seit wir hier im Keller seiner Eltern sitzen. Den ganzen Tag haben wir versucht, Aufnahmen zu machen, und die Ergebnisse sagen alles über den Punkt, an dem wir stehen.
Ästhetik ist wichtig, Musik ist wichtig – Philosophie ist wichtiger.
Wenn der Unterbau fehlt, ist jede Musik für’n Arsch. Deswegen gibt es auch so wenig gute Musik, weil sie von Menschen gemacht wird, die flach sind und nichts zu sagen haben. Wenn man nichts zu sagen hat, soll man keine Musik machen und auch sonst nichts.
Bei uns ist es anders. Wir haben zwar die Philosophie, aber auch wir haben nichts mehr zu sagen. Das Gesagte bedeutet nämlich irgendwann nichts mehr, wenn nicht danach gehandelt wird. Nur reden und nicht handeln ist schwach. Schwäche ist das, was wir am meisten verachten. Aber die eigene Schwäche erkennen die meisten nicht.
Wir stagnieren schon zu lange. Wenn ich mir die Gesichter in diesem Keller so betrachte, weiß ich auch, warum.
Mark, kuhäugig, krummnasig, Sohn liebender Eltern, lümmelt in einem Sessel, trinkt Bier und schaukelt seinen langhaarigen Kopf träge im Rhythmus der Musik. Jetzt fängt er wieder an, von Nietzsche zu schwafeln, den er nicht nur überschätzt, sondern nicht mal richtig versteht. Sandra trinkt Bier aus der Flasche, wie ein Kerl. Sie ist klein und drahthaarig und hat viel zu muskulöse Oberarme und klobige Tätowierungen, die sie total verschandeln. Sie kennt nur ein Zitat von Nietzsche, das sie gerne über den Tisch brüllt, um Marks Monologe zu beenden: »Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!«
Dann fängt sie an, über ihr Lieblingsthema zu schwadronieren: Was ist true und was nicht. Ich habe keine Ahnung, was Henri an ihr findet.
An der Diskussion, was true ist, beteiligen sich wie gewohnt alle. Alle außer mir, heute Abend. Ein ewiges Wah-Wah lange bekannter, sich niemals ändernder, niemals zu Ende gedachter Meinungen, das mein von den nutzlosen Aufnahmen frustriertes Gehirn über die Maße erschöpft. Seit Kurzem habe ich es aber drauf, Störgeräusche komplett auszublenden, indem ich sie in meinem Kopf auf stumm schalte. So höre ich sie nicht mehr, sehe nur noch Münder auf- und zuklappen, sinnlos, wirkungslos, albern.
Heute, Freunde der Nacht, stehen wir am Scheideweg. Ihr wisst es nur noch nicht.
Ich beobachte sie und warte auf den Moment. Das, was ich jetzt tun werde, soll niemandem gefallen; es soll wirken.
Schon seit einiger Zeit habe ich das Knochenmesser fest im Blick. Es liegt auf dem Tisch, blitzblank und frisch geschärft. Es ist nicht meins, es gehört Henri und außer ihm soll es keiner anfassen. Schon deshalb muss alles sehr schnell gehen. Ich spreize die Finger, soweit ich kann, drücke die Hand fest auf den Tisch, nehme das Messer und hacke zu. Mit aller Kraft, und ich habe nicht wenig davon. Blut spritzt, und das erste Glied des kleinen Fingers kugelt über den Tisch. Ich bin so berauscht davon, wie einfach es war, dass nicht mal Schmerz kommt. Endlich: Schweigen.
Versunken in meinen Triumph sehe ich sie gar nicht, sehe nicht, wie sie auf die Stelle glotzen, an der eben noch ein normaler Finger gewesen ist und auf das abgetrennte Glied neben dem Aschenbecher. Paralysiert, fasziniert.
Meine Hand zittert, als ich es aufhebe, das blutige kleine Stück Fleisch und Knochen. Meine Hand zittert, weil ich so aufgeregt bin, so unglaublich zufrieden, und in meinem Kopf geht ein großes Feuerwerk los. Eine neue Grenze ist gefallen.
Zu Hause lege ich das Stück Finger auf eine Untertasse und stülpe ein Glas darüber. Ich will sehen, was passiert, wie sich das Fleisch verändert und vergeht. Mein Fleisch. Als fast nur noch der Knochen übrig ist, bohre ich ein Loch hinein und trage ihn um den Hals. Ein Opfer, das gewirkt hat, denn jetzt haben sie verstanden: Ästhetik ist wichtig, Musik ist wichtig, Philosophie ist wichtig – Aber das alles nutzt nichts, wenn keine Taten folgen. Wenn keine Taten folgen, ist alles Abfuck, alles Heuchelei. Wir dürfen nicht länger heucheln. Es muss etwas passieren, und es muss bald passieren.





























