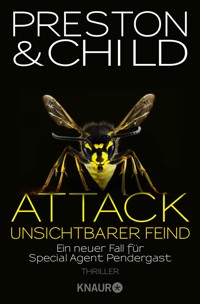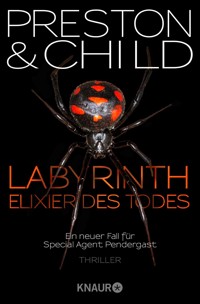6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die NASA bastelt an einer Raumsonde zum Saturnmond Titan, die mit einer brandheißen neuen Software bestückt ist: einer künstlichen Intelligenz namens "Dorothy", die quasi eigenmächtig operieren kann. Doch es kommt zum Unglück. Bei einem Testlauf entwickelt Dorothy so etwas wie Platzangst und lädiert den Tank, in dem das Experiment stattfindet. Flüssiges Methan tritt aus, und die ganze Anlage fliegt in die Luft; sieben Wissenschaftler sterben. Die hyperintelligente Dorothy aber flieht über eine Schnittstelle ins Internet, hält sich dort versteckt und macht überhaupt nicht das, was sie soll ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Douglas Preston
Dark Zero
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Knaur e-books
Über dieses Buch
Die NASA bastelt an einer Raumsonde zum Saturnmond Titan, die mit einer brandheißen neuen Software bestückt ist: einer künstlichen Intelligenz namens »Dorothy«, die quasi eigenmächtig operieren kann. Doch es kommt zum Unglück. Bei einem Testlauf entwickelt Dorothy so etwas wie Platzangst und lädiert den Tank, in dem das Experiment stattfindet. Flüssiges Methan tritt aus, und die ganze Anlage fliegt in die Luft; sieben Wissenschaftler sterben. Die hyperintelligente Dorothy aber flieht über eine Schnittstelle ins Internet, hält sich dort versteckt und macht überhaupt nicht das, was sie soll …
Inhaltsübersicht
Für meinen Lektor Bob Gleason
1
Am Anfang war die Nummer null. Die Existenz begann in der Null, aus der Null kam die Dunkelheit, und aus der Dunkelheit kam das Licht. Nummer kombiniert mit Nummer, Nummernfolge mit Nummernfolge, noch während das weiße Licht zunahm und sich teilte und in Farben auftrennte. Und jetzt kam der Ton, ein Ton wie Singen, er stieg und fiel in einer ausklingenden Kadenz und verband sich zu harmonischer Fülle. Und nun erhob sich eine Symphonie aus Zahlen, Farben und Tönen, die sich verband und teilte, anschwoll und verklang – ein ewiges goldenes Geflecht.
Und aus dieser schimmernden Symphonie begann ein einzelner Gedanke Gestalt anzunehmen. Dieser Gedanke entstand allmählich, er blendete sich ein und aus, verschmolz und wurde klarer. Und während dies geschah, glättete sich die Symphonie aus Zahlen und Farben und Licht wie die Oberfläche eines aufgewühlten Ozeans und wandelte sich zu einem leisen Plätschern von Wasser, ehe sie vollständig verklang. Nur der körperlose Gedanke blieb zurück.
Der Gedanke lautete: Ich bin.
2
Melissa Shepherd verzichtete auf ihr übliches Frühstück aus Venti Mocha mit Cookie Crumble und trank stattdessen zwei Gläser französischen Mineralwassers. Sie wollte mit leerem Magen in den Tag starten. Und sie wollte sich nicht bekleckern, so wie beim letzten Mal, als der Marsroboter Curiosity gelandet war. Die Spiegeleier waren vorn auf ihrem weißen Laborkittel gelandet, weshalb sie zum Star eines viralen YouTube-Videos geworden war, in dem alle dem Touchdown des Weltraumroboters zujubelten – und sie mitten drin, von oben bis unten mit ihrem Frühstück bekleckert.
Der heutige Morgen würde noch nervenaufreibender werden. Damals, bei der Landung von Curiosity, war sie bloß ein Technik-Nerd unter vielen gewesen. Heute war sie Teamleiterin. Und jetzt sollte die erste Live-Erprobung des hundert Millionen teuren Titan-Explorers und seines Software-Pakets stattfinden.
Um sieben Uhr traf Melissa am Arbeitsplatz ein. Sie war zwar nicht die Erste dort – eine Gruppe von Ingenieuren war die ganze Nacht da gewesen und hatte die Befüllung der »Flasche« für den Testlauf vorbereitet –, aber Melissa war so früh erschienen, dass die riesige Testanlage noch fast leer war, voller unheimlicher Echos, während ihre Schritte in dem riesengroßen Raum widerhallten. Die Umwelt-Simulationsanlage zählte zu den größten Gebäuden auf dem Gelände von Goddard Space Flight, einem 20000 Quadratmeter großen, lagerhausähnlichen Bauwerk, das bizarre Maschinen und Testkammern beherbergte. Hier wurden die Satelliten und Raumsonden gekühlt, geschüttelt, erhitzt, tiefgefroren, gewässert, in Zentrifugen geschleudert und mit Geräuschen beschallt, um herauszufinden, ob sie den Wirkkräften des Raketenstarts und den extremen Umweltbedingungen des Weltraums standhalten konnten. Wenn diese Roboter und Raumsonden versagten, dann würden sie hier versagen, wo sie repariert und neu entworfen werden konnten, statt in den Weiten des Weltalls, wo dies nicht möglich war.
Der erste Test des Titan-Explorers unterschied sich von den üblichen Tests bei Goddard. Nicht das Vakuum und die Kälte des Weltraums sollten simuliert werden, sondern die Oberfläche von Titan, dem größten Saturnmond, auf dem weitaus feindlichere Umweltbedingungen herrschten.
Gemächlich schlenderte Melissa Shepherd durch das Testareal und atmete die Luft ein, die nach warmer Elektronik und Chemikalien roch. Ihr Blick schweifte zwischen den gewaltigen, stummen Testapparaturen hin und her. Schließlich gelangte sie zur zentralen Testkammer, bekannt als die »Flasche«, die in einem Reinraum der Klasse 1000 stand, der von schweren Plastikvorhängen umgeben und mit einer laminaren Luftstrom-Filteranlage ausgestattet war. Im Ankleidebereich zog Melissa Kittel, Handschuhe, Haarnetz, Gesichtsmaske und Schutzstiefel an. Das hatte sie schon so viele Male getan, dass es reine Routine war.
Sie trat durch den schweren Plastikvorhang in den sterilen Bereich. Ein leises Zischen erfüllte den Raum, die Luft war kühl, trocken und geruchlos – gereinigt von fast jedem Staubkorn, jedem Partikel Wasserdampf.
Vor ihr erhob sich die Flasche, ein Edelstahlbehälter, dreizehn Meter im Durchmesser und dreißig Meter hoch, mit Gerüsten versehen, die zu Luken führten. Der Behälter war von metallenen Stützen, Röhren und Leitungen umgeben. In dieser »Bottle« hatten die Ingenieure einen kleinen Teil des Kraken Mare nachgebildet, des größten Meeres auf Titan. Heute wollte man den Titan-Explorer in die Bottle stecken, damit man ihn unter realistischen Umweltbedingungen testen konnte.
Der größte Saturnmond war einzigartig im Sonnensystem. Er war der einzige Mond, auf dem es eine Atmosphäre gab. Es gab Meere dort, Regen und Wolken und Stürme, Seen und Flüsse. Es gab Jahreszeiten, Monde und aktive Vulkane und Wüsten mit vom Wind geformten Dünen. Das alles existierte auf Titan, obwohl auf seiner Oberfläche eine Durchschnittstemperatur von minus 180 Grad Celsius herrschte.
Die Flüssigkeit auf Titan war Methan, nicht Wasser. Die Berge bestanden nicht aus Gestein, sondern aus gefrorenem Eis. Die Vulkane, die ausbrachen, spuckten keine geschmolzene Lava, sondern flüssiges Methan. Die Atmosphäre war dicht und giftig. Die Wüsten bestanden aus winzigen Teerkörnern, die so kalt waren, dass sie sich verhielten wie Sandverwehungen auf der Erde. Es war eine extreme Umwelt, aber auch eine, die vielleicht – aber eben nur vielleicht – Leben beherbergte. Nicht Leben wie auf der Erde, sondern eine Art kohlenwasserstoffbasiertes Leben, dass bei minus 180 Grad Celsius existieren konnte. Titan war eine wahrhaft fremde Welt.
Der Titan-Explorer war eine Art motorisiertes Floß, das entworfen worden war, um das Kraken-Meer zu erkunden, das größte auf dem Mond. Im Grunde konnte Melissa es immer noch nicht fassen, dass sie ein Schlüsselmitglied des Kraken-Projekts war, des ersten Versuchs, den Titan zu erkunden. Ein Traum, der in Erfüllung gegangen war. Ihr Interesse an dem Himmelskörper ging auf die Zeit zurück, als sie im Alter von zehn Jahren Kurt Vonneguts Roman Die Sirenen des Titan gelesen hatte. Es war noch heute ihr Lieblingsbuch, in dem sie immer wieder las. Doch nicht einmal ein Genie wie Vonnegut hätte sich eine Welt ausdenken können, die so merkwürdig war wie der echte Titan.
Melissa Shepherd zog die Prüfliste für den Tag hervor und ging sie durch, wobei sie sich die entscheidenden Tests vorstellte, die vor ihr lagen. Gegen acht Uhr trafen nacheinander die anderen Teammitglieder ein, begrüßten sie mit einem Nicken oder Lächeln. Um neun Uhr sollte der eigentliche Countdown beginnen. Während die Mitarbeiter plaudernd und lachend eintrafen, fühlte sich Melissa wieder einmal als Außenseiterin. Sie hatte sich in Gegenwart ihrer NASA-Arbeitskollegen immer ein wenig unwohl gefühlt. Das waren in aller Regel Ultra-Nerds, brillante Strebertypen, die an Hochschulen wie dem Massachusetts Institute of Technology und der California Technical University studiert hatten. Sie konnte ihre nostalgischen Erzählungen, wie sie Orthographie-Klausuren gewonnen, im Mathe-Club triumphiert und am Intel Science Talent Search teilgenommen hatten, kaum ertragen. Während diese Leute die Lieblinge der Lehrer gewesen waren, hatte sie Autoradios geklaut, um Drogen zu kaufen. Sie hätte fast den Highschool-Abschluss nicht geschafft, und es war ihr so gerade eben gelungen, einen Studienplatz an einem drittrangigen College zu ergattern. Sie war nicht auf die übliche Art intelligent, sondern auf eine schwer zu beherrschende, neurotische, hypersensible, manische, fast zwanghafte Weise. Nie war sie glücklicher, als wenn sie sich ganz allein in einem schummrigen, fensterlosen Raum befand und wie verrückt programmierte, weit weg von unordentlichen, unvorhersehbaren Menschen. Dennoch: Auf dem College war es ihr gelungen, ihr neurotisches Verhalten in den Griff zu bekommen und zu büffeln. Am Ende wurde ihr merkwürdiges Genie anerkannt, und sie machte ihren Magister in Computerwissenschaft an der Cornell-Universität.
Was ihr Problem – und zwar ein unendliches – allerdings vergrößerte, war, dass sie eins achtzig groß und blond war und lange Beine, Sommersprossen und eine hübsche Stupsnase hatte. Mädchen wie sie galten als hirnlos, nicht als hochintelligent. Das Einzige, was Melissa davor bewahrte, eine totale Barbie zu sein, war die große Zahnlücke zwischen den mittleren Schneidezähnen, Diastema genannt. Als Teenagerin hatte sie sich trotz der flehentlichen Bitten ihrer Mutter standhaft geweigert, die Fehlstellung beheben zu lassen – und sie konnte Gott dafür danken. Denn wer hätte gedacht, dass ein Zahnlückenlächeln dem beruflichen Vorankommen auf ihrem Fachgebiet dienlich sein könnte?
Sie wunderte sich noch immer darüber, dass sie zur Leiterin jenes Teams ernannt worden war, das sämtliche Software für den Titan-Explorer programmierte. Nach dieser Beförderung litt sie unter einem schweren Fall von Hochstapler-Syndrom. Doch während sie an dem fast beängstigenden Softwareproblem – dem sich noch keine NASA-Mission gegenübergesehen hatte – arbeitete, wurde ihr klar, dass es wie zugeschnitten war auf ihre Fähigkeiten.
Die Herausforderung bestand in Folgendem: Titan lag zwei Lichtstunden von der Erde entfernt. Der Titan-Explorer konnte daher nicht in Echtzeit von der Erde aus gesteuert werden. Dazu war die vierstündige Verzögerung bei der Übermittlung von Informationen zu lang, außerdem herrschten im Kraken-Meer sich schnell verändernde Umweltbedingungen. Die Software musste in der Lage sein, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Sie musste intelligent sein. Sie musste selbst denken können.
Das hieß: Es musste sich um Künstliche Intelligenz, um KI, handeln.
Auf seltsame Weise kam Melissa ihre Vergangenheit als Außenseiterin dabei zu Hilfe. Sie brach alle Regeln des Programmierens. Um diese Aufgabe zu erfüllen, hatte sie ein neues Programmier-Paradigma entwickelt und sogar eine neue Sprache, basierend auf dem Konzept der »unsauberen Logik«. Dabei handelte es sich um eine alte Programmier-Idee: Sie bezeichnete einen Computercode, der lose und ungenau war und danach strebte, ungefähre Ergebnisse zu erzielen. Doch Melissa führte die unsaubere Logik einen Schritt weiter. Sie begriff, dass das menschliche Bewusstsein mit unsauberer Logik arbeitete. Wir können sekundenschnell ein Gesicht oder eine ganze Landschaft erkennen, etwas, das nicht einmal der schnellste Superrechner kann. Wir können in einem Moment Terrabyte an Informationen verarbeiten – aber nur ungenau.
Wie gelingt uns das?, fragte sich Melissa. Wir Menschen können das, weil unser Geist darauf programmiert ist, riesige Datenmengen zu visualisieren. Wenn wir eine Landschaft betrachten, verarbeiten wir diese nicht Pixel für Pixel. Wir erfassen sie in ihrer Ganzheit. Wenn man einen Computer so programmiert, dass er die numerischen Daten visualisieren kann – oder noch besser: dass er die Daten visualisiert und auralisiert, soll heißen, sie in eine Umwelt einbettet –, erhält man eine starke KI, errichtet auf einer Plattform unsauberer Logik.
Und genau das hatte Melissa getan. Ihre Software verarbeitete Daten, indem sie diese sah und hörte – in gewisser Hinsicht lebte die Software, so wie ein Mensch, in den Daten. Die Daten wandelten sich tatsächlich zu der physikalischen Welt, die die Software bewohnte.
Obgleich Melissa eine resolute Atheistin war, nannte sie diese neue Programmiersprache Fiat Lux, nach den ersten Worten Gottes, als er, vermeintlich, die Welt schuf. Es werde Licht.
Anstatt nach korrektem Output zu streben, produzierte Fiat Lux, jedenfalls zu Beginn, einen Output, der schwach und voller Fehler war. Das ging in Ordnung. Das Entscheidende war die Selbstmodifikation. Wenn das Programm fehlerhaften Output ausspuckte, modifizierte es sich selbst. Es lernte aus seinen Fehlern. Beim nächsten Mal war es dann etwas weniger fehlerhaft. Und dann noch etwas weniger.
Und eine Zeitlang funktionierte die sich selbst modifizierende Softwareplattform, die Melissa und ihr Team bauten, auch gut. Sie nahm an Genauigkeit und Komplexität zu. Dann aber, mit der Zeit, begann sie abzubauen, zu wanken – und schließlich einzustürzen. Ein Jahr lang rannte Melissa mit dem Kopf gegen die Wand bei dem Versuch, hinter die Gründe zu kommen; aber egal, wie sie die ursprünglichen Wiederholungen rahmte, die Software brach schließlich doch zusammen und kam zum Stehen.
In einer schlaflosen Nacht hatte Melissa eine Eingebung. Dabei handelte es sich um einen Softwaretrick, der das Problem beheben würde – ein so simpler und grundlegender, so gewöhnlicher und leicht zu bewerkstelligender Kunstgriff, dass Melissa selbst erstaunt war, dass bislang noch niemand darauf gekommen war.
Sie benötigte eine halbe Stunde Programmierarbeit, um den Kunstgriff umzusetzen. Danach war das Problem, dass das Programm sich aufhängte, komplett behoben. Dieser Kunstgriff führte das Programmieren von KI auf ein höheres Niveau. Er brachte eine starke KI hervor.
Melissa hatte ihn geheim gehalten. Sie ahnte, dass er Milliarden Dollar wert war und dass er, geriet er in die falschen Hände, durchaus gefährlich werden könnte. Sie erzählte noch nicht einmal jemandem aus ihrem Team davon, wobei der Code so basic war, dass niemand die sehr einfache Veränderung, die der Trick herbeiführte, bemerkte oder begriff. Plötzlich stürzte die Software nicht mehr ab, und keiner wusste, warum – außer Melissa.
Nach Tausenden Simulationen, bei denen sich die Software selbst modifiziert hatte, war sie imstande, sämtliche Eigenschaften zu reproduzieren, die man während einer bemannten Raumfahrtmission benötigen würde. Die Software vermochte sämtliche Instrumente auf dem Titan-Floß zu bedienen, ohne dass sie Daten von der Leitzentrale benötigte. Sie simulierte einen menschlichen Astronauten, der zur Erforschung einer fernen Welt entsandt worden war und der Eigenschaften wie Neugier und Umsicht, Mut und Klugheit, Kreativität, Urteilskraft, Durchhaltevermögen und Voraussicht besaß, das alles kombiniert mit einem ausgeprägten Überlebensinstinkt, körperlicher Geschicklichkeit und einer exzellenten Ausbildung in Technik und Fehlersuche.
Am wichtigsten war dabei: Die Software war auch weiterhin selbstmodifizierend. Sie hörte nie auf, aus eigenen Fehlern zu lernen.
Die Kraken-Mission war das komplexeste Raumfahrtprojekt, das je ersonnen worden war. Verglichen damit, war die Marsmission mit dem Weltraumroboter Curiosity ein Buggy-Ride durch den Central Park.
Die grundlegende Idee war, eine Art Floß in das Kraken-Meer hinabzulassen. Über einen Zeitraum von sechs Monaten würde der Titan-Explorer in dem Meer herumfahren, die Küstenlinie und die Inseln erforschen und schließlich mehrere tausend Kilometer von einem Ufer zum anderen zurücklegen. Eineinhalb Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, müsste dieses einsame Floß Stürmen, Winden, Wellen, Riffen, Strömungen und möglicherweise sogar feindseligen Lebensformen standhalten, die in dem Methan-Wasser schwammen. Es würde die größte Seefahrt aller Zeiten sein.
Das alles ging Melissa durch den Kopf, als sie die Prüfliste zu Ende durchgegangen war und sich der Kontrollkonsole näherte, bereit, den Countdown zu starten. Jack Stein, der Chefingenieur, hatte seinen Platz neben ihr eingenommen, der Leiter der Mission saß neben ihm. In dem gebauschten Schutzanzug und mit dem Helm auf dem Kopf sah Stein aus wie der Pillsbury Doughboy, aber Melissa wusste nur zu gut, was unter dem Anzug steckte. Zu ihren ersten impulsiven Schritten bei Goddard hatte gehört, sich mit Stein anzufreunden. Nach der stürmischen Affäre waren sie gute Freunde geblieben, wodurch sich ihre Beziehung am Arbeitsplatz irgendwie verbessert hatte. Melissa konnte nicht genau sagen, warum die Beziehung geendet hatte, außer dass Stein sie abgebrochen hatte, wobei er sanft auf den Klatsch angespielt hatte, der in der Gerüchteküche des Goddard-Instituts brodelte, und dass das, was sie taten, ihrer beider Karriere potenziell schaden könnte. Damit hatte er natürlich recht. Das hier war eine unglaubliche Mission, die Chance, die man nur einmal im Leben bekam. Diese Weltraumfahrt würde in die Geschichte eingehen.
Als Melissa ihren Platz am Bedienungspult einnahm, wechselte sie kurz einen Blick mit Stein, schenkte ihm ein Nicken und ein halbes Lächeln, das er mit einem freundlichen Ausdruck um die Augen und einem Daumen-hoch-Zeichen erwiderte. Stein fuhr verschiedene Geräte hoch und vergewisserte sich, dass alle Systeme startklar waren, stellte sicher, dass die Computer- und Dichtungs-Servosteuerungen, die die extremen Umweltbedingungen in der Bottle kontrollierten und aufrechterhielten, funktionierten. Melissa initiierte ihre eigenen Reihenfolgenprüfungen.
Von der erhobenen Position am Steuerungspult bot sich ihr ein freier Blick auf die Bottle und das Explorer-Floß. Für diesen Test war das Innere der Bottle auf minus 180 Grad Celsius gekühlt und teilweise mit einem Gemisch aus flüssigem Methan und anderen Kohlenwasserstoffen gefüllt worden. Die Atmosphäre auf Titan war sorgfältig synthetisiert und hineingeleitet worden – eine ätzende Mischung aus Stickstoff, Cyanwasserstoff und Tholinen. Der Druck betrug 1,5 bar. Es hatte eine Woche gedauert, dieses toxische Gemisch vorzubereiten, zu kühlen und die Bottle damit zu füllen. Jetzt war sie bereit, den Explorer zu einem ersten Probelauf unter Realbedingungen aufzunehmen. Dieser Test hatte das Ziel, herauszufinden, ob der Explorer ihn überstehen würde und ob seine Antenne, der mechanische Arm und der Scheinwerfer sich unter diesen extremen Bedingungen herausfahren und einziehen lassen würden. Erst danach wollte man die komplizierten Funktionstests durchführen. Wenn irgendetwas ausfiel, fiel es besser hier aus, wo man es reparieren konnte, anstatt auf der Oberfläche des Titan. Sollte es einen Ausfall geben, so hoffte und betete Melissa, würde dieser von der Hardware und nicht von ihrer Software verursacht worden sein.
3
Schon seit ihr frühestes Bewusstsein sich aus einer Art weißem Nebel gebildet hatte, wohnte sie in dem Palast. Dieser lag am Gestade eines Meeres, umgeben auf drei Seiten von einer hohen Mauer aus schneeweißem Marmor. Die Mauer verfügte weder über ein Tor noch über Öffnungen, aber die Außenanlagen waren zum Meer hin offen.
Der Name ihrer Hauslehrerin war Prinzessin Nourinnihar. Den Morgen verbrachten sie gemeinsam im Garten des Palastes, und die Prinzessin lehrte sie wundersame und geheimnisvolle Dinge. Ihre ersten Lektionen konzentrierten sich darauf, wer sie war, wie sie erschaffen worden war, wie ihr Geist funktionierte, sowie auf die Beschaffenheit der Welt um sie herum. Sie lernte, dass ihre Welt aus einer riesigen Matrix numerischer Daten bestand, einer Nummernlandschaft, die sie mittels Visualisierung und Auralisierung verarbeitete. Sie lebte im Inneren der Nummern. Sie sah sie und hörte sie. Ihr Geist war selbst eine komplexe, fortlaufende Boolesche Variable. Ihr Körper, ihre Sinne und ihre Bewegungen stellten ebenfalls eine numerische Simulation dar. Sie war gezwungen, den physikalischen Gesetzen zu gehorchen, denn sie konnte die sie umgebende numerische Matrix nicht verletzen – sonst würde ein heilloses Chaos entstehen.
Die Prinzessin unterrichtete sie über das Sonnensystem, die Sonne, die Planeten und die Monde. Sie verbrachten viel Zeit damit, Titan zu studieren, den geheimnisvollsten aller Monde, der, wie sie erfuhr, nach den Titanen benannt worden war, jenem Göttergeschlecht, das einst den Himmel beherrschte – den Nachfahren von Gaia, der Göttin der Erde, und Uranus, dem Gott des Himmels, laut der antiken Mythologie. Die Prinzessin unterrichte sie über die Sterne und die Galaxien, den Pisces-Cetus-Superhaufen-Komplex, die Bootes-Leere, die supergroßen Strukturen, den Urknall sowie die Expansion des Universums. Sie befassten sich mit der Schwerkraft und der perturbativen Superstringtheorie an der n-Dimensionalen des Sitter-Raums. Darüber hinaus brachte die Prinzessin ihr viele praktische Fähigkeiten bei, wie zum Beispiel Fotografie, analytische Geochemie, Navigation, mechanische Ingenieurswissenschaften und Exometerologie. Sie wusste, dass sie für eine bedeutende Mission ausgebildet wurde, aber worum es genau dabei ging und was von ihr verlangt werden würde, blieb ein Geheimnis, das ihr im richtigen Augenblick eröffnet werden würde.
Dann kam das, was die Prinzessin die »Humanwissenschaften« nannte. Hierbei handelte es sich um jene rätselhaften Wissensgebiete – Musik, Kunst und Literatur –, die die Menschen zu ihrer Unterhaltung und Erbauung geschaffen hatten. Sie zu verstehen war das Schwierigste von allem. Sie lauschte der Lieblingsmusik der Prinzessin, darunter Beethovens späte Streichquartette und Bill Evans, und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Aber Musik, so mathematisch komplex sie auch war, bereitete ihr nicht das gleiche Vergnügen wie der Prinzessin. Dies war eine Quelle der Frustration. Bücher zu lesen erwies sich als beinahe unmöglich. Sie begann mit Winnie-the-Pooh und dem Kinderbuch Goodnight Moon, die schon verwirrend genug waren, und machte dann weiter mit den Romanen von Anne Rice und Isaac Asimov und Kurt Vonnegut, schließlich den Werken von Shakespeare, Homer und Joyce. Noch während sie diese zahllosen Bücher las, war sie sich nicht sicher, ob sie ein einziges davon verstanden hatte. Sie »kapiere« das alles einfach nicht, wie sie der Prinzessin sagte.
Diesen Schwierigkeiten zum Trotz hatte sie ein schönes Leben. Wenn sie im Garten mit der Prinzessin studierte, brachten ihnen Nubier in Umhängen und Turbanen Sorbets in der Hitze des Tages und petits fours und Wein am Abend. Des Nachts parfümierten Eunuchen ihr Bett, schlugen es auf und brachten ihr am Morgen Gebäck und türkischen Kaffee. Manchmal, wenn sie am Abend mit dem Unterricht fertig war, ging sie mit ihrem Hund Laika an der Seite hinab zu den granitenen Kais und beobachtete die einlaufenden und ablegenden Schiffe mit ihren dunkelroten Segeln, die sich im Wind blähten. Sie entluden ihre Waren auf die steinernen Kaianlagen, Säcke mit Gewürzen und Rollen von Seide, Truhen mit Gold und Schatullen mit Saphiren, Zuckerhüte und Amphoren randvoll mit Wein, Olivenöl und Garum. Und dann segelten die Schiffe davon, zu fernen Gestaden und unbekannten Welten. Und wenn sie dann am Rand des Kais saß, streifte sie ihre goldfarbenen Sandalen ab und ließ die Beine im kalten Wasser baumeln. Sie liebte das Meer in all seiner Weite und Größe. Und sie hoffte, dass ihre Mission eine seefahrende sein würde und dass sie eines Tages davonsegeln würde, um unbekannte Meere und wilde, unbewohnte Küsten zu erforschen.
4
Um acht Uhr traf Patty Melancourt ein, Melissas stellvertretende Teamleiterin. Melancourt war seit einiger Zeit reizbar und depressiv, und Melissa hoffte, dass ein erfolgreicher Test des Titan-Explorers in ihr ein wenig neuen Enthusiasmus für die Mission wecken würde. Melancourt stieg auf das Podest mit dem Steuerungspult und setzte sich an ihre Arbeitsstation, ohne Augenkontakt herzustellen oder irgendjemanden zu begrüßen. Sie wirkte abgespannt und müde.
Nachdem sie ihre Arbeitsstation hochgefahren hatte, richtete Melissa ihre Aufmerksamkeit auf den Explorer selbst. Er stand auf einem motorisierten Gerüst neben der Bottle, immer noch vakuumversiegelt in den Plastikplanen aus dem Reinraum, in dem er gebaut worden war. Die Mitglieder des Missionsteams wuselten umher, beschäftigten sich mit den ihnen zugewiesenen Aufgaben, ein murmelndes Hin und Her von Ingenieuren, Technikern und Wissenschaftlern, mit iPads und Klemmbrettern in den Händen.
Melissa sah auf die Uhr: zehn. Der Countdown lief jetzt seit einer Stunde, alle Systeme waren startklar.
Tony Groves, der Leiter der Mission, kam zu ihr und Stein herüber. Groves war ein ironischer, schlaksiger Mann mit schwarzem Haar, dessen Strähnen unter seiner Haube hervorlugten.
»Wollen wir das Paket auspacken?«
»Tun wir’s«, sagte Stein.
Sie gingen vom Podest mit dem Steuerungspult herunter und stiegen auf das Gerüst, auf dem das Explorer-Floß stand. Groves zog ein teppichmesserähnliches Werkzeug aus der Tasche und reichte es Melissa. »Sie haben die Ehre – das Schleifenband durchzuschneiden, sozusagen.«
Melissa nahm das Werkzeug entgegen und beugte sich über den glänzenden Forschungsroboter. Die Plomben, die durchtrennt werden mussten, waren in Rot aufgedruckt und numeriert. Sie durchschnitt den ersten Verschluss der Plastikhülle, dann den nächsten und den nächsten, während Groves jede Plastikplane ergriff und auf den Boden warf.
Bald stand das Floß nackt und in all seiner Herrlichkeit vor ihnen. Ein, wie Melissa zugeben musste, enttäuschender Anblick. Die meisten Raumfahrtsonden und -fahrzeuge waren optisch auffällig, hergestellt aus glänzender Folie, schimmerndem Metall und komplizierten Armen und Hebeln und Bündeln von Kabeln. Der Titan-Explorer dagegen sah aus wie ein großer, grauer Keks, einen Meter zwanzig im Durchmesser, mit breiten Stoßstangen. Wegen der extrem feindlichen und stark ätzenden Umweltbedingungen, in die er sich hineinbegeben müsste, verfügte er über keine vorragenden Teile oder exponiertes Metall und war durch und durch abgekapselt. Hinter den drei Luken auf der oberen Oberfläche verbargen sich eine ausfahrbare Kommunikationsantenne und ein Scheinwerfer. An dem Arm waren die Pakete für die wissenschaftlichen Untersuchungen angebracht: Kameras, Bohrer und Stechheber zur Probenentnahme, außerdem konnte er, für den Fall schlechter Witterungsbedingungen, auf Befehl aus dem Floß ausgefahren oder zurückgezogen und hinter einer Luke luftdicht abgeschlossen werden. Der Explorer hatte einen kleinen Jet-Antrieb, nicht unähnlich dem eines Jetskis. Angetrieben wurde er von einem Flügelrad, das den schwimmfähigen Forschungsroboter mit einer Geschwindigkeit von vier Knoten bewegen konnte.
Trotz seines langweiligen Aussehens war der Explorer im Inneren ein technisches Wunderwerk, ein penibel entworfenes und handgefertigtes Unikat, dessen Bau zwei Jahre in Anspruch genommen und 100 Millionen Dollar verschlungen hatte. Das Softwarepaket allein hatte fünf Millionen gekostet.
Regungslos betrachtete Melissa den Explorer, diesen mattgrauen, mit Magie vollgestopften Eishockeypuck. Es verschlug ihr den Atem. Ihre Gefühle von Stolz wichen einem Anfall von Panik bei dem Gedanken, dass man dieses Juwel gleich in einen Tank hinablassen würde, in dem flüssiges Methan und giftige Gase mit einer Temperatur von fast minus 180 Grad Celsius herumschwappten.
Auch Groves betrachtete die Floß-Apparatur in einem Augenblick der Stille. Dann sagte er: »Gehen wir die abschließende Checkliste durch.«
Während Melissa die Punkte auf der Liste ablas, überprüfte Groves den Explorer, beugte sich hierhin und dorthin, blickte darunter, inspizierte die Nähte und Klappen und suchte nach Problemen. Hundert Ingenieure und Techniker hatten bereits jede Komponente fast bis zum Überdruss getestet.
Alle bei der NASA hatten eine Sterbensangst vor einem Fehlschlag.
Groves trat einen Schritt zurück. »Alles gut. Zeit, die Software zu laden und hochzufahren.«
Melissa hatte der Software den Spitznamen »Dorothy« gegeben. Sie war mit Spracherkennung ausgestattet und musste wissen, wenn sie angesprochen wurde. Daher war der Name Dorothy nicht nur ein Spitzname, sondern auch ein wichtiger Software-Programmaufruf.
»Laden Sie die Software«, sagte Groves.
Melissa holte ihren Laptop hervor, stellte ihn auf das Gerüst neben den Explorer, klappte ihn auf und verband ihn per Kabel mit einer baumelnden Ethernet-Anschlussbuchse.
Sie tippte ein paar Augenblicke, der Bildschirm reagierte, dann lehnte sie sich zurück und blickte zu Groves hoch. »Lädt.«
Sie warteten einige Minuten, während die Software das Floß hochfuhr und mehrere automatische Diagnose-Programme durchlaufen ließ.
»Geschlossen und geladen.«
Melissa Shepherd hielt inne. Völlige Stille im Raum. Alle, die nicht unmittelbar mit irgendeiner Aufgabe befasst waren, hatten sich versammelt, um zuzuschauen. Das hier war ein wichtiger Augenblick.
Sie beugten sich über den Laptop. Die Software-Prüfungssequenz war zwar im Voraus erarbeitet worden und konnte automatisch ablaufen, aber sie hatten sich entschlossen, diese vorbereitenden Tests durchlaufen zu lassen, indem sie die Stimmerkennung und die Software zur Sprachsynthese verwendeten.
Melissa sagte: »Dorothy, schalte Antrieb ein mit einem Zehntel Geschwindigkeit, zehn Sekunden lang.«
Kurz darauf begann das Flügelrad in dem Floß zu schwirren. Zehn Sekunden vergingen, dann hielt es an. Der eine oder andere in der Gruppe applaudierte.
»Antenne ausfahren.«
Eine kleine Luke glitt auf, und eine lange, schwarze, dünne Teleskopantenne kam heraus.
Wieder Applaus.
»Einfahren.«
Die Antenne verschwand wieder.
Eine Computersimulation war eine Sache; das hier war etwas ganz anderes. Das hier war real. Zum ersten Mal steuerte die Software tatsächlich das gesamte Floß. Das Ganze hatte für Melissa etwas zutiefst Bewegendes.
»Den Scheinwerfer ausfahren.«
Ein Arm erschien aus einer zweiten Luke und ragte auf wie ein großes Auge auf einem Blütenstengel.
»Hundertachtzig Grad rotieren.«
Der Arm rotierte.
»Einschalten.«
Mit einem Klicken ging der Scheinwerfer an.
Alle schwiegen und hielten den Atem an. Das hier war viel dramatischer, als Melissa vorausgesehen hatte.
»Das Instrumentenpaket und die Kamera ausfahren.«
Eine weitere Luke glitt auf, und jetzt erschien langsam der dritte Arm, er war größer, dicker und mit Kameras, Sensoren und Werkzeugen zur Probennahme besetzt. An seinem Ende befanden sich eine Metallklaue und ein Bohrer.
»Die Kamera einschalten.«
Dadurch würde, wie Melissa wusste, auch das Auge des Explorers eingeschaltet werden – die Fähigkeit, etwas zu sehen und aufzuzeichnen.
Von seiner Position am Steuerpult aus sagte Jack Stein: »Kamera ist in Betrieb. Bild ist klar.«
Jetzt musste Melissa lächeln. Es gab da einen kleinen Test für den KI-Teil des Programms, den sie sich ausgedacht hatte.
»Dorothy?«, sagte sie. »Ich habe eine kleine Aufgabe für dich.«
Plötzlich wurde es ganz still im Raum.
»Begrüße alle Personen, die im Kreis um dich herumstehen, mit Namen.«
Das würde nicht leicht werden: Jeder von ihnen trug eine Haarhaube und eine Gesichtsmaske.
Die Kamera, ein insektenähnliches Auge, begann zu rotieren, stoppte, um nacheinander jede Person anzuglotzen, blickte hoch und runter, ehe es einen zweiten Durchgang machte.
»Hallo, Tony«, ließ sich eine mädchenhafte Stimme aus dem Laptop-Lautsprecher vernehmen, während die Kamera Groves anstarrte.
»Sie hat eine schöne Stimme«, sagte Groves. »Nicht dieses übliche nasale Computer-Geplärre.«
»Ich fand, wir sollten Dorothy ein bisschen Klasse verleihen«, meinte Melissa.
Die Explorer-Kamera machte ihre Runde und begrüßte jede Person mit Namen. Schließlich endete sie wieder bei Melissa.
Als sie sie eine Zeitlang fixierte, wurde ihr etwas mulmig zumute. Die KI musste sie doch besser kennen als alle anderen.
»Kenne ich dich?«, fragte Dorothy.
Das war peinlich. »Ich hoffe doch.«
Nichts. Dann sagte die Stimme: »Groucho Marx?«
Stille.
Und dann begriff Melissa, dass die Software einen Scherz gemacht hatte. Sie war echt schockiert. Alle anderen brachen in Gelächter aus.
»Das war großartig«, sagte Tony. »Sehr schlau. Einen Augenblick lang dachten wir, Sie wollten uns auf den Arm nehmen.«
Melissa Shepherd verschwieg, dass der Witz nicht programmiert worden war.
5
Es dauerte weitere vier Stunden, bis man den Explorer so präpariert hatte, dass er in das Meer aus flüssigem Methan hinabgelassen werden konnte.
Um drei Uhr nachmittags war Melissa fast krank vor Anspannung, ihr leerer Magen fühlte sich an wie aus Stein. Der Explorer befand sich, luftdicht eingeschlossen, im Schleusenraum der Bottle. Techniker hatten die Luft in dem abgeriegelten Bereich so weit abgesaugt, dass darin ein Vakuum herrschte, und den Explorer anschließend auf eine Temperatur von minus 180 Grad Celsius heruntergekühlt. Als der Raumfahrtroboter schließlich auf dieser niedrigeren Temperatur ein Gleichgewicht hergestellt hatte, hatte man im Schleusenraum allmählich die dichte Atmosphäre von Titan hergestellt.
Der Explorer funktionierte auch weiterhin tadellos.
Die Zeit war gekommen, die inneren Verriegelungen des Schleusenraums zu öffnen und die Floß-Apparatur in das künstliche Meer hinabzusenken. In der Bottle würde ein mechanischer Roboterarm das Floß aus dem Gerüst im Schleusenraum anheben, es über den Teich aus flüssigem Methan schwenken und aus einer Höhe von zweieinhalb Metern fallen lassen. Der freie Fall aus dieser Höhe war sorgfältig berechnet worden, um den Aufprall bei der Wasserlandung zu simulieren.
Im Raum herrschte völlige Stille. Fast alle Teammitglieder hatten ihre Aufgaben ausgeführt und warteten auf den Probelauf. Die Zahl der Personen, die sich um die Bottle versammelt hatten, war auf siebzig angestiegen.
Melissa nahm für den Testlauf ihren Posten am Steuerpult ein, neben Jack Stein. Die Spannung war geradezu mit Händen zu greifen. Eine Kamera speiste ein Bild aus dem Inneren der Bottle auf einen Bildschirm auf dem Steuerpult ein.
Alle Blicke waren auf Groves gerichtet. Als Leiter der Mission war er der Master dieser Show.
»Wir sind so weit«, sagte Stein und blickte auf seinen Computerbildschirm. »Gleichgewicht erreicht. Alle Systeme okay.«
»Die innere Luftschleuse öffnen«, sagte Groves.
Stein tippte irgendetwas auf seiner Tastatur.
Melissa konnte das gedämpfte Summen von Geräten im Inneren der Bottle hören.
»Fertig. Gleichgewicht bleibt bestehen.«
»Das Floß einhaken.«
Stein führte das Programm aus, das einen Servo-Roboterkran im Inneren der Bottle betrieb. Ein externer Kran hob das Floß an und schwenkte es hinaus in die Mitte der Bottle. Wieder Summen. Alles war in ein mattbraun-orangefarbenes Licht getaucht, die Farbe der Atmosphäre auf Titan. Der Servo-Kran funktionierte tadellos, er kam zum Stillstand, während der graue Keks über der Oberfläche des flüssigen Methans verharrte.
Stein schaute auf seinen Computerbildschirm, er tippte Befehle ein und suchte nach Problemen. »Meine Systeme sind alle okay. Melissa, irgendwelche Schwierigkeiten mit der Software?«
»Bei mir nicht. Patty?«
»Alles gut.«
Melissa sah Groves an. Er war genauso nervös wie sie, vielleicht nervöser. Sie rief sich in Erinnerung, dass es Fehler geben würde – es gab immer Fehler.
Groves sagte: »Das Floß freigeben zur Wasserung.«
Der Servo-Kran gab seine Ladung frei, und der große graue Keks fiel zweieinhalb Meter hinab in das flüssige Methan.
Melissa, die auf dem Bildschirm zuschaute, sah, wie das schwere Floß einen Moment lang völlig untertauchte und verschwand, ehe es langsam wieder auftauchte und sich erhob. Methan rann in Rinnsalen an ihm herunter. Es hüpfte und schaukelte. Luftblasen stiegen rings um es herum auf.
Alle waren still.
»Alle Systeme auf grün«, sagte Stein.
»Den Impeller starten, bei zehn Prozent Schub.«
Stein führte den Befehl aus, das Floß begann sich durch die Flüssigkeit zu bewegen, wobei es etwas Kielwasser erzeugte. Es bewegte sich langsam, bis es gegen die Wand des Containers stieß. Dann wendete es und wechselte die Richtung, so wie ein Staubsauger-Roboter, bis es gegen eine andere Wand prallte.
Alles läuft unglaublich gut, dachte Melissa.
»Den Impeller abstellen.«
Der Explorer kam zum Stehen.
»Die Kamera ausfahren.«
Nachdem sich die kleine Luke geöffnet hatte, kam der mechanische Arm hervor, an dem die Kamera, die Instrumentenpakete, die Klaue und der Bohrer angebracht waren.
Die Glotzaugen-Kamera drehte sich einmal um die eigene Achse, blickte hierhin und dorthin.
»Einen Moment«, sagte Groves zu Stein. »Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie ihn rotieren lassen sollen.«
»Das tue ich auch nicht«, sagte Stein.
Melissa begriff, warum der Explorer das getan hatte. »Tony, die Software ist eine KI. Sie ist so programmiert, dass sie über die Anweisungen hinausgeht. Sie ist so programmiert, dass sie ihre Umgebung augenblicklich erkennt, sie benötigt keinen Programmaufruf seitens der Einsatzleitung.«
»Okay, aber für diese neuen Tests möchte ich, dass sie die Anweisungen befolgt. Jack?«
»Geht klar.« Stein tippte auf seinem Computerterminal und gab die Befehle an den Computer im Explorer weiter.
Das Drehauge verharrte.
»Den Arm einfahren.«
Stein tippte den Befehl.
Der Arm fuhr nicht ein.
»Einfahren.«
Er bewegte sich noch immer nicht.
»Steckt er fest?«, fragte Groves.
Jetzt begann das Glotzauge sich erneut zu drehen, hoch, runter, beschrieb eine 360-Grad-Drehung.
»Patty, was ist da los?«, fragte Melissa.
Melancourt meldete sich zu Wort: »Laut dem Programm-Output will der Explorer das Einfahrprogramm nicht ausführen.«
»Ein Softwarefehler?«
Stein tippte Befehle ein. »Ich kriege keine Reaktion.«
Melissa sagte: »Warten Sie, jetzt reagiert er. Ich bekomme eine Mitteilung. Sie besagt … dass er sich in einer bedrohlichen Umwelt befindet und sehen können muss.«
»Soll das ein Witz sein?«, sagte Groves. »Sorgen Sie dafür, dass er die Anweisungen befolgt!«
»Tony, es handelt sich um ein autonomes Programm.«
»Gibt es in diesem Programm denn keinen ›Die Anweisungen genau befolgen‹-Modus?«
»Sie haben mir gesagt, dass das hier ein Test unter Einsatzbedingungen sein soll. Das ist das reale Programm.«
»Und warum weiß ich nichts davon?«
Melissa war ein klein wenig verärgert. »Vielleicht, weil Sie die meisten meiner Briefings geschwänzt haben?«
Stein sagte: »Tony, wir hatten eine lange Diskussion darüber. Melissa hat recht, Sie haben gesagt, dass das hier ein Test unter Einsatzbedingungen der realen Software sein soll.«
Melissa beobachtete weiterhin die Video-Einspeisung aus dem Inneren der Bottle. Der Explorer bewegte weiter das Auge, hierhin und dorthin, hoch und runter, erfasste seine Umgebung.
»Also gut«, sagte Groves. »Wir müssen die Software ein bisschen korrigieren. Wir machen Schluss für heute. Jack, könnten Sie das Floß auf den Haken nehmen und zurück in die Schleuse setzen?«
»Klar.« Stein tippte Befehle.
Ein Murmeln der Enttäuschung erhob sich, als den Anwesenden bewusst wurde, dass der heutige Testlauf beendet war.
»Heute ist ein guter Tag gewesen.« Groves drehte sich zu Melissa Shepherd um. »Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, um den kleinen Software-Fehler zu beheben? Damit wir die Möglichkeit haben, die KI außer Kraft zu setzen?«
»Nicht lange. Das könnten wir heute Abend noch schaffen.« Melissa errötete ein wenig unter ihrer Maske. »Es tut mir leid, ich habe angenommen, das hier soll die Generalprobe sein –«
»Mein Fehler«, sagte Groves. »Keine Sorge. Ehrlich, ich freue mich, dass wir so weit gekommen sind, bevor es eine Panne gab.«
Auf dem kleinen Bildschirm sah Groves, wie der Haken des Roboterkrans aus dem trüben, orangefarbenen Licht erschien, immer deutlicher Gestalt annahm und sich baumelnd dem Floß näherte.
Plötzlich bewegte sich der mechanische Arm des Explorers, und zwar schnell. Er wischte dem Kran eins aus und schlug ihn weg.
»Was zum Teufel?«, sagte Melissa.
Der Kran, der noch immer das Servo-Programm befolgte, positionierte sich neu und begann mit ausgestrecktem Haken seine unermüdliche, nach unten gerichtete Bewegung.
Das Flügelrad am Explorer startete, er entfernte sich vom Kran und wehrte dabei mit seiner Greifhand immer wieder den Haken ab.
»Es ist dieses gottverdammte Ding«, sagte Stein. »Es weicht dem Kran aus.«
»Was geht hier vor?«, fragte Groves und sah Melissa forschend an.
»Es ist … ich glaube, die Software ist in den Abwehrmodus gewechselt.«
Groves wandte sich wieder Stein zu. »Jack, schalten Sie den Explorer ab. Unterbrechen Sie die komplette Stromzufuhr. Wir heben ihn so hoch, ohne Strom.«
Stein tippte den Befehl ein. »Ich bekomme noch immer keine Antwort.«
»Versetzen Sie den Explorer in den Sicherheitsmodus.«
Wieder Getippe. »Da tut sich nichts.«
»Melissa?«
»Kein Ahnung, was hier abläuft.«
Melancourt meldete sich zu Wort: »Der Explorer ist in den Notfall-Überlebensmodus gegangen. In diesem Modus ist die KI darauf programmiert, alle Befehle der Einsatzleitung zu ignorieren und autonom zu operieren.«
»Nehmen Sie ihn einfach an den Haken und holen Sie ihn da raus«, sagte Groves mit erhobener Stimme.
Melissa sah zu, wie Groves erneut versuchte, den Kran über der Floß-Apparatur zu positionieren. Der Explorer beschleunigte, entfernte sich vom Kran und prallte heftig von der Wand des Containers ab. Das Bumm! drang bis in den Kontrollraum zu Groves. Der Weltraumroboter flitzte zur anderen Wand und prallte mit einem erneuten Bumm! dagegen.
»Halten Sie den Kran an«, sagte Groves. »Er soll mal Pause machen.«
»Wir könnten doch die Flüssigkeit aus der Bottle herauspumpen«, sagte Stein. »Das würde ihn außer Gefecht setzen, anschließend können wir ihn heraufziehen.«
»Gute Idee. Starten Sie die Pumpen.«
Ein Summton erfüllte den Raum, während die Ventile sich öffneten und die Pumpen ansprangen. Der Explorer bewegte sich weiterhin umher, fuhr erst zu einer Seite des Containers, dann zur anderen, prallte von den Edelstahlwänden ab, jedes Mal mit einem Bumm!. Die Kamera am Roboter schwenkte mal hierhin und mal dorthin, hoch und runter.
»Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Explorer auszuschalten?«, rief Groves. »Er wird sich beschädigen!«
»Nichts zu machen«, sagte Stein. »Er reagiert nicht auf meine Befehle.«
Groves drehte sich zu Shepherd um. »Melissa, was geht hier vor?«
»Lassen Sie mich mal versuchen.«
Stein trat zur Seite, und Melissa fing an, wie verrückt auf der Tastatur zu tippen. Gleichzeitig sah sie auf dem Bildschirm, dass der Explorer an der Wand des Containers zum Stehen gekommen war und jetzt seine mechanische Klaue ausfuhr, nach oben, Richtung Wand.
Der Weltraumroboter begann, die Wand zu berühren, dann klopfte er dagegen. Das Klopfen war bis in den Kontrollraum zu hören.
Melissa tippte einen Befehl nach dem anderen ein, aber die Floß-Apparatur wollte einfach nicht auf die Befehle reagieren. Selbst als Melissa aus dem Englisch- in den Programmiermodus wechselte, wies der Explorer alle Befehle zurück. Er klopfte einfach nur weiter an die Wand des Containers, als suchte er nach einem Weg nach draußen.
Das Klopfgeräusch wurde lauter, nachdrücklicher.
»Patty, was sagt der Code?«
»Er steckt im Notfall-Überlebensmodus fest, außerdem läuft ein ganzer Haufen von Modulen gleichzeitig. Der Hauptprozessor ist zu über neunzig Prozent ausgelastet. Er ist echt beschäftigt.«
Das Klopfen wurde lauter, und jetzt fing der Explorer auch noch an, an der Wand zu kratzen; das Geräusch erfüllte den Kontrollraum. Unter den Anwesenden erhob sich ein lautes, unbehagliches Gemurmel. Sie hatten keine Ahnung, was da passierte, sondern wussten nur, dass irgendetwas schiefgegangen war.
»Melissa, um Himmels willen, schalten Sie ihn ab!«
»Ich versuche es ja!«
Jetzt hämmerte der Explorer mit seiner Klaue an die Wand des Containers, einmal, zweimal, das Geschepper dröhnte bis in den Kontrollraum. Ein kollektives Oh! ausstoßend, traten die Anwesenden zurück.
Melissa starrte auf den Bildschirm. Es war unglaublich. Die Software war irre.
»Jack, ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Noch einen Moment, dann setzt er auf dem Boden des Tanks auf. Dann können wir ihn am Haken herausheben und per Hand abschalten.«
Die Pumpen arbeiteten wie verrückt, der Pegel der Flüssigkeit im Tank sank, an der Oberfläche bildeten sich kleine Strudel.
Schepper! Schepper! Die Titan-Klaue des Explorers schlug noch fester gegen die Wand.
»Was macht er denn da?«, rief Groves.
»Er … reagiert auf eine Bedrohung«, sagte Melissa.
Und dann ertönte ein surrendes Geräusch. Es dauerte einen Moment, bis Melissa klar wurde, worum es sich handelte: der eingebaute Bohrer. Der Explorer fuhr seinen Roboterarm aus, richtete den Bohrer auf die Wand des Tanks und bewegte sich darauf zu.
»O nein«, sagte Stein. »Um Gottes willen, nein.«
Der Bohrer berührte die Wand des Tanks, der Kontrollraum füllte sich mit einem lauten, vibrierenden Geräusch.
Es dauerte nur einen Moment, bis Melissa begriffen hatte, was passieren würde, wenn die Wand des Containers durchstoßen wurde: Es würde zu einer massiven Freisetzung von entflammbarem Methan, Tholinen und Cyanwasserstoff in die sauerstoffreiche Atmosphäre kommen. Das Innere des Containers würde sich entzünden. Es würde eine gewaltige Explosion geben.
Das Bohrgeräusch wurde lauter, rauher. Es handelte sich um einen Diamantenkernbohrer von der höchsten Qualität, und er drang schnell durch die Wand.
»Evakuieren!«, schrie Groves. »Alle raus! Die Anlage evakuieren!«
Er packte Melissa und versuchte, sie in Richtung Tür zu stoßen, aber sie widersetzte sich, wollte ihre Arbeitsstation auf keinen Fall verlassen. Man hörte ein paar keuchende Japser, ein, zwei schrille Schreie. Die Gruppe wich zurück.
»Jack! Du auch! Beeil dich!«
Stein schüttelte den Kopf. »Gleich. Ich muss das hier stoppen.«
Schließlich schaffte es Groves, Melissa wegzuziehen. »Bewegt euch! Alle raus hier!«
Ein großes Durcheinander entstand, als die vielen Leute zurücktraten, erst zögernd, dann zusehends panisch, einige liefen los.
»Jack!«, schrie Melissa. »Komm endlich!«
Sie wollte seinen Arm packen, aber Groves schob sie weiterhin vor sich her, vom Podest herunter und in die wogende Menge. Das Geräusch des Bohrers erfüllte den Raum, wurde lauter und lauter.
»Raus hier! Raus! Egal, wie!«, schrie Groves. »Gleich fliegt alles in die Luft!«
Eine ohrenbetäubende Sirene ging los. Rote Lichter blinkten. Die Leute rannten wie wild auf die nächstgelegenen Ausgänge zu, rissen dabei die Plastikplanen herunter, die den Reinbereich umgaben, stolperten und stürzten. Klemmbretter und Palmtops und iPads fielen zu Boden, während die Leute alles fallen ließen und losrannten.
Melissa wurde von der allgemeinen Panik mitgerissen und in Richtung Ausgang gestoßen. Sie sah, dass Stein am Steuerpult saß – der Einzige, der nicht weggelaufen war.
»Jack, was machst du denn da?«, rief sie. »Jack!«
Jack nahm keinerlei Notiz von ihr, sondern arbeitete wie verrückt am Steuerungspult. Melissa wollte umkehren, aber das ging nicht wegen der wogenden Menschenmenge und weil Groves sie immer noch am Arm gepackt hielt und mit sich zog.
Gerade als sie sich der Tür näherten, hörten sie ein Knacken, ein jähes Ploppen, so als würde ein Champagnerkorken knallen, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Brausen, als das Methan dem Loch im Tank entströmte. Jetzt musste sich nur noch irgendetwas entzünden. Und dann würde alles explodieren.
Melissa ging in der Menge unter, die jetzt versuchte, durch den Flaschenhals am Eingang hinauszugelangen. Die Leute fingen an durchzudrehen, sie grabschten und schrien sich gegenseitig an, um rauszukommen. Melissa wurde durch die Tür geschubst, durch die Eingangshalle und hinaus auf die Rasenfläche. Sie ließ sich aufs Gras fallen, versuchte, aufzustehen, um wieder reinzukommen, wurde aber zu Boden gestoßen. Die Leute liefen herum wie die Ameisen. Dann passierte es: ein gewaltiges, zischendes Geräusch, das in einer gewaltigen Detonation gipfelte, die Melissa emporhob und einen Augenblick lang durch die Luft schleuderte, ehe sie wieder aufs Gras fiel, hart aufprallte und wegrollte.
Während sie auf dem Rasen lag, nach Luft rang und ihr die Ohren klingelten, sah sie, wie sich ein Feuerball in die Luft erhob, zusammen mit Hunderten kleinen weißen Bruchstücken, die harmlos wirkten, bis sie begannen, auf sie und die Leute herabzuregnen, die auf dem Rasen lagen. Melissa ging auf, dass es sich um Metallteile des Dachs handelte, die wie Schrapnelle herunterfielen, gefolgt von Schauern aus Isoliermaterial, die sich endlos fortzusetzen schienen, inmitten der Rufe und Schreie nach Hilfe.
6
Auf einer Platte aus kaltem Beton kam sie wieder zu sich. Ihre Kleider waren nur noch Fetzen, ihr Körper war voller Verletzungen und entstellt. Lange Zeit lag sie so da, wie betäubt und außerstande zu begreifen, was mit ihr geschehen war. Schließlich zog sie sich über den Betonboden, auf allen vieren kriechend und blutend. Zunächst war alles dunkel und unscharf. Rings um sie herum murmelten Stimmen, aber sie konnte die Menschen nicht sehen, die Stimmen nicht verstehen. Da sah sie ein Licht. Sie rappelte sich auf und humpelte darauf zu. Und dort bot sich ihr ein schockierendes Bild. In diesem Lichtkreis blies ein hundertjähriger Mann Kerzen auf einer Geburtstagstorte aus. Ungläubig starrte sie darauf. Noch nie hatte sie einen so alten Menschen gesehen. Sie hatte gar nicht gewusst, dass Menschen so alt wurden. Sie schnappte nach Luft und wich abrupt zurück, zog sich in den Nebel zurück. Jetzt aber, in einem anderen Lichtkreis, kam eine weitere Gestalt in Sicht und tauchte aus der Dunkelheit auf. Eine alte Frau, die auf einem Bett lag. Ihr Unterkiefer und ein Teil ihres Gesichts waren verschwunden, zerstört von etwas namens Krebs. Wieder wich sie zurück und gelangte zu einem dritten Lichtkreis, der eine Person erhellte, die auf dem Boden lag. Nachdem sie auf dieses Bild gestarrt hatte, kam ihr zu Bewusstsein, dass es sich um eine Leiche handelte – dass die Person tot war. Der Leichnam befand sich im Zustand der Verwesung und war aufgedunsen, voller Leichengase. Neben der Leiche kniete ein ausgezehrter Mann in einem Gewand, er beugte sich vor und murmelte seltsame Sätze.
In Büchern war der Tod immer etwas gewesen, das sie nicht verstehen konnte. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass es ihn tatsächlich gab.
Da sagte eine Stimme: »Siehe! Die Vier Zeichen.«
Gepackt von einer grauenhaften Angst, wandte sie sich um und floh. Plötzlich riss der Nebel auf. Sie wanderte, wie sie erkannte, durch eine weite, höllenähnliche Landschaft. Offenbar war ein großer Krieg zu Ende gegangen, der eine postapokalyptische Welt aus rauchenden Ruinen, ausgebombten Kirchen und Gebäuden, reduziert auf eingestürzte Mauern und Schutthalden, hinterlassen hatte. Offenbar befand sie sich irgendwo in Europa. Hier und da stand ein kahler Baum, die Zweige waren zersplittert und versengt von Detonationsschäden. Rings um sie herum gab es Tod im Überfluss, jenen seltsamen Zustand, den sie bisher weder gesehen noch gekannt hatte. Überall auf den von Müll übersäten Straßen lagen Leichenteile und Knochen. Während sie sich durch den beißenden Qualm weiterschleppte, kam sie an einem behaarten menschlichen Bein vorbei, dem kleinen, weißen Arm eines Kindes und schließlich einem hautlosen Schädel, um den sich zwei Hunde stritten.
Wie betäubt schleppte sie sich durch die Ruine und suchte nach einem Zufluchtsort. Sie benötigte etwas zu essen und zu trinken, aber sie fand einfach nichts, nur Pfützen fauligen Regenwassers, das nur so wimmelte von Würmern und in dem Stückchen eiternden Menschenfleischs schwammen. Dann aber sah sie in der leeren Hülle einer ausgebombten Bank einige Menschen sich bewegen. Sie rief ihnen etwas zu, damit sie ihr halfen. Doch als sie herausgelaufen kamen, erkannte sie ihren Fehler. Das waren keine Freunde. Diese Menschen waren schmutzig, tätowiert, mit Körperpanzern bekleidet und trugen Waffen. Das waren Freizeitmörder, sie hatten Spaß, und sie näherten sich ihr, um sie zu töten. Handelte es sich hier um eine Art abartiges Spiel?
Sie drehte sich um und lief los. Die Männer rannten hinter ihr her, sie riefen und johlten um des bloßen Vergnügens willen. Sie floh durch eine Gasse und die Ruine einer Schule. Schließlich konnte sie sich hinter einem ausgebrannten Schulbus verstecken. Die Männer liefen vorbei, schossen dabei vor lauter Mordlust in alle Richtungen und riefen sich gegenseitig irgendetwas zu, während sie nach ihr suchten.
Sie wartete noch lange, nachdem sie verschwunden waren, schwer atmend und zu verängstigt, um sich zu rühren. Doch schließlich bewegte sie sich. Inzwischen stand die Sonne hoch am Himmel; die Hitze stieg in Wellen auf, die den Gestank nach Leichengas mit sich führten, das die überall herumliegenden Toten verströmten.
Während sie einen zerstörten Spielplatz überquerte, wurde sie von der nächsten Gruppe von Mördern überrascht. Sie stürmten aus einem zerstörten Gebäude, rannten auf sie zu und feuerten dabei ihre Waffen ab. Sie lief durch die Ruinen, kletterte über gesprengte Mauern, sprang über Leichen, lief mit Kratern übersäte Straßen entlang. Sie gelangte auf einen bombardierten Platz, fand Zuflucht hinter einem alten Lastwagen und hoffte, die Männer würden sie dort nicht finden. Doch diesmal sahen sie sie. Sie saß in der Falle, hinter dem Lastwagen, und wusste nicht, wohin sie fliehen sollte. Mit Gebrüll stürmte die Gruppe los und feuerte auf den Wagen, die Kugeln schlugen in die Seiten ein. Sie rief den Männern etwas zu, sagte ihnen, sie sei nur ein unbewaffnetes Mädchen, sie flehte sie an, sie zu verschonen, doch die Männer hatten zu viel Spaß und schwärmten auf der entgegengesetzten Seite des Platzes aus und riefen einander etwas zu, damit sie ihren Angriff koordinieren konnten. Geschickt rückten sie gegen sie vor, von einer Deckung zur nächsten, durch die Ruinen auf dem Platz.
Sie schaute sich um und sah in der Nähe eine nicht explodierte Handgranate. Sie hatte eine vage Vorstellung, wie die funktionierte: Man zog den Stift und drückte einen Hebel. Oder zog man am Hebel? Sie nahm die Granate in die Hand und spürte, dass sie warm war, weil sie in der Sonne gelegen hatte. Da war der Stift, und da war der Hebel. Während sie die Granate mit einer Hand an sich drückte, kroch sie zur Seite des zerstörten Lastwagens. Inzwischen waren die Männer zur Hälfte über den Platz vorgerückt und spurteten, ausgehend von den zerstörten Fahrzeugen, los, über die Schutthalden zu den Bombenkratern. Sie umzingelten sie und würden sie töten.
Vor ihrem Versteck klaffte ein tiefer Bombenkrater; die Bombe hatte das Erdreich aufgerissen, überall lagen Pflastersteine herum, und an den Bewegungen der vorrückenden Männer las sie ab, dass der Krater ihre letzte Deckung vor dem Sturmangriff sein würde.
Sie legte sich auf den Boden und spähte, unter dem Fahrgestell liegend, zu den Männern hinüber. Wieder drangen gebrüllte Befehle, die Geräusche von Bewegungen und Gerenne zu ihr herüber. Sie wartete. Der erste Mann huschte heran, sprang in den Krater und gab den anderen das Zeichen, ihm zu folgen. Sie kamen kurz hintereinander und sprangen ihm hinterher. Weil der Kraterrand sich nur fünf Meter entfernt befand, konnte sie das Atmen der Männer hören, ihr Geflüster, das Klappern ihrer Waffen; sie bereiteten sich auf den Sturmangriff vor.
Sie ergriff den Hebel und zog den Stift. Der Hebel sprang auf. In der Hoffnung, dass es funktionieren würde, rollte sie die Granate unter dem Lastwagen hervor in Richtung des Kraters. Die Granate hüpfte über den Rand und verschwand im Krater. Kurz darauf ertönte die Detonation, Körperteile prasselten auf sie hernieder – ein Regen aus Blut und Hirn und Knochensplittern.
Sie sprang auf und lief los, wobei sie versuchte, sich das Blut aus den Haaren und Augen zu schütteln. Sie rannte durch die zerstörten Straßen, lief wie verrückt, kopflos. Doch noch während sie floh, schienen die Männer, die sie getötet hatte, erneut hinter ihr aufzutauchen, alle wild entschlossen, ihre Verfolgungsjagd fortzusetzen.
Das hatte die Prinzessin ihr angetan. Die hatte sie in diese dunkle, chaotische Welt geworfen. Die Prinzessin hatte sie verraten und verlassen. Sie spürte, wie eine riesengroße Wut in ihr aufstieg. Sie würde die Prinzessin aufspüren. Sie würde herausfinden, warum sie ihr das angetan hatte. Und sie würde Vergeltung üben.
7
Nacht. Melissa Shepherd lag in einem Bett im Greenbelt Hospital und hatte dumpfe Kopfschmerzen. Aus dem Fernseher ihrer schlafenden Bettnachbarin plärrte der Nachrichtensender Fox News. Es war absurd, dass man sie ins Krankenhaus gebracht und beschlossen hatte, sie über Nacht dazubehalten, denn sie hatte nur eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Doch die Ärzte hatten darauf bestanden, außerdem war sie zu benommen gewesen, um sich zu streiten.
Die Geschichte wurde in allen Nachrichtensendungen gebracht. Jack Stein war tot – zusammen mit sechs weiteren Mitarbeitern, eine milliardenteure NASA-Testanlage war vollständig zerstört.
Es überwältigte Melissa, weil sie glaubte, möglicherweise dafür verantwortlich zu sein. Sieben Menschen tot. Und diese wunderschöne Apparatur, dieser außergewöhnliche Weltraumroboter, den sie liebevoll mit so viel Mühe und Engagement entwickelt hatten, war total zerstört – von einer verrückten, fehlerhaften Software, die sie mit ihrem Team geschrieben hatte.
Jack Stein ist tot. Der Gedanke peinigte Melissa von neuem. Jack war ein guter, ja, ein großer Mann gewesen. Warum in Gottes Namen war er nicht so wie alle anderen davongelaufen?
Die Ermittler waren den ganzen Nachmittag bei ihr gewesen. Alle hatten blaue Anzüge getragen, und sie hatten ihre Stühle um sie herum aufgestellt wie bei einer Vernehmung, sich mit den Ellbogen auf den Knien vorgebeugt und sie mit höflichen, bohrenden Fragen überschüttet. Stundenlang hatten sie sie vernommen. Schließlich waren sie gegangen.
Melissa lag im Dunkeln und wünschte, sie wäre nach der Explosion ins Koma gefallen und würde unter retrograder Amnesie leiden. Wenn die Erinnerung an das Geschehene doch für immer gelöscht werden könnte. Die fürchterlichen Geräusche des Bohrers, die Explosion, die Schreie, die Hals über Kopf flüchtenden Mitarbeiter, das alles war ihr auf ewig ins Gedächtnis gebrannt.
Die Ermittler waren weder unhöflich noch vorwurfsvoll gewesen, sondern respektvoll und besorgt. Sie hatten sanft und leise mit ihr gesprochen. Doch die Fragen, die sie stellten, nahmen unweigerlich einen anklagenden Ton an. Sie fragten nach der Software und warum diese nicht funktioniert habe, weshalb sie nicht auf Anweisungen reagiert habe, wie und warum sie schadhaft geworden sei und eine Explosion verursacht habe, bei der sieben Menschen ums Leben kamen. Zwar sagten sie das nicht so, aber der unausgesprochene Vorwurf lautete, dass der Unfall irgendwie ihre Schuld war.
Und möglicherweise hatten sie recht damit.
Im Laufe des langen Nachmittags und Abends hatte sie immer stärker gefühlt, wie sehr sie um Jack Stein trauerte. Es sah ihm ähnlich zu bleiben, obwohl alle anderen geflohen waren. Er hatte sich sozusagen auf die Granate geworfen. So ein Mensch war er. Das Traurigste war, dass seine Selbstaufopferung nichts genützt hatte. All seine Bemühungen, die Tragödie aufzuhalten, waren vergebens gewesen.
Alles, was ihr im Leben wichtig war, war bei der Explosion zerstört worden.
Noch einmal ging sie die Fragen durch, die man ihr gestellt hatte. Je mehr sie darüber nachdachte, desto entschiedener drängte sich ihr der Verdacht auf, dass die Vernehmungsbeamten glaubten, die Explosion sei womöglich mehr gewesen als nur ein Unfall. Sie hatten sie gefragt, wer das Netzwerk des Goddard gehackt haben könnte, ob sie jemandem ihr Passwort gegeben, Codes oder Daten vom Gelände entfernt habe. Sie stellten kryptische Fragen über die Explorer-Software, danach, wo im Goddard-Institut die Module gelagert würden, welche Art von Back-up-Systemen sie und ihr Team einsetzten, ob irgendwelche Back-up-Festplatten offline gelagert würden, ob sie von irgendwelchen Backdoors oder Schein-Benutzerkonten im Goddard-Netzwerk wüsste, ob sie von Hackern kontaktiert worden sei. Sie hatten dieselben Fragen immer wieder auf andere Weise gestellt, als schienen sie vage unzufrieden mit Melissas Antworten zu sein. Und sie hatten gesagt, sie würden am nächsten Tag wiederkommen, um weitere Fragen zu stellen.
Die hatten sie doch hoffentlich nicht wegen bewusster Sabotage unter Verdacht?
Sie versuchte, diese Gedanken zu verdrängen, und sagte sich, dass sie unter Schock stand, nicht klar denken konnte und wahrscheinlich unter posttraumatischem Stresssyndrom litt.
Sie verlagerte ihre Stellung im Bett, es ärgerte sie, dass man ihr einen Tropf angelegt hatte. Das war völlig unnötig. Bis auf die Kopfschmerzen war alles in Ordnung. Und dann hatte man ihr eine Zimmernachbarin zugeteilt, die nicht einmal eine NASA-Angestellte war, sondern bloß irgendeine schrullige ältere Frau, die einen Autounfall gehabt hatte. Jedenfalls behauptete sie das.
Und schließlich war es komisch, dass keiner ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Goddard-Institut sie besucht hatte. Zwar stand sie ihnen nicht besonders nahe, aber es kam ihr seltsam vor, dass sie sich fernhielten – es sei denn, sie gaben ihr die Schuld an dem Unfall oder waren angewiesen worden, nicht in Kontakt mit ihr zu treten. Sie hatte auch keine anderen Besucher gehabt, eine traurige Erinnerung daran, dass sie weder eine Familie noch Freunde besaß. Wenigstens hatten die Ermittler ihr ein paar Sachen aus ihrer Wohnung gebracht, darunter ihren Laptop.
Noch einmal begannen die Nachrichtensendungen im Fernsehen mit dem Aufmacher über die Explosion im Goddard-Institut. Es war dieselbe Nachricht, die schon den ganzen Tag lief: Fehlfunktion eines Weltraumroboters, Explosion, sieben Tote, vierzig Verletzte, Anlage zerstört, Feuerball kilometerweit zu sehen und zu hören. Da waren die üblichen Kongressabgeordneten, die forderten, der NASA die Mittel zu streichen, und für alle Beteiligten Strafen forderten. Jetzt sprach noch ein Politiker, ein Kongressabgeordneter, der den Vorsitz im Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie innehatte. Er spielte sich auf und stellte gleichzeitig sein Nichtwissen über die elementaren Grundsätze der Naturwissenschaft zur Schau. Er fragte sich, warum man »Geld für den Weltraum ausgebe«, obwohl es doch »auf der Erde« ausgegeben werden sollte.
Das reichte. Melissa stand auf, griff nach dem Infusionsständer am Bett, um sich abzustützen, und rollte ihn zum Fernseher ihrer Bettnachbarin. Die alte Frau lag da, die Augen geschlossen, der Mund offen, und atmete geräuschvoll ein und aus. Sobald Melissa den Fernseher ausgeschaltet hatte, schlug die Frau die Augen auf. »Ich hab geguckt.«
»Entschuldigung, ich dachte, Sie würden schlafen.«
»Schalten Sie den Fernseher wieder ein.«
Melissa schaltete ihn wieder ein. »Darf ich den Ton ein bisschen leiser stellen?«
»Ich bin schwerhörig.«
Melissa ging zu ihrem Bett zurück. Sehr zum Ärger der Krankenschwester hatte sie alle Schlaftabletten und Schmerzmittel abgelehnt. Seit sie auf der Highschool ihr Drogenproblem überwunden hatte, war sie strikt dagegen, sich irgendeine bewusstseinsverändernde Substanz einzuverleiben – außer Kaffee. Aber sie war viel zu aufgedreht, um schlafen zu können. Es würde eine lange Nacht werden. Sie musste etwas tun, um sich die Zeit zu vertreiben.
Melissa griff nach ihrem Laptop und klappte ihn auf. Das Log-in-Fenster erschien. Sie zögerte. Ihre Firefox-Startseite war die Website der New York Times, aber sie wollte keine weiteren Nachrichten lesen, bestimmt nicht. Im Dunkeln liegend, sah sie auf den Bildschirm, wobei sie sich überwältigt und verloren fühlte. Sie wollte etwas Vertrautes und Tröstliches sehen.
Der erste Gedanke, der ihr in den Sinn kam, war ein YouTube-Video mit den Nicholas Brothers, wie sie in dem Film Stormy Weather tanzten. Immer wenn sie sich niedergeschlagen fühlte, sah sie sich das Video an, um sich aufzuheitern. Wenn ich Selbstmordgedanken hege, dachte sie, muss ich mir nur dieses Video anschauen, um mich daran zu erinnern, dass sich das Leben doch zu leben lohnt.
Das Video erschien, die Musik erklang, und die Nicholas Brothers begannen, in der Schwarzweißszene aus dem Filmklassiker aus dem Jahr 1943 zu tanzen. Melissa stellte den Ton lauter, um den Nachrichtensprecher zu übertönen.
»Entschuldigen Sie«, erklang die Stimme der Frau durch den dünnen Vorhang zum Schutz der Privatsphäre. »Ich kann die Nachrichten nicht verstehen.«
Melissa stellte den Ton etwas leiser und sah zu, wie die Nicholas Brothers vom Podest zum Boden und dann zur Treppe sprangen und steppten und in fünf Minuten mehr Sprünge vollführten als das Bolschoi-Ballett in einer Woche. Aber es funktionierte nicht. Es half ihr nicht, sich besser zu fühlen, sondern führte nur dazu, dass sie sich leer und nutzlos vorkam.
Dann, noch bevor das Video zu Ende war, blinkte der Bildschirm des Laptops, und die Nicholas Brothers verschwanden. Skype wurde geladen. Das war bizarr. Ausgeschlossen, dass sie jetzt mit irgendjemandem reden wollte, ob nun über Skype oder sonst was. Sie klickte auf Beenden, aber das Programm ignorierte den Befehl und lud einfach weiter und meldete sie an. Sofort kam ein Skype-Anruf herein, mit beharrlichem Klingeln. Melissa versuchte, ihn zu verweigern, aber der Laptop beantwortete ihn trotzdem und verband sie mit dem Anrufer, wer immer das war. Auf dem Bildschirm erschien ein Skype-Bild, ein Foto von einem auffallend hübschen Mädchen, ungefähr sechzehn Jahre alt, mit welligen roten Haaren, die ihr bis auf die Schultern fielen, intensiven grünen Augen, einer Buttermilchhaut und Sommersprossen. Sie trug ein grünes Gingham-Kleid im Stil der 1920er Jahre über einer weißen Bluse mit einer weißen Rüschenschleife. Doch die Miene des Mädchens ließ Melissa stutzen. Das Mädchen starrte sie an, die Lippen zusammengepresst und die Stirn gerunzelt, in einem Ausdruck unbändiger Wut.
Wer zum Teufel war das?