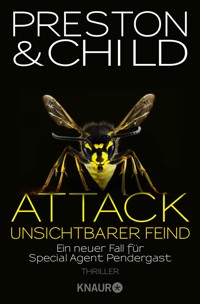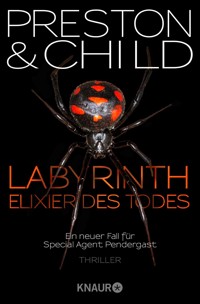9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
In einem tibetischen Kloster will Aloysius Pendergast endlich Frieden finden – doch den Mönchen ist eine Reliquie gestohlen worden, die in den falschen Händen zu einer gefährlichen Waffe werden kann. Pendergasts Ermittlungen führen ihn nach London und auf das Kreuzfahrtschiff Britannia. Der Dieb ist mit der Reliquie an Bord – und kurz nach dem Auslaufen wird für die ahnungslosen Passagiere aus dem geplanten Luxusurlaub ein wahrer Höllentrip … Darkness - Wettlauf mit der Zeit von Douglas Preston · Lincoln Child: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
DOUGLAS PRESTON / LINCOLN CHILD
Darkness
WETTLAUF MIT DER ZEIT. Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einem tibetischen Kloster will Aloysius Pendergast endlich Frieden finden – doch den Mönchen ist eine Reliquie gestohlen worden, die in den falschen Händen zu einer gefährlichen Waffe werden kann. Pendergasts Ermittlungen führen ihn nach London und auf das Kreuzfahrtschiff Britannia. Der Dieb ist mit der Reliquie an Bord – und kurz nach dem Auslaufen wird für die ahnungslosen Passagiere aus dem geplanten Luxusurlaub ein wahrer Höllentrip …
Inhaltsübersicht
[Widmung]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
Epilog
Anmerkungen der Autoren
Die Pendergast-Romane
Die Nicht-Pendergast-Romane
Danksagung
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Tochter Veronica.
Douglas Preston widmet dieses Buch Nat und Ravida, Emily, Andrew und Sarah.
1
Nichts bewegte sich in der Weite des Llölung-Tales außer zwei kleine, schwarze Punkte, kaum größer als die vom Frost rissigen Felsbrocken, die den Talboden bedeckten; langsam mühten sich die Gestalten den kaum erkennbaren Pfad entlang. Das Tal war öde, kein Baum wuchs hier. Der Wind wisperte zwischen den Felsen, die Schreie der schwarzen Malaienadler hallten von den steilen Felshängen wider. Die Gestalten waren zu Pferde und näherten sich einer riesigen, knapp siebenhundert Meter hohen Felswand aus Granit, aus der sich ein schmaler Wasserfall ergoss – die Quelle des heiligen Flusses Tsangpo. Der Pfad mündete in eine schmale Schlucht, die die Felswand einkerbte, tauchte ein Stückchen weiter oben als Einschnitt in die Felswand wieder auf, verlief schließlich auf einem langgestreckten Bergkamm, bevor er nach einer Weile zwischen gezackten Gipfeln und Felsschluchten wieder verschwand. Im Hintergrund erhob sich als ein Bildnis immenser Kraft und Erhabenheit das ewige Eis dreier Bergriesen des Himalaya. Auf dem Dhaulagiri, dem Annapurna und dem Manaslu wehten Fahnen aus Schnee, während hinter ihnen ein eisengraues Meer aus Sturmwolken wogte.
Im Tal ritten die beiden Gestalten bergan, den Oberkörper zum Schutz gegen den kalten Wind nach vorn gebeugt. Es war die letzte Etappe einer langen Reise, und trotz des aufkommenden Unwetters ritten sie langsam; ihre Pferde standen am Rand der Erschöpfung. Vor dem Eingang zur Felsschlucht überquerten sie einen reißenden Wildbach, einmal und dann noch einmal. Gemächlich verschwanden sie in der Schlucht.
Die beiden Gestalten folgten weiter dem kaum erkennbaren Pfad, der über den rauschenden Gebirgsbach aufstieg. Dort, wo die granitene Felswand auf den mit Felsbrocken übersäten, schattigen Talgrund traf, lagen Felder ewigen Eises. Der Wind frischte auf, jagte dunkle Wolken über den Himmel und heulte in den oberen Bereichen der Schlucht.
Unten an der mächtigen Felswand änderte der Pfad jäh seinen Verlauf, stieg durch einen steilen, beängstigend engen Einschnitt im Fels empor. Auf einer vorspringenden Felszunge lag eine uralte Wachstation in Ruinen: vier zerbrochene Steinmauern, die nichts stützten als eine Reihe von Schwarzdrosseln. Ganz unten am Einschnitt stand ein großer mani-Stein, in dessen Oberfläche ein tibetisches Gebet gemeißelt war, blank gerieben und poliert von den Händen jener Abertausenden, die sich einen Segen erwünschten, ehe sie den gefahrvollen Aufstieg wagten.
An der Wachstation saßen die beiden Reisenden ab. Von hier ging es nur zu Fuß weiter, sie mussten die Pferde den schmalen Pfad hinaufführen, denn der Überhang war so niedrig, dass kein Reiter darunter hindurch gelangte. Hier und da hatten Abgänge des blanken Felsgesteins den Pfad unter sich begraben; diese Abschnitte wurden von roh gezimmerten Planken und in den Fels getriebenen Stangen überbrückt, wodurch eine Reihe schmaler, knarrender Brücken ohne Geländer entstanden war. An anderen Stellen war der Pfad so steil, dass die Reisenden und ihre Pferde in den Fels geschlagene Stufen erklimmen mussten, die durch den Aufstieg zahlloser Pilger glatt und uneben geworden waren.
Abrupt änderte der Wind seine Richtung, er pfiff durch die Felsschlucht und führte Schneeflocken mit sich. Der Sturmschatten fiel in die Klamm, tauchte sie in nachttiefe Finsternis. Dennoch folgten die beiden Gestalten dem schwindelerregenden Pfad unverdrossen weiter hinauf, über die vereisten Treppenstufen und Felssteigungen. Bei ihrem Aufstieg hallte das Rauschen des Wasserfalls eigentümlich zwischen den Felswänden wider und vermischte sich mit dem auffrischenden Wind wie geheimnisvolle Stimmen, die in einer fremden Sprache redeten.
Als die Reisenden schließlich den Bergkamm erreichten, wären sie fast gegen den Wind nicht angekommen, er ließ ihre Mäntel flattern und blies ihnen schmerzhaft ins Gesicht. Sie beugten sich vor, um sich zu schützen, zogen die widerstrebenden Pferde weiter den Felsgrat entlang, bis sie die Überreste eines verfallenen Dorfes erreichten. Es war ein öder Ort, die Häuser niedergeworfen durch irgendeine uralte Katastrophe, das Bauholz lag verstreut und zerborsten, die Lehmziegel hatten sich aufgelöst und wieder mit der Erde vermischt, aus der sie geformt waren.
In der Mitte des Dorfes erhob sich eine niedrige Pyramide aus Gebetssteinen; oben ragte eine kleine Stange daraus hervor, an der Dutzende ausgefranster Gebetsfähnchen im Wind knatterten. Zur einen Seite befand sich ein alter Friedhof, dessen Mauer eingestürzt war; wegen der Erosion lagen die Gräber jetzt offen da, hier und da waren Gebeine und Schädel zu sehen. Während sich die beiden Personen näherten, erhob sich ein Schwarm Raben flügelschlagend in die Lüfte. Ihre krächzenden Schreie stiegen aus den Trümmern in die bleigrauen Wolken empor wie lautstarker Protest.
An der kleinen steinernen Pyramide blieb einer der Reisenden stehen und gab dem anderen ein Zeichen, zu warten. Er beugte sich vor, hob einen Stein auf und fügte ihn der Pyramide hinzu. Dann hielt er kurz inne in stummem Gebet, während der Wind an seinem Mantel zerrte, ehe er wieder die Zügel seines Pferdes ergriff. Die beiden Gestalten setzten ihren Weg fort.
Hinter dem verlassenen Dorf verengte sich der Pfad jäh zu einem extrem schmalen Grat. Die beiden Reisenden kämpften sich gegen den ungeheuer heftigen Wind voran, umrundeten einen Bergrücken – und dann endlich konnten sie in der Ferne die Mauern und Zinnen einer riesigen Festung ausmachen, die sich undeutlich vor dem dunklen Himmel abhoben.
Das war das unter dem Namen Gsalrig Chongg bekannte Kloster – was man vielleicht als »das Juwel der Bewusstheit der Leere« übersetzen könnte. Je weiter der Pfad an dem Berghang entlangführte, desto mehr wurde vom Kloster sichtbar: Mächtige, mit roter Farbe getünchte Mauern und Stützpfeiler stiegen die Hänge eines öden granitenen Felsmassivs hinauf und endeten in einem Gebäudekomplex mit spitzen Dächern und Türmen, die hier und da mit funkelndem Goldblech versehen waren.
Das Kloster Gsalrig Chongg zählte zu den ganz wenigen in Tibet, die den Verwüstungen der chinesischen Invasion entronnen waren, während der die Soldaten den Dalai Lama vertrieben, Tausende Mönche getötet und zahllose Klöster und religiöse Gebäude zerstört hatten. Ein Grund dafür, dass Gsalrig Chongg verschont geblieben war, lag sicher in seiner Abgeschiedenheit und seiner Nähe zu der umstrittenen Grenze zu Nepal. Ein weiterer jedoch war ein schlichtes Versäumnis der Behörden: Irgendwie war die Existenz des Klosters der amtlichen Aufmerksamkeit entgangen. Noch heute verzeichnet keine Karte der sogenannten Autonomen Region Tibet das Kloster, wobei sich die Mönche große Mühe geben, dass dies auch so bleibt.
Der Pfad querte einen steilen Geröllhang, auf dem eine Gruppe Geier an irgendwelchen verstreut herumliegenden Knochen pickte.
»Hier scheint kürzlich jemand gestorben zu sein«, sagte der Mann leise und nickte in Richtung der großen Vögel, die völlig furchtlos zwischen den Knochen herumhüpften.
»Wie kommst du darauf?«, fragte der zweite Reisende.
»Wenn ein Mönch stirbt, wird sein Körper zerstückelt und den wilden Tieren zum Fraß hingeworfen. Es gilt als die höchste Ehre, dass deine sterblichen Überreste andere Geschöpfe nähren und erhalten.«
»Ein sonderbarer Brauch.«
»Ganz im Gegenteil, er ist von makelloser Logik. Unsere Bräuche sind eigenartig.«
Der Pfad endete an einem kleinen Tor in der mächtigen Umgrenzungsmauer. In der offenen Tür stand ein buddhistischer Mönch, gehüllt in ein scharlachrotes und safrangelbes Gewand, eine brennende Fackel in der Hand, als habe er die Reisenden erwartet.
Ihre Pferde noch immer am Zügel führend, durchschritten die beiden das Tor. Ein zweiter Mönch erschien, übernahm ohne ein Wort die Tiere und führte sie zu den innerhalb der Umgrenzungsmauer gelegenen Stallungen.
In der hereinbrechenden Dämmerung blieben die Reisenden vor dem ersten Mönch stehen. Dieser sagte nichts, sondern wartete einfach.
Der erste Reisende schob seine Kapuze nach hinten – und da kamen das längliche, blasse Gesicht, das weißblonde Haar, die marmornen Gesichtszüge und die silbrig grauen Augen von Special Agent Aloysius Pendergast vom Federal Bureau of Investigation zum Vorschein.
Der Mönch wandte sich seinem Begleiter zu. Zögernd schob dieser die Kapuze aus dem Gesicht, die braunen Haare wehten im Wind und fingen die wirbelnden Schneeflocken auf. Vor ihm stand eine junge Frau von Anfang zwanzig. Sie hielt den Kopf leicht geneigt, ihre Gesichtszüge waren zart, mit hohen Wangenknochen, ihr Mund schön geformt. Es war Constance Greene, Pendergasts Mündel. Mit einem kurzen Blick aus ihren durchdringenden, veilchenblauen Augen nahm sie ihre Umgebung kurz in sich auf, dann senkte sie rasch die Lider.
Nur einen Augenblick sah der Mönch sie an. Dann wandte er sich ohne ein Wort um und gab den Neuankömmlingen durch ein Zeichen zu verstehen, dass sie ihm einen steinernen Fußweg zum Hauptgebäude folgen sollten.
Schweigend gingen Pendergast und sein Mündel dem Mönch hinterher. Sie passierten ein zweites Tor und betraten die dunklen Räume des eigentlichen Klosters, dessen Luft vom Geruch nach Sandelholz und Wachs erfüllt war. Als das große, eisenbeschlagene Tor hinter ihnen zuschlug, verstummte der heulende Wind zu einem fernen Flüstern. Sie schritten über einen langen Gang, dessen eine Seite kupferne Gebetsmühlen säumten, die, angetrieben von irgendeinem verborgenen Mechanismus, sich knarrend drehten. Nachdem der Gang sich gegabelt und eine weitere Biegung gemacht hatte, gelangten sie tiefer ins Innere des Klosters. Noch ein Mönch erschien, er trug große Kerzen in Messinghaltern, deren flackerndes Licht zu beiden Seiten des Gangs sehr alte Wandmalereien enthüllte.
Am Ende der labyrinthischen Gänge gelangten sie schließlich in einen großen Raum, dessen rückwärtiger Teil von einer goldenen Statue des Padmasambhava, des tantrischen Buddhas, dominiert wurde. Hunderte von Kerzen tauchten sie in weiches Licht. Anders als die kontemplativen, halb geschlossenen Augen auf den meisten Darstellungen Buddhas, waren die Augen des tantrischen Buddhas weit geöffnet, wach und voller Leben, denn sie symbolisierten das gesteigerte Bewusstsein, das man durch das Studium der Geheimlehren des Dzogchen und des noch esoterischeren Chongg Ran erlangt.
Das Kloster Gsalrig Chongg war eines der beiden Refugien, in denen noch das Chongg Ran gelehrt wurde, jene geheimnisvolle Lehre, die den wenigen, die noch mit ihr vertraut waren, als »das Juwel der Unbeständigkeit des Geistes« bekannt war.
An der Schwelle zu diesem Allerheiligsten blieben die beiden Reisenden stehen. Am gegenüberliegenden Ende saß eine Reihe von Mönchen schweigend auf gestaffelten Steinbänken, als erwarteten sie jemanden.
Auf dem obersten Rang thronte der Abt des Klosters. Der Mann sah ungewöhnlich aus, sein uraltes, faltiges Gesicht wirkte belustigt, ja geradezu heiter. Das Gewand hing ihm am klapperdürren Leib wie nasse Wäsche an einer Wäschespinne. Neben ihm saß ein etwas jüngerer Mönch, den Pendergast ebenfalls kannte: Tsering. Er zählte zu den ganz wenigen Mönchen, die Englisch sprachen, diente als eine Art Manager des Klosters und hatte sich für seine gut sechzig Jahre außergewöhnlich gut gehalten. Unterhalb dieser beiden saßen eine Reihe von zwanzig Mönchen aller Altersstufen; einige von ihnen waren Jugendliche, andere sehr alt und verhutzelt.
Tsering erhob sich und sagte in einem mit dem melodischen Singsang des Tibetischen durchsetzten Englisch: »Freund Pendergast, wir heißen dich wieder willkommen im Kloster von Gsalrig Chongg, wie auch deinen Gast. Bitte nehmt Platz und trinkt mit uns einen Tee.«
Er deutete auf eine Steinbank mit zwei bestickten Seidenkissen – es waren die einzigen im ganzen Raum. Pendergast und sein Mündel setzten sich. Kurz darauf erschienen mehrere Mönche mit Messingtabletts voller Tassen dampfenden Buttertees und tsampa. Schweigend nippten sie an dem süßen Getränk, doch erst als sie ihre Tassen geleert hatten, ergriff Tsering wieder das Wort.
»Was führt Freund Pendergast zurück nach Gsalrig Chongg?«
Pendergast erhob sich.
»Vielen Dank für dein herzliches Willkommen, Tsering«, sagte er leise. »Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich kehre hierher zurück, um meine meditative Reise zur Erleuchtung fortzusetzen. Ich möchte dir Miss Constance Greene vorstellen, die ebenfalls gekommen ist, um hier zu studieren.« Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Beine.
Eine lange Stille entstand. Schließlich erhob sich Tsering. Er ging zu Constance hinüber, stellte sich vor sie und sah ihr ruhig ins Gesicht; schließlich streckte er die Hand aus und berührte ihr Haar, befingerte es sanft. Dann strich er noch sanfter über die Wölbung ihrer Brüste. Constance rührte sich keinen Millimeter von der Stelle.
»Sind Sie eine Frau?«, fragte er.
»Sie haben doch sicherlich schon einmal eine gesehen«, erwiderte Constance trocken.
»Nein«, entgegnete Tsering. »Seit ich im Alter von zwei Jahren hierhergekommen bin, habe ich keine mehr zu Gesicht bekommen.«
Constance errötete. »Verzeihen Sie vielmals. Ja, ich bin eine Frau.«
Tsering wandte sich an Pendergast. »Sie ist die erste Frau, die je nach Gsalrig Chongg gekommen ist. Wir haben noch nie eine Schülerin aufgenommen. Es tut mir leid, aber unser Orden gestattet das nicht. Insbesondere jetzt nicht, inmitten der Begräbnisfeierlichkeiten für den Verehrten Ralang Rinpoche.«
»Der Rinpoche ist tot?«, fragte Pendergast.
Tsering verneigte sich.
»Es tut mir leid, vom Tod des allerhöchsten Lamas zu hören.«
Da lächelte Tsering. »Es ist kein Verlust. Wir werden seine Reinkarnation finden – den neunzehnten Rinpoche –, und dann ist er wieder unter uns. Mir tut es leid, dass ich euer Ersuchen ablehnen muss.«
»Meine Begleiterin braucht deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wir sind beide … der Welt überdrüssig. Wir sind einen weiten Weg gekommen, um Frieden zu finden. Frieden und Heilung.«
»Ich weiß, wie beschwerlich die Reise ist, die du gemacht hast. Ich weiß, wie viel du erhoffst. Aber Gsalrig Chongg existiert seit tausend Jahren ohne die Anwesenheit von Frauen, wir können das nicht ändern. Sie muss gehen.«
Ein langes Schweigen folgte. Und dann hob Pendergast den Kopf und blickte hinüber zu dem greisen, reglosen Mönch, der den höchsten Sitz innehatte. »Ist dies auch die Meinung des Abts?«
Zunächst ließ sich keinerlei Regung erkennen. Ein Fremder hätte den verhutzelten Mönch sogar für einen glücklichen, wenngleich senilen Schwachsinnigen halten können, wie er dort auf seiner hohen Warte über den anderen grinste. Doch auf ein kaum merkliches Schnipsen seiner dürren Finger stieg einer der jüngeren Mönche zu ihm hinauf, beugte sich über den betagten Abt und legte das Ohr nahe an dessen zahnlosen Mund. Nach einem Moment richtete er sich auf und sagte etwas auf Tibetisch zu Tsering.
Dieser übersetzte: »Der Abt bittet Frau, ihren Namen zu wiederholen, bitte.«
»Ich heiße Constance Greene«, antwortete sie mit leiser, aber fester Stimme.
Wieder entstand ein – überaus langes – Schweigen.
Wieder das Schnipsen der Finger; wieder murmelte der alte Mönch dem jungen Mönch etwas ins Ohr, der es mit lauterer Stimme wiederholte.
Tsering sagte: »Der Abt fragt, ob das ihr wahrer Name ist.«
Sie nickte. »Ja, das ist mein richtiger Name.«
Langsam hob der alte Lama seinen dürren Arm und deutete mit zentimeterlangem Fingernagel zu einer dunklen Wand des Raums. Alle Blicke wandten sich zu einem unter einem Tuch verborgenen Tempelgemälde, einem von vielen, die an der Wand hingen.
Tsering ging hinüber, hob das Tuch an und hielt eine Kerze daran. Im Schein der Kerze kam ein überwältigend detailreiches und komplexes Bild zum Vorschein: eine hellgrüne weibliche Gottheit mit acht Armen, die auf einer weißen Mondscheibe saß; Götter, Dämonen, Wolken, Berge und Linien aus Goldfiligran wirbelten um sie herum, als umtoste sie ein heftiger Sturm.
Der alte, zahnlose Lama murmelte dem jüngeren Mönch etwas ins Ohr. Dann lehnte er sich zurück und lächelte. Wieder übersetzte Tsering seine Worte.
»Seine Heiligkeit bittet, Aufmerksamkeit auf thangka-Gemälde von Grüner Tara zu richten.«
Die Mönche murmelten und scharrten mit den Füßen, erhoben sich von ihren Plätzen und stellten sich im Halbkreis vor dem Gemälde auf, wie Schüler, die auf einen Vortrag warteten.
Mit seinem spindeldürren Ärmchen bedeutete der alte Lama Constance Greene, sich in den Kreis einzureihen, was sie eilig tat, wobei die Mönche ihr bereitwillig Platz machten.
»Das hier ist Bildnis von Grüner Tara«, fuhr Tsering in seiner Übersetzung der gemurmelten Worte des alten Mönches fort. »Sie ist Mutter aller Buddhas. Sie hat Beständigkeit. Dazu Weisheit, Geistesgegenwart, rasches Denken, Großzügigkeit und Furchtlosigkeit. Seine Heiligkeit lädt Frau ein, näher zu treten und Mandala von Grüner Tara zu betrachten.«
Constance trat zögernd vor.
»Seine Heiligkeit fragt, warum Schülerin Namen von Grüner Tara trägt.«
Constance blickte sich um. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«
»Du heißt Constance Greene. Dieser Name beinhaltet zwei wichtige Eigenschaften von Grüner Tara. Seine Heiligkeit fragt, wie du deinen Namen bekommen hast.«
»Greene ist mein Nachname. Er ist in England sehr geläufig, aber ich habe keine Ahnung, woher er stammt. Und meinen Vornamen, Constance, hat mir meine Mutter gegeben. Er war beliebt … zur Zeit meiner Geburt. Jedweder Zusammenhang zwischen meinem Namen und der Grünen Tara ist offensichtlich ein Zufall.«
Da lachte der Abt, wenngleich etwas zittrig. Mühsam richtete er sich mit Hilfe zweier Mönche auf. Nach einigen Augenblicken stand er, wenn er auch den Anschein erweckte, als könnte der kleinste Lufthauch ihn zu Boden strecken. Er lachte immer noch so sehr, dass sein rosa Gaumen zu sehen war, als er leise und keuchend zu sprechen anhub. Selbst seine Knochen schienen vor Heiterkeit zu klappern.
»Zufall? So etwas gibt es nicht. Schülerin macht guten Witz«, übersetzte Tsering. »Der Abt mag guten Witz.«
Constance blickte zu Tsering, dann zum Abt und wieder zu Tsering. »Heißt das, dass ich hier studieren darf?«
»Es heißt, dass dein Studium bereits begonnen hat«, sagte Tsering und lächelte.
2
In einem der abseits gelegenen Pavillons des Klosters Gsalrig Chongg saß Aloysius Pendergast auf einer Bank neben Constance Greene. Eine Reihe von Steinfenstern ging zur Schlucht des Llölung hinaus. Von hier aus konnte man bis zu den mächtigen Gipfeln des Himalaya sehen, die in ein zart rosafarbenes Abendrot getaucht waren. Von unten drang das leise Rauschen des Wasserfalls am Eingang des Llölung-Tales herauf. Während die Sonne hinter dem Horizont versank, erklang eine dzung-Trompete: ein tiefer, langgezogener Laut, der von den Schluchten und Bergen widerhallte.
Fast zwei Monate waren vergangen. Es war Juli und somit Frühjahr in den hohen Vorbergen des Himalaya. Die Talböden waren grün und mit Wildblumen gesprenkelt. Auf den Berghängen blühten rosafarbene Wildrosen.
Die beiden saßen schweigend da. Noch zwei Wochen, dann ging ihr Aufenthalt hier zu Ende.
Wieder ertönte die dzung, und das feuerrote Licht auf den Gipfeln von Dhaulagiri, Annapurna und Manaslu, drei der zehn höchsten Berge der Welt, verglühte. Die Abenddämmerung fiel rasch, drang in die Täler wie eine Flut dunklen Wassers.
Pendergast erhob sich. »Deine Studien verlaufen gut. Äußerst gut. Der Abt ist hochzufrieden.«
»Ja.« Ihre Stimme klang leise, fast distanziert.
Er legte eine Hand auf ihre; die Berührung war so leicht und luftig wie die eines Blattes. »Wir haben noch nie darüber gesprochen, aber ich wollte dich fragen, ob … in der Feversham-Klinik alles gutgegangen ist. Ob die, ähm, Prozedur ohne Komplikationen verlaufen ist.« Pendergast wirkte geradezu schüchtern und um Worte verlegen, was untypisch für ihn war.
Constance blickte weiter auf die kalten, schneebedeckten Berge.
Er zögerte. »Ich wünschte, ich hätte bei dir sein dürfen.«
Sie senkte den Kopf, schwieg aber weiter.
»Constance, du liegst mir so sehr am Herzen. Vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gemacht. Dafür entschuldige ich mich.«
Errötend beugte Constance den Kopf noch tiefer. »Danke.« Die Distanziertheit in ihrer Stimme wich einem leichten Tremolo. Sie erhob sich jäh und wandte den Blick ab.
Er stand ebenfalls auf.
»Verzeih, Aloysius, aber ich möchte eine Weile allein sein.«
»Natürlich.« Pendergast sah ihr nach, bis ihre schlanke Gestalt, einem Geist gleich, in den steinernen Gängen des Klosters verschwand. Dann wandte er den Blick der Berglandschaft hinter dem Fenster zu und verlor sich in seinen Gedanken.
Während die Dunkelheit den Pavillon erfüllte, verklangen die Laute der dzung; sekundenlang hallte die letzte Note einem Echo gleich zwischen den Felswänden wider. Alles war still, als habe die heranbrechende Nacht eine Art Starre mit sich gebracht. Und dann erschien in den tiefsten Schatten unterhalb des Pavillons eine Gestalt: Es war ein alter Mönch in safrangelbem Gewand. Mit seiner welken Hand gab er Pendergast ein Zeichen; es war jenes eigentümliche tibetische Schütteln des Handgelenks, das Komm mit! bedeutet.
Langsam ging Pendergast dem Mönch entgegen. Dieser wandte sich um und huschte ins Dunkel.
Fasziniert folgte Pendergast dem Mönch, der ihn in eine unerwartete Richtung führte, über schwach erleuchtete Gänge bis zu jener Zelle, in welcher der berühmte Anachoret lebte. Dieser Mönch hatte sich angeblich bereits als Zwölfjähriger aus freien Stücken in einer Kammer einmauern lassen, die gerade groß genug war, dass ein Mensch darin sitzen und meditieren konnte; sein ganzes Leben verbrachte er in dieser Zelle. Einmal am Tag versorgten ihn seine Brüder mit Brot und Wasser, das ihm durch eine Lücke im Mauerwerk zugeschoben wurde.
Der Mönch blieb vor der Zelle stehen. Sie war nichts Besonderes, nur eine unauffällige dunkle Mauer, deren Steine von Tausenden von Händen blankpoliert worden waren. Unzählige Menschen waren gekommen, um von diesem besonderen Anachoreten Weisheit zu erbitten, der inzwischen fast hundert Jahre alt und ein wegen seiner einzigartigen Gabe der Weissagung berühmtes Orakel war.
Der Mönch tippte mit dem Fingernagel zweimal auf den Stein. Sie warteten. Nach einer Minute begann sich ein loser Stein im Mauerwerk zu bewegen, ganz leise kratzte er langsam über die Fuge. Eine welke Hand, weiß wie Schnee mit bläulich durchschimmernden Venen, kam zum Vorschein. Sie kippte den Stein auf die Seite, wodurch ein Spalt in der Mauer entstand.
Der Mönch beugte sich zu der Lücke im Mauerwerk vor und murmelte eine leise Bemerkung. Dann horchte er. Minuten verstrichen, in denen Pendergast von drinnen ein leises Flüstern vernahm. Der Mönch richtete sich auf, offenbar zufrieden, und gab ihm ein Zeichen, näher zu treten. Er tat, wie ihm geheißen, und sah, wie der Stein in seine ursprüngliche Stellung zurückglitt.
Mit einem Mal drang aus dem Fels neben der gemauerten Kammer ein dumpfer, kratzender Laut; ein Spalt öffnete sich. Er verbreiterte sich zu einer steinernen Tür, die von irgendeinem unsichtbaren Mechanismus bewegt wurde. Ein ungewöhnlicher Duft, dem Weihrauch verwandt, drang aus dem Inneren. Der Mönch streckte die Hand aus, eine Geste, die Pendergast zum Eintreten aufforderte; als dieser die Schwelle übertreten hatte, glitt die Tür hinter ihm zu. Der Mönch war ihm nicht gefolgt – Pendergast war allein.
Ein weiterer Mönch tauchte mit einer blakenden Kerze in der Hand aus dem Dunkel auf. Während der vergangenen sieben Wochen in Gsalrig Chongg, wie auch bei seinen vorherigen Besuchen, hatte Pendergast alle Mönche kennengelernt – doch dieses Gesicht war ihm neu. Also hatte er soeben das innere Kloster betreten, von dem zwar hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurde, dessen Existenz aber niemals bestätigt worden war. Er war im Allerheiligsten. Der Zutritt war niemandem gestattet und wurde offenbar von dem eingemauerten Anachoreten bewacht, so viel hatte Pendergast begriffen. Es handelte sich um ein Kloster im Kloster, in dem ein halbes Dutzend Mönche ihr ganzes Leben in tiefster Meditation und nicht enden wollendem geistigen Studium verbrachte. Die Männer sahen niemals die Außenwelt, noch kamen sie mit den Mönchen des äußeren Klosters in Kontakt. Sie hatten sich so sehr aus der Welt zurückgezogen, wie Pendergast einmal zufällig gehört hatte, dass Sonnenlicht auf ihrer Haut sie bereits töten konnte.
Er folgte dem seltsamen Mönch einen schmalen Gang hinunter, der in die tiefsten Bereiche der Klosteranlage führte. Der Gang wurde schmaler, und Pendergast erkannte, dass es sich dabei um einen Tunnel handelte, der aus dem Felsen geschlagen und vor tausend Jahren verputzt und bemalt worden war. Rauch, Feuchtigkeit und die Zeit hatten die Fresken inzwischen fast verbleichen lassen. Der Gang machte eine Biegung nach der anderen, führte an kleinen Felsnischen mit Buddha- und thangka-Gemälden vorbei, die von Kerzen erhellt und von Weihrauchschwaden erfüllt waren. Sie begegneten niemandem, sahen keinen Menschen – die fensterlosen Räume und Tunnel wirkten leer, klamm und verlassen.
Schließlich, nach einer scheinbar endlosen Strecke, gelangten sie wieder an eine Tür, deren geölte Eisenplatten dick vernietet waren. Noch ein Schlüssel wurde hervorgeholt, die Tür mit einiger Mühe entriegelt und geöffnet.
Der Raum war klein, eine einzelne Butterlampe spendete ein mattes Licht. Die Wände waren mit altem, von Hand poliertem Holz verkleidet und sorgfältig intarsiert. Süßlicher Rauch durchzog stechend und harzig die Luft. Pendergast brauchte einen Moment, um zu erkennen, dass die Kammer mit Schätzen angefüllt war. Vor der gegenüberliegenden Wand stand ein Dutzend Schatullen aus schwerem getriebenem Gold, die Deckel fest verschlossen; daneben stapelten sich Ledertaschen, einige vermodert und an den Nähten aufgeplatzt, so dass ihr Inhalt zum Vorschein kam: Goldmünzen – von altenglischen Sovereigns und griechischen Drachmen bis zu schweren indischen Goldmünzen aus dem Mughal-Reich. Kleine Holzfässchen waren drumherum aufgeschichtet worden, die Dauben geschwollen und verrottet, aus denen sich rohe und geschliffene Rubine, Saphire, Diamanten, Türkise, Turmaline und Peridots ergossen. Andere waren offenbar mit kleinen Goldbarren und ovalen altjapanischen Kobans gefüllt.
Die Wand zu seiner Rechten beherbergte eine andere Art Schatz: Schalmeien und Hörner aus Ebenholz, Elfenbein und Gold, besetzt mit Edelsteinen; dorje-Glocken aus Silber und Elektrum; menschliche Schädelkappen, verziert mit Edelmetallen und funkelnden Intarsien aus Türkisen und Korallen. In einem anderen Bereich drängten sich Statuen aus Gold und Silber, eine davon mit Hunderten von Sternsaphiren geschmückt; in Holzkisten ganz in der Nähe erkannte er auf Stroh gebettete durchscheinende Schüsseln, Figuren und Tafeln aus feinster Jade.
Unmittelbar links von Pendergast befand sich der größte Schatz von allen: Hunderte kleine Kämmerchen, vollgestopft mit staubigen Schriftrollen, gerollten thangkas und Bündeln aus Pergament und Kalbsleder mit Schleifen aus Seidenkordeln.
So erstaunlich war dieser Schatz, dass Pendergast erst nach einer Weile die Person wahrnahm, die im Lotussitz auf einem Kissen in der nächstgelegenen Ecke saß.
Der Mönch, der ihn hierhergeführt hatte, verneigte sich, legte die Hände aneinander und zog sich zurück. Hallend fiel die Eisentür ins Schloss, der Schlüssel drehte sich. Der Mönch im Lotussitz deutete auf ein Kissen neben sich. »Bitte setzen Sie sich doch«, sagte er auf Englisch.
Pendergast verneigte sich und nahm Platz. »Ein höchst bemerkenswerter Raum.« Er machte eine kurze Pause. »Und ein höchst ungewöhnlicher Weihrauch.«
»Wir sind die Hüter der Schätze des Klosters – des Goldes und des Silbers und all der anderen vergänglichen Dinge, die die Welt für Reichtum hält.« Der Mönch sprach ein gemessenes, elegantes Englisch mit einem Oxford-Akzent. »Wir sind außerdem die Diener der Bibliothek und der religiösen Gemälde. Den ›Weihrauch‹, den Sie bemerkt haben, produziert das Harz der dorzhan-qing-Pflanze. Wir verbrennen es fortwährend, um die Würmer in Schach zu halten; die gefräßigen Holzwürmer, die im Hochhimalaya vorkommen und alles in diesem Raum, das aus Holz, Papier oder Seide ist, zu zerstören trachten.«
Pendergast nickte und betrachtete den Mönch genauer. Er war alt, jedoch drahtig und erstaunlich fit. Sein rot-und-safrangelbes Gewand war fest gewickelt, der Schädel glattrasiert. Die Füße waren nackt und starrten vor Schmutz. Seine Augen blitzten in einem alterslosen Gesicht mit weichen Zügen, das Intelligenz, aber auch Bekümmertheit, ja sogar große Besorgnis verriet.
»Zweifellos fragen Sie sich, wer ich bin und warum ich Sie gebeten habe, herzukommen«, sagte der Mönch. »Ich bin Thubten. Herzlich willkommen, Mr Pendergast.«
»Lama Thubten?«
»Wir hier im inneren Tempel tragen keine Titel.« Er beugte sich vor und spähte Pendergast ins Gesicht. »Wie ich höre, ist es Ihr Beruf – ich weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll –, sich in die Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen, das Recht wiederherzustellen, wenn ein Unrecht geschehen ist? Rätsel zu lösen, Licht in Geheimnisse und ins Dunkel zu bringen?«
»So hat es zwar noch niemand ausgedrückt. Aber ja, so könnte man es nennen.«
Der Mönch lehnte sich sichtlich erleichtert zurück. »Das ist gut. Ich fürchtete fast, mich zu irren.« Beinahe flüsternd setzte er hinzu: »Es gibt hier ein Rätsel.«
Ein langes Schweigen entstand. Schließlich sagte Pendergast: »Sprechen Sie weiter.«
»Der Abt darf nicht über die Sache sprechen. Daher hat man mich darum gebeten. Doch obwohl die Situation sehr ernst ist, finde ich es … schwierig, darüber zu reden.«
»Sie alle hier sind sehr freundlich zu mir und meinem Mündel«, sagte Pendergast. »Ich begrüße die Gelegenheit, mich dafür erkenntlich zeigen zu können – so es denn möglich ist.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Zu der Geschichte, die ich Ihnen nun gleich erzählen will, gehört auch, dass ich einige Details von geheimer Art enthüllen muss.«
»Sie können auf meine Diskretion zählen.«
»Zunächst möchte ich Ihnen ein wenig von mir erzählen. Ich bin im entlegenen Hügelland um den See Manosawar in Westtibet zur Welt gekommen. Ich war ein Einzelkind, meine Eltern kamen vor meinem ersten Geburtstag bei einem Lawinenunglück ums Leben. Zwei englische Naturliebhaber – ein Ehepaar, das eine ausführliche Erkundungstour durch die Mandschurei, Nepal und Tibet unternahm – erbarmten sich eines so jungen Waisen und adoptierten mich inoffiziell. Zehn Jahre lang blieb ich bei ihnen, während sie beobachtend, zeichnend und Notizen machend durch die Wildnis reisten. Dann überfiel eines Nachts eine Bande vagabundierender Soldaten unser Zelt. Sie erschossen den Mann und die Frau und verbrannten sie mitsamt ihrem ganzen Besitz. Ich allein entkam.
Zweimal die Eltern verlieren – sie können sich meine Gefühle sicher vorstellen. Meine einsamen Wanderungen führten mich hierher, nach Gsalrig Chongg. Nach einiger Zeit leistete ich einen Eid und trat ins innere Kloster ein. Wir widmen unser Leben einer extremen Schulung des Geistes und des Körpers und beschäftigen uns mit den tiefsten, profundesten und rätselhaftesten Aspekten des Daseins. Während Ihres Studiums von Chongg Ran sind Sie auf einige der Wahrheiten gestoßen, die wir auf unermesslich tiefere Weise ergründen.«
Pendergast neigte den Kopf.
»Hier, im inneren Kloster, sind wir von allem Leben abgeschnitten. Es ist uns nicht gestattet, einen Blick in die äußere Welt zu werfen, den Himmel zu sehen, frische Luft zu atmen. Alles ist darauf konzentriert, sich nach innen zu wenden. Es ist ein sehr großes Opfer, selbst für einen tibetischen Mönch, und so sind wir auch nur zu sechst. Wir werden vom Anachoreten bewacht, dürfen mit keinem Außenstehenden reden. Ich habe meinen heiligen Eid gebrochen, damit ich mit Ihnen sprechen kann. Dies allein sollte helfen, Ihnen den Ernst der Lage zu verdeutlichen.«
»Verstehe.« Pendergast nickte.
»Als Mönche des inneren Tempels haben wir bestimmte Pflichten. Wir sind nicht nur die Hüter der Bibliothek, der Reliquien und des Schatzes des Klosters, sondern auch die Hüter des … Agozyens.«
»Des Agozyens?«
»Der bedeutendste Kultgegenstand im Kloster, vielleicht in ganz Tibet. Es wird in einer verschlossenen Gruft aufbewahrt, dort in jener Ecke.« Er deutete auf eine ins Gestein gehauene Nische mit einer schweren Eisentür davor, die einen Spaltbreit offen stand. »Einmal im Jahr versammeln sich hier alle sechs Mönche, um bestimmte Rituale zur Beaufsichtigung der Gruft des Agozyens durchzuführen. Als wir dieser Pflicht im Mai nachkamen, einige Tage vor Ihrer Ankunft, stellten wir fest, dass sich das Agozyen nicht mehr an seinem Platz befand.«
»Gestohlen?«
Der Mönch nickte.
»Wer besitzt einen Schlüssel?«
»Ich. Als Einziger.«
»Und die Gruft war verschlossen?«
»Ja. Lassen Sie mich Ihnen versichern, Mr Pendergast, es ist völlig ausgeschlossen, dass einer unserer Mönche dieses Verbrechen begangen hat.«
»Verzeihen Sie, wenn ich diese Behauptung mit Skepsis betrachte.«
»Skeptisch zu sein, ist gut.« Thubten sagte das mit eigenartiger Inbrunst, so dass Pendergast nicht antwortete. »Das Agozyen befindet sich nicht mehr im Kloster. Wäre es anders, würden wir das wissen.«
»Warum?«
»Darüber muss ich schweigen. Bitte glauben Sie mir, Mr Pendergast: Wir würden es mit Sicherheit wissen. Keiner der Mönche hier hat den Gegenstand an sich genommen.«
»Darf ich einen Blick hineinwerfen?«
Der Mönch nickte.
Pendergast erhob sich, nahm eine kleine Taschenlampe aus der Tasche, ging hinüber zur Gruft und spähte durch das runde Schlüsselloch. Kurz darauf untersuchte er es mit einem Vergrößerungsglas.
»Das Schloss wurde geknackt«, sagte er und richtete sich auf.
»Verzeihen Sie – geknackt?«
»Aufgesperrt, ohne Verwendung eines Schlüssels.« Er warf dem Mönch einen Blick zu. »Ehrlich gesagt, gewaltsam aufgebrochen, allem Anschein nach. Sie sagten, keiner der Mönche kann das Objekt gestohlen haben. Hatten Sie noch weitere Besucher hier im Kloster?«
»Ja.« Ein Lächeln huschte über Thubtens Miene. »Offen gestanden, wissen wir, wer es gestohlen hat.«
»Schön«, sagte Pendergast. »Das macht alles viel einfacher. Erzählen Sie mir mehr davon.«
»Anfang Mai kam ein junger Mann zu uns – ein Bergsteiger. Eine merkwürdige Ankunft. Er kam aus dem Osten, aus den Bergen zur nepalesischen Grenze. Er war am Ende, stand geistig und körperlich kurz vor dem Zusammenbruch. Er war ein erfahrener Bergsteiger, der einzige Überlebende einer Expedition, die die noch unbezwungene Westwand des Dhaulagiri hinaufwollte. Eine Lawine riss alle in den Tod, nur ihn nicht. Er musste die Nordwand überqueren und hinabsteigen und illegal die tibetische Grenze überschreiten. Drei Wochen lang war er zu Fuß unterwegs, durchquerte Gletscher und Täler, bis er das Kloster erreichte. Er überlebte, indem er Ratten aß. Die sind recht sättigend, wenn man eine erwischt, deren Magen voller Beeren ist. Wie ich bereits sagte: Er war dem Tod sehr nah. Wir pflegten ihn wieder gesund. Er ist Amerikaner – sein Name ist Jordan Ambrose.«
»Hat er bei Ihnen studiert?«
»Er zeigte kaum Interesse am Chongg Ran. Es war schon seltsam – er besaß gewiss Willenskraft und Geistesschärfe, vielleicht mehr als jeder Westler, den wir kennengelernt haben … das heißt, abgesehen von der Frau. Constance.«
Pendergast nickte. »Woher wissen Sie, dass er es war?«
Der Mönch gab ihm keine direkte Antwort. »Wir möchten, dass Sie den Mann aufspüren, das Agozyen finden und ins Kloster zurückbringen.«
Pendergast nickte. »Dieser Jordan Ambrose – wie hat er ausgesehen?«
Der Mönch griff in sein Gewand und zog eine kleine Pergamentrolle hervor. Er löste die Bänder und entrollte sie. »Unser thangka-Maler hat auf mein Ersuchen ein Porträt angefertigt.«
Pendergast nahm die Rolle und betrachtete sie. Sie zeigte einen jungen, sportlichen, gutaussehenden Mann von Ende zwanzig mit langen blonden Haaren und blauen Augen und Gesichtszügen, die körperliche Robustheit, moralische Nonchalance und hohe Intelligenz verrieten. Ein hervorragendes Porträt, das die äußere ebenso wie die innere Person wiedergab.
»Das Gemälde dürfte sehr nützlich sein«, sagte Pendergast, rollte es zusammen und steckte es ein.
»Brauchen Sie irgendwelche weiteren Informationen für Ihre Suche nach dem Agozyen?«, fragte der Mönch.
»Ja. Sagen Sie mir, worum es sich dabei handelt.« Die Miene des Mönches zeigte eine erschreckende Veränderung. Plötzlich wirkte er verschlossen, fast verängstigt. »Das kann ich nicht«, sagte er mit bebender Stimme, so leise, dass er kaum zu verstehen war.
»Es lässt sich nicht vermeiden. Wenn ich dieses Agozyen finden soll, muss ich wissen, was es ist.«
»Sie missverstehen mich. Ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, weil wir nicht wissen, was es ist.«
Pendergast runzelte die Stirn. »Wie kann das sein?«
»Seit es vor tausend Jahren unserem Kloster zur sicheren Aufbewahrung anvertraut wurde, befand sich das Agozyen in einem versiegelten Holzkasten. Wir haben ihn niemals geöffnet – das war streng verboten. Er wurde weitergereicht, von Rinpoche zu Rinpoche. Stets versiegelt.«
»Was für eine Art Kasten?« Der Mönch deutete die Ausmaße an, ungefähr fünfzehn mal fünfzehn mal einhundertundzwanzig Zentimeter.
»Das ist eine ungewöhnliche Form. Was könnte Ihrer Ansicht nach in einem Kasten mit solchen Ausmaßen aufbewahrt worden sein?«
»Es kann sich nur um etwas Langes, Dünnes handeln. Einen Stab oder ein Schwert. Eine Schriftrolle oder ein eingerolltes Gemälde. Eine Reihe von Siegeln vielleicht oder Seile mit heiligen Knoten.«
»Was bedeutet der Begriff Agozyen?«
Der Mönch zögerte.
»Finsternis.«
»Und warum war es verboten, den Kasten zu öffnen?«
»Der Begründer des Klosters, der erste Ralang Rinpoche, bekam den Kasten von einem heiligen Mann im Osten, aus Indien, geschenkt. Dieser Heilige hatte auf die Seite des Kastens einen Text geschnitzt, der die folgende Warnung enthält. Ich habe hier eine Kopie des Textes, den ich Ihnen übersetzen möchte.« Er zog eine kleine, mit tibetischen Zeichen vollgeschriebene Schriftrolle hervor, hielt sie mit leicht zittrigen Händen auf Armeslänge von sich weg und rezitierte:
Befreien darf niemand das dharma von seinen Ketten
Nur so ist es vor Bösem und Leid zu retten
Damit das Rad der Finsternis auf nimmer sich dreht
Das Siegel des Agozyen auf ewig besteht.
»Das ›dharma‹ bezieht sich auf die Lehren Buddhas?«, fragte Pendergast.
»In diesem Kontext bezeichnet der Begriff etwas noch Größeres – die gesamte Welt.«
»Dunkel und beängstigend.«
»Der Ausdruck ist im Tibetischen genauso rätselhaft. Aber die verwendeten Worte sind sehr machtvoll. Es ist eine starke Warnung, Mr Pendergast – eine sehr starke.«
Pendergast dachte einen Augenblick darüber nach. »Wie konnte ein Außenstehender denn genug über den Kasten wissen, dass er ihn stahl? Ich habe ein ganzes Jahr hier verbracht und nie davon gehört.«
»Das ist ein großes Rätsel. Sicherlich hat keiner unserer Mönche jemals von dem Objekt gesprochen. Wir leben in größter Angst vor ihm und sprechen nie davon, nicht einmal untereinander.«
»Dieser Bursche, Ambrose, hätte mühelos Edelsteine im Wert von Millionen scheffeln können. Jeder gewöhnliche Dieb hätte zunächst das Gold und die Juwelen mitgehen lassen.«
»Vielleicht«, sagte der Mönch nach kurzem Zögern, »ist er ja kein gewöhnlicher Dieb. Gold, Edelsteine … Sie sprechen von irdischen Gütern. Vergänglichen Schätzen. Das Agozyen hingegen …«
»Ja?«
Aber der alte Mönch breitete nur die Arme aus und schaute Pendergast voller Furcht an.
3
Der schwarze Schleier der Nacht begann sich gerade zu lüften, als Pendergast durch die eisenbeschlagene Tür des inneren Bezirks des Klosters trat. Vor ihm, hinter der äußeren Mauer, erhob sich der mächtige Annapurna; unverrückbar, ein violetter Umriss, der sich aus der weichenden Dunkelheit löste. Während ein Mönch ihm schweigend sein Pferd brachte, blieb Pendergast im kopfsteingepflasterten Innenhof stehen. Die kühle Luft vor Sonnenaufgang war erfüllt von Tau und dem Duft wilder Rosen. Pendergast legte seine Satteltaschen über den Widerrist des Pferdes, überprüfte den Sitz des Sattels, passte die Steigbügel an.
Constance sah ihm wortlos zu, während er die letzten Reisevorbereitungen traf. Sie trug ein verwaschenes safrangelbes Mönchsgewand; wären nicht ihre feinen Gesichtszüge und ihr brauner Haarschopf gewesen, hätte man sie für einen Mönch halten können.
»Entschuldige, dass ich dich so früh am Morgen verlasse, Constance. Aber ich muss die Fährte unseres Mannes aufnehmen, ehe sie kalt wird.«
»Haben die Mönche wirklich keine Ahnung, worum es sich handelt?«
Pendergast schüttelte den Kopf. »Außer seiner Form und seinem Namen wissen sie nichts.«
»Finsternis …«, murmelte sie. Sie sah ihn sichtlich beunruhigt an. »Wie lange bleibst du fort?«
»Der schwierige Teil ist bereits erledigt. Ich kenne den Namen des Diebes und weiß, wie er aussieht. Es geht nur noch darum, ihn einzuholen. In einer Woche – im Höchstfall vielleicht zwei – müsste ich den Gegenstand gefunden haben. Ein einfacher Auftrag. In zwei Wochen hast du deine Studien beendet und kannst dich mir anschließen, so dass wir unsere Europareise antreten können.«
»Pass gut auf dich auf, Aloysius.«
Pendergast lächelte milde. »Der Mann mag einen fragwürdigen Charakter haben, aber er kommt mir nicht wie ein Mörder vor. Das Risiko dürfte minimal sein. Es handelt sich um einen simplen Raub, der nur einen etwas verwirrenden Aspekt hat: Warum hat der Mann das Agozyen gestohlen, aber die Juwelen und das Gold nicht angerührt? Er scheint vorher nie Interesse an tibetischen Kultgegenständen gezeigt zu haben. Das deutet darauf hin, dass es sich beim Agozyen um etwas bemerkenswert Kostbares und Wertvolles handelt – oder dass es auf irgendeine andere Art wahrhaft außergewöhnlich ist.«
Constance nickte. »Hast du irgendwelche Anweisungen für mich?«
»Erhol dich. Meditiere. Beende die Studien, die du aufgenommen hast.« Er hielt inne. »Ich bezweifle, dass tatsächlich niemand hier weiß, was das Agozyen ist – jemand muss einmal einen Blick darauf geworfen haben. Aber so ist die menschliche Natur – selbst hier, unter den Mönchen. Es würde mir sehr helfen, wenn ich wüsste, worum es sich handelt.«
»Ich kümmere mich darum.«
»Ausgezeichnet. Ich weiß, ich kann auf deine Diskretion zählen.« Er zögerte, dann wandte er sich noch einmal an sie. »Constance, ich muss dich noch etwas fragen.«
Als sie seinen Gesichtsausdruck sah, weiteten sich ihre Augen, aber ihre Stimme blieb ruhig. »Ja?«
»Du hast nie von deiner Reise nach Feversham erzählt. Irgendwann möchtest du vielleicht darüber reden. Wenn du dich mir wieder anschließt … wenn du so weit bist …« Wieder verriet seine Stimme eine für ihn untypische Verwirrung und Unentschlossenheit.
Constance wandte den Blick ab.
»Seit Wochen«, fuhr er fort, »haben wir nicht darüber gesprochen, was geschehen ist. Aber früher oder später …«
Sie drehte sich abrupt zu ihm um. »Nein!«, sagte sie heftig. »Nein.« Sie hielt einen Augenblick inne, riss sich zusammen. »Bitte, versprich mir eins: Erwähne ihn … oder Feversham … mir gegenüber nie wieder.«
Pendergast blieb regungslos stehen, schaute sie forschend an. Offenbar hatte die Verführung durch seinen Bruder Diogenes Constance noch tiefer berührt, als ihm klar gewesen war. Schließlich nickte er fast unmerklich. »Ich verspreche es dir.«
Dann entzog er ihr seine Hände und küsste sie auf beide Wangen. Er nahm die Zügel, schwang sich in den Sattel, trieb sein Pferd an, ritt durch das äußere Tor und machte sich auf den Weg, den gewundenen Pfad hinab.
4
In einer kahlen Zelle tief im Kloster Gsalrig Chongg saß Constance Greene im Lotussitz, die Augen geschlossen, und visualisierte die außerordentlich komplex verknotete Seidenkordel, die auf einem Kissen vor ihr lag. Tsering saß im Halbdunkel hinter ihr. Sie vernahm den leisen Klang seiner Stimme, ein tibetisches Gemurmel. Nach acht Wochen intensiven Unterrichts beherrschte sie die Sprache einigermaßen, wenn auch stockend; sie hatte ein bescheidenes Vokabular erworben und einige Redewendungen erlernt.
»Sieh den Knoten mit deinem geistigen Auge«, kam die leise, hypnotisierende Stimme ihres Lehrmeisters.
Der Knoten erschien, ungefähr einen Meter vor ihren geschlossenen Lidern; er war in klares, helles Licht gehüllt. Dass sie auf dem nackten, kalten Fußboden einer salpeterverkrusteten Zelle saß, schwand aus ihrem Bewusstsein.
»Mach das Bild deutlich. Mach es klar.«
Der Knoten begann zu flackern und wurde undeutlich, sobald ihre Aufmerksamkeit nachließ, kehrte aber immer wieder vor ihr geistiges Auge zurück, wenn sie sich wieder konzentrierte.
»Dein Geist ist wie ein See in der Dämmerung«, raunte ihr Lehrmeister. »Still, ruhig und klar.«
Ein seltsames Gefühl des Hierseins und Doch-nicht-Hierseins umfing Constance. Der Knoten, den sie für ihre Visualisierungsübung gewählt hatte, blieb in ihrem Geist präsent. Es war ein Knoten von mittlerer Komplexität, vor über dreihundert Jahren von einem großen Lehrer geknotet. Er war unter dem Namen »Doppelte Rose« bekannt.
»Verstärke das Bild des Knotens in deinem Geist.«
Es war ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Bemühen und Loslassen. Wenn sie sich zu sehr auf die Klarheit und Deutlichkeit des Bildes konzentrierte, begann es sich aufzulösen und andere Gedanken drängten sich vor; wenn sie zu stark losließ, verschwand das Bild in den Nebeln ihres Bewusstseins. Aber es gab einen Punkt der vollkommenen Balance, und allmählich – sehr allmählich – fand sie ihn.
»Nun schau auf das Bild des Knotens, den du in deinem Geist erschaffen hast. Betrachte ihn aus allen Blickwinkeln: von oben, von den Seiten.«
Die sanft schimmernden Seidenwindungen blieben vor ihrem geistigen Auge. Sie vermittelten ihr eine stille Freude, eine Achtsamkeit, die sie nie zuvor erfahren hatte. Und dann verschwand die Stimme ihres Lehrers ganz und gar, und allein der Knoten blieb. Die Zeit verschwand. Der Raum verschwand. Nur der Knoten blieb.
»Löse den Knoten.«
Das war der schwierigste Teil – es erforderte ungeheure Konzentration, den Windungen des Knotens zu folgen und sie in Gedanken zu lösen.
Die Zeit verging; zehn Sekunden oder auch zehn Stunden, alles war eins.
Eine Hand berührte sie sanft an der Schulter, sie schlug die Augen auf. Tsering stand vor ihr.
»Wie lange?«, fragte sie auf Englisch.
»Fünf Stunden.«
Sie erhob sich und stellte fest, dass ihre Knie so wackelig waren, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte. Er packte sie am Arm und stützte sie.
»Du lernst gut«, sagte er. »Achte darauf, keinen Stolz zu empfinden.«
Sie nickte. »Danke.«
Langsam schritten sie den uralten Gang entlang und bogen um eine Ecke. Von weiter vorn hörte Constance die Gebetsmühlen. Wieder bogen sie um eine Ecke. Sie fühlte sich erfrischt, klar, hellwach. »Was treibt die Gebetsmühlen an?«, fragte sie. »Sie hören nie auf, sich zu drehen.«
»Es gibt eine Quelle unter dem Kloster – der Ursprung des Tsangpo. Das Wasser läuft über ein Rad und treibt die Mühlen an.«
»Sehr erfinderisch.«
Sie passierten den Wald aus quietschenden, klappernden bronzenen Hohlzylindern. Hinter den Gebetsmühlen sah Constance unzählige sich bewegende Messingstäbe und Holzräder. Sie ließen die Gebetsmühlen hinter sich und gelangten in einen der äußeren Gänge. Vor ihnen ragte einer der Steinpavillons des Klosters auf – zwischen den Pfeilern sah man die drei großen Bergmassive. Sie betraten den Pavillon. Constance sog tief die reine Hochgebirgsluft ein. Tsering deutete auf eine Sitzgelegenheit, sie setzte sich. Er ließ sich neben ihr nieder. Einige Minuten blickten sie schweigend auf die dunkler werdenden Berge.
»Die Meditation, die du lernst, ist sehr intensiv. Eines Tages öffnest du die Augen und wirst vielleicht feststellen, dass der Knoten … gelöst ist.«
Constance schwieg.
»Es gibt Menschen, die die materielle Welt mit reinen Gedanken beeinflussen, die Dinge aus Gedankenkraft erschaffen können. Es gibt die Geschichte von einem Mönch, der so lange über die Rose meditierte, dass eine Rose auf dem Boden lag, als er die Augen öffnete. Das ist sehr gefährlich. Manche Menschen, mit der richtigen inneren Konzentration und Technik, können Dinge erschaffen … nicht nur Rosen. Das ist nicht erstrebenswert und auch eine schwerwiegende Abweichung von der buddhistischen Lehre.«
Sie nickte zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, aber sie glaubte ihm kein Wort.
Tserings Mund verzog sich zu einem Lächeln. »Du bist eine Skeptikerin. Das ist sehr gut. Aber ob du mir glaubst oder nicht, wähle den Gegenstand deiner Meditationsübung immer sorgfältig aus.«
»Das werde ich«, sagte Constance.
»Vergiss nicht: Wir haben viele Dämonen, aber die meisten sind nicht böse. Es sind die Bindungen an das irdische Leben, die du besiegen musst, um Erleuchtung zu erlangen.«
Es folgte ein langes Schweigen.
»Hast du eine Frage?«
Sie schwieg einen Augenblick länger und dachte an Pendergasts Abschiedsworte. »Sag mir: Warum gibt es ein inneres Kloster?«
Tsering antwortete nicht sofort. »Das innere Kloster ist das älteste Kloster Tibets. Es wurde hier in den entlegenen Bergen von einer Gruppe indischer Wandermönche erbaut.«
»Wurde es zum Schutz des Agozyens errichtet?«
Tsering warf ihr einen scharfen Blick zu. »Davon sollte man nicht sprechen.«
»Mein Vormund ist aufgebrochen, um das Agozyen zu finden, auf Bitten des Klosters hin. Vielleicht kann ich ebenfalls von Nutzen sein.«
Der alte Mann wandte den Blick ab, und die Entrücktheit in seinen Augen hatte nichts mit der Landschaft hinter dem Pavillon zu tun. »Das Agozyen wurde aus Indien hergebracht. Weit fort in die Berge, wo es keine Bedrohung war. Man baute ein inneres Kloster, um das Agozyen zu schützen und aufzubewahren. Dann, später, wurde das äußere Kloster um das innere Kloster herum errichtet.«
»Es gibt da etwas, das ich nicht verstehe. Wenn das Agozyen so gefährlich ist, warum wurde es dann nicht einfach vernichtet?«
Der Mönch schwieg sehr lange. Dann sagte er ruhig: »Weil es eines Tages einen wichtigen Zweck erfüllen wird.«
»Und welchen?«
Aber ihr Lehrmeister antwortete nicht.
5
Der Jeep raste um eine Kurve am Berghang, polterte aufspritzend durch eine Reihe riesiger, schlammiger Schlaglöcher und bog auf eine breite, unbefestigte Straße ein, die in ein sumpfiges Tal unweit der tibetisch-chinesischen Grenze führte. Hier lag die Stadt Qiang. Grauer Nieselregen fiel vom Himmel auf eine braune Dunstglocke, die über der Stadt hing; Rauch stieg aus einer Reihe von Schornsteinen auf der anderen Seite eines trüben Flusses auf. Auf beiden Seitenstreifen türmte sich Müll.
Wild hupend überholte der Fahrer des Jeeps einen überladenen Laster. Der Wagen schleuderte in einer Blindkurve um einen weiteren Laster herum, drehte sich ein, zwei Meter vom Abgrund entfernt um die eigene Achse, und die Abfahrt in die Stadt begann.
»Zum Bahnhof, bitte«, sagte Pendergast auf Mandarin zu dem Fahrer.
»Wei wei, xian sheng!«
Mit raschen Manövern wich der Fahrer Fußgängern, Fahrradfahrern und einem Ochsengespann aus und kam schließlich mit kreischenden Bremsen vor einem Kreisverkehr zum Stehen. Hier herrschte dichtes Verkehrsgewühl, danach ging es nur noch schrittweise vorwärts, obwohl der Fahrer pausenlos auf die Hupe drückte. Abgase und eine wahre Symphonie von Signalhörnern erfüllten die Luft. Die Scheibenwischer fuhren hin und her und verteilten den Schlamm, von dem der Jeep bedeckt war, auf der Windschutzscheibe; zu mehr reichte der schwache Regen nicht aus.
Hinter dem Kreisverkehr endete der breite Boulevard vor einem niedrigen Betongebäude. Der Fahrer hielt abrupt an. »Wir sind da«, sagte er.
Pendergast stieg aus und spannte seinen Regenschirm auf. Die Luft roch nach Schwefel und Petroleum. Er betrat den Bahnhof und schlängelte sich zwischen Scharen schiebender, brüllender Menschen hindurch, die riesige Säcke und Körbe auf dem Rücken schleppten. Manche trugen lebende, zusammengeschnürte Hühner oder Enten, einer schob sogar ein jämmerlich kreischendes, festgebundenes Schwein in einem alten Einkaufswagen vor sich her.
Im hinteren Teil des Bahnhofs war es weniger voll, und Pendergast fand das, wonach er gesucht hatte: einen schwach erleuchteten Korridor, der zu den Büros der Beamten führte. Er passierte einen halb schlafenden Wachtposten, lief den langen Flur hinunter und blickte im Vorübergehen auf die Namensschilder an den Türen. Endlich blieb er vor einer besonders schäbigen Tür stehen. Er drückte die Klinke herunter, fand die Tür unverschlossen und trat, ohne zu klopfen, ein.
Ein chinesischer Beamter, klein und rundlich, saß hinter einem mit Papierstapeln überladenen Schreibtisch. Daneben stand ein mitgenommenes Teegeschirr mit angeschlagenen, dreckigen Tassen. Das Büro roch nach Gebratenem und Hoisin-Sauce.
Der Beamte sprang auf, wütend über das unangemeldete Eindringen. »Wer du sein?«, brüllte er in schlechtem Englisch.
Pendergast, der ein hochnäsiges Lächeln aufgesetzt hatte, stand mit verschränkten Armen da.
»Was du wollen? Ich rufen Wache.« Der Beamte griff nach dem Telefonhörer, aber Pendergast beugte sich rasch vor und drückte die Gabel herunter.
»Ba«, sagte Pendergast leise auf Mandarin. »Lassen Sie das.«
Bei dieser weiteren Ungeheuerlichkeit lief das Gesicht des Chinesen rot an.
»Ich habe ein paar Fragen, die ich gern beantwortet haben würde«, sagte Pendergast, immer noch im kalt formellen Mandarin.
Die Wirkung auf den Beamten war beachtlich – sein Gesicht spiegelte Empörung, Verwirrung und Besorgnis wider. »Sie beleidigen mich«, brüllte er schließlich auf Mandarin. »Sie dringen in mein Büro ein, berühren mein Telefon, stellen Forderungen! Wer sind Sie, dass Sie hier einfach eindringen und sich aufführen wie ein Barbar?«
»Bitte setzen Sie sich, werter Herr, seien Sie ruhig, und hören Sie zu. Oder –«, hier wechselte Pendergast in die beleidigende informelle Sprechweise, »oder Sie werden sich unversehens im nächsten Zug wiederfinden, auf dem Weg zu Ihrer neuen Wirkungsstätte, einem Wachposten hoch in den KunlunBergen.«
Das Gesicht des Mannes war fast purpurrot angelaufen, aber er schwieg. Dann setzte er sich steif hin, legte die gefalteten Hände auf den Schreibtisch und wartete.
Pendergast setzte sich ebenfalls. Er nahm das Rollbild heraus, das Thubten ihm gegeben hatte, und reichte es dem Beamten. Nach kurzem Zögern nahm der es widerstrebend entgegen.
»Dieser Mann ist vor zwei Monaten hier durchgekommen. Sein Name ist Jordan Ambrose. Er hatte einen sehr alten Holzkasten bei sich. Er hat Sie bestochen, und dafür haben Sie ihm eine Ausfuhrgenehmigung für den Holzkasten beschafft. Ich würde gern die Kopie der Ausfuhrgenehmigung sehen.«
Es folgte ein längeres Schweigen. Dann legte der Beamte das Rollbild auf den Schreibtisch. »Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen«, erklärte er missmutig. »Ich nehme keine Bestechungsgelder. Und hier kommen jede Menge Leute durch, ich kann mich unmöglich an jeden erinnern.«
Pendergast zog ein flaches Bambuskästchen aus der Tasche, klappte es auf, drehte es um und legte einen Stapel frischer Hundert-Renminbi-Yuan-Scheine auf den Tisch. Der Mann starrte auf das Geld und schluckte.
»An diesen Mann würden Sie sich erinnern«, sagte Pendergast. »Der Holzkasten war groß – anderthalb Meter lang. Er war ganz offensichtlich alt. Es wäre Mr Ambrose unmöglich gewesen, ihn ohne Ausfuhrgenehmigung hier durch oder außer Landes zu schaffen. Nun, werter Herr, haben Sie die Wahl: Entweder vergessen Sie Ihre Prinzipien und nehmen das Bestechungsgeld, oder Sie bleiben ihnen treu und landen in den Kunlun-Bergen. Wie Sie vielleicht an meinem Akzent und meiner Beherrschung Ihrer Sprache gemerkt haben, habe ich in Ihrem Land beste Verbindungen, obwohl ich Ausländer bin.«
Der Beamte wischte sich die Hände mit einem Taschentuch ab. Dann legte er eine Hand über die Banknoten, zog den Stapel dichter an sich heran, und die Scheine verschwanden rasch in einer Schreibtischschublade. Dann erhob er sich. Auch Pendergast stand auf, und sie gaben einander die Hand und tauschten höfliche Begrüßungsfloskeln aus, als habe er gerade erst den Raum betreten.
Der Mann setzte sich. »Hätte der Herr gern etwas Tee?«, fragte er.
Pendergast warf einen Blick auf das dreckige, verfärbte Teegeschirr, dann lächelte er. »Ich würde mich sehr geehrt fühlen, werter Herr.«
Der Mann brüllte etwas in ein Hinterzimmer. Ein Untergebener kam hereingetrottet und nahm das Teegeschirr mit. Fünf Minuten später kam er mit der dampfenden Kanne zurück. Der Beamte schenkte Tee ein.
»Ich erinnere mich an den Mann, von dem Sie sprechen«, sagte er. »Er hatte kein Visum für China. Er hatte einen langen Holzkasten dabei. Er wollte ein Einreisevisum – das er brauchte, um ausreisen zu können – und eine Exportgenehmigung. Ich habe ihm beides verschafft. Es war … sehr teuer für ihn.«
Der Tee, ein Lung-Cheng-Grüntee, war zu Pendergasts Überraschung von guter Qualität.
»Natürlich sprach er kein Chinesisch. Er erzählte mir eine unglaubliche Geschichte. Angeblich war er über das Gebirge von Nepal nach Tibet gekommen.«
»Und der Kasten? Sagte er etwas darüber?«
»Er sagte, es sei eine Antiquität, die er in Tibet gekauft hatte – Sie wissen ja, für ein paar Yuan würden diese dreckigen Tibeter ihre eigenen Kinder verkaufen. In der Autonomen Region Tibet wimmelt es ja nur so von altem Kram.«
»Haben Sie gefragt, was sich in dem Kasten befand?«
»Angeblich ein phur-bu-Ritualdolch.« Der Beamte wühlte in einer Schreibtischschublade herum, blätterte ein paar Dokumente durch und zog die Kopie der Ausfuhrgenehmigung hervor. Er schob sie Pendergast hin, der sie sich ansah.
»Aber der Kasten war verschlossen, und der Mann weigerte sich, ihn zu öffnen«, fuhr der Beamte fort. »Das hat ihn noch einiges mehr gekostet, diese Vermeidung einer Inspektion des Inhalts.« Er lächelte und entblößte seine Zähne, die braun vom Tee waren.
»Was, glauben Sie, befand sich in dem Kasten?«
»Ich habe keine Ahnung. Heroin, Devisen, Edelsteine?« Er machte eine Geste, die sein Desinteresse unterstrich.
Pendergast wies auf die Exportgenehmigung. »Hier steht, dass er mit dem Zug nach Chengdu fahren, dann mit Air China nach Beijing fliegen und von dort einen Flug nach Rom nehmen wollte. Stimmt das?«
»Ja. Es war notwendig, dass er mir sein Ticket zeigte. Wenn er versucht hätte, China auf einer anderen Route zu verlassen, hätte die Gefahr bestanden, dass er festgehalten wird. Die Ausfuhrgenehmigung gilt nur für die Strecke Qiang–Chengdu–Beijing–Rom. Ich bin also sicher, dass er diese Route genommen hat. Einmal in Rom angekommen natürlich …« Wieder spreizte er die Hände.
Pendergast notierte sich die Reiseinformationen. »Wie hat er sich verhalten? War er nervös?«
Der Beamte dachte kurz nach. »Nein. Es war sehr merkwürdig. Er schien … voller Freude. Überschwänglich. Fast euphorisch.«
Pendergast erhob sich. »Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Tee, xian sheng.«
»Und ich danke Ihnen, wertester Herr«, sagte der Beamte.
Eine Stunde später saß Pendergast in einem Erster-Klasse-Wagen des Trans-China-Express auf dem Weg nach Chengdu.
6
Constance Greene wusste, dass die Mönche des Klosters Gsalrig Chongg nach einem festen Stundenplan lebten: Meditation, Studium und Ruhe wurden durch zwei Pausen für Mahlzeiten und Tee unterbrochen. Die Schlafperiode war festgelegt – von acht Uhr abends bis ein Uhr nachts. Von dieser Routine wurde nie abgewichen, sie war wahrscheinlich seit tausend Jahren unverändert. Daher ging sie davon aus, dass ihr um Mitternacht in dem gewaltigen Kloster kein Mensch über den Weg laufen würde.
Wie in den vergangenen drei Nächten warf sie also um Punkt zwölf die grobe Yakhaut zurück, die ihr als Decke diente, und setzte sich im Bett auf. Es war still bis auf das Wispern des Windes in den äußeren Pavillons des Klosters. Sie stand auf und schlüpfte in ihre Mönchsrobe. In der Zelle war es bitterkalt. Sie trat an das winzige Fenster und öffnete die Holzläden. Es war nicht verglast, und ein Schwall eisiger Luft strömte herein. Sie schaute in die Dunkelheit der Nacht hinaus; ein einzelner Stern funkelte hoch oben in der samtigen Schwärze.
Constance schloss das Fenster, ging zur Tür und lauschte. Alles war ruhig. Behutsam öffnete sie die Tür, schlüpfte in den Flur hinaus und ging den langen äußeren Flur entlang. Sie kam an den Gebetsmühlen vorbei, die endlos ihre Gebete gen Himmel klapperten, und betrat einen Gang, der tief hinein in das innere Labyrinth des Klosters führte. Sie war auf der Suche nach dem eingemauerten Einsiedler, dem Wächter des inneren Klosters. Zwar hatte Pendergast ihr den ungefähren Standort beschrieben, doch der Klosterkomplex war so riesig und die Gänge so verwinkelt, dass es sich als geradezu unmöglich erwies, ihn zu finden.
Aber in dieser Nacht kam sie nach vielen Abzweigungen endlich zu der von zahlreichen Händen blankpolierten Steinmauer, die die Außenwand seiner Zelle war. Auch der lose Ziegelstein fand sich, die Kanten von unzähligen Drehungen angeschlagen. Sie klopfte ein paarmal leicht darauf und wartete. Minuten vergingen, dann bewegte sich der Ziegelstein leicht; ein leises, kratzendes Geräusch, und er begann sich zu drehen. Knochige Finger, die an lange, weiße Würmer erinnerten, umfassten die Kante des Ziegelsteins und kippten ihn, so dass sich eine kleine Luke auftat.
Constance hatte vorher eine kleine Ansprache auf Tibetisch vorbereitet. Sie beugte sich vor und flüsterte in das Loch hinein: »Lass mich ins innere Kloster.«
Sie drehte den Kopf und legte das Ohr an die Öffnung. Eine schwache, insektenähnliche Flüsterstimme antwortete. Constance bemühte sich, zu hören und zu verstehen.
»Du weißt, dass das verboten ist?«
»Ja, aber –«
Bevor sie den Satz beenden konnte, gab es ein scharrendes Geräusch, ein Teil der Mauer begann sich zu bewegen. Ein Spalt tat sich auf. Dahinter erschien ein finsterer Gang. Constance war verblüfft – der Eremit hatte nicht einmal ihre sorgsam ausgearbeitete Erklärung abgewartet.
Sie kniete sich hin, entzündete ein Drachen-Räucherstäbchen und trat ein. Die Wand schloss sich. Vor Constance roch es nach Feuchtigkeit und nassem Gestein. Ein süßlicher, harziger Duft lag in der Luft.
Constance hielt das Räucherstäbchen hoch und tat einen Schritt vorwärts. Die Flamme flackerte wie im Protest. Die junge Frau folgte dem langen Gang, dessen Wände mit verstörenden Bildern seltsamer Gottheiten und tanzender Dämonen bemalt, aber nur schwach zu erkennen waren.
Das innere Kloster, wurde ihr klar, musste ursprünglich weit mehr Mönche beherbergt haben als heute. Es war gewaltig, kalt und leer. Ohne zu wissen, wohin sie unterwegs war, sogar ohne klare Vorstellung davon, was sie hier eigentlich suchte – abgesehen davon, dass sie den Mönch, mit dem Pendergast gesprochen hatte, weiter befragen wollte –, bog sie um mehrere Ecken, durchquerte lange, leere Räume, deren Wände mit nur halb sichtbaren thangkas und Mandalas bedeckt waren, von der Zeit fast ausgelöscht. In einem Raum flackerte eine einsame, vergessene Kerze vor einer uralten, von Grünspan zerfressenen Bronzestatue des Buddhas. Das Räucherstäbchen, das Constance als Lichtquelle benutzte, begann zu zischen. Sie zog ein neues aus der Tasche und entzündete es, und der Geruch von Sandelholzrauch erfüllte den Gang.
Sie bog wieder um eine Ecke und blieb wie angewurzelt stehen. Vor ihr stand ein hochgewachsener, hagerer Mönch in einem zerlumpten Mönchsgewand. Seine tiefliegenden Augen starrten sie mit seltsamer, fast glühender Intensität an. Sie erwiderte seinen Blick. Er sagte nichts. Keiner von beiden rührte sich.
Dann hob Constance die Hand zu ihrer Kapuze und schob sie zurück, so dass ihr braunes Haar auf ihre Schultern fiel.
Die Augen des Mönchs weiteten sich, aber nur leicht. Immer noch schwieg er.
»Sei gegrüßt«, sagte Constance auf Tibetisch.