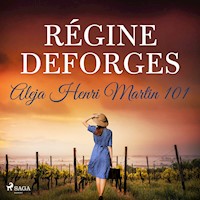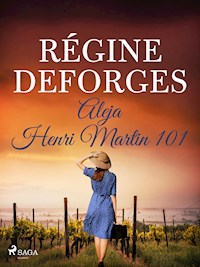Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das blaue Fahrrad
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Léa Delmas lebt sorglos in den Weinbergen von Bordeaux, doch mit der Besatzung ihrer Heimat durch deutsche Soldaten wird ihr Leben jäh auf den Kopf gestellt. Mit ihrem blauen Fahrrad bewegt sie sich nicht nur zwischen den Fronten des Krieges, sondern auch zwischen zwei Männern: Laurent und Francois verstricken sie gleichermaßen in die Wirrungen des Krieges wie auch der Gefühle."Das blaue Fahrrad" ist der erste Band der gleichnamigen Trilogie, mit dem Régine Deforges der internationale Durchbruch gelang. Das Buch wurde mit Laetitia Casta in der Hauptrolle als TV-Zweiteiler verfilmt. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 613
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Régine Deforges
Das blaue Fahrrad
Aus dem Französischen von Sylvia Strasser und Claus Sprick
Roman
Saga
Das blaue Fahrrad
Übersezt von Claus Sprick, Sylvia Strasser
Titel der Originalausgabe: La Bicyclette bleue
Originalsprache: Französisch
La Bicyclette bleue © Libraire Arthème Fayard, 1993.
Copyright © 1985, 2022 Régine Deforges und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728422373
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Im Gedenken an Fürst Yvan Wiazemsky
Die Autorin bedankt sich bei den folgenden Personen
für ihre ‒ in den meisten Fällen unfreiwillige ‒
Kollaboration: Henry Amouroux, Robert Aron, Marcel
Aymé, Robert Brasillach, Benoist-Méchin,
Louis-Ferdinand Céline, Colette, Arthur Conte, Jacques
Delarue, Jacques Delperrié de Bayac, Jean
Galtier-Boissière, General de Gaulle, Jean Giraudoux,
Jean Guéhenno, Gilbert Guilleminault, Bernard
Karsenty, Jacques Laurent, Roger Lemesle, General
Alain Le Ray, François Mauriac, Claude Mauriac,
Henri Michel, Margaret Mitchell, Pierre Nord, Gilles
Perrault, Marschall Pétain, L. G. Planes und
R. Dufourg, Lucien Rebatet, P. R. Reid, Colonel Rémy,
Maurice Sachs, Charles Tillon, Jean Vidalenc, Gérard
Walter, bei Fürstin Wiazemsky und Fürst Yvan
Wiazemsky.
Prolog
Wie an jedem Morgen war Pierre Delmas auch heute als erster auf den Beinen. Er trank eine Tasse von dem aufgewärmten Kaffee, den das Dienstmädchen auf einer Ecke des uralten Herdes bereithielt, pfiff nach seinem Hund und verließ das Haus ‒ im Winter noch bei Nacht, im Sommer in der grauen Dämmerstunde vor Sonnenaufgang. Pierre Delmas liebte den Geruch der Erde, wenn noch alles schlief. Oftmals überraschte ihn der Tag auf der Terrasse; und er folgte dann mit den Augen der dunklen Linie der pinienbewaldeten Landes in Richtung Meer.
Am meisten bedauerte er, so erzählte man sich in der Familie, daß er nicht zur See gefahren war. Als Kind stand er oft stundenlang in Bordeaux am Quai des Chatrons und schaute den ein- und auslaufenden Frachtern nach. Er sah sich als Kapitän auf einem dieser Schiffe, als alleiniger Herrscher an Bord gleich nach dem lieben Gott, auf den Weltmeeren kreuzend, den Stürmen trotzend. Eines Tages hatten sie ihn, versteckt im Rumpf, auf einem Kohlendampfer aufgegriffen, der, bereit zur Abfahrt nach Afrika, im Hafen vor Anker lag. Weder Drohungen noch gutes Zureden hatten ihm zu entlokken vermocht, wie er auf das Schiff gelangt war und weshalb er ohne ein Wort der Erklärung seine über alles geliebte Mutter hatte verlassen wollen. Von diesem Tage an hatte er sich nie mehr an den Kais herumgetrieben, wo es so herrlich nach Abenteuer, Teer und Vanille duftete.
Pierre Delmas war schließlich Winzer geworden wie sein Vater. Vielleicht trieb ihn seine unerfüllte Liebe zum Meer dazu, jährlich Hektar um Hektar Land zu erwerben, auf dem nichts anderes wuchs als vom Westwind gepeitschte Pinien.
Im Alter von fünfunddreißig Jahren hielt er es für an der Zeit, sich eine Frau zu nehmen. Doch heiratete er nicht in die Bourgeoisie von Bordeaux ein, obwohl er dort manch gute Partie hätte machen können.
Isabelle de Montpleynet hatte er in Paris im Haus eines befreundeten Weinhändlers kennengelernt. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Sie war gerade erst neunzehn geworden, aber der schwere schwarze Haarknoten, der ihren Kopf nach hinten zog, und ihre melancholischen blauen Augen ließen sie älter wirken. Zu Pierre war sie aufmerksam und charmant, obwohl sie ihm zuweilen traurig und abwesend schien. Er wollte ihre Schwermut vertreiben und war lustig, ohne plump zu sein. Wenn Isabelle lachte, war er der glücklichste Mann auf der Welt. Es gefiel ihm, daß sie ihr prächtiges Haar nicht der Mode geopfert hatte wie die meisten Damen der feinen Gesellschaft von Bordeaux.
Isabelle de Montpleynet war die einzige Tochter eines reichen Grundbesitzers auf Martinique. Dort hatte sie auch die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbracht und sich den dort üblichen melodischen Tonfall und eine geschmeidige Gewandtheit der Bewegungen bewahrt. Hinter ihrer scheinbaren Nonchalance verbarg sich jedoch ein stolzer, starker Charakter, der sich im Laufe der Jahre immer stärker herausbildete. Nach dem Tode ihrer Mutter, einer hinreißend schönen Kreolin, hatte der verzweifelte Vater sie seinen Schwestern anvertraut, Albertine und Lisa de Montpleynet, zwei unverheirateten alten Damen, die in Paris lebten. Sechs Monate später war auch er gestorben. Er hinterließ seiner Tochter riesige Plantagen. Schon nach kurzer Bekanntschaft erklärte Pierre Delmas Isabelle seine Liebe und hielt um ihre Hand an ‒ ohne sich indes allzu große Hoffnungen zu machen. Zu seiner äußersten Überraschung und Freude willigte sie ein. Vier Wochen später heirateten sie in einer prunkvollen Zeremonie in Saint-Thomas-d’Aquin. Nach einem längeren Aufenthalt auf Martinique ließen sie sich auf Gut Montillac nieder, begleitet von Ruth, der alten Gouvernante, von der Isabelle sich nicht hatte trennen wollen.
Obwohl Isabelle eine Fremde war, wurde sie von Verwandten und Nachbarn rasch als eine der ihren aufgenommen. Ihre beträchtliche Aussteuer verwandte sie auf die Verschönerung des neuen Heims. Pierre hatte während seines Junggesellendaseins nur drei Räume bewohnt; die übrigen hatten leergestanden. Das änderte sich innerhalb eines Jahres gründlich, und als Françoise, ihre älteste Tochter, geboren wurde, war das alte Haus nicht mehr wiederzuerkennen. Zwei Jahre danach kam Léa zur Welt, dann, im Abstand von drei Jahren, Laure.
Pierre Delmas, der Eigentümer von Montillac, galt als der glücklichste Mann der ganzen Gegend. Von La Réole bis Bazas, von Langon bis Cadillac beneidete ihn manch einer um sein stilles Glück. Schloß Montillac lag inmitten mehrerer Hektar fruchtbaren Landes, zu dem viel Wald, vor allem aber Weinberge gehörten. Die Reben lieferten einen Weißwein, der im Geschmack dem berühmten Sauternes nahekam und bereits mit etlichen Goldmedaillen ausgezeichnet worden war. Auch einen kräftigen vollmundigen Rotwein gab es in Montillac.
Die Bezeichnung »Schloß« für den aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert stammenden weitläufigen Landsitz, war ziemlich hochgegriffen. Außer ein paar Weinkellern bestand es aus einem Bauernhof mit Scheunen, Ställen und Remisen. Pierres Großvater hatte die hübschen rosaroten bis dunkelbraunen Ziegel der Gegend durch ein kaltes graues Schieferdach ersetzen lassen, das angeblich als vornehm galt. Auf den Weinkellern und Wirtschaftsgebäuden war zum Glück die ursprüngliche Bedachung erhalten geblieben. Das Haus mit dem grauen Dach nahm sich daneben ehrwürdig und ein wenig trist aus und entsprach ganz dem Geist der großbürgerlichen Vorfahren aus Bordeaux. Man erreichte das Gut, das zwischen Verdelais und St. Macaire auf einem Hügel mit einem prachtvollen Ausblick auf die Garonne und das Langonnais gelegen war, über eine lange Platanenallee, die an einem alten Taubenschlag vorbeiführte. Gleich hinter der ersten Scheune verlief die »Straße«, wie man den Weg zwischen dem Bauernhof und den Wirtschaftsgebäuden des Schlosses nannte, zu denen auch eine riesengroße Küche gehörte. Hier war der eigentliche Eingang des Hauses. Nur Fremde empfing man in der Diele, deren schwarzweiß gefliester Boden mit einem farbenfrohen Teppich bedeckt war und deren Einrichtung sich aus den verschiedensten Stilrichtungen zusammensetzte. Alte Teller, reizende kleine Aquarelle und ein herrlicher Directoire-Spiegel verliehen den weißen Wänden eine heitere Note.
Durch die Eingangshalle gelangte man in den Hof, in dem zwei riesige Linden standen. Hier lebte die Familie von den ersten Frühlingstagen bis zum Beginn des Herbstes. Ein friedlicheres Fleckchen hätte man sich nicht vorstellen können. Zum Teil gesäumt von Fliederbüschen und Ligusterhecken, führte der Platz zwischen zwei Steinsäulen auf einen ausgedehnten Rasen, der sanft zur Terrasse hin abfiel und den Blick weit über das Land freigab. Zur Rechten sah man einen Hain, einen Blumengarten und die Weinberge, die sich rings um das Gut bis hin nach Bellevue erstreckten.
Pierre Delmas hatte diesen Flecken Erde liebengelernt, und inzwischen bedeutete er ihm beinahe ebensoviel wie seine Töchter. Er war ein leicht aufbrausender und doch sensibler Mann. Sein viel zu früh gestorbener Vater hatte ihm die Leitung des Guts übertragen, das seine Brüder und Schwestern verschmäht hatten, weil es zu weit von Bordeaux entfernt lag und nicht genug einbrachte. Bei der Übernahme hatte Pierre Delmas sich geschworen, ein rentables Weingut daraus zu machen, und sich bei seinem Freund Raymond d’Argilat, einem reichen Großgrundbesitzer aus Saint-Emilion, hoch verschuldet, um seine Brüder auszuzahlen. Und so war es gekommen, daß er zwar nicht an Bord eines Frachters gleich nach dem lieben Gott alleiniger Herrscher geworden war, wohl aber auf Montillac.
1
Der August neigte sich seinem Ende zu. Die siebzehnjährige Léa, zweitälteste Tochter von Pierre Delmas, saß mit halb geschlossenen Augen auf dem noch warmen Steinmäuerchen der Terrasse von Montillac und ließ die nackten, gebräunten Beine mit den gestreiften Leinenschuhen herunterbaumeln. Sie hatte sich der Ebene zugewandt, über die an manchen Tagen der salzige Geruch der Pinien heranwehte, die Hände links und rechts neben sich aufgestützt, und genoß es, das pulsierende Leben ihres Körpers unter dem leichten weißen Leinenkleid zu spüren. Mit einem wohligen Seufzer räkelte sie sich und bewegte sich fast wie ihre Katze Mona, wenn sie im Sonnenschein erwachte.
Wie ihr Vater liebte Léa dieses Gut, von dem sie jeden Winkel kannte. Als Kind hatte sie sich hinter den Bündeln aus Rebenreisig und zwischen den langen Reihen der Weinfässer versteckt und hatte mit Vettern, Cousinen und den Nachbarskindern Fangen gespielt.
Léa und Mathias Fayard, der um drei Jahre ältere Sohn des Kellermeisters, waren unzertrennliche Spielkameraden gewesen. Sie brauchte ihn bloß anzulächeln, und schon las er ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Léas lockiges Haar war ständig in Unordnung, ihre Knie aufgeschürft, und ihr Gesicht schien nur aus zwei großen veilchenblauen Augen zu bestehen, die unter langen schwarzen Wimpern hervorschauten. Ihr Lieblingsspiel bestand darin, Mathias in Versuchung zu führen. An ihrem vierzehnten Geburtstag hatte sie ihn aufgefordert: »Zeig mir, wie Mann und Frau sich lieben!« Überglücklich nahm er sie daraufhin im Heu in der Scheune in seine Arme und bedeckte das schöne, hingebungsvolle Gesicht mit vielen kleinen Küssen. Aufmerksam unter halb geschlossenen Lidern hervorschauend, verfolgten die großen blauen Augen jede seiner Bewegungen. Sie stützte sich auf, um ihm zu helfen, als er die zarte weiße Bluse aufknöpfen wollte. Doch dann, aus einem plötzlichen Schamgefühl heraus, hatte sie die Hände über ihre kindlichen Brüste gelegt; ein unbekanntes Verlangen war in ihr entbrannt.
Als sie draußen die Stimme Pierre Delmas’ hörten, hatte Mathias in seinen Liebkosungen innegehalten. »Hör nicht auf«, hatte Léa geflüstert und seinen Kopf mit dem krausen braunen Haar an sich gepreßt.
»Dein Vater . . .«
»Hast du etwa Angst?«
»Das nicht, aber was ist, wenn er uns sieht?«
»Macht doch nichts! Was tun wir denn Schlimmes?«
»Das weißt du ganz genau. Deine Eltern sind immer so gut zu uns!«
»Aber du liebst mich doch!«
Er hatte sie lange betrachtet. Wie schön sie war: In ihrem Haar hatten sich kleine getrocknete Blumen und Grashalme verfangen, ihre Augen glänzten, der halb geöffnete Mund entblößte kleine weiße Raubtierzähne, die Spitzen ihrer knospenden Brüste hatten sich aufgerichtet. Er streckte die Hand aus, zog sie aber sogleich wieder zurück. Als spreche er zu sich selbst, sagte er: »Nein, es wäre nicht recht. Lieber nicht . . .« Dann fuhr er mit festerer Stimme fort: »Ja, ich liebe dich, und weil ich dich liebe, will ich dich nicht einfach . . . Du bist schließlich die Tochter des Gutsbesitzers, und ich . . .«
Er kletterte bereits die Leiter hinab.
»Mathias . . .«
Er antwortete nicht. Sie hörte nur noch, wie das Scheunentor hinter ihm ins Schloß fiel.
»So ein Trottel!«
Sie knöpfte ihre Bluse wieder zu und schlief ein. Erst beim zweiten Ruf zum Abendessen wurde sie wach.
In der Ferne, vom Kirchturm in Langon oder in Saint-Macaire, schlug es fünf. Sultan, der Hofhund, jagte fröhlich bellend hinter zwei jungen Männern her, die lachend den Rasen hinunterstürmten. Raoul Lefèvre erreichte vor seinem Bruder Jean das Mäuerchen, auf welchem Léa Platz genommen hatte. Atemlos lehnten sie sich rechts und links von Léa gegen die Mauer. Léa sah sie schmollend an.
»Ihr kommt ja reichlich spät! Ich dachte schon, ihr wärt zu dieser blöden Noëlle Villeneuve gegangen. Sie läßt ja keine Gelegenheit entgehen, euch schöne Augen zu machen.«
»Noëlle ist nicht blöd!« protestierte Raoul.
Sein Bruder versetzte ihm einen Tritt. »Ihr Vater hat uns aufgehalten. Villeneuve glaubt, daß es bald Krieg geben wird.«
»Der Krieg, der Krieg ‒ von nichts anderem ist mehr die Rede. Ich kann es nicht mehr hören! Es interessiert mich überhaupt nicht«, entgegnete Léa schroff und schwang ihre Beine über die Mauer. Mit großer Geste warfen Jean und Raoul sich ihr zu Füßen.
»Vergib uns, Königin unserer Nächte, Sonne unserer Tage! Schämen soll er sich, dieser Krieg, der die jungen Mädchen unglücklich macht und die jungen Männer dahinrafft! Deine verhängnisvolle Schönheit soll sich nicht in die Niederungen dieser erbärmlichen Kleinigkeiten begeben müssen! Unsere Liebe zu dir ist ohnegleichen. Wen von uns erwählst du, o Königin? Triff deine Wahl. Jean? Der Glückliche! Augenblicklich will ich tot daniedersinken vor Verzweiflung«, deklamierte Raoul und ließ sich mit ausgebreiteten Armen zu Boden fallen.
Mit schelmischen Blicken umkreiste Léa den am Boden liegenden Körper, stieg mit verächtlicher Miene über ihn hinweg, stieß ihn mit dem Fuß an und meinte nicht minder dramatisch:
»Im Tode ist er noch größer als zu Lebzeiten.«
Jean bemühte sich, ernst zu bleiben, als Léa seinen Arm ergriff und ihn mit sich fort zog.
»Soll er doch da bleiben, der stinkende Kadaver. Kommt, mein Freund, und werbt um mich.«
Die beiden entfernten sich unter dem gespielt verzweifelten Blick Raouls, der ihnen mit erhobenem Kopf nachsah.
Raoul und Jean Lefèvre verfügten über enorme Kräfte. Die beiden jungen Männer ‒ zwanzig und einundzwanzig Jahre alt ‒ waren einander beinahe ebenso zugetan wie Zwillinge. Machte Raoul eine Dummheit, nahm auch Jean die Schuld auf sich; erhielt Jean ein Geschenk, teilte er es sogleich mit seinem Bruder. Auf dem Gymnasium in Bordeaux hatten sie die Lehrer durch ihr unverhohlenes Desinteresse schier zur Verzweiflung gebracht. Jahrelang gehörten sie zu den Schlechtesten der Klasse. Das Abitur hatten sie mit Verspätung geschafft ‒ und das nur, um, wie sie erklärten, ihrer Mutter Amélie eine Freude zu machen. Der eigentliche Grund waren indes wohl die Hiebe mit der Reitpeitsche gewesen, die die temperamentvolle Frau ohne zu zögern unter ihrem vielköpfigen wilden Nachwuchs auszuteilen pflegte. Bereits in jungen Jahren hatte der Tod ihres Mannes sie mit sechs Kindern, von denen das jüngste gerade zwei Jahre alt war, alleingelassen. Mit Energie und Ausdauer hatte sie das Weingut La Verderais weitergeführt.
Sie mochte Léa nicht sonderlich, hielt sie für schlecht erzogen, ja für unausstehlich. Es war kein Geheimnis, daß Raoul und Jean Lefèvre in das Mädchen verliebt waren; die anderen Jungen witzelten darüber, und die Mädchen ärgerten sich.
»Sie ist unwiderstehlich«, sagten die jungen Burschen. »Wenn sie einen aus halb geschlossenen Augen anschaut, würde man alles dafür geben, sie in die Arme nehmen zu dürfen.«
»Allen Männern läuft sie nach!« sagten die Mädchen voll Eifersucht. »Sobald sie merkt, daß einer sich für eine andere interessiert, macht sie ihm schöne Augen.«
»Mag sein, aber mit Léa kann man sich über alles unterhalten: Pferde, Pinien, Weinberge und vieles andere.«
»Das paßt zu einem Bauern, aber nicht zu einem Mädchen von Welt. An ihr ist ein Junge verlorengegangen! Schickt es sich vielleicht, allein oder mit Männern und dem Gesinde den Kühen beim Kalben und den Pferden bei der Paarung zuzusehen ‒ oder mitten in der Nacht aufzustehen, um mit dem Hund Sultan den Mond zu betrachten? Ihre Mutter ist ratlos. Léa wurde wegen Ungehorsams aus dem Internat verwiesen. Sie sollte sich ein Beispiel an ihrer Schwester Françoise nehmen. Das ist ein ordentliches junges Mädchen . . .«
»Aber so langweilig! Sie hat nichts als Musik und Kleider im Kopf . . .«
Léas Macht über die Männer war in der Tat grenzenlos. Nicht einer, der ihr zu widerstehen vermocht hätte. Alt oder jung, Pächter oder Eigentümer, das Mädchen wickelte sie alle um den Finger. Für ein Lächeln von ihr hätte so mancher eine Dummheit begangen ‒ ihr Vater zuallererst.
Hatte sie irgend etwas angestellt, ging sie in sein Arbeitszimmer, setzte sich auf seine Knie und schmiegte sich in seine Arme. Das Glücksgefühl, das Pierre Delmas in solchen Augenblicken durchströmte, war so mächtig, daß er die Augen schloß, um es besser genießen zu können.
Raoul sprang auf und gesellte sich zu Léa und Jean.
»Kuckuck, ich bin wiederauferstanden! Worüber habt ihr gesprochen?«
»Von der Gartenparty, die Monsieur d’Argilat morgen gibt, und von dem Kleid, das Léa anziehen soll.«
»Was du auch trägst, ich bin sicher, du wirst die Schönste sein!« meinte Raoul und faßte Léa um die Taille.
Sie befreite sich lachend. »Hör auf, du kitzelst mich! Es wird ein herrliches Fest werden. Und weil Laurent seinen vierundzwanzigsten Geburtstag feiert, wird sich alles um ihn drehen. Nach dem Picknick findet ein Ball statt, dann das Abendessen und schließlich ein Feuerwerk. Wenn das nichts ist!«
»Laurent d’Argilat hat doppelten Grund zu feiern«, sagte Jean.
»Was meinst du damit?« Léa hob ihr hübsches, sommersprossiges Gesicht.
»Das darf ich dir nicht sagen; das ist noch geheim.«
»Du hast also Geheimnisse vor mir! Und du«, wandte sie sich an Raoul, »weißt du, was er meint?«
»Ja, ich glaube schon . . .«
»Ich habe gedacht, ich wäre eure Freundin und ihr hättet mich so gern, daß ihr mir nichts verheimlichen würdet«, maulte Léa und ließ sich auf die kleine Steinbank vor der Mauer des Weinkellers fallen. Sie tat, als wische sie sich mit dem Rocksaum über die Augen. Schniefend beobachtete sie aus den Augenwinkeln, wie die beiden Brüder einander verlegen ansahen. Léa nutzte ihre Unschlüssigkeit aus und versetzte ihnen den Gnadenstoß, indem sie sie von unten her mit falschen Tränen in den Augen ansah: »Laßt mich allein, ihr habt mich gekränkt!«
Raoul wurde weich. »Also gut. Monsieur d’Argilat wird morgen die Vermählung seines Sohnes bekanntgeben . . .«
»Die Vermählung seines Sohnes?« fiel Léa ihm ins Wort. Sie verstellte sich nicht länger, sondern stieß heftig hervor: »Du mußt völlig übergeschnappt sein. Laurent denkt nicht daran zu heiraten, das hätte er mir bestimmt gesagt!«
»Wahrscheinlich hatte er noch keine Gelegenheit dazu, aber du weißt doch, daß er seit seiner Kindheit mit Camille d’Argilat, seiner Cousine, verlobt ist«, fuhr Raoul fort.
»Camille d’Argilat? Aber die liebt er doch gar nicht! Das war doch nur Spielerei, um den Eltern einen Gefallen zu tun!«
»Da irrst du dich. Morgen wird offiziell die Verlobung zwischen Laurent und Camille bekanntgegeben; sie wollen schon sehr bald heiraten, wegen des Krieges . . .«
Léa hörte nicht mehr hin. Ihre Fröhlichkeit wich einer furchbaren Panik. Ihr wurde abwechselnd warm und kalt, ihr wurde übel, und der Kopf tat ihr weh. Laurent und heiraten? Das konnte nicht wahr sein! Alle wußten zwar nur Gutes über Camille zu erzählen, aber sie war bestimmt nicht die richtige Frau für ihn; eine Intellektuelle, die ständig über ihren Büchern saß, eine richtige Städterin. Er kann dieses Mädchen nicht heiraten, er liebt doch mich! Ich habe es neulich genau gespürt an der Art, wie er meine Hand hielt, wie er mich ansah. Ich weiß es, ich fühle es.
»Das interessiert Hitler doch nicht . . .«
»Trotzdem, in Polen . . .«
Die beiden Brüder waren so sehr in ihre Unterhaltung vertieft, daß sie die Veränderung, die mit Léa vor sich gegangen war, gar nicht bemerkten.
»Ich muß ihn unbedingt sehen«, sagte sie laut.
»Was sagst du da?« fragte Jean.
»Ach nichts, ich muß jetzt nach Hause.«
»Jetzt schon? Wir sind doch gerade erst gekommen.«
»Ich bin müde und habe Kopfschmerzen.«
»Morgen auf Roches-Blanches wirst du doch bestimmt nur mit Raoul und mir tanzen, versprochen?«
»Meinetwegen, meinetwegen«, sagte Léa gereizt und erhob sich.
»Hurra!« schrien sie in gemeinsamer Vorfreude.
»Grüß deine Mutter von uns.«
»Werde ich tun. Bis morgen.«
»Und vergiß nicht: Jeder Tanz gehört uns!«
Die beiden rannten davon.
Die benehmen sich wie kleine Kinder, dachte Léa. Entschlossen kehrte sie dem Haus den Rücken und steuerte auf den Kalvarienberg zu, der ihr schon als Kind stets Zufluchtsstätte gewesen war, wenn sie Kummer hatte. Hatte sie sich mit ihren Schwestern gezankt, hatte Ruth sie bestraft, weil sie ihre Hausaufgaben vernachlässigt hatte, oder war sie von der Mutter gescholten worden, immer hatte sie sich in eine der Kapellen geflüchtet, um ihren Schmerz oder Zorn zu besänftigen.
Sie machte einen weiten Bogen um den Hof von Sidonie, die früher im Schloß Köchin gewesen war, dann aber infolge Krankheit ihre Stellung hatte aufgeben müssen. Als Dank für ihre treuen Dienste hatte Pierre Delmas ihr dieses Haus zur Verfügung gestellt, dessen Lage einen weiten Blick in die Umgebung bot. Léa kam des öfteren auf ein Plauderstündchen zu Besuch zu der alten Frau, die ihr jedesmal ein Gläschen ihres Johannisbeerlikörs aufdrängte. Sie war überaus stolz auf ihr Gebräu, und Léa versäumte es nie, ihr das erhoffte Kompliment zu machen, obgleich es ihr vor Johannisbeerlikör grauste. Heute jedoch konnte sie Sidonies Geschwätz und ihren Cassis unmöglich ertragen.
Atemlos blieb sie vor dem Kalvarienkreuz stehen und ließ sich, den Kopf zwischen den eiskalten Händen, auf die unterste Stufe fallen. Ein fürchterlicher Schmerz durchbohrte sie, das Blut pochte in ihren Schläfen, in ihren Ohren rauschte es, und der Geschmack von Galle erfüllte ihren Mund. Sie hob den Kopf und spie aus.
»Nein, es kann nicht sein! Es ist einfach nicht wahr!« Die Gebrüder Lefèvre hatten ihr bestimmt nur aus Eifersucht von Laurents bevorstehender Heirat erzählt. Heiratete man etwa, bloß weil man im Kindesalter einander versprochen worden war? Camille war außerdem viel zu häßlich für Laurent. Ihr braver, schwermütiger Blick, ihre angeblich zarte Gesundheit, ihr unscheinbares Auftreten ‒ wie öde und lustlos ein Leben an der Seite einer solchen Frau! Nein, Laurent konnte sie unmöglich lieben; sie allein, Léa, liebte er und nicht dieses schmächtige Ding, das sich nicht einmal richtig auf einem Pferd halten oder eine Nacht hindurch tanzen konnte . . . Er liebte sie, davon war sie überzeugt. Seine Art, ihre Hand zu halten, ihren Blick zu suchen, hatte es bewiesen . . . Gestern erst am Strand . . . sie hatte den Kopf in den Nacken geworfen . . . und sie hatte gespürt, wie leidenschaftlich gern er sie geküßt hätte. Freilich hatte er es nicht getan . . . Sie gingen einem wirklich auf die Nerven, diese jungen Männer der guten Gesellschaft, arme Gefangene ihrer Erziehung! Nein, Laurent konnte Camille unmöglich lieben.
Diese Gewißheit gab ihr neuen Mut. Entschlossen, herauszufinden, was wirklich dran war an diesem Märchen, richtete sie sich auf. Die beiden Lefèvres würden teuer bezahlen für diesen üblen Scherz. Sie blickte zu den drei Kreuzen auf und murmelte: »Hilf mir!«
Léas Vater war heute morgen nach Roches-Blanches gefahren, er mußte jeden Augenblick zurückkehren. So beschloß sie, ihm entgegenzugehen. Er würde ihr bestimmt sagen können, was es mit dieser Geschichte auf sich hatte.
Wie erstaunt war sie, als er ihr unterwegs plötzlich entgegenkam. »Du bist ja gerannt, als wäre der Teufel hinter dir her! Hast du dich wieder mal mit deinen Schwestern gestritten? Du bist feuerrot im Gesicht, und dein Haar ist ganz durcheinander.«
Sie hatte sich bemüht, eine gefaßte Miene aufzusetzen, als sie ihren Vater erspäht hatte, geradeso, wie man sich hastig das Gesicht pudert, wenn unangemeldet Besuch vor der Türe steht: das Ergebnis war mangelhaft. Sie zwang sich zu einem Lächeln, ergriff ihres Vaters Arm, legte den Kopf an seine Schulter und sagte mit zuckersüßer Stimme:
»Wie schön, dich zu sehen, Papa; ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ein herrlicher Tag, nicht wahr?«
Leicht verwundert über den scherzenden Ton, drückte Pierre Delmas seine Tochter an sich. Sein Blick schweifte über die Weinberge, deren schöne Regelmäßigkeit den Eindruck von Ordnung und Beschaulichkeit vermittelte. Seufzend meinte er: »Ja, ein herrlicher, friedlicher Tag. Womöglich der letzte.«
Gedankenlos entgegnete Léa: »Der letzte? Warum denn? Der Sommer ist noch nicht vorbei, und auf Montillac ist die schönste Jahreszeit der Herbst.«
Pierre Delmas lockerte seine Umarmung und sagte nachdenklich: »Ja, es ist die schönste Jahreszeit . . . Dennoch überrascht mich deine Unbekümmertheit. Alle um dich herum reden von einem bevorstehenden Krieg und du . . .«
»Der Krieg, der Krieg!« fiel sie ihm heftig ins Wort. »Ich kann das Gerede vom Krieg nicht mehr hören! Hitler ist doch nicht so verrückt und erklärt Polen den Krieg; und wenn, was geht uns das an? Sollen doch die Polen sehen, wie sie zurechtkommen!«
»Sei still, du weißt nicht, was du sagst!« schrie er und packte sie am Arm. »Zwischen unseren beiden Staaten besteht ein Bündnis. Weder Großbritannien noch Frankreich können sich dem entziehen.«
»Die Russen haben sich doch mit Deutschland verbündet.«
»Ja, zu ihrer Schande. Aber Stalin wird eines Tages begreifen, daß er hereingelegt worden ist. Chamberlain wird tun, was die Ehre ihm zu tun befiehlt; er wird Hitler zu verstehen geben, daß er das Bündnis zwischen England und Polen zu respektieren gedenkt.«
»Und dann?«
»Dann? Dann gibt es Krieg.«
Betroffenes Schweigen senkte sich über Vater und Tochter. Nach einer Weile brach Léa es: »Aber Laurent d’Argilat sagt doch, wir sind gar nicht vorbereitet, unsere Waffen stammen aus dem Ersten Weltkrieg, sie taugen höchstens noch für ein Waffenmuseum, unsere Luftwaffe ist unfähig und unsere schwere Artillerie erbärmlich . . .«
»Für jemanden, der nichts vom Krieg wissen will, bist du aber gut über unsere Streitkräfte informiert, besser jedenfalls als dein Vater. Was hältst du von der Tapferkeit unserer Soldaten?«
»Laurent sagt, die Franzosen hätten keine Lust zu kämpfen.«
»Es wird ihnen aber nichts anderes übrigbleiben . . .«
». . . und sie sterben für nichts und wieder nichts in einem Krieg, den sie gar nicht wollen.«
»Sie warden für die Freiheit sterben . . .«
»Die Freiheit . . . eine schöne Freiheit, wenn man tot ist! Ich will nicht sterben, und ich will auch nicht, daß Laurent stirbt!« Ihre Stimme war heiser geworden. Sie wandte den Kopf, damit ihr Vater ihre Tränen nicht sah.
Delmas war von den Worten seiner Tochter erschüttert. Daß sie weinte, merkte er nicht.
»Wenn du ein Mann wärst, Léa, würde ich dich einen Feigling nennen.«
»Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Papa! Verzeih mir, ich hab dir weh getan, aber ich fürchte mich.«
»Wir haben alle Angst . . .«
»Laurent nicht! Er sagt, er wird seine Pflicht tun, obgleich er überzeugt ist, daß wir geschlagen werden.«
»Die gleiche Miesmacherei habe ich heute nachmittag bei seinem Vater herausgehört.«
»Warst du in Roches-Blanches?«
»Ja.«
Léa legte ihre Hand in die des Vaters, schenkte ihm ihr zärtlichstes Lächeln und zog ihn mit sich fort.
»Komm, gehen wir nach Hause, sonst wird es zu spät, und Mama macht sich Sorgen.«
»Du hast recht«, meinte er und lächelte zurück.
Sie machten halt bei Bellevue, um Sidonie zu begrüßen, die nach dem Abendessen draußen ein wenig frische Luft schöpfte.
»Na, Sidonie, wie geht’s?«
»Oh, es könnte schlimmer sein, Monsieur. Solange das Wetter gut ist, wärmt die Sonne meine alten Knochen. Und hier ist es doch so schön.« Mit einer weitausholenden Handbewegung wies sie auf die wunderbare Landschaft. Im Schein der untergehenden Sonne leuchtete das Smaragdgrün der Reben, die staubigen Straßen und die ziegelgedeckten Weinkeller wirkten golden; über allem lag ein Licht von trügerischem Frieden.
»Kommt doch auf ein Gläschen herein . . .«
Die Glocke am Gutshaus läutete zum Abendessen. So blieb ihnen der Johannisbeerlikör erspart.
Unterwegs fragte Léa, die sich bei ihrem Vater eingehängt hatte: »Worüber habt ihr sonst noch gesprochen, Monsieur d’Argilat und du, abgesehen vom Krieg? Über das Fest von morgen?«
In dem Bestreben, seine Tochter auf andere Gedanken zu bringen, erwiderte Pierre Delmas: »Es wird bestimmt ein herrliches Fest werden, das schönste seit langem. Ich will dir ein Geheimnis verraten ‒ aber nur, wenn du mir versprichst, es deinen Schwestern nicht weiterzusagen. Die können nämlich ihren Mund nicht halten.«
Unwillkürlich verlangsamte Léa ihren Schritt; ihr wurden plötzlich die Beine schwer.
»Was für ein Geheimnis?«
»Morgen wird Monsieur d’Argilat die Vermählung seines Sohnes bekanntgeben.«
Léa blieb stehen; sie sagte kein Wort.
»Willst du denn nicht wissen, mit wem?«
»Mit wem?« brachte sie mühsam hervor.
»Mit seiner Cousine Camille d’Argilat. Das kommt ja nicht überraschend. Camille wollte allerdings den Hochzeitstermin vorverlegen, weil soviel vom Krieg gemunkelt wird . . . aber . . . aber was hast du denn?«
Pierre Delmas faßte Léa am Arm, da sie zu fallen schien. »Du bist ja ganz blaß, mein Schatz . . . was ist mit dir? Du bist doch hoffentlich nicht krank? Ist es wegen Laurents Hochzeit? . . . Du bist doch nicht etwa in ihn verliebt?«
»Doch . . . ich liebe ihn, und er liebt mich!«
Fassungslos führte er Léa zu einer Bank am Wegesrand, drückte sie nieder und setzte sich neben sie.
»Was erzählst du denn da! Er kann dir unmöglich gesagt haben, daß er dich liebt. Er weiß doch, daß er seine Cousine heiraten muß. Wie kommst du darauf, daß er dich lieben könnte?«
»Ich weiß es, das ist alles.«
»Das ist alles . . .«
»Ich gehe zu ihm hin und sage ihm, daß ich ihn liebe, dann kann er seine Cousine, diese dumme Gans, nicht heiraten.«
Pierre Delmas sah seine Tochter betrübt an. Dann sagte er streng: »Zunächst einmal ist Camille d’Argilat nicht dumm. Sie ist ein reizendes Mädchen, wohlerzogen und gebildet, genau die richtige Frau für Laurent . . .«
»Ganz bestimmt nicht.«
»Laurent ist ein Mann mit strengen Grundsätzen; ein Mädchen wie du würde sich bald mit ihm langweilen.«
»Das ist mir gleich, ich liebe ihn so, wie er ist. Und ich werde es ihm sagen . . .«
»Gar nichts wirst du ihm sagen! Ich will nicht, daß sich meine Tochter einem Mann an den Hals wirft, der eine andere liebt.«
»Er liebt keine andere, denn er liebt ja mich.«
Als er die Bestürzung im Gesicht seiner Tochter sah, zögerte Pierre Delmas einen Augenblick. »Er liebt dich nicht. Er selbst hat mir voller Freude von seiner Hochzeit erzählt«, sagte er dann.
Der Schrei, der sich der Kehle seiner Tochter entrang, traf ihn wie ein Schlag. Es war noch gar nicht lange her, da war seine Léa ein kleines Mädchen gewesen, war in sein Bett gekrochen, weil sie sich vor dem Wolf aus dem Märchen fürchtete, die die gute Ruth ihr erzählte, ‒ und jetzt war seine kleine Léa verliebt!
»Aber Häschen, meine Kleine, mein Lämmchen!«
»Papa . . . oh, Papa!«
»Ist ja gut, ich bin ja da . . . Wisch dir die Tränen ab . . . Wenn deine Mutter dich so sieht, macht sie sich Sorgen. Versprich mir, daß du vernünftig sein wirst. Du darfst dich nicht so weit erniedrigen, Laurent deine Liebe zu gestehen. Du mußt ihn vergessen . . .«
Léa hörte nicht hin. Ein hoffnungsvoller Gedanke riß sie aus ihrer Trübseligkeit. Sie nahm das Taschentuch, das er ihr reichte, und schneuzte sich geräuschvoll ‒ »Nicht gerade wie eine Frau von Welt«, hätte Françoise gesagt. Lächelnd hob sie ihr fleckiges Gesicht. »Du hast recht, Papa, ich werde ihn vergessen.«
Das Erstaunen, das sich in seinem Gesicht widerspiegelte, war so komisch, daß Léa in Gelächter ausbrach.
Da soll sich einer bei den Frauen auskennen, sagte sich Delmas, und ein großer Stein fiel ihm vom Herzen.
Der zweite Glockenschlag, der zum Abendessen rief, trieb sie zur Eile an.
Vor dem Essen rannte Léa hinauf in ihr Zimmer. Sie tauchte ihr Gesicht in kaltes Wasser und bürstete sich das Haar. Prüfend betrachtete sie ihr Spiegelbild. Fast nichts mehr zu sehen, dachte sie. Nur ihre Augen glänzten ein wenig stärker als gewöhnlich.
2
Léa hatte, um nicht am traditionellen Abendspaziergang teilnehmen zu müssen, eine Migräne vorgeschützt. Diese Ausrede hatte ihr Ruths Fürsorge und von seiten ihrer Mutter ein besorgtes Streicheln über die Stirn eingetragen, die daraufhin einstimmig für zu heiß befunden wurde. Als die Familie außer Haus war, flüchtete Léa ins »Kinderzimmer«, wie es noch immer genannt wurde.
Dies war ein großer Raum im ältesten Flügel des Schlosses, in welchem sich ansonsten die Unterkünfte der Dienstboten und die Rumpelkammer befanden. Das »Kinderzimmer« war ein einziges großes Durcheinander. Hier stapelten sich Truhen aus Korbgeflecht voller altmodischer Kleider; früher hatten die Delmas-Mädchen sie an Regentagen mit großer Freude hervorgekramt, um sich zu verkleiden; daneben gab es Schneidermannequins, deren Rundungen derart übertrieben waren, daß sie wie Parodien auf den weiblichen Körper wirkten; in zahlreichen Kisten lagerten kostbare Bücher aus dem Besitz Pierre Delmas’ und seiner Brüder. Anhand dieser Bände hatten Léa und ihre Schwestern lesen gelernt. Aus hohen Fenstern, die außer Reichweite der Kinder lagen, fiel Licht in das Zimmer, dessen Decke mit breiten Dachbalken versehen war. Der Boden bestand aus verblaßten, teilweise gelockerten und hier und da zerbrochenen Terrakottafliesen und war mit alten, verschossenen Teppichen bedeckt; die Tapeten waren verblaßt. Dieses Zimmer war einer von Léas Schlupfwinkeln. Inmitten von unbrauchbar gewordenem Kinderspielzeug lag sie oft stundenlang zusammengekauert auf ihrem Kinderbett und las, träumte vor sich hin oder weinte, in den Armen ihre alte Lieblingspuppe.
Das letzte Tageslicht erhellte schwach den Raum und tauchte die Ecken in dunkle Schatten. Die Arme um ihre Beine geschlungen, hockte Léa in dem Kinderbett und starrte mit gerunzelter Stirn auf das Porträt einer Ahnfrau, ohne es indes wahrzunehmen.
Seit wann bin ich eigentlich in Laurent d’Argilat verliebt? fragte sie sich. Immer schon? Nein, das stimmt nicht. Seit dem vergangenen Jahr erst ‒ und zunächst hatte ich es nicht einmal bemerkt. Er übrigens auch nicht.
Alles hatte in den Osterferien begonnen, als Laurent seinen kranken Vater besuchte. Wie immer, wenn er in der Gegend war, hatte er Monsieur und Madame Delmas einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Léa hatte allein in dem kleinen Eingangssalon gesessen, vertieft in den neuesten Roman von François Mauriac, ihrem nächsten Nachbarn. So sehr war sie in ihre Lektüre versunken, daß sie die Eingangstüre nicht hatte gehen hören. Der herbe Geruch feuchter Erde war mit der frischen Frühlingsluft hereingeweht und hatte sie von ihrer Lektüre aufblicken lassen. Überrascht sah sie vor sich einen großen, gutaussehenden blonden Mann in Reitkleidung mit einer Gerte in den Händen. Die Bewunderung in seinen Augen war so offensichtlich, daß sie lebhaftes Vergnügen an seinem Blick empfand. Sie erkannte ihn in ihrer Verwirrung nicht sofort, aber ihr Herz begann schneller zu schlagen. Er lächelte. Endlich sprang sie auf und warf sich in einer kindlichen Geste an seinen Hals.
»Laurent!«
»Léa? Bist du es?«
»Ja, ich bin Léa!«
»Wie ist das möglich, als ich Sie . . . als ich dich das letztemal sah, warst du noch ein Kind, dein Kleid war zerrissen, dein Haar struppig und deine Beine aufgeschürft. Und jetzt . . . jetzt sehe ich eine bezaubernde, elegante junge Dame vor mir« ‒ er ließ sie sich vor ihm drehen, damit er sie besser bewundern konnte ‒ »mit einer kunstvollen Frisur« ‒ sie hatte ihr Haar Ruths Händen überlassen, die es zu meisterhaften Korkenziehern gebändigt hatten, so daß sie wie ein Burgfräulein aus dem Mittelalter wirkte.
»Gefalle ich dir?«
»Mehr, als ich mit Worten auszudrücken vermag.«
Wie stets, wenn sie jemanden zu becircen versuchten, klimperte Léa naiv mit den Wimpern ihrer großen dunkelblauen Augen. Man hatte ihr viel zu oft gesagt, wie unwiderstehlich sie dadurch wirkte.
»Ich könnte dich immerzu ansehen. Wie alt bist du jetzt?«
»Im August werde ich siebzehn.«
»Meine Cousine Camille ist zwei Jahre älter als du.«
Warum nur erweckte dieser Name ihr Mißfallen? Eigentlich hätte sie sich aus Höflichkeit nach Camilles Familie, die sie gut kannte, erkundigen müssen, aber der Gedanke, Camilles Namen auszusprechen, war ihr unerträglich.
Laurent d’Argilat fragte nach dem Befinden ihrer Eltern und Schwestern. Sie hörte kaum auf seine Fragen, beantwortete sie aufs Geratewohl mit Ja oder Nein und hatte nur Ohren für den Klang seiner Stimme, die sie erbeben ließ. Verwundert verstummte er und betrachtete sie mit größter Aufmerksamkeit. Léa war überzeugt, er hätte sie in diesem Augenblick in seine Arme genommen, hätten nicht ihre Mutter und die beiden Schwestern unerwartet das Zimmer betreten.
»Aber Léa! Laurent ist hier, und du hast uns nicht gerufen?«
Der junge Mann küßte der Mutter die Hand. »Jetzt weiß ich, woher Léa ihre schönen Augen hat«, sagte er und blickte das Mädchen an.
»Schweigen Sie! Man darf Léa nicht zu oft sagen, daß sie schön ist, sie weiß es nur zu gut.«
»Und was ist mit uns?« riefen Françoise und Laure.
Laurent beugte sich hinab und nahm die kleine Laure auf den Arm. »Jeder weiß, daß die Frauen von Montillac die schönsten der ganzen Gegend sind!«
Ihre Mutter hatte darauf bestanden, daß Laurent zum Abendessen blieb. Léa lauschte wie gebannt seinen Worten, auch dann noch, als er zum erstenmal die Möglichkeit eines Krieges erwähnte. Beim Abschied hatte er sie auf die Wange geküßt, viel länger, da war sie sicher, als ihre Schwestern. Vor Erregung hatte sie ein paar Sekunden lang die Augen geschlossen. Als sie sie wieder öffnete, begegnete ihr Blick dem ihrer Schwester Françoise, in dem sich Erstaunen und Verärgerung spiegelten. Auf der Treppe zu den Schlafzimmern hatte Françoise ihr dann zugeflüstert: »Den bekommst du nicht!«
Léa, die in Erinnerungen an den wunderbaren Abend schwelgte, hatte nichts darauf erwidert, und das verblüffte Françoise mehr als alles andere.
Eine Träne rann über Léas Wange.
Inzwischen war die Nacht hereingebrochen. Das stille Haus füllte sich mit den Stimmen der heimkehrenden Spaziergänger. Léa sah ihren Vater das Feuer im Wohnzimmerkamin entfachen, um die abendliche Feuchtigkeit zu vertreiben. Dann setzte er sich in seinen Sessel, legte die Füße auf den Feuerbock, und nahm Zeitung und Brille von dem einbeinigen, ovalen Tisch. Ihre Mutter, deren schönes, ebenmäßiges Gesicht der Schein der Lampe mit dem rosaseidenen Schirm erhellte, arbeitete an einer Stickerei. Ruth hatte sich neben die Stehlampe zurückgezogen und nähte die letzten Stiche an den Ballkleidern für das morgige Fest. Laure spielte mit einer der von ihr so geliebten Miniaturpuppen. Die ersten Takte eines Chopin-Walzers klangen herauf. Léa lauschte für ihr Leben gern dem Spiel von Françoise, deren Talent sie bewunderte – was sie ihr freilich niemals sagen würde . . . Die heimelige Atmosphäre im Schoß der Familie, die ihr manchesmal auf die Nerven ging, vermißte Léa an jenem Abend in der kühlen Finsternis des Kinderzimmers. Sie wünschte, sie könnte jetzt zu Füßen ihrer Mutter sitzen, auf dem kleinen Schemel, der ausschließlich ihr vorbehalten war, und ins Feuer schauen oder, den Kopf gegen die mütterlichen Knie gelehnt, von Ruhm und Liebe träumen oder lesen oder gar in den alten Fotoalben mit den abgegriffenen Einbänden blättern, die ihre Mutter wie Reliquien aufbewahrte.
Seit Beginn des Sommers war Laurent beinahe täglich nach Montillac gekommen. Gemeinsam galoppierten sie durch die Weinberge oder rasten in seinem neuen Wagen durch die eintönige Heidelandschaft und die schier endlosen Pinienwälder des Landes. Den Kopf gegen die Lehne des Cabriolets gelehnt, wurde Léa der vorbeihuschenden Baumwipfel, die in einen künstlich-blauen Postkartenhimmel ragten, nicht müde. Nur selten waren Léa und Laurent auf diesen Ausflügen allein, aber die Gegenwart der anderen nahm Léa hin als eine Konvention, die man eben wahren mußte. Sie rechnete es Laurent hoch an, daß er nicht von der plumpen Aufdringlichkeit der Lefèvre-Brüder war. Er redete wenigstens nicht in einem fort von Jagd, Weinbergen, dem Wald oder Pferden. Sie hatte ihren früheren Widerwillen gegen seine scharfsinnigen Beobachtungen über englische und amerikanische Autoren vergessen. Ihm zuliebe hatte sie Conrad, Faulkner und Fitzgerald im Originaltext gelesen; das war eine schwere Prüfung für sie gewesen, denn englische Texte fielen ihr nicht leicht. So ungeduldig sie sonst auch sein mochte, ertrug sie nun sogar seine Anfälle von Schwermut, wenn ihn der Gedanke an einen nahe bevorstehenden Krieg überkam.
»Unzählige Menschen werden wegen eines zweitrangigen Aquarellmalers sterben müssen«, sagte er traurig.
Was sie an anderen störte, bei ihm akzeptierte sie es, weil ein Lächeln, ein liebevoller Blick oder ein Händedruck sie für alles entschädigte.
»Léa, bist du da?«
Ein helles Rechteck flutete in den dunklen Raum, als die Tür geöffnet wurde. Die Stimme der Mutter ließ sie zusammenfahren. Als Léa sich aufrichtete, knarrte das Bett.
»Ja, Mama.«
»Was machst du denn hier im Dunkeln?«
»Ich hab’ nachgedacht.«
Das grelle Licht der Glühbirne blendete sie schmerzhaft, und sie bedeckte ihre Augen mit dem angewinkelten Arm.
»Mach bitte das Licht wieder aus, Mama!«
Isabelle Delmas gehorchte und trat näher. Sie stieg über einen Stapel Bücher hinweg, der ihr den Weg versperrte, setzte sich auf einen alten, eingedrückten Betschemel am Fußende des Bettes und strich ihrer Tochter über das zerzauste Haar.
»Sag mir, was dich bedrückt, mein Schatz.«
Léas Kehle schnürte sich zusammen, und das Bedürfnis, ihr Herz auszuschütten, wurde übermächtig. Doch sie kannte die strengen Ansichten ihrer Mutter in diesem Punkt und widerstand ihrem Verlangen, ihr die Liebe zu einem Mann zu gestehen, der im Begriff war, eine andere zu heiraten. Um nichts in der Welt hätte sie dieser ein wenig unnahbaren Frau, die sie bewunderte, verehrte und der ähnlich zu sein sie sich sehnlich wünschte, Kummer bereiten mögen.
»Nun sag es mir schon, mein Kleines. Schau mich nicht an wie ein in die Falle gegangenes Tier!«
Léa versuchte zu lächeln, von dem bevorstehenden Fest zu erzählen und von ihrem neuen Kleid, aber ihre Stimme versagte. Unter Tränen warf sie sich der Mutter an die Brust und schluchzte heftig. »Ich fürchte mich so vor dem Krieg!«
3
Früh am nächsten Morgen hallte das Haus wider von dem Gebrüll, dem Gelächter und dem hastigen Hin und Her der drei Schwestern. Angesichts der Wünsche ihrer drei »Kleinen« wußte Ruth nicht mehr, wo ihr der Kopf stand. Überall mußte sie nach Handtaschen, Hüten, Schuhen suchen . . .
»Beeilt euch, da kommen schon eure Onkel und Vettern!«
Vor dem Schuppen waren inzwischen drei Limousinen vorgefahren. Luc Delmas, Pierres älterer Bruder, ein berühmter Anwalt aus Bordeaux, der große Stücke auf Maurras hielt, hatte seine drei jüngsten Kinder mitgebracht: Philippe, Corinne und Pierre. Léa mochte sie ganz und gar nicht; in ihren Augen waren sie arrogant und hinterhältig ‒ bis auf Pierre, den sie Pierrot nannte. Es hatte ganz den Anschein, als wäre er aus der Art geschlagen. Mit zwölf Jahren war er wegen unverschämten und gottlosen Betragens von allen kirchlichen Lehranstalten in Bordeaux verwiesen worden und besuchte ‒ zum großen Leidwesen seines Vaters ‒ ein staatliches Gymnasium.
Bernadette Bouchardeau, die Witwe eines Obersten, hatte all ihre Liebe und Zärtlichkeit auf ihren einzigen Sohn, Lucien, gelenkt, der kurze Zeit vor dem Tod ihres Gatten zur Welt gekommen war. Der Achtzehnjährige fühlte sich schier erdrückt von der Fürsorge seiner Mutter und wartete auf die erstbeste Gelegenheit, das Elternhaus zu verlassen.
Adrien Delmas, Dominikaner und das »Gewissen der Familie«, hatte die Angewohnheit, mit seinem Bruder Pierre seinen Spott zu treiben. Léa war die einzige seiner Neffen und Nichten, die sich nicht von seiner hünenhaften Mönchsgestalt mit der beeindruckenden langen weißen Kutte einschüchtern ließ. Er war ein bemerkenswerter, weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannter Prediger. Mit zahlreichen Geistlichen aller Konfessionen stand er in regem Briefwechsel, sprach mehrere Sprachen und unternahm häufig Auslandsreisen.
Sowohl in der vornehmen Gesellschaft von Bordeaux als auch in seiner eigenen Familie galt Pater Adrien als Revolutionär. Hatte er etwa nicht einige spanische Flüchtlinge, die Nonnen vergewaltigt und Gräber geschändet hatten und nach dem Fall von Barcelona das Land verlassen mußten, bei sich aufgenommen? War er nicht auch mit dem Briten George Orwell, diesem sozialistischen Schriftsteller, befreundet? Auch einem ehemaligen Oberleutnant der 29. Division, der mit schweren Verwundungen unter sengender Sonne durch Kaffeehäuser und Badeanstalten irrte und des Nachts in ausgebombten Häusern oder im Dickicht schlief, ehe er die Grenze nach Frankreich überqueren konnte, hatte Adrien bereitwillig Gastfreundschaft gewährt. Als einziger von drei Brüdern hatte er das Münchener Abkommen als rechtswidrig angeprangert und dabei geäußert, daß die Feigheit, durch welche es zustande gekommen sei, dem Krieg nur Vorschub leiste. Monsieur d’Argilat war der einzige, der diese Ansicht teilte.
Raymond d’Argilat und Adrien Delmas waren seit vielen Jahren befreundet. Beide liebten Chamfort, Rousseau und Chateaubriand, gerieten sich in die Haare über Zola, Gide und Mauriac und waren ein Herz und eine Seele, wenn es um Stendhal oder um Shakespeare ging. Ihre Diskussionen über Literatur konnten sich über Stunden hinziehen. Traf Pater Delmas in Roches-Blanches ein, sagten die Bediensteten: »Ach, da ist ja der Pater wieder mit seinem Zola, dabei weiß er doch genau, daß Monsieur ihn nicht mag!«
Als einziges Mädchen war Léa an jenem Spätsommermorgen dunkel gekleidet, obwohl es dem Anlaß nicht entsprach. Sie hatte einst einen zähen Kampf mit ihrer Mutter führen müssen, bevor ihr das Kleid aus schwerer schwarzer Seide mit einem Muster von winzigen roten Blüten, das ihre schmale Taille, ihren hübschen Busen und ihre geschwungenen Hüften stark betonte, angepaßt und schließlich auch gekauft wurde. An den nackten Füßen trug sie hochhackige Sandaletten aus rotem Leder. Kokett blickte sie unter einem schwarzen Strohhut hervor, der mit einem zu den Schuhen passenden Blumensträußchen verziert war. Ihre Handtasche war ebenfalls rot.
Als erste stürzten sich die Gebrüder Lefèvre auf Léa. Danach küßte Lucien Bouchardeau sie und flüsterte Jean ins Ohr: »Mensch, ist die attraktiv!«
Nun trat auch Philippe Delmas hinzu; er gab ihr einen Kuß und errötete dabei heftig. Léa ließ ihn stehen und wandte sich Pierrot zu, der ihr um den Hals fiel und dabei ihren Hut verschob.
»Wie schön, dich zu sehen, Pierrot!« sagte sie und erwiderte seine Küsse.
Sich einen Weg durch den Schwarm von Verehrern bahnend, stand nun der Dominikaner in seiner weißen Kutte vor dem Mädchen. »Wollt ihr mich endlich durchlassen, damit ich mein Patenkind umarmen kann!«
»Oh, Onkel Adrien, das freut mich aber, daß du gekommen bist! Aber du machst so ein besorgtes Gesicht! Stimmt etwas nicht?«
»Es ist nichts weiter, mein Kleines, ist schon in Ordnung! Wie groß du geworden bist! Wenn ich daran denke, wie ich dich damals über das Taufbecken gehalten habe! Es wird Zeit, daß du ans Heiraten denkst. An Verehrern mangelt es dir ja wohl nicht!«
»Aber Onkelchen!« lachte sie geschmeichelt und rückte ihren Hut gerade.
»Los, beeilt euch, wir kommen noch zu spät! Alle Mann einsteigen!« schrie Pierre Delmas mit gezwungener Fröhlichkeit. Sie schlenderten zu den Fahrzeugschuppen. Zur großen Enttäuschung der Gebrüder Lefèvre, die Léa zu Ehren den alten Celtaquatre auf Hochglanz poliert hatten, stieg diese in den Wagen ihres Onkels.
»Fahrt schon vor mit eurer Klapperkiste! Wir treffen uns in Roches-Blanches. Läßt du mich fahren, Onkel?«
»Kannst du das denn?«
»Ja, aber Mama darf es nicht wissen. Papa erlaubt es mir manchmal. Er lehrt mich auch die Verkehrsregeln. Die sind viel schwieriger als das Fahren selbst. Ich hoffe, daß ich trotzdem bald die Prüfung ablegen kann.«
»Aber du bist doch noch viel zu jung!«
»Papa hat gesagt, wir werden uns mit den Leuten schon einigen.«
»Das sollte mich wundern. Aber nun zeig mal, was du kannst.«
Lucien, Philippe und Pierrot stiegen zu ihnen ins Auto. Nachdem der Mönch den Motor angeworfen hatte, stieg er, die Kutte hochgerafft, als letzter ein.
»Heiliger . . .«
Mit einem heftigen Ruck war Léa angefahren.
»Entschuldige, Onkel, ich bin an dein Auto nicht gewöhnt.« Nachdem die Passagiere heftig durchgeschüttelt worden waren, gelang es Léa endlich, das Fahrzeug in Griff zu bekommen. Sie trafen denn auch als letzte auf Roches-Blanches, dem Gut von Monsieur d’Argilat in der Nähe von Saint-Emilion, ein. Eine lange Eichenallee führte zu dem im eleganten Stil des späten achtzehnten Jahrhunderts gebauten Schloß ‒ das sich von der Neugotik der umliegenden Schlösser abhob, die samt und sonders aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts stammten. Laurent und sein Vater hingen mit großer Liebe an diesem Besitz, den sie nach besten Kräften instandhielten.
Als Léa aus dem Wagen stieg, öffneten sich die übereinanderliegenden Bahnen ihres Kleides und gewährten einen tiefen Blick auf ihre Beine. Raoul und Jean Lefèvre stießen unwillkürlich einen bewundernden Pfiff aus, worauf die anwesenden Damen und Mädchen sie mit entrüsteten Blicken bedachten.
Ein Diener fuhr den Wagen in einen Hof hinter den Gebäuden. Léas Blick suchte nur einen einzigen Menschen in der Menge, die sich inzwischen vor dem Schloß gebildet hatte: Laurent. Mit ihren Begleitern ging sie auf den Hausherrn zu.
»Da bist du ja endlich, Léa! Ohne dein Lächeln und deine Schönheit kann kein Fest gelingen!« begrüßte sie Raymond d’Argilat und betrachtete sie liebevoll.
»Guten Tag, Monsieur. Ist Laurent nicht da?«
»Selbstverständlich ist er da! Er zeigt Camille gerade, wie weit der Umbau gediehen ist.«
Léa erschauderte. Die Sonne an diesem prächtigen Septembertag verfinsterte sich für sie. Pierre Delmas war die Veränderung an Léa nicht entgangen. Er griff ihren Arm und zog sie beiseite.
»Bitte kein Theater und keine Tränen! Ich wünsche nicht, daß meine Tochter vor allen Gästen eine Szene macht!«
Léa unterdrückte das in ihr aufsteigende Schluchzen. »Es ist nichts weiter, Papa, ich bin bloß ein wenig erschöpft. Nach dem Essen geht es mir sicher wieder besser.«
Sie nahm ihren Hut ab und gesellte sich mit hoch erhobenem Kopf zu ihren Verehrern, die sich um einen großen Tisch drängten, an dem Erfrischungen geboten wurden. Sie lächelte zu ihren galanten Reden, lachte über ihre Scherze, trank ihnen mit einem köstlichen Château-d’Yquem zu, und dennoch ging ihr nur ein einziger Gedanke durch den Kopf: Er ist bei Camille.
Das Fest versprach herrlich zu werden. Von einem wolkenlosen Himmel strahlte die Sonne. Der am frühen Morgen besprengte Rasen war tiefgrün und roch nach frisch gemähtem Gras, die Rosen in den Blumenrabatten dufteten. Unter einem riesigen Zeltdach war ein üppiges Büffet aufgebaut; für die Bedienung sorgten Angestellte im weißen Jackett. Da und dort hatte man Sonnenschirme, Tische, Stühle und Gartensessel aufgestellt. Die helle Garderobe der Frauen, ihre Bewegungen, ihr Gelächter verliehen der Gesellschaft einen Hauch von ausgelassener Fröhlichkeit, die nicht so recht passen wollte zu den ernsten und besorgten Mienen einiger Herren. Selbst Laurent d’Argilat, dem zu Ehren man hier versammelt war, schien Léa blaß und abgespannt, als er endlich in Begleitung eines Mädchens in einem schlichten, weißen Kleid erschien. Das zarte Gesicht der Braut strahlte vor Glück. Die Gäste applaudierten. Léa ordnete in gespielter Teilnahmslosigkeit ihr Haar.
Raymond d’Argilat bat um Ruhe.
»Liebe Freunde, wir haben uns an diesem 1. September 1939 versammelt, um den Geburtstag meines Sohnes Laurent und seine Verlobung mit seiner Cousine Camille zu feiern.«
Abermals erscholl lauter Beifall.
»Danke, meine Freunde, danke, daß ihr so zahlreich gekommen seid! Es ist mir eine große Freude, euch heute hier in meinem Haus begrüßen zu dürfen. Wir wollen trinken, essen, lachen an diesem festlichen Tag . . .« Seine Stimme versagte vor Rührung. Mit einem strahlenden Lächeln trat sein Sohn neben ihn.
»Das Fest möge beginnen!«
Léa hatte sich mit ihren Verehrern abseits von den anderen einen Platz gesucht. Jeder beanspruchte für sich die ehrenvolle Aufgabe, sie bedienen zu dürfen. Bereits nach kurzer Zeit hatte sie Speisen vor sich stehen, die für mehrere Tage gereicht hätten. Sie lachte, plauderte, verschenkte großzügig ihr Lächeln und kokette Blicke. Die Mädchen, die leer ausgingen, sahen enttäuscht zu. Noch nie schien Léa so fröhlich gewesen zu sein. In Wirklichkeit jedoch tat ihr jedes Lächeln weh, und ihre Fingernägel gruben sich fest in ihre feuchten Handflächen. Als Laurent auf sie zukam, am Arm Camille, die immer noch vor Glück strahlte, dachte Léa, sie müsse auf der Stelle tot umfallen.
»Guten Tag, Léa, ich hatte noch gar keine Zeit, dich zu begrüßen«, sagte Laurent mit einer Verbeugung. »Erinnerst du dich an Léa, Camille?«
»Aber natürlich!« erwiderte diese und ließ den Arm ihres Verlobten los. »Wie könnte man Léa vergessen?«
Léa hatte sich erhoben und betrachtete die Rivalin verächtlich. Ihre Muskeln spannten sich, als Camille sie auf beide Wangen küßte.
»Laurent hat mir viel von dir erzählt. Ich hoffe sehr, daß wir Freundinnen werden.« Sie schien zu übersehen, daß Léa ihre Küsse nicht erwiderte, und zog ihren Bruder, einen schüchternen jungen Mann, heran. »Erinnerst du dich an meinen Bruder Claude? Er freut sich riesig, dich wiederzusehen.«
»Guten Tag, Léa.«
Wie sehr er seiner Schwester ähnelte!
»Komm, Liebling, wir wollen die anderen Gäste nicht vernachlässigen«, sagte Laurent und zog seine Verlobte mit sich fort.
Léa blickte ihnen nach. Ein Gefühl tiefer Verlassenheit überkam sie, und sie hatte Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten.
»Darf ich mich zu euch setzen?« fragte Claude.
»Mach ihm doch Platz«, sagte Léa grob und stieß Raoul Lefèvre, der rechts neben ihr saß, in die Seite. Verwundert und gekränkt erhob er sich und ging zu seinem Bruder.
»Findest du nicht, daß Léa heute sonderbar ist?«
Anstelle einer Antwort zuckte Jean nur mit den Achseln.
Léa reichte Claude einen mit kaltem Fleisch überladenen Teller. »Hier, nehmen Sie, ich hab’s noch nicht angerührt.«
Claude setzte sich, nahm den Teller und bedankte sich, nicht ohne dabei sichtlich zu erröten.
»Bleiben Sie längere Zeit auf Roches-Blanches?«
»Sollte mich wundern, bei dem, was sich da zusammenbraut . . .«
Léa hörte nicht hin. Ihr war plötzlich der Gedanke gekommen, daß Laurent wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung von ihrer Liebe hatte. Eine ungeheure Erleichterung ergriff von ihr Besitz, und ihr fröhliches Lachen rief bei den anderen erstaunte Blicke hervor. Sie stand auf und ging auf das sogenannte Wäldchen zu. Claude d’Argilat und Jean Lefèvre stürzten hinterher. Ungnädig herrschte sie die beiden an: »Laßt mich in Ruhe, ich will allein sein!«
Betreten kehrten sie an den Tisch zurück, um den sich inzwischen viele Gäste drängten, die eifrig ins Gespräch vertieft waren.
»Glaubst du, es kommt zum Krieg?« wollte Raoul Lefèvre von Alain de Russay wissen, der ein wenig älter war und ihm für eine zuverlässige Auskunft der richtige zu sein schien.
»Ohne jeden Zweifel. Ihr habt doch letzte Nacht die Meldung im Rundfunk gehört: Danzig soll unverzüglich dem Deutschen Reich angegliedert werden; Hitler hat dem polnischen Gesandten seine Forderungen vorgetragen und ihm ein Ultimatum gestellt, das am Abend des 30. August abläuft. Heute haben wir den 1. September. Ihr könnt euch darauf verlassen, daß zu dieser Stunde Gauleiter Forster die Angliederung Danzigs an das Deutsche Reich verkündet hat und die Deutschen bereits in Polen einmarschiert sind.«
»Dann gibt es also tatsächlich Krieg?« sagte Jean Lefèvre, und seine Stimme klang plötzlich beinahe erwachsen.
»Ja.«
»Das ist ja herrlich! Wir ziehen in den Kampf!« tönte Lucien Bouchardeau großspurig.
»Und wir werden siegen!« erklärte Raoul Lefèvre mit jungenhafter Begeisterung.
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, meinte Philippe Delmas skeptisch.
Im Laufschritt war Léa über die große Wiese geeilt. Unter den schattenspendenden Bäumen des Waldrands hielt sie inne. Von hier aus bot sich ein weiter Blick über das Gut der Argilats. Es war ein reiches Land, Lage und Boden waren noch besser als auf Montillac, und der Wein war feuriger. Léa liebte Roches-Blanches. Ihr Blick wanderte über die Wiesen und Wälder, über die Weinberge und das Schloß, als gehöre alles ihr. Nein, niemand kannte dieses Land besser und liebte es zärtlicher als sie, einmal abgesehen von ihrem Vater und Monsieur d’Argilat . . . und Laurent natürlich. Laurent, der liebte sie, daran gab es keinen Zweifel. Aber er sah in ihr offenbar immer noch das kleine Mädchen. Dabei war sie kaum jünger als Camille. Camille . . . was er bloß an diesem schmächtigen, flachbrüstigen, schlecht gekleideten, linkischen Ding finden mochte, das den Anschein erweckte, als sei es erst vor kurzem aus dem Kloster gekommen! Und ihre Frisur! Wie konnte man heutzutage noch so herumlaufen! Zu einem solchen Kranz aus strohblonden Zöpfen fehlte bloß noch die Elsässer Kopfschleife! Alles paßt genau zu dem wieder in Mode gekommenen fanatischen Patriotismus! Und dann noch ihr falschfreundliches Getue: »Ich hoffe sehr, daß wir Freundinnen werden . . .«
Nein, Laurent konnte dieses unscheinbare Ding unmöglich lieben, und er heiratete Camille sicher nur einer alten Familienfreundschaft zuliebe. Wenn er jedoch erführe, daß sie, Léa, ihn liebte, würde er bestimmt diese lächerliche Verlobung auflösen und mit ihr auf und davon gehen.
So versunken war Léa in ihre Träume, daß sie gar nicht den Mann bemerkte, der sie, an einen Baum gelehnt, amüsiert beobachtete. Oh, jetzt fühlte sie sich gleich wohler! Man brauchte nichts als ein bißchen Ruhe und Zeit zum Nachdenken, und schon hatte man wieder einen klaren Kopf. Léa hatte ihr Gleichgewicht zurückgewonnen: sie würde ihren Willen schon durchsetzen. Sie stand auf und schlug sich mit der rechten Faust in die linke Handfläche, eine Geste, die sie ihrem Vater abgeschaut hatte; sie bedeutete, daß er soeben einen Entschluß gefaßt hatte. »Und ich kriege ihn bestimmt!«
Lautes Gelächter ließ sie zusammenfahren. »Davon bin ich überzeugt!« sagte eine fremde Stimme mit geheuchelter Ehrfurcht.
Léa fuhr herum. »Sie haben mich aber erschrocken! Wer sind Sie überhaupt?«
»Ein Freund von Monsieur d’Argilat.«
»Sie? Das würde mich sehr wundern. Oh, Verzeihung . . .«
Abermals brach er in Gelächter aus.
Das Lachen steht ihm gut, dachte Léa.
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Sie haben gar nicht so unrecht. Abgesehen von ein paar Geschäftsinteressen gibt es nicht viel Gemeinsames zwischen den ehrenwerten Herren von d’Argilat und meiner Wenigkeit. Überdies würde ich mich in dieser Gesellschaft ungeheuer langweilen.«
»Wie können Sie nur so etwas sagen! Die d’Argilats sind die höflichsten und kultiviertesten Leute der ganzen Gegend!«
»Das meinte ich ja.«
»Wie bitte?«
Neugierig betrachtete Léa ihren Gesprächspartner. Eine derart ungenierte Äußerung über die Eigentümer von Roches-Blanches hatte sie noch nie gehört. Der Mann, der vor ihr stand, war sehr groß, sein braunes Haar war sorgfältig gekämmt, die blauen Augen in seinem tiefgebräunten, ziemlich häßlichen, aber scharf konturierten Gesicht blickten übermütig; der Mund mit den fleischigen Lippen zeigte prächtige Zähne. Der Mann kaute auf einer übelriechenden Zigarre herum. Der gut geschnittene Anzug in hellem Grau mit feinen weißen Streifen stand in schroffem Gegensatz zu dem wettergebräunten Gesicht und der fürchterlichen Zigarre.
Léa machte eine Handbewegung, als wolle sie den widerlichen Geruch vertreiben.
»Stört Sie vielleicht der Rauch? Eine schlechte Angewohnheit, die ich in Spanien angenommen habe. Aber nun, da ich wieder in der feinen Gesellschaft von Bordeaux verkehre, werde ich mich wieder an Havannas gewöhnen müssen.« Mit diesen Worten warf er die Zigarre zu Boden und trat sie sorgfältig aus. »Im Krieg wird es wohl ziemlich schwer werden, welche zu bekommen.«
»Der Krieg . . . der Krieg . . . ihr Männer redet von nichts anderem mehr. Warum sollte es Krieg geben? Ich will davon nichts wissen!«
Der Mann lächelte nachsichtig und sagte wie zu einem launischen Kind: »Sie haben recht, ich bin ein Unmensch. Ein reizendes junges Mädchen wie Sie mit so läppischen Dingen zu belästigen! Sprechen wir lieber von Ihnen. Haben Sie einen Bräutigam? Nein? Aber einen Liebhaber? Auch nicht? Das glaube ich nicht. Ich habe vorhin beobachtet, wie Sie von netten jungen Männern umschwärmt wurden, die Ihnen sehr zugetan schienen ‒ abgesehen natürlich vom glücklichen Bräutigam . . .«
Léa, die sich wieder gesetzt hatte, erhob sich abrupt. »Sie langweilen mich, Monsieur, ich möchte zu meinen Freunden zurück.«
Er verneigte sich spöttisch. Sein Gehabe begann Léa aufzuregen.
»Ich werde Sie nicht zurückhalten. Nichts liegt mir ferner, als Ihnen meine unangenehme Gesellschaft aufzudrängen oder Sie Ihren Verehrern vorenthalten zu wollen.«
Léa schritt grußlos und erhobenen Hauptes an ihm vorüber.
Der Mann setzte sich auf die Bank, holte eine Zigarre aus einem braunen Lederetui hervor, biß das Ende ab und spie es aus. Dann steckte er sie an und sah dem hübschen Mädchen, das den Krieg nicht mochte, nachdenklich hinterher.
Unter den Bäumen begannen Musiker auf einem Holzpodest ihre Instrumente aufzubauen. Neugierig sahen ihnen die Jüngeren unter den Gästen zu.
Léa wurde von ihren Freunden mit großem Hallo begrüßt. »Wo warst du bloß? Wir haben dich überall gesucht.«
»Es war nicht nett von dir, einfach zu verschwinden.«
»Léa zieht eben reife, etwas undurchsichtige Männer jungen Leuten aus gutem Hause vor«, sagte ihre Cousine schnippisch.
Léas hochgezogene Augenbrauen verrieten großes Erstaunen. »Wen meinst du damit?«
»Du wirst uns doch nicht einreden wollen, François Tavernier nicht zu kennen, mit dem du da oben im Wäldchen geflirtet hast!«
Léa zuckte die Achseln und warf dem Mädchen einen mitleidigen Blick zu. »Ich habe diesen Herrn heute zum erstenmal gesehen, und seinen Namen erfahre ich gerade von dir. Im übrigen hätte ich gerne zu deinen Gunsten auf seine Gesellschaft verzichtet. Aber was soll man machen: Schließlich kann ich ja nichts dafür, daß die Männer lieber mit mir zusammen sind als mit dir.«
»Vor allem diese Sorte Männer.«
»Jetzt hör endlich auf damit! So scheußlich, wie du mir weismachen willst, kann er nicht sein, sonst hätte d’Argilat ihn wohl kaum in seinem Haus empfangen.«
»Ich glaube, Léa hat recht. Wenn Monsieur Tavernier Gast von d’Argilat ist, dann wird das schon seine Richtigkeit haben«, kam Jean Lefèvre seiner Freundin zu Hilfe.
»Er soll Waffenschieber sein und die Dinger tonnenweise an die spanischen Republikaner verkauft haben«, murmelte Lucien Bouchardeau.
»An die Republikaner!« rief Corinne Delmas aus, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen.
»Na und? Schließlich brauchen auch sie Waffen, um zu kämpfen!« sagte Léa gereizt. In diesem Moment begegnete ihr Blick dem ihres Onkels Adrien, der ihr, so hatte es den Anschein, beifällig zulächelte.