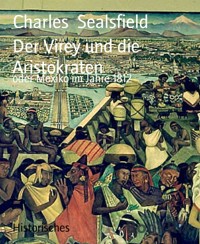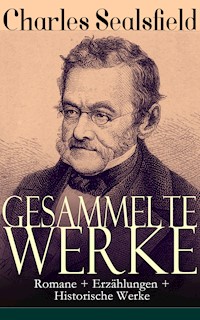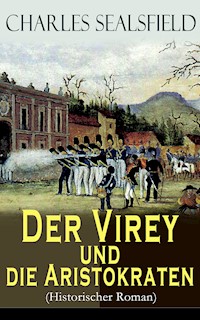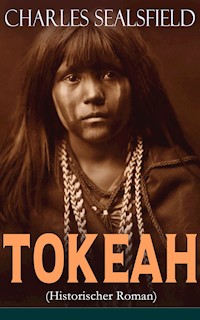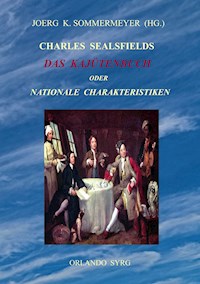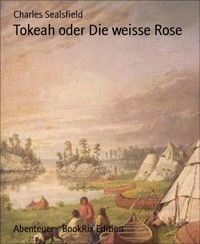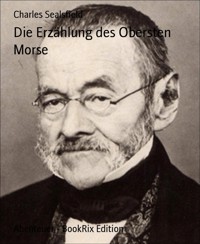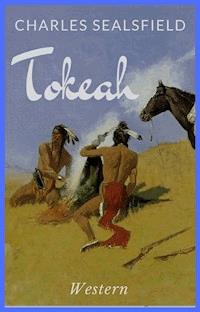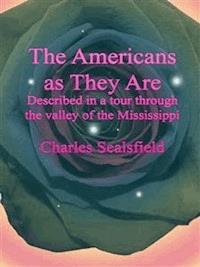1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Amerika, die Nation im Entstehen, die Charles Sealsfield als beispielhaft für eine neue Weltordnung sah. Erzählungen über Erzählungen, eingebettet in eine Rahmenhandlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das blutige Blockhaus
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenCharles Sealsfield: Das blutige Blockhaus
Charles Sealsfield
Das blutige Blockhaus
Der vorliegende Roman spielt in den Jahren
1799 bis 1802, 1811 und 1828
Die Pflanzung am Red River
1
Die beiden Freunde standen mit ihren Frauen auf dem Oberdeck des Raddampfers ›Alexandria‹, der den Red River aufwärts fuhr: der achtundzwanzigjährige schlanke George Howard, der von seinen Eltern eine herabgewirtschaftete Pflanzung am Strom einige dreißig Meilen oberhalb seiner Mündung in den »Vater der Flüsse« geerbt und mit Fleiß und dem Geld des Schwiegervaters wieder zur Blüte gebracht hatte, und der gleichaltrige riesige Ralph Doughby, der politischen Ehrgeiz hatte und ein eifriger Parteigänger des Generals Andrew Jackson war.
Beide waren nach abenteuerlichen Brautfahrten jetzt glückliche Ehemänner und sogar Schwäger. Hatten zwei hübsche Schwestern geheiratet, feurige Kreolinnen französischer Abkunft, Töchter des reichen Pflanzers Menou, Howard die jüngere Luise und Doughby die ältere Julie, und waren nun auf der Fahrt zum Elternhaus ihrer Frauen. In ihrer Gesellschaft befanden sich noch Richard Moreland, ein Jugendfreund Howards, ebenfalls ein Pflanzer, mit seiner Frau Clara und mit seiner Tante Mistreß Houston, einer stattlichen, steifen, frostigen alten Dame, die so recht ein Gegenstück war zu dem leichtlebigen Kentuckier Doughby, der gern trank, polterte, lärmte, raufte, rauchte, kaute und sich mit Pflanzern, Jägern, Squatters, Krämern zu unterhalten, sich bei allen beliebt zu machen und doch wieder allen einen gewissen Respekt einzuflößen wußte.
Es war im Indianersommer des Jahres 1828.
Weit hinter ihnen lag bereits die Mündung des Black River mit seiner dunkelblauen Farbe, lagen die Windungen des schokoladebraunen unteren Red River mit den seeartigen Verbreiterungen und schneckenartigen Schrumpfungen. Lagen Urwälder mit dem Dunkelgrün der Zypressen, dem Silberweiß der Cottonwoods und dem Hellgrün der Pecan-Bäume. Lagen Haine säuselnder Palmettos, und blühender Magnolien, Catalpas und Papaws, die in roten und blauen und goldenen Tinten ineinander verschmolzen waren. Lagen schroffe, von Efeu bekleidete Felsenwände, lagen liebliche Auen voll Blumen, die wie bunte Edelsteine geleuchtet hatten.
Hinter ihnen lag nun auch bereits Bakers Niederlassung mit der seeartigen Bucht, in die der Fluß sich dort erweiterte. Lagen Ufer mit parkähnlichen Gruppen gigantischer Cottonwoods und Immergrün-Eichen, vermengt mit Honigakazien und Bohnenbäumen, durch die der dunstige ferne Rand des Horizonts magisch durchschimmerte. Lagen Buchten, von Tränenweiden und Zypressen überhangen, die von Langschwanzpapageien, Spottvögeln und roten Kardinalen belebt und aus denen bei der Annäherung des Dampfers Züge von wilden Enten, Gänsen und Schwänen emporgeprallt waren. Lagen vereinzelte Blockhäuser und kleine Pflanzungen mit Mais-, Tabak- und Baumwollfeldern. Jeder Stoß der Maschine, jede Umdrehung der Räder am Heck hatten neue Schönheiten gebracht.
Das Dampfboot mit den beiden hohen Schornsteinen näherte sich nun dem nördlichen Rand der großen Prärie, die sich vom rechten Ufer des Stromes südwärts bis hinab gegen die Opelousas zog. Es nützte die Gegenströmung und hielt sich nahe am Ufer. Der Farbenschmelz dieser herrlichen Prärie entfaltete sich vor Howards Augen in seiner ganzen Pracht. Es war ein Blumenteppich, ein Ozean von Blüten und balsamischen Düften. Die Gräser hoben und senkten sich in den Strahlen der untergehenden Sonne wie Meereswogen, die von einer leichten Brise gefächelt werden. Umspielt von den Strahlen der schräg einfallenden Sonne weideten in der Ferne Rinder und Pferde im hohen Gras. Gegen Westen begrenzte diese ungeheure Prärie ein Saum schwarzer Kiefern.
Howard dachte daran, wie manche Tage er schon in dieser weiten Prärie umhergeirrt war. Obwohl nur eine Wiese im Vergleich zu den weiter westlich gelegenen Prärien, hatte sie ihm einen deutlichen Begriff von diesen Ebenen gegeben, und er bedauerte, daß die vorrückende Kultur ihr allmählich schon den wilden, großartig einsamen Charakter raubte, der in den Sabine-, Arkansas- und Oregon-Prärien so unbeschreiblich wirkte.
Nur in blauer Ferne erspähte sein Auge einzelne Baumgruppen wie einsame Segel auf den rollenden Meereswogen. Immer nur Wiesen und Gräser und im Luftzug bewegte, gleichsam rollende Hügel schaute man, und näherte man sich einer Baumgruppe, so kamen Hirsche vertraulich neugierig heraus, erwarteten den Fremden, sowie er die Hände hob und winkte, und ließen ihn näher kommen, gleichsam um zu erfahren, was er ihnen denn brächte. Oft hatte es Howard leid getan, den Stutzen auf diese lieben Tiere anzulegen, die erst beim Schuß mit einem gewaltigen Satz das schützende Dickicht suchten. Wenn man tagelang so fortzog und immer nur Wiesen sah und Baumgruppen in der Ferne und zur Abwechslung eine Horde Präriehunde oder Wölfe, dann begann etwas wie Bangen über den Wanderer zu kommen. Die Größe, die Unermeßlichkeit der Natur erfüllte seine Sinne, sein Gemüt, sein ganzes Wesen. Das Treiben der Menschen, das er hinter sich gelassen hatte, sein eigenes Treiben wurde ihm so klein, so geringfügig, verächtlich!
Ein geheimer Schauder überkroch ihn, besonders wenn er einige Tage einsam umhergeirrt war. In solchen Tagen, Stunden durchdrang die Allgewalt des Schöpfers auch den im Weltgetriebe Verschliffenen, Versteinerten bis ins Innerste. Dieser Tempel Gottes vermochte den Ungläubigen zum Glauben an ihn zurückzuführen.
Howard dachte: Sendet den Gottesleugner für einen Monat, nur für einen Monat in unsere Prärien und er wird, er muß an Gott glauben!
Bei Avoyelles Station hielt das Dampfschiff einen Augenblick an, um Fahrgäste abzusetzen und aufzunehmen. Dann tanzten die ersten Pflanzungen vorüber: Baumwoll- und Tabakfelder und Viehherden, viele Viehherden. Prärien an beiden Ufern des Stromes und weiter zurück Schwarzkieferwaldungen, die Ufer selbst mit Zypressen eingefaßt, deren dunkles Grün und vielgezackte Äste und Zweige das Auge wohltätig ansprachen. Ein paar häßlich braun und schmutzig gefleckte Ungeheuer plumpsten von vermoderten Baumstämmen in den Sumpf hinab, während andere, zu träge, ihre Eidechsenaugen dumm und unbeweglich auf den Dampfer richteten. Es waren Alligatoren, die ihre Siesta hielten.
Abermals wechselte die Landschaft. Weiden und Cottonwoods deuteten einen leichteren Boden an. Der Dampfer näherte sich Holmes Station, dem Herzen der kreolischen Niederlassungen. Die freundlichen Pflanzer- und Negerhäuser mit ihren Cottonfeldern gaben schon Anzeichen amerikanischer Regsamkeit und ließen auf die Anwesenheit von Gliedern aus Uncle Sams Familie schließen. Wirklich war hier ein Dutzend amerikanischer Familien angesiedelt, die sich gleichzeitig mit Howard hier im nördlichen Louisiana niedergelassen hatten und wohl gediehen.
Es hatte für Howard einen eigenen Reiz, das Land in seinen verschiedenen Entwicklungsphasen zu beobachten, die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart zurückzurufen. So hatte er diese Niederlassungen, deren Pflanzungen, noch ausschließlich von Kreolen bewohnt, ihm nun entgegenkamen, in einem so ärmlichen Zustand gesehen, wie ihn das ärgste Faulleben nur immer mit sich bringen kann. Er erinnerte sich noch, wie trostlos ihm zumute war, als er diese verfallenen Hütten und Häuser zum erstenmal erblickt hatte, diese mageren, von Unkraut überwachsenen Baumwoll- und Tabakfelder, die aller Arbeit zu spotten schienen.
Es war wie ein verdammtes Stück Land gewesen, wo keine Arbeit fruchten und die kleine Gemeinschaft gar nicht gedeihen wollte. Da kamen ein paar Dutzend Amerikaner an, und die hatten das Ganze, ohne es zu wollen, vom Fleck gebracht. Anfangs freilich war des Schimpfens und Nachredens kein Ende gewesen. Die ganze Gemeinde war eine Stimme in diesem Punkt. Sie glich einem wohlgemästeten Schankwirt, der, in seine vier Pfähle wie die Made in den Käselaib eingewühlt, sich weder um die Welt noch um seine Gäste kümmert, denn er weiß, daß beide seinen abgestandenen Wein doch trinken müssen, weil weit und breit kein besserer zu haben ist. Erst wenn er an einem heiteren Morgen plötzlich gegenüber ein neues Schild heraushängen sieht und davor einen jungen Wirt, der billige Zeche verspricht, rafft er sich aus seiner Trägheit auf. Der gute Mann poltert und lärmt, und seine Partei tobt. Aber aus Neugierde versucht man den Wein des Eindringlings und findet ihn besser als den sauren, abgestandenen des alten Wirts. Die Gemeinde schimpft zwar über den neuen, zieht aber doch seinen Wein dem des alten vor und beginnt einzusehen, daß sie gewonnen bei der Rivalität, der Wein gewonnen, der Ort gewonnen. Denn der Reisenden kommen mehr als zuvor, angezogen durch den guten Wein und den fröhlichen jungen Wirt.
Geradeso war es den Kreolen in dieser und den übrigen Stationen ergangen. Ihr Tabak, erst grob und schwer, war nun duftend und fein parfümiert, ihre Baumwolle, einst gelb und kurzfädig, war lang und weiß, war die schönste im Staate geworden. Sie wußten nicht recht, wie das alles gekommen, wie ihr kleines Reich einen solchen Umschwung genommen. Es erging ihrem kleinen Reich geradeso wie jenen großen, die recht behaglich im Faulleben dahinvegetieren, solange sie nicht mit tätigeren Nachbarn in Berührung kommen, die aber, sobald ein jugendlicher Rivale lebendig sie zu rütteln beginnt, sich aus ihrer verdrossenen Ruhe aufraffen und ihre fünf Sinne zusammennehmen müssen, wenn sie nicht zuletzt über den Haufen gerannt werden wollen.
*
Die Uhr zeigte fünf, die Reisenden näherten sich dem ersehnten Ziel. Der Dampfer machte bei höchstem Druck zwölf Meilen in der Stunde, er brauste flußaufwärts. Pflanzung um Pflanzung blieb hinter ihm. Luise Howard war zum Kind geworden, denn jedes Haus, jede Pflanzung war ihr bekannt, kaum eine, wo sie nicht zum Ball geladen war, getanzt hatte. Sie erzählte Julie Doughby, Julie ihr. Vor allen Veranden waren Gesichter, die sie erkannten und ihre Freude durch laute Zurufe, durch Händeklatschen und Schwenken der Taschentücher zu erkennen gaben.
Auf einmal wurden die beiden Schwestern gespannt. Ihre Blicke hafteten auf den mit Immergrün-Eichen bekrönten Hügeln, die sich über den Flußufern wölbten und sich in den roten Fluten spiegelten.
»Dort, ja dort ...!« Julie stockte, unfähig ein Wort mehr hervorzubringen.
»Da ist unser Hafen!« flüsterte Luise mit vor Freude erstickter Stimme.
Howard hatte den Arm um sie gelegt, sie zitterte vor Aufregung. Noch eine Pflanzung, von der eine Begrüßung herübergerufen wurde, aber weder Luise noch Julie sahen oder hörten.
Der Drang, das Vaterhaus zu sehen, erfüllte ihre kindlichen Seelen.
»Maman, Papa – was werden sie jetzt tun?« schluchzte Julie.
»Sie denken an uns!« erwiderte Luise mit glänzenden Augen.
»Ralph, sieh nur!« Julie stieß ihren Mann an. »Hinter dieser Baumgruppe!«
»Was ist hinter dieser Baumgruppe?«
»Der Hafen, das Vaterhaus!« rief Julie.
»Da sind wir also am Ziel! Wohl und gut!«
Luise warf dem Schwager einen seltsamen Blick zu, wandte sich dann von ihm weg und schaute die Schwester teilnehmend sinnend an. Sie schmiegte sich näher an Howard, als wollte sie sich recht weit von Doughby zurückziehen.
»Aber was ist, was soll das?« rief dieser verblüfft.
Die beiden Schwestern sahen ihn abermals an, ihre Lippen zuckten, aber kein Wort kam von ihnen. Howard stand ein wenig betroffen. Denn so wenig der Mangel an Gefühl bei Anglo-Amerikanerinnen geschmerzt hätte, hier hatte er verletzt. Die beiden Frauen waren dem Geblüt nach Französinnen, die lebhafter fühlten, und Howard besorgte, sie hatten an Doughby eine Entdeckung gemacht, die dem Kentuckier fatal werden konnte, die Entdeckung einer gewissen Gemeinheit, einer Gemütsöde. Bereits war etwas wie Widerwille auf ihren hübschen Gesichtern zu lesen.
Woher kommt doch dieses feine Gefühl bei Weibern, das bei weit weniger Scharfblick, als wir Männer haben, um so viel tiefer eindringt, fragte sich Howard. Liegt es im zarteren organischen Bau, im reizbareren Nervensystem, das jeden rauheren Anklang lebhafter in ihnen schwingen macht, ihre Gemüter stärker durchschauert? Oder im feineren Takt der durch Leidenschaften nicht getrübten Anschauung? Oder dem natürlichen Widerwillen gegen alles, was gemein, gefühllos ist? Sicher ist es, daß dieser zarte Takt, diese sensitive Reizbarkeit bei Frauen, die reinen, unbefleckten Herzens sind, stark hervortritt und daß jeder rauhere Anklang in ihrem ganzen organischen System stärker nachhallt als bei uns Männern, zwar wieder verklingt, aber doch Spuren hinterläßt.
»O George!« flüsterte Luise ihm mit weicher Stimme zu. »Arme Julie!«
»Nicht doch, Luise! Nicht doch, Julie!« wehrte Howard ab. »Laßt keine Regenschauer den heiteren Himmel eures Ehelebens trüben!«
Und Doughby ergriff die Hand seiner Frau und sah ihr fest fragend in die Augen. Sie schlug den Blick zu ihm auf, das flüchtige Wölkchen am heiteren Horizont schien schwinden zu wollen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber beachtenswert dürfte es immer sein, dieses Wölkchen ließ vielleicht doch einen leichten Dunst zurück. Wie der Hauch, der am blank polierten Stahl hinaufgleitet, verschwand es. Wenn aber der Hauch öfters kommt, setzt er jenen Rost an, den Rost des trostlosen Bewußtseins eines verfehlt angeknüpften Daseins, getäuschter Hoffnung, verdorbenen Lebensglücks.
»Maman!« riefen die beiden Schwestern und winkten zum Ufer.
Der Dampfer rundete dem Landungsplatz zu, alles war vergeben, vergessen. Luise konnte kaum die Zeit abwarten, bis die Bretter ans Ufer fielen. Sie sprang voran, zog Julie hinterdrein, und dann flogen beide ihrer geliebten Maman zugleich in die Arme.
Wie so ganz anders sie hier doch fühlten als die Nordländerinnen! Mutter und Töchter preßten sich, als wollten sie ineinander verwachsen, nimmer sich trennen, so stürmisch, herzinnig! Endlich sprang Luise zurück, erfaßte Howard beim Arm und zog ihn mit tränenden Augen der lieben Maman zu. In diesem Augenblick kam auch der Papa, der hinter einem klafterdicken Cottonbaum Verstecken gespielt, hervorgerannt. Luise sah ihn kaum, so rannte sie auf ihn zu.
»Mechant que tu es, Papa!«
Sie zog den guten Mann gleichfalls der lieben Maman zu. Dampfschiff und Zuschauer waren für sie gar nicht vorhanden. Mittlerweile kam auch Doughby heran. Er rief den beiden Schwiegereltern auf ihrem eigenen Grund und Boden ein Willkommen zu und drückte ihnen lachend die Hand, daß beide aufschrien über den Kentuckierscherz. Maman griff zu ihrem Riechfläschchen, denn er roch stark nach Toddy, der unglückselige Doughby.
Nach den ersten Begrüßungen führte Papa Menou seine Gäste zum Wagen, einer eleganten Berline, mit zwei raschen Rappen bespannt. Alle packten sich in die alte Familienkarosse ein, samt Nachtsäcken, Koffern und Schachteln. Mutwillig und fröhlich hätschelte Luise bald die Maman, bald den Papa. Bald schmollte sie Cato, der ihr zu langsam fuhr, und der Schwarze bleckte vor Freude die Zähne. Alle redeten zugleich, es war ein kleines Babel, dieser Kasten während der zehn Minuten Fahrt.
Doch siehe da! Luise hielt auf einmal inne, fuhr mit der Hand über die Stirn. Wahrhaftig, eine Träne!
»Was fällt dir auf einmal ein, Luise?«
Sie gab keine Antwort, deutete nur mit dem Finger aus dem Wagen hinaus. Zwischen dem Kranz von Akazien und Baumwollbäumen, die es von mehreren Seiten umringten, schimmerte das Vaterhaus hervor. Eine Pause entstand, während der Vater und Mutter bewegt das von süßer Wehmut gedrängte Kind anschauten.
»Luise!« sagte Howard sanft.
Sie gab keine Antwort, aber sie starrte das Vaterhaus an mit seinen malerischen Giebeln und seinem architektonischen Wirrwarr. Ja, sie betrat das Haus zum ersten Male wieder, seit sie es gegen das ihres Mannes vertauscht hatte. Es stand abermals vor ihr. Wie der Baum der Erkenntnis rückte es ihr die Vergangenheit vor die Augen, die Gegenwart, die Zukunft. Jene Tage, wo sie heiter und grün, eine unentfaltete Knospe, am blumigen Gängelband elterlicher Fürsorge umherschwirrte, keine Sorgen kannte als die, wie der Schmetterling von einem unschuldigen Genuß zum anderen zu flattern! Und nun die Gegenwart mit ihren Plackereien des Alltagslebens und seinen Mühen und Lasten, die sie ihrem Gatten, tragen half! Und die graue Zukunft, im düsteren Nebelvorhang verschleiert! Alles das stand vor ihr, und die Erkenntnis, ob sie gut oder böse gewählt habe, stand auch vor ihr, in diesem Augenblick wie ein Schild auf das Vaterhaus geschrieben. Dieser Augenblick sagte ihr, sagte Howard, ob er sie, ob sie ihn glücklich machte.
Howard schaute sie bewegt, ängstlich an.
Ihre in Tränen schwimmenden Augen hingen noch immer in stiller Wehmut am Vaterhaus, an jeder Hütte, jedem Baum, der in ihren Gesichtskreis trat. Jetzt fielen sie auf Howard. Ein freudiges Blitzen durchzuckte sie, sie drückte seine Hand, sank ihm in die Arme.
»George!«
»Luise! Bedauerst du, das Vaterhaus verlassen zu haben?« fragte er leise.
»Nein! Nein!« flüsterte sie.
»Danke dir!«
Jetzt fühlte Howard, daß er glücklich war, weil er sie glücklich gemacht hatte. Vater und Mutter sahen beide starr an. Als sie aufblickten, fielen ihre Blicke auf Julie, in der ähnliches vorgegangen war, die sich aber so fest an die Mutter anklammerte, als ob sie nicht mehr von ihr lassen wolle.
»Mes enfants! Voilà du monde qui nous attend!« mahnte der Papa.
Und wie der Regenschauer vor den siegenden Strahlen der Sonne schwindet, so schwanden Wölkchen und Tränen auf diese Worte. Zwanzig Stimmen, die sie begrüßten, rissen sie vollends aus den tiefen Gedanken.
*
Es war ein entzückender Abend. Im Westen der Pflanzung erglühten die Wälder wie ein wogendes Feuermeer. Die gebrochenen Strahlen flammten durch Dattelpalmen, Traubenkirschbäume, Papaws und Pecans herüber. Die ganze Landschaft leuchtete in siegender Glorie auf. Die Giebel des Vaterhauses neigten sich und tanzten in dem verschwimmenden Farbenschmelz der Cottonwood- und Akazienwipfel. Himmel und Erde schienen sich in den lechzenden Strahlen des scheidenden Gestirns noch einmal zu umarmen.
Alles bebte, zitterte in den letzten Pulsschlägen des Tages. Bäume und Sträucher, die Orangen- und Zitronenwäldchen, die südwestlich und östlich des kleinen Sees sich gegen das Negerdorf hinabwanden, sie schwammen, die Negerhüttchen mit ihren winzigen Gärtchen schienen sich hin- und herzuwiegen in der flimmernden Luft, die Cottonfelder bis zu den Urwäldern hinüberzuwogen. Ein Flammenmeer, so weit das Auge reichte. Ein solcher Abend ließ die Hitze eines ganzen Sommers vergessen. War doch ein wundervolles Land, dieses Louisiana!
Howards Freund Richard Moreland, Mistreß Houston und die Gesellschaft, die ihn und Doughby auf der Fahrt begleiteten, waren bereits ausgestiegen, warteten auf der Piazza. Sie schauten drein mit Mienen, die recht deutlich sagten: Touch me not – rühr mich nicht an!
Ist eine wahre Plage, diese unsere Steifheit und Starrheit, die aller geselligen Annäherung Trotz bieten, dachte Howard. Wie ganz anders wieder diese Franzosen oder Kreolen, welche zuvorkommende Beweglichkeit!
Sie hüpften, sprangen den angekommenen Gästen entgegen. Gerade als sie ausstiegen, kamen zwei Damen mit einem ältlichen Herrn zu Pferde durch das Dorf an die Wagen herangesprengt. Aus den Laubengängen, die den See umfaßten, brachen ein paar andere hervor. Es waren zwei Herren mit einer Dame, die wahrscheinlich auf einer Kahnfahrt gewesen waren. Sie schulterten ihre Ruder, präsentierten und kamen dann lachend heran. Alle fühlten sich augenscheinlich wie zu Hause, bis auf Mistreß Houston und ihre Gesellschaft, die sich sehr anständig unbeweglich in der beweglichen Umgebung ausnahmen.
Maman und Julie wurden unterdessen von zwei Messieurs Lassalle und Monteville aus dem Wagen gehoben. Luise hüpfte lachend statt ihrem Mann dem Chevalier der beiden Damen in die Arme, der auch, ohne Howard zu fragen, vom ›Wagenrecht‹ Gebrauch machte und ihr einen Kuß auf die linke, einen zweiten auf die rechte Wange drückte. Und sie machte es ihm recht bequem.
»George, das ist Papa Vignerolles!« lachte sie. »Das ist George Howard, mon mari – Graf Louis Victor de Vignerolles!«
Der Mann stellte sich Howard vor, eine altadelige Erscheinung. Man sah es beim ersten Blick. Während Luise den beiden von ihren Pferden abgestiegenen Damen in die Arme flog, wollte Howard einige Worte mit ihm wechseln, hatte aber nicht die Zeit, die Umarmungen gingen so stürmisch vor sich.
»Ninon! Genièvre! Luise!« riefen alle drei auf einmal und hielten sich umschlungen.
Dann tanzten sie Arm in Arm der Piazza zu, Howard hinterdrein. Mit Schal, Strickbeutel und derlei Dingen. Auf dem Wege hatte Luise noch ein halbes Dutzend Knickse zu machen und Umarmungen zu erwidern. Die beiden Herren von der Kahnpartie, Vergennes und d'Ermonvalle, kamen gleichfalls, um ihren Anteil abzuholen. Sie aber schlug ihnen ein Schnippchen.
»How d'ye do?« lachte sie und reichte ihnen die kleinen Finger beider Hände, die sie in Ermangelung von etwas Besserem zum Mund führten. Sie tat recht, denn reichte man diesen Franzosen den kleinen Finger, wollten sie in einer halben Stunde die ganze Hand.
Und jetzt kam ein Dutzend Kammerzofen und Hausbediente, versteht sich Schwarze, alle in ihrer Galalivree, grün mit Goldschnüren, die Mädchen dunkelrot mit grünen, turbanartig gewundenen Kopftüchern. Alle grinsten vor Freude und fletschten die Zähne. Die alte Diana führte sie an, die Hausmeisterin, die, mit vier Schlüsselbünden bewaffnet, deren jeder wenigstens zwanzig Schlüssel hielt, einen Majordomo gar nicht übel vorstellte. Kaum ward sie von Luise gesehen, so wurde sie auch bereits in Empfang genommen.
»Ah Diana! Unsere Zimmer, geschwind unsere Zimmer!«
Und sie ließ der Alten nicht Zeit, ihr die Hand zu küssen. Sie mußte sogleich fort. Die Zimmer, die Zimmer! Und hinter den Gästen schwärmte ein Vierteldutzend schwarzer dienstbarer Geister, jeder etwas von der Luggage – dem Reisegepäck – in den Händen. Fort ging es wie im Sturm, durch die Gänge den Zimmern zu.
»Aber mein Gott, Diana!« rief Luise. »Wo willst du denn hin? Hast du den Kopf verloren? Da sind ja unsere Zimmer!«
Diana lachte und grinste und wies die Zähne: »Monsieur le comte de Vignerolles!«
»Aber mein Gott! Papa Vignerolles hat seine Zimmer doch sonst über dem See!«
Wieder grinste die Alte mit einem schlauen Lächeln: »Le baron de Lassalle!«
»Welche Verwirrung!« schmollte Luise. »Da siehst du, George, wenn unsereins von Hause ist, so geht alles bunt über Eck!«
Doch sofort trippelte sie bereits höchst ungeduldig der Alten nach, die endlich am äußersten Ende des ewig langen Korridors vor einem Galeriezimmer hielt und es aufschloß.
Wunderschön, dieses Zimmerchen, recht lieblich traulich, dachte Howard. Zitronen- und Orangenzweige rankten durch die Jalousien hinein, man könnte die goldenen Früchte pflücken, ohne die Hand durch die Fenster zu strecken.
»Aber klein, Luise! Sehr klein! Kaum zwölf Fuß lang, zwölf Fuß breit! Gar zu eng, und nur ein einschichtiges Bett!«
»Mein Gott!« rief Luise. »Wo hat Papa nur hingedacht?«
Die alte Diana lachte ihr ins Gesicht. Luise aber ließ alles liegen und stehen, faßte Howard an der Hand und rannte fort, fort durch den ganzen langen Zickzackgang zur Piazza, wo der Papa noch mit den Gästen stand. Als er seine Tochter sah, überflog ein schelmisches Lächeln das ein wenig vertrocknete väterliche Gesicht. Sie zog ihn ungeduldig seitwärts.
»Viens, Papa, viens, Papa! Qu'as tu fait?«
Und mit mußte er, er mochte wollen oder nicht. Und vor dem Zimmerchen angekommen, zog sie ihn herein, lief einmal, zweimal auf und ab, gerade als ob sie das Zimmer abmessen wollte, und wandte sich zum Papa.
»Mais, Papa! Que penses-tu? Comment nous arrangerons- nous? Mais c'est trop petit!« sagte sie dann vorwurfsvoll.
Sie ließ dazu die Unterlippe so allerliebst herabhängen, daß ihr die schneeweißen Perlenzähne durchschimmerten. Der Papa lachte und schritt zur Wand. Er griff unter die Seidendecke des Bettes. Eine Feder knarrte, und eine vergoldete Handhabe kam zum Vorschein. Er drehte daran, die Schuppenwand bewegte sich und ging auseinander, das einfache Bettchen wurde zum doppelten, das Kabinettchen zum geräumigen Schlafzimmer.
Luise schaute, klatschte in die Hände und fiel dem lieben Papa, der wie die Mehrzahl der Kreolen ein mechanischer Tausendkünstler in derlei Dingen war, um den Hals. Der Papa rollte die Wand wieder ineinander und zeigte auf eine zweite Feder, die eine in der Wand verborgen angebrachte Tür öffnete. Dann lief er zur Tür hinaus.
Howard und seine Frau besahen den niedlichen Einfall, die artige Überraschung, um so artiger, als wirklich eine Mauer durchbrochen werden mußte, um seinem lieben Kind den kleinen Streich zu spielen. Das hätte wieder ein amerikanischer Pa nicht getan, eine solche kurzweilige Idee wäre alle Tage seines Lebens nicht in sein trockenes Gehirn gekommen.
Das Schlafzimmer, im besten Geschmack eingerichtet, konnte nach Beheben in zwei Ankleidezimmer umgewandelt werden. Luise trippelte aus einem Zimmerchen in das andere, prüfte die Waschtische, die verschiedenen Fläschchen mit Wässern und Parfüms, und alles fand sie allerliebst.
»Luise, wollen wir uns nicht umziehen?«
Sie legte den Finger auf einen der Knöpfe ihres Reitkleides, zögerte aber, etwas Neues fuhr ihr durch den Sinn. Zuvor mußte sie noch sehen, ob das Haus auch noch am alten Fleck stünde. Die Veränderungen mußte sie schauen, und ihr Mann mußte natürlich mit. Die Inspektionsreise führte zuerst in das Appartement der Maman, die aber nicht da war. Ein flüchtiger Blick in das Boudoir, dann ging es weiter. Diana, die gerade vorbeitrottete, wurde mit den vier Schlüsselbünden in Empfang genommen. Ein Fragen begann, beide redeten auf einmal. Jeder Nagel, der seit ihrer Abwesenheit eingeschlagen worden, wie er eingeschlagen worden, alles wurde erörtert, mit einer Zungenfertigkeit erörtert! Es ist etwas einziges um ein paar Weiberzungen, dachte Howard belustigt.
Alle Gemächer, die noch nicht besetzt waren, wurden im Flug durchstrichen, in jeden Winkel wurde hineingesehen, selbst die Vorratskammern, die Garderobe für die Schwarzen wurde nicht vergessen. Hier kam der Papa hinzu.
»Papa«, meinte sie. »Gar zu viele Wolldecken! Was willst du mit all den Wolldecken machen? Die Motten, weißt du!«
Der Papa lächelte.
»Einhundert Decken könnten wir brauchen«, war ihre unmaßgebliche Meinung. »Wollen darum senden, oder besser, Papa, du sendest sie uns selber!«
Papa lachte und nickte, und sie flog ihm um den Hals. »O mon eher Papa!«
»Ma petite chère Luise!«
Weiter ging es, nachdem sie ihm die Hand zum Dank für die Wolldecken geküßt hatte. Alles wüßte sie zu gebrauchen, ließen sie der Pa schalten und die Ma, sie behielten keinen Topf im Hause. In den Garten ging es, oder vielmehr den Orangen- und Zitronenhain. Einige hundert Bäume waren mit Früchten ganz beladen, das erstemal seit sechs Jahren. Denn im Winter 1822 waren die Orangen- und Zitronenbäume in ganz Louisiana erfroren. Sie bildeten einen köstlichen Kranz goldener Früchte, duftender Blüten.
»Noch dreißig bis vierzig Bäumchen könnten wir wohl brauchen«, meinte Luise. »Die unsrigen tragen vor einigen Jahren nicht.«
»Aber wir müßten erst Kübel haben und sie darin hinabschaffen, das würde viel Mühe machen!«
»Laß nur Pa dafür sorgen, er schafft schon Rat!«
Aus den Gärten sprang sie hinüber ins Negerdorf. Kaum ersah das schwarze Völkchen die Gestalt des Lieblings, so erhob sich ein Jauchzen. Von allen Seiten kamen die Kinder, Knaben, Mädchen, frohlockend herangesprungen, eine ganze Herde von schwarzen Wechselbälgen, wenigstens hundert, vom zweijährigen Piccaninny bis zum zwölfjährigen Mädchen oder Knaben. In jede Hütte guckte sie, ein paar Worte lachte sie hinein und sprang wieder heraus, um dasselbe Spiel bei der nächsten fortzusetzen.
»George, wir gehen zur alten Toni, weißt du, die alte Toni, die schon bei Großpapa ...« rief sie endlich.
Toni war die erste Schwarze, die in die Familie gekommen, gewissermaßen die Stammutter der schwarzen Generation auf der Pflanzung.
»Toni, liebe, gute Toni, kennst du deine Luise nicht mehr?«
Toni war eine eisgraue Negerin. Ihr dunkelgrünes versteinertes Gesicht war nicht mit Negerwolle, nein, einem Haarmoos überzogen, ihre Augen waren tief eingefallen, und bloß ein zeitweiliges Schimmern des Weißen verriet, daß sie der Sehkraft nicht ganz beraubt war. Sie war ein malerisches hundertjähriges Fragment, die alte Toni, wie sie dasaß, trotz der lieblich-milden Lüfte in dreifache Wolldecken gehüllt. Als sie Luise hörte, erhob sie ihre Stimme, es war mehr ein röchelndes Geächze als eine menschliche Stimme. Sie streckte ihre klapperdürre Rechte aus der Wolldecke heraus, erfaßte die Hände Luisens, preßte sie und schlug die Augen auf, senkte sie aber wieder, die Abendröte war zu grell für sie.
»Mon bon enfant!« kreischte sie endlich.
»Toni! Toni!« rief Luise. »Du mußt in die Hütte, die Abendluft wird zu kühl für dich!«
Die Alte nickte. Howard und seine Frau hoben sie und führten sie ihrer Hütte zu, in der eine ihrer Urenkelinnen mit ihr wohnte. Sie ließen sie auf ihrem Bett nieder, und die Alte kreischte nochmals »Bon enfant!« Luise fragte sie, ob sie zufrieden sei, ob sie keinen Wunsch habe. Den hatte sie nicht. Howards Schwiegervater Menou nährte und pflegte die Alte wie seine eigene Großmutter, obwohl sie mehrere tausend Dollar eigenes Vermögen besaß, was bei alten treuen Negern, die mit ihren Ersparnissen hausgehalten hatten, sehr häufig der Fall war.
Sinnend verließen George und Luise die Hütte Tonis, vor der nun die ganze junge schwarze Bevölkerung des Dorfes versammelt war. Luise hatte Gelegenheit, ihre ziemlich schwere Handtasche zu erleichtern. Jeder erhielt seinen Anteil, die größeren einen halben, die kleineren einen Vierteldollar, die kleinsten ein Escalin. Der Jubel war groß. George und Luise mußten sich im Ernst der Zärtlichkeiten erwehren, sonst hätte man sie auf Händen ins Haus zurückgetragen.
Sie kamen dort an, als gerade der flammende Feuerknäuel hinter dem Kranz der Traubenkirschbäume verschwand.
»Wir müssen an unsere Toilette denken, George!« meinte Luise. »Papa sieht bei solchen Gelegenheiten darauf!«
»Er hat recht! Eine elegante Toilette ist das Lebensprinzip eines Salons!«
Doch siehe da! Vor dem Wirtschaftsgebäude stand Julie, vor dem Hundebehälter Doughby mit Monsieur Tricot, dem Aufseher. Menou hielt nämlich ein Dutzend Hunde, auf deren Zucht und Veredlung er viele Sorgfalt verwandte. Es war eines seiner altadeligen Steckenpferde. Da waren drei Bluthunde von der Größe halbjähriger Kälber, furchtbare Tiere, aber ungemein edel und schlank gebaut.
Doughby hatte wieder eine Teufelei im Kopf. Er wollte die Hunde heraus haben, ihren Gang und so weiter sehen. Tricot meinte, wenn er vier Leben hätte, so möchte er es wagen. Drei Leben würden sie in weniger Zeit nehmen, als nötig wäre, ein Kotelett zu verzehren. Bloß Monsieur de Menou könne sie meistern.
»Pah, mit ihren Bluthunden und wildem Getier!« schrie Doughby. »Sag dir, Schwager, das wildeste Getier ist der Mensch, der ledert sie alle! Sah letztes Jahr so eine wilde Karawane in New Orleans, einen Löwen und ein paar Bären und Panther, mit denen sie eine Hetze veranstalteten. Schaute mir den Löwen so an, und wie ich ihn mir ansah, kam es mir in den Sinn, und war auch vollkommen überzeugt, ihn ledern zu können. Sagt' es auch dem Tiertreiber, sagte ihm, was gilt die Wette, ich nehm' es mit euerm großmäuligen Löwen auf, will ihn ledern, euch zeigen, wie ein Kentuckier einen Löwen ledert! Mögt noch dazu ein paar Affen und Zibetkatzen an meinen Rockschößen herumzerren lassen, will mit allen fertig werden. Wollte es auch mit einem dieser Bluthunde aufnehmen! Aber wo geht ihr hin?«
So rief er George und Luise nach. Die hatten sich bereits dem Hause zugewandt, um nicht einer neuen kentuckischen Großtat beiwohnen zu müssen. Das beste Mittel, den Wildfang ins Geleise zu bringen. Man sah, er hatte Lust zu einem Kampf. Vor acht Wochen würde er kaum widerstanden haben, aber sechs Wochen Ehestand hatten ihn doch kühler, zahmer gemacht.
»Toilette machen!« antwortete Howard.
»Toilette machen?« Er besah sich von Kopf zu den Füßen. »Glaube, wir schauen doch sauber genug aus!«
»Gehen zur Tafel, und die Gesellschaft ist, wie du weißt, ausgesucht! Können doch nicht in Stiefeln erscheinen!«
»Hast recht, dürfen uns nichts vergeben! Möchten sonst glauben, wären so ein paar Squatters!« Er trabte den beiden nach. »Wollen also Toilette machen, Julie! Aber macht es kurz, Schwager! Bin bei euch, ehe ihr's euch verseht!«
»Brauchst dich nicht sehr zu beeilen, lieber Ralph! Werden ohnedem noch oft genug das Vergnügen deiner Gesellschaft haben!«
Sie gingen lachend ins Haus.
»Ist im Grunde genommen gar kein übler Bursche, liebe Luise. Ein wenig rauh zwar, auch juckt es noch stark in ihm, lodert, brennt heraus wie inneres Feuer. Aber die Ausbrüche sind nicht mehr so heftig, ist doch schon viel Unterschied zwischen dem Junggesellen Doughby und dem Ehemann zu spüren.«
»Aber noch fehlt die Politur«, meinte Luise. »Er ist ein halber Barbar.«
»Das ist wahr, wird sich aber geben. Denn er hat Ehrgeiz, und dieser ist ein trefflicher Hebel, der den rauhesten Klotz ...«
Doch Luise war bereits in ihrem Kabinett verschwunden. Howard begann sich gleichfalls umzuziehen.
Er war bis zum Anziehen der Jacke fertig. Luise trat soeben im Pudermantel in die Tür, in der Hand zwei Kornähren aus Madame Dubois' berühmter Blumenfabrik, als es an der Korridortür klopfte.
»Walk in!«
Doughby trat bereits umgekleidet ein.
»Wenn du uns zehn Minuten später mit deinem Besuch beglücken möchtest – wir sind noch nicht fertig.«
»Dann will ich euch nicht stören«, versetzte er. »Komme nur, weil mich Julie mit dem Moskitowedel forttrieb. Habe ihr, sagt sie, ein ganzes Blumenbukett verdreht, das, weiß nicht, wie viele Dollar kostet und aus einer weltberühmten Fabrik her ist.«
Luise gab George einen Wink, der zu sagen schien:
»Laß ihn!«
»Wohl, Schwager, so nimm denn Platz!«
»Hört«, fuhr er fort, »wenn ich so allein bin und nichts zu tun habe, kommen mir immer Teufeleien in den Kopf, eine nach der andern.«
»Was sagst du, George?« fragte Luise und hielt die beiden Kornähren über die in einen Knoten geschlungenen Haarflechten.
»Recht artig! Aber ich würde sie so anbringen.« Howard legte die beiden Kornähren zu beiden Seiten des Haarknotens.
Sie eilte in ihr Kabinett zurück und kam in der nächsten Minute geputzt wieder heraus.
»Du hast recht, George! Und welches Kleid?«
»Evening dress, Luise! Rosarot steht dir ungemein gut zu deinen blonden Locken!«
»Was nimmst du für einen Rock?«
»Braun ist die letzte Mode.«
»Dann nehme ich auch braun!«
Luise schlüpfte abermals durch die Tür. Doughby sah ihr aufmerksam nach, schaute dann Howard an, augenscheinlich in Gedanken. Sie kam wieder hereingetanzt in einer Robe von braunem Gros de Naples.
»Nun«, lachte sie, »geh hin und tu desgleichen! Ich will unterdessen unseren Schwager unterhalten.«
Howard ging und zog den braunen Frack an.
»Die emaillierten Busenknöpfe stehen dir gut, George. Ich will Armbänder von derselben Art nehmen.«
Abermals schlüpfte sie durch die Tür, kam jedoch sogleich wieder mit den Armbändern in der Hand, die sie ihm reichte. Er legte ihr die Goldschnallen um die zarten Gelenke, die er küßte, gerade als Julie an der Tür klopfte und den Kopf hereinsteckte.
»Darf ich?«
»Aber Julie«, rief Luise und schlug in komischem Schreck die Hände zusammen, »du hast ja noch die Schuhe vom Dampfschiff an!«
»Daran ist Ralph schuld! Er hat mir und Polly den Kopf so wirr gemacht, daß sie mir die Prünellstiefelchen wieder anlegte. Psyche, geh und sag Polly, sie soll die grünen Schuhe bringen!«
Und Psyche lief, und Polly brachte die grünen Schuhe und Psyche das gepolsterte Fußschemelchen, auf das Julie den rechten Fuß setzte.
»Nun, Doughby, weißt du nicht, was Pflicht und Schuldigkeit von einem galanten Ehemann heischt?« fragte Howard.
»Was?« meinte Doughby.
Howard deutete auf den Fuß.
»Werdet doch nicht wollen, ich soll die Schuhriemen auflösen?«
»Er ist's nicht würdig, sie aufzulösen«, meinte Luise.
»Da hat meine schöne Schwägerin ganz recht!« lachte Doughby.
Etwas ungelenk bückte er sich und legte seine Bärentatzen an die Stiefelchen. Während er noch mit dem zweiten Fuß beschäftigt war, traten der Papa und die Mama ein. Einen Augenblick schauten sie, angenehm überrascht. Besonders die Mama schien, nach ihrer halbverwunderten Miene zu schließen, Doughby einer solchen Aufmerksamkeit gar nicht für fähig zu halten.
»Schwager, ihr macht mich noch zum Adepten!« raunte Doughby Howard zu, während der Pa und die Ma Luisens Kleid betrachteten.
»Der den Stein der Weisen sicher noch finden wird!« ergänzte Howard. »Merk dir das, unsere Weiber sind Kreolinnen, oder was dasselbe sagen will, Französinnen. Sie haben zwei Seelen, eine äußerst konventionelle und eine innere. Erst wenn in diese zu dringen dir geglückt ist, bist du ihrer sicher, sonst nicht. Und das unfehlbare Mittel, da einzudringen, sind diese kleinen Aufmerksamkeiten und Spielereien. Sie wollen in der Ehe ein wenig geschmeichelt, geliebkost sein.«
»Wahr, aber ein wenig lästig! Aber hoble mich nur immer!« Doughby drückte Howard die Hand. »Brauche es, weiß es wohl!«
Die Tafelglocke ließ sich nun hören und führte alle heiter und fröhlich ihrem Schall nach dem Speisesaal zu.
2
In den Korridoren fing es an zu dunkeln. Die Gentlemen und Damen waren kaum mehr voneinander zu unterscheiden, wie sie ihre Zimmer verließen. Der Gäste waren mehr, als Howard gedacht. Die Damen erreichten die schöne Zahl der Musen, der Herren war ein volles Dutzend.
Als sie in den hell erleuchteten Salon eintraten, warfen Eingeführte und Einführende sich forschende Blicke zu, die kurz auf den Gesichtern, den Kleidern hafteten und dann in ein zufriedenes Lächeln übergingen. Es war etwas naiv Drolliges in diesem wechselseitigen Mustern, das herausfinden wollte, wer das Vis-à-vis und ob es auch comme il faut wäre. Die Blicke der Kreolen waren neugieriger, verrieten aber mehr Feingefühl, obwohl ein leichter Anflug von Arglist auch wieder nicht zu verkennen war. Die Blicke der Nordamerikaner waren starrer, bohrender. Auch die Haltung der Franzosen war natürlicher, ungekünstelter, freier. Die gute Gesellschaft war das Element, in dem sie sich von Jugend auf bewegt. Die Nordamerikaner dagegen, besonders Mistreß Houston, standen so gespreizt da, als ob sie die ganze Würde ihrer Geldaristokratie zu repräsentieren hätten.
Sie musterte die Kreolen oder Franzosen mit zweifelhaften Blicken, die erst in ein süßes Lächeln auftauten, als sie die klassischen Namen Comte de Vignerolles, Baron de Lassalle, de Monteville und so weiter hörte, Namen, die sich an sehr bedeutende Häuser am Red River und in den Attacapas knüpften, an Häuser, deren Gründer ihre Geschäfte so wohl verstanden, daß sie die gute Gesellschaft par excellence bildeten.
Soll ich die Wahrheit gestehen – dachte Howard – würde ich zwischen guter Gesellschaft zu wählen haben, ich würde lieber die der Kreolen nehmen als die unserer Geldaristokraten in New York, Boston oder Baltimore, die beinahe durchgängig nur Provinzial-Nachdrücke der Londoner Ausgaben sind und durch ihre Nachäfferei nur anekeln. Die Kreolen hingegen bildeten eine wahrhaft gute Gesellschaft, der man es ansah, daß sie noch aus jener alten Zeit herdatierte, wo der Adel noch keine Rivalin an der Geldaristokratie hatte.
Während sein Freund Richard sich in seiner kühlen Art noch zurückhielt, hatte Doughby bereits mit den meisten Bündnisverträge geschlossen, die Hände der Herren wie der Damen mit Kentucky-Anmut erfaßt.
»And how d'ye do, my dear Mister Comte?« fragte er den Grafen Vignerolles.
»Very well, my dear Mister Doughby!« erwiderte der Graf.
Howard grinste. Käme der gute Doughby in die Tuilerien zu König Charles X., er würde seine Hand gleich ungeniert erfassen und ihn ebenso unbekümmert fragen: »How d'ye do, my dear Mister Charles dix?«
Nur schade, daß die aufgehenden Flügeltüren des Speisesaals diese nette Unterhaltung verkürzten, aber was kam, war noch fesselnder, obwohl Doughby stutzig schien. Es war recht possierlich zu bemerken, wie naiv er auf einmal dreinschaute, sich so auf einmal alleinstehend, von aller Welt verlassen zu finden. Der gute Doughby war noch Neuling in diesem Punkt, hatte keine Ahnung von den angenehmen Empfindungen, die der Anblick eines wohlangerichteten Speisesaals, einer in die Augen blinkenden Tafel erregen. Wie wohltuend die Gesamtheit gastronomischer Vorrichtungen auf Herz und Sinne wirkt, wie der Vorgeschmack auf allen Gesichtern ein so unvergleichlich wohlwollendes Lächeln hervorzaubert!
Bei einigen äußerte sich auch bereits die Wirkung dieses Anblicks durch ein unwillkürliches leises Schnalzen der Lippen und der Zunge. Das war der Fall mit Howards Nachbarn, dem Chevalier d'Ecars, den Doughby mit einem Satyrslächeln beäugte. Aber Doughby war in diesem Punkt ein Barbar, der weder von Lucullus noch von Apicius gehört hatte.
Howard hingegen liebte eine wohlbestellte Tafel mit appetitlich weißem Tischzeug, hübschem Eßgeschirr. Um Silber fragte er nicht viel, Sèvresporzellan tat es auch; und das ließ sich hier schauen. Die Aufsätze waren geschmackvoll, die Kühlwannen mit den Flaschen verrieten viel »savoir vivre«, die ganze Anrichtung viel Takt. Feine Servietten auf den Gedecken, zwei Suppennäpfe an beiden Enden nebst einigen bedeckten Schüsseln. In der Mitte ein Aufsatz und hinter den Sesseln ein halbes Dutzend sauber gekleideter Diener.
Man nahm Platz. Howard saß zwischen seiner Frau und Genièvre Vignerolles, einem allerliebsten Mädchen. Es gab eine Austernsuppe, die Monteville in Entzücken brachte. Es entstand eine kurze Debatte um Suppen, die aber mittendrin abgebrochen wurde, denn die Deckel wurden von den Schüsseln gehoben, und damit nahm der Ideengang eine neue Richtung.
»Weißt du, lieber Menou, daß sich der neueste gastronomische Grundsatz gegen das Bedecken der Fische wendet?« bemerkte der Graf de Vignerolles.
Seine fein aristokratischen Züge, der schöne schneeweiße Kopf mit der geistreichen Stirn, leicht gerunzelt, die zarte Gesichtsfarbe mit den lichtblauen, funkelnden Augen hatten Howard schon beim ersten Zusammentreffen ungemein angesprochen.
»Es kommt darauf an, welche Gattung von Fischen es ist«, versetzte Menou mit dem Gesicht eines Kathedermannes. »Zum Beispiel Soles oder frischer Stockfisch, das gebe ich dir zu, aber unsere Sturgeons und Turbots vertragen es nicht.«
Die Fischunterhaltung wurde durch das Anstoßen der Madeiragläser unterbrochen, worauf eine kurze erwartungsvolle Pause eintrat. Der Übergang zu regerer Tätigkeit wurde durch zwei neue Erscheinungen bewirkt: Green Turtle- und Ringeltauben-Pasteten.
»Bon!« sagte d'Ecars.
»Delicieux!« bemerkte Lassalle.
Howard versuchte die Schildkrötenpastete. Sonst liebte er sie nicht sehr, denn das Fleisch erhielt erst durch Gewürze seinen Geschmack, und er haßte alles, was Gewürze enthielt. Doch dann kam das wahre Ding, die zweite Tracht, und mit dieser als Einleitung: Canvas-back duck – Wasserenten! Keine europäische Kaisertafel kann ein Gericht so zart, so duftend, so schmelzend aufweisen! Das Fleisch zergeht buchstäblich auf der Zunge, das Fett träufelt über die Lippen, es ist ein wahrer Hochgenuß!
Tiefe Stille herrschte während der sechs Minuten dieses Schmauses, und Howard hing seinen Gedanken nach.
Die allerliebsten Tierchen waren in der letzten Nacht im Ocasse-See gefangen worden und daher ganz frisch, was sie auch unbedingt sein müssen. Denn zwei Tage alt haben sie allen Geschmack verloren. Die Seen Louisianas, so höllische Dünste und Dämpfe sie ausatmeten, wimmelten von Fischen und waren ganz bedeckt mit allen Arten von Wasservögeln. Eine Jagd auf dem See bei Natchitoches war der Mühe wert. Der Horizont glich einer dichten Wolke von Wildenten, Gänsen und fliegendem Getier, unter die man nur blindlings hineinzuschießen brauchte, ohne zu zielen. Solch eine Jagd war eine wahre Schlacht, die zwei oder drei Stunden dauerte, und auf der einen Seite von ein paar hundert Schützen geliefert, auf der anderen von Hunderttausenden von Wasservögeln ausgehalten wurde. Erst wenn die Jäger müde und matt waren, nicht mehr laden noch schießen konnten, sammelten sie die Beute, von der in der Regel auf den Mann mehrere hundert Tiere kamen.
Überhaupt, sann Howard, so wenig man uns im Sommer um unsere Tafeln zu beneiden Ursache hat, so reich, üppig werden sie im Herbst. Der liebe Gott weiß, was seinen Louisianern guttut, und daß vieles Essen im Sommer sie mit Extrapost in sein Himmelreich bringen müßte. Deshalb spart er sich und uns die Freude auf den Herbst und Winter. Aber dieser Herbst und Winter! Das sind ganz andere Herbste und Winter als bei euch im Norden! Ganze Armeen von Zug- und Wasservögeln kommen nun von dort herabgezogen. Unsere Schaltiere, den Sommer hindurch ungenießbar, erlangen ihre Reife. Unser Louisiana ist doch, nehmt es, wie ihr wollt, eine ganz gute ... die beste Welt! Was sind zum Beispiel eure wilden Truthühner im Norden gegen diesen Riesen, wie er da vor uns in seinem Fett schwimmt? Von zwanzig ausgewachsenen Hähnen, die ihr schießt, zerplatzen unzweifelhaft achtzehn im Fallen. Dieser jedoch ist gefangen, denn diese treuherzigen, aber dummen Tiere werden auf unseren Pflanzungen zu Dutzenden in Fallen gelockt, in die sie den Weg – so eng er ist – hinein, aber nicht wieder heraus finden. Ihr Fleisch ist eine wahre Delikatesse, doch ziehen wir ihnen die Schnepfen mit ihren langen Schnäbeln vor. Auch diesen gebührt vor euren nordischen Woodcocks der Vorzug; ich habe nie im Norden einen gefunden, der über sechzehn Unzen wog, wogegen die unsrigen bis zwanzig schwer sind. Sind ein unvergleichliches Verdauungsgericht, das just das Gewürz aufweist, das ich liebe.
Doch Howard wurde seinen Gedanken entrissen. Die Unterhaltung begann wieder aufzuleben. Es entstand ein Gesumse, aus dem man noch nicht so eigentlich klug werden konnte. Der Chambertin und Chateau Margôt taten ihre Wirkung bei den Franzosen, bei den Amerikanern der Madeira. Doughby hatte seinen Platz am Ende der Tafel, und er war in eifriger Debatte mit d'Ermonvalle und Vergennes begriffen. Doughby parlierte französisch, Vergennes radebrechte englisch, d'Ermonvalle gab ein Quodlibet beider Sprachen zum besten. Bald erscholl lautes Gelächter durch den Speisesaal ob der Mißverständnisse, die dabei herauskamen.
Mit dem funkelnden Champagner wurden die Geister noch lebendiger, stürmischer. Vergennes ließ etwas von seinem französischen Liberalismus, seiner weltbeglückenden Philanthropie hören und fand es grauenhaft, daß in einem Land der Freiheit, das sich mit seiner Aufklärung, seiner Humanität brüstete, die Sklaverei bestünde. Monteville bemerkte dagegen ziemlich gelassen, obwohl ihm die Lippen bereits zuckten, daß die Sklaverei ein altes, seit anderthalb Jahrhunderten eingeführtes und eingewurzeltes Übel wäre, das nur mit der Zeit behoben werden könnte.
Das gab wieder Vergennes nicht zu. Ein so ungeheures Übel, das die Moral der bürgerlichen Gesellschaft von Grund aus zerstöre, sollte auf der Stelle ausgerottet werden. Die Regierung sollte sogleich eingreifen, die Sklaven freigeben, ihnen Ländereien anweisen, Schulen für sie errichten und so fort.
»Wir geben unsere Neger frei, sobald ihr uns für die Summen, die unsere Eltern ihr Ankauf und ihre Erhaltung gekostet haben, entschädigt!« erklärte Monteville. »Wir haben notgedrungen, gezwungen durch Frankreichs und Englands Regierungen, unser Kapital, unser Alles in sie hineingesteckt. Wir haben in den südlichen Staaten über zwei Millionen Sklaven bei einer Bevölkerung von etwas über vier Millionen Weißer, in Louisiana allein auf weniger denn hunderttausend Weiße mehr denn hundertundzwanzigtausend Schwarze und Farbige. Die zwei Millionen Schwarzen der elf sklavenhaltenden Staaten – der Kopf im Durchschnittspreis nur zu dreihundert Dollar gerechnet – erforderten eine Entschädigungssumme von sechshundert Millionen Dollar! Wo ist die Nation, die sich und die kommenden Geschlechter mit einer so ungeheuren Schuldenlast beladen würde? Aber selbst wenn die acht Millionen unserer nordischen Mitbürger – denn sie allein müßten die Entschädigung leisten – ihren fünf nachkommenden Generationen diese Schuldenlast aufbürden wollten, wäre dann dem Übel abgeholfen? Könnten sie die tierischste, trägste Rasse des Erdbodens, die einzig durch die Peitsche zur Arbeit angehalten wird, durch eine Befreiungsakte zu tätigen Bürgern umwandeln? Würden diese nicht in den ersten Monden ihrer Freiheit das Spielzeug irgendeines schwarzen Spartacus sein und mit uns einen Kampf auf Leben und Tod beginnen?«
So beiläufig lautete die Schlußfolgerung Montevilles. Während seiner sprudelnden Rede war er immer heftiger geworden. Unwillig stieß er das Champagnerglas von sich und maß Vergennes mit einem Flammenblick. Der gute Monteville merkte, daß es eine Unbesonnenheit gewesen war, sich in die Widerlegung einer Frage einzulassen, die nach Howards Meinung nie von einem Fremden in Louisiana hätte gestellt werden sollen, weil sie nur die Einheimischen und sonst niemanden anging. Was würde ein französischer oder englischer Fabrikbesitzer sagen, an dessen gastlicher Tafel ein Fremder das Ungeheuerliche der Sklaverei seiner Arbeiter, die riesige Ungleichheit zwischen dem Verdienst des Taglöhners und dem Gewinn des Fabrikherrn aufs Tapet bringen wollte? Weil die nordamerikanischen Staaten frei sind, erlaubt sich jeder Fremde Freiheiten, die er sich in seinem Land herauszunehmen wohl hüten würde.
Eine unheimliche, ja bange Stille herrschte im ganzen Saal, eine schweigsame Spannung. Keine Silbe war zu hören, alle schienen den Atem anzuhalten. Es war die Windstille, die dem Tornado vorhergeht. Alle Zungen waren wie gelähmt, die Augen der Kreolen auf Vergennes und Monteville geheftet, einige waren bleich vor Zorn. Die allgemeine Heiterkeit war verschwunden, die Damen waren nicht weniger aufgeregt.
Auf einmal ließ sich die Stimme des Grafen de Vignerolles vom oberen Ende der Tafel herab hören, freundlich und wohlwollend.
»Sind Sie schon lange in unserem Louisiana, lieber Vergennes?«
»Bereits zehn Wochen, Monsieur de Vignerolles.«
»Schon zehn Wochen? Da haben Sie freilich unser Land kennenzulernen Gelegenheit gehabt!«
Und die Miene des Grafen überflog ein ungemein fein ironisches Lächeln. Alle sahen ihn erwartend an. Er wandte sich an Papa Menou.
»Gedenkst du noch der Zeiten von 1788? Du warst damals freilich noch sehr jung, bist fünf Jahre jünger als ich. Welcher Unterschied zwischen dem alten und dem jungen Frankreich!«
»Es hatte viel Aufrichtigkeit und Feingefühl, das gute alte Frankreich«, murmelte Lassalle.
»Les extrêmes se touchent«, bemerkte der Graf. »Wir hörten in unserer Jugend die Nachklänge der alten, in unserem Alter hören wir die Anklänge der neuen Herrschaft.«
»Ich halte es mit der neuen!« rief Vergennes mit beinahe herausfordernder Heftigkeit. Der gute Junge hatte etwas zu viel Chambertin eingenommen.
»Ich glaube nicht, daß der gesellschaftliche Zustand im ganzen bei den großen Umwälzungen verloren hat«, erwiderte Vignerolles im selben freundlichen Ton. »Wir haben verloren, soviel ist ausgemacht, aber das Volk hinwieder gewonnen.«
»In fünfzig Jahren wird Europa republikanisch oder kosakisch sein!« behauptete Vergennes kurz und bestimmt.
»So hat Napoleon gesagt«, entgegnete der Graf in seinem gefällig leichten Ton. »Ich wieder bin der festen Meinung, daß die Throne der alten Welt so ruhig fortbestehen werden wie in der neuen Welt Republiken entstehen und fallen werden. An ihrem Glanz mögen sie allenfalls einbüßen, aber ihr Dasein ist zu tief in der menschlichen Natur begründet, als daß sie gestürzt werden könnten. Als Napoleon die berühmten prophetischen Worte sprach, hatte er noch keine Ahnung von der großen Macht, die seit seinem Fall entstanden ist, der Macht der Geldaristokratie, die als Mittlerin zwischen Völkern und Thronen beide in der Waagschale hält und kosakischer Willkür nie den Eingang in das eigentliche Heiligtum europäischer Zivilisation gestatten wird. Ihr Losungswort ist Sicherheit des Eigentums.«
»Aber Sie geben doch zu, Monsieur de Vignerolles«, wandte Vergennes ein, »daß die Welt seit den letzten zwanzig Jahren demokratischer geworden ist, als sie es je war.«
»Ohne Zweifel haben die materiellen, oder was dasselbe sagen will, demokratischen Interessen seit zwanzig Jahren gewonnen. Aber eben weil sie materiell sind, werden sie, wenn sie bis zu einem gewissen Punkt gelangen, konservativ. Denn merken Sie wohl, Individuen wie Staaten sind nur demokratisch, solange sie arm sind. Reich geworden zeigen sie sich konservativ, aristokratisch. Die Interessen ...«
»O diese Interessen, diese Interessen!« unterbrach Vergennes.
»Für uns Europäer ist es ungemein schwer, lieber Vergennes, das Wesen des republikanischen Charakters zu erfassen, und noch schwerer, Geschmack daran zu finden. Wir sind in zu künstlichen Formen auferzogen, um an der natürlichen Ungezwungenheit – einer philosophischen Ordnung der Dinge Gefallen zu finden. Die Menschen erscheinen uns nicht nur zu ungeniert, sondern auch zu selbstsüchtig im Vergleich mit der Ergebenheit der alles aufopfernden Treue rein monarchisch beherrschter Nationen. Die Ursache ist wohl diese, daß in reinen Monarchien die Interessen aller, der allgemeine Egoismus, wenn ich so sagen darf, in der Hand eines einzigen Mannes und seines Kabinetts konzentriert, in Republiken hingegen dieser Egoismus über die ganze Masse der Bürger zerstreut ist. Daher die Erscheinung, daß je republikanischer eine Regierung wird, desto selbstsüchtiger und geldsüchtiger das Volk. Ich zweifle, ob Napoleon, wenn er heute in all seiner Kraft erstünde, noch die Hälfte der Opfer von unserem Frankreich erlangen würde, die ihm während seines Konsulats und Kaisertums zu seinem Unglück gewissermaßen aufgedrungen wurden.«
Der Graf machte eine Pause und fuhr dann fort: »Ebenso zweifle ich, ob sich heutzutage fünfzig Kavaliere finden würden, die, wie wir es zu tausenden taten, ihrem Vaterland, ihren Besitzungen und Familien den Rücken kehren würden, um für eine hohe Idee zu kämpfen. Die materiellen Interessen sind das Grab jener hohen Treue, wie sie früher verstanden wurde, aber sie haben auf der anderen Seite wieder das Gute, daß auch die sogenannten Prinzipmänner heutzutage nur wenig mehr ausrichten würden.«
»Und halten Sie das für etwas Gutes?« Die Lippen von Vergennes kräuselten sich auf eine Weise, die zu verstehen gab, wie gern er einen solchen Prinziphelden spielen würde.
»Allerdings, lieber Vergennes! Wir haben die Übel geschaut, die Brände gesehen, die Stürme, die diese Prinzipmänner, die Mirabeaus, die Robespierres, Dantons, Marats, verursacht haben.« Der Graf sah den jungen Mann mit einem funkelnden Blick an. »Es ist etwas Schönes und wieder etwas Furchtbares mit einem sogenannten Prinzipmann. Er ist ein Wesen, das seinem Prinzip alles opfert – Religion und Familie, Vaterland und Herd. Anarchie und Verwirrung, das Zerreißen alle Bande von Liebe, Freundschaft und Gesellschaft, Ströme von Blut, brennende Städte und rauchende Landschaften kümmern ihn nicht, so nur sein Prinzip weiterschreitet. Es ist sein Gott, dieses Prinzip, dem er das ganze Menschengeschlecht zum Opfer bringen möchte! Es ist wirklich etwas Gottähnliches in dem konsequenten Aufrechterhalten eines Prinzips, aber darum wehe dem armen Erdensohn, der sich Allgewalt anmaßt, ohne deren Arm zu besitzen! Er fällt früher oder später als der Sklave, das Opfer seiner Anmaßung. Mirabeau und Robespierre, Danton und Marat waren Prinzipmänner. System-Männer, Erdengötter – sie fielen. Warum? Weil sie nicht die Kraft hatten, ihr Prinzip bis zum Ende durchzuführen. Noch einen Schritt, und sie hätten triumphiert. Aber diesen Schritt vermochten sie nicht mehr zu tun, die Kraft ging ihnen aus, weil sie beschränkte Erdensöhne waren.«
»Aber ihre Prinzipien, ihre Systeme stehen fest«, erwiderte Vergennes. »Ein anderer führt sie, bringt sie zum Ziel!«
»Nie wird ein System-Mann ein Prinzip fortführen, das ein anderer begann«, versetzte der Graf. »Es ist moralisch unmöglich, ein Denkmal wahnwitziger Vermessenheit findet er es, und es bleibt, gleichsam wie kahle riesige Grundmauern eines aus den Trümmern einer zerstörten Stadt aufgebauten Warnungstempels, dem vorübergehenden Wanderer ins Auge zu starren, ihm die furchtbaren Schicksale der geschlachteten Tausende, den Jammer der Väter und Mütter, die Flüche, die Verzweiflung eines ganzen Volkes zu erzählen und Nachteulen, Schlangen und Fledermäusen zum Schlupfwinkel zu dienen.«
»Was hat der Mann gegen Prinzipien, scheint kein Freund von Prinzipien?« raunte Doughby zu Howard hinüber. »Gebe keinen Strohhalm für einen Mann ohne Prinzipien!«
»Vergebung, Mister Doughby!« sagte der Graf, der ihn gehört hatte. »Ein Mann ohne Prinzipien, ohne Grundsätze, der ist freilich nur wenig wert. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen einem Mann von Grundsätzen und einem Prinzip- oder System-Mann.«
»Verstehe, was Sie sagen wollen, Monsieur de Vignerolles«, fiel Doughby ein. »Dem einen sind die Prinzipien Meilenzeiger auf seinem Wege, die ihn die gerade Straße fortführen, dem anderen ist sein System ein Sporn, der ihm Tag und Nacht in den Flanken sitzt, ihn zu Tode hetzt. Wüßte auch etwas von derlei Prinzipmännern zu erzählen.«
»Aber mein Gott, Papa!« unterbrach Luise die Diskussion. »Über lauter Prinzipien haben wir ganz das Dessert vergessen!«
Und alle schauten auf und riefen laut: »Ma foi! – En vérité! – Mais voyez donc!« Wirklich hatten sie in der Hitze des Gefechts ganz diesen wesentlichen, ja vorzüglichen Bestandteil einer Louisianatafel vergessen. Die Überbleibsel des zweiten Gangs standen noch immer in nichts weniger als malerischen Bruchstücken umher, und die Diener, schien es, machten es sich auch bequem, keiner war zu sehen.
»Mein Gott, wo sind denn die Leute alle?« jammerte die Maman. »Kein einziger ist da! Champagner seit einer halben Stunde auf der Tafel und kein Dessert! Welche Verwirrung!«
Der Papa sprang auf und Luise mit ihm. Beide liefen zur Tür hinaus in den Salon. Luise kam laut lachend zurück.
»Stellen Sie sich vor, Amadée steht mitten unter den Domestiken und erzählt ihnen wer weiß was für Geschichten! Und sie hören alle mit offenem Munde zu!«
Neues Gelächter.
»Ma foi, c'est drôle!«
»Wer ist dieser Amadée?« fragte Howard.
»Kennst du Amadée nicht? Es ist der Amadée von Papa Vignerolles. Da kommt er!«
Und der liebe Amadée kam wirklich mit Menou Hand in Hand. Dieser flüsterte dem Grafen und Maman ein paar Worte in die Ohren. Die gute Maman schaute auf und reichte dem Alten freudig die Rechte, die er recht französisch galant an die Lippen drückte. Die Kreolen steckten die Köpfe zusammen, und ihre Gesichter erheiterten sich. Sie wurden kindisch ausgelassen, die guten Kreolen. Nichts als »Amadée, bon Amadée« war zu hören.
»So sag mir nur, was das alles soll?« fragte Howard leise.
»Später!« raunte Luise ihrem Mann zu. »Du wirst hören!«
»Amadée, deine Gesundheit!« rief der Papa und hob das Glas, und alle folgten seinem Beispiel.
Und der alte Amadée hob das ihm von Maman gereichte Glas gleichfalls, salutierte mit Anstand rings umher und leerte es dann auf aller Gesundheit. Seltsam, wirklich seltsam. Der alte Vendéer oder Gascogner führte die Diener der Gäste mir nichts dir nichts aus dem Saal, um ihnen alte Geschichten zu erzählen, statt sie das Dessert aufstellen zu lassen, und dafür tranken ihm sämtliche Kreolen zu, als ob er eine Heldentat vollbracht hätte.
Auf alle Fälle war er ein ganz einzigartiges Muster eines ehemaligen Kammerdieners oder was er gewesen war. Ein wahres Laternengesicht, das bloß Haut und Knochen vorwies und Runzeln und eine scharfe spitze Nase, am äußeren Ende rot punktiert, ein Paar kleine funkelnde Augen, grauweiße Wimpern, das ganze Profil ungemein scharf, eine wahre Häscher- oder Polizeidirektors-Physiognomie. Für das ihm übriggebliebene Haarkapital trug er übrigens viele Sorge, ein kurzer dicker Haarzopf saß ihm im Nacken und zwei eisgraue Wülste über den Ohren, die zu dem spiegelglatten ehrwürdigen Scheitel keinen üblen Gegensatz bildeten. Sein Rock war aus dem feinsten blauen Tuch mit weißen Aufschlägen, aber in einem Schnitt, der wenigstens ein halbes Jahrhundert alt war. Auch seine Gamaschen datierten in diese Zeit zurück.
Jetzt war er ganz mit der Aufstellung des Desserts beschäftigt, das er recht kunstgerecht vor die Augen zu bringen wußte. Die Ananastorte verriet Meisterhand. Und wie er den Schwarzen die Teller, Schüsseln und Schüsselchen abnahm und sie gefällig auf die Tafel stellte, ging Howard ein Licht auf. Der Alte hatte die Diener zweifelsohne aus dem Saal bugsiert, um zwischen ihre Ohren und die Zunge Vergennes' die gehörige Entfernung zu legen.
»Nicht wahr, Luise?«
Sie nickte, legte aber mit einem vielsagenden Blick auf Vergennes den Finger auf den Mund.
»Weiß nicht, liebe Luise, wer so rücksichtslos jede Schicklichkeit verletzt wie dieser junge Mensch und den fanatischen Apostel spielt, verdiente eigentlich eine ernste Zurechtweisung. Achtung vor jeder Meinung, aber Feingefühl ist da am unrechten Ort, wo unsere und der Unsrigen Sicherheit und Leben in Gefahr stehen. Ohne die Dazwischenkunft dieses alten Amadée würde ein Dutzend Sklaven Dinge gehört haben, die in Zeit von einer Woche unseren fünfundzwanzigtausend Negern am River – auf die wir nicht fünfundzwanzighundert Weiße haben – die Köpfe leicht lichterloh hätten anbrennen können. Ist nicht zu scherzen in diesem Punkt, ist furchtbarer Ernst! Wir sitzen auf einem Vulkan, einem Pulvermagazin, wir dürfen es uns nicht verhehlen. Aber wie wir unsere Lage kennen sollten, sollten wir auch nicht jeden Unbesonnenen mit glimmender Lunte in dieses Magazin eintreten lassen! Wie Männer sollten wir unsere Lage ins Auge fassen, nicht wie alte törichte Weiber, und die Kreolen sind in diesem Punkt leichtsinnige, schnatternde Weiber. Ich befürchte und gestehe es aufrichtig: Diese Kreolen bringen früher oder später eine St. Domingo-Teufelei über uns und unser Louisiana! Zum Glück haben wir Uncle Sam im Norden!«
Doch die Stimmen wurden immer fröhlicher, die Reden lauter. Alle fühlten sich so wohl, wie man es nur immer sein kann, wenn Ananas- und Bananentorten und Granadillos und Pecans und Orangen und zwanzigerlei Arten tropischer Früchte mehr und Champagner- und Madeirawein einen anlächeln. Einige saßen bereits wie im Traum, die Akazien vor dem Hause begannen ihnen Menuetts zu tanzen, die Tafel, die Sessel fingen an zu promenieren.
Mistreß Houston hatte mit einiger Ungeduld der französischen Sitte, an der Tafel zu bleiben, das Opfer gebracht. Nun erhob sie sich, mit ihr die übrigen. Es war auf alle Fälle Zeit, den Aufruhr, den die Weinfluten angerichtet, mit dem Öl der Mokkabohne zu beschwichtigen.
»Mesdames et Messieurs! Ist's gefällig, in den Salon zurückzukehren?«
Keine Einwendung gegen den Vorschlag des guten Papa kam – alle ordneten sich in Reih und Glied.
*
An der Spitze zog der Graf de Vignerolles mit Mistreß Houston ein. Wirklich ein vollendeter Gentleman. Elegante Formen, leichte, ungezwungene, anmutige Haltung, die alles Auffallende zu vermeiden weiß, lebendiges, geistreiches Gesicht, von einem fortwährenden Lächeln aufgehellt, das bald mild ironisch, bald schärfer spöttisch oder freundlich gutmütig ihm so wohl anstand. Er hatte vieles vom Höfling im besseren Sinne des Wortes. Wie unvergleichlich hatte er die krampfhafte Spannung zu lösen gewußt, in die der heillose Vergennes die ganze Tischgesellschaft versetzt hatte! Wie gefällig, leidenschaftslos der Wortfluß seiner Rede! Auch nicht die mindeste Aufregung. Sprache, Ton, Haltung, Kleidung, alles verriet den geborenen Aristokraten jenes alten Regimes, bei dem Leidenschaften und Tränen längst versiegt waren.
Chevalier d'Ecars sagte, er hätte herbe Tage in seinem Leben gesehen. In seiner Jugend am Hofe Ludwig XVI. und Vertrauter eines der Brüder des Königs, sollte de Vignerolles nach dem Tod des unglücklichen Monarchen in wichtigen Aufträgen gebraucht worden sein, die Aufstände in der Vendée mit organisieren geholfen, gegen die Westermanns, die Marceaus, die Dumas und Hoches gefochten haben. Als alles verloren war außer der Ehre, entwich er nach England und von da nach Amerika, wo seine Familie noch aus früheren Zeiten her eine bedeutende Schenkung an Ländereien in den Attacapas besaß. Auf diesen hatte er eine Pflanzung gegründet, die zu den bedeutendsten in Louisiana gehörte und sich durch musterhafte Zucht und Ordnung auszeichnete.
So lieb sollte ihm sein neuer Wirkungskreis geworden sein, daß er es abschlug, nach Frankreich zurückzukehren, wo ihm nach der Restauration seine Familiengüter mit einer ansehnlichen Entschädigung anheimfielen. Welche Gründe immer ihn bestimmt haben mochten, die ewig grünen Wiesen und Orangenwäldchen der Attacapas den glänzenden Vorzimmern der Tuilerien vorzuziehen, sie verrieten einen selbstbewußten Charakter.
Der Graf hatte sich mit Mistreß Houston und Luise auf einem Sofa niedergelassen. Ein zweites wurde herangeschoben und nahm Genièvre, Lassalle und Howard auf. Die übrigen Gäste gruppierten sich in kleinen Abteilungen und musterten die Gemälde. D'Ermonvalle erging sich im Reich der Töne und verlor sich in einer stürmischen Symphonie Beethovens. Er spielte meisterhaft, auch Vergennes bewies nach ihm eine ungemeine Fertigkeit.
Der alte Amadée begann mit Kaffee die Runde zu machen.
»Amadée, woran denkst du jetzt?« fragte ihn der Graf.
»Vergebung, Herr Graf, ich denke mir so allerlei.«
»Zum Beispiel?« Der Graf nippte an seiner Tasse. »An das Scharmützel bei St. Florent?«
»Nein, Herr Graf!«
»Oder an die furchtbaren Tage von Nantes? Wo deine Schwester und – du armer Knabe! – in dem Boot mit den zwanzig Fuß breiten Falltüren ...«
»Nein, Herr Graf, das alles habe ich zu vergessen gesucht!«
»Jaja, alter Freund, du hast zu deiner Zeit den Hof und die königliche Familie gekannt, den Marquis von Beaulieu und Charette und Marigny.«