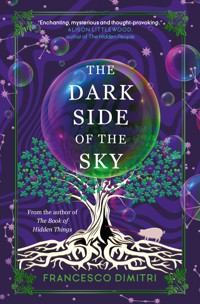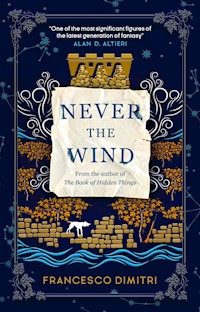6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fabio, Mauro, Tony und Arturo sind schon seit ihrer Schulzeit befreundet, und obwohl das Leben sie inzwischen in alle Himmelsrichtungen verstreut hat, treffen sie sich einmal im Jahr in ihrem apulischen Heimatdorf Casalfranco. Das haben sie sich versprochen, das ist der Pakt. Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn Arturo taucht nicht auf. Ausgerechnet er, der sie einst auf den Pakt eingeschworen hat. Beunruhigt fahren die drei Freunde zu Arturos abgelegenem Bauernhof – nur um das Anwesen völlig verlassen vorzufinden. Sofort ist ihnen klar, dass ihrem Freund etwas zugestoßen sein muss, und sie machen sich auf die Suche nach ihm. Eine Suche, die sie nicht nur in ihre eigene Vergangenheit führt, sondern auch zu einem magischen Geheimnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Einst waren Fabio, Mauro, Tony und Arturo, genannt Art, unzertrennlich. Sie wuchsen im Salento im tiefsten Süden Italiens auf, einer Gegend so flach und einsam, so trocken und windig und so eigenwillig, dass sie einen nie loszulassen scheint. Einer Gegend, in der eigene Regeln über Land, Meer und Menschen herrschen und die Sacra Corona Unita die Macht innehat. Gemeinsam haben die vier Freunde ihre ersten Erfahrungen mit Mädchen gemacht, gemeinsam den ersten Joint geraucht. Und gemeinsam hüteten sie ein dunkles Geheimnis. Inzwischen sind sie erwachsen geworden, und jeder von ihnen führt sein eigenes Leben, aber einmal im Jahr treffen sie sich in ihrem Heimatort Casalfranco – das haben sie einander nach dem Schulabschluss versprochen.
Doch dieses Mal ist alles anders, denn Art taucht nicht auf. Ausgerechnet Art, der sie damals auf den Pakt eingeschworen hat. Beunruhigt fahren die Fabio, Mauro und Tony zu Arts abgelegenem Bauernhof – nur um das Anwesen völlig verlassen vorzufinden. Sofort ist ihnen klar, dass ihrem Freund etwas zugestoßen sein muss, und sie machen sich auf die Suche nach ihm. Eine Suche, die sie nicht nur in ihre eigene Vergangenheit führt, sondern auch zu einem magischen Geheimnis – und zum Buch der Verborgenen Dinge …
Der Autor
Francesco Dimitri wurde 1981 im italienischen Manduria geboren und lebt inzwischen in London. Er hat Romane, Sachbücher, Essays und Comics verfasst, fürs Kino, digitale Medien und Zeitschriften geschrieben und für Top-Geschäftskunden gearbeitet. Auf seiner ständigen Suche nach Wundern hat er Dokumentarfilme über UFO-Kulte gedreht, tief in den Wäldern Siebenbürgens geschlafen und sich mit Mathematikern, Künstlern, Köchen, Psychologen sowie Bühnenmagiern unterhalten.
FRANCESCODIMITRI
Das Buch der verborgenen Dinge
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Felix Mayer
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der englischen OriginalausgabeThe Book of Hidden ThingsDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Deutsche Erstausgabe 03 / 2020Redaktion: Martina VoglCopyright © 2018 by Francesco DimitriCopyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München, unter Verwendung eines Designs von Julia LloydSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-24680-8V001www.heyne.de
Für jene Paola.
Wenn ein Orkan aufzieht, bist du das Auge.
Wenn die Sonne herunterbrennt, bist du der Schatten.
Wenn alles gut zu sein scheint, zeigt sich:
Du bist besser.
Ihr Gang war nicht ein irdisch sterblich Wesen,
Vielmehr von Engelart; aus ihrem MundeErtönten Worte, nicht wie Menschenlaute;Ein Engel war’s, ja Sonne, was ich schaute.Und wär nun auch nicht mehr, was einst gewesen;Ob schwächern Bogens heilet keine Wunde.
Francesco Petrarca, Canzoniere, Sonett 90
FABIO
1
Am Tisch neben mir sitzt ein älteres deutsches Ehepaar. Als der Kellner meinen örtlichen Akzent erkennt, den ich trotz aller Bemühungen nicht unterdrücken kann, zwinkert er mir zu und sagt: »Die sind aus Berlin. Sind vor einem Monat hergezogen.« Er ist ganz begeistert davon, dass es Leute gibt, die von so weit weg hierherkommen, um in diesem Drecksloch zu versauern. Ich frage mich, warum sie sich ausgerechnet Casalfranco ausgesucht haben. Weil hier immer die Sonne scheint? In Berlin haben sie doch bestimmt Solarien. Ich werfe einen Blick auf die beiden. Sie wirken glücklich. Noch.
Mir gefällt es hier nicht. Damit meine ich nicht die Pizzeria, die ist in Ordnung. Nein, ich meine diesen Ort, diese Gegend: Apulien. Ja, natürlich, zu dieser Jahreszeit schlägt einem hier der berauschende Duft von Rosmarin, Zitronen und blühendem Thymian entgegen. Als ich vorhin, an diesem warmen Juniabend, aus dem Taxi gestiegen bin, war ich so überwältigt, dass ich die Augen geschlossen und all das geradezu aufgesogen habe, wie köstlichen Wein bei einem romantischen Abendessen. Doch in Wahrheit ist diese Region eine Venusfalle. Noch drei Wochen, dann hat die Sommersonne alle Gerüche verdampfen lassen und den Boden zu Staub verbrannt, und das wenige Leben, das noch verblieben ist, wird einen Krieg um die letzten Wasserreste führen, die tief in der Erde verborgen sind. Ich habe Casalfranco nicht vertraut, als ich noch hier gelebt habe, und ich vertraue ihm noch weniger, seitdem ich von hier weg bin. Ein rauer, wilder Ort. Ich bin nur für den heutigen Abend zurückgekommen, nur wegen des Paktes. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob der Pakt noch gilt. Es ist ohnehin ein Wunder, dass er so lange gehalten hat.
Ich sitze an einem Ecktisch, aber nicht an irgendeinem, sondern an unserem Tisch. Er war frei, als ich gekommen bin. Noch bin ich allein mit drei leeren Stühlen, und ich frage mich, ob die anderen auftauchen werden. Neben mir erhebt sich der Holzofen, ein höhlenartiges Maul aus weißen Steinen. Ein pizzaiolo mit dunkelbrauner Haut bearbeitet mit ruckartigen Bewegungen einen Klumpen Teig, ein anderer schiebt eine Pizza in den Ofen, die vor Parmaschinken, Rucola und Parmesanspänen nur so überquillt. Der dunkelbraune Typ kommt mir bekannt vor, ich glaube, er heißt Guido oder Gianni oder so ähnlich. Ich war mit seinem Cousin in einer Klasse.
Ich bin vom Flughafen Brindisi direkt ins American Pizza gekommen (wo die Pizza so italienisch ist, wie es nur geht). Von dem Wagen, den ich bestellt hatte, war – in guter südländischer Tradition – keine Spur zu sehen gewesen. Zwei Stunden später konnte ich endlich einen anderen auftreiben, weshalb ich zu dem Treffen des Paktes, das seit ewigen Zeiten (oder jedenfalls seit unserer Gymnasialzeit) zur selben Stunde beginnt, zwanzig Minuten zu spät kam. Ich rief in der Pension an und gab Bescheid, dass ich erst nach dem Abendessen kommen würde. Ich hatte vergessen, dass in Süditalien eine Verspätung von zwanzig Minuten bedeutet, dass man zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde zu früh dran ist. Ich vergesse das jedes Mal. Art meint, ich mache das absichtlich, aber das glaube ich nicht.
Vielleicht ist es mit dem Pakt vorbei.
Sie werden kommen, rede ich mir ein. Sie werden kommen. Während der gesamten Fahrt vom Flughafen hierher habe ich mir das immer wieder vorgesagt. Wir haben einen Pakt. Sie werden ihn nicht brechen. Der Pakt war Arts Idee. Im Grunde ist er eine dumme Spielerei. Letztes Jahr habe ich mir geschworen, nicht mehr mitzumachen, und wenn die Jungs heute nicht auftauchen (wovon ich mittlerweile fast überzeugt bin), werde ich mir wie ein Idiot vorkommen. Mit dem Geld, das mich diese Reise gekostet hat, hätte ich Besseres anfangen können. Der Flug und die Pension waren zwar spottbillig, aber seit einiger Zeit bedeutet »spottbillig« für mich dasselbe wie »sündhaft teuer«. Trotzdem sitze ich jetzt hier.
Ich vertilge eine knoblauchgetränkte Bruschetta, und als ich sie mit einem Schluck Primitivo hinunterspüle (ein kräftiger Roter, der typisch für die Gegend ist), betritt Mauro die Pizzeria. Also kommt wenigstens einer von ihnen. In seinen cremefarbenen Chinos, dem weißen Hemd und dem marineblauen Sakko mimt er den Erwachsenen, und das mit einer Leichtigkeit, von der ich nur träumen kann. Wie es den Regeln des Paktes entspricht, nicke ich ihm zur Begrüßung nur leicht zu, als sähen wir einander regelmäßig. Er grüßt auf dieselbe Weise zurück und kommt an den Tisch. Seit unserem letzten Treffen vor zwei Jahren hat er ein paar Pfunde zugelegt, und seine Frisur ist gepflegter. Beides gefällt mir.
»Wartest du schon lange?«, fragt er und setzt sich.
»Nicht so lange wie beim letzten Mal.«
»Also ein gewisser Fortschritt.«
»Ein winziger, Mauro, ein winziger.«
Er lächelt und schenkt sich Wein ein. »Ich hatte meine Zweifel, ob wir dich wiedersehen würden.«
»Ich auch.«
»Wann bist du angekommen?«
»Gerade eben. Ich bin vom Flughafen direkt hierhergefahren.«
»Und du warst vorher nicht bei Angelo?«
»Er weiß nicht, dass ich hier bin.«
Das Lächeln verschwindet aus Mauros Gesicht. Wir sind zu lange miteinander befreundet, als dass wir unsere Gefühle voreinander verbergen könnten. Ich weiß genau, dass er mich jetzt für einen Mistkerl hält. Er versteht die Beziehung zwischen mir und meinem Vater nicht. Das kann ich ihm nicht verübeln – meistens verstehe ich sie genauso wenig.
»Ich wohne nicht bei ihm«, sage ich zur Erklärung. »Ich habe mir ein Zimmer in einer Pension genommen. Ich reise morgen früh wieder ab, und der kurze Aufenthalt war mir die Scherereien mit meinem Vater nicht wert.« Hör auf damit. Du bist ein erwachsener Mann, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen.
»Und wenn du jemandem über den Weg läufst, der dich kennt und ihm davon erzählt?«
»Ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert.«
Mauro hebt die Hände zum Zeichen, dass er aufgibt, und sagt: »Ich bin gestern angekommen.«
»Hast du Art getroffen?«
»Was glaubst du?«
Ich glaube, er hat ihn nicht getroffen. Das käme einem Bruch des Paktes gleich. So lächerlich der Pakt ist, wir nehmen ihn ernst oder haben ihn zumindest bis jetzt immer ernst genommen. Jedenfalls komme ich seinetwegen seit siebzehn Jahren einmal im Jahr nach Casalfranco, mit Ausnahme des letzten Jahres. Was mein achtzigjähriger verwitweter Vater nicht schafft – der Pakt schafft es. Dieses Treffen dürfte unsere Abschiedsvorstellung sein, und ich will das Beste daraus machen.
»Art hat doch einen an der Waffel«, sagt jemand hinter mir.
Mauro steht auf. »Tony!«
Ich drehe mich um. Tony verbeugt sich und macht eine ausladende Geste. »Mittlerweile nennt man mich Der Große Tony.«
Tony ist eher klein, aber muskulös und kräftig gebaut. Er trägt ein ärmelloses Shirt, und auf den ersten Blick ist klar, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Seine Erscheinung war schon immer Respekt einflößend, und er hat auch schon immer gern den Clown gespielt. Wenn andere Art schikanieren wollten, gaben sie meist nach ein paar halbherzigen Versuchen wieder auf – hauptsächlich wegen Tony, obwohl Art auf seine Weise auch Angst einflößend sein konnte. Wir hatten damit gerechnet, dass Tony Profiboxer werden oder sich als Handlanger bei der Sacra Corona Unita verdingen würde, der regionalen Mafiaorganisation. Er ist dann Chirurg geworden, und zwar ein ziemlich guter. Vor ein paar Monaten ist ihm eine komplizierte Herztransplantation gelungen, was ihm seine fünfzehn Minuten Ruhm beschert hat. Wir haben uns früher oft geirrt. Auch was Art angeht. Wir haben so viel erwartet.
Tony legt mir eine Hand auf die Schulter. »Wie ich sehe, beehrst du uns diesmal mit deiner Anwesenheit.«
»Tut mir leid, dass ich es letztes Jahr nicht geschafft habe.«
»Schäm dich was«, sagt Tony und setzt sich.
»Ich habe von deinem Meisterstück gelesen«, sagt Mauro zu ihm.
»Das war wirklich beeindruckend«, setze ich grinsend hinzu. »Ich dachte immer, du könntest ein Herz nicht von einer Niere unterscheiden.«
»Das war Glück«, erwidert Tony. »Ich halte zufällig ein Herz in der Hand, stolpere, das Ding fliegt in hohem Bogen durch die Luft und landet genau an der richtigen Stelle. Aber unter uns gesagt«, fügt er leise hinzu, »ich bin mir nicht sicher, ob es das Herz eines Menschen war. Hätte auch von einem Hund sein können.«
»Solange es seinen Dienst tut«, meint Mauro.
»Jedenfalls hat der Typ nicht angefangen zu bellen. Noch nicht. Aber wie geht’s euch denn so?«
»Alles in Ordnung«, antwortet Mauro.
Das ist maßlos untertrieben. Mauro ist nicht gerade das, was man genügsam nennt. Ganz im Gegenteil. Bei ihm heißt es eher: Wenn du mich nicht kennst, bin ich zu teuer für dich. Mauro lebt in Mailand und ist Anwalt, Fachgebiet Steuern und Finanzen. Er lebt da, wo das Geld ist, und wenn du da lebst, wo das Geld ist, dann lebt früher oder später ein Teil des Geldes bei dir.
»Kann nicht klagen«, sage ich. Was eine glatte Lüge ist.
»Natürlich nicht«, sagt Mauro mit einem Augenzwinkern. Er glaubt, bei mir läuft alles bestens. Kein Wunder, er hat ja keine Ahnung, keiner von ihnen hat eine Ahnung, und heute Abend kann das von mir aus ruhig so bleiben. Morgen habe ich noch genug Zeit, um mir den Scherbenhaufen anzusehen, den mein Leben im Moment darstellt.
Ich sehe auf die Uhr. »Wo bleibt denn Art? Es ist schon spät.«
»Nur die Ruhe, ich bin doch auch eben erst gekommen«, entgegnet Tony.
»Ja, aber du warst selbst für hiesige Verhältnisse ordentlich zu spät.«
»Sag mal, Fabio, mein Bester, brauchst du vielleicht was zu essen? Wenn du hungrig bist, wirst du unausstehlich.«
»Ja, ich könnte schon etwas vertragen«, gebe ich zu. Die Bruschetta von vorhin habe ich kaum bemerkt. Südländer haben einen gesunden Appetit, und etwas anderes zu unterstellen, ist eine tödliche Beleidigung. Das ist die ganze Macht von Casalfranco: Sobald man die Stadt betritt, verfällt man in alte Gewohnheiten.
Mauro winkt einem Ober. »Eine Runde Antipasti, bitte«, sagt er. »Wir warten noch auf einen Freund.«
2
Art hat große Ohren und eine große Nase, Augen so schwarz wie die Nacht und eine Brille mit Gläsern so dick wie Flaschenböden. Mitte der Neunziger fand niemand so eine Erscheinung attraktiv, der Typus des Nerds kam erst später in Mode. Aber in Schubladen hat Art sowieso nie gepasst. Er war gut in der Schule, und obwohl seine Umgangsformen bisweilen etwas verstörend waren, ging etwas von ihm aus – eine Spannung, eine magnetische Kraft, wie man vielleicht sagen könnte – , das ihn von den üblichen Sonderlingen unterschied. Dazu kam, dass er keine Angst vor Mädchen hatte (genauso wenig wie vor älteren Jungs, Pfarrern oder Lehrern). Er war es, der Anna in Mauros Leben gebracht hat. Da waren wir fünfzehn.
Wir lernten Anna und Rita in Portodimare kennen, einem Dorf am Meer, rund zehn Kilometer von Casalfranco entfernt. Die beiden kamen oft an den selben Strandabschnitt wie wir. Der Strand dort war aus weichem, weißem Sand und ging nahtlos ins Meer über, das fast so hell wie der Himmel war. Wenn von Norden her die Tramontana wehte, präsentierte sich das Meer come una tavola, so flach wie eine Tischplatte. Vom Ufer aus konnte man bis zum sandigen, mit Felsbrocken übersäten Meeresboden hinabsehen, über den Schwärme von cazzi di Re huschten (»Königsschwänze«, eine Fischart mit leuchtendem Schuppenkleid). Sie tragen ihren Namen, weil dem Volksmund zufolge der Schwanz eines Königs mehr Farben hat als der eines gewöhnlichen Mannes.
An Fische waren wir gewöhnt, an Mädchen dagegen nicht. Anna und Rita waren uns aufgefallen, weil ihr Akzent verriet, dass sie aus Mailand kamen, weshalb sie einen gewissen Respekt verdienten. Wir hatten keine Ahnung, wie wir uns solchen weitgereisten, bourgeoisen und des Lebens überdrüssigen Mädchen aus Mailand nähern sollten. Sie hatten ein Auge auf uns geworfen (wahrscheinlich, weil ihnen langweilig war), aber den ersten Schritt zu machen, war ganz klar Sache der Jungs. Anfangs herrschte eine Pattsituation: Wir beäugten sie, und sie beäugten uns, und niemand bewegte sich einen Zentimeter. Bis Art eines Tages sagte: »Jetzt reicht’s.«
Wir hatten am Strand in der brüllenden Hitze Fußball gespielt und gehofft, die Mädchen würden unseren athletischen Kunststücken Beachtung schenken. Aber sie hatten uns nicht eines Blickes gewürdigt. Anschließend hatten wir uns durch einen Sprung ins Wasser abgekühlt, die zwei Flaschen Eistee geleert, die Mauro aus seiner Tasche hervorgeholt hatte, und saßen nun ratlos und frustriert im Sand.
»Schon klar«, entgegnete ich genervt. »Du hast natürlich wieder die zündende Idee.«
Art neigte sich zu mir und richtete zwei Finger auf seine Augen, wie um zu sagen: Schau genau zu. Dann sprang er auf und stolperte dabei fast über den Ball. Wir lachten, aber er ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Er rückte seine Brille zurecht und marschierte in seiner viel zu großen Badehose zu Anna und Rita hinüber, die auf ihren Handtüchern in der Sonne lagen. Dort angekommen, ging er neben Rita in die Hocke und fragte sie: »Kann ich dich mal kurz stören?«
»Wenn’s sein muss«, sagte sie verächtlich.
»Mir sind deine Hände aufgefallen.«
»Meine Hände?«
Art nickte und fügte vollkommen ernst hinzu: »Meine Mutter ist Zigeunerin. Von ihr habe ich das Handlesen gelernt.«
»Vergiss es.«
Art lachte. »Ich habe nicht behauptet, dass ich daran glaube.«
»Und warum willst du ausgerechnet meine Hände lesen?«
Ohne ein weiteres Wort ergriff er ihre rechte Hand. Sie ließ es geschehen. Wie ein Kobold aus einem Märchen beugte er sich über sie und fuhr mit seinem linken Zeigefinger den Rand ihrer Handfläche entlang. Bei jedem anderen wäre diese Geste einfach nur gruselig gewesen, aber Art war so entwaffnend, dass selbst ich mich darauf eingelassen hätte, und ich weiß nun ganz sicher, dass seine Mutter so wenig eine Zigeunerin war, wie ich ein Schwede bin.
»Deine Hände haben eine ganz besondere Form«, erklärte Art. »Meine Mutter würde sagen, es sind die Hände einer Träumerin. Du bist eine sehr feinfühlige junge Frau, nicht wahr?«
Rita brachte vor Staunen den Mund nicht mehr zu. »Woher weißt du das?«
»Das lässt sich alles hier ablesen. Und schau hier, diese Linie! Die Beziehungslinie. Erkennst du sie? Voller Windungen und hochdramatisch. Du bist schwer zu fassen. Deine ausgeprägte Sensibilität unterscheidet dich von den anderen. Du hast eine Menge Freunde, fühlst dich aber dennoch bisweilen einsam.«
»Das … das stimmt«, bestätigte Rita.
Jetzt ging Anna dazwischen. »Du Dummschwätzer«, sagte sie und gab Art einen leichten Knuff. Sie schien eher amüsiert als genervt. Art verlor das Gleichgewicht und kippte aus seiner Koboldhaltung, woraufhin wir alle schallend loslachten. Es kam nicht oft vor, dass ihm das ins Gesicht gesagt wurde.
Auch Art musste lachen. »Ja«, sagte er, »da hast du vielleicht recht.« Das Eis war gebrochen, er hatte uns gezeigt, dass es möglich war, und schon wieder das Interesse an der Sache verloren. Das ist Art, wie er leibt und lebt: im Handumdrehen Feuer und Flamme, und genauso schnell wieder gelangweilt. Uns und dem Pakt bleibt er treu, und mehr Stabilität braucht er im Leben nicht.
3
Noch immer keine Spur von Art.
Wir lassen uns die Antipasti schmecken (warmes Brot, Parmaschinken, frittierte Calamari, im Ofen gebackene Muscheln, Hartkäse, gegrilltes Gemüse und Oliven – überall sonst wäre das eine vollständige Mahlzeit, hier dagegen ist es eine Art Aufwärmübung), anschließend Pizza und dazu zwei Flaschen Primitivo, und Art lässt sich immer noch nicht blicken. Selbst Mauro, den sonst nie etwas aus der Fassung bringt, wirkt enttäuscht. Am Abend des Paktes ist man zur Stelle. Man kann im Ausland leben, verheiratet sein oder in einem fremden Land zum König gekrönt werden, doch am Abend des Paktes ist man zur Stelle. Ohne Wenn und Aber. So lautet jedenfalls die Theorie, und wir haben sie erstaunlich lange in die Praxis umgesetzt. Beim ersten Treffen, während unseres ersten Studienjahres, hatte keiner von uns damit gerechnet, dass die anderen kommen würden, aber dann waren wir alle da. Anschließend machten wir eine Art Sport daraus, dem Pakt treu zu bleiben und darauf zu warten, wer als Erster ausscheren würde.
Je länger wir an dem Pakt festhielten, desto wichtiger wurde er für uns. Vor vier oder fünf Jahren sagte Art, wir seien in einer Schleife gefangen, wie sie oftmals zu beobachten sei: Man glaubt, das eigene Handeln sei von Bedeutung, einfach, weil es das eigene Handeln ist. Je länger man etwas tut, für desto wichtiger hält man es und desto weniger kann man sich vorstellen, damit aufzuhören. »Diesen Zustand nennt man kognitive Dissonanz«, sagte er. »Wenn du jeden Tag an einem Schreibtisch sitzt, bist du irgendwann davon überzeugt, dass dein Job unverzichtbar ist, ja sogar, dass er dir gefällt. Wenn du lange genug Messwein trinkst, glaubst du irgendwann, dass er das Blut Christi ist.« Ich fragte ihn, ob das heißen solle, dass er nicht mehr an unseren Pakt glaube. »Doch«, antwortete er. »Doch, das tue ich.«
Letztes Jahr habe ich den Pakt gebrochen. Ich hatte keine Lust, über mein Leben zu reden, und ich hatte keine Lust, Mauro und Tony zu begegnen und mir anzuhören, wie erfolgreich sie sind. Ich hatte lange überlegt, ob ich den anderen sagen sollte, dass ich nicht kommen würde, und mich dann entschieden, es nicht zu tun, denn ich wusste, dass Tony protestieren und Mauro mir Vorwürfe machen würde und dass Art mich so lange bequatschen würde, bis ich dann doch fahren würde. Ich redete mir ein, dass es einem Bruch des Paktes gleichkäme, offen darüber zu sprechen, und es daher für alle besser wäre, wenn ich einfach nicht auftauchte.
Am späteren Abend rief mich ein völlig verzweifelter Tony an, der befürchtete, etwas Furchtbares sei geschehen. Nachdem ich klargestellt hatte, dass ich wohlauf war, schrie Art im Hintergrund »Verräter!« und lachte dabei, und auf einmal sehnte ich mich danach, bei ihnen zu sein. Als ich vor drei Tagen entgegen jeder Vernunft beschloss, dieses Jahr zu kommen, dachte ich wieder an dieses »Verräter!«.
»Und dieses Jahr lässt Art uns sitzen«, sagt Mauro. »Du hast damit angefangen, Fabio.«
»Ich hatte zu tun.«
»Du kannst nie so viel zu tun haben, dass du keine Zeit für den Pakt hast«, erklärt Tony in der Manier eines Oberlehrers.
»Wie oft muss ich noch sagen, dass es mir leidtut?«
»Noch sehr oft. Die Kumpels sitzenzulassen, das passt zu dir, aber nicht zu Art.«
Ich greife nach meinem Handy. »Bringen wir’s hinter uns.«
»Damit brichst du den Pakt.«
»Der Pakt ist Kinderkram, Tony.«
»Und was machst du dann hier?«
Ohne auf seine Bemerkung einzugehen, wähle ich Arts Nummer. Mein Anruf landet direkt auf der Mailbox. »Sein Handy ist aus.«
Mauro signalisiert dem Ober, dass wir zahlen wollen. »Er wohnt in seinem alten Haus, nicht wahr?«
»Ganz genau«, sagt Tony.
Vor neun Jahren ist Arts Vater gestorben, und vor zwei Jahren seine Mutter, woraufhin er beschloss, von Prag, wo er damals lebte, zurück nach Casalfranco zu ziehen. Das kam für uns alle überraschend, denn er hasste Apulien aus tiefstem Herzen, und er erklärte uns auch nicht, weshalb er zurückkehrte. Ich fürchte, es war ein unüberlegter Entschluss. Etwas schien mit ihm nicht zu stimmen. Er war dürr geworden und sprach bei unserem Treffen die meiste Zeit über Steinmauern und darüber, wie »einzigartig« und »faszinierend« sie seien.
»Wir sollten nach ihm sehen«, sagt Mauro.
»Das wäre eine gravierende Verletzung des Paktes«, erwidert Tony. Er meint es nur halb scherzhaft.
»Aber du hast doch selbst gesagt, dass so ein Verhalten nicht zu Art passt.« Mauro steht auf. »Ich habe gleich vor der Tür geparkt.«
Ich will einwenden, dass wir den ganzen Abend getrunken haben und keiner von uns noch fahren kann, aber dann fällt mir wieder ein, wo ich bin. Nicht in London, sondern im Salento, der Halbinsel, die den Sporn des italienischen Stiefels bildet. Hier hat niemand ein Problem damit, sich betrunken ans Steuer zu setzen.
Wir zahlen – die Rechnung ist lächerlich niedrig – und treten aus dem Lokal auf die kleine, runde Piazza. Sie ist mit Steinen gepflastert, von weißen Häusern mit flachen Dächern gesäumt, und in der Mitte stehen in einem Blumenbeet zwei Palmen. In einer Ecke plätschert ein verrosteter Trinkwasserbrunnen. Der Hahn ist abgebrochen, sodass das Wasser unaufhörlich herausläuft. Dieses Plätschern ist das lauteste Geräusch in der milden mediterranen Nacht. Wir gehen durch eine schwach erleuchtete Gasse und schrecken dabei eine vereinzelte Katze auf. Ich bin nur noch so selten hier, dass mir das Stadtbild fremd geworden ist, die engen Sträßchen und die klapprigen Türen, diese bizarre und mittlerweile heruntergekommene Mischung aus arabischen, griechischen und französischen Elementen. Casalfranco wirkt kleiner, als es ist. Die Stadt hat fünfunddreißigtausend Einwohner, gibt sich aber wie ein Dorf. Als ich hier aufgewachsen bin, existierte keine Buchhandlung, kein Kino, kein Theater. Wenn ich Bücher kaufen wollte, musste ich eine Stunde lang mit dem Bus fahren. Ein Heimatforscher hat einmal herausgefunden, dass alle Einwohner der Stadt miteinander verwandt sind. Dieser inzestuöse Zustand erklärt so manches.
Mauros Auto ist eine Ford-Limousine. Kein Angeberwagen, aber scheckheftgepflegt. Tony läuft zur Beifahrertür und ruft: »Ich sitz vorne!«
Ich lande auf der Rückbank, zwischen einem Kindersitz und einem Quietscheentchen. »Ist Anna auch mitgekommen?«, frage ich, als Mauro den Motor startet.
»Frau und Kinder, die ganze Bagage. Wir nutzen die Zeit, bevor die Touristenmassen kommen, und hängen noch ein paar Tage Urlaub dran.«
Zum Glück ist das für mich kein Thema. Mein Rückflug geht morgen früh um halb sechs. Eine Begegnung mit Anna ist so ziemlich das Letzte, was ich jetzt brauche.
Tony holt ein Päckchen Zigaretten hervor und bietet mir und Mauro eine an. Schweigend rauchen wir, während Mauro aus der Stadt hinausfährt. Arts Haus liegt auf dem Land, etwa zehn Kilometer südlich von Casalfranco. Wir alle würden den Weg auch mit verbundenen Augen finden, so oft sind wir ihn gegangen, als wir noch Kinder waren.
Bestimmt geht es Art gut. Wenn man sich wegen etwas Sorgen macht (ein geliebter Mensch kommt zu spät oder eine wichtige Vorsorgeuntersuchung steht an), stellt sich fast immer heraus, dass alles in Ordnung ist. Aber der heutige Abend ist so oder so versaut. Der Pakt ist versaut, und das ist ganz allein meine Schuld. Ich wusste, dass das früher oder später passieren würde, aber das macht es auch nicht besser. Ein Teil von mir vergeht vor Selbstmitleid und sagt: Und wieder hast du eine Sache gründlich vor die Wand gefahren. Ganz der Fabio, wie man ihn kennt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich eine Miniaturausgabe meiner selbst, die mir höhnisch Beifall klatscht.
Die Stadt verliert sich in der offenen Landschaft, und schließlich fahren wir eine schmale Straße entlang, auf der es stockfinster ist – keine Laternen, keine Pfosten an den Straßenrändern, nicht die geringste Spur von Elektrifizierung. Die umliegende Gegend blitzt nur kurz auf, wenn das Licht der Scheinwerfer über sie hinwegstreicht. Sie ist so flach wie das Meer an den Tagen, an denen die Tramontana weht. Erst fahren wir durch Weinbauflächen mit gekrümmten Reben, dann durch Olivenhaine mit dicken Bäumen, deren in sich gewundene Stämme sich gleichfalls krümmen. Die Pflanzen, die hier wachsen, müssen mit sehr wenig Wasser und zu viel Sonne zurechtkommen, außerdem mit Wind, Hagelschlag und Gewittern. Nur die kräftigsten überleben, und selbst sie bleiben verschrumpelt und vernarbt zurück. Es ist eine zeitlose Landschaft, aber nicht in der Art, wie ich sie mag. Ich fühle mich zerbrechlich, wenn ich mich in ihr wiederfinde.
Mauro biegt auf einen Seitenweg ab, der gleichfalls durch Weinberge führt. Die jungen Trauben leuchten im Licht der Scheinwerfer. Dazwischen sind immer wieder die ovalen Blätter der Feigenkakteen zu erkennen, auf denen inmitten von Dornen schon die farbenfrohen Früchte heranreifen. Art stammt aus einer Bauernfamilie, die seit drei Generationen in dem Haus lebt, das sein Großvater mit eigenen Händen errichtet hat. Das massive, würfelförmige Gebäude steht am Ende des Feldweges, ein weißer Klotz mitten im Nichts. Früher gab es dort weder Rohrleitungen noch Strom. Erst Arts Vater sorgte für eine Modernisierung, doch jetzt ist davon nichts zu sehen. Das ganze Haus ist stockdunkel.
»Er ist nicht da«, sage ich.
Mauro parkt neben einem verbeulten alten Fiat Panda, der vermutlich Art gehört, und wir steigen aus. Als das Motorgeräusch verklungen ist, erfüllt das endlose Zirpen der Grillen die Luft.
»Art!«, ruft Tony. »Wir sind’s!«
Durch das Zirpen der Grillen wird die Stille geradezu greifbar. Irgendwo in der Ferne bellt ein Hund, doch mehr ist nicht zu hören.
»Fabio hat recht. Er ist nicht zu Hause«, sagt Mauro.
»Und warum steht dann sein Auto da?«, entgegnet Tony. »Art!«, ruft er noch einmal. Er drückt auf die Klingel. Keine Reaktion.
»Seltsam«, sagt Mauro.
»Es wäre doch denkbar, dass er vergessen hat, dass unser Treffen heute ist«, sage ich zögerlich.
»So? Das wäre denkbar, meinst du?«
Ich schüttele den Kopf. Art glaubt nicht ans Vergessen.
»Wir sollten nachsehen«, schlägt Tony vor. »Vielleicht ist er verletzt. Oder …«
Er spricht nicht aus, was wir alle denken: … oder vollkommen zugedröhnt. Wir wissen nicht sicher, ob Art harte Drogen nimmt, aber wir haben uns hin und wieder darüber unterhalten und sind uns einig, dass es gut ins Bild passen würde. Es wäre nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, was er durchgemacht hat. Darüber sprechen wir jedoch nie.
Ich werfe einen Blick unter die Keramikvase, die neben der Tür steht (und in der früher Geranien wuchsen, bevor Art sie hat verkümmern lassen). So wie sein Vater vor ihm hatte Art darunter immer einen Ersatzschlüssel versteckt. »Nichts.«
»Weißt du noch?«, sagt Tony. »Ich brauche für so ein billiges Schloss wie das hier keinen Schlüssel. Meine alten Tricks habe ich noch immer drauf.« Er legt die Hand auf die wacklige Klinke. »Oh«, entfährt es ihm.
Die Tür ist offen.
4
Wir haben den Pakt vor siebzehn Jahren im American Pizza begründet, an dem Abend, als Art sein Leben in die Tonne getreten hat. Unsere Schulzeit war fast vorbei, nur die letzten Prüfungen standen noch aus. Wir alle wollten zum Studieren weggehen: Tony nach Rom, Mauro nach Mailand, und ich hatte mir London in den Kopf gesetzt, diese unerschöpfliche Quelle exotischer Träume. Art würde in die USA gehen, nach Stanford, dank eines Stipendiums, an das keine Bedingungen geknüpft waren und sämtliche Kosten deckte. Dieses Stipendium war tagelang Stadtgespräch gewesen. Eine solche Unterstützung war für Art die einzige Möglichkeit, eine anständige Universität zu besuchen, und als er überlegt hatte, wo er sich bewerben sollte, hatte er beschlossen, dass er sich ruhig hohe Ziele stecken könnte.
Er wusste, dass man in Stanford einen Bewerber von einer unterdurchschnittlichen italienischen Schule sofort aussortieren würde. Also nahm er ein Projekt in Angriff, wie es typisch für ihn ist: In acht Monaten intensiver Arbeit schrieb und zeichnete er einen zweihundert Seiten starken Comic, der auf seiner eigenen Übersetzung des Goldenen Esels von Lucius Apuleius beruhte, einer grotesken Geschichte voller Zauberei, Gestaltwandler und mystischer Kulte, mit der er sich zuvor leidenschaftlich beschäftigt hatte. Er übersetzte sie aus dem Lateinischen ins Englische, machte daraus ein Textbuch und fertigte die Zeichnungen dazu an, in einem Stil, der so unterschiedliche Einflüsse wie Steve Ditko und Francis Bacon zusammenführte. Dann verpackte er die Originalblätter und schickte sie nach Stanford – Farbkopien konnte er sich nicht leisten. Er hatte durchschlagenden Erfolg. Das Antwortschreiben war in seinem ausufernden Lob schon fast obszön. Seine Eltern kriegten sich gar nicht mehr ein vor Stolz, und uns ging es genauso. Ich glaube, wir waren niemals eifersüchtig auf Art und seine Fähigkeiten. Wir wussten, dass er in einer anderen Liga spielte.
Keiner von uns hatte vor, jemals nach Casalfranco zurückzukehren. Art und ich waren unserer Heimatstadt in unversöhnlichem Hass verbunden, Mauro schmiedete mit Anna, die inzwischen seine Freundin war, Pläne für die Zukunft (die sie dann alle verwirklichten), und Tony hatte etwas an sich entdeckt, das ihm ein Leben in Casalfranco mehr als unangenehm machen würde, auch wenn er uns erst sehr viel später einweihte.
Erstaunlicherweise zuckte mein Vater nicht mit der Wimper, als ich ihm eröffnete, dass ich weggehen würde. Er war sicher, dass ich scheitern würde. »Du wirst zurückkommen«, sagte er. Das sagten auch alle anderen. Dass die jungen Leute weggehen und eine Zeit lang woanders leben wollten, war normal, aber irgendwann kamen sie alle zurück. Ti Casalfrancu sinti – mit diesen dialektgefärbten Worten wurde man von den lebensklugen Einwohnern der Stadt an die eigene Herkunft erinnert. Du bist aus Casalfranco, und dein Geburtsort ist dein Schicksal, also markier hier nicht den großen Macker. Wer zwischen ausgetrockneten Erdschollen, Königsschwänzen und der Corona aufwuchs, war in der Tat nicht besonders gut auf die große weite Welt vorbereitet. Casalfranco war wie ein Gummiband: Man konnte es dehnen, aber früher oder später riss es einen wieder an den Ausgangspunkt zurück. In unserem Jahrgang waren Mauro, Tony und ich die Einzigen, die weggingen und auch wegblieben. Selbst Art kam irgendwann zurück. Das ist traurig und auch irgendwie ungerecht, denn ohne seinen Einfluss hätten wir anderen der Anziehungskraft Casalfrancos womöglich nicht widerstanden.
In dieser weit zurückliegenden Zeit, als Urlauber und Rentner die Region noch nicht für sich entdeckt hatten, war das American Pizza ein trostloser Ort: eine Handvoll abgenutzter Tische mit rot-weiß karierten Tischdecken, an der Wand das vergilbte Foto eines örtlichen Fußballvereins und in einer Ecke eine kränkliche gelbliche Pflanze, die wir in Anspielung auf The Little Shop of Horrors Audrey getauft hatten. Das Lokal war ein schäbiger Laden mit einem entsetzlich provinziellen Namen, aber die Pizza war gut. Genauer gesagt, sie war billig. Das American Pizza war die einzige Pizzeria, die Art sich leisten konnte.
Alles fing damit an, dass er sagte: »Ich gehe nicht nach Stanford.«
»Und was machst du stattdessen? Angeln gehen?«, witzelte Tony.
»Ich meine das ernst.«
Tony und ich sahen uns an. Mauro wischte sich den geschmolzenen Mozzarella von den Lippen und fragte: »Wirklich?«
»Voll und ganz. Es ist etwas passiert.«
»Ist mit deinen Eltern alles in Ordnung?«, wollte Tony wissen.
»Etwas Gutes ist passiert.« Art machte eine theatralische Pause, sah uns der Reihe nach an und verkündete dann: »Ich habe einen Buchvertrag für meinen Comic. Jemand im Zulassungskomitee von Stanford hat einen Bruder, der als Lektor in einem Verlag arbeitet. Eines führte zum anderen, und jetzt will er die Rechte an meinem Buch kaufen.«
»Das ist ja großartig!«
»Ich weiß.«
»Und warum ist das ein Grund, nicht nach Stanford zu gehen?«, fragte Mauro.
»Sie zahlen mir einen Vorschuss. Wenn ich mir hin und wieder etwas dazuverdiene, reicht das aus, um ein Jahr lang freizumachen.«
»Und das soll besser sein als ein volles Stipendium an einer der coolsten Unis der Welt?«
»So habe ich mehr Zeit, um meine Interessen zu verfolgen.«
Wir schwiegen eine Weile. Wir kannten Art zu gut, um zu glauben, dass er scherzte. »Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt«, sagte Mauro.
Art wischte die Bemerkung mit einer Geste beiseite. »Ich habe das Stipendium diesmal bekommen, also kann ich es jederzeit wieder bekommen, wann immer ich will. Ich nehme mir einfach nur ein Jahr Auszeit. In anderen Ländern ist das völlig normal.«
»Und wo gehst du stattdessen hin?«, wollte ich wissen.
»Nach Turin. Da gibt es ein paar Bibliotheken, die ich mir ansehen will. Und dann nach Volterra. Ein faszinierender Ort.«
»Lass uns nach den Prüfungen noch mal darüber reden«, meinte Tony.
»Ich habe Stanford schon abgesagt.«
Wieder entstand ein Schweigen, bedrückender als das erste. Als wir vierzehn gewesen waren, war Art etwas widerfahren, das ihm mehr Schaden zugefügt hatte, als wir alle ahnten, aber in diesem Augenblick fragte ich mich zum ersten Mal ernsthaft, ob er noch bei Sinnen war.
»Ich gehe weg von hier. Genau das wollte ich immer«, fuhr er fort. Dann biss er ein Stück von seiner Pizza ab und sagte mit vollem Mund: »Und das hier ist das einzige, was ich an dieser beschissenen Stadt vermissen werde.«
»Es gibt schlimmere Orte als Casalfranco«, entgegnete Mauro.
»Sei dir da mal nicht so sicher«, sagte ich. »Diese Stadt ist ein Ungeheuer, das dir das Mark aus den Knochen saugt.« Wir waren alle erleichtert, dass wir das Thema wechseln konnten.
»Aber die Pizza ist klasse«, warf Tony ein.
»Das stimmt«, gab Art zu. »Aber seien wir ehrlich: In einem Jahr werden wir merken, dass sie so toll nun auch wieder nicht ist. Wir mögen sie, weil wir mit ihr so viele Erinnerungen verbinden.«
»Und das heißt, dass wir angenehme Erinnerungen haben«, sagte Tony. »Dass der Arsch der Welt doch ein paar schöne Seiten hat.«
Art nickte. »In der Tat. Die Pizza wird mir fehlen, und ihr werdet mir auch fehlen.«
Das Gespräch fand nicht vor tausend Jahren statt, aber noch in Zeiten vor Facebook, vor Skype und bevor jeder ein Handy hatte – zumal im Süden. Entfernungen spielten noch eine Rolle.
»Es ist ja nicht so, dass wir uns nie wiedersehen werden«, sagte Tony.
»Doch, irgendwie ist es schon so«, erwiderte Art. »Schließlich hat keiner von uns vor, andauernd hierherzukommen, oder? An Weihnachten und im Sommer, wenn überhaupt.«
»Ist das hier dann so was wie ein letztes Abendmahl?«
Ich hielt ein Pizzastück mit Anchovis und Kapern hoch und sagte mit tiefer Stimme: »›Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.‹«
»Wir alle werden einander verraten«, sagte Art. »Wir alle werden neue Freunde finden.«
»Und Freundinnen, und zwar eine ganze Menge«, sagte Tony. »Nehmt’s nicht persönlich, Jungs, aber für ein Paar ordentliche Titten verkaufe ich meine besten Freunde, ohne mit der Wimper zu zucken.« Zur Veranschaulichung hielt er sich die Hände mit gespreizten Fingern vor die Brust. Dann nahm er eine Hand weg. »Auch für eine Titte, wenn sie denn hübsch genug ist.« Tony gab sich alle Mühe zu verbergen, dass er schwul war, und das gelang ihm auch, hauptsächlich, weil es für uns damals unvorstellbar war, dass ein Schwuler mit uns am Tisch saß. Mauro und ich erfuhren es zwei Jahre später, als Tony uns und seine Schwester Elena einweihte, um sich Mut anzutrainieren, bevor er es seinen Eltern sagte. Art hatte es schon immer gewusst, aber nie ein Wort darüber verloren.
»Ja, sicher: Frauen, Jobs, das wird alles bestimmt ganz toll. Aber das hier«, sagte Art und legte die Hand auf den Tisch, »das hier, das ist vorbei. Das Ende unseres Lebens, wie wir es kennen.«
Wir ließen seine Worte nachwirken. Manchmal klang Art wie eine Mischung aus einem weisen Einsiedler und einem Achtjährigen, der einen Kranken tröstet. Keiner von uns hegte auch nur den geringsten Zweifel daran, dass er für Großes geschaffen war.
»Scheiße«, sagte Mauro.
Ich zuckte mit den Schultern. »Scheint, als könnten wir nichts dagegen tun.«
»Und warum?«, fragte Art.
Manchmal ging er mir wirklich auf die Nerven. »Na ja, die Wirklichkeit …«
»Soll uns die Wirklichkeit doch am Arsch lecken. Lassen wir uns unsere Träume nicht zerstören!«
Mit einer Kopfbewegung deutete ich auf den Besitzer der Pizzeria, der hinter der Kasse saß, in die Lektüre eines Schwarz-Weiß-Pornocomics vertieft, auf dessen Titel ein Vampir zu sehen war. Jacula, ein italienischer Klassiker. Mit seinem runden Bauch, seiner üppig behaarten Brust und seinem Rückenhaar, das unter der speckigen Weste hervorquoll, die seine Uniform darstellte, hätte man ihn leicht für einen Gorilla halten können (in der Stadt nannte man ihn nur Kong). »Sieht so dein Traum aus?«, fragte ich.
Art zog in gespieltem Ernst eine Augenbraue hoch. »Ich habe einen breit gefächerten Geschmack. Hört zu, ich schlage euch etwas vor: Wir schließen hier und heute einen Pakt miteinander. Wir treffen uns jedes Jahr wieder, immer am selben Tag.«
»Art …«, hob ich an.
»Psst«, unterbrach mich Tony. »Lass den weisen Mann zu Ende sprechen.«
»Danke, mein Freund«, sagte Art. »Also, wie gesagt: Wir treffen uns jedes Jahr am selben Tag. Was auch immer passiert, wohin uns das Leben auch führt, wir treffen uns hier an diesem Ort, am selben Tag und zur selben Uhrzeit. Egal, ob wir den Rest des Jahres regelmäßig in Kontakt sind oder nie voneinander hören. Wir werden nie über die Verabredung sprechen. Wir werden sie nie ausfallen lassen oder verschieben. Wo auch immer wir gerade auf der Welt sind, am zehnten Juni kommen wir nach Casalfranco, laufen im American Pizza ein, setzen uns an unseren Tisch und tun so, als wäre die Zeit stehengeblieben. Scheiß auf die Wirklichkeit.«
Ich glaubte, dass das funktionieren könnte, sah aber auch die Schwierigkeiten. »Damit bleiben wir Casalfranco auf ewig verbunden.«
»Wir bleiben einander verbunden«, berichtigte Art. »Ich bin dabei. Du auch?«
»Und wenn wir keine Zeit haben?«
»Dann werden wir uns Zeit nehmen. Das ist keine lockere Verabredung, sondern ein Pakt. Die ganz harte Nummer.«
»Abgefahren«, sagte Tony. »Ich bin dabei.«
»Scheiß auf die Wirklichkeit, jetzt und in alle Ewigkeit«, pflichtete Mauro ihm bei.
Das bedeutete, dass ich einmal im Jahr nach Casalfranco würde zurückkehren müssen, wozu ich nicht die geringste Lust hatte. Aber wenn ich meine Freunde behalten wollte, würde ich etwas dafür tun müssen, und behalten wollte ich sie unter allen Umständen. Der Preis dafür war gesalzen, aber die Sache war es wert. Also stimmte auch ich dem Pakt zu.
Und was Art betrifft: Er hat nie eine Universität besucht.
5
Kaum habe ich das Haus betreten, weiß ich, dass es verlassen ist. Leere Häuser fühlen sich immer eigenartig an. Es ist nicht die Stille, nicht die Reglosigkeit, es ist etwas Subtileres. Es fehlt das Gefühl, dass noch etwas oder jemand außer einem selbst da ist. Das Haus riecht nach Feuchtigkeit und alten Büchern. Tony saugt deutlich hörbar die Luft ein und verkündet dann: »Keine verwesenden Leichen. Das ist doch schon mal was.«
Mauro legt einen Schalter an der Wand um, und ich bin ein wenig überrascht, als tatsächlich das Licht angeht.
Als Erstes fallen mir die Bücher ins Auge. Der Raum, in dem wir stehen, ist klein und quadratisch. Er ist mit einem Tisch und ein paar Korbstühlen eingerichtet und übersät mit Büchern: Sie stehen in IKEA-Regalen, lehnen in Stapeln an den Wänden, türmen sich auf dem Boden oder liegen aufgeklappt mit dem Rücken nach oben auf dem Tisch. Die meisten meiner Lieblingsautoren hat Art mir nahegebracht. Inzwischen habe ich allerdings so gut wie keine Zeit mehr zum Lesen.
»Art?«, ruft Tony in einem letzten, halbherzigen Versuch.
»Er ist nicht da«, sagt Mauro.
»Das ist mir schon klar«, entgegnet Tony. »Aber wir sollten trotzdem nachsehen. Man weiß ja nie.«
Ich gehe unter einem Türsturz aus Tuffstein hindurch in die Küche. Ich fühle mich wie in der Zeit zurückversetzt – der Ort ist der richtige, aber mit dem Zeitgefüge stimmt etwas nicht. Das letzte Mal war ich mit neunzehn hier, als ich mich vor der Abreise nach London von Arts Eltern verabschiedet habe. Wir sprachen nicht einmal dieselbe Sprache. Ich sprach Italienisch, und sie antworteten in dem örtlichen Dialekt, der mit Italienisch so wenig zu tun hat wie Walisisch mit Englisch. Sie waren freundliche Leute, und ich mochte sie viel lieber als meinen Vater. Sie hatten mitbekommen, dass ihr Sohn aus anderem Holz geschnitzt war als die anderen Menschen, machten darum aber nie viel Aufhebens. Kann es wirklich sein, dass siebzehn Jahre vergangen sind? Da muss sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben. Arts Eltern sind tot, und ich bin ein erwachsener Mann, der seine besten Jahre damit vergeudet hat, seinen Hirngespinsten nachzulaufen und das wenige an Talent, das er besitzt, zu verschleudern.
In der Küche stimmt irgendetwas nicht.
Der Raum ist vergleichsweise groß, und früher hat sich hier die ganze Familie versammelt. Auch hier liegen überall Bücher herum, aber das ist es nicht, was mich irritiert. Was mich irritiert, ist der Tisch in der Mitte, der schon damals hier stand und an den ich mich gut erinnern kann. Darauf steht ein Teller, daneben eine Gabel, ein Glas und eine Flasche Wein. Der Teller ist schmutzig, darauf liegen noch Reste verschimmelter Pasta mit Tomatensauce und Käse. Eine fette Fliege wandert langsam den Rand des Tellers entlang. Die Flasche ist halb voll. Sie ist nicht verschlossen, und der Wein verströmt einen ekelhaften Geruch. Auch im Glas ist noch Wein übrig.
Das passt ganz entschieden nicht zu Art. Art hätte die Pasta aufgegessen und den Wein ausgetrunken, den Korken wieder auf die Flasche gesteckt und anschließend sofort abgespült. Einen Ordnungsfimmel kann man ihm weiß Gott nicht nachsagen, aber er achtet immer peinlich genau auf Sauberkeit. Außerdem würde er nie eine halbe Flasche Wein schlecht werden lassen. Ich höre Mauro und Tony hinter mir reden, doch dann bricht ihr Gespräch plötzlich ab. Ich weiß, dass sie dasselbe denken wie ich.
»Scheiße«, sagt Tony.
Er nimmt eine grüne Packung Hundefutter aus einem der klapprigen Schränke. »Das ist eine individuelle Mischung. Ich kenne die Marke. Einer meiner Ex-Feunde hat seinen geliebten Foxterrier mit dem Zeug gefüttert. Es macht aus deinem Hund einen Gelehrten, einen Leistungssportler und einen Politiker. Und es kostet dementsprechend.«
Neben dem Kühlschrank stehen zwei glänzende Metallschüsseln auf dem Boden. In einer ist noch ein wenig Wasser, in der anderen Reste von Hundefutter. Die Schüsseln sind robust, von guter Qualität und sehen teuer aus. »Seit wann hat Art denn einen Hund?«, frage ich.
»Und seit wann wirft er so mit Geld um sich?«
»Ich schau mich mal im Rest des Hauses um«, sagt Mauro.
Ich mache den Kühlschrank auf: eine halbe Salami, ein Stück Käse und zwei Pfirsiche, die verfault und schon ganz schwarz sind. Das passt nicht zu Art, definitiv nicht. Ich gehe zu der Tür, die von der Küche in den Garten hinter dem Haus führt. Sie ist nicht verschlossen. Ich öffne sie, und frische Luft strömt herein, vermischt mit einem Geruch, der mir nicht unbekannt ist: Cannabis. Ich muss lächeln. Nicht weit vom Haus entfernt steht eine ganze Reihe üppig wuchernder Pflanzen. Art hat als Teenager angefangen, sein eigenes Gras zu ziehen, und nach dem, was er uns erzählt hat, hat er immer wieder mal welches angepflanzt, wann immer sich die Gelegenheit bot. Seitdem er wieder in Casalfranco lebt, betreibt er den Anbau in größerem Stil. Cannabis gedeiht gut im hiesigen Klima. Früher hat er die Blumenkübel vor seinen Eltern versteckt. Jetzt braucht er die Pflanzen weder zu verstecken noch in Kübel zu zwängen. Sie stehen meterhoch und sind so groß, dass sie im Mondlicht klar zu erkennen sind.
Wenn man es recht bedenkt, ist das verdammt viel Gras für einen einzelnen Menschen.
Mein Lächeln fällt in sich zusammen. Ich weiß, dass Art immer wieder mal mit Gras gedealt und sich so ein bisschen Geld verschafft hat. In Turin, in Paris und was weiß ich wo – aber hier? In Casalfranco hat nur die Corona das Recht zu dealen, das ist ein Fakt und steht nicht zur Diskussion. So wie die unerbittliche Hitze der Sonne oder der Wechsel der Jahreszeiten. Wenn du auch noch so pleite bist – dein Gras behältst du für dich.
»Fabio«, ruft Mauro. »Komm mal her.«
Ich gehe in das Zimmer, aus dem seine Stimme zu hören war.
»Willkommen im Dschungel«, sagt Tony. »Im Bücherdschungel.«
Der ganze Raum ist voller Bücher. Sie stapeln sich so hoch, dass sie die Wände verdecken. Früher war das hier das Wohnzimmer. In der Mitte stand ein Sofa und an der Rückwand ein Fernseher. Jetzt sind nur noch Bücher zu sehen. Obwohl das Licht brennt, wirkt der Raum düster und unheilvoll. Tony hat recht, man fühlt sich wie im Dschungel. Ich würde mich nicht wundern, wenn Anakondas aus Tinte um uns herumschlängeln oder Affen aus Papier mit Taschenbüchern nach uns werfen würden.
»Und dann wäre da noch das Schlafzimmer«, sagt Tony und öffnet eine weitere Tür. Dort sind keine Bücher zu sehen, nur ein Bett mit zerknautschten Laken und ein offen stehender Schrank voller Kleidung. An den mit Reißzwecken und Posterstrips übersäten Wänden finden sich zahlreiche helle Stellen, als hätte jemand eine Menge Blätter daran befestigt, sie eine Zeit lang hängen lassen und dann alle auf einmal wieder abgenommen.
»Sieht aus, als hätte er Zeitungsausschnitte gesammelt und an die Wand gehängt«, mutmaßt Tony. »Wie ein Serienmörder.«
Mauro hält einen Finger vor einen der Posterstrips, ohne es zu berühren. »Wir haben doch keine Ahnung, was er da gemacht hat.«
»War nur ein Scherz«, sagt Tony, etwas leiser als vorhin.
»Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze.«
»Aber überrascht bin ich nicht.«
»Warum?«, frage ich.
»Du warst letztes Jahr nicht da«, sagt Tony. »Du hast ihn nicht erlebt. Er war … so wie immer, nur extremer. Viel extremer.«
»In Richtung psychische Erkrankung?«, frage ich.
»Art ist eben Art. Er lebt einfach immer in seiner eigenen Welt.«
Wir gehen zurück in die Küche, wo ich mich auf einen Stuhl fallen lasse. Bei jedem anderen würde ich jetzt auf meinem Handy nachsehen, was er zuletzt auf Facebook gepostet hat, um einen Anhaltspunkt zu bekommen, was er gerade macht. Aber Art ist nicht auf Facebook. Er hat keine Lust auf die Datenschutzbestimmungen von Facebook, die andauernd geändert werden. Die können ihm gestohlen bleiben, sagt er.
Tony zückt sein Handy.
»Was wird das?«, fragt Mauro.
»Ich rufe die Carabinieri an.«
»Warum das denn?«
Tony zieht ein genervtes Gesicht. »Warum wohl? Weil wir nicht wissen, wo Art steckt, weil wir nicht wissen, wo seine Nobeltöle steckt, und weil wir uns Sorgen machen.«
»Deshalb musst du doch nicht gleich eine Vermisstenmeldung aufgeben.«
»Aber er würde doch niemals sein Haus in diesem Zustand verlassen!«
»Das ist noch lange kein Grund, die Carabinieri zu informieren.«
Tony hält sein Handy weiter in der einen Hand und legt die andere in den Nacken. »Und wenn wir ihnen nur vorsorglich Bescheid geben?«
»Damit handeln wir uns nur Ärger ein. Allein schon, weil wir erklären müssten, warum wir mitten in der Nacht in sein Haus einbrechen wollten. Wir alle leben schon lange nicht mehr in Casalfranco, keiner von uns hat regelmäßig Kontakt zu Art, und wir haben keine Ahnung, wie sein Leben derzeit aussieht.«
»Aber wir sind seine besten Kumpels!«
Mauro zuckt nur mit den Schultern.
»Und dann noch das Gras«, füge ich hinzu.
»Welches Gras?«, fragt Tony.
»Art hat hinter dem Haus eine kleine Plantage angelegt.«
Mauro wird bleich, was eigentlich ziemlich komisch aussieht, nur dass heute Abend überhaupt nichts komisch ist. »Eine Plantage?«
»Na ja, eine echte Plantage ist es nicht. Nur acht oder zehn Pflanzen. Riesige Dinger.«
»Die können wir ja beseitigen, bevor wir die Carabinieri anrufen«, schlägt Tony vor.
»Und wenn sich dann herausstellt, dass wir völlig grundlos in Panik verfallen sind, wird Art uns ganz schön was erzählen«, wende ich ein.
Bevor Tony etwas entgegnen kann, sagt Mauro: »Abgesehen davon, ist einer von euch ein Profi in Sachen Kriminalität? Ich bin das nämlich nicht. Wenn die Carabinieri die Ermittlungen einleiten, dann garantiere ich euch, dass sie herausfinden werden, dass da jemand gerade eben ›acht oder zehn‹ Cannabispflanzen hat verschwinden lassen. Dazu muss man kein Einstein sein. Und dann stecken wir tiefer in der Scheiße, als wir uns das jetzt vorstellen können.«
»Moment mal«, sagt Tony. »Was denn für Ermittlungen? Ich habe doch nur gemeint, wir sollten ihnen sagen, dass wir uns Sorgen machen.«
»Und du glaubst, sie lassen es dabei bewenden? Bei jedem anderen schon, aber wir reden hier von Arturo Musiello. Den Carabinieri bricht doch schon der kalte Schweiß aus, wenn sie den Namen nur hören. Und die Presse wird den Ort überrennen.«
Ich brauche ein paar Sekunden, um zu verstehen, was Mauro meint. Als ich es endlich begriffen habe, starre ich ihn an. Worauf er gerade angespielt hat – darüber haben wir noch nie gesprochen.
»Du meinst …«, sagt Tony in düsterem Ton.
»Ganz genau. Das meine ich.«
Wir sprechen nicht darüber, zum einen, weil Art selbst nie darüber spricht, und zum anderen, weil es so besser ist. Auch ich habe diese Tage in eine finstere und verstaubte Ecke meines Gedächtnisses verbannt, in die ich nie einen Blick werfe. Wenn ich daran denke, läuft es mir noch zweiundzwanzig Jahre danach kalt den Rücken hinab, obwohl ich keinen blassen Schimmer habe, was damals passiert ist. Aber ich habe Art davor gekannt, und ich habe ihn danach erlebt, und ich schwöre, er war danach nicht mehr derselbe. Ich habe und ich hatte keine Ahnung, und ich glaube, meistens war mir das auch lieber so.
6
Wenn ich meiner Freundin Lara, einer Engländerin, das Salento erklären will, dann sage ich: Italien ist eine lange Halbinsel, an deren Ende wieder eine lange Halbinsel liegt. Das ist Apulien. Apulien ist eine lange Halbinsel, an deren Ende wieder eine lange Halbinsel liegt. Das ist das Salento. Hinter dem kristallklaren Meer, von dem es umgeben ist, hört die Welt zwar nicht auf, aber es kommt einem so vor. Es fühlt sich an, als sei das Salento die Endstation, das Ende der Welt. Oft verspreche ich Lara, ihr all das eines Tages zu zeigen, wenn sie Lust hat. Wir werden von London aus auf dem Landweg hinunterfahren, und sie wird mitansehen, wie sich die Landschaft verändert, wie die von städtischer Zivilisation geprägten Gegenden Mitteleuropas und Norditaliens der Wildnis des Südens Platz machen und schließlich der echten Wildnis des echten Südens, diesem flachen Land, das keine Gesetze kennt, wo die Menschen in schlechten Jahren den Heiligen Opfer darbringen und sie inbrünstig anflehen, ihnen nur ein wenig Regen zu schenken, nur so viel, dass das Vieh und die Weinreben das Jahr überstehen. Und dann werden Lara und ich am Strand sitzen und aufs Mittelmeer hinausblicken, und sie wird empfinden, was auch die Einheimischen empfinden, nämlich dass dieses Land tatsächlich finis terrae ist, das äußerste Ende der Welt.
Wir werden diese Reise im Sommer machen. Nie würde ich Lara im Winter hierher mitnehmen. Wenn man im Winter im Salento sitzt, würde man am liebsten sterben. Dann wird hier nicht nur alles kälter und schroffer, sondern auch noch abweisender, als es ohnehin schon ist. Allem voran der Wind, der wie ein Geisteskranker tobt. Er beißt und peitscht, und wenn er vom Meer her weht, schleudert er dir den Gestank toter Fische ins Gesicht und bringt eine Feuchtigkeit mit sich, die dich nach unten zieht wie nasse Kleidung, wenn du ertrinkst.
Als die Sache mit Art passiert ist, war es Winter, und wir waren vierzehn.
Damals hatten wir an langen Winterabenden nichts anderes zu tun, als Horrorfilme zu schauen oder ins American Pizza zu gehen. Wir waren durchaus schon an Mädchen interessiert, aber die Mädchen in unserem Alter nahmen keinerlei Notiz von uns und hielten sich lieber an ältere Jungs, also schlugen wir wie viele andere Jugendliche im Ort die Zeit tot, indem wir stundenlang auf der Hauptstraße auf und ab gingen, während uns die Kälte bis ins Mark drang. Diese Art des Herumschlenderns, struscio genannt, ist einer der Aspekte der südländischen Kultur, die meine englischen Freundinnen nie verstanden haben. »Und was genau macht ihr da?«, hat Lara mich einmal gefragt. »Geht ihr da einfach immer nur hin und her?« Genau so ist es, aber Lara konnte das einfach nicht glauben. Man geht in kleinen Gruppen auf und ab, hin und wieder begegnet man einem Bekannten und bleibt kurz stehen, oder man spielt mit einem der herrenlosen Hunde, die das Salento schon seit Urzeiten zu bevölkern scheinen.
Art hatte zu Weihnachten ein Fernrohr bekommen.
Es war ein einfaches Modell, aber von guter Qualität. Arts Eltern hatten lange gespart, um es ihm schenken zu können. Art beschäftigte sich damals mit Astronomie, und wie immer taten seine Eltern alles, um ihn zu unterstützen. Danach stürzte er sich auf die Fotografie, was für mich und mein Leben so weitreichende Folgen haben sollte. Art hat mehr Phasen durchgemacht, als ich zählen kann, und vermutlich ist das noch immer so. Dabei ist er nicht wie ein verzogenes Kind irgendwann von seinem alten Spielzeug gelangweilt und schreit nach einem neuen. Zwar langweilt ihn jedes Spielzeug früher oder später, aber erst, wenn er verstanden hat, wie es funktioniert (das geht allerdings meistens ziemlich schnell). Wenn er ein Faible für etwas Neues entwickelt, sei es für Astronomie oder für die Methoden, Mädels anzubaggern, besorgt er sich alle Bücher, sämtliche Requisiten und sämtliches Wissen, dessen er habhaft werden kann, presst sie aus wie eine Zitrone, und wenn er das Gebiet bis in den letzten Winkel beackert hat und zufrieden ist, sucht er sich das nächste. »Fachleute verfolgen nur eine bestimmte Linie«, pflegte er zu sagen, »ich dagegen bin auf der Suche nach Mustern.« Ich habe nie verstanden, was er damit meint. Art verstehen zu wollen, war immer frustrierend.
Jedenfalls hatte er dieses neue Fernrohr und wollte es einweihen, indem er den am leichtesten anzuvisierenden Himmelskörper beobachtete, den Mond. Eine sternenklare Nacht zu erwischen, stellt im Salento keine große Schwierigkeit dar. Man sucht sich einfach eine Nacht aus, und mit ziemlicher Sicherheit wird sie sternenklar sein. Art entschied sich für den ersten Samstag nach den Weihnachtsferien. »Da ist Vollmond«, sagte er. »Das wird großartig.« Er wollte, dass wir mitkommen. Damals verstand ich nicht, warum. Von uns anderen interessierte sich keiner für Astronomie. Heute ist mir klar, dass das Fernrohr der kostbarste Gegenstand war, den Art je besessen hatte, und dass er es mit uns teilen wollte, nicht zuletzt, weil wir ihm unzählige Male ein Bier, einen Kaffee oder Zigaretten spendiert hatten. Uns machte das nichts aus, nicht einmal Mauro, aber Art mag es nicht, bei anderen in der Schuld zu stehen, selbst wenn diese Schuld nur in seinem Kopf existiert.
Jeder andere Junge hätte das Stativ einfach auf dem Acker hinter dem Haus aufgestellt. Nicht so Art. Mithilfe mathematischer Formeln, die weit über mein Begriffsvermögen hinausgingen (und die vielleicht auch einfach nur Hokuspokus waren), hatte er errechnet, dass die beste Stelle für eine Mondbeobachtung in der Gegend um Casalfranco einige Kilometer weiter im Landesinneren lag. Von dort aus, so versicherte er uns, hätten wir die ideale Sicht, aber uns war das alles völlig egal und wir gingen einfach mit. Wir nahmen eine Flasche Wein, Tabak, Gras und ein wenig Proviant mit. Gras hatten wir erst kurz zuvor für uns entdeckt. Noch baute Art es nicht selbst an.
Wir fuhren mit den Vespas von Mauro und Tony hin, Art und ich jeweils auf dem Sozius, und Art versuchte, so gut es ging, trotz des Gewichts des Fernrohrs nicht die Balance zu verlieren. Natürlich trugen wir keine Helme. Niemand, wirklich niemand trug da unten in den Neunzigern einen Helm. Eine Vespa durfte man erst mit vierzehn fahren, aber Tony fuhr schon, seit er zehn war. Mauro hatte seine erst seit Kurzem und war noch immer ganz aufgeregt angesichts dieses neuartigen Erlebnisses.
Die Stelle, die Art ausgesucht hatte, lag buchstäblich im Nichts. Als wir schließlich anhielten, waren wir zehn Minuten lang an keinem richtigen Haus mehr vorbeigekommen, nur an ein paar vereinzelten dunklen Hütten, kleinen Würfeln aus Ziegelsteinen, ohne Heizung, Strom oder Wasser. Dort lebte fast niemand mehr. Fast.
Um uns herum lag eine weite, mit Gestrüpp bewachsene Fläche. Auf dem rötlichen Lehmboden wuchsen dornige Büsche, zwischen denen niedrige Steinmauern verliefen, die die Felder voneinander abgrenzten. Rundherum zeichneten sich in der Ferne die Silhouetten verwachsener Olivenbäume ab, als wäre diese Stelle eine geheime Kultstätte. Ein trostloser, unbarmherziger Ort.
»Wir haben Glück«, bemerkte Mauro, »der Wind hat sich gelegt.«
»Seht euch den Mond an«, flüsterte Art.
Der Mond war gewaltig. Ich weiß, dass das teilweise meiner Fantasie geschuldet ist. Die Erinnerung ist wie das Elixier und der Kuchen in Alice im Wunderland: Sie lässt die Dinge nach Lust und Laune größer oder kleiner erscheinen, und diese Nacht ist in meiner Erinnerung so groß, dass alle ihre Elemente riesig aussehen. Doch zum Teil war es wirklich so. Durch irgendeinen optischen Effekt wirkte der Mond gewaltig, wie ein leuchtendes Loch im Nachthimmel. Mauro und Tony stellten ihre Vespas am Rand der unbefestigten Straße ab und wir gingen los, ins offene Gelände.
Im Salento gibt es keine markierten Wege, keine Drehkreuze oder Zauntritte, nur niedrige Steinmauern, die immer wieder durchbrochen sind, sei es, weil jemand mutwillig eine Bresche hineingeschlagen hat oder weil die Mauer an der Stelle einfach in sich zusammengefallen ist. Für Spaziergänge ist diese Gegend denkbar ungeeignet. Im Winter peitscht einem der Wind ins Gesicht, im Sommer brennt die Sonne gnadenlos herab, und über diese Felder geht nur, wer hier sein Tagewerk verrichtet – oder einem verrückten Freund mit einem Fernrohr hinterherläuft. Fast zwei Monate lang hatte es nicht mehr geregnet, und die wenige Feuchtigkeit, die sich in der Erde gesammelt hatte, stammte vom Meer. Das Licht des Mondes überzog das ausgetrocknete Land mit einem lila Schimmer. Art hatte uns verboten, Taschenlampen mitzunehmen (damit, wie er sagte, sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnten und das Fernrohr so seine ganze Wirkung entfalten konnte), und so hatten wir nur das Mondlicht, um uns zwischen Steinen und Gestrüpp unseren Weg zu bahnen. Das war nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. Ich hatte nicht bedacht, wie hell es bei Vollmond ist.
Plötzlich heulte Tony auf.
Ich zuckte zusammen. »Du Idiot!«
»Was hast du denn? Sollen wir nicht ein paar Werwölfe anlocken?«