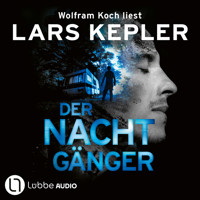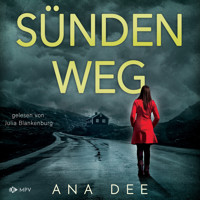2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Paket aus der Zukunft empfangen. Der Münchner Physiker Hannes Lofa glaubt, den Schlüssel dazu gefunden zu haben. Doch die erste Hürde ist gigantisch: eine exakte Adresse im sich ständig wandelnden Kosmos zu definieren, die über Äonen Bestand hat. Als ihm das scheinbar Unmögliche gelingt, steht er vor der nächsten atemberaubenden Herausforderung: eine Botschaft über Jahrtausende an die zukünftigen Absender zu übermitteln, damit diese wissen, wohin sie das geheimnisvolle "Chronos-Relikt" schicken sollen. Doch Lofas bahnbrechende Entdeckung bleibt nicht unbemerkt. Mächtige Organisationen und skrupellose Agenten wittern ihre Chance und wollen das Artefakt mit seinen unvorstellbaren Möglichkeiten um jeden Preis in ihre Gewalt bringen. Ein internationaler Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der Hannes und sein kleines Team an die Grenzen des Vorstellbaren und darüber hinaus führt. Denn das Chronos-Relikt verspricht unermessliche Macht – oder den Untergang. Am entlegenen, präzise berechneten Nullpunkt der Zeit und des Raumes spitzt sich die Lage zu. Wird es Hannes Lofa gelingen, das Erbe der Zukunft zu sichern, bevor es in die falschen Hände fällt und das Schicksal der Menschheit besiegelt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Matthias Selg
Das Chronos-Relikt
Wettlauf um die Zukunft
Seine Theorie ermöglichte das Unmögliche: den Empfang eines Artefakts aus der Zukunft.Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Der Ketzer von Garching
Kapitel 2: Eine unerwartete Verbündete
Kapitel 3: Das kosmische Nadelöhr
Kapitel 4: Erste Schatten
Kapitel 5: Der Ruf nach Expertise
Kapitel 6: Durchbruch am Abgrund
Kapitel 7: Die Last der Erkenntnis
Kapitel 8: Ein Denkmal für die Ewigkeit
Kapitel 9: Die Sprache der Zeit
Kapitel 10: Wächter der Botschaft
Kapitel 11: Das Echo in den Hallen der Macht
Kapitel 12: Jäger und Gejagte
Kapitel 13: Der Verrat
Kapitel 14: Countdown zum Empfang
Kapitel 15: Am Nullpunkt
Kapitel 16: Das Chronos-Relikt
Kapitel 17: Die Macht der Zukunft
Kapitel 18: Zwischen den Fronten
Kapitel 19: Der Preis der Wahrheit
Kapitel 20: Das Echo der Zukunft
Impressum
Kapitel 1: Der Ketzer von Garching
Der Projektor warf das komplexe Diagramm einer in sich verschlungenen Raumzeitkrümmung an die Wand des großen Hörsaals P.01 der Physikfakultät an der Technischen Universität München in Garching. Davor stand Dr. Hannes Lofa, ein Mann Mitte vierzig, dessen leicht ergrauendes, zerzaustes Haar und das knittrige Leinenhemd einen deutlichen Kontrast zur sterilen Präzision des Raumes bildeten. Seine Augen jedoch, als er in das spärlich besetzte Auditorium blickte, brannten mit einer Intensität, die manchen seiner etablierten Kollegen Unbehagen bereitete.
„Es geht nicht darum, eine Nachricht in die Zukunft zu senden“, erklärte Hannes mit einer ruhigen, aber den Raum füllenden Stimme, während er mit dem Laserpointer auf einen Punkt im Diagramm deutete, der eine Art Nadelöhr in der Zeit darzustellen schien. „Sondern darum, die theoretischen und praktischen Grundlagen zu schaffen, um ein physisches Objekt – ein Artefakt – aus der Zukunft zu empfangen.“
Ein verhaltenes Raunen ging durch die Reihen. Die meisten Plätze waren leer geblieben – ein stilles Urteil über die Relevanz, die man Lofas aktueller Forschung beimaß. Die Anwesenden jedoch bestanden überwiegend aus Professoren, Postdocs und einigen wenigen mutigen Doktoranden der Fakultät. Hannes kannte die meisten Gesichter. Er sah die kaum verhohlene Skepsis, das Stirnrunzeln, das gelegentliche, vielsagende Kopfschütteln.
In der dritten Reihe lehnte sich Professor Dr. Alarich Kessler, Ordinarius für Experimentelle Kosmologie und ein Schwergewicht an der Fakultät, dessen Wort Gewicht hatte, sichtlich genervt zurück. Sein Gesichtsausdruck sprach Bände über das, was er von Lofas Ausführungen hielt.
„Die theoretischen Grundlagen“, fuhr Hannes unbeirrt fort und wechselte die Folie zu einem Schwall komplexer Gleichungen, die selbst für viele der anwesenden Physiker schwer zu durchdringen waren, „basieren auf einer Erweiterung der Allgemeinen Relativitätstheorie, gekoppelt mit Erkenntnissen aus der Stringtheorie. Sie postulieren nicht nur das Potenzial für geschlossene zeitartige Kurven unter extrem spezifischen, energiereichen Bedingungen, sondern legen deren Existenz als eine statistische Notwendigkeit nahe.“ Er wusste, dass er sich auf gefährliches Terrain begab. Die Idee von CTCs war zwar ein bekanntes theoretisches Konstrukt, aber der Gedanke, sie für den Empfang von Materie aus der Zukunft nutzbar zu machen, grenzte für die meisten an wissenschaftliche Ketzerei.
Noch bevor Hannes zum nächsten Punkt ansetzen konnte, erhob sich Professor Kessler langsam. Seine Statur war imposant, sein Blick eisig. „Herr Dr. Lofa“, begann er mit jener schneidenden Höflichkeit, die im deutschen Akademikerbetrieb oft schärfer war als offene Feindseligkeit, „Ihre, nun ja, Hypothese ignoriert geflissentlich etablierte Grundsätze unserer Disziplin. Ich erinnere Sie und das Auditorium nur ungern an Hawkings Chronologie-Schutzkonjektur, die, wie wir alle wissen, mit guten Argumenten darlegt, warum die Natur solche Kausalitätsverletzungen zu verhindern weiß.“ Zustimmendes Murmeln und leises Räuspern war aus den Reihen zu vernehmen.
Hannes nickte langsam. „Die Konjektur ist mir selbstverständlich bekannt, Herr Professor. Meine Arbeit adressiert sie direkt.“ Er klickte zur nächsten Folie, die eine noch komplexere mathematische Ableitung zeigte. „Ich schlage einen theoretischen Pfad vor, der sie möglicherweise umgeht – oder, genauer gesagt, in einem sehr spezifischen, hochdimensionalen Kontext als nicht uneingeschränkt anwendbar erweist.“ Er zögerte einen Moment, die Worte wägend. „Die Implikationen eines Erfolgs, Professor Kessler, wären… transformativ.“
Kesslers Miene verfinsterte sich weiter. „Implikationen sind das eine, Herr Kollege, wissenschaftliche Seriosität und der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsgeldern das andere. Was Sie hier präsentieren, kratzt bedenklich an der Grenze zur Pseudowissenschaft. Die Technische Universität München ist ein Ort exzellenter, weltweit anerkannter Forschung und kein Podium für Zeitreisefantasien.“ Der letzte Satz war ein gezielter Tiefschlag, und beide wussten es.
Hannes spürte die altbekannte Mischung aus Frustration und dem brennenden Verlangen, verstanden zu werden. Er dachte an den ursprünglichen Funken, der diese Forschung vor Jahren entzündet hatte – ein Bild, ein tief sitzender Schmerz, eine Ahnung, die er wie ein Geheimnis hütete. War es eine persönliche Tragödie, die ihn so hartnäckig an dieser scheinbar unmöglichen Idee festhalten ließ? Oder war es eine fast schon messianische Vision, die vage, aber unerschütterliche Hoffnung, ein drohendes Unheil abwenden zu können, von dem er nichts Konkretes wusste, das er aber mit jeder Faser seines Wesens erahnte? Diese tiefere Motivation, die er selbst kaum in Worte fassen konnte, gab ihm die Kraft, die ständigen Angriffe, die Isolation und das ungläubige Kopfschütteln der etablierten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu ertragen.
„Ich bin davon überzeugt, dass meine Berechnungen stichhaltig sind und einer Überprüfung standhalten“, erwiderte Hannes fester, als er sich innerlich fühlte. „Es bedarf lediglich des Mutes, sie zu Ende zu denken und die notwendigen experimentellen Schritte zu wagen.“
Die Präsentation endete kurz darauf in einer Atmosphäre frostiger Ablehnung. Niemand stellte weitere Fragen – ein klares Zeichen im akademischen Diskurs. Man verließ den Hörsaal rasch, beinahe fluchtartig, als fürchte man, durch bloße Nähe zu Lofas abwegigen Ideen den eigenen wissenschaftlichen Ruf zu kontaminieren.
Zurück in seinem Büro – einem chaotischen Refugium aus überquellenden Bücherregalen, Stapeln von Fachzeitschriften, halb geleerten Kaffeetassen und einer großen Tafel, die mit einem unentwirrbar scheinenden Geflecht aus Gleichungen und Diagrammen bedeckt war – ließ sich Hannes auf seinen abgenutzten Bürostuhl fallen. Der Raum selbst war ein stiller Protest gegen die oft sterile und rigide Ordnung des deutschen Akademikerbetriebs, den er oft als Fessel empfand. Von hier aus, umgeben vom Duft kalten Kaffees und dem leisen Surren seines alternden Computers, führte er seinen einsamen Kampf gegen die etablierten Dogmen der Physik. Er blickte auf eine kleine, vergilbte Fotografie auf seinem Schreibtisch, ein kaum sichtbares Detail in dem kreativen Durcheinander. Ein flüchtiger Schmerz huschte über sein Gesicht, wurde aber schnell von einer neuen Welle der Entschlossenheit verdrängt.
Er war sich des Risikos vollauf bewusst. Seine Karriere, sein Ruf, die spärlichen Forschungsgelder, die ihm noch gewährt wurden – alles stand auf dem Spiel. In den Augen seiner Kollegen war er entweder ein hoffnungsloser Spinner oder, im besten Fall, ein tragisch fehlgeleiteter, aber brillanter Visionär. Doch der Gedanke, dass es eine Möglichkeit geben könnte, eine Brücke durch die Zeit zu schlagen, eine helfende Hand aus einer fernen Zukunft zu ergreifen, ließ ihn nicht los. Es war mehr als nur wissenschaftliche Neugier. Es war eine innere Notwendigkeit. Und Hannes Lofa war nicht der Mann, der vor einer Herausforderung zurückwich, nur weil die Welt sie für unmöglich hielt. Er würde ihnen zeigen, dass er Recht hatte. Irgendwie.
Kapitel 2: Eine unerwartete Verbündete
Die gedämpfte Stille der riesigen Hauptbibliothek der Technischen Universität München in Garching wurde nur vom gelegentlichen Rascheln umgeblätterter Seiten und dem leisen Tippen auf Laptoptastaturen unterbrochen. Emily Garcon, Doktorandin im dritten Jahr im Fachbereich Theoretische Computerphysik, saß tief über einen Ausdruck von Hannes Lofas umstrittener Präsentation gebeugt, die ihr ein Kommilitone eher spöttisch zugesteckt hatte. Die meisten hatten Lofas Ideen als das Hirngespinst eines exzentrischen Außenseiters abgetan, doch Emily, deren scharfer Verstand sich selten mit oberflächlichen Urteilen zufriedengab, sah etwas anderes.
Sie kam ursprünglich aus Lyon, Frankreich, und hatte sich bewusst für die TUM entschieden, angezogen vom exzellenten Ruf der Universität und der Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld zu forschen. Ihre dunklen, intelligenten Augen folgten den verschlungenen Pfaden von Lofas Gleichungen. Wo andere nur unhaltbare Spekulation sahen, erkannte sie eine kühne, fast schon elegante Logik, eine Bereitschaft, etablierte Grenzen zu überschreiten, die sie insgeheim bewunderte. Ihre eigene Forschung bewegte sich an der Schnittstelle von Quantenalgorithmen und der Simulation komplexer Systeme – ein Feld, das eine ähnliche Denkweise erforderte.
Nachdem sie die letzte Seite des Ausdrucks gelesen hatte, lehnte sie sich zurück und blickte aus dem großen Fenster auf den grünen Innenhof des Campus. Die Skepsis ihrer Kollegen war verständlich. Lofas Theorie war radikal, die Implikationen schwindelerregend. Doch etwas an seinem Ansatz fesselte sie. Es war nicht nur die wissenschaftliche Herausforderung; es war die schiere Kühnheit des Gedankens, eine Brücke in die Zukunft schlagen zu wollen.
Am nächsten Tag, nach langem Überlegen und einer inneren Debatte, die sie die halbe Nacht wachgehalten hatte, klopfte Emily an die Tür von Hannes Lofas Büro. Sie fand ihn inmitten seines kreativen Chaos vor, vertieft in eine handgeschriebene Notiz auf einem Whiteboard, das aussah, als hätte es schon bessere Tage gesehen.
„Herr Dr. Lofa?“, begann sie etwas zögerlich.
Hannes blickte auf, überrascht. Besuch von Doktoranden, die nicht direkt unter seiner Betreuung standen, war selten. „Ja? Kann ich Ihnen helfen?“
„Mein Name ist Emily Garcon. Ich bin Doktorandin bei Professor Brandtner in der Computerphysik.“ Sie hielt den Ausdruck seiner Präsentation hoch. „Ich habe das hier gelesen. Und ich… ich finde es faszinierend.“
Ein Anflug von Überraschung, vielleicht sogar Misstrauen, huschte über Hannes’ Gesicht, wich dann aber einer müden Neugier. „Faszinierend oder verrückt? Die meisten tendieren zu Letzterem.“
Emily lächelte leicht. „Vielleicht ein bisschen von beidem. Aber ich glaube, da ist mehr dran, als Ihre Kollegen wahrhaben wollen.“ Sie trat näher an das Whiteboard. „Ihre Annahmen über die Stabilisierung von Mikrowurmlöchern durch exotische Materie mit negativer Energiedichte – die meisten übersehen, dass Ihre Berechnungen zur notwendigen Krümmung der Raumzeit eine elegante Lösung für das Energieproblem implizieren, wenn man sie mit den neuesten Modellen zur Vakuumenergie koppelt.“
Hannes hob eine Augenbraue. Dieses junge Frau hatte seine Arbeit nicht nur gelesen, sondern offenbar auch verstanden – und weitergedacht. „Sie haben sich also tatsächlich die Mühe gemacht.“
„Ich habe einige Simulationen zu ähnlichen Problemen der Raumzeit-Topologie durchgeführt“, erklärte Emily. „Natürlich in einem anderen Kontext. Aber Ihre mathematischen Ansätze… sie haben eine gewisse Resonanz.“ Sie zögerte einen Moment. „Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht anmaßend, aber ich glaube, meine Expertise in der Entwicklung von Quantensimulationsalgorithmen könnte nützlich sein, um einige Ihrer theoretischen Modelle zu testen. Insbesondere die Stabilität der von Ihnen postulierten CTCs unter verschiedenen Quantenfluktuationen.“
Hannes starrte sie an. Seit Jahren hatte er allein gekämpft, sich an die Skepsis und Ablehnung gewöhnt. Und nun stand diese junge, brillante Frau in seinem Büro und bot nicht nur Verständnis, sondern konkrete Hilfe an. Es war, als hätte jemand in einem dunklen Raum ein Fenster geöffnet.
„Das… das ist ein unerwartetes Angebot, Ms. Garcon“, sagte er schließlich, eine ungewohnte Wärme in seiner Stimme. „Und ein sehr willkommenes.“
In den folgenden Wochen trafen sie sich regelmäßig, oft in der Abgeschiedenheit von Hannes’ Labor oder bei langen Diskussionen in einem kleinen, studentischen Café in der Maxvorstadt, unweit der Hauptuniversität. Die Dynamik zwischen ihnen war komplex. Hannes war der erfahrene, wenn auch unkonventionelle Mentor, Emily die ehrgeizige, scharfsinnige Schülerin, die jedoch schnell zur gleichberechtigten intellektuellen Partnerin wurde. Ihre frische Perspektive und ihre Fähigkeit, komplexe Probleme in elegante Algorithmen zu übersetzen, erwiesen sich als unschätzbar. Sie sah Lösungsansätze, die Hannes, gefangen in seinen eigenen Denkmustern, übersehen hatte.
Es gab Momente unausgesprochener Anziehung, flüchtige Blicke über dampfenden Kaffeetassen oder inmitten komplexer Gleichungen, doch die Professionalität und die komplizierte Machtdynamik des deutschen akademischen Systems – Professor und Doktorandin – legten einen unsichtbaren Schleier darüber. Ihre gemeinsame Leidenschaft für das Projekt und der gegenseitige Respekt vor den Fähigkeiten des anderen bildeten das Fundament ihrer wachsenden Verbindung.
Für Hannes war Emilys Entscheidung, sich ihm anzuschließen, mehr als nur eine willkommene Ergänzung seines Ein-Mann-Teams. Es war die erste wirkliche externe Validierung seiner Arbeit, ein Hoffnungsschimmer in der akademischen Wüste, die ihn umgab. Ihre Motivation war eine Mischung aus dem brennenden Wunsch, an einer potenziell bahnbrechenden Entdeckung beteiligt zu sein, einer tiefen Loyalität zu dem Mann, der es wagte, das Undenkbare zu denken, und einer eigenen, starken ethischen Überzeugung, dass das Potenzial dieses Projekts, wenn es denn gelänge, die Mühe und das Risiko wert war.
Emily Garcon war nicht nur eine Assistentin. Sie war eine Verbündete. Und Hannes Lofa wusste, dass er ohne sie vielleicht schon längst aufgegeben hätte. Mit ihr jedoch schien das Unmögliche plötzlich ein klein wenig erreichbarer.
Kapitel 3: Das kosmische Nadelöhr
Die anfängliche Euphorie über Emilys unerwartete und kompetente Unterstützung wich schnell der ernüchternden Realität der vor ihnen liegenden Aufgabe. In Hannes’ kleinem Labor, das eher einer vollgestopften Garage als einem sterilen Forschungstrakt der TUM ähnelte, umgeben von surrenden Prototypen und Whiteboards, die mit Gleichungen übersät waren, vertieften sie sich in das Kernproblem: die Definition einer „universellen Adresse“. Es war ein Problem von so gewaltiger Komplexität, dass es die Grenzen des bisher Gedachten sprengte.
„Es reicht nicht, einen Punkt im Raum zu definieren“, erklärte Hannes, während er mit einem Stift energisch auf eine komplexe Darstellung des Sonnensystems auf einem seiner Whiteboards deutete. „Wir sprechen hier von einer Koordinate, die über Tausende, vielleicht Zehntausende von Jahren hinweg absolut stabil und eindeutig identifizierbar sein muss. Ein kosmisches Nadelöhr, durch das die Zukunft uns ein Signal, ein Artefakt, schicken kann.“
Emily nickte langsam, ihr Blick auf die sich drehenden Planetenbahnen gerichtet. „Die Erde rotiert. Sie umkreist die Sonne. Unser Sonnensystem bewegt sich durch die Milchstraße, die wiederum Teil des Virgo-Superhaufens ist und sich ebenfalls bewegt. Jede Koordinate, die wir heute definieren, ist morgen schon Makulatur, kosmisch gesehen.“
Ihre Tage und oft auch Nächte wurden zu einem intellektuellen Marathon. Sie wälzten Fachliteratur über Astrophysik, Kosmologie und Himmelsmechanik. Die Wände von Hannes’ Labor verwandelten sich in ein Labyrinth aus Diagrammen, die verschiedene Koordinatensysteme darstellten: äquatoriale, ekliptikale, galaktische und supergalaktische Koordinaten. Jedes System hatte seine Vor- und Nachteile, aber keines bot die benötigte Langzeitstabilität.
„Das Internationale Himmelsreferenzsystem, das ICRS“, murmelte Emily eines späten Abends, die Augenringe dunkel unter ihren sonst so wachen Augen, „basiert auf der Position von über zweihundert extragalaktischen Radioquellen, meist Quasaren. Das ist das Stabilste, was wir derzeit haben.“
Hannes rieb sich müde die Schläfen. „Selbst die scheinbar festen Positionen von Quasaren unterliegen über kosmische Zeiträume hinweg minimalen Eigenbewegungen. Und dann ist da die Präzession der Erdachse, die Nutation… jede noch so kleine Abweichung potenziert sich über die Jahrtausende zu einer gewaltigen Unsicherheit. Wir würden ein Scheunentor anpeilen und bestenfalls einen Stecknadelkopf treffen – oder eher gar nichts.“
Sie diskutierten die Möglichkeit, Lagrange-Punkte im Sonnensystem als Referenz zu nutzen – jene gravitativ stabilen Punkte, an denen sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde aufheben. Aber auch diese waren nicht absolut fix, sondern drifteten mit dem System. Der Forschungsreaktor FRM II auf dem Garchinger Campus, dessen Neutronenquelle für Präzisionsmessungen in vielen Forschungsbereichen genutzt wurde, stand wie ein stummer Mahner für die Notwendigkeit höchster Genauigkeit im Hintergrund ihrer Überlegungen, doch die Skalen, um die es hier ging, waren ungleich größer.
Manchmal schien die Aufgabe schier unlösbar. Die Frustration war greifbar. Es gab Tage, an denen sie kaum ein Wort miteinander wechselten, jeder in seinen eigenen komplexen Berechnungen und Simulationen versunken, die Emily auf den Hochleistungsrechnern der Fakultät laufen ließ. Die Visualisierungen, die sie erstellte, zeigten oft nur das Ausmaß des Problems: chaotische Bahnen, Fehlerbereiche, die sich wie riesige Blasen im virtuellen Raum ausdehnten.
„Was ist mit der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung?“, warf Hannes eines Nachmittags in den Raum, als sie gerade eine weitere Sackgasse erreicht hatten. „Der CMB ist das älteste Licht im Universum, ein nahezu perfekter isotroper Hintergrund. Könnten wir dessen Dipolanisotropie, verursacht durch die Bewegung unseres lokalen Systems relativ zum CMB, als eine Art absoluten Geschwindigkeitsvektor nutzen, um unsere Position zu triangulieren?“
Emily runzelte die Stirn. „Die Messung des CMB-Dipols ist extrem komplex und selbst von lokalen Vordergrundeffekten beeinflusst. Und die Interpretation der Daten für eine präzise Positionsbestimmung über so lange Zeiträume…“ Sie schüttelte den Kopf. „Die Fehlermargen wären immer noch enorm.“
Der wissenschaftliche Prozess war mühsam, ein ständiges Vorantasten, Irren und Neubewerten. Es gab keine einfachen Antworten, keine Abkürzungen. Jede scheinbar vielversprechende Idee wurde seziert, analysiert und meist wieder verworfen. Doch trotz der Rückschläge wuchs die kollaborative Dynamik zwischen Hannes und Emily. Sie stritten, diskutierten, forderten sich gegenseitig heraus, aber immer mit einem tiefen gegenseitigen Respekt. Emilys Fähigkeit, Hannes’ oft sprunghafte, intuitive Ideen in strenge mathematische Modelle und testbare Simulationen zu gießen, war von unschätzbarem Wert. Hannes wiederum erkannte in ihrer analytischen Schärfe und ihrer unermüdlichen Ausdauer den Schlüssel, um die theoretischen Klippen zu umschiffen.
Sie wussten, dass sie einen fundamentalen Durchbruch brauchten, einen „Heureka“-Moment, der über die bekannte Physik hinausging. Die Definition der universellen Adresse war nicht nur ein technisches Problem; es war eine Frage des Verständnisses der tiefsten Struktur von Raum und Zeit. Und während sie in den Tiefen der Kosmologie und der theoretischen Physik gruben, ahnten sie noch nicht, dass ihre Suche sie zu Erkenntnissen führen würde, die weitaus beunruhigender waren als die reine wissenschaftliche Herausforderung. Das kosmische Nadelöhr war schmaler und gefährlicher, als sie es sich je hätten vorstellen können.
Kapitel 4: Erste Schatten
Die intensive, fast fieberhafte Zusammenarbeit an der „universellen Adresse“ hatte Hannes und Emily für eine Weile von der Außenwelt abgeschirmt. Doch die Gänge der Physikfakultät der TUM Garching hatten Ohren, und das Flüstern begann. Zuerst waren es nur vereinzelte spöttische Bemerkungen über „Lofas Zeitmaschine“ oder seine „kosmischen Spinnereien“, die Emily in der Mensa oder auf den Fluren aufschnappte. Doch bald nahmen die Gerüchte eine schärfere, gehässigere Note an.
Professor Dr. Alarich Kessler, der Hannes bereits im Hörsaal öffentlich desavouiert hatte, schien eine besondere Genugtuung darin zu finden, Lofas Arbeit bei jeder Gelegenheit ins Lächerliche zu ziehen. Bei einer Fakultätssitzung, zu der auch einige Doktorandenvertreter, darunter Emily, geladen waren, nutzte er eine Diskussion über die Vergabe von Forschungsmitteln, um eine Spitze gegen Hannes loszulassen.
„Wir müssen sicherstellen, dass die Reputation unserer Fakultät und die hart erarbeiteten Forschungsgelder nicht für Projekte verschwendet werden, die, sagen wir, eher in den Bereich der spekulativen Fiktion als der seriösen Wissenschaft gehören“, erklärte Kessler mit einem süffisanten Lächeln in Richtung des Dekans, wohl wissend, dass Hannes nicht anwesend war, um sich zu verteidigen.