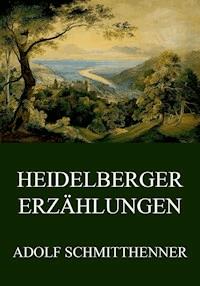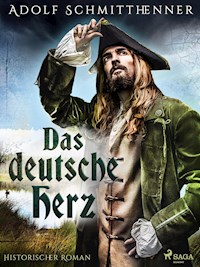
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman, der zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges spielt: Friedrich von Hirschhorn ist zwar Lutheraner, spricht sich aber dennoch vehement für religiöse Toleranz und gegen die Religionskriege aus. Doch sein idealistischer und nach Ruhm strebender Sohn lässt sich davon nicht beirren und zieht in den Krieg...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adolf Schmitthenner
Das deutsche Herz
Saga
Das deutsche HerzCoverbild/Illustration: Sutterstock Copyright © 1908, 2020 Adolf Schmitthenner und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726642926
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
ERSTER TEIL
1
Aus dem weiten und warmen Busen des Schwabenlandes rauscht der Neckar dem Odenwald zu. Er verschmäht es, durch die niedrigen Hügel des Kraichgaues zu brechen; er will seine Kraft an den Lenden eines Gebirges erproben. Oder es geht ihm wie einem verwöhnten Muttersohn: es ist ihm zu wohl geworden im bequemen schwäbischen Bürgerhaus, er will ein wenig auf Ritterschaft in die Büsche hinein.
Was nun auch der Grund sei, eigensinnig hält er die Richtung nach Norden fest und bohrt sich ins Gebirge hinein, wo es am höchsten emporsteigt. „Dort ist der Rhein!“ spricht zu ihm der Katzenbuckel und drückt ihn links hinüber. Und nun ist es, wie wenn des unschierigen Mahners Rippenstoß das Gewissen des träumenden Burschen geweckt hätte. Ungestüm und doch mit der Hoheit, die dem deutschen Strome ziemt, bricht er sich nach Westen die Bahn. Leidenschaftliche Sehnsucht gibt ihm die Kraft, die Felsen auseinander zu schieben oder zu durchbrechen und das Gebirge zu zerteilen bis auf den Grund. Und doch tut er zuweilen wieder, wie wenn er sich nicht trennen könnte von diesen grünen, runden Bergen; er schmiegt sich daran fest und hält sie umschlungen mit seinem glänzenden Arm, also daß, wohin auch der Abhang sich senke, des Neckars Woge zu ihm aufrauscht. Strom und Gebirge rüsten sich zum Abschied. Es wird ihnen feierlich zumute, und die große Empfindung gibt ihnen ein erhabenes Ansehen. Stolzer steigen die Berge empor, näher rücken sie an den Strom heran, höher schäumt die Woge, majestätischer blinkt die gleitende Flut. Der Neckar und der Odenwald halten Abschied. Wie eine entfesselte Schlange schießt der Fluß in die Ebene hinaus, genießt der Freiheit in weitem, wohligem Bogen, und dann streckt er sich dem blinkenden Rheine entgegen. Das Gebirge aber reckt sich und schaut dem enteilenden Freunde nach mit einem langen, stillen Blick. —
Über dreihundert Jahre sind vergangen seit dem Tag, wo unsere Geschichte anfängt. Am Fuße des Königsstuhles rauschte der Neckar lauter, als er heute rauscht, denn man war den Granitblöcken, die im Strombett liegen, noch nicht mit Pulver und Dynamit zu Leibe gegangen. Viel mehr Waldvögelchen als heute netzten ihre Schnäbel im Neckarwasser, denn man hatte die Ufer des Flusses und der Seitenbäche noch nicht von dem tausendfältigen Buschwerk gesäubert und ieß die lieben Hecken wachsen, wo sie wachsen wollten. Die Reiher im Reiherwald hatten herrliche Tage, denn den Junkern war die Falkenjagd abhanden gekommen und der Neckar wimmelte von Fischen. Oh, wie es in einer lauen Sommernacht unter dem Ersheimer Kirchlein schnalzte! Die Fische waren wie trunken vom Mondenlicht. Zuweilen klang es plump und grob vom Neckar her, wie wenn ein Pfundstein ins Wasser fiele. Das war ein alter Hecht, der ein Maulvoll Sommernachtlicht geschnappt hatte, oder ein würdevoller Salm, der bei sich dachte: ‚Ich komme auf des Junkers Tisch, das ist mein verbrieftes Recht‘, und bei diesem Selbstgespräch vor Hochmut durch die Luft sprang. Nachtigallenchöre sangen herüber und hinüber über den schimmernden Strom, und die Turteltäubchen gurrten aus dem Wald. Es ist keine Frage, bei Nacht war es damals schöner im Neckartal als heute. Bei Tag dagegen ist es heute lustiger. Noch nicht floß vor dreihundert Jahren der grüne tiefe Strom des Waldes von Berg zu Berg und ins Tal herunter bis zu den Neckarwiesen. Man wußte nicht, was man mit dem Holz anfangen sollte, und rodete sinnlos bald hier bald dort für ein paar Jahre; dann ließ man wieder die Buchen und Eichen hereinwachsen über den ausgeraubten Boden und fing wo anders an. So sah man rechts und links auf den Höhen nur dürftige Roggenfelder oder unerfreulichen Lausewald. Die Berge, worauf die Burgen liegen, waren völlig kahl, und die Schlösser, als sie noch ganz waren, sahen sehr weißgetüncht, nüchtern und behäbig aus, halb ritterlich, halb bäuerlich. Der Torwärtel saß in Schlappen auf dem Bänklein, sagte: „Hä!“ und aß ein dickes Käsebrot.
Die Dörfer und Städtlein, die heute im Neckartal liegen, waren damals schon alle miteinander da; ja noch einige Flecken und Weiler mehr, die in den späteren Kriegsläuften abhanden gekommen sind. Die Dörfer sahen ungefähr geradeso aus wie heute, nur gackerten viel mehr Hühner, und wenn man einen Bauern gefragt hätte, was ihm von der ganzen Welt das liebste sei, so hätte er gesagt: das Schwein und noch einmal das Schwein und zum drittenmal das Schwein. Oh, wie es so köstlich grunzte des Winters in den Ställen und des Sommers in lauschigen Talbuchten unter dem jungen Eichwald! Mit den Städtlein aber, wie Eberbach, Hirschhorn, Steinach, Gemünd, hatte es zu jener Zeit ein ganz andres Wesen als heute. Sie staken in Schanz und Wehr, waren von Mauern umgeben, hatten ein Neckartürlein, ein Bergpförtlein, ein Vordertor, ein Hintertor und ein Mitteltor. Auf den Wällen standen einige Katzenköpfe und andres grobes Geschütz. Es läutete sehr oft, bald dünn, bald dick, und jedermann wußte, was es bedeute. Des Morgens früh, ehe der Tag graute, mahnte die Betglocke: befehlet Leib und Seele dem Herrn und steiget flugs aus dem Bett! Des Abends in der lichten oder dunklen Dämmerung rief dieselbe Glocke die spielenden Kinder in die Häuser; auch die Knechte und Mägde kamen herein. Alle standen um Vater und Mutter herum und beteten der Reihe nach:
„Als unser Herr in Garten ging
und sein bitteres Leiden anfing.“
Des Morgens um elf Uhr rief ein helles, weit klingendes Glöcklein die Mähder und Holzfäller zum Mittagsmahl. Und dasselbe Glöcklein verkündete des Winters um drei und des Sommers um vier den bekümmerten Mägen rings in der Rund: jetzt gibt’s wieder etwas zu essen. Um neun oder um zehn Uhr des Abends läutete die Lumpenglocke, und der Schiffer Stapf zu Hirschhorn stülpte den Würfelbecher um und sagte: „Gute Nacht, Löwenwirt!“ Auch das Bürgerglöcklein hatte mancherlei zu sagen. Es rief die Mannsleut zur Frond oder die Schöffen zum Gericht. Mitunter gellte die Sturmglocke, dann rannten die Leute wie besessen auf die qualmende Gasse und schrien: „Wo, wo?“ Wenn aber die große Glocke mitläutete, dann ließen die Bürger alles stehen und liegen, sprangen in verteilter Ordnung an die Tore und verriegelten und verrammelten die eichenen Flügel. Mitunter kam auch das Armsünderglöcklein in Schwung. Dieses geschah jedesmal eine halbe Stunde später, als der Meister Henker mit seinem Knecht auf der Fähre über den Neckar gefahren war. Das Armsünderglöcklein läutete unterschiedlich lang. Wenn nichts als der Block und das lange Richtschwert auf dem Wägelein des Scharfrichters lag, war das Glöcklein bald zu Ende; wenn aber bei den übrigen Gerätschaften ein schweres eichenes Rad mit dicken Speichen über dem Wägelchen lag, dann läutete die Glocke lange, ach, furchtbar lange, es waren keine einzelnen Schläge mehr, sondern ein fortgehendes Heulen und Wimmern. Wenn es endlich aufgehört hatte, dann wurde dem Meister, wie es anders unbillig gewesen wäre, zu seinem höchsten Lohn noch ein starker Imbiß verehrt. Während nur die Armsünder auf dieses Glöcklein Anspruch erhoben, war die übrige Menschheit, mit Ausnahme derer, die sich selber aus dem Leben beförderten, mit der allgemeinen Totenglocke zufrieden. Diese Glocke läutete nach keiner irdischen Uhr, aber der, den sie meinte, war immer bereit; beim ersten Schlag machte er sich schleunig auf, und lang hingestreckt fuhr er über den Neckar, dem Ersheimer Friedhof zu.
So war das Neckartal zwar damals noch ohne die tausend Geräusche der heutigen Zeit. Kein Dampfschlepper brüllte, keine Lokomotive pfiff, kein Güterzug polterte, kein Automobil blökte, kein Fahrrad klingelte, aber viel mannigfaltiger und eindringlicher redeten Glocke und Glöcklein in das Leben der Menschen hinein.
Wenn diese Leute einmal zu ernster Feier oder zu Spiel und Scherz beieinander waren, wie sah die Versammlung doch so stattlich aus! Die kurzen, stämmigen Bauern in Wams und Lederkappe, die Bürger in ihren pelzverbrämten Röcken und kübelartigen Pelzmützen, die man für wunderschön hielt, weil die Tracht von weither kam; sie kam aus dem Lande der wilden Kroaten, von denen man aus den Türkenkriegen her viel erzählte. Die Junker gingen im Barett und im bequemen Flaus oder im engen, düsteren spanischen Gewand, worinnen man wohl oder übel steif und gemessen wandeln mußte. Malerisch sahen die Soldaten aus, die Landsknechte und Reiter, in Blechhaube, Harnisch und hellgelben Schlappstiefeln oder im buntfarbigen Rock, Pluderhose und breitem, verwegenen Filzhut. Wärest du mit dabei gewesen auf einer Kirchweih in Gerach oder auf dem Jahrmarkt in Hirschhorn, nach einer Weile hättest du gemerkt, daß die Leute kein Kauderwelsch reden, sondern Deutsch, und hättest sie auch bald fast ganz verstanden und hättest dich gefreut, wie sie so frisch und kernig und lustig drauflos redeten, sangen und lachten. Auch hättest du manch ein Mägdlein und manch eine Ehefrau gesehen, die dir herzlich Wohlgefallen hätte, und nicht allein dir, sondern auch deinem Herrn Bruder und vielleicht sogar deinem eigenen Schatz. Die Kinder glichen den heutigen am meisten. Sie aßen gerne Äpfel und hatten nichts dagegen einzuwenden, wenn der Lehrer auch einmal außer der Reihe Ferien gab. Ein schönes Leben hatten die Kinder. Denn so bucklig und verschunden die Landstraßen waren, so waren sie doch viel reicher an buntem Leben und Treiben, an Sang und Klang, freilich auch an Seufzen und Wehklagen, als sie heute sind. Täglich gab es irgend etwas Herrliches, Fremdartiges, Rauschendes oder Klirrendes zu sehen, was die Straße gesprengt oder getrabt oder gefahren oder gewandert kam. Die heutigen Kinder des Neckartals wären aus dem Gaffen gar nicht herausgekommen. Wären sie und ihre Kameraden von damals sich gegenübergestanden, so hätten sie sich freilich verwundert angeschaut und hätten zueinander gesagt: ihr seid einmal sonderbar ausstaffiert! Hätten sich aber beide Parteien in holder Nacktheit in ihr eigentliches Element, in den Neckar, gestürzt und hätten sich darinnen getummelt wie die Fische, so hätte man die Knaben von damals und von heute nicht voneinander unterscheiden können: dieselben rosigen Gesichter und die gleichen flachsgelben Haare, vor allem aber die nämliche kurze stumpige Gestalt, weshalb ja auch die Burschen aus dem Neckartal zu Mannheim und zu Worms in der zwölften Kompanie standen, bei den „Mündungsdeckeln“, während sie damals von den hochgewachsenen Leuten der Ebene die „Grampen“ genannt wurden. Sie selbst aber bezeichneten sich mit Stolz als „Neckarschleim“, und ein Zimmergesell aus Heidelberg hatte ein neu Lied gedichtet, dessen Kehrreim lautete:
„Wir sind ein jung frisch Neckarschleimer Blut,
Neckarschleimer Blut.“
Wenn nun wir Leute vom heutigen Tag in das Wesen und Treiben der Neckarschleimer vor dreihundert Jahren hineinschauen, müssen wir einmal übers andre Mal den Kopf schütteln und sagen: „Allhier geht’s wunderlich zu.“ Wenn ein Rechtsbeflissener alles, was gültig und Rechtens war in Stadt und Dorf, in Weiler und Mühle, in Burg und Stift, schwarz auf weiß in Lehensbriefen, Pfandscheinen, Schenkungsurkunden, Zinstabellen und Zehntbeschreibungen hätte sammeln wollen, er hätte mit einem vierspännigen Planwagen fahren müssen, um all das Papier und Pergament mitzunehmen, und wenn einer in einem kleinen Dörflein wie in Mückenloch oder in Igelsbach von Haus zu Haus und von Mensch zu Mensch gefragt hätte, wer alles an den Gefällen, an den Gilten, Zehnten und Frondrechten Anteil habe, er wäre verrückt geworden, noch ehe er zum halben Dorf draußen gewesen wäre. Aus all dem kunterbunten Zeug der siebenundvierzig und dreiviertel Herrschaften, die sich in Recht und Macht teilten, wären doch schließlich zwei als die vornehmsten herausgetreten, das Kurstift Mainz und die Kurpfalz, und unter den einzelnen Herren, deren Hände zu füllen waren, wäre keiner häufiger genannt worden als der Junker von Hirschhorn. Hätte man irgendwelchen Juden oder Müller oder Schiffmann oder Bauern oder Knecht gefragt: was hast du dem Junker von Hirschhorn zu leisten, so hätte unter zehnen kaum einer gesagt: nichts; die andern alle hätten etwas zu nennen gehabt, sei es sieben Batzen oder zwei Sester Korn auf Martini oder einen Hahnen auf Ostern oder einen Brotkuchen auf den Stephanstag. Und hätte man verwundert gesagt: Muß doch ein reicher Herr sein, der Junker von Hirschhorn, so hätte der Jude gerufen: „Reich? Grausam reich! Allen hohen Herren hat er Geld geliehen.“ Der Müller aber hätte gesagt: „Hundert Dörfer sind sein eigen, und der Erzbischof von Mainz, sein Lehensherr, hat ihm zu Ladenburg einen Kuß gegeben, obgleich der Junker lutherisch ist.“
Das war damals allerdings ein großes Stück, denn die Religionen standen sich damals in Deutschland feindselig gegenüber. Im südlichen Odenwald jedoch ging es auch in Glaubenssachen so buntscheckig wie möglich zu. Wenn einer ein Pferd von mäßiger Gangart hatte, so konnte er an dutiem Tag katholisch frühstücken, lutherisch zu Mittag essen und auf reformiert den Abendimbiß einnehmen.
Ja, es ging wunderlich zu bei den alten Neckarschleimern.
Aber die liebe Sonne schien damals in den Tagen, die die längsten sind, geradeso lieb und warm, wie sie uns geschienen hat an dem letzten längsten Tag, den wir verlebt haben. Und die Haselstaude hatte damals geradeso weiche grüne Blätter, wie die waren, die wir im letzten Juni durch die Finger gleiten ließen. Und es gibt heute keinen spitzbübischeren und abgefeimteren Fuchs im ganzen Odenwald, als es der alte Fuchs war, der damals am Johannistage im hellen Sonnenschein vor der Haselstaude lag, sich den Bart leckte und seinen beiden hoffnungsvollen Knaben vergnüglich zublinzelte. Die kleinen Füchslein spielten vor ihrem Vater auf einer Waldblöße, bis sie müde waren, dann legten sie sich dem Alten zwischen die Pfoten und baten ihn: „Erzähle uns etwas.“
„Heute hat der Junker Hochzeit“, antwortete der Alte.
„Wie ist denn das, wenn man Hochzeit macht?“, fragte der jüngste der beiden Buben und drückte die Augen geradeso pfiffig zu wie sein Vater.
„Das verstehst du nicht, du bist noch zu jung“, erwiderte der Vater.
„Kriegen wir auch etwas von der Hochzeit?“, fragte das andre Füchslein.
„Ja, Hasenbraten.“
„Wieso, liebster Vater?“
„Der Junker hat auf Hirschhorn fünf Forstwärtel, die haben heut und morgen fünf große Räusche. Er hat auf der Burg fünfundzwanzig Hetzhunde, die haben heut und morgen vielhundert Knochen zu beißen. Der Junker selber denkt nicht ans Jagen, wohl vierzehn Tage nicht. Wenn er zum erstenmal wieder herauskommt in den Wald, nimmt er keine Hunde mit, sondern seine schöne junge Frau.“
„Wie heißt sie denn?“ fragte der älteste Sohn.
Der Vater besann sich eine Weile und sprach: „Sie heißt Fuchsia.“
„Das ist ein schöner Name, Vater.“
„Freilich. Wenn er zum erstenmal hier herauskommt, geht die liebliche Fuchsia an seiner Seite. Da denkt er nicht ans Jagen. Folglich?“
Die beiden Knaben schwiegen.
„Folglich?“ wiederholte der Alte in strengem Ton.
„Folglich sind wir die Meister im Wald“, sagte der ältere Knabe.
„Ja“, bestätigte der Vater. „Und wir fangen fette junge Hasen.“
„Junge fette Hasen!“ lachte der Jüngste und schlug vor Vergnügen einen Purzelbaum.
In diesem Augenblick rief eine Menschenstimme: „Ein Fuchs!“
Im Nu waren der Vater und der älteste Sohn verschwunden. Der jüngste aber überschlug sich und fiel einem blondlockigen Knaben in die Arme. Der hielt das Füchslein lachend an den Ohren fest. Das Kerlchen wehrte sich, warf sein Unterkörperchen hin und wider und biß um sich, daß es eine Lust war. Endlich fing es in der Todesangst zu hofieren an. Der blonde Knabe erschrak, aber blitzschnell drehte er das Tierlein um, so daß es vorwärts schaute, und hielt es mit gestreckten Armen von sich. Steif und still hing es da und vollendete sein Geschäftchen so säuberlich und anständig, daß sich jedes Heddesbacher Büblein hätte ein Vorbild daran nehmen können. Dann fing das Bürschlein wieder zu zappeln und zu schnappen an, aber nimmer lang. Der Knabe warf das Tierchen über seinen blonden Kopf rückwarts in das Dickicht hinein, dann wandte er sich um und schaute mit blitzenden Augen den Weg, den er gekommen war, zurück ins Tal hinunter.
2
Während der alte Fuchs blinzelnd seinem Söhnlein zuhörte, das mit großen Gebärden von seiner Heldentat erzählte, vergoß einige hundert Schritt weiter oben der Brummbaß von Affolterbach dicke Schweißtropfen. Er blieb stehen, beugte sich vornüber und stemmte die Hände auf die Knie. Der Bauch der Baßgeige lag über seinem Kopf, und ihr Hals hob eine entwurzelte Hainbuche aus dem zerbröckelten Boden.
Die Viola, die mit langen, dünnen Beinen die Waldhalde heraufgestiegen kam, lachte aus vollem Hals und rief in die Büsche zurück: „Guckt einmal, was unser Brummbaß für Kunststücke macht!“
Der Brummbaß schielte zurück nach seinem Rücken und klagte: „Einen ganzen Wald schlepp’ ich den Berg hinauf. Ich sag’s ja immer, wo viel ist, will viel hin. Du, Posaune, wo ist denn die Burg?“
„Die Posaune ist nicht da.“
„Findebusch, Kind, wo ist denn die Burg?“
„Findebusch ist nicht da.“
„Wenn nur Findebusch da wäre, daß mir doch ein ehrlicher Mensch die Augen zudrückt. Wenn die Burg nicht gleich kommt, sterbe ich.“
„Meinst du denn, die Burg käme zu dir? Wenn du da stehen bleibst, muß der Junker seine Urschel ohne Brummbaß nehmen.“
Die gutmütige Viola trat heran und fing an, das Bäumchen aus den Saiten zu lösen.
„Schade!“ rief der Pfeifer herauf, der neben dem Geiger gemächlich hintennach stieg.
„Schade?“ greinte der Brummbaß und schaute erbost zurück. „Der sähe es gern, wenn ich unter einem Eichbaum läge.“
„Sag lieber: ‚Wenn ich an einem Eichbaum hinge!‘ Wo wir gehen und stehen, sollten wir einen Baum bei uns haben, damit sich jeder, der Lust hat, ohne Umstände aufhängen kann.“
Der Pfeifer hatte eine harte, barsche Stimme. Er schien der Oberste in der Gesellschaft zu sein.
Unterdessen hatte die Viola die Zweige zwischen den Saiten herausgehoben und legte das Bäumchen vorsichtig auf den Boden, wie wenn es ein totes Kind wäre. Dann trat der Geselle zu dem weiterkeuchenden Brummbaß, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: „Du, warum soll denn ich dir nicht einmal die Augen zudrücken?“
Der Brummbaß schaute den Frager erbost an.
„Du mir? Ich werde sie dir zudrücken, ob Gott will!“
Der Pfeifer und der Geiger waren nun herangekommen.
Die beiden andern blieben stehen und fragten eines Mundes: „Nichts?“
„Nichts!“ erwiderte der Pfeifer. „Sie muß doch auf dieser Seite liegen. Hätten die beiden andern sie gefunden, so hätten sie schon gerufen.“
„Findebusch und die Posaune, wo sind sie denn?“ fragte der Brummbaß.
„Ich habe sie rechts hinübergeschickt, Ausguck zu halten“, antwortete der Pfeifer und stieg rüstig aufwärts.
„Ich fürcht’, wir kriegen heute noch etwas aufs Dach“, meinte der Geiger. „Die Sonne sticht und es ist dunstig.“
„Und wenn es Katzen hagelt, wir müssen gleich nach Mitternacht abfahren, denn morgen früh um sechs Uhr müssen wir dem Zehntrechner in Kirchheim aufspielen.“
„Abfahren?“ fragte die Viola. „Schickt uns der Zehntrechner ein Wägelein?“
„Mit dem Schiff. Wir fahren den Neckar hinunter und wenn es donnert, daß dem Petrus die Schwarten krachen.“
„Wenn es donnert, kriech’ ich am liebsten in einen Kuhstall“, greinte der Brummbaß. „Beim unvernünftigen Vieh ist man am besten aufgehoben, denn das flucht nicht.“
„Warum müssen wir denn ums Verrecken morgen früh dem geizigen Zehntschreiber zum Kirchgang spielen? Hätt’ er nicht dem Federvieh absagen können? Bei des Junkers Hochzeit sollte man sich doch gründlich auslustieren, und jetzt müssen wir davon, wenn es am schönsten ist.“
Niemand gab der Viola Antwort. Der Brummbaß blieb ein wenig zurück und raunte dem Frager zu: „Er freit um des Zehntschreibers Schwester.“
Dabei winkte er mit dem Kopf nach dem Pfeifer hinüber, sah aber bei seinem scheelen Blick dabei aus wie ein stößiger Widder, verwickelte sich mit dem linken Fuß in eine Wurzel und fiel vornüber gestreckten Leibs in einen Haselbusch.
Der Geiger schaute zurück und lachte hellauf.
„Alles macht Hochzeit“, rief er. „Der Junker mit der Ursula, der Zehntschreiber mit der Urschel, der Buchbaum mit der Baßgeige, der Brummbaß mit der Hasel.“
„Und der besoffene Geiger mit dem Misthaufen!“ schrie der Brummbaß grimmig und rappelte sich mühselig auf. Die Viola half ihm dabei.
„Wenn nur der Findebusch da wäre!“ jammerte der Brummbaß.
„Ich helfe dir ja. Ist das nicht geholfen, wenn ich es tue?“
„Ach, wenn nur das Kind da wäre, damit ein Ehrenmann bezeugen kann, wie ich schwitze!“
Um den Brummbaß zu ärgern, fing der Geiger zu singen an:
„Am Himmel glänzt ein heller Stern,
Ju, ja, heller Stern,
Bei meinem Schatz da lieg’ ich gern,
Ju, ja —“
Wie’s Wetter war der Brummbaß bei dem Sänger, hielt ihm mit seiner breiten Tatze den Mund zu und rief in hellem Zorn:
„Schweig still, du wüster Igel! Sing deine Schandlieder auf dem Privet und halt dein Maul dazu! Du bist so voller Schweinerei, wie meine Geige voller Baß. Wenn nur ein Funke Gottesfurcht in dir wäre, müßtest du dich der Sünde fürchten, das Kind zu verderben. Das Kind! Wo bleibt es nur? Findebusch!“
„Dort kommt die Posaune“, rief die Viola. „Da ist die Trompete auch nicht weit. Wo ist Findebusch?“
„Nichts gesehen?“ fragte der Pfeifer den Heraufkletternden.
„Nichts! Die Burg muß hier oben sein.“
Dann wandte er sich der Viola zu und sagte: „Findebusch hat zu schaffen. Er hat ein Füchslein auf einen Ulmer Hafen gesetzt, und jetzt besieht er das Wasser.“
Die Posaune hatte sich zu den andern gesellt, und die fünf Männer gingen durch den Niederwald dem nahen Höhenrande zu.
Plötzlich blieben alle stehen wie auf einen Schlag.
„Was war das?“ fragte der Geiger.
„Wenn wir nicht mitten im Walde wären“, meinte die Posaune, „würde ich sagen, es sägt einer ein Brett.“
„Es war vielleicht ein Specht. Still!“
Man hörte wieder den singenden, knirschenden Ton, und ganz in der Nähe.
„Kein Zweifel“, sagte der Pfeifer. „Dort oben ist eine Säge und ein Brett.“
„Und eine Hobelbank und ein Schreiner“, fuhr die Posaune fort.
„Woher weißt du, daß es ein Mensch ist von Fleisch und Blut?“ sagte der Geiger ängstlich. „Vielleicht ist es der Lindenschmitt. Der geht um hierzuland.“
„Der Reitersknab’?“ antwortete die Viola. „Was hat das mit der Säge zu tun? Soeben fallen die Bretter, hört ihr nicht?“
„Gehen wir drauflos“, entschied der Pfeifer, und die Männer stiegen in einer Reihe den letzten Rain hinauf.
„Wäre nur das Kind da!“ klagte der Brummbaß. „Vor dem Findebusch weicht jeder Spuk.“
„Was er wohl machen mag?“ fragte der Geiger, der wieder Mut bekommen hatte. Er gab sich selbst die Antwort. „Was anders als ein Ehebett, oder gar eine Wiege, oder — oh, ich weiß —“. Er brach in ein wieherndes Gelächter aus. „Er macht — einen —“
Sein Einfall erstickte ihn fast durch den Haufen Gelächter, worin er sich wickelte.
„So hör doch auf und sag’s!“ rief die Posaune.
„Er macht — einen —“
Eine neue Flut kreischenden Gekichers.
Die andern waren auf die Höhe getreten und standen still und unbeweglich.
Jetzt kam auch der lachende Geiger nach. Auch er verstummte. Sein freches Gesicht wurde bleich. Seine Augen wurden groß und größer und bekamen einen angstvollen Schein. „Er macht einen Sarg“, sagte er leise.
Die Männer standen am Rande einer weiten Lichtung, die sich, an den Seiten und im Rücken von Hochwald umgeben, über den Kamm des Höhenzuges hinzog. Auf dem mit Waldgras überwachsenen Boden standen einzelne hohe Föhren. Unter der nächsten und größten war eine Hobelbank zu sehen. Auf ihr und um sie herum standen und lagen alle möglichen Werkzeuge und Gerätschaften der Schreinerei. Mehrere zurechtgesägte Bretter lagen auf dem Boden, hinter dem Baum lehnte ein Bord am Stamm, noch in seiner ganzen Länge, mit rindigem Rand. Weiter vorn aber, dicht vor den Musikanten, lag Sarg an Sarg im hohen Gras.
Als die Männer auf die Höhe traten, wurde gerade das Bord vom Boden gehoben, leicht, als ob es ein Pfahl wäre, auf eine schlanke Schulter geworfen, über die Hobelbank gelegt, und eine jugendliche Gestalt beugte sich darüber, setzte die Säge mit Sorgfalt an und sägte. Die wirren blonden Haare fielen über die Stirn in das Gesicht hinein und bedeckten es, so daß nur die bleichgelbe und magere Wange zu sehen war. Vom Hals bis zu den bloßen Füßen hing ein langer, weiter Rock herunter, der mit mehr denn hundert Stücken von allerhand Tuch überflickt und aufeinander gesetzt war. Anstatt des Gürtels war ihm ein Strick um den Leib geschlungen.
Der wunderliche Mensch verwandte keinen Blick von der Arbeit, und wenn er nicht taub und blind war für die ganze Welt, die außerhalb seiner Arbeit lag, so wollte er es wenigstens für die Fremdlinge sein, die da standen und ihn angafften.
„Wie hast du denn die Hobelbank heraufgebracht mitten in den Wald?“ fragte der Geiger.
Der Brummbaß warf dem albernen Gesellen einen zornigen Blick zu; aber es wäre unnötig gewesen, denn der Einsiedler sägte zu und gab keine Antwort.
„Wieviel Särge machst du denn?“ fragte der Fant weiter.
„Wieviel Leute seid ihr denn?“ erwiderte der Jüngling und hielt im Sägen inne.
Er sah langsam auf und zählte: „Eins, zwei, drei, vier, fünf —“
„Nein, sechse!“ rief eine helle Stimme, und ein blondgelockter Knabe tauchte aus dem Gebüsch.
Der Einsiedler sah den zuletzt Gekommenen scharf an und sagte: „Sechs Särge mache ich.“
Er schaute wieder auf das Brett und zog die Säge an, aber nach dem ersten Strich hielt er inne, und sein düsterer Blick, wie wenn er etwas vergessen hätte, hob sich wieder zu dem Rufer von vorhin.
Es war auch ein wonniges Ding, in das feine, offene frauenhaft schöne Gesicht zu schauen. Ein wundersamer Reiz war darüber ausgebreitet, aber man mußte oft hinschauen, bis man sich über den Grund Rechenschaft geben konnte.
Findebusch hatte die Arme übereinander geschlagen und sah verwundert drein, wie die andern getan hatten. Bei diesen war der Bann des Staunens einer unruhigen Neugier gewichen, bei dem Geiger seiner fahrigen Frechheit.
„Sechs Särge! Dann reicht es ja gerade für uns!“ rief er lachend. „Wir wollen doch sehen, ob sie uns angemessen sind.“
Und er sprang mit gleichen Füßen in eine der offenen Grabkisten und streckte sich der Länge nach aus.
„Den Deckel darauf, daß wir ihn nimmer sehen, den Schandbuben!“ rief der Brummbaß.
Was er im Zorn meinte, meinten die Posaune und der Pfeifer im Scherz. Sie holten den Sargdeckel und stülpten ihn darüber. Der darinnen lag, war still und regte sich nicht.
Niemand lachte. Die beiden Gesellen schämten sich des mißlungenen Spaßes. Der Pfeifer trat hinweg und ließ den andern hantieren. Der hob leise den Deckel auf und ließ ihn ins Gras fallen. Jetzt erhob sich auch der Geiger, half sich auf die Beine und stieg vorsichtig aus dem Sarg. Er war weiß wie ein Handtuch und schlotterte an allen Gliedern. Er versuchte zu lachen, aber es gelang ihm nicht; er trat blöd und verlegen auf die Seite und stand da wie ein nasser, frierender Hund.
Der Sargmacher hatte unterdessen weitergearbeitet, wie wenn er allein wäre. Die Frage der Posaune, wo die Burg läge und wie weit es noch bis dorthin wäre, hatte er überhört oder keiner Antwort gewürdigt.
„Hier liegt sie ja!“ rief Findebusch.
Er war auf einen geglätteten Baumstumpf gestiegen, so daß er eines Hauptes größer war als die andern.
„Ihr braucht nicht hierherzukommen. Dort, wo der Geiger steht, wenn ihr ein paar Schritte weiter vorgeht, müßt ihr sie sehen. Wahrhaftig, ein stolzes Schloß! Was für ein mächtiger Turm! Und unten glänzt der Neckar. Oh, ist die Welt hier so schön!“
Findebuschs Zuruf machte die müde und verstörte Gesellschaft wieder lebendig. Alle waren froh, den düsteren Eindruck abschütteln zu können, und zeigten sich doppelt lustig. Der Brummbaß, der auf einem in die Quere liegenden Baumstamm ausruhte, schlug sich vergnügt auf die Schenkel, und der Pfeifer, der Grund haben mochte, den liederlichen Geiger bei der Gesellschaft zu halten, trat zu diesem hin und reichte ihm die Branntweinflasche.
Findebusch aber stand noch immer auf seinem Schemel und schaute barhäuptig in das Land hinaus.
Sein Gesicht war der vollen Sonne dargeboten. Geradeso schien das erleuchtende Himmelsgestirn mit breitem Schein in das Antlitz des Eremiten, der ein eisernes Winkelmaß hinter sich auf den Baumstumpf gelegt hatte, auf dem Findebusch stand, und jetzt nach der Säge griff und ihre Schneide fester schraubte. Findebusch ragte dicht hinter dem Siedler in die Höhe, und sein glattes Kinn berührte fast die dunkelblonden Locken des Waldschreiners.
Auf seinen Zuruf: „Dort ist die Burg!“ hatten für einen Augenblick alle zu ihm hingesehen, der Brummbaß mit einem verklärten Blick. Während aber jetzt die andern vorgetreten waren, um behaglich das Tal und die Burg und das Städtlein zu beschauen, ging die Viola alsbald wieder zurück, und wie wenn seine Augen etwas verabsäumt hätten, schaute er alsbald wieder den einen Kopf und den andern an, und so oft ihn auch die Gesellen durch Frage oder Zuruf oder eine Bemerkung in Anspruch nahmen, kehrte sein Blick immer wieder zu dem Geschäfte zurück, die beiden Gesichter zu besehen und zu vergleichen.
Plötzlich rief er: „Hast du einen Bruder, Trompeter?“
Der Knabe griff an sein Instrument.
„Viele, viele! Alle, die lieber blasen als sägen, und lieber küssen als essen, und lieber schlemmen als sparen!“
„Was er großtut“, sagte der Brummbaß, „und ist doch der einzige unter uns, der noch nie einen Rausch gehabt und ein Mädel geküßt hat!“
Er kam herbei und hängte sich mit einem Seufzer die Baßgeige über den Rücken.
Die Viola schaute noch einmal prüfend die beiden Gesichter an, schüttelte den Kopf und sagte: „Unter all deinen Blasbrüdern sieht dir keiner so ähnlich wie hier der Sargbruder. Schaut nur einmal her, ihr andern!“
Sie sahen die beiden Jünglinge an, und einer wie der andere staunte über die Ähnlichkeit. Was die häßliche Kutte um den Nacken und an den Handknöcheln von den Gliedmaßen sehen ließ, verriet einen schlanken Leib und einen zarten, feinen Bau. Er mochte etwa fünfundzwanzig Jahre alt sein oder anfangs der zwanziger stehen, denn das Kleid und der düstere Blick waren über die Jahre, auf die sein glattes Gesicht schließen ließ. Wenn auch die Züge schärfer, spitzer und ernster waren als in dem lachenden, vollen Antlitz des Knaben, so zeigten sie doch denselben Schnitt von der hohen freien Stirn an bis zu dem weichen Kinn, worinnen weder bei dem einen noch bei dem andern das Grübchen fehlte. Vor allem fiel bei dem ersten Blick in jedem der beiden Gesichter das Auge auf, und wenn man sie verglich, hätte man sich die Augen und ihre Umgebung vertauscht denken können, ohne daß die beiden Menschen anders geworden wären: dasselbe Leuchten aus der Hefe, dieselbe unbestimmbare Farbe, bald tiefblau, bald schwarz, bald golden, dieselbe steile, zarte Nasenwand und vor allem die gleichen schwarzen, scharfgezeichneten, edelgeschwungenen Brauen.
Der Einsiedler hatte sich aufgerichtet, die Säge aus der Hand gelegt und sich langsam umgedreht. Und dann betrachteten sich die beiden.
„Ich hatte nie einen Bruder“, sagte der Waldschreiner, „aber ein Schwesterlein.“ Nach einer Weile fügte er hinzu im Tone einer klagenden Litanei: „Ich hatte einen Vater und eine Mutter.“
„Ei, wie merkwürdig!“ rief der Geiger, der sich wieder ins Ansehen setzen wollte. „Findebusch, merke wohl auf: der Vater hat ihn gezeugt und die Mutter hat ihn geboren.“
„Ich schlag’ dir mein Instrument um die Ohren! Lieber komm’ ich aufs Rad, als daß du Igel mir das Kind verdirbst!“ Brummbaß hob drohend die Baßgeige.
„Laß nur liegen“, begütigte der Knabe. „Ich trag’ sie dir vollends bis zur Burg. Geh nur mit den andern voraus, ich folge euch sofort nach.“
Der Pfeifer hatte das Zeichen zum Aufbruch gegeben und war mit langen Schritten den hohen Tannen zugegangen. Der Geiger und die Posaune folgten ihm auf dem Fuße nach. Die Viola wartete auf den Brummbaß, der sein Instrument abnahm, die Riemen kürzer schnallte und sich dann, der fortweisenden Gebärde des Knaben gehorsam, wankend und trippelnd auf den Weg machte. Findebusch blieb allein zurück.
Er hängte sich die Baßgeige um die Schulter. Dann eilte er auf den Einsiedler zu, ergriff seine Hand und sagte: „Sargbruder, ade!“
Der andere legte die Säge hin, zog den Knaben an seine Brust und flüsterte: „Noch nie hatt’ ich jemand so lieb wie dich!“
Er bückte sich, griff unter die Hobelbank und holte ein kleines Sträußchen roter Blüten vom Boden. Die kurzen Stiele waren mit einer Binse zusammengebunden.
„Da nimm! Steck es an! Verlier es nicht! Es sind Donnerblumen. Sie schützen im Wetter.“
Findebusch steckte sich das Sträußchen in den Wams.
„Ich kann dir nichts geben als meine Fuchsmütze.“
Er stülpte sie ihm über die wirren Locken.
„Nimm sie nur! Die Posaune macht mir eine andre, sie versteht sich darauf. — Du, warum machst du so viele Särge? Ist bei euch eine Seuche?“
„Ich mache Särge“ — der Einsiedler hielt den Knaben an die Brust gepreßt und flüsterte: „Bis ich meiner Mutter Grab gefunden habe.“ — Mit lauter Stimme fuhr er fort: „Dann mache ich Kreuze, nichts als Kreuze.“
„Auch ich kenne meiner Eltern Grab nicht“, sagte Findebusch fröhlich. „Aber das kümmert mich nicht. Springt mir ein Fuchs in die Arme, dann denke ich, den schickt mir mein Vater aus dem Grab, und streichelt mir ein Haselbusch die Wange, dann denke ich, der ist aus meiner Mutter Grab gewachsen. Darum ist mir so wohl in der ganzen Welt.“
„Versprich mir eins, Bruder Findebusch! Wenn du drüben bist im Schloß, dann blase ein Sterbelied!“
„Du bist nicht gescheit! Für wen denn?“
„Für meine Mutter. Die ist drinnen in der Burg irgendwo verscharrt und vermodert.“
„Was soll da das Sterbelied? Sie feiern Hochzeit dort drüben.“
„Aber sie hat noch kein Grablied bekommen. Den ärmsten Leuten und den Fahrenden und Gerichteten wird eines gesungen. Den Selbstmördern nicht; aber sie hat sich nicht selber umgebracht. Nein, du —“
Er schüttelte den Knaben an den Schultern und raunte: „Ich weiß, man hat sie schmählich gemordet.“
„Wer? Der Junker?“
„Der nicht; er war damals zwölf Jahre alt. Aber dabeigewesen ist er und weiß ihr Grab.“
„Warum fragst du ihn nicht?“ — „Er schweigt.“ — „Und die andern?“
„Die es getan haben, leben nimmer. Sie sind ertrunken, haben den Hals gebrochen, die Pest hat sie gefressen. Keiner hat im Frieden die Augen geschlossen und keiner in der Burg ihres Geschlechtes. Ich habe allen die Särge gemacht und habe in jeden einen Fluch gelegt. Aber gesungen hat man ihnen doch drüben in der Ersheimer Kirche. Nur meiner Mutter, meiner Mutter ist nicht gesungen worden. Drum blase du ihr heute nacht auf des Junkers Hochzeit ein Grablied.“
Findebusch machte sich aus den Armen des Einsiedlers los, reichte dem Gesellen die Hand und sah ihm treuherzig in die Augen.
„Versprechen will ich dir es nicht. Aber wenn ich es tun kann, dann vollbringe ich’s und blase mitten hinein in den Tanzreigen der andern:
‚Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod!‘“
Die beiden umarmten sich in urplötzlicher Bewegung. Und wie sie nun schieden, da war es, als ob zwei Brüder voneinander gingen.
Findebusch sprang seinen Gesellen nach. Hinter einem Busch stand der Brummbaß und wartete. Er warf einen mißtrauischen Blick nach der Richtung, woher die Säge des Einsiedlers schrillte, und fragte seinen Liebling:
„Willst du mich verlassen, Kind?“
Im nächsten Augenblick hing Findebusch an dem Hals des alten Mannes und bedeckte dessen Brust mit seinen Tränen.
Der neigte seinen Kopf und lauschte, denn es war, als ob der Knabe schluchzend etwas sage.
„Ich habe dich nicht verstanden.“
„Wie plötzlich, ach, und wie behende
Kann kommen meine Todesnot.“
Der Brummbaß schüttelte den Kopf, hob das Gesicht von seiner Brust hinweg und in die Höhe und sah dem Knaben eindringlich in die Augen.
„Willst du mich verlassen, Kind?“
„Nie“, flüsterte der Knabe. „Ich bleibe bei dir bis in den Tod.“
Und nun eilten die beiden, ohne ein weiteres Wort zu wechseln, dem Hochwalde zu. Als sie ihn erreicht hatten, sahen sie das Goldblech der Posaune links unter sich durch die Büsche blitzen.
Der Einsiedler aber arbeitete, ohne aufzusehen, Stunde um Stunde, bis der Mond über den Berg gestiegen war, und vollendete den sechsten Sarg.
Der Mond schien bleich und verschleiert aus einem tiefen Dunsthof. Der Tag war düster erloschen, wie ein Licht erstickt im Qualm. Der Einsiedler nahm die Hobelbank auseinander und trug die einzelnen Stücke in eine Hütte, die eine Strecke weiter hinten im niederen Tannengrün lag. Ebendorthin trug er die Werkzeuge und Gerätschaften, und dann schleifte er die Särge über den grasigen Boden und barg sie unter dem Dach. Darüber war es völlig Nacht geworden.
Nachdem er die Tür der Hütte verschlossen hatte, ging er über die Lichtung auf die Stelle, von der man nach der Burg sehen konnte. Mit gekreuzten Armen stand er an eine Buche gelehnt und sah zum hellerleuchteten Schlosse hinüber.
Man hörte die Klänge fröhlicher Tanzweisen, sah dunkle Gestalten an den Fenstern vorübergleiten, und aus den Höfen und vom Neckar her erscholl mitunter ein Jauchzen.
Jetzt fingen die Musikanten von neuem an: es war die Melodie eines marschartigen Reigens, aber hell und fröhlich; der Klang der Trompete war der König unter den Tönen.
‚Jetzt geleiten sie das Paar in die Kammer‘, dachte der Siedler und horchte gespannt.
Da löste sich der Trompetenklang los von dem übrigen Klingen und Singen, Dröhnen und Rauschen, und klar und rein scholl durch die Luft die Weise des Grabliedes. Zuerst wirbelten und schwirrten die übrigen Töne verwirrt um die majestätischen Klänge her, dann wurden sie mitgezogen, zuerst der Baß und ein Klang nach dem andern, bis in voller Harmonie der Choral herüberklang:
„Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod.
Wie plötzlich, ach, und wie behende
Kann kommen meine Todesnot!
O Gott, ich bitt’ durch Christi Blut,
Mach’s nur mit meinem Ende gut!“
Der Einsiedler hielt die Fuchsmütze an seine Brust gepreßt. Aus seinen Augen stürzten Tränen. Als die Weise vorüber war, fiel er auf die Knie zu brünstigem Gebet. Dann erhob er sich und ging mit großen Schritten durch den schwarzen Wald dem Schlosse zu.
3
„Hä!“ sagte der Torwärtel Peter, als der letzte Gast draußen war. Er zog die Torflügel herein, legte den Querbalken dahinter und riegelte das Pförtchen. Dann ging er in die Stube, entledigte sich seiner Hochzeitsstiefel und seines Festgewandes und kam bald wieder in den Torbogen heraus in seinen Schlappen und im Hauswams. Er schlurfte ein wenig herum, um sich wieder ins gewohnte Leben hineinzufinden; er schlappte zur inneren Torbrücke und spuckte über das Geländer, dann schlitterte er wieder herunter und goß Milch in das Katzenschüsselchen, dann tappelte er noch einmal hinauf, stieg auf die Zwingmauer und stellte eine Mausefalle vor den Meisenkäfig. Eine Weile stand er tiefsinnig vor den Schweineställen. Dann kam er an den Brunnen heran und zog einen gefüllten Eimer herauf, ließ ihn aber in der Kette hängen, wie es die nächtliche Burgordnung gebot. Dann schleifte er seine Schlappen wieder zum Tore hinunter, in die Stube hinein und kreuz und quer über die sandigen Dielen. Endlich kam er mit einem dick gestrichenen Käsebrot heraus, setzte sich auf sein Bänklein, sagte „Hä!“ und biß ein.
Da klopfte es an das Pförtchen, und eine tiefe Stimme sagte: „Ich bin’s, der Hannes.“
Peter schob den Riegel zurück. Ein stämmiger Bursche kam herein, schloß das Pförtchen und setzte sich neben den Wärtel.
„Heute nacht kommt noch ein Wetter, und was für eines!“ sagte er. „Die Musikanten täten gescheiter und blieben hier. In der Johannisnacht ist der Neckar aufs Ersäufen aus, und Schiffer Stapf ist heute der rechte Mann, ihm dabei zu helfen, denn er hat einen Mordsrausch.“
Der Bursche redete vor sich hin, ohne zu beanspruchen, daß ihm jemand zuhöre. Wie es zum Abschluß des Festtages dem Peter ein Bedürfnis war, herumzuschlurfen, so war es dem Hannes ein Bedürfnis, vor sich hin zu pappeln.
„Herrschaft, war das ein Wesen, bis sie alle untergebracht waren! Mit den Junkern ging’s noch, die machten sich’s bequem und schlenderten zum Nachttrunk in den ‚Löwen‘ Aber die Edelfrauen. Einer Mutter und einer Tochter hab’ ich den Mantelsack ins Zimmer getragen. ‚Hier riecht es nicht gut‘, hat die Alte gesagt. ‚Es stinkt‘, sagt’ ich drauf; ‚aber es geht natürlich zu‘. Drauf fragte die Junge: ‚Ob es wohl hier Flöhe gibt?‘ ‚Ich schätze, daß es gibt‘, sagt’ ich drauf. ‚Denn hier sind zwei Weibsleute und in der oberen Kammer drei.‘ Drauf haben sie mich zur Stube hinausgejagt.“
Der Torwärter stand auf, tappelte in den Hof hinauf und betrachtete im Zwielicht einen liegengebliebenen Stallbesen.
Hannes legte die Ellbogen auf die Knie und erzählte in seinen Schoß hinein.
„Meiner Seel, die Unkosten! Der Junker Landschad ist mit dreizehn Pferden gekommen. Alle Ställe sind voll. Die Häuser der Herrschaft und die Wirtshäuser sind gepfropft voll, daß sie mit ihren Buckeln und Bäuchen schier gar die Dächer abheben. Und immer noch nicht genug! Das liebe Vieh weiß doch, wann’s zufrieden ist. Aber die fressen und saufen in Ewigkeit Amen. Wär’ ich der Junker, tät’ ich so: Jeder kriegt auf der Burg sein Gesatz an Essen und Trinken, wie sich’s gehört. Wer noch mehr will, für den gibt’s Wirtshäuser in der Stadt. — Aber auf Rechnung vom Junker Hirschhorn? Nicht wahr, Hannes? — Prost die Mahlzeit, gnädige Frau! Habt ihr Geld, kriegt ihr was. — Meiner Seel, sie hätten nicht den zwölften Teil Hunger und Durst! — Aber die Gäule? Die sind doch zehrungsfrei? Für ein brav Trinkgeld kriegt jeder Gaul einen Stallplatz, aber Hafer und Heu und was der Roßbub verzehrt, kostet für jeden Gaulskopf zwei Batzen. Hei, wäre jetzt das Städtlein so sauber und so still; neckarauf, neckarab täten sie reiten, was das Zeug hält, damit sie noch heimkommen, ehe das Wetter einbrennt.“
Über solchen und ähnlichen Phantasien schlief der Hannes ein. Der Peter aber geisterte noch ein wenig herum. War es im Tore wie in einem Bratofen, so war es im Stüblein daneben wie in einem Backofen. Peter zog das Losament mit der fliegenden Hitze vor. Er schlurfte schließlich endgültig in die Kemenate und legte sich auf die Pritsche.
Nun wachte niemand mehr in der Burg als der Junker und sein junges Weib. Und hätte man nach schlafenden Menschen gesucht, man hätte nur zwei gefunden, und zwar im Tore, sonst nicht einmal im Wächterstüblein oben auf dem Turm. Der Junker hatte allen seinen Leuten erlaubt, die Nacht in der Stadt oder am Strande oder bei den Johanhisfeuern auf den nächsten Höhen zuzubringen, bis es zu Ersheim Tag läute. In den alten Gassen, in den Schenkstuben der Wirtshäuser, oben auf dem Feuerberg und vor der Neckarpforte auf dem grünen Rasen ging es laut und lustig zu. Die Edelknechte und Edelfräulein tanzten um die lodernden Holzstöße. Die ritterlichen Herren saßen mit den Männern vom Gericht und mit den Bürgermeistern und Vögten des Junkers in den kühlen Stuben am eichenen Tisch und redeten von den bedrohlichen Zeichen der Zeit. Die Edelfrauen wandelten am kühlen Neckar und freuten sich, wie die flammenden Räder vom Feuerberg herunterrollten, Funken sprühten, wenn sie springend, aufschlingend und endlich fauchend und zischend im Neckar versanken. Auf dem Plan aber, über den man zur Ersheimer Fähre herunterstieg, waren Bänke und Tische im Freien aufgerichtet und ein bretterner Tanzboden war aufgeschlagen. Beim qualmenden Licht aufgesteckter Pechfackeln spielten die Odenwälder Musikanten, und das junge Volk wurde nicht müde, sich zu umfassen und im Tanze zu drehen. Hinter den Bergen aber brauten die Luftgeister ein Wetter. Mit schlaffen Flügeln standen sie hoch und schwarz zwischen Himmel und Erde und senkten die Köpfe und schauten mit glühenden Augen in die auf und ab steigenden stillen Wirbel, und aus geheimnisvoll spielenden Fingern quollen immer neue schwangere Dünste und zogen sich, verhohlen qualmend, in den brodelnden Kessel. Von Westen aber flog ein Wind und fing an zu blasen, und siehe, der verstockte Brodem dehnte und flog auseinander wie ein ungeheurer schwarzer Flügel, der sich entfaltet, langsam und doch unheimlich schnell, schwarze Wolken zogen herauf. Es wetterleuchtete, und wenn die Musik nicht spielte und das Volk nicht jauchzte, hörte man ununterbrochen ein fernes dumpfes Grollen. Schwarz, eilfertig und tückisch zog die Flut des Neckars dahin. An die Fähre angebunden war ein breites Boot; darinnen wollten die Musikanten nach Heidelberg hinunterfahren. Es hob und senkte sich unter der ziehenden, schwellenden Flut, kleine Wellchen leckten hinauf; zuweilen klirrte die Kette, und dann atmete es aus der Tiefe, wie wenn dort unten etwas laure.
Auf der Erde aber ging die Liebe um, weiß und gewaltig. Blick und Händedruck wurden getauscht, Mund streifte am Mund vorüber. Die Paare lösten sich vom Reigen und wandelten eng zusammengepreßt den Schatten zu. Der treue Schultheiß von Eschelbach aber verließ die Schenkstube, trat auf die Straße, schöpfte Atem und schaute zu dem dunkeln Schlosse empor. Er faltete die Hände und sagte zu sich selbst: ‚Will’s Gott, setzt in dieser Nacht ein neues Reis an und wächst in viel tausendmal tausend.‘
Friedrich von Hirschhorn und seine angetraute Braut Ursula von Sternenfels standen aneinander gelehnt auf dem Balkon. Hinter ihnen war alles finster. Wohl brannte in der Kemenate die Ampel, aber hinter einem Schirm, so daß die Fenster dieses Gemaches geradeso schwarz waren wie alle übrigen. Auch nicht das schärfste Auge konnte vom Tale oder von der Stadt her die beiden Gestalten aus dem Schatten lösen, der schwer und schwarz den Berghang hinunterhing bis auf die Dächer der Bergstadt. Sie selber aber schauten wie zwei schwebende Vögel vor sich und unter sich das wundersame Bild, das vom bewegten Himmel groß und lebendig zu ihnen herankam und das wie ein phantastisches Kinderspiel schwirrend und flimmernd die stille, nächtliche Erde beunruhigte. Das feuerhauchende Gewölk überspannte Gebirg und Tal. Noch stand der Mond am östlichen Himmel und um ihn her eine kleine Schar von tröstlichen Sternen. Aber diese Insel, von der Wolkenflut umringt, wurde kleiner und kleiner, und Ursula wollte nimmer zu ihr emporschauen, weil jeder Stern, der verschwand, sie traurig machte. Das ferne Grollen war hinterhaltig und kam nicht näher; das Ohr hatte sich daran gewöhnt, und wenn die Braut darauf lauschte und ihrem Gatten sagte: „Hörst du, wie es dort hinten murrt und knurrt?“, dann tröstete er sie: „Laß die Bestien murren und knurren; sie kommen nicht zu uns herüber.“
Zu Füßen der Schauenden lag das schattenerfüllte, schweigende Finkenbachtal, und die schwarzen Stücke finsterster Nacht, die hier und dort dicht unter der Burgmauer die Schatten umhüllten, verrieten den gähnenden Schloßgraben. Der Zug des Neckars flimmerte zwischen den Bergen vor und im Tale her und zeigte die huschenden Himmelsflammen im stillen Abbild. Es sah aus, als ob er, ein Verbündeter der Wetterwolken, aus ihrem Dunkel herwärts käme, während er doch in Wirklichkeit dem Gewitter entgegenflutete.
Gegenüber diesen machtvollen Vorgängen am Himmel und auf Erden erschien alles, was die Menschen taten, winzig und putzig: das Feuer auf dem Berg, die glühenden Scheiben und flammenden Räder, die hin und wieder huschenden Fackellichter, die schwarzen Gestalten am Strand mit ihrem wunderlichen Hinundherlaufen. Nur die freundlichen Lichter des Städtleins taten den Augen wohl in ihrer Ruhe und Traulichkeit; sie erinnerten an die Sterne am Himmel, wie Menschliches an Göttliches erinnern kann.
„Hörst du die Trompete?“ sagte Ursula zu ihrem Gatten und beugte sich lauschend über die Brüstung. „Ihr Ton schwingt sich in die Höhe wie ein Falke.“
„Grollst du ihr nicht, daß sie dir Tränen entlockt hat?“ fragte Friedrich und stemmte sich auf das Geländer.
„Ich bin ihr dankbar, und es tat mir leid, daß du dem Trompeter zürntest.“
„Es war nur für einen Augenblick.“
„Ich sah den jähen Grimm und erschrak.“
Friedrich ergriff ihre Hand und drückte sie leise. Es war wie ein Gelöbnis.
„Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Früher war ich der wilde Hirschhorn. Ich habe es gelernt, meinen Zorn niederzuringen.“
Er seufzte aus der Tiefe.
„Und wenn je einmal die jache Flamme über mich kommt, dann hebe deine Hände so, siehst du? — So! Dann werde ich still und klein wie ein ängstliches Kind. — Verstehst du mich?“
Ursula sagte leise: „Nicht ganz; aber ich weiß, woran du denkst.“
„Du Gute!“
Die Gatten schwiegen eine Weile. Die Musik jauchzte hellauf, und der Trompetenklang flatterte heran.
„Nicht das hat mich ergrimmt“, fing der Ritter wieder an, „daß er auf einmal den frohen Marsch hinüberleitete in den Choral; denn ich liebe unsere Kirchenlieder, und es war wundersam und rührend, wie die andern Töne stutzten und aus der Reihe kamen und hin und her schwirrten, bis der Trompetenton sie alle zwang und sie wohl oder übel und schließlich sehr wohl mit ihm zogen. Darüber habe ich mich gefreut. Aber als er nun vor der Tür zu unserm Brautgemach die Trompete absetzte und mit lauter Stimme zu singen anhub:
‚Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod; — ‘
und als ich die bestürzten Gesichter der Herren und Frauen sah, die uns zu unserm Gemach geleitet hatten, da wallte in mir der Zorn auf.“
„Du griffst nach deinem Dolch“, sagte sie vorwurfsvoll.
„Ich weiß es.“ — „Wie ein Engel hat er gesungen.“
„Wie ein Engel. Um so furchtbarer war mein Grauen. — Du verstehst doch. Vor der Schwelle zur Hochzeitskammer wird keiner gern an das Sterben erinnert. Und — Ursula — du weißt doch, mit welchen Gedanken alle, die mein Haus liebhaben, die Tür anschauen, die zum Brautgemach führt; du weißt doch“, er senkte die Stimme, „was viele gute Menschen vom heutigen Tag erwarten für mein Geschlecht.“
Ursula nickte mit dem Kopf und stand da wie jemand, der gewärtig ist.
Aber Friedrich war in seinen Gedanken noch ganz bei jenem Vorgang.
„Da war mir der Gesang, der vom nahen Ende und vom herkommenden Tod kündete, wie ein Schlag ins Gesicht, und ich wurde zornig. Aber ich dachte an etwas, woran mich Gottes Geist erinnert, wenn die Wut über mich kommt, und ich sagte zu mir: der Herr hat’s ihn geheißen. Da wurde ich ruhig und konnte um mich blicken. Du standest in Tränen und wolltest nicht über die Schwelle — deine Muhme schlug die Tür zu. Unsere Gäste standen verstört und betreten in Gruppen, die Musikanten waren auseinander gestoben, nur der unglückselige Trompeter stand an der Wand. Der erboste Landschad schrie auf ihn ein, und Venningen rief mir zu: ‚Wirf den Schelmen in den Turm!‘ Ich aber sagte: ‚Er steht im Frieden meiner Burg. Ich bitte die Gäste, uns zu verlassen. Die Musik voran! Hinunter in die Stadt! Viel Freud’ und Glück! Auf Wiedersehen morgen in der Früh‘.“
„Von all dem weiß ich nichts“, sagte Ursula. „Wo war ich doch mit meinen Gedanken?“
„Du standest und weintest still vor dich hin. Ich habe noch nie einen Menschen so weinen sehen: die Augen weit offen, das Gesicht still, der Mund zusammengepreßt, kein Laut, aber Tränen und Tränen wie quellende Wasser. Da rief ich dem Trompeter: ‚Bitte die Herrin um Vergebung!‘ — Ich tat es um seinetwillen, denn sie schalten ihn greulich. Er hörte nicht; da nahm ich dich bei der Hand und führte dich zu ihm und wiederholte: ‚Bitte die Herrin, daß sie dir vergebe!‘ Er rührte sich nicht. Er hatte nicht gehört. Und nun sah ich das Merkwürdigste von der Welt: er stand und weinte geradeso wie du: die Augen weit offen, das Gesicht regungslos, die Lippen geschlossen, kein Laut, aber Tränen und Tränen wie quellende Wasser. Verwundert sah ich von ihm zu dir und von dir zu ihm, und mein Staunen wuchs. Ursula, er sieht dir ähnlich wie ein Bruder, der seiner älteren Schwester aus dem Gesicht geschnitten ist. Komm, ich will dir zeigen, wo er dir ähnlich ist; da — und da — und da — und da.“
Er küßte ihr die Stirn und die Brauen und beide Augen und das Grübchen im Kinn und dann ihren Mund.
Die Trompete drunten am Neckar jauchzte, ein heller Blitz und ein munterer Donnerschlag flammte und rollte über den Kuß, der länger währte als das rollende Echo und der Raketenstrahl des Trompetenklanges. Es war still und finster, als Friedrich sein Haupt hob und seinem Gemahl ins Ohr flüsterte. Sie nickte unmerklich, und die beiden wandten sich langsam, verließen den Altan und traten in die Kemenate.
Ursula stand in der Mitte des Zimmers und harrte. Friedrich holte die Ampel hinter ihrem Schirme vor und schob den Riegel der Tür zurück. Ehe er öffnete, sah er sein Weib lächelnd an.
„Wir müssen dem Trompeter dankbar sein“, sagte er. „Ist es nicht so viel schöner, als wenn die, die jetzt drunten zechen und tanzen, alle hier ständen, und wir hörten hinter der Tür ihr Lärmen und Pochen und den frechen Pfeifenton, und wir säßen da und zitterten und fürchteten uns vor dem wüsten Lärm. Wie ist es doch so viel heimeliger und traulicher!“
„Oh, es war schrecklich!“ sagte Ursula. „Ich verging vor Scham, darum hatten auch die Tränen solche Gewalt über meine Augen.“
„Ursula, komm!“
Er öffnete die Türe weit. Ein Windstoß kam ihnen entgegen. Die Ampel flatterte hoch.
Ursula warf einen Blick durch die Tür und fragte betreten: „Wo führst du mich hin?“
„Wohin? In unser Schlafgemach.“
„Hier ist kein Gemach; hier ist ein Gang.“
„Wohl; er führt an der Mauer hin, aus dem neuen Haus in das alte Haus; links ist die Tür in dein und mein Schlafzimmer. Seit unser Geschlecht hier oben haust, haben dort die Ritter bei ihren Frauen geschlafen.“
„Und dort das schwarze Fenster?“
„Es geht in den hinteren Graben und schaut in den Tannwald. Das Fenster ist nicht geschlossen. Daher der Windzug, der dich erschreckt hat. Wir schließen das Fenster im Vorübergehen. — Ursula, dir schaudert?“
„Ja“, sagte sie und zitterte. Sie stand noch immer jenseits der Schwelle, im neuen Haus.
„Dort aus dem Gange hat es geseufzt.“
Friedrich erbleichte.
„Das ist vorbei“, sagte er leise vor sich hin.
„Was ist vorbei? Ich hab’ es wohl gehört, was du gesagt hast. Du selber bist bleich.“
„Oh, Ursula, frag nicht! Die Vergangenheit liegt schwer auf meiner Seele, und ich werde sie nicht los, weil ich meinen Namen nicht los werde. Du bist mein starkes, treues Weib, du hilfst mir tragen. Aber höre, Ursula, wir wollen unwissend tragen. Oh, zwinge die Vergangenheit nicht, dir zu antworten! Laß sie ruhen und schweigen. Ursula, komm und gib mir dein süßes Herz!“
Sie wollte kommen. Aber von neuem schreckte sie zurück.
„Ich kann ja nicht!“ flüsterte sie. „Es stöhnt so entsetzlich dort!“
Friedrich sah erleichtert auf. „Allerdings“, sagte er, „das ist ein lebendiger Mensch. Einer von den Wunderlichen. Er fragt so viel; dadurch ist er sich zur Last, und mir ist er’s auch. Jetzt sitzt er im Burggraben oder läuft drinnen umher und klopft an die Mauern und fragt die schweigenden Steine. Es ist dies nicht hübsch für dich und für mich. Aber sei ohne Furcht. Er tut dir nichts zuleid. Und in der Burg selber erschreckt er dich nicht. Es ist ihm verboten, sie zu betreten. Aber draußen lassen wir ihn gewähren, Ursula, daß er tue nach seiner seltsamen Weise. Denn der Herr hat es ihn geheißen. — Ursula, komm, gib mir dein süßes Herz.“
Er hielt die Ampel hoch, faßte sein Weib an der Hand und schritt vorwärts. Sie zögerte noch immer, so daß ihr Arm und der ziehende ihres Gatten gestreckt waren. Durch das auf und zu wehende Fenster und das rasch bewegte Windlicht entstanden huschende, streichende, sich beugende Schatten an der langen Wand des Ganges.
Ursula stieß einen markerschütternden Schrei aus und, vorgebeugt, hielt sie sich zitternd fest an ihrem Gatten.
„Sieh! sieh! dort!“ stammelte sie.
„Es ist nichts“, sagte er erschüttert.
„Doch! Eine Gestalt — eine Frau ist aus der Mauer getreten, mir in den Weg, und sie hat die Hände erhoben, so, Friedrich, so, wie du mir vorhin gezeigt hast.“
Der Junker sank in die Knie. Es sträubten sich ihm die Haare.
„Geh!“ rief er, und wie ein Flüchtiger drängte er sein Weib in die Stube zurück.
Er stellte das Licht auf den Tisch und ging einigemale im Zimmer auf und nieder. Dann ging er mit festen Schritten durch den finsteren Gang und schloß das auf- und zuschlagende Fenster. Ursula ergriff die Leuchte und hielt sie ihm zum Rückweg entgegen. In der Mitte des Ganges bückte er sich und hob etwas vom Boden auf. Er brauchte dazu längere Zeit, als dieses Geschäft erfordert hätte. Als er das Ding in der Hand hielt, schüttelte er den Kopf, sah an der Wand empor und schüttelte den Kopf von neuem. Als er in die Stube trat, sah er so bleich aus wie ein Mensch, der ein Gespenst gesehen hat.
Ursula bemerkte die Wandlung bei ihrem Manne, und jetzt wurde sie ruhig und sicher.
„Verzeih mir, Geliebter“, sagte sie zu ihm. „Ich war eine Törin, aber es ist vorbei. Laß mich dir leuchten und komm!“
Sie wollte voraus in den Gang hinein. Er aber war ans Fenster getreten.
Sie stellte die Lampe auf einen Stuhl und trat zu ihm.
„Das Gewitter ist näher gekommen. Wie es blitzt! Der ganze Himmel ein Feuer. Aber noch regnet es nicht. Das Wetter steht noch hinter dem Berg.“
Friedrich schwieg.
„Sind auch unsere Gäste alle gut untergebracht? Ich weiß, sieben Herrschaftshäuser und zwei Wirtshäuser hast du dazu eingerichtet. Vortrefflich, ich weiß es, aber ich bin doch etwas in Sorge. Meine Muhme, die Degenfeld, ist so heikel.“
„Wenn ich nur jemand hätte, den ich schicken könnte“, sagte Friedrich, „so ließe ich jetzt allsogleich den Trompeter holen, um ihn etwas zu fragen.“
„Was hast du mich doch über das Fragen gelehrt?“ sagte Ursula lächelnd.
„Aber alle meine Leute sind drunten; nur der Wärtel ist da, vielleicht auch sein Knecht, aber wahrscheinlich nicht.“
„So geh doch selbst!“
„Ich dich verlassen?“
„Ich gehe mit dir, lieber Herr!“
Friedrich zog sie an sein Herz.
„Nein, ich schicke morgen einen reitenden Boten mit einem ledigen Gaul nach Kirchheim. Sie spielen dort auf. Dann ist er gegen Mittag hier.“
„Und nun?“ fragte Ursula nach einer Pause. „Lieber Herr!“
„Warum sagst du jetzt so zu mir?“
„Ich weiß nicht, wie ich dich fassen soll, damit du wieder —“
Sie brach ab und wurde blutrot.
Er rührte sich nicht.
Sie schmiegte sich an ihn und flüsterte: „Es ziemt sich nicht, daß die Braut — komm!“
„Ja, komm!“ seufzte er und ging vom Fenster.
„Wohin?“ fragte sie betreten und sah ihn mit großen Augen an.
„Laß mich!“ sagte er und trat wieder hinaus auf den Altan.
„Willst du eine nasse Braut in dein Bett tragen?“ fragte sie ihn verwundert und folgte ihm.
Und nun standen sie wieder draußen und schauten hinunter ins Tal.
Es lag ganz finster. Die Fackeln am Strande zeigten, wie schwarz die Nacht war. Das Gewitter war näher gekommen. Unaufhörlich flammte es hinter den Bergen vor, und das Rollen des Donners hatte keine Pause. Es rauschte in der Schloßlinde, und ein Weben und Sausen kam vom Walde herüber. Aber noch führte der Sturm nur Staub und Blätter mit sich. Noch war kein Tropfen gefallen.
Vom Strande her hörte man das Sprechen und Rufen arbeitender Männer. Sie schlugen die Zelte ab und brachten die Fässer und Kannen unter Dach und Fach. Die Häuser der Stadt waren noch alle hell erleuchtet. Die Musik spielte in einem der Wirtshäuser.
„Sie können nicht genug bekommen“, sagte Friedrich. „Aber es ist mir lieb, daß die Musikanten hierbleiben.“
„Grausig schön müßte es sein, in dieser Nacht den Neckar hinunterzufahren.“
„Schön, aber gefährlich, denn wenn die Wetterbraut in den Neckar fällt, wird er wild. — Ich wüßte die Leute nicht gern heute nacht auf dem Fluß. Es ist die Johannisnacht. — Es ist ein wunderlich Ding. Ich glaube nicht dran, aber es schaudert mich doch. — So ist es auch mit dem Strauße hier. Es ist ein Wetterstrauß. Hätte er ihn mitgenommen, so wäre ich ruhiger. Nun lag der Strauß in der Burg, und zwar seltsamerweise —“
Friedrich brach ab.
„Was bewegt dich so? Ich versteh’ dich nicht. Wovon redest du?“
„Von diesem Sträußchen hier. Der Trompeter hat es am Wams getragen. Ich habe es wohl bemerkt. Und nun lag es mitten im Gang, hart an der Mauer.“
„Was ist daran Wunderliches? Lieber, ich muß über dich lächeln.“
„Es sind Himmelfahrtsblumen. Sie sind selten und werden in diesen Tagen von den Leuten im Wald gesucht. Sie wachsen an liebsten unter hohen Eichen, die der Blitz getroffen hat. Man sagt, daß sie aus Wettersamen sprießen und daß sie bei Sturm und Blitz Schutz gewähren. Aber wie kommt der Strauß dorthin?“
„Das ist leicht zu erraten“, sagte Ursula. „Der Trompeter hat ihn verloren.“
„Er hat ja den Gang gar nicht betreten! Keines Menschen Fuß hat ihn betreten außer mir. Die unser Zimmer bereiteten, kamen vom Turm hinein. Den Schlüssel zum Gang trug ich in der Tasche.“
„Oh, ich weiß“, rief Ursula; sie rief es fröhlich, denn es war ihr ein Anliegen, daß ihr Herr wieder froh wurde.