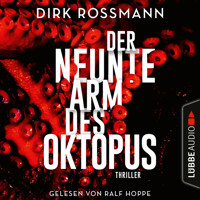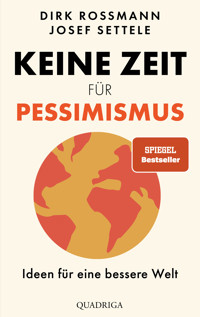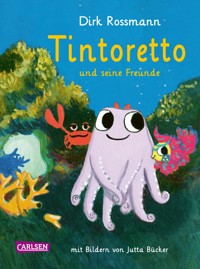9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Oktopus-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 2032, die Weltregierung kämpft gegen die Klimakatastrophe. Aber immer noch sperren und sträuben sich auf der Welt viel zu viele Menschen - wie kann man sie überzeugen, zur Einsicht bringen? Oder sogar - ändern? Ein ehrgeiziger Wissenschaftler hat eine Lösung: Ein Parasit, der unser Denken verwandelt, der uns zu besseren Menschen macht. Doch als ein Verbrecher diesen Parasiten für seine skrupellosen Ziele benutzen will, liegt unser aller Schicksal in den Händen eines kleinen Beamten und einer temperamentvollen Millionärin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 864
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumZitatErstes Kapitel: Das Tier aus der TiefeSydney Opera House, AustralienMarianengraben, Pazifischer OzeanIsla Robinson Crusoe, etwa 700 Kilometer vor der chilenischen PazifikküsteSydney Opera House, AustralienWohnung von Ariadna Ferrer und Thomas Pierpaoli, Kapstadt, SüdafrikaZweites Kapitel: Die Geisel»Pyramide«, Sitz der Klima-Allianz, KapstadtGeheimes Papierdokument der Task-Force, erstellt 2 Jahre zuvor»Pyramide«, Sitz der Klima-Allianz, KapstadtKonferenzraum 13/2, »Pyramide«, KapstadtTerminal 1, Cape Town International AirportDolphin Queen, unterste Etage, Bereiche XII bis XIVDrittes Kapitel: Dr. Charles ElaniDas Jahr 2032 – die Welt wird umgebautPunaauia, Tahiti / Wackerballig, DeutschlandGeltinger Bucht, DeutschlandHalbinsel Kvisnæs bei Wackerballig, DeutschlandLeuchtturm Kalkgrund, Geltinger Bucht, DeutschlandAuf der Greta, Wackerballig, Deutschland»Pension Benzler«, Geltinger Bucht, DeutschlandGeltinger Bucht, Ostsee, Deutschland»Pension Benzler«, Geltinger Bucht, DeutschlandLeuchtturm Kalkgrund, Geltinger Bucht, Deutschland»Pension Benzler«, Geltinger Bucht, DeutschlandCafé »Maresol«, Kapstadt, Südafrika»Pension Benzler«, Geltinger Bucht, Deutschland»Pension Benzler«, Geltinger Bucht, DeutschlandGeheimes Papierdokument der Task-Force, erstellt 2 Jahre zuvor:Der Aufstieg TalaseasViertes Kapitel: TalaseaLagezentrum, Geltinger Bucht, DeutschlandOstsee, Geltinger Bucht, DeutschlandPapeete, Tahiti, SüdseeVermisstenanzeigePapenoo-Tal, Tahiti, SüdseeFünftes Kapitel: SchattenGeltinger Bucht, DeutschlandHafen Hirtshals, DänemarkTetiaroa, vor Tahiti, SüdseeLagezentrum, Geltinger Bucht, DeutschlandLagezentrum, Geltinger Bucht, DeutschlandSechstes Kapitel: Der RaubKurz vor Aalborg, DänemarkHafen Hirtshals, DänemarkHafen Hirtshals, DänemarkSiebtes Kapitel: Die FalleGeheimes Papierdokument der Task-Force, erstellt vor ca. 2 JahrenBahnhofsrestaurant in Aalborg, DänemarkIm Zugabteil, Rhein-Main-Ebene, DeutschlandHotelzimmer im »Fatata-te-Miti«, Papeete, Tahiti»Dem Planeten eine Stimme«Konferenzraum 13/2, »Pyramide«, KapstadtAchtes Kapitel: Der ParasitChâteau der Familie de Barré, SüdfrankreichFreihafen Colón, PanamaChâteau der Familie de Barré, SüdfrankreichDas Dorf Les Libellules, SüdfrankreichGeheimes Papierdokument der Task-Force, erstellt vor ca. 2 JahrenNeuntes Kapitel: TrugbilderTahiti, SüdseeElanis Apartment, Colón, PanamaPierpaolis Wohnung, Papeete, TahitiPierpaolis Wohnung, Papeete, TahitiPierpaolis Wohnung, Papeete, TahitiLagerhalle auf der Pont-de-Motu-Uta-HalbinselPierpaolis Wohnung, Papeete, TahitiGeheimes Papierdokument der Task-Force, erstellt knapp 2 Jahre zuvorZehntes Kapitel: AlleinDer Blaue PlanetElanis Penthouse-Wohnung, Colón, PanamaColón, PanamaAn Bord der Marguerita, PazifikHafenbehörde, Colón, PanamaWichita Creek, Texas; Glendale, Kalifornien, USAAn Bord der Marguerita, PazifikColón, PanamaPanama, ColónAn Bord der Marguerita, PazifikPeluquería La Bonita, Colón, PanamaColón, PanamaGeheimes Papierdokument der Task-Force, erstellt 1 Jahr und 2 Monate zuvorDas Geisel-Versteck der Yaya-Gang, unweit von Colón, PanamaKapstadt, SüdafrikaColón, PanamaElftes Kapitel: Die GefangenenVor der Isla Robinson Crusoe, PazifikIsla Robinson Crusoe, PazifikFestung »Cárcel Vieja«, Isla Robinson CrusoeHabitat I, Festung »Cárcel Vieja«Habitat II, Festung »Cárcel Vieja«Isla Robinson Crusoe, PazifikZwölftes Kapitel: Frey»Pyramide«, Kapstadt, SüdafrikaAn Bord der Change, PazifikSpeiseraum an Bord der Change, PazifikMeggen, ZentralschweizAn Bord der Change, PazifikAn Bord der Change, PazifikAn Bord der Marguerita, PazifikMonitorraum, an Bord der Change, PazifikIn der Kantine der »Pyramide«, Kapstadt, SüdafrikaDas Büro von Yaya, Colón, PanamaAn Bord der Marguerita, PazifikAn Bord der Marguerita, PazifikAn Bord der Change, PazifikAn Bord der Change, PazifikPierpaolis Kabine, an Bord der Change, PazifikPierpaolis Kabine, an Bord der Change, PazifikFreys Büro, an Bord der Change, PazifikMonitorraum, an Bord der Change, PazifikMonitorraum, an Bord der Change, PazifikMonitorraum, an Bord der Change, PazifikAn Bord der Change, PazifikDreizehntes Kapitel: Der ArrestDer Wolkenturm, vor der Küste FloridasIsla Robinson Crusoe, PazifikEinschreiben an Monsieur Thomas Pierpaoli, KapstadtTalaseas WahlsiegSafe House, südlich von Kapstadt, SüdafrikaWohnung von Juniper Gillespie, Kapstadt, SüdafrikaDas Safe House, südlich von Kapstadt, SüdafrikaVierzehntes Kapitel: TodDie Innenrevision innerhalb der »Pyramide«, Kapstadt, SüdafrikaDie Geo-Engineering-Anlage vor der Küste Floridas, genannt WolkenturmDie Geo-Engineering-Anlage vor der Küste Floridas, genannt WolkenturmFünfzehntes Kapitel: LebenDie Vernichtung des ParasitenKapstadt, SüdafrikaKapstadt, SüdafrikaWohnung von Ariadna Ferrer und Thomas Pierpaoli, Kapstadt, SüdafrikaGolf von MexikoContainerhafen, PanamaDank und WidmungÜber dieses Buch
Das Jahr 2032, die Weltregierung kämpft gegen die Klimakatastrophe. Aber immer noch sperren und sträuben sich auf der Welt viel zu viele Menschen – wie kann man sie überzeugen, zur Einsicht bringen? Oder sogar – ändern? Ein ehrgeiziger Wissenschaftler hat eine Lösung: Ein Parasit, der unser Denken verwandelt, der uns zu besseren Menschen macht. Doch als ein Verbrecher diesen Parasiten für seine skrupellosen Ziele benutzen will, liegt unser aller Schicksal in den Händen eines kleinen Beamten und einer temperamentvollen Millionärin.
Über die Autoren
Dirk Rossmann, geboren 1946, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Schriftsteller, unter anderem Mitgründer der »Deutschen Stiftung Weltbevölkerung«. Bisherige Veröffentlichungen: »… dann bin ich auf den Baum geklettert!« (2018) und »Der neunte Arm des Oktopus« (2020). Seine Autobiografie wie auch der Thriller erreichten Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Dirk Rossmann setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein.
Ralf Hoppe, geboren 1959 in Teheran, Iran, verbrachte seine Kindheit im Orient. Er studierte Kunst und Wirtschaft, wurde Journalist und arbeitete fast drei Jahrzehnte für die ZEIT und den SPIEGEL. Seine Reportagen, die ihn in zahlreiche Krisengebiete führten, wurden vielfach preisgekrönt (u. a. Henri-Nannen-Preis, Theodor-Wolff-Preis). Zwischendurch war er Drehbuchautor und schrieb an mehreren SPIEGEL-Büchern mit. Der Autor lebt im Osten von Hamburg.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023/2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das
Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Einband-/Umschlagmotiv: © OLaLa Merkel/Shutterstock.com; sopf/Shutterstock.com
Kartenillustration: Markus Weber, Guter Punkt, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4826-1
luebbe.de
lesejury.de
Man sagt, die See sei kalt / Und doch birgt sieDas heißeste Blut von allen, das wildeste, das drängendste
D. H. Lawrence
Erstes KapitelDas Tier aus der Tiefe
Sydney Opera House, Australien
Die Operation ist lange schon geplant. Jetzt ist es so weit.
Schauplatz: Sydney, größte Stadt Australiens, hier: das Opernhaus.
Zielperson: John Garreth Martindale, ehemals Marineoffizier im Rang eines Flottillenadmirals d. R., ehemals australischer Ministerpräsident, nach atemberaubender politischer Karriere derzeitiger Verteidigungsminister der Klima-Allianz.
Die Täter: eine radikale Abspaltung der »Fraction de l’armée polynésienne«, kurz F.A.P. Es sind überwiegend junge Kämpferinnen und Kämpfer, die oft eigenständig agieren, mit flachen Hierarchien, dabei extrem gut ausgebildet, zu allem entschlossen.
Und davon überzeugt, dass Gerechtigkeit auf der Welt nur mit Gewalt herzustellen sei.
Der Plan: äußerst präzise. Die Ausarbeitung hat sich über einen Zeitraum von fast zwei Jahren erstreckt. Für die eigentliche Tat sind zwei Minuten und vierzig Sekunden angesetzt. Präzision und Planung sind entscheidend.
*
Verbrechen ist ein Betätigungsfeld, das zunächst jedem offensteht. Denn »Verbrecher« – das ist keine geschützte Berufsbezeichnung, vielmehr ein Metier ohne systematische Ausbildung, eher learning by doing, und seltsamerweise wird man auch erst dann als Verbrecher qualifiziert, sobald man gefasst und verurteilt wird, genau genommen also durch erwiesenes Versagen.
Deshalb tummeln sich auf diesem Gebiet vornehmlich Amateure, die eher in die Laufbahn des Kriminellen hineingescheitert sind, als dass sie sie bewusst und freudig ergriffen hätten. Von rühmlichen Ausnahmen abgesehen, sind die meisten Gangster, all die Entführer, Bankräuber, Erpresser, Dealer, Mörder, wie Kriminologen seufzend bestätigen werden, Pfuscher und keine Leuchten auf ihrem Gebiet. Sie haben etwas falsch gemacht, darum füllen sie die Gerichtssäle, bevölkern die Gefängnisse, wo sie genug Muße haben, sich zu fragen, was eigentlich das Problem war.
Die Antwort ist einfach.
Die Planung macht den Unterschied.
Ein Verbrechen bedarf, soll es zielführend ablaufen, einer wahrhaft anspruchsvollen Planung, wie bei einem sorgfältigen Ingenieur oder bei einem Handwerker, der zunächst nachdenkt und dann erst zu Werke geht. Es braucht auch im illegalen Geschäft ein Timing, Vorbereitung, exakte Choreografie. Vor allem, wenn im Team gearbeitet wird, etwa bei einem Banküberfall oder einer Entführung: Hier müssen die Täter sich zuerst selbst kennen, ihre Position. Sie müssen wissen, wer wann und an welchem Ort welche Rolle spielt, eigentlich wie bei einer gut eingespielten Fußballmannschaft. Sie müssen ihr Ziel kennen, ihre Mittel beherrschen, die Technologie, Waffen, Werkzeug, Einsatz von Gewalt, Einschüchterung und Psychologie, Baupläne, das Gelände, Fluchtwege, und sie müssen Eventualitäten hochrechnen und vor allem den Schauplatz beherrschen.
Verbrechertum treibt eine alte Lebensweisheit auf die Spitze: Improvisation ist tödlich, Planung ist alles. Die Taten, von denen hier die Rede sein wird, wurden allerdings von langer Hand geplant und mit äußerster Skrupellosigkeit durchgeführt. Sydney war nur der Auftakt.
*
Die Gruppe, die für die spektakuläre Entführung des Verteidigungsministers John Garreth Martindale verantwortlich war, nannte sich »La Septième«, die Siebente. Sie waren die Zornigsten, die Radikalsten, die Unerbittlichsten innerhalb der F.A.P. – eine von sieben Untergruppen, die, unzufrieden mit den langsamen Fortschritten der Dachorganisation, in den bewaffneten Kampf gegangen war.
Die F.A.P. selbst war eine friedliche und politische Bewegung, die von den Inselstaaten der Südsee ausgegangen war – und der sich zahlreiche andere Klimakämpfer aus vielen Nationen angeschlossen hatten. Wie im irischen Widerstand die »Sinn Féin« einst der politische Arm und die IRA der bewaffnete Arm war, so verhielt es sich auch hier. Es gab eine offizielle und legale Organisation. Daneben formierte sich eine Armee der Schatten.
In der »Septième« kamen die radikalsten Kämpfer zusammen, weil sie nach eigenem Dafürhalten nichts zu verlieren hatten, weil ihnen alles genommen worden war: die Heimat, die Eltern, die Geschwister, die Zukunft. Es waren überwiegend junge Menschen aus allen Teilen der Welt, deren Leben durch den Klimawandel radikal auf den Kopf gestellt worden war. Dies war etwa um die Jahre 2026 bis 2028 geschehen; damals waren zum Beispiel viele Inseln in der Südsee einfach überschwemmt worden. In Afrika hatte die Überwärmung ein Dutzend Staaten mit ihrer Infrastruktur zerschlagen, die Menschen waren in die Steinzeit versetzt worden. Auch in Asien, etwa in Bangladesch, Indien oder Thailand, waren viele Küstenstädte überflutet worden.
Die Menschen hatten fliehen müssen, hatten alles aufgegeben, und wer das als Kind oder als junger Mensch erlebt hatte, der war entweder daran völlig verzweifelt – oder ging zur »La Septième«. Viele der Kämpfer wurden in den diversen Gefängnissen rund um die Welt rekrutiert.
Sie waren überzeugt, die Änderung der Machtverhältnisse war nur durch Gewalt zu erreichen.
Die Klima-Allianz, eine übergeordnete Regierung, der fast alle Länder in den Jahren 2025 bis 2026 beigetreten waren, fand keine Gnade vor ihren Augen. Für die Widerstandskämpfer war die Klima-Allianz nur eine weitere Institution, die von den wahren Ursachen ablenken sollte und in Wahrheit von den reichen Gesellschaftsschichten gelenkt wurde.
Innerhalb der F.A.P. herrschte Uneinigkeit über den Umgang mit dieser gefährlichen Splittergruppe, die man lange unterschätzt hatte. Deren Kämpferinnen und Kämpfer waren militärisch organisiert und zu jeder anarchischen Wildheit, zu jeder brutalen Aktion bereit. Ihr Motto lautete: Eat the power, eat the rich. Macht sie fertig, die Mächtigen und die Reichen dieser Erde.
Die »Operation Martindale« war ihr erster großer Coup.
*
Martindale war ein großer, fleischiger Mann, in seiner Jugend athletisch, immer noch mit wenig Fett am Körper und einem enormen Brustkorb. Viele starke Männer sind in Wahrheit gutmütig, Martindale nicht. Er war ein Typ mit einer stets ausbruchsbereiten Aggressivität; in der Privatschule, die er dank eines Stipendiums besuchte, war »Büffel« sein Spitzname gewesen, aber es hatte nur wenige Mitschüler gegeben, die so unklug waren, ihn laut so zu nennen.
Martindale war zum Zeitpunkt der Entführung zweiundfünfzig Jahre alt, charismatisch, reich, sehr intelligent. Im politischen Metier war Martindale mit allen Wassern gewaschen, von zahllosen Bewunderern umschwärmt, mit nicht wenigen Feinden gesegnet. Die sich aber in Acht nahmen.
Er hatte eine breite, sommersprossige Stirn, braune Augen in einem kantigen Gesicht, das weißblonde Haar trug er lang und straff zurückgekämmt. Auf Bildschirmen und Fotos sah er großartig aus. In seinen späten Jahren hatte er einen provozierenden Stil entwickelt. An diesem Abend trug er zum Smoking kanariengelbe Hosenträger. Die Leute liebten ihn. Er hatte gleichmäßig weiße Zähne und einen ausdrucksvoll geschnittenen Mund – er lächelte viel. »Das Lächeln eines Delphins, die Absichten eines Haifischs«, so hatte ein politischer Gegner es mal ausgedrückt.
In einem anderen Leben hätte Martindale einen römischen Feldherrn abgeben können, dem die Soldaten in den Tod folgen; er war ein Machtmensch und Herrschertyp durch und durch. Wer herrscht, heißt es, hasst zwar den Verräter, aber er liebt den Verrat. Martindale galt als ein manchmal schlau-abwägender, gern selbst Intrigen anzettelnder Typ, der immer unberechenbar blieb und urplötzlich Anfällen von Gefühl und Aufrichtigkeit unterworfen war.
Er hatte unendlich viele Intrigen, Verrätereien und Hinterhalte überlebt, und sein Gedächtnis und seine Fähigkeit, nachtragend zu sein, waren geradezu legendär, sein nom de guerre, sein Kriegsname: Der Mann, der nie vergisst.
Er war ein harter Brocken; vor allem, wenn es um Terrorbekämpfung ging. Zwar war das australische Militär größtenteils in der Armee der Klima-Allianz aufgegangen, die Regierung in Canberra unterhielt jedoch immer noch eine schlagkräftige Anti-Terror-Einheit, größer als eigentlich erlaubt. Bei jedem Terroranschlag hatte Martindale eine sofortige Strafaktion befohlen – das Volk liebte ihn dafür.
Die Operation der F.A.P. – oder genauer: der »Septième« – hatte also einen der am schärfsten bewachten Männer auf dem Planeten zum Ziel. Darum die sorgsame Planung. Einen Vorteil allerdings bildete die Tatsache, dass Martindale ein Opernfan war.
Das war das Kernstück des Plans.
Marianengraben, Pazifischer Ozean
Elf Grad nördlicher Breite, hundertzweiundvierzig Grad östlicher Länge – die Koordinaten beschreiben, bei aller Exaktheit, dennoch einen Ort im Nirgendwo, definieren im Undefinierbaren, anders gesagt: in der Leere und Weite des Pazifischen Ozeans.
Hier auf dem Meer hört scheinbar alles auf. Weiter entrückt von der Zivilisation, weiter entfernt vom Festland, von Menschen und Städten kann man nicht sein.
Ein einsamer Schiffbrüchiger, der hier vorbeitriebe, in einem Rettungsboot etwa, hätte nichts, woran sein Auge sich festhalten könnte, keine Insel, keine Orientierung, keine Horizontlinie. Das nächste Eiland, Guam, das zu Mikronesien gehört, zur »Welt der kleinen Inseln«, liegt Hunderte von Seemeilen entfernt. Unser Mann in seinem Boot sähe nur Himmel und Meer, ein blaues Panorama, so weit man schaut. Gewaltig und atemberaubend, unendlich und meistens friedlich.
Zwar gibt es gelegentlich Stürme hier, die wochenlang brüllen und toben, aber die meisten Tage sind warm und freundlich, daher hat der Pazifik auch seinen Namen, das Meer des Friedens. Meist weht eine milde Brise. Die Luft ist seidig, die Himmelskuppel ziseliert mit weißen Federwölkchen, das Plätschern der Wellen ist einlullend.
Der Pazifik, inklusive seiner Nebenmeere, ist mit Abstand die größte Wasserfläche auf der Erde. Mehr als die Hälfte allen Wassers auf dem Planeten befindet sich hier, mehr als ein Drittel der Erdoberfläche wird vom Pazifik bedeckt. Aber wirklich erfassen lässt sich die Gewalt und Größe dieses Meeres weder mit Zahlen noch mit Worten – und für den Menschen wahrscheinlich gar nicht.
Bei aller Verlorenheit ist diese eine, ganz bestimmte Position nördlicher Breite und östlicher Länge dennoch besonders, dennoch geheimnisvoll, nicht nur als Schauplatz dieser Erzählung.
Ihr Geheimnis liegt in der Tiefe, in dem, was man nicht sieht.
*
Steigen wir also hinab. In die Tiefe, wo der Ursprung allen Lebens ist, und auch der Beginn dieser Geschichte.
Hier, an diesen Koordinaten, verläuft nämlich der sogenannte Marianengraben, hier ist der tiefste Punkt der Erde. Hier ist die See nicht etwa nur durchschnittlich 52 Meter tief, wie in der Ostsee, oder 1 450 Meter, wie im Mittelmeer – nein, hier geht es mehr als zehn Kilometer tief hinab. In eine Welt immerwährender Dunkelheit, die nichts gemein hat mit der Welt da oben. Würde man den Mount Everest in seiner Majestät auf den Grund der Rinne verfrachten, läge der Gipfel immer noch zwei glatte Kilometer unter Wasser.
Der Marianengraben ist, wissenschaftlich ausgedrückt, eine Senkung des Meeresbodens, ein tiefer, eingepresster Sichelabdruck, so lang wie die Entfernung zwischen Berlin und Madrid. Über der tektonischen Spalte liegt die gewaltige Kraft der Wassersäule. An der bisher gemessenen tiefsten Stelle liegt der Druck bei etwa 1 093 Bar. Für den menschlichen Körper, ausgerichtet auf ein Tausendstel dessen, bedeutet das, dass etwa siebzehn Millionen Kilo auf ihm lasten würden. Ein Tiefseetaucher, den der unkluge Gedanke überkäme, seine Tauchglocke versuchsweise zu verlassen, würde das merken – oder eigentlich nicht merken. Im Bruchteil einer Sekunde würden sämtliche Organe und Knochen, die mit Gas oder Luft gefüllt sind, zerquetscht: Die Lunge würde auf die Größe etwa einer Mandarine zusammengedrückt, Schädelknochen wie das Schläfenbein oder das Stirnbein würden pulverisiert. Pink ashes, sagen die Tiefseetaucher, blutrotes Pulver. Und die physikalischen Kräfte wirken ohne Zeitverzögerung; es ginge sehr schnell.
Und trotzdem gibt es hier unten, am Bodensatz der Welt, an diese Umstände angepasste Wesen, flitzende, beißende, fressende Geschöpfe, dem Überleben gewidmete Aktivitäten. Denn das Leben findet fast immer seinen Weg, auch hier unten, in steter Dunkelheit. Die Evolution hatte Zeit, und Raum für Mutationen und Experimente gab es hier unten auch.
Die Tiefsee ist weniger erforscht als die Oberfläche des Planeten Mars, aber ungleich belebter. Spanische Wissenschaftler schätzen, dass die Zahl der Geschöpfe in der Tiefsee zehnmal höher liegt, vielleicht sogar tausendmal höher als bislang gedacht. Es gibt eine wahrscheinlich vier- oder fünfstellige Zahl von unbekannten Bakterien, und es existieren Parasiten, deren Wirkung wir nicht kennen, deren Herkunft im Dunkeln liegt.
Die Wesen, die bislang entdeckt wurden und die dieses gepresste Dasein aushalten, sehen bizarr aus – aber das ist nur Geschmackssache, eine Frage der Perspektive, aus Sicht der Tiefseebewohner wären wir Menschen die Monströsen und Seltsamen.
Da ist zum Beispiel der Anglerfisch. Ein unschöner und grimmiger Geselle – genau genommen: eine Gesellin, denn nur die weiblichen Tiere erreichen eine ansehnliche Größe von etwa einem Meter, die Männchen, nur ein Sechzigstel so groß, schwimmen als kleine Fortsätze mit, manchmal sogar im Körper des Weibchens. Aber beim Anglerfisch weiß man zumindest, wo vorn und hinten ist. Vorn scheint das Tier nur aus einem Kopf, beziehungsweise aus einem zahnbewehrten Maul zu bestehen, dazwischen ein plumper, stachliger Leib, hinten hängt ein Schwänzchen dran, winzig, faserig, fast lieblos, als hätte die Evolution die Lust verloren. Mit seinen spitz-scharfen Zahnreihen sieht das Tier aus wie ein schwimmender Bolzenschneider, ausgestattet mit einem flimmernden Leuchtorgan, das der Anglerfisch vor sich herträgt wie ein Kind beim Laternegehen, und das ihm seine Beute zutreiben soll.
Harmloser als der Anglerfisch ist der Scheibenbauch, auch Schneckenfisch genannt, wegen seiner schleimigen, schuppenlosen Haut und der energiesparenden Langsamkeit, mit der er durchs Leben gleitet und, eher stumpf, nichts als Flohkrebse verspeist.
Die meisten dieser Tiefseebewohner aber sind winzig, für das menschliche Auge unsichtbar: Bakterien, Einzeller, exotische Parasiten, die wenige Mikrometer lang sind. Denn ein großer Organismus bedeutet Aufwand in der Unterhaltung, die Proteinketten, die etwa die Muskulatur ausmachen, drohen unter dem Druck ständig zu verklumpen, was den Tod bedeutet. So sind die meisten Seegurken, die an die neunzig Prozent der bodennahen Biomasse ausmachen, klein, primitive Bodenstaubsauger, die alles abgrasen, was nach unten sinkt – manche Arten können allerdings bis zu zwei Meter lang werden. Und sehr selten gibt es sogar Säugetiere, die diese Tiefen aufsuchen: Pottwale zum Beispiel; die Zellen der Pottwale stellen ein Enzym her, das die Verklebung ihrer Eiweißketten verhindert.
*
Und dann existiert in diesen tiefsten Bereichen noch ein anderes riesiges Wesen. Eine Kreatur, die dem raubgierigen Pottwal ein mehr als ebenbürtiger Gegner ist, die ihn an Größe sogar noch weit übertrifft – es ist ein mutierter Verwandter des Pazifischen Riesenkraken Enteroctopus dofleini, aus der Familie der Echten Kraken, der Octopodidae.
Sein Name: Megaloctopus octaviae.
Hierbei handelt es sich um eine äußerst seltene und nahezu unbekannte Spezies, ein Oktopus, einigen Spezialisten bekannt, aber unbelegt, unerforscht – und würden die Wissenschaftler sich einem lebenden Tier widmen können, hätten sie mehr Fragen als Antworten.
Der Megaloctopus erreicht eine Gesamtlänge von etwas mehr als fünfzig Metern, die Länge der Tentakel schwankt zwischen neunundzwanzig und vierundzwanzigeinhalb Metern; die Kopflänge: mehr als neun Meter; die Spannweite der Tentakel beträgt zweiundsechzig Meter; und dieses ungeheuerliche Wachstum verdankt Megaloctopus octaviae schlechterdings der Tatsache, dass er nicht gestorben ist. »Normale« Kraken (aber die Evolution unterscheidet nicht zwischen »normal« und »neuartig«, sie probiert, spielt, experimentiert) werden allenfalls zwei Jahre alt. Megaloctopus octaviae erreicht jedoch eine Lebensspanne wie ein Pottwal, bis zu achtzig Jahren. Wie und warum, das ist eine andere Frage.
Während dieser Zeit wächst er – und er lernt. Kraken sind ohnehin hochintelligent, allerdings auf eine ganz andere Art als wir Menschen. Für uns nicht nachvollziehbar. Und im Normalfall setzt ihr kurzes Leben dem Lernpensum der Kraken ohnehin eine Grenze. Hier nicht. Seine lange Lebensdauer gibt Megaloctopus die Chance, viel mehr Wissen anzusammeln.
*
Bei dem Megaloctopus octaviae, der im Marianengraben lebt, handelt es sich um ein relativ junges weibliches Tier mit drei abgabereifen Eierstöcken. Hat das Weibchen sich unlängst von einem Männchen befruchten lassen, oder fand die Samenabgabe vor längerer Zeit statt und der Samen wurde gleichsam in einer Hauttasche gebunkert?
Und warum gehen diese Tiere von Zeit zu Zeit, aus bisher ungeklärten Gründen, auf Wanderschaft? Dass Tiere wandern, ist nicht ungewöhnlich, Grauwale legen bis zu zwanzigtausend Kilometer zurück, Flussaale immerhin mehr als fünftausend Kilometer. Die meisten Oktopoden-Arten sind heimische Tiere, sie verlassen ihr Habitat nur im Notfall, wenn sie eine Gefahr kommen sehen.
Das Exemplar, von dem die Rede ist, welches das Habitat im Marianengraben bewohnte, bei elf Grad nördlicher Breite, hat diese Umgebung bereits vor neun Wochen verlassen, aus ungeklärten Gründen – möglicherweise aus einem Fluchtimpuls heraus, vielleicht, weil ein Seebeben bevorsteht, das gibt es hier häufig. Vielleicht ahnte das Tier eine viel umfassendere Veränderung der Verhältnisse auf dem Planeten.
Mit seiner Größe, durch seine Anpassungsfähigkeit kann es sich jedenfalls aufmachen, kann wandern – anders als eine Seegurke oder ein Anglerfisch.
So beginnt es also.
Es beginnt damit, dass Megaloctopus octaviae, ein junges Weibchen mit befruchteten Eiern, riesig und seltsam, sein Habitat verlassen hat. Es ist unterwegs – irgendwohin. Ausgerechnet dieser Kreatur ist es vorherbestimmt, eine Geschichte in Gang zu setzen, die Tod, Gefahr und Verderben über unzählige Menschen bringen könnte.
Isla Robinson Crusoe, etwa 700 Kilometer vor der chilenischen Pazifikküste
Die Isla Robinson Crusoe: ein grüner Punkt im Südpazifik. Ein kleines Eiland vulkanischen Ursprungs. Im Inneren ein paar Anhöhen mit Misch- und Regenwald, außen ein schmaler Sandstreifen. Das Ganze gottverlassen und scheinbar unbewohnt – doch der Schein trügt.
Politisch gehört die Insel zu Chile. Aber die Regierung hat sie vor zwei Jahren an eine Non-Profit-Organisation verpachtet, die angeblich ein Naturreservat daraus machen wollte. Der Plan sah vor, hier Seelöwen auszuwildern, außerdem einige endemische Vogelarten, vor allem Juan-Fernandez-Kolibris. Der Regierung und auch der Oberen Naturschutzbehörde in der Hauptstadt Santiago war das nur recht. Inseln wie diese bringen nichts ein. Alles in allem sind sie belanglos, harmlos.
Doch die Isla Robinson Crusoe ist nicht harmlos.
Ginge man an Land, so stünde man zunächst an dem weißen Sandstrand, der die Insel fast rundum säumt, aber nicht sehr breit ist. Das Eiland selbst ist klein: achtundvierzig Quadratkilometer, in zwei strammen Tagesmärschen könnte man die Insel umrunden, theoretisch. Allerdings käme man als unangemeldeter Besucher nicht weit. Denn die Überwachungssysteme sind ausgezeichnet. Kameras, Infrarotmelder, Drohnen. Das Wachpersonal besteht aus drei Teams, ausgerüstet mit Handfeuerwaffen, Maschinengewehren, Plastikschrot, Betäubungswaffen. Die Männer und Frauen werden ausgezeichnet bezahlt und wurden von einer privaten Sicherheitsfirma angeheuert.
Der Komplex, den sie überwachen, ist ein ehemaliges Gefängnis. Das Gebäude ist riesig und alt, es stammt noch aus der Pinochet-Diktatur. Doch man hat es entkernt und sehr gründlich umgebaut. Ein Teil ist ein Labor; in einem anderen Teil der Anlage werden Experimente durchgeführt – Experimente an lebenden Menschen.
Die Frauen und Männer, an denen diese Experimente durchgeführt werden, sind infiziert. Damit sind sie anders als andere Menschen, in einem umfassenden Sinne. An ihnen wird in vitro etwas studiert, was auf der Welt fast noch unbekannt ist. Es handelt sich nicht um ein Bakterium, auch nicht um ein Virus, sondern um etwas Neuartiges.
Das, was diese Menschen in sich tragen, hat Besitz von ihnen ergriffen.
Die Ansteckungsgefahr ist extrem hoch. Das, was die Testpersonen oder Probanden, wie sie genannt werden, in sich tragen, könnte auf uns alle übergreifen, auf jedes Kind, jede Frau, jeden Mann. Die menschlichen Versuchskaninchen leben hinter Glasfronten, streng isoliert.
Die Probanden sind in Wahrheit also so etwas wie Versuchstiere; Labormäuse in Menschengestalt.
Zuletzt lief hier nicht alles, wie es sollte. Es gab Probleme. Einige der Probanden sind teilweise lethargisch, teilweise autoaggressiv. Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen, die Nerven liegen bloß, die kleinste Kleinigkeit wirkt wie ein Peitschenhieb. Manchmal sind ihre Gehirne erfüllt von einem einzelnen Ton: ein Jaulen wie ein Feueralarm.
Es hat Schlägereien und eine Messerattacke gegeben, dabei gab es einen Toten, die Security musste die Leiche entsorgen, die Probanden konnten sich nicht mal dazu aufraffen. Viele von ihnen sind außerdem hygienisch verwahrlost, leiden an Ekzemen und Zahnfäule. Etliche haben sich sinnlose Verstümmelungen zugefügt, eine Frau hat sich die Zunge abgeschnitten, ein Auge ausgestochen – die Kameras haben all diese Schrecklichkeiten aufgezeichnet.
Der wissenschaftliche Leiter dieser Anlage hat die Aufnahmen natürlich genauestens studiert.
Gerade sitzt er an einem Elektronenrastermikroskop und vergleicht Proben molekularer Sequenzen. Das Labor, in dem er sitzt, ist gesichert durch drei Zugangsschleusen mit antibakteriellen Sprüh- und Vakuumkammern. Die letzte Tür ist eine schwere Stahltür, mächtig wie der Eingang zu einem Tresorraum.
Der wissenschaftliche Leiter, der Jefe, wie sie ihn nennen, der Chef, ist ein hochgewachsener Mann, ein dunkler Typ, gut aussehend, athletisch. Aber die Anstrengungen der vergangenen Stunden sind ihm anzumerken; der Druck, dem er sich ausgesetzt hat, ist enorm.
Gleichzeitig ist sein Ehrgeiz unbändig: Seine Experimente gelten nicht nur ein paar Probanden auf einer abgelegenen Insel. Sein Ziel ist vielmehr die gesamte Menschheit.
Das Labor ist technisch auf dem modernsten Stand: drei Elektronenmikroskope, TEM, SEM, Cryo-SEM, Lichtmikroskope, Hochleistungs-Server, Klimaschränke der neuesten Generation, Laboröfen, Umlaufkühler, Schüttelwasserbäder, ein eigenes Isotopen-Labor – hier fehlt kein Gerät. Was fehlt, ist jedoch das Material, an dem er arbeiten kann: Er braucht frisches, biologisch unverändertes Erbmaterial, so, wie ein Bildhauer einen rohen Stein benötigt. Der Mann hatte dieses »Material«, um es wertfrei zu bezeichnen, lange Jahre gehütet wie einen Schatz. Inzwischen aber ist es »zerbastelt«, wie Biochemiker sagen. Zu viele Modulationen haben die Molekularstruktur zerhackt, alles Material ist aufgebraucht.
Für den Mann ist das schlecht. Sehr schlecht sogar. Er lässt sich das nicht anmerken, sein Geldgeber darf nichts erfahren, aber eigentlich handelt es sich um eine wahre Katastrophe. Würde der Geldgeber wissen, wie die Lage ist, könnte der Jefe seine ehrgeizigen Träume begraben, für immer. Er muss ihn also anlügen. Und das tut er.
Er arbeitet konzentriert, er hält den Anschein aufrecht, aber in Wahrheit ist er verzweifelt. Außerdem natürlich erschöpft, kein Wunder. Da er darauf besteht, alles selbst zu machen, schiebt er lange Schichten. Heute zum Beispiel arbeitet er bereits seit achtzehn Stunden. Seine Kondition ist allerdings phänomenal.
Er überlegt, ob er sich noch einen Kaffee holen sollte, damit könnte er noch vier oder fünf Stunden durchhalten. Vielleicht sogar gezuckert? Aber nein, das wäre Schwäche, die er sich nicht leisten kann. Er wird ein Glas Wasser trinken, das muss genügen.
Seine Funkverbindung blinkt. Der Mann drückt die Taste. »Ja?«
»Herr Doktor? Entschuldigen Sie die Störung. Da gibt es etwas, das Sie sehen sollten … Ein Oktopus ist aufgetaucht, möglicherweise handelt es sich um dieselbe Spezies, nach der Sie suchen lassen. Und jetzt ist er plötzlich aufgetaucht.«
»Wo?«
»In Europa.«
»Genauer!«
»Verzeihung. In Deutschland. An der Ostseeküste. Es ist schon in den Medien, es ist die absolute News …«
»Stellen Sie mir einige Informationen auf den Schirm. Ich rufe zurück.«
»Jawohl, Jefe. Wird gemacht.«
Der Mann geht zu seinem Laptop, ruft ein paar Dateien, ein paar Sendungen auf. Dann greift er zum Telefon. »Ich muss dorthin. Organisieren Sie die Reise.«
»Jawohl, Herr Doktor.«
»Und ich brauche meinen Assistenten. Rufen Sie Mutterperl, sofort. Und vielleicht noch ein paar Techniker.«
»Jawohl, Sir.«
Der Mann legt auf. Er schließt die Augen, atmet tief ein. Sein Gesicht ist unbewegt, es könnte genauso gut das Gesicht eines lebenslänglich Verurteilten sein.
Sydney Opera House, Australien
Das Opernhaus von Sydney befindet sich auf einer »Bennelong Point« genannten Halbinsel unweit des verzweigten Hafengebietes. Es ist ein Viertel, das Touristen gern zu Fuß erkunden. Hier gibt es Sportboothäfen, Reste von Containeranlagen, Bootsbauer, Galerien, Yachtverleiher, edle Restaurants, lustige Kneipen und Cafés, einen großen Park mit dem Government House, dem Sitz des Gouverneurs. Und hier steht, über die Macquarie Street zu erreichen, das Wahrzeichen der Stadt Sydney, der größten, betuchtesten und schönsten Stadt Australiens.
Es ist das weiß-leuchtende Opernhaus mit seiner Architektur aus keramikbesetzten Segeln, eines der berühmtesten Gebäude der Welt, ein elegantes Bauwerk, das sich wie ein spreizender Riesenvogel der Wasserseite zuwendet. Als das Gebäude endlich fertiggestellt war, nachdem die Kosten, nebenbei gesagt, das Vierzehnfache der angesetzten Summe erreicht hatten, machten die Bürger von Sydney ihren Frieden mit dem Ding. Erst gewöhnten sie sich, dann liebten sie es. Ein junger Journalist, der mit lyrischen Anwandlungen zu kämpfen hatte, schrieb, dass »die Sonne nicht wusste, wie schön ihr Licht war, bis sie es auf diesem Gebäude reflektiert sah«.
Jedenfalls – dies war der Schauplatz.
Die Operation beginnt am Abend, während einer Aufführung, beginnt um 20.40 Uhr, kurz nach den ersten Klängen des dritten Aktes. Gegeben wird an diesem Abend eine der berühmtesten Opern der Musikgeschichte, »Turandot« von Giacomo Puccini.
Die Premiere ist ausverkauft. Die Abendgarderobe ist festlich, zumeist teure Abendkleider, Smokings.
Die 2 866 Zuschauer sitzen auf ihren Plätzen. Die Musik setzt ein, Streicher, Holzbläser, gedämpftes Blech. Gleich wird der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich berühmteste, jedenfalls teuerste Tenor, ein Star namens Fernando Fernandes Castillo aus Sevilla, mit dem die männliche Hauptrolle, der Prinz Calàf, besetzt ist, eine der schönsten Arien der Musikhistorie anstimmen. Die Arie heißt »Nessun Dorma«.
Martindale sitzt allein in seiner gläsernen Loge. Manchmal kommt er in Begleitung, aber meistens allein, er genießt es. Die Musik erklingt.
Die gläserne Loge, in der er sitzt, ist das Ergebnis zäher Verhandlungen und gewiefter Schachzüge. Das Opernhaus musste saniert werden, aber das Geld fehlte. John Garreth Martindale, damals noch nicht Verteidigungsminister der Klima-Allianz, dafür aber ein großer Freund der Oper, hatte seinerzeit seine Privatschatulle geöffnet und für den Umbau einen dreistelligen Millionenbetrag gestiftet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten viele noch gar nicht gewusst, wie reich Martindale eigentlich war – jetzt wussten sie’s.
Es gab auch andere Sponsoren, aber niemand konnte bezweifeln, dass Martindale die Oper praktisch im Alleingang gerettet hatte. Mit solchen Taten macht man sich nicht nur Freunde. Vor allem, als die Bedingungen bekannt wurden: Martindale verlangte fünfzehn zusammenhängende Sitzplätze im vorderen Rang für sich, um dort einen Glaskasten, eine Art Loge, einsetzen zu lassen. So könne er Aufführungen gemeinsam mit dem Premierenpublikum genießen – es sei zwar eine Privatloge, ja, aber eben nicht, um sich abzugrenzen, sondern um physisch sicher zu sein. Ohne Angst vor Attentaten, die gegen einen Mann wie ihn nun mal nicht auszuschließen waren.
Martindales Verhandlungsvorteil gegenüber den Leuten im Opernhaus-Vorstand, im Beirat, bei der Kulturbehörde bestand darin, dass es keinen anderen Geldgeber weit und breit gab, keinen, der derart großzügig sein wollte. Und dass er außerdem warten konnte. Entweder – oder, sagte er.
Er bekam seinen Glaskasten.
Die Loge war ein Würfel aus schusssicherem Panzerglas, mit einer Kantenlänge von vier Metern, mit einem Glasgewicht pro Quadratmeter von 52 Kilo. Roter, altmodisch anmutender Theatersessel, für einen zweiten Sessel war Platz genug. Die Loge war im Notfall auf Knopfdruck verschließbar, mit eigener Sauerstoffversorgung für 72 Stunden, mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus zur Stromversorgung, das ganze Ding vorn auf den Rang gesetzt und nach oben hin zusätzlich mit vier Stahlseilen verankert. Die Vorderseite, zur Bühne hin, konnte geöffnet werden, während die Aufführung lief.
Wie auch jetzt. Die Loge ist zur Bühne hin geöffnet, Martindale genießt die Musik.
*
Die Entführer, ein Team aus 32 Leuten, sind auf ihren Positionen. Drinnen läuft das Operngeschehen, draußen ist es ein herrlich warmer Novemberabend, Frühling auf der Südhalbkugel, die Bars haben Tische und Stühle herausgestellt, vor dem Stand eines Eisverkäufers steht eine kleine Schlange. Der Eismann macht gute Geschäfte.
Und dann nicht mehr.
Denn jetzt explodiert, in Sichtweite des Eisverkäufers, nämlich am Circular Quai, dem Fährterminal, eine Reihe von neun kleineren Sprengladungen. Sie sind am Anleger platziert, damit Menschen nicht ums Leben kommen, allerdings gibt es Verletzte, zumal die Tanks zweier Fähren in Brand geraten und zusätzlich für Chaos sorgen.
Etwa achtundzwanzig Sekunden sind vergangen.
Chaos ist das erste Ziel der Operation, Chaos und Abriegelung.
Über die Macquarie Street donnert jetzt ein sogenannter Road Train der Marke Volvo-Leyland, ein zweizügiger Lastwagen, ursprünglich zum Transport von Erzen, die Fahrer bremsen und manövrieren das schwere Gefährt derart, dass es quer ausschert und wie ein Bollwerk die gesamte Macquarie Street, die Hauptzufahrt, blockiert. Die breiten Fußwege, die um das Opernhaus angelegt sind, und die auch notfalls befahren werden könnten, werden mit kleineren Semtex-Ladungen gesprengt, Steine, Asphalt- und Betonsplitter fliegen auf und prasseln nieder, die klaffenden Löcher füllen sich rasch mit stinkendem Hafenwasser und Wasser aus den teilweise ramponierten Trinkwasserleitungen. Man hört Schreie, dumpfes Krachen vom Quai. Kreischend steigen Möwen auf.
Diese knapp dreißig Sprengungen werden allesamt ferngesteuert ausgelöst, vom abgedunkelten Hinterzimmer eines kleinen geschlossenen Cafés namens »Surprise«, das ein Strohmann der Entführer vor fünf Monaten gekauft hat. Hier befindet sich der OR, der Operation Room, die Vor-Ort-Kommandozentrale der Entführer, drei Männer und zwei Frauen an Laptops. Sie alle verbindet, dass sie jung sind, hervorragende Hacker. Jene, die nicht aus Überzeugung hier sind, sondern Söldner, werden gut bezahlt. Der Operation Room hat eine eigene Stromversorgung, Hochleistungsbatterien und Generatoren.
Draußen, unter dem kapitänsblauen Abendhimmel und dem gelben Schein der kugeligen und altmodisch anmutenden Straßenlampen, herrscht das erwünschte Chaos.
Gebrüll, Gewimmer, Menschen rennen, Hunde kläffen, Alarmanlagen schrillen und gellen. Jemand steht in Unterwäsche auf einem Balkon, ringt die Hände und ruft unverständliche Dinge, niemand achtet auf ihn. Hier und da lodern Feuer. Der Eiswagen ist umgekippt, der Verkäufer hat das Weite gesucht, Stracciatella, Zitrone, Pistazie, alles mischt sich zu einem Matsch. Gestank nach Verbranntem. Ein Vater steht vor einem klaffenden Loch im Bürgersteig, aus dem schwarzes stinkendes Wasser aufgluckert. Er schreit nach seiner kleinen Tochter auf der anderen Straßenseite, sie solle sich nicht vom Fleck rühren. Ein aufgerissener Rucksack auf dem Asphalt, der Inhalt verstreut, Stifte, Notizblöcke, ein Datenspeichergerät. Eine Frau taumelt, ihr Gesicht blutüberströmt, quer über einen kleinen Platz, sie stolpert, sie fällt hin. Ein alter Mann mit einer hellen Baseballmütze kniet neben ihr, redet auf sie ein. Passanten greifen zu ihren Telefonen.
Niemand weiß, was geschehen ist. Niemand kann sich vorstellen, dass diese Sprengungen nur Theaterdonner sind, dass die Attentäter die Sprengungen genau berechnet haben, damit kein Mensch schwer verletzt wird.
Fast zeitgleich zu den Sprengungen erfolgt der Angriff auf die Mobilfunknetze.
Sie werden durch eine kleine Plasma-Explosion in relativer Höhe über der Bennelong-Halbinsel unterbrochen, ein künstliches Polarlicht – das hocherhitzte Plasma stößt geladene Teilchen aus, die extreme Energie haben und den Funk stören. Die Schnittstellen und Knotenpunkte der Glasfaserkabel werden von Hackern einfach lahmgelegt, abgestellt.
Jetzt bricht die Stromversorgung des Stadtteils zusammen. Diese Attacke war nicht weiter schwierig. Sydney hat bereits vor zwei Jahren, im Jahr 2030, auf emissionsfreie Solar- und Windenergie umgestellt; die Hacker müssen nur die Windkraftanlagen lahmlegen, die zu Tausenden im südöstlichen Bundesstaat New South Wales stehen.
Etwa vier Minuten sind vergangen.
Draußen gehen die Lichter aus, schlagartig, Straßenlaternen, Leuchtreklamen, Schaufenster. Dunkelheit legt sich über das Viertel wie eine schwere Decke.
Die Zuschauer im Opernhaus bekommen von alledem nichts mit, denn im Keller der Oper springen die Generatoren in ihren dreifach schallschutzgesicherten Räumen an. Die Musiker, alle hoch konzentriert, der Dirigent, in der Seitenbühne das Team um den Inspizienten, die Feuerwehrleute, die Männer am Vorhang, die Beleuchter und das Publikum – alle konzentrieren sich entweder auf ihren Job, oder sie sind hingerissen im Kunstgenuss.
Das ist die Qualität großer Musik: Sie kann alles andere ausschließen. Die Szene spielt bei Mondlicht, das Bühnenbild zeigt vor schwarzem Hintergrund nur einen riesigen Vollmond. Der verliebte Prinz möchte, dass alle mit ihm diese Nacht durchwachen.
Nessun dorma!
Vier Noten, wie ein Ruf, ein Appell. Und dann nochmals, aber eine Oktave tiefer:
Nessun dorma! Niemand möge schlafen!
Und so genießen die Zuschauer und übrigens auch die Zielperson der Entführung, Martindale, den aufsteigenden künstlichen Mond, die ersten, schmelzend gesungenen Töne der Arie, fünfunddreißig Takte sind es nur, jener Arie, die alle großen Tenöre gesungen haben, Pavarotti, Domingo, Kaufmann und jetzt eben Castillo, mit dem bei Takt 10 a tempo beginnenden und singbaren, fast schon simplen Motiv, drei schlichte Ganztonschritte vom d zum fis, und wieder abwärts.
Niemand möge schlafen: Es zeugt von Ironie bei den Entführern, dass sie sich ausgerechnet diesen Moment, diese Arie ausgesucht haben, um ihren Plan umzusetzen, den Wunsch des Prinzen, den sie nun ins Gegenteil verkehren.
Denn sie werden jetzt 3 098 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Opernhaus befinden, Zuschauer, Aufführende, Musiker, Techniker, Sicherheitsbeamte, ausschalten.
Weniger als zwei Minuten sind vergangen. Bei Takt 33 der Arie leiten die Entführer über das Belüftungssystem des Opernhauses ein starkes Schlafgas in den Zuschauerraum, ins Parkett, in die drei Ränge.
Und auf die Bühne.
Und auf die Hinterbühne.
Und in den Orchestergraben.
Unsichtbar und unhörbar, so strömt das Gas aus den Luftschlitzen und Düsen. Geruchlos und hoch wirksam, so füllt das Gas das Innere des Opernhauses zu Sydney.
Es ist eine Mischung aus drei Stoffen, Opioiden, nämlich Halothan, einem Inhalations-Anästhetikum, Fentanyl, das oft zur Betäubung großer Wildtiere eingesetzt wird, etwa bei Nashörnern und Straußenvögeln, und das hilft, der Atemdepression entgegenzuwirken. Der dritte Stoff ist Remifentanil, das die Atmung dämpft. Beigesetzt ist außerdem ein diffundierendes Treibmittel, welches dynamisierend wirkt, mit anderen Worten: für sehr schnelle Verteilung sorgt, somit den großen Zuschauerraum in weniger als zwanzig Sekunden füllt. Die Klimaanlage ist neu.
Im engen Orchestergraben tritt die Wirkung des Narkotikums zuerst auf. Die Musiker verlieren, als hätte man sie gelähmt, die Kontrolle über ihre Instrumente. Das Gehirn wehrt sich noch einen Moment lang, es gibt Anweisungen, aber die Hände gehorchen nicht. Die Musik wird stockend, schwammiger, die Klänge zerfließen wie bei einem Ofenkäse, bis auch die letzten Instrumente mit einem winselnden Bogenstrich verklingen, abrutschen. Die Musikerinnen und Musiker, die Streicher, Fagottisten, Blechbläser, der Mann an der Kesselpauke, die Flötisten, sie gleiten ohnmächtig von ihren Stühlen und Hockern, reißen Notenständer mit, Celli fallen polternd zu Boden, eine Querflöte rollt durch den Orchestergraben. Die Flötistin hat Schaum vor dem Mund.
Der Dirigent auf seinem kleinen Podium starrt fassungslos. Aber das Gift tut bereits seine Wirkung, greift auch bei ihm ein in die Elektrochemie der Nervenbahnen. Er hebt noch einmal, wie zur Abwehr, den rechten Arm mit seinem zierlichen Stöckchen, aber dann schon geben seine Knie nach, die der Sänger auf der Bühne ebenfalls, Marionetten, die man fallen lässt. Der Tenor, Fernando Fernandes Castillo, ein großer bauchiger Mann, fällt um wie ein Baum, stürzt zu seinem Glück nicht drei Meter tief hinab in den Orchestergraben, sondern bleibt hingemäht auf der Bühne liegen. Auch die Bühnenarbeiter, die Männer an den Verfolgerscheinwerfern, die Garderobieren, der vierschrötige Inspizient und die bebrillten, zappeligen Operndramaturgen – sie knicken weg, das Publikum, fast 2 900 Zuschauer, die Security-Leute, die Martindale begleiten und bewachen, sie alle sacken weg. Als hätte man sie ausgeknipst.
Für manche ist das Narkotikum zu stark, sie verlieren die Kontrolle über ihre Blase. Zu der Duftwolke von Parfüm, die über dem Parkett hängt, mischt sich der Geruch von Urin.
Ein Bild wie im Märchen, wo Dornröschen in den Zauberschlaf fällt, mit ihr Königin und König und der gesamte Hofstaat, wo alles erstarrt, bis runter zum Küchenjungen. Nur dass es hier keine Märchenspindel gibt, an der Dornröschen sich sticht, vielmehr ein dosierter Cocktail, es ist Berechnung und Chemie.
Den Kidnappern der »Septième« kommt zugute, dass sie die Security des Opernhauses teilweise mit eigenen Leuten unterwandern konnten. Ihre Leute haben, als Techniker und Hausmeister auftretend, ihre nichts ahnenden »Kollegen« ausgeschaltet, wenn auch nicht getötet. Zuvor haben sie die Baupläne besorgt, vor allem die Verstrebungskonstruktion im Dach ist wichtig für das, was jetzt kommt.
Die gefährlichste und kühnste Phase des Plans.
Das gesamte Opernhaus schläft. Kann sein, dass manche von der Melodie träumen. Die Kidnapper, schwarz gekleidet, mit Gasmasken, huschen durch Seiteneingänge herein. Sie bewegen sich schnell und präzise. Sie schleppen große Kisten. Gleichzeitig macht sich auf dem Dach des Opernhauses, direkt über dem Rang, in zweiundzwanzig Metern Höhe, das Outside-Team bereit, ebenfalls mit einer ganzen Batterie von Werkzeugen.
Mehr als 3 000 Menschen sind bewusstlos, ein einziger Mann ist hellwach – das Entführungsopfer, John Garreth Martindale. Denn er hat natürlich längst den Alarm aktiviert, er weiß schon, dass er das Ziel ist. Sein Glaskasten ist mit Sensoren ausgestattet, sofort schließen sich die hydraulischen Türen an der Vorderseite, die normalerweise während der Vorstellung geöffnet sind. Im Alarmfall läuft die Meldung beim nächstgelegenen SWAT-Team ein, am südlichen Stadtrand von Sydney, woraufhin zwei Dutzend Schwerbewaffnete zwei kleine, aber schnelle Helikopter besteigen. Bis das SWAT-Team allerdings am Opernhaus ist, vergehen mindestens sechs Minuten. Das ist das Zeitfenster, das die Kidnapper jetzt haben. Sechs Minuten. Bis 20.50 Uhr.
Die Entführer standen bei ihrer Planung vor dem Problem, dass der Glaskasten nicht leicht zu knacken ist, selbst mit schwerem Gerät. Er kann in weniger als sechs Minuten wahrscheinlich nicht geöffnet werden, zumal in dieser Positionierung oben auf dem Rang – die Entführer veranschlagten für das Aufschneiden mit Diamantschneidern mindestens neun Minuten.
Sie verfielen darum auf ein anderes Vorgehen.
20.45 Uhr. Die Dinge geschehen jetzt gleichzeitig. Das Inside-Team entnimmt den Kisten eine Reihe von Sprengdrohnen, die gestartet werden und zur Saaldecke fliegen. Gefolgt von einer zweiten Staffel von Drohnen, die ein Stahlnetz transportieren. Das Outside-Team hat an genau markierten Stellen Löcher durch das Dach gebohrt, das Stahlnetz wird verbolzt. Die Sprengdrohnen werden gezündet. Auf dem Dach gehen die Leute in Deckung. Die Explosion ist nicht laut, aber ausreichend. Betonbrocken und Teile der Konstruktionsrippen fliegen empor, etliche landen im Stahlnetz, das verhindert, dass die Schlafenden getroffen werden. Die Leute auf dem Dach machen sich eilig daran, das entstandene Loch freizulegen. Die Staubwolke wird mit Gebläse-Maschinen verwirbelt. Sie ziehen das Stahlnetz hoch aufs Dach.
20.45 Uhr, 27 Sekunden: Ein Helikopter nähert sich, ein Boeing XCH-62A, doppelrotorig, Startgewicht: 53,5 Tonnen. Die Attentäter haben ihn mit Bedacht ausgewählt.
20.46 Uhr: Das Outside-Team arbeitet mit sogenannten Sauerstoff-Lanzen, fauchenden Schneidgeräten, die eine Hitze von 5 530 Grad entwickeln. Sie säubern die Lochkanten, legen die pollergroßen Ösen frei, an denen der Glaskasten mit Stahlseilen aufgehängt ist.
Der Helikopter ist über dem Dach. Er lässt über Seilwinden vier Dyneema-Seile ab, eine ultrahochfeste Faser. Die Stahlseile werden mit den Dyneema-Seilen gekoppelt.
20.46 Uhr, 40 Sekunden: Das Loch ist annähernd quadratisch, hat die Maße 4,50 mal 4,50 Meter. Es ist so kalkuliert, dass der Glaskasten gerade hindurchpasst.
20.47 Uhr: Der Helikopter schwebt über dem Durchbruch. Jemand vom Inside-Team gibt mit einer Signallampe das »Okay« Richtung Dach, vom Dach wird es weitergegeben zum Hubschrauber. Der zieht genau senkrecht an.
20.47 Uhr, 22 Sekunden: Der Glaskasten wird durch das freigesprengte Loch im Opernhaus nach oben gezogen, ins Freie; die Zuladung, die an dem Transporthubschrauber hängt, sechseinhalb Tonnen, lässt die Rotoren aufheulen.
Die Frauen und Männer vom Outside-Team seilen sich vom Dach ab, für sie stehen Motorräder bereit, mit denen sie durch das Chaos entkommen können, das sie selbst im Hafenviertel gesät haben.
Als die beiden Hubschrauber mit den SWAT-Befreiungsteams um 20.50 Uhr anrücken, zweieinhalb Minuten später, ist der Transporthelikopter mit dem Glaskasten bereits in sicherer Entfernung. Sie können nicht mehr tun als Spuren sichern, nach Hinweisen fahnden.
*
Der Glaskasten ist so gut gesichert, dass das Auftrennen mit diamantgehärtetem Schneidgerät beinahe zehn Minuten in Anspruch nimmt. Aber die Entführer haben jetzt Zeit; der Transporthubschrauber hat den Glaskasten unbemerkt in einem abgelegenen Lagerhaus abgesetzt. Dann ist er weitergeflogen, um die SWAT-Teams in die Irre zu führen.
Als die Glaswände aufgesprengt werden, lässt sich das Entführungsopfer nicht widerstandslos fesseln, im Gegenteil. Martindale wehrt sich mit Händen und Füßen, mit Fäusten und Tritten attackiert er die Schwarzgekleideten, die ihn zu Boden drücken wollen – aber auch darauf sind sie vorbereitet, sein Temperament ist bekannt, sie setzen ihn mit einem Elektrotaser außer Gefecht.
Im Lagerhaus steht ein Krankenwagen bereit. Martindale wird auf die Krankentrage gelegt, man streift ihm eine Sauerstoffmaske über das Gesicht. Der Krankenwagen fährt los, mit Blaulicht und mit überhöhtem Tempo, als einer von vielen Krankenwagen.
Was die »Septième« mit dieser Entführung bezweckt, darüber wird viel spekuliert werden. Der Spitzname des Opfers lautet bekanntlich »Der Mann, der nie vergisst«. Die Eskalation scheint unausweichlich.
Wohnung von Ariadna Ferrer und Thomas Pierpaoli, Kapstadt, Südafrika
An seinem achtundvierzigsten Geburtstag, einem normalen Dienstagmorgen im Oktober des Jahres 2032, stand Thomas Pierpaoli im Wohnzimmer der freundlichen Altbau-Wohnung, die er sich mit seiner Freundin Ariadna teilte, und dachte über sein Leben und das Alter nach.
Achtundvierzig Jahre. Nun war Pierpaoli mit achtundvierzig Jahren noch kein Greis, aber auch kein Jüngling mehr. Er war irgendwo dazwischen, knapp nach der Halbzeit, einMannin seinen besten Jahren, wie es beschwichtigend heißt. Thomas Pierpaoli war zufrieden mit seinem Leben, dabei kein Mann für große Auftritte. Ihm war eine natürliche Höflichkeit zu eigen, und eine etwas verblichene Ritterlichkeit.
Pierpaoli und Ariadna bewohnten ein Apartment im vierten und obersten Stock eines etwas heruntergekommenen hellrot getünchten Mietshauses in Kapstadt, Südafrika, im Stadtteil Camps Bay. Die Wohnung hatte durchaus ihre Nachteile. Zum Büro etwa, wo Pierpaoli arbeitete, in der »Pyramide«, war es ein weiter Weg, wenn man die gefährlichen Straßen vermeiden wollte. Außerdem stand das Haus – eigentlich waren es drei Häuser, die nebeneinander erbaut worden waren, ein rotes, ein grün getünchtes, ein orangefarbenes – an einem Abhang und verrutschte gelegentlich um ein winziges Stück. Irgendwas mit dem Fundament stimmte nicht. Dann gab es Risse in den Wänden, und die Bilder hingen schief. Für Pierpaoli war das beunruhigend, Häuser sollten besser an Ort und Stelle bleiben.
Seine Freundin Ariadna hingegen fand es erheiternd, wie sie sagte, es sei lustig, in einem Haus zu wohnen, das einen eigenen Willen hatte. Und sie liebte die Aussicht: am Morgen das tanzende Sonnenlicht über den Baumkronen, am Abend das opernhaft-prachtvolle Farbspiel eines Sonnenuntergangs am Meer. Die Sonne, größer werdend, bevor sie das Wasser berührte. Die violetten Schatten, kurz bevor sie versank. Wenn sie sich entscheiden sollte zwischen einem Sonnenuntergang und der Baustatik, war für sie die Entscheidung klar.
Das Haus hatte allerdings auch für Pierpaoli einen Vorteil. Der Besitzer der drei Gebäude, ein kleiner, sorgsam gescheitelter Inder namens Patel, hatte Pierpaoli erlaubt, auf der Dachterrasse ein Gewächshaus aufzustellen, für ein kleines Aufgeld. Pierpaoli züchtete dort Tomaten. Vor allem die Sorten Kumato, Green Zebra, Kalimba, er kreuzte aber auch Tengeru und Tanya, sein Ziel war es, eine schmackhafte, schnell wachsende und transportfähige Sorte zu züchten. Jeden Abend zog er sich dorthin zurück und fuhrwerkte mit Muttererde, Dünger und Gießkanne; er liebte es.
Pierpaoli nippte jetzt an seinem Kaffee. Er hatte noch etwas Zeit, bevor er ins Büro musste. Das Büro befand sich in der »Pyramide«, offiziell das »Hochkommissariat für die Neuordnung der Welt«. Dort war das Verwaltungszentrum des mächtigen, vor sieben Jahren gegründeten Staatenbundes – der »Klima-Allianz«.
Pierpaoli bekleidete dort eine Stelle als Unterabteilungsleiter im Bereich Science Control, dem Bereich oblag die Kontrolle der diversen wissenschaftlichen Ansätze zur Klimarettung. Insgesamt war es ein eher mittlerer Posten, was ihn aber nicht zu stören schien. Die »Pyramide« und auch die acht anderen Gebäude der Staatenvereinigung befanden sich in Oranjezicht, im Süden von Kapstadt. Inzwischen arbeiteten dort mehr als 190 000 Menschen. Politische Beamte, Wissenschaftler, Parlamentarier und Regierungsstellen hatten dort ihre Büros und Labore – es war das politische Gehirn der Welt. Und natürlich waren dort die Hauptverwaltungen der diversen Geheimdienste untergebracht.
Viele Mitarbeiter wohnten in der Nähe, aber für Ariadna kam es nicht infrage, in einem abgeschotteten »Compound« zu leben, auch wenn es dort sehr luxuriöse und dennoch erschwingliche Häuser gab. Sie war Sängerin, Musikerin, sogar berühmt, ein Popstar – aber der Sonderfall eines Popstars, der normale Lebensumstände vorzog. »Tom, kein goldener Käfig für mich«, hatte sie gesagt. Pierpaoli mochte das. Sie waren beide genügsam, klar, ehrlich und einfach, und diese Lebenshaltung verband sie – in anderen Dingen waren sie sehr gegensätzlich.
In Stilfragen und im Auftreten wirkte Pierpaoli wie ein klassischer Konservativer. Er trug an diesem Morgen ein hellblaues Businesshemd, dazu einen leichten hellgrauen Anzug aus Baumwolle. Er war einer der Letzten gewesen, die noch eine Krawatte getragen hatten, neuerdings verzichtete er darauf. Nie allerdings hätte er es über sich gebracht, wie etliche seiner Kollegen, in Jeans und verblichenen T-Shirts zur Arbeit zu erscheinen. Pierpaoli glaubte an gute Umgangsformen, er glaubte auch an Pünktlichkeit, an einen aufgeräumten Keller und an seinen bescheidenen Beitrag für das Gute in der Welt. Natürlich vom Schreibtisch aus; er war ein Schreibtischmensch.
Pierpaoli goss sich eine zweite Tasse ein. Er bevorzugte seinen Kaffee mit etwas geschäumter Hafermilch und einer zarten Schicht Zimt obenauf, er mochte es, wenn der Zimt nicht einen dumpfen Klecks bildete, sondern, nach einem behutsamen Klaps auf den Streuer, in einer duftigen Wolke auf den Milchschaum niederging – das war natürlich unbedeutend, nur eine der kleinen Freuden des Lebens. Aber aus diesen kleinen Freuden, wenn man sie geschickt addierte, setzte sich für Pierpaoli das Glück zusammen.
Von dem Verbrechen hingegen, in das sie hineingezogen werden sollten, Ariadna und er – von diesem Verbrechen, das die gesamte Menschheit betraf, ahnte er noch nichts.
*
Pierpaoli hörte jetzt über sich Geräusche, dumpf. Es klang nach Hammerschlägen. Das war merkwürdig: Über ihrer Wohnung war nur die Dachterrasse, und nur Ariadna und er hatten den Schlüssel. Die Geräusche kamen vom Dach. Wurde das Dach repariert? Der Hausbesitzer hatte nichts davon gesagt. Ariadna auch nicht. Wo war sie eigentlich? Als Pierpaoli aufgestanden war, war das Bett neben ihm leer gewesen, warm zwar, aber leer. Wie auch die Wohnung.
Doch da – jetzt hörte er den Schlüssel in der Wohnungstür, vernahm das Klackern von Absätzen, und Ariadna betrat den Raum: erhitzt, mit dem verwegensten Gesicht, das sich denken lässt, glücklich. Sie wirkte verwuschelt, hatte einen Morgenmantel übergezogen, ein kurzes rosafarbenes und verschlissenes Ding, ihre nackten Beine steckten in schwarzen silberbeschlagenen Cowboystiefeln. Pierpaoli setzte ein fragendes Gesicht auf, wollte auf sie zugehen, aber sie trat einen halben Schritt zurück. Schüttelte den Kopf, etwas theatralisch, legte einen Finger an die gespitzten Lippen. Dann lockte sie ihn mit dem Finger, parodistisch, wie die Hexe im Kindertheater, und wandte sich um, ging voraus, die Treppe hoch zur Dachterrasse.
Pierpaoli folgte ihr, etwas ratlos.
Als er durch die quadratische Luke das Dach betrat, empfingen ihn eine frische Brise, gleißende Helle und eine Überraschung. Ariadna deutete auf die Dachterrasse des Nachbarhauses, mit einem stolz-verhaltenen Lächeln und einer präsentierenden Bühnengeste, als wäre sie die Assistentin eines Zauberkünstlers.
Dort stand ein spiegelndes Ding.
Es war ein Gewächshaus. Davor, drumherum waren Männer zugange, geschäftig, sie knieten oder standen auf Leitern, zogen Folien von Glasscheiben, waren ausgestattet mit gelben Helmen und Zangen und Bohrmaschinen, sie zogen noch die letzten Schrauben an, rieben, putzten, polierten.
Es war das schönste Gewächshaus, das Pierpaoli je gesehen hatte. Es war so groß, dass es fast die ganze Fläche der benachbarten Dachterrasse einnahm.
»Happy Birthday, Tom«, sagte Ariadna. »Für dich. Gefällt es dir?«
Pierpaoli sah schon die Töpfe und Stauden und sah sich selbst schneiden und binden und wässern und ernten.
»Hallo, Tom? Also, ich hab’ das Dach für drei Jahre gemietet, Verlängerung jederzeit möglich, wie bei einer Liebesgeschichte.«
Zwischen die beiden Flachdächer war ein kleiner, aber sehr stabiler Steg gelegt worden.
Die Bauarbeiter waren mehr oder weniger fertig, sie nahmen die gelben Helme ab und machten aufmunternde Bemerkungen, bereit, den stolzen Besitzer, das Geburtstagskind – denn sie waren eingeweiht – auf ihrer Seite zu empfangen, auch, um Lob einzuheimsen, vielleicht auch ein hübsches Trinkgeld. Aber Pierpaoli rührte sich nicht. Er stand wie erstarrt, blickte kopfschüttelnd auf das große, in der Morgensonne glänzende Gewächshaus – bis er seine Fähigkeit zu sprechen wiedererlangte.
»Ari, das ist wunderschön, aber … du bist ja wahnsinnig.«
Ariadna lachte. Sie zog den Gürtel ihres Morgenmantels fester. »Dein altes Gewächshaus platzte aus allen Nähten.«
Pierpaoli sagte nichts, er war überwältigt. Er konnte sich vorstellen, wie viel Aufwand Ariadna betrieben hatte – das Einverständnis des Hausbesitzers einholen, Bauarbeiter auftreiben, ohne dass er etwas bemerkt hatte. Ariadna stand neben ihm und strahlte.
»Danke«, sagte er endlich.
Pierpaoli zog sie an sich. Er atmete den Duft ihrer Haare ein, den Geruch ihres Shampoos, Vanille. Endlich küsste er sie. Die Bauarbeiter auf dem Dach nebenan lachten und applaudierten, einer pfiff auf zwei Fingern, möglicherweise ob des romantischen Bildes, möglicherweise wegen des Anblicks von Ariadna Ferrer, Popstar, in verschossenem Morgenmantel und Cowboystiefeln.
Pierpaoli umarmte sie. Wie konnte es sein, dass diese Frau – die doch jeden Mann auf der Welt haben konnte – ausgerechnet ihn liebte? Was sah sie in ihm? Das war eine Frage, die er sich nie so ganz hatte beantworten können.
Aber so war es wohl. Er musste es einfach akzeptieren.
Sie drückte ihr Gesicht in seine Halsbeuge. »Happy Birthday, Tom.«
In diesem Moment vibrierte etwas in seiner Hemdtasche. Pierpaoli holte sein Telefon hervor und blickte stirnrunzelnd auf das Display. Es war seine Chefin aus der »Pyramide«.
»Da muss ich leider rangehen, Ari.«
»Natürlich.«
Pierpaoli ging ein paar Schritte abseits.
Ariadna spitzte die Ohren. Was sie hörte, waren nur ein paar abgerissene Worte: »Ja« und »Nein« und »Meeting« und »Oktopus« – aber an Pierpaolis Gesichtsausdruck merkte sie, es gab einen Notfall im Büro.
Und tatsächlich, Pierpaoli steckte das Telefon weg und wandte sich ihr zu. Jetzt schien er bekümmert. »Mit der Geburtstagsfeier, das müssen wir verschieben, Ari. Ich weiß, du hast einen Tisch bei Ricardo bestellt …«
Das Ricardo’s war das absolute In-Restaurant von Kapstadt. Ariadna war mit dem Inhaber und Chefkoch befreundet, einem rundlichen Brasilianer namens Ricardo da Silva. Normalerweise musste man ein Jahr zuvor reservieren; nur Ariadna nicht. Sie hatte für Pierpaolis Geburtstagsfeier ein paar gemeinsame Freunde eingeladen, Caroline Corner, Horace Nkunke, Gudrun Sigrunsdóttir, Arthur Redmondis.
»Aber ich muss verreisen. Dringender Auftrag. Ich fahre noch einmal kurz ins Büro, dann muss ich los.«
»Wohin, Tom?«
»Nach Deutschland. Es geht um einen Oktopus. Ein sehr großes Tier. Offenbar ist er da gestrandet, ich weiß es auch nicht, aber es ist heikel, und jedenfalls sind alle sehr aufgeregt deswegen …«
»Moment. Der Riesenoktopus? Der plötzlich aufgetaucht ist? Das kam schon in den News. Was hast du damit zu tun, Tom?«
»Ich soll dort das Lagezentrum übernehmen. Du weißt schon. Wir dürfen in solchen Fällen von Kapstadt aus die Leitung übernehmen, na ja, Organisation, Betreuung der Wissenschaftler, Medien, Kommunikation, biologische Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Wir sind eben die Regierung der Klima-Allianz. Haben also das Vorrecht. Und in Berlin ist man sehr kooperativ. Sie haben die Leitung an uns abgetreten. Deshalb fliege ich hin.«
»Ich finde das faszinierend. Sie sagen, dieses Tier sei eine unbekannte Spezies …«
»Ja. Da kommen jetzt Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Deshalb ist das unser Aufgabengebiet, Science Control. Ich soll das koordinieren. Jedenfalls müssen wir die Feier leider verschieben …«
»Vergiss doch die Feier, Tom! Dieser Oktopus ist eine Sensation! Und ich habe eine Idee.« Sie starrte ihn an. Verwegen.
»Was für eine Idee?«
Die Frage entlockte ihr ein triumphierendes Schweigen.
»Ari? Was für eine Idee?«
»Ich komme mit. Nach Deutschland. Wir feiern deinen Geburtstag im Flugzeug. Ich würde dieses Riesentier gern mal sehen. Meinst du, das ginge?«
»Aber Ari, ich kann dich nicht auf dem Regierungsticket mitnehmen …«
Flüge waren im Jahr 2032 sehr viel teurer geworden; vor fünf Jahren war die Kontingent-Regelung eingeführt worden. Für Privatpersonen gab es nur sehr wenige Plätze.
»Ich organisiere das schon. Ich erkläre es Ricardo. Wir verschieben deine Feier. Glaub mir, ich habe schneller ein Flugticket in der Hand, als du ›Tintenfisch in Deutschland‹ sagen kannst.«
Zweites KapitelDie Geisel
»Pyramide«, Sitz der Klima-Allianz, Kapstadt
Die Nachricht von der Entführung des Verteidigungsministers erreichte und erschütterte das Zentrale Hochkommissariat der Klima-Allianz, im Volksmund »Pyramide« geheißen, am Südrand von Kapstadt gelegen, an diesem Dienstagmorgen gegen 11.32 Uhr.
Die Nachricht war ein Polit-Beben der Stärke sieben, mindestens. Sie setzte sich in Wellen fort, ging als auf- und abschwellendes Zittern durch den gesamten Laden, flackerte als interne Eilmeldung über die Tablets und Laptops, ließ hochgestellte Damen und Herren in ihren Büros ihre Arbeit unterbrechen. Memoranden blieben ungeschrieben, Sandwiches unverzehrt, Prüfberichte ungelesen. Die News rollte vom Ost- zum Westflügel, schwappte von oben nach unten, wirbelte Beamte, Militärattachés, Kulturattachés, Wissenschaftler, Sekretärinnen aus ihren Büros, sie traten auf die Flure, rissen mit einem Haben-Sie-schon-gehört? dieTüren von Büronachbarn auf, drängten sich in debattierenden Grüppchen vor Fahrstühlen, viele mit blassen, erschrockenen Gesichtern, standen eng beieinander in den Raucherzonen und Teeküchen oder zogen sich, sofern sie der weisen und hochgestellten Führung angehörten, mit vom Ernst der Lage erfüllten Gesichtern hinter schalldicht schließenden Chefzimmertüren zurück. Man muss nicht denken, dass dort Klügeres besprochen wurde als irgendwo sonst. Aber Krisen sind auch Momente, wo sich zeigt, wer dazugehört und wer nicht. In Apparaten dieser Macht und Größenordnung ist Information die wichtigste Währung.
Angst ging um unter den mehr als 190 000 Menschen, die inzwischen in der »Pyramide« arbeiteten – und in den umliegenden Vertretungen der Länderblocks: Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Kanada und Neuseeland und im Block der »Gemeinschaft der Länder«. In diesem Fall: zu Recht.
Tatsächlich war die Krise dramatisch.
Ein knappes Bekennerschreiben war in der »Pyramide« und zeitgleich in Australiens Hauptstadt Canberra eingegangen und im Netz veröffentlich worden. Die F.A.P. übernahm die Verantwortung, wobei der Wortlaut unklar war – sprachen die Kidnapper für die gesamte F.A.P. oder lediglich für eine Splittergruppe, die »Septième«?
Martindale hatte loyale Mitstreiter in der australischen Regierung, vor allem bei den Anti-Terror-Abteilungen. Australien hatte seit längerer Zeit Schwierigkeiten gehabt mit der F.A.P.; die Regierung in Canberra fühlte sich verantwortlich für die Sicherheit in der Südpazifik-Region, sie beanspruchte die Kontrolle. Die Chefs der Anti-Terror-Einheit brannten darauf, eine Strafaktion gegen die »Septième« in die Wege zu leiten, am besten gleich gegen die gesamte F.A.P. – was politisch heikel war. Denn die F.A.P. war legal. Außerdem durfte die Regierung der Klima-Allianz diese Eigenmächtigkeit der Australier eigentlich nicht zulassen. Das Monopol für militärische Aktionen lag bei der Regierung in Kapstadt. Allerdings war dies eine Grauzone, eine Frage der Auslegung: War eine »Such- und Strafaktion« noch eine Anti-Terror-Intervention oder bereits als militärisch zu werten?
Die Konflikte waren also geschürt. Eine Eskalation liegt immer erst mal im Interesse radikaler Gruppierungen wie der »Septième«. Die Strafaktionen würden den Volkszorn schüren, die bestehenden Strukturen würden erschüttert. Das war die Situation nach dem spektakulären Kidnapping von Sydney.
Im siebenten Jahr ihres Bestehens war die Klima-Allianz, ein ohnehin zerbrechliches Abkommen, so gefährdet wie nie zuvor.
*
Es ist nicht leicht zu verstehen, wieso die Klima-Allianz einerseits so mächtig war und dennoch so zerbrechlich. Um dies zu erklären, muss man ins Jahr 2025 zurückblenden. Die Gründung der Klima-Allianz war nämlich nicht das Resultat ewiger UNO-Konferenzen und letztlich fruchtloser Debatten. Sie war ein Unterfangen aus der Not heraus, sie durchschlug den Gordischen Knoten des Zauderns und der allgemeinen Lähmung. Die Klima-Allianz wurde von den mächtigsten Staatsführern beschlossen und verkündet als letzte Chance der Menschheit, die Katastrophe aufzuhalten. Entsprechend hart, kantig und entschieden wurden die Ziele definiert.
Es hatte begonnen an einem frostigen Januarmorgen im Jahre 2025, auf dem Capitol Hill, mit der inzwischen historischen Antrittsrede der US-Präsidentin Kamala Harris. Damals wurden bereits die drei Vorgaben ausgerufen: die Begrenzung des Ausstoßes von Kohlendioxid, die Kontrolle des Bevölkerungswachstums, radikale Abrüstung. Die Nationen wurden gedrängt, ihre Armeen aufzulösen und der Regierung in Kapstadt das Monopol für Militäraktionen zu übertragen. Dafür kam ein Staat in den Genuss beträchtlicher Vergünstigungen. Die Klima-Allianz garantierte ihm seine Territorialrechte, der Verteidigungshaushalt konnte also auf ein Minimum reduziert werden. Die Klima-Allianz mischte sich auch nicht in religiöse, staatsrechtliche, kulturelle oder sonstige Belange ein. Nur die drei Ziele waren heilig. Mit dem Geld, das bei den Militärausgaben eingespart wurde, konnten Härten ausgeglichen werden.
Solch einen Schritt hatte es noch nie gegeben in der Geschichte; nie zuvor hatte jemand eine derartige Kühnheit überhaupt zu denken gewagt.
Die Jahre danach waren dramatisch. Man sprach später von einem »Jahrzehnt der Schwarzen Schwäne«. Das Jahrzehnt brachte unerwartete Wendungen, auch politische Umstürze, klimatisch bedingte Krisen, es gab ungeahnte Anstrengungen, aber auch neue Hoffnung. In Brasilien musste die damalige Regierung mit militärischem Druck gezwungen werden, den Regenwald zu schützen. In Russland trat eine neue Regierung an. Nach und nach traten die meisten Länder der Allianz bei, ratifizierten die »drei heiligen Ziele«.