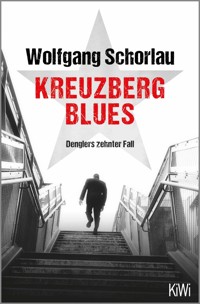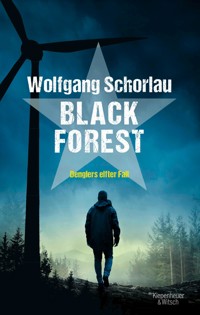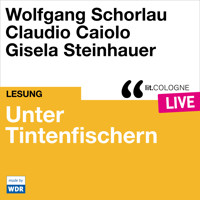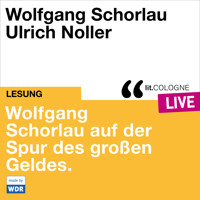9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit – Privatermittler Georg Dengler deckt ein unfassbares Verbrechen aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs auf. Robert Sternberg beauftragt den Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler, Licht in eine merkwürdige Familienangelegenheit zu bringen. In den Unterlagen seiner verstorbenen Mutter hat er einen Vertrag von 1947 gefunden, in dem sein Großvater das alte Schlosshotel in Gündlingen ohne erkennbare Gegenleistung an die Familie Roth überschreibt. Sternberg hofft, den Kontrakt rückgängig machen zu können. Doch bei seinen Nachforschungen stößt Dengler auf eine Mauer des Schweigens. Der Notar, der den Vertrag damals beurkundete, rät ihm eindringlich davon ab, die Vergangenheit aufzuwühlen. Schicht für Schicht enthüllt der Privatermittler die Lügen um ein unfassbares Verbrechen in den Wirren der letzten Kriegstage. Und als er kurz davor ist, die schockierende Wahrheit ans Licht zu bringen, eröffnen Unbekannte die Jagd auf ihn ... Wie in seinem gefeierten Debüt »Die blaue Liste« verwebt Wolfgang Schorlau gekonnt wahre Begebenheiten zu einem packenden Krimi und wirft dabei eine beängstigende Sichtweise auf unsere heutige Wirklichkeit. Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg Blues - Black Forest Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Das dunkle Schweigen
Denglers zweiter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Wolfgang Schorlau
Wolfgang Schorlau lebt und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. 2006 wurde er mit dem Deutschen Krimipreis und 2012 mit dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet.
Näheres über den Autor und dieses Buch unter www.schorlau.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Trotz guter Horoskope: Die Geschäfte des Privatermittlers und leidenschaftlichen Bluesfans Georg Dengler gehen schlecht. Mit kleinen Aufträgen muss der ehemalige Superbulle vom BKA sich über Wasser halten: untreue Ehefrauen überwachen, Vorzeige-Bodyguard auf einer Milliardärsparty spielen, Sozialhilfeempfänger kontrollieren.
Die Ermittlungen in einer scheinbar harmlosen Erbschaftssache führen Dengler in einen kleinen Ort in Süddeutschland – und an den Rand der Verzweiflung. Ein rätselhafter Vertrag dokumentiert: 1947 hat das Schlosshotel seinen Besitzer gewechselt, die Enkel des ehemaligen Eigentümers wollen wissen, was es mit dieser Transaktion auf sich hat. Dengler stößt auf einen Familienkonflikt aus den Tagen der dunkelsten deutschen Vergangenheit und droht an einer Mauer des Schweigens zu scheitern.
Frustriert nimmt er eine Auszeit, lässt einen alten Traum wahr werden und fliegt nach Chicago, um seinen Blueshelden Junior Wells im legendären Bluesclub Theresa’s Lounge live spielen zu sehen. Mitten im Getto der Chicago South Side erhält Dengler einen neuen Auftrag – der ihn wieder in den kleinen Ort nach Süddeutschland führen wird. Und wieder in die Zeit des Kriegsendes. Dengler macht eine furchtbare Entdeckung – und gerät in einen Hinterhalt …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2005, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Vorlage von Philipp Starke, Hamburg
Covermotiv: © photonica/Henry Horenstein
ISBN978-3-462-30019-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Erster Teil
1. Es geht um eine Erbschaftssache
2. Nachdem Sternberg die Rechnung bezahlt hatte
3. Der Jour fixe fand abends statt
4. Als Steven Blackmore wieder zu sich kommt
5. Dengler sah Richard Nolte an
6. Olga saß an dem großen Tisch
7. Sternberg erwartete ihn
8. Dengler startete den Wagen
9. Das macht doch keinen Sinn
10. Die beiden Buben sitzen im Gras
11. Pünktlich um Viertel nach sieben sah er das Wiesel
12. Olga sah ihn entgeistert an
13. Als die Bomben auf Bruchsal fallen
14. Er schwebt über der Hölle
15. Lieber Georg, so lange zögere ich nun schon
Zweiter Teil
16. Es waren zwei Kondome
17. Hinter Stuttgart stand er zwei Stunden im Stau
18. Die Milliardärsparty
19. Denglers Wecker klingelte um halb sieben
20. Einer plötzlichen Eingebung folgend
21. Im Schatten des Waldrandes
22. Dengler parkte am Straßenrand
23. Vor ihm lag das Cockpit
24. Ich kenne Ihren Vater
25. An der Bar stand ein hagerer Mann
26. Es gibt ein Geheimnis
27. Blackmore verließ den Absturzort
28. Kurz nach zehn
29. Er beschloss, im Schlosshotel zu essen
30. Auf einem Leiterwagen
31. Dengler betrachtete Sternbergs Gesicht
32. Als er gehen wollte
33. Als Georg Dengler kurz vor acht ins Basta kam
34. Zwischen den beiden Tunneln
35. Am Morgen rief er im Krankenhaus an
36. Drei Wochen nach der Rizinus-Affäre
37. Sternberg sah Dengler nicht
38. Die Frau in dem gläsernen Empfangsbüro
39. Morgens wurde der Schäferhund gefüttert
40. Die Augen des alten Mannes glänzten
41. In der vierten Nacht
42. Das ist doch kein Kriminalfall
43. Am nächsten Tag
44. Am Abend
45. Sweet Home Chicago
46. Der Volkssturm war in Reih und Glied angetreten
47. Dengler schaute überrascht auf eine kleine Treppe
48. Kurz nach elf betrat Junior Wells die Bühne
49. Am nächsten Morgen
50. Die nächsten Tage
51. Sie streiften gemeinsam durch die Stadt
Dritter Teil
52. Der Rückflug verlief ruhig
53. Die Frau sagte ihm zunächst, was er schon wusste
54. Steven Blackmore saß gefesselt im Spritzenhaus
55. Am Nachmittag
56. Wieder in Stuttgart
57. Die Kripo war in einem neuen Gebäude untergebracht
58. Früh am Morgen
59. Der Wagen brachte sie bis zum Schlosshotel
60. Was machen wir nun?
61. Olga und Dengler frühstückten
62. Was hat sie gesagt?
63. Hier soll ich graben
64. Einer der vier Stellplätze
65. Am nächsten Mittag
66. Das Gewehr lag vor ihm auf dem Tisch
67. Dengler kletterte aus dem Graben
68. Als sie die Pension erreichten
69. Albert Roth dachte, er habe sich verhört
70. Tief und traumlos
71. Kennen Sie das Gündlinger Kreuz?
72. Die Fesseln sind fast durchgescheuert
73. Der Engel hatte Olgas Augen
74. Drei Wochen lang fühlte er sich schwach
75. Dengler wartete, bis es dunkel wurde
76. Dengler stieß die Tür zum Schankraum auf
77. Inmitten des gleißenden Lichtes steht ein Mann
78. Es war still im Schankraum des Schlosshotels
Epilog
Nachwort
Leseprobe »Black Forest«
Für Gabriele
Wurzeln werfen keine Schatten.
Afrikanisches Sprichwort
Die Hartherzigkeit der Reichen berechtigt die Armen zu ihrer Schlechtigkeit.
Marquis de Sade
John Lee Hooker for president!
Eric Burdon
Prolog
Bruchsal, 1. März 1945
Die Granate schlägt unmittelbar hinter dem großen Propeller in den Rumpf der P-51 Mustang und explodiert sofort. Ihr Mantel zerlegt sich in 1500 scharfkantige Splitter, so, wie ihre Konstrukteure es berechnet haben.
Eine Hitzewelle schießt durch die Maschine, und Steven Blackmore fühlt sich inmitten einer weißen, blendenden Hölle. Der plötzliche Luftdruck wirft die Mustang wie einen Ball zur Seite. Steven Blackmores Kopf schlägt gegen die Verstrebung des Kabinendachs.
Dann wird sein Gesicht gegen die Armaturen gepresst.
Er denkt, die Gurte brechen seine Schulterblätter. Er wird in den Sitz zurückgeschleudert, und es ist, als halte eine riesige Faust das Flugzeug plötzlich fest und als stehe es in der Luft still. Vor ihm verformt sich einer der vier großen Propellerflügel zu einer bizarren Skulptur, bevor er aus seinem Gesichtsfeld verschwindet.
Blackmore stemmt sich in seinem Sitz nach vorne.
Ist die Maschine noch steuerbar?
Tankanzeige? Normal.
Bordwaffen testen.
Blick nach rechts.
Aus dem Tragflügel sind alle drei Maschinengewehre herausgerissen, ihre Rohre spreizen sich in grotesken Winkeln gegen den Himmel. Die Waffen in der linken Tragfläche scheinen intakt. Sein Zeigefinger tastet zum Auslöser am Steuerknüppel. Er feuert eine Salve aus den drei MGs der linken Tragfläche. Sie funktionieren einwandfrei.
Seine Augen tasten die primären Fluginstrumente im gelben Sektor ab.
Kurskreisel normal, Künstlicher Horizont normal, Wendezeiger hängt.
Die Maschine befindet sich nicht mehr auf der Flugachse.
Ladedruck gefallen, Climb Variometer: Die Maschine sinkt schnell.
Er steuert dagegen. Die Maschine reagiert nicht.
Höhensteuerung ausgefallen. Wahrscheinlich Hauptholm getroffen.
Die Mustang ist nicht mehr steuerbar.
Ich muss raus.
Seine rechte Hand zieht den roten Hebel auf der rechten Seite.
Klemmt.
Er reißt an dem Hebel.
Zieht mit beiden Händen.
Dann ist das Kabinendach verschwunden.
Er löst die Gurte.
Auf die linke Tragfläche klettern.
Der Tank in der rechten Tragfläche explodiert, ehe er sich aus dem Sitz ziehen kann.
Steven Blackmore wird wie eine menschliche Kanonenkugel in den kalten Märzhimmel katapultiert. Himmelwärts. Die Beine voran. Eine eiserne Faust presst seinen Kopf an den Magen, drückt ihn zusammen, als wolle sie ihn in eine winzige Büchse stecken.
Die tödlich getroffene Mustang rast ohne ihn weiter.
So ist das also, wenn man stirbt, denkt er.
Dann verliert er das Bewusstsein.
Bald kann ich nach Chicago zurück, hatte Steven Blackmore noch am Morgen gedacht. Der Krieg ist gewonnen.
Er verstand die Deutschen nicht.
Warum geben sie nicht auf?
Die amerikanischen Bodentruppen hatten die Grenzen des Deutschen Reiches in der Eifel und im Saarland überschritten, standen im Elsass und bereiteten den Vorstoß durch die Pfalz bis zum Rhein vor. Die Russen würden Berlin einnehmen. Tag und Nacht warfen die alliierten Fliegerströme Tausende von Tonnen Spreng- und Brandbomben auf die deutschen Städte und töteten mehr Zivilisten als in den vorhergehenden Kriegsjahren zusammen. Und trotzdem, Blackmore schüttelte wieder den Kopf, die Deutschen waren dumm: Sie machten in einer aussichtslosen Lage einfach weiter.
Vor zwei Wochen hatte er mit seiner Staffel die Schienen eines Güterbahnhofs einer kleinen Stadt am Rhein gesprengt, deren Namen er längst vergessen hatte. Noch in der Nacht reparierten die Verrückten auf dem Boden die Gleise. Die Aufklärer brachten bereits mittags Fotos von zwei dampfenden Zügen, die Nachschub an die Front im Westen transportierten. Major Waters zeigte ihnen die Bilder und übersetzte auch den Satz, den die Deutschen mit großen weißen Lettern auf eine der beiden Lokomotiven geschrieben hatten: »Räder müssen rollen für den Sieg.« Am nächsten Tag legten zwanzig Flying Fortress einen Bombenteppich über Güterbahnhof und Stadt und verwandelten alles unter sich in ein Gemisch aus Stein und Stahl und Blut und Knochen.
Leutnant Steven Blackmore hatte nach seiner Ausbildung in Tuskegee/Alabama die meiste Zeit des Krieges in Italien gekämpft. Die 332nd Fighter Group, erkennbar an dem rot bemalten Heckleitwerk, gab den Bombern der 12. und 15. Air Forces Geleitschutz, wenn sie von Italien aus Stellungen der Wehrmacht oder Städte im Süden Deutschlands angriffen. Nun waren einige Mustangs nach Toul-Ochey verlegt worden, um den Vormarsch an den Rhein zu unterstützen.
Der 1. März sollte ursprünglich ein Erholungstag sein. Doch frühmorgens kam der Einsatzbefehl. Die Jäger der 352nd Fighter Group vom Flugplatz Chievres in Belgien, die einen großen Bomberstrom aus East Anglia und Kimbolton im Süden Englands ab Straßburg schützen sollten, konnten wegen Nebels nicht starten, und so mussten die Mustangs aus Toul-Ochey einspringen.
Die Besprechung am Morgen war kurz gewesen. Major Waters hatte den Piloten auf der Landkarte die Lage dargestellt, mit dem Zeigestock zog er Kreislinien auf dem aufgehängten Ausschnitt.
»Unsere Truppen stehen unmittelbar vor Saarbrücken und im Elsass. Die Krauts stehen in der Pfalz und werden sich bei unserem nächsten Angriff zurückziehen. Die Air Force will das Gefechtsfeld abriegeln, sodass dem Feind weder ein geordneter Rückzug noch der Aufbau einer neuen Verteidigungslinie möglich ist. Insbesondere werden wir die Zuführung von Truppen und Material auf dem Bahnweg unterbinden. Die Nazis haben kein Benzin mehr und müssen jeden Schuss Munition mit der Bahn an die Front bringen. Sie reparieren in der Nacht und transportieren in der Nacht. Deshalb schalten wir die Bahnverkehrsknoten aus.«
Sein Stock deutete auf einen kleinen Ort östlich des Rheins. Dann nahm er ein Fernschreiben vom Tisch und schwenkte es vor den Piloten.
»Befehl 1679. Legt die Ziele des Einsatzes Nr. 857 von heute Mittag fest. Das ist der Rangierbahnhof Bruchsal, die Rangier- und Güterbahnhöfe Neckarsulm, Heilbronn, Reutlingen, Göppingen und Ulm sowie die Messerschmitt-Teilefertigungen in Baumenheim und Schwabmünchen, das Klöckner-Humboldt-Deutz Panzer-Werk Ulm und das Munitionsdepot Ulm. Ihr Rendezvouspunkt mit dem Bomberstrom liegt acht Kilometer südwestlich von Straßburg. Hier Ihre Flugwegkarten. Irgendwelche Fragen?«
Es gab keine Fragen.
Südlich von Straßburg traf er pünktlich auf den riesigen Bomberstrom, der durch das flakfreie Loch zwischen Karlsruhe und Mannheim nach Deutschland einflog. Das Bild der anfliegenden Bomber beeindruckte ihn jedes Mal aufs Neue. Diesmal waren es über 1000 »Fliegende Festungen«, die ihm »dreistöckig«, das heißt auf drei unterschiedlichen Flughöhen, und in einer Länge von 300 Kilometern entgegenkamen. Der Strom wandte sich ostwärts, und nach 40 Kilometern löste sich der riesige Verband in die einzelnen Combat Wings auf, die ihren vorgegebenen Zielen entgegenflogen.
Blackmore begleitete drei Verbände, die sich von dem riesigen Bomberstrom getrennt hatten: die 379th, die 303rd und die 384th Bomb Group. Zusammen waren es 117 schwere B-17-Bomber, die auf Bruchsal zuflogen.
Mit deutscher Gegenwehr rechnete er nicht. Die feindlichen Piloten verloren seit einigen Monaten jeden Luftkampf gegen die Mustangs. Die Krauts litten unter Treibstoffmangel, und wegen des Treibstoffmangels konnten sie ihre Piloten nicht mehr ausbilden. Hitler schickte sie mit nur wenigen Flugstunden in den sicheren Tod.
Sie bemerken uns zu spät. Wenn wir von hinten kommen, sehen sie uns gar nicht.
Blackmore hatte in diesem Jahr bereits drei Messerschmidt abgeschossen, und sie waren leichte Beute gewesen.
Auch die einstmals gefürchtete Flak war stumm geworden. Die deutschen Städte lagen wehrlos unter ihnen. Nur selten standen noch die kleinen weißen Wölkchen am Himmel, die entstanden, wenn eine Flakgranate explodierte und sich in ihre gefährlichen Splitter zerlegte. Die gefürchteten Granatteppiche, die die Piloten der B-17-Bomber früher in Panik versetzten, gab es schon lange nicht mehr. Wenn jetzt Flakfeuer eröffnet wurde, dann schossen die Krauts planlos und ungenau. Waters hatte ihnen erklärt, die Deutschen hätten die Flakbesatzungen komplett an die Ostfront verlegt. Im Westen würden nun Kinder und Jugendliche die Flugabwehrkanonen bedienen. Die Piloten hatten stumm dagesessen, und nicht alle glaubten Waters.
Die drei amerikanischen Bombergruppen, die Blackmore mit seiner Fighter Group zu schützen hatte, flogen gestaffelt hintereinander, zuerst die 379th, dann die 303rd und schließlich die 384th Bomb Group. Jede der drei Gruppen bestand wiederum aus drei Schwadronen, die unterschiedlich hoch flogen. Zunächst kam auf einer mittleren Höhe die Lead Squadron mit 12 Bombern. Hinter ihr, nach links versetzt und tiefer fliegend, folgte die Low Squadron mit 13 Maschinen. Dahinter rechts versetzt und am höchsten flog die High Squadron mit 14 Maschinen. Dann folgte die nächste Bomb Group mit wiederum drei Squadrons. Die drei Bomb Groups hielten fünfzehn Kilometer Abstand, nicht mehr als drei Flugminuten Distanz.
Blackmore zog seine Mustang an die Spitze des ersten Verbandes. Um 13.41 Uhr bog er mit der Lead Squadron der 379th Bomb Group, die die erste Angriffswelle bildete, über Pfalzgrafenweiler im Schwarzwald in eine Nordkurve und nahm Kurs auf Bruchsal. Blackmore hielt sich jetzt links des Verbandes. Vier bis sechs Zehntel Bewölkung, registrierte er. Dann rissen die Wolken auf, und er sah plötzlich Häuser. Er überflog sie, und hinter ihm regneten Bomben auf die Stadt.
Als die zweite Angriffswelle nahte, bemerkte er, dass die High Squadron zu nahe an den vor ihnen fliegenden Bombern klebte. Deshalb scherte der Verband jetzt aus, flog eine weite 360-Grad-Kurve und setzte sich hinter die B-17-Bomber der dritten Angriffswelle. Blackmore zog seine Maschine ebenfalls in eine weite Rechtskurve.
Da sah er fünf Kilometer vor sich zwei weiße Wölkchen auf 5500 Meter Höhe.
Flakfeuer!
Er korrigierte den Kurs der Mustang und entsicherte die Bordwaffen.
Als er auf die deutsche Stellung zurast, dorthin, wo er sie vermutet, erfasst ihn eine maßlose Wut.
Vor zwei Tagen hatte es im Casino eine Schlägerei gegeben.
An diesem Abend spielte eine weiße Combo, und natürlich spielten sie wieder schwarze Musik. Der Saxophonist war ein kleiner, rothaariger Mann mit dickem Bauch und unzähligen feinen blauen Äderchen um die Nase. Bestimmt ein Ire, dachte Blackmore. Der Mann blies die Backen auf wie ein Ochsenfrosch aus dem Mississippi-Delta. Er versuchte, Charlie Parkers Stil zu imitieren, dessen halsbrecherisch schnelle Tonkaskaden zu spielen, aber es gelang ihm nicht. Er schwitzte, seine Finger kamen nicht mit, er überging einzelne Töne – alle schwarzen Soldaten bemerkten es mit Genugtuung: Parker war zu schnell für ihn.
Den weißen Jungs auf der Tanzfläche machte das nichts aus. Sie tanzten, lachten und schwangen die französischen Mädchen im Kreis, die gerne zu der Einladung auf den Luftwaffenstützpunkt gekommen waren, getrieben halb von Zuneigung zu den Befreiern, halb von ihrer Neugier auf den American Way of Life.
Als die Combo sich an »Groovin’ High« wagte, stand plötzlich Sergeant Sonny Cotton, Blackmores schwarzer Bordmechaniker, mit seinem Saxophon vor der Bühne. Der Sänger der Band, der mit seinem dunklen, nach hinten gekämmten Haar wohl italienischer Abstammung war, sah ihn, reichte ihm die Hand und zog ihn auf die Bühne. Der kleine Ire trat sofort zur Seite und räumte den Platz vor dem Mikrophon.
Blackmore kneift die Augen zusammen und starrt durch das Glas des Cockpits. Die Sonne steht hell am Himmel. Er sieht die Flakstellung nicht. Wo stecken die Krauts?
Sobald Sonny vor dem Mikrophon stand, war er der Star auf der Bühne. Er hielt das Instrument eigentümlich abgewinkelt von seinem Körper, und er spielte wirklich Charlie Parker. Er beatmete mit seinem Saxophon die Combo. Die Töne kamen nun schnell und stoßweise. Der Schlagzeuger erwachte aus seiner Routine, konzentrierte sich, schlug schneller und härter. Der Trompeter wandte sich Sonny zu, suchte den musikalischen Dialog mit ihm, und mit einem kleinen Schwenk seines Instruments machte Sonny ihm den Weg frei für ein Solo. Der schwarze Saxophonist in der Ausgehuniform, die beige Krawatte lässig hinter dem zweiten Knopf im Uniformhemd versteckt, war der Mittelpunkt auf der Bühne. Instinktiv rückten die anderen Musiker näher zu ihm auf. Die Musik bekam den Swing, den sie brauchte, um nicht nur die Beine, sondern auch die Seelen der Tanzenden zu erreichen.
Blackmore bemerkte, wie der Tanzstil der Paare auf der Bühne sich änderte. Sie tanzten nun freier. Und schneller.
Die Soldaten an den Tischen waren aufgesprungen und klatschten. Die Paare wirbelten auf der Tanzfläche. Die Kellner kamen nicht mehr durch das Gewühl. Blackmore erinnerte sich an seine besten Stunden in der Green Mill in Chicago, dem Lokal, das er manchmal aufsuchte, obwohl es im Norden der Stadt lag. Dort gab es keine Rassentrennung wie in der Army. Wenn dort die Musik diesen bestimmten Hitzegrad erreichte, dann fiel das unsichtbare Seil in der Mitte der Tanzfläche, das schwarze und weiße Besucher voneinander trennte, und die Paare und die Hautfarben mischten sich zu einem freien Durcheinander.
So war die Stimmung im Casino an diesem Abend vor zwei Tagen. Sie näherte sich dem Siedepunkt, und daher achtete niemand auf die vier weißen Soldaten, die im Hintergrund tuschelten, ohne den Blick von der Bühne zu wenden, sich besprachen und dann weitere Weiße zu sich riefen. Wie eine drohende Masse standen sie eine halbe Stunde später neben der Eingangstür und starrten zur Bühne, zu Sonny, der erneut Charlie Parker mit einem Solo huldigte. Weitere weiße Soldaten mit finsteren Gesichtern sammelten sich an der Tür, und als es zwanzig waren, die sich stark und betrunken genug fühlten, marschierten sie los, stießen die Tanzenden zur Seite, bahnten sich einen Weg zur Bühne. Ein paar Jungs auf der Tanzfläche und einige der französischen Mädchen protestierten, als sie von ihnen angerempelt wurden, aber sie tanzten weiter, als der Trupp an ihnen vorbei war.
Vor der Bühne griffen zwei nach Sonnys Hosenbeinen. Der blies immer noch sein Solo und bemerkte es nicht. Er schüttelte ein Bein, ohne hinzusehen, als könne er so einen lästigen kleinen Köter abwehren. Dann rissen sie an seinen beiden Beinen gleichzeitig, und Sonny ging zu Boden. Er versuchte, mit der ausgestreckten Rechten sein Saxophon in der Luft zu halten, um es beim Sturz zu schützen. Doch kaum lag er auf dem Bretterboden, den rechten Arm mit dem blitzenden Instrument in die Luft gereckt, zogen sie ihn an den Füßen von der Bühne, und sein Kopf schlug hart auf den Boden. Die zwanzig bildeten einen Kreis um ihn, und jeder trat zu. Einer sprang mit beiden Füßen auf das Saxophon, auf Sonnys geliebtes Saxophon, seine Braut, wie er es nannte, und die Klappendeckel und andere Metallteile sprangen ab, als wollten sie flüchten. Der weiße Soldat, ein dünner, schmal bebrillter Kerl, den Blackmore schon einmal bei der Treibstoffversorgung gesehen hatte, sprang noch einmal, und unter seinen Stiefeln verformte sich der Trichter des Instruments zu sinnlosem Metall.
Ganz hinten, an der Wand, dort wo die schwarzen Soldaten saßen, fielen etliche Stühle um. Die schwarzen GIs waren aufgesprungen und rannten nach vorne, um ihrem Bruder zu helfen. Die Paare vor der Bühne tanzten nicht mehr; die französischen Mädchen kreischten oder redeten auf ihren Tanzpartner ein, sie sollen dem schwarzen Musiker helfen, der dort zu Tode getreten und geschlagen wurde.
Keiner der weißen Soldaten auf der Tanzfläche rührte auch nur einen Finger. Sie hatten den Kopf gesenkt und schwiegen, und die französischen Mädchen verstanden nicht, warum. Eines von ihnen warf sich von hinten auf einen der tretenden Soldaten, aber der schüttelte sie ab. Sie fiel zu Boden.
Die schwarzen Soldaten erreichten den Kreis; einer hob die Frau auf, die anderen zogen die ersten Weißen von Sonny weg. Da flog die Tür auf, und vier Militärpolizisten rannten in den Saal. Mit gezückten Schlagstöcken. Der Sänger der Band gab den Musikern ein Zeichen, unsicher spielten sie einen schnellen Swing, dessen fröhliche Melodik die brutale Szene grotesk steigerte. Drei schwarze GIs hoben den übel zugerichteten Sonny hoch. Blackmore sah für einen Augenblick die dunkle, blutende Masse, die einmal sein Gesicht gewesen war. Irgendjemand gab dem Rest seines Saxophones einen Tritt, und es schlidderte unter die Bühne.
Und nun geschah etwas, was Blackmore immer noch wie ein Wunder vorkam: Die französischen Mädchen lösten sich von ihren bisherigen Tanzpartnern. Sie wollten nicht mehr tanzen. Nicht mit den weißen Ärschen. Zuerst kam die junge Frau in dem grünen Chiffonkleid, die vorher versucht hatte, Sonny beizustehen, zu einem der schwarzen Soldaten. Ihre Freundin, die neben ihr stand und weinte, ein weißes Taschentuch gegen ihr rechtes Auge drückte, erriet ihre Absicht, reckte stolz den Kopf und ging ebenfalls auf einen der schwer atmenden schwarzen Soldaten zu: Would you dance with me, please? Dann begriff die nächste, dann noch eine – und schließlich gingen alle diese wunderbaren Frauen zu den schwarzen Soldaten, manche machten sogar einen Knicks, und baten sie um den nächsten Tanz.
Bis zum Morgen erzählten sich die schwarzen Soldaten diese Geschichte wieder und immer wieder.
Und nun diese verdammte deutsche Flak.
Da sieht er das Mündungsfeuer, und der gelbe Feuerball rast auf ihn zu.
Erster Teil
1. Es geht um eine Erbschaftssache
»Es geht um eine Erbschaftssache«, sagte der Mann.
Sie hatten sich im Vinum verabredet, einer modernen Trattoria im Stuttgarter Literaturhaus, direkt neben der Liederhalle. Es war 10 Uhr vormittags. Georg Dengler und sein Gegenüber waren die einzigen Gäste. Eine junge Frau war damit beschäftigt, schmale Glasvasen mit grün und blau gefärbtem Wasser und je einer Gerbera auf den Tischen zu verteilen. Der Mann schaute der Frau dabei zu.
Sie wandte ihnen den Rücken zu. Sie trug eng anliegende dunkelblaue Jeans. Dengler bemerkte, dass sie an den Oberschenkeln, den beiden Pohälften und im Schritt weiß gefärbt waren, als solle die Aufmerksamkeit auf diese Stellen gelenkt werden. Ihm fiel der Tierfilm ein, den er gestern Nachmittag im Fernsehen gesehen hatte. Die ranghöchsten Weibchen der Gorillas besitzen die markantesten Genitalien im Rudel und stellen sie gegenüber den anderen Weibchen zur Schau, um so ihre überlegene Stellung in der Horde geltend zu machen.
»Eine Erbschaftssache?«, fragte er dann.
Der Mann wandte den Kopf von der Frau ab und sah Dengler an.
»Eine merkwürdige Erbschaftssache«, sagte er und starrte wieder zu der jungen Frau hinüber.
Dengler wartete.
Der Mann zog, ohne den Blick von der Frau zu wenden, eine Visitenkarte aus seinem Jackett und schob sie über den Tisch.
»Wir haben telefoniert«, sagte er.
Dengler nickte.
Vor ein paar Tagen hatte Georg Dengler eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter gefunden. Ohne seinen Namen zu nennen, hatte der Anrufer mit belegter Stimme mitgeteilt, dass er die Hilfe eines Privatdetektivs benötige, und seine Nummer hinterlassen. Als Dengler zurückrief, stellte der Mann sich als Robert Sternberg vor, und mit der gleichen belegten Stimme schilderte er nun hastig seinen Fall: In den Unterlagen seiner verstorbenen Mutter habe er einen Vertrag gefunden, einen Vertrag von 1947, in dem sein Großvater ein komplettes Hotel verschenkt habe. Die Familie habe beschlossen, einen Detektiv zu beauftragen, die Hintergründe dieser Transaktion zu ermitteln. Vielleicht könne man die Übertragung anfechten. Dengler hatte den Mann unterbrochen und mit ihm einen Termin verabredet. Robert Sternberg hatte das Vinum als Treffpunkt vorgeschlagen.
Und nun saß ihm der nervöse Sternberg gegenüber, der sich sichtlich unwohl fühlte und dessen unruhige braune Augen den Blickkontakt mit Dengler vermeiden wollten. Dengler musterte seinen neuen Klienten. Er mochte etwa vierzig Jahre alt sein. Feine Falten zeichneten sich auf seiner Stirn ab, und zwei große Furchen zogen sich rechts und links der Mundwinkel zum Kinn. Seine Haare waren dunkel und dünn. Sie hatten sich an den Schläfen deutlich zurückgezogen. Auch auf dem Hinterkopf sah Dengler eine kahle Stelle. Das Gesicht war massig, jedoch nicht von zu viel Fleisch: Der kantige Schädelbau verlieh Sternbergs Gesicht seine viereckige Form, und diese Physiognomie verstärkte einen Gesichtsausdruck, der missmutig und mit dem Leben unzufrieden wirkte.
Dengler räusperte sich und fragte: »Ihr Großvater hat also dieses Hotel, von dem Sie sprachen, verschenkt. 1947, sagten Sie? Haben Sie Ihren Großvater zu dieser Schenkung befragt?«
Sternberg sah Dengler irritiert an.
»Mein Großvater ist schon lange tot«, sagte er, »und letzte Woche starb auch meine Mutter. In ihren Unterlagen fanden wir den Vertrag.«
»Haben Sie ihn dabei?«
Robert Sternberg nickte und hob eine schweinslederne Aktenmappe auf seinen Schoß. Als er den Reißverschluss der Tasche aufzog, bemerkte Dengler, dass sich ein Schweißfilm auf seiner Handinnenseite gebildet hatte. Auch auf den beiden Nasenflügeln entdeckte er winzige Schweißperlen.
Mit einer schnellen Bewegung holte Sternberg eine Klarsichtfolie heraus und stellte die Tasche auf den Boden zurück. Aus dem durchsichtigen Umschlag zog er sorgfältig ein Schriftstück hervor und legte es vor sich auf den Tisch. Mit dem rechten Handrücken fuhr er zweimal über das Papier, als müsse er das Dokument glätten. Dengler bemerkte, wie der Handschweiß an zwei Stellen dunkle Flecken zurückließ.
Georg Dengler streckte die Hand aus. Der Mann zögerte einen Augenblick und schob ihm dann den Vertrag zu.
Die junge Frau hatte alle Vasen mit dem gefärbten Wasser verteilt. Sie kam an ihren Tisch und fragte nach ihrer Bestellung. Georg Dengler bestellte einen doppelten Espresso, Robert Sternberg einen Kaffee und einen Cognac.
Der Vertragstext war erstaunlich kurz. Es ging darin um eine Immobilie, um das »Schlosshotel« in einem Ort namens Gündlingen. Dengler kontrollierte das Datum: 24. Juni 1947. Das Hotel wurde von dem bisherigen Eigentümer Volker Sternberg an einen Herrn Kurt Roth übertragen. Aber nicht Kurt Roth, sondern ein gesetzlicher Vertreter, so entnahm Dengler auch dem Kopf der Urkunde, hatte das Dokument unterzeichnet. Ein Mann namens Albert Roth. Also ein Verwandter des Begünstigten. Ein Vormund? Dengler prüfte die Personalangaben im Kopf des Vertrages und stieß einen leisen Pfiff aus: Das Geburtsjahr von Kurt Roth, dem Begünstigten, lautete »18. Februar 1932«, demnach war er zum Zeitpunkt der Schenkung erst 15 Jahre alt, was die Einsetzung eines gesetzlichen Vertreters erklärte. Aber – Dengler studierte noch einmal die Personendaten – warum überträgt ein 36 Jahre alter Mann, Volker Sternberg, einem 15-Jährigen ein Hotel?
Er blätterte in den drei vergilbten Seiten. Ein Kaufpreis oder sonst eine Gegenleistung waren aus dem Vertrag nicht zu ersehen. Unter »Sonstige Vereinbarungen« las er: »Dieser Vertrag ist nur solange gültig, wie die in Zusatzvereinbarung 1 aufgenommenen Verpflichtungen von beiden Parteien eingehalten werden.«
»Wo ist diese Zusatzvereinbarung?«, fragte Dengler.
»Wissen wir nicht. Eine solche Vereinbarung haben wir nicht gefunden, und wir wissen auch nicht, was drinsteht.«
»Wir?«
»Meine Schwester und ich. Wir sind gemeinsam Ihre Auftraggeber.«
»Kennen Sie die Leute, denen das Hotel jetzt gehört?«, fragte Dengler.
Sternberg schüttelte den Kopf.
»Weder meine Schwester noch ich wussten, dass das Hotel einmal in unserem Familienbesitz war.«
Die Frau brachte den doppelten Espresso und stellte Kaffee und Cognac vor Sternberg hin. Der dankte mit einem kurzen Nicken und trank den Cognac in einem Zug aus. Den Kaffee schob er mit dem Handrücken beiseite.
»Gut«, sagte Dengler, »wann kann ich mit der Arbeit beginnen?«
»So schnell Sie können. Am besten gleich morgen.«
Georg Dengler zog aus der Innentasche seines Jacketts ein Papier hervor und reichte es Sternberg.
»Das ist der Ermittlungsauftrag«, sagte er, »er kostet Ihre Schwester und Sie 80 Euro pro Stunde, Spesen und Reisekosten extra. Vier Stunden müssen Sie bei Vertragsunterzeichnung anzahlen.«
Zu seinem Erstaunen unterschrieb Robert Sternberg den Auftrag, nachdem er ihn nur kurz überflogen hatte.
»Das wären dann 320 Euro«, sagte er und zog seine Brieftasche hervor.
»Exakt«, sagte Georg Dengler und lehnte sich zurück.
Dann verabredeten sie sich für den nächsten Tag um 12 Uhr auf dem Gündlinger Bahnhof.
2. Nachdem Sternberg die Rechnung bezahlt hatte
Nachdem Sternberg die Rechnung bezahlt und das Vinum verlassen hatte, blieb Georg Dengler noch eine Weile sitzen. Schließlich stand er auf.
Er überquerte den Berliner Platz und schlenderte die Fritz-Elsas-Straße hinab. Vor einem Kiosk blieb er stehen und las die Schlagzeilen. Die Arbeitslosigkeit hatte die 5-Millionen-Grenze überschritten. Der zuständige Minister erklärte, man dürfe dies nicht allzu tragisch nehmen. Die Bild-Zeitung titelte: »Herr Minister, wollen Sie uns verar…« Dengler ging weiter.
Als er in die Wagnerstraße einbog, klingelt sein Handy.
»Hier ist Jakob.«
Denglers Sohn Jakob lebte bei seiner Mutter in Stuttgart-Heslach. Seinetwegen war Dengler nach Stuttgart gezogen, und doch sah er Jakob nur selten. Hildegard, seine Exfrau, wachte über den Buben wie über einen Schatz, den sie für sich alleine behalten wollte. Nun war sie von ihrem Arbeitgeber, einer Bank, für ein halbes Jahr nach Rostock abgeordnet worden. Ihren gemeinsamen Sohn hatte sie mitgenommen.
»Ich hab Mamas Handy.«
Dengler bot sofort an, ihn zurückzurufen, aber der Junge erzählte ihm bereits von einer Bootsfahrt und von dem Sturm vor zwei Tagen. Plötzlich hörte er Hildegards Stimme im Hintergrund.
»Ich muss Schluss machen«, sagte der Junge und legte auf. Dengler wollte zurückrufen. Die Nummer wurde jedoch nicht angezeigt; Hildegard hatte die Ruferkennung gesperrt.
Georg vermisste seinen Sohn.
Zehn Minuten später stand er vor dem Basta im Bohnenviertel. Seine Wohnung und sein Büro lagen direkt über der Bar. Aber ihm war nicht nach Büroarbeit. Er betrat das Lokal.
Martin Klein, der ebenfalls eine Wohnung im Haus gemietet hatte, saß an dem kleinen Tisch am Fenster und winkte ihm zu. Er war wie immer schwarz gekleidet. Heute trug er zu einer schwarzen weiten Hose aus grobem Stoff ein ebenso schwarzes Sweatshirt. Die grauen Haare waren modisch kurz geschnitten, aus seinen Ohren lugte ein freches Büschel grauer Borsten. Vor ihm lag ein Stapel bedruckter Papiere und ein Füller.
»Ah, der Herr Privatdetektiv«, rief er laut. »Komm, Georg, setz dich zu mir. Ich lese dir dein Horoskop vor.«
»Das von heute?«
»Quatsch, das von heute steht doch schon in den Zeitungen. Ich bin der Einzige, der die Horoskope von morgen kennt.«
»Weil du sie selbst schreibst.«
Er setzte sich zu seinem Freund an den Tisch. Der kahlköpfige Kellner des Basta stellte einen doppelten Espresso vor ihn auf den Tisch. Dengler nickte dankbar.
»Widder, hier haben wir ihn. Wie findest du das: Morgen werden Sie eine interessante Begegnung haben. Seien Sie offen für Neues. Geldprobleme halten an.«
»Kannst du das mit den Geldproblemen nicht ändern? Ich verzichte dafür auch auf die interessante Begegnung. Wahrscheinlich stimmt das Horoskop auch gar nicht. Ich habe heute einen neuen Auftrag angenommen.«
»Wirst du damit reich?«
Dengler lachte.
»Ich bin froh, wenn ich über die Runden komme. Dazu brauche ich aber mindestens drei Aufträge. Ich habe nur einen.«
»Dann stimmt mein Horoskop also.«
Martin Klein schlug sich begeistert auf den Schenkel.
Georg Dengler sagte: »Na, vielleicht bekomme ich heute Abend einen zweiten Auftrag.« Er beugte sich zu Martin Klein über den Tisch: »Ich gehe zum monatlichen Treffen der Stuttgarter Detektive. Die Detektei Nolte veranstaltet einmal im Monat einen Jour fixe. Bisher habe ich den Umgang mit anderen Detektiven immer vermieden, aber heute will ich mich dort mal sehen lassen. Und den großen Richard Nolte treffen. Er sucht Security-Personal.«
»Mein Horoskop stimmt aber bei zwei Aufträgen immer noch, oder?«
»Leider.«
Dengler rührte den Espresso um.
»Vielleicht kann ich dir ja den dritten Auftrag beschaffen«, sagte Martin Klein.
»Ich erledige keine Auftragsmorde.«
Martin Klein lachte.
Dann sagte er: »Ich habe die Horoskopschreiberei satt. Ich möchte mal wieder einen richtigen Kriminalroman schreiben.«
»Aber die letzten drei haben sich doch schon nicht verkauft. Was willst du mit einem vierten?«
»Mir fehlt nur ein richtiger Fall, ich brauche einfach einen guten Stoff.«
»Warum siehst du mich dabei an?«
»Ganz einfach«, sagte Martin Klein, »du schilderst mir deine Fälle. Daraus mache ich einen Roman. Du bekommst dafür ein Viertel meiner Horoskophonorare.«
»Mmh.«
»Was ist das für ein Fall, den du übernommen hast?«
»Eine Erbschaftssache.«
Martin Klein verzog das Gesicht.
»Eine Erbschaftssache! Das klingt wirklich hochspannend. Wie soll ich daraus einen Kriminalroman machen?«
»Sorry, ich würde auch lieber ein großes Wirtschaftsdelikt bearbeiten, viel Geld verdienen und dir nebenbei das Material für einen großen Krimi liefern.«
Dann wechselte er das Thema: »Wann kommt Olga zurück?«
Olga bewohnte die Wohnung im dritten Stock über dem Basta. Sie war letzte Woche in Zürich an der Hand operiert worden.
»Heute Abend, mein Lieber. Heute Abend ist sie wieder bei uns.«
Er hob die Kaffeetasse.
Und lachte.
Draußen begann es zu regnen.
3. Der Jour fixe fand abends statt
Der Jour fixe fand abends ab 19 Uhr in der Kantine der größten Detektei Stuttgarts statt. Die Geschäftsräume von Security Services Nolte & Partners befanden sich in der besten Lage der Stadt, in der Königstraße, nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Dengler ging zu Fuß. Vom Bohnenviertel aus brauchte er nur auf die andere Seite der Hauptstätterstraße zu wechseln, die die Stadt wie eine Machete durchschlug. Er hatte einen alten schwarzen Herrenschirm in einer der immer noch unausgepackten Umzugskisten gefunden. Eine der Ösen, die den Stoff mit dem Gerippe des Schirms verbanden, hatte sich gelöst, und ein Stoffzipfel flatterte vor ihm im Wind. Durch diese Lücke sprühte ihm winterkalte Feuchtigkeit ins Gesicht. Deshalb hielt er den Kopf gesenkt, beschleunigte seinen Schritt und stand kurz nach halb acht vor den beiden Glastüren im vierten Stock des großen Geschäftshauses.
Dengler nannte seinen Namen einem der beiden Männer am Eingang. Der sah in der Gästeliste nach, nickte, notierte etwas hinter seinem Namen und ließ ihn mit einem Wink des Kopfes ein. Dengler ging durch einen Flur auf die geöffneten Türen der Kantine zu, als ihm mit eiligen Schritten ein Mann entgegenkam, der den Jour fixe bereits verließ. Er schien ein Chinese zu sein oder ein Halbchinese, mit gelblicher Hautfarbe und schwer zu schätzendem Alter. Er zog an einer Leine einen kleinen, schweren Hund hinter sich her, eine Art Pinscher, der seinem Herrn nicht folgen wollte.
So ein hässlicher Köter, dachte Dengler.
Das Tier stemmte sich mit allen Pfoten gegen den Boden, doch es nutzte ihm nichts, denn der Chinese zog ihn über den polierten Steinflur und fluchte dabei mit österreichischem Akzent. Dengler sah dem merkwürdigen Paar nach. Irgendwo habe ich die beiden schon einmal gesehen, fuhr es ihm durch den Kopf. Dann betrat er die Kantine.
Security Services Nolte & Partners schienen nicht an Auftragsmangel zu leiden. Die Kantine war ein großer, weiß getünchter Raum, dreimal so groß wie Denglers Wohnung samt Büro. An der linken Seite stand eine Bar aus schwarzem Holz. Eine Frau in weißem T-Shirt mit der Aufschrift »Für Ihre Sicherheit – Best Security Services: Nolte & Partners« zapfte eilig Bier. Eine zweite, etwas ältere Frau im gleichen T-Shirt schenkte Rotwein in bereitstehende Gläser. Im Raum verteilten sich zwölf kleine Tische, umsäumt von schwarzen Korbstühlen, an denen etwa dreißig Personen saßen. Hinter der Bar drängten sich sieben Männer im mittleren Alter. Vier trugen dunkle Blousons, drei schwarze Lederjacken. Alle mit Schnauzbart. Sie sehen aus wie Bullen im Urlaub, dachte Dengler. Kein Wunder, dass manche Ganoven Polizisten regelrecht riechen können.
Noch während seiner Zeit beim BKA hatte Georg Dengler seinen Kleidungsstil geändert. Er wollte nicht an der Jeans- und Lederjacken-Uniform sofort als Bulle in Zivil erkannt werden. Seiher trug er meist dunkelblaue Anzüge, Jeans nur mit Jacketts und einem hellen Hemd darunter oder einem dunklen T-Shirt. So war er auch auf dieser Veranstaltung ein Außenseiter. Er ging zur Bar, und sofort traten die Männer rechts und links von ihm zur Seite. Sie betrachteten ihn mit unverhohlenem Misstrauen.
Die Frau, die den Rotwein ausschenkte, sah ihn an, und er nickte ihr zu. Sie stellte ein Glas vor ihn. Dengler zahlte gleich.
Er trank einen Schluck.
»Hey, wir kennen uns doch …«
Eine Hand klopfte ihm auf den Rücken. Die Stimme klang hoch und unangenehm. Dengler drehte sich nicht um.
»Du bist doch der Zielfahnder vom BKA. Erinnerst du dich noch an mich?«
Ein kleiner Mann in gelber Lederjacke drängte sich neben ihn. Er trug einen dünnen Schnurrbart, und aus seinem Mund blinkte ein goldener Vorderzahn. Sein Gesicht hatte etwas von einem Wiesel. Dengler konnte sich nicht erinnern, den Mann schon einmal gesehen zu haben. Die anderen Männer an der Bar drehten sich nun erneut um und starrten ihn an.
Das Wiesel griff seine Hand und drückte sie lasch. Dengler spürte kalten Handschweiß und zog instinktiv die Hand zurück.
»Rümmlin. Gerd Rümmlin. Erinnerst du dich nicht? Ich war bei der Festnahme von Rolf Heisemann in Griechenland dabei. Ich habe einen Kiosk in Athen überwacht. Klasse Job damals.«
Der Fall Heisemann. Als Dengler im zweiten Jahr beim BKA als Zielfahnder arbeitete, jagte er den deutschen Terroristen Rolf Heisemann. Er wusste von dessen Freundin, dass Heisemann sich in Griechenland aufhielt. Und er wusste, dass Heisemann regelmäßig die »Süddeutsche Zeitung« las. Dengler organisierte daraufhin die Überwachung aller Verkaufsstellen des Blattes in Griechenland durch deutsche und griechische Kriminalbeamte. Am dritten Tag der Aktion wurde Rolf Heisemann an einem Kiosk in Saloniki verhaftet. Offensichtlich war der Mann in der gelben Lederjacke an der Aktion beteiligt gewesen.
Das Wiesel klopfte ihm erneut auf die Schulter.
»Damals war ich bei der Kripo Ludwigsburg. Die kommandierten mich zu der Aktion ab. Waren ein paar tolle Tage. Viel Ouzo.«
Wahrscheinlich waren die Ludwigsburger Kollegen heilfroh, diesen Kerl eine Weile los zu sein, dachte Dengler.
Das Wiesel orderte ein Bier.
Die Frau stellte sofort ein Glas vor ihm auf den Tresen. Rümmlin nahm einen tiefen Schluck und wandte sich wieder Georg Dengler zu.
»Jetzt bin ich in der freien Wirtschaft«, sagte er.
Dengler sah in das wieselartige Gesicht, dessen Schnurrbart vom Bierschaum fast verdeckt wurde. Ihm stiegen, nicht zum ersten Male, Zweifel auf, ob es richtig gewesen war, den Job beim Bundeskriminalamt zu kündigen.
»Und wie läuft es so«, fragte er lasch und sah sich in der vergeblichen Hoffnung um, jemand zu erkennen, den er kannte.
»Alles bestens«, sagte das Wiesel, »hab genug zu tun.«
Mit dem Handrücken wischte er sich den Bierschaum vom Mund.
Georg Dengler musterte den Mann, der jetzt zufrieden rülpste.
»Ich arbeite für die Stadt«, sagte er mit wichtiger Miene und trank noch einen Schluck Bier.
»Für die Stadt?«
Das Wiesel stellte vorsichtig das Glas zurück auf die Theke.
»Bei dir läuft’s wohl nicht so gut?«, fragte er.
»Geht so«, sagte Dengler.
Er sah, wie es im Kopf des Wiesels rumorte.
»Komm mal mit.«
Das Wiesel nahm sein Bierglas, zog Dengler mit der anderen Hand zu einem der kleinen Tische und ließ sich in einen der schwarzen Korbstühle fallen. Georg Dengler setzte sich ihm gegenüber.
»Der Superbulle ohne Job«, feixte Rümmlin.
Georg Dengler sagte nichts.
Das Wiesel beugte sich zu ihm über den Tisch.
»Pass mal auf. Ich habe Aufträge genug. Ich bring dich auch bei der Stadt unter. Da gibt es genug zu tun. Aber …«
Er zögerte und fixierte Dengler.
»Da muss auch was für mich drin sein«, sagte er schließlich.
Dengler wartete.
»20 Prozent«, sagte das Wiesel.
Dengler sah ihn fragend an.
»20 Prozent.« Das Wiesel wurde ungeduldig. »20 Prozent von dem, was du durch meine Vermittlung verdienst, gibst du mir. Dann bring ich dich da unter.«
Er lehnte sich in den Sessel zurück, als habe er eben eine schwierige Aufgabe gelöst.
»Um was geht es überhaupt?«, fragte Dengler.
»Um Drückeberger und Sozialschmarotzer«, sagte Rümmlin.
»Schwarzarbeit?«
Das Wiesel winkte ab.
»Quatsch«, sagte er, »wir kontrollieren, ob die Leute zu Recht Kohle vom Staat bekommen. Hartz IV – schon mal gehört? Verschafft mir gerade eine Menge Aufträge.«
Wieder neigte er den Kopf Dengler vertraulich zu: »Ein Haufen Weiber kriegt zu Unrecht Geld vom Staat. Leben in Wirklichkeit mit einem Mann zusammen. Betrügen den Staat. Wir kontrollieren, ob alles gesetzlich vor sich geht. Wenn nicht, machen wir Meldung, und die Stadt streicht denen das Geld. Einen Teil davon bekomme ich. Da verdienen alle. Außer den Deppen, die wir erwischen.«
Er lachte ein kleines dreckiges Lachen, das wie ein Meckern klang.
Er fixierte Dengler erneut.
»Ich weiß, du bist ein Superbulle, nicht so ein Schwachkopf wie die anderen hier.«
Sein Arm deutete im Raum umher.
»Ich bring dich ins Geschäft, aber du musst mir versprechen: 20 Prozent.«
Dengler war unschlüssig. Es kommt noch so weit, dass ich von so einem Typen einen Job vermittelt bekomme, dachte er.
»Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag«, sagte das Wiesel, »geh doch einen Tag probeweise mit mir. Dann siehst du, wie leicht das Geld verdient ist.«
Er kramte einen Zettel aus der Tasche.
»Übermorgen habe ich einen Einsatz. Komm mit. Wir treffen uns um sieben Uhr …«
Er schob ihm die Adresse einer Wohnung in Vaihingen über den Tisch.
»Ich werde da sein«, sagte Dengler.
»20 Prozent«, sagt das Wiesel und schob seine Hand über den Tisch.
Dengler nahm sie und ekelte sich.
In diesem Augenblick setzte sich ein älterer, elegant gekleideter Mann an ihren Tisch.
Dengler sah, wie sich das Wiesel verkrampfte.
»Guten Tag, Herr Nolte«, sagte Rümmlin mit belegter Stimme.
»Sie müssen Georg Dengler sein«, sagte der Mann, ohne Rümmlin eines Blickes zu würdigen. Das Wiesel stand eilig auf und verließ den Tisch.
4. Als Steven Blackmore wieder zu sich kommt
Als Steven Blackmore wieder zu sich kommt, fällt er wie ein Stein der Erde entgegen. Voller Panik fasst er sich an den Rücken. Erleichterung – der Fallschirm hängt noch dort. Seine rechte Hand tastet die Brust ab und sucht die Reißleine.
Hier.
Er zieht und – fällt weiter.
Für einen schrecklichen langen Augenblick glaubt er, dass der Fallschirm verbrannt oder beschädigt ist. Doch dann gibt es einen Ruck. Ein Blick nach oben – und er sieht, wie der riesige Schirm sich über ihm öffnet. Blackmore greift nach den Steuerleinen.
Rechts und links von ihm regnet eine Kaskade von Feuer, Funken und Trümmern seiner Mustang an ihm vorbei. Sie verschwinden in der Wolke, auf die er nun zusteuert.
Als er aus der Wolke auftaucht, sieht er unter sich die brennende Stadt. Sie gleicht einem Teppich aus Gold, aus dem einzelne Kerzen hoch auflodern. Einen Bach sieht er, von den detonierenden Brandbomben rot erleuchtet.
Und er spürt die Hitze, die nach ihm greift.
Mit aller Kraft zieht Blackmore an der rechten Reißleine, und der Schirm ändert träge die Richtung. Über das Feuer unter ihm wird er nach Norden abgetrieben.
Langsam verliert er an Höhe.
5. Dengler sah Richard Nolte an
Dengler sah Richard Nolte an. Der Eigentümer von Security Services Nolte & Partners war über fünfzig, hatte aber die sechzig noch nicht erreicht. Der dunkelblaue Anzug wirkte teuer, doch nicht aufdringlich. Weißes Hemd, dunkelblaue Krawatte. Silbernes, sorgfältig geschnittenes Haar.
Die Männer blickten einander an.
Eine der beiden Frauen stellte ein Glas Mineralwasser vor Nolte auf den Tisch.
Dengler registrierte die hellblauen Augen des Mannes, die in einer durchsichtigen Flüssigkeit zu schwimmen schienen.
»Ich freue mich, dass Sie kommen konnten«, sagte Nolte schließlich.
Dengler nickte. Er wartete.
»Sehen Sie«, Nolte wischte ein imaginäres Staubkorn von der Tischplatte, »in unserer Branche sind Männer mit tadellosem Ruf selten. Und Sie, Dengler, erfreuen sich eines besonderen Rufes. In Wiesbaden erzählt man sich immer noch von Ihren Heldentaten.«
Er will mich mit seinen Beziehungen zum BKA beeindrucken, dachte Dengler.
»Und wir suchen immer gute Leute. Spitzenleute.«
Das Gespräch schien einen guten Verlauf zu nehmen. Trotzdem wartete Dengler weiter ab.
»Aber die Zeiten sind hart, in allen Branchen, auch in unserer«, sagte Nolte.
Er fixierte Dengler.
»Ich habe für Sie nichts zu tun, was Ihrer Qualifikation entspricht«, sagte Nolte, »vielleicht später, aber im Augenblick nicht.«
Nolte schwieg, aber blickte Dengler unverwandt an.
»Dann hat es mich gefreut, Sie kennen zu lernen«, sagte Dengler und erhob sich.
Nolte wedelte mit dem Arm, als wolle er ihn bitten, sich wieder zu setzen.
Dengler blieb stehen.
»Jetzt bleiben Sie doch«, sagte Nolte, »vielleicht kommen wir ja doch zusammen.«
Dengler setzte sich.
»Ich brauche Sicherheitsleute für eine Party. Sehr reiche Leute. Ich kann da keinen der üblichen Verdächtigen hinschicken. Ich brauche Leute, die wissen, wie man etwas Besseres als eine Lederjacke trägt.«
Dengler schwieg.
»Die Kunden sind reich. Aber wie Reiche nun mal sind: sehr sparsam. Ich kann Ihnen nicht mehr als vierzig Euro in der Stunde zahlen.«
»Risiken? Ist der Job gefährlich?«
»Nein. Harmlos. Eine Milliardärsgeburtstagsfeier. Sie gehören als Security gewissermaßen zum Status. Es liegen weder Drohungen noch sonstige sicherheitsrelevante Hinweise vor.«
»Sie bieten mir die Hälfte meines üblichen Stundensatzes an.«
Nolte zuckte mit den Achseln, als täte es ihm Leid.
Und wartete.
Er lauert, dachte Dengler.
»Unter einer Bedingung«, sagte Dengler, »ich bringe noch einen Mann mit. Der kostet Sie nichts.«
Nolte schien nachzudenken.
»Einverstanden«, sagte er schließlich, »geben Sie morgen meinem Büro seinen Namen und seine Adresse durch.«
Dengler zog ein Formular aus seinem Jackett.
»Das ist ein Ermittlungsauftrag«, sagte er, »wir können ihn jetzt …«
Richard Nolte berührte Dengler leicht am Arm.
»Wir haben unsere eigenen Verträge. Ich werde Ihnen morgen einen davon zustellen lassen.«
Er stand auf.
Auch Dengler erhob sich.
Nolte gab ihm die Hand.
Dann ging der Chef von Security Services Nolte & Partners zum nächsten Tisch.
Dengler überlegte einen Augenblick, ob er sich wieder setzen sollte, um den Rest des Rotweins zu trinken.
Aus einer hinteren Ecke winkte ihm Rümmlin zu. Dengler ging zum Ausgang und nahm seinen alten Regenschirm aus dem Schirmständer.
Zwei beschissene Jobs an einem Abend, dachte er.
Draußen regnete es immer noch.
6. Olga saß an dem großen Tisch
Olga saß an dem großen Tisch unter dem Spiegel. Neben ihr strahlte Martin Klein, eine Flasche Weißwein in der Hand, und füllte ihr Glas nach. Georg Dengler blieb an der Tür des Basta stehen und betrachtete sie. Sie war schöner denn je. Die roten Haare loderten bis auf die Schultern. Wenn sie den Kopf zurückwarf und über eine Bemerkung von Martin lachte, sah er ihre Zähne, die weiß und ebenmäßig gewachsen waren wie bei einer Schauspielerin.
Als Olga ihn sah, stand sie auf und winkte ihm zu. Mit einer triumphierenden Geste reckte sie die rechte Hand in die Luft. Sie zwängte sich an den beiden Männern vorbei, die neben ihr gesessen hatten, und kam strahlend auf ihn zu.
»Georg, schau!«
Sie fuchtelte mit ihrer rechten Hand vor seinem Gesicht. Sie bewegte dabei jeden einzelnen Finger.
»Alles ist wieder, wie es sein soll«, jubelte sie leise.
Georg Dengler nahm ihre Hand, legte sie in die seine und betrachtete sie. Ihr Zeigefinger war immer noch genauso lang wie der Mittelfinger, der daneben in seiner Handfläche ruhte.
Ein Onkel hatte Olga, als sie ein kleines Mädchen war, während ihrer Wachstumsphase den Zeigefinger gestreckt. Millimeter für Millimeter wurde er gedehnt und gespannt, wurde länger, als er hätte sein dürfen, bis er gleich groß war wie der Mittelfinger. Diese zweieinhalb Zentimeter waren der entscheidende Vorteil gewesen, wenn sie mit den anderen Kindern auf die Raubzüge in die großen Städte geschickt wurde. Eine Brieftasche lässt sich sehr viel leichter mit zwei gleich langen Fingern aus der Innentasche eines Jacketts ziehen als mit einem normal gewachsenen Zeigefinger. Olga wurde der Star unter den rumänischen Kinderdieben.
Später floh sie, wurde wieder gefangen, zwangsverheiratet, floh wieder und landete schließlich in Stuttgart. Die Gelenke des misshandelten Fingers schwollen an und schmerzten selbst bei kleinen Bewegungen. Sie fand einen Schweizer Chirurgen, der sie behandelte. Eine Woche lang war sie in dem Züricher Spital gewesen.
»Nun bin ich wieder gesund«, flüsterte sie und krümmte und streckte den Zeigefinger.
Sie nahm Georg bei der Hand und zog ihn an den Tisch. Martin Klein rutschte zur Seite, jemand schob einen Stuhl herbei, der gut aussehende kahlköpfige Kellner brachte ein Glas, Olga schenkte Georg ein, er lachte, und Olga zog ihm unbemerkt sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche seiner Hose.
»Ich bin wieder in Form«, sagte sie, als sie ihm den Geldbeutel zurückgab.
Es war schon fast halb drei, als sie aufbrachen. Bereits vor zwei Stunden hatte der kahlköpfige Kellner die Stühle auf die Tische gestellt und sich zu ihnen gesetzt. Doch nun war Georg Dengler müde, Martin Klein auch, und der Kellner wollte nach Hause. Nur Olga wäre gerne noch geblieben.
Untergehakt verließen sie zu dritt das Basta. Bis zum Hausgang waren es kaum mehr als zwei Meter. Doch Dengler kam es vor, als schwanke Martin Klein. Er fasste den Freund fest unter die Schultern und zog ihn zum Eingang.
»Dein Horoskop hat versagt, mein Freund«, sagte er zu ihm, »heute Abend habe ich zwei weitere Aufträge bekommen.«
»Gut bezahlte?«, fragte Klein, der seinen Schlüssel aus der Hosentasche zog.
»Nein. Schlecht bezahlte.«
Klein stieß mit der Schlüsselspitze zwischen Daumen und Zeigefinger an Denglers Brust.
»Dann, mein lieber Freund, dann stimmt mein Horoskop.«
»Du kannst mich bei einem Einsatz begleiten.«
»Bei einer Geiselbefreiung?«
»Nein, ich bin Sicherheitsmann bei einer Milliardärsparty.«
»Da will ich auch mit«, sagte Olga.
»Milliardäre haben nie Bargeld dabei«, krächzte Klein und versuchte, die Tür aufzuschließen.
»Kreditkarten akzeptiere ich nicht«, sagte Olga, nahm ihm den Schlüssel ab und schloss auf.
»Ich könnte Milieustudien betreiben«, sagte Klein, als sie die Treppe hinaufgingen.
»Ich will auch Studien betreiben«, sagte Olga. »Komm, Georg, spiel uns noch einen Blues vor, einen einzigen.«
Später saßen sie auf seiner Couch und lauschten Junior Wells.
They take your house and your home
They take your flesh from your bone
They take everything you got
Why people like that
»Sobald ich etwas Geld verdient habe, fahre ich nach Chicago und höre Junior Wells live«, sagte Georg Dengler leise.
Olga lehnte mit dem Kopf an seiner Schulter und hörte der Musik zu.
»Dein alter Traum«, sagte sie. »Nimm mich mit auf die Milliardärsparty. Dann hast du genug Geld für Chicago und jeden anderen Platz der Erde.«
Martin Klein schnarchte laut.
»Und du weißt, wo du Junior Wells findest?«, fragte sie.
»Er spielt fast jeden Abend in einem Club namens Theresa’s Lounge. Sagt das Internet.«
»Was macht eigentlich Christiane?«, fragte Olga nach einer Weile.
»Sie ist immer noch in Italien. Bei ihrem Vater«, erwiderte Dengler rasch.
»Na denn.« Olga stand auf und ging zur Tür. »Gute Nacht, Georg.«
Dengler blieb noch eine Weile sitzen und lauschte Junior Wells. Er betrachtete die Madonnenstatue an der Wand. Bilder stiegen in ihm auf, der Hof von Paul Stein, Christianes Vater, das Feld mit den Ringelblumen; er sah, wie sich Vater und Tochter umarmten. All das schien ewig zurückzuliegen.