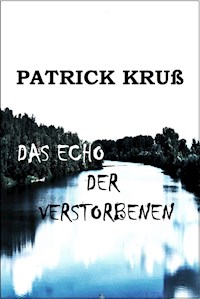
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der zehnjährige Colby verbringt die Sommerferien bei seiner Großmutter Viviane, die zurückgezogen in einem einsamen Haus nahe eines Sees lebt. Bereits kurz nach seiner Ankunft findet er sich in einem Strudel rätselhafter und unheimlicher Ereignisse wieder, bis er schließlich die Wahrheit über ein unvorstellbares Geheimnis erfährt. Ein Geheimnis, das sein künftiges Leben für immer verändern wird und ihn Jahre später auf die Spur eines wahnsinnigen Serienmörders führt. Colby wird klar: Sein Schicksal ist mit dem des Mörders auf beängstigende Weise verbunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 723
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Kruß
Das Echo der Verstorbenen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zweiter Teil
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Dritter Teil
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Impressum neobooks
Widmung
Für meine Opa.
Ein Mann, der den Tatsachen vertraute.
Und für den ich umso mehr glauben möchte.
Erster Teil
- Erster Teil -
Die Gabe
1
Der Sommer, in dem ich zehn Jahre alt wurde, hat für mich eine besondere Bedeutung. Damals veränderte sich mein Leben.
Es lag nicht daran, dass ich die kompletten Ferien bei meiner Grandma Viviane verbringen musste, damit sich mein Dad der Baseballkarriere meines älteren Bruders Samuel widmen konnte.
Es lag auch nicht daran, dass es der erste Sommer war, nachdem uns meine Mum verlassen hatte.
Der Grund, weshalb diese drei Monate einem Brandmal gleich ihre Spur in meiner Erinnerung hinterlassen haben, ist ein anderer. Denn in diesem Sommer hatten sie zum ersten Mal Kontakt mit mir aufgenommen.
Meine Grandma nannte es eine Gabe.
Ich nenne es einen Fluch.
An jenen Tagen im Juni durchzog eine unerträgliche Hitzewelle das Land. Tagsüber kletterte die Temperaturanzeige stets über 35 Grad Celsius und seit Wochen hatte kein Tropfen Regen den Boden berührt.
In den Nachrichten war immer wieder davon zu hören, wie Waldbrände unerbittlich wüteten. Kaum hatte die Feuerwehr einen Brandherd unter Kontrolle gebracht, begannen die Flammen an einer anderen ausgetrockneten Stelle ihr zerstörerisches Schauspiel aufzuführen.
Meine Grandma Viviane lebte, fernab dieser Katastrophe, in einem einsamen Haus am Ufer eines Sees. Als wir das große Grundstück erreichten, glaubte ich, in einer anderen Welt angelangt zu sein. Die Bilder von Feuer und Rauch schienen hier unwirklich und aus einem Furcht einflößenden Albtraum zu stammen.
Ich wuchs in einer belebten Vorstadtgegend auf und so war mir die Ruhe, die mich empfing, fremd. Außer dem leisen Gezwitscher der Vögel, die sich in den Bäumen um den See versteckten, war nichts zu hören.
Viviane stand vor einer Staffelei auf der Veranda und winkte meinem Dad, Sam und mir fröhlich zu. Sie trug ein weites, hellgrünes Baumwollkleid, das ihren drahtigen Körper verbarg. Um die Schultern hatte sie ein zitronenfarbenes Tuch gelegt. Ihre beinahe schneeweißen Haare reichten ihr bis zu den Hüften und schienen in der kräftigen Mittagssonne regelrecht zu schimmern. In den Händen hielt sie eine Palette und einen Pinsel. Sie legte beides auf einen Tisch und kam mit eiligen Schritten auf uns zu. Der Bernsteinanhänger an ihrem Hals wippte wild umher.
„Tut mir Leid, das wir uns verspätet haben“, entschuldigte sich Dad. „Wir standen gut eineinhalb Stunden im Stau.“
Eineinhalb Stunden, in denen sich Dad und Sam über Baseball unterhalten hatten. Ich hatte teilnahmslos auf dem Rücksitz von Dads Jeep Platz genommen und mit einem Bleistift in einem Notizblock herumgekritzelt. Diese Autofahrt war ein Paradebeispiel für meine Rolle, denn damals war ich der Statist meiner Familie.
Sam dagegen war ein begnadeter Baseballspieler.
Die große Hoffnung der Highschool.
Dads ganzer Stolz.
Kein Wunder also, dass Dad ihn auf ein Trainingscamp begleitete. Es machte ihn glücklich, Sam beim Schlagen auf dem Feld zuzusehen. Er wollte dabei sein und erleben, wie sein Sohn zu einem noch besseren Spieler wird. Und er wollte der Einsamkeit aus dem Weg gehen, die ihn zuhause empfing, seit uns Mum mit einer kurzen Nachricht auf dem Küchentisch verlassen hatte.
Ich kann hier nicht länger bleiben.
„Das macht wirklich nichts“, versicherte Viviane und deutete auf die Veranda. „Ich habe mir die Staffelei hinausgestellt. Das Licht ist heute hervorragend.“
Viviane war Künstlerin. Hinter dem Wohnhaus, so wusste ich, hatte sie sich in einem Schuppen ein Atelier eingerichtet, in dem sie an ihren Bildern arbeitete.
Dad nickte kurz. Er hatte keinen Sinn für die Malerei und wusste nicht recht, was er hätte antworten können. Insgeheim hielt er Grandma für eine Verrückte. Ihr Erscheinungsbild widerlegte diese Behauptung jedenfalls nicht. Sie wirkte wie eine Zeitreisende aus den späten Sechzigern.
Bevor sie Mum während eines längeren Aufenthalts in Südafrika zur Welt gebracht hatte, war Viviane zwei Mal kurz verheiratet gewesen. Mein Großvater war ein Phantom, das es niemals zu Ehemann Nummer drei geschafft hatte. Letztlich hatte sie ihre Tochter alleine groß gezogen.
Umso erstaunlicher war es, dass ich den kompletten Sommer über hier bei ihr verbringen sollte. Dachte ich zumindest. Im Grunde hatte Dad keine Wahl, wie mir heute bewusst ist. In das Trainingscamp wollte er mich nicht mitnehmen – nicht, dass ich es selbst gewollt hätte – und seine beiden Brüder, Onkel Steve und Onkel Eric, lebten viel zu weit weg, als dass sie eine Option für meine Unterkunft gewesen wären.
Viviane blieb als einzige Möglichkeit.
Dad holte meinen Koffer aus dem Wagen und stellte ihn neben mir ab. Dem dumpfen Knall des Gepäcks auf dem Boden folgte eine kleine Staubwolke.
„Machs gut, Colby. Und sei anständig.“ Er klopfte mir auf die Schulter und verabschiedete sich von Grandma. „Sam und ich müssen weiter. Vor uns liegt noch ein gutes Stück.“
Ich wich seinem Blick aus und konzentrierte mich auf eine Trauerweide, die nahe der Veranda hoch in den Himmel ragte.
Sam stieg, ohne ein letztes Wort an mich zu richten, in den Wagen. Er mochte mich nicht besonders und war bestimmt froh darüber, seinen nervigen kleinen Bruder einige Wochen nicht sehen zu müssen.
Dad startete den Motor und nur einen Augenblick später verschwand der rote Jeep in Richtung der Landstraße, aus der wir gekommen waren.
Es war ein emotionsloser Abschied. Er hatte, so dachte Dad sicherlich, seine Pflicht als Vater erfüllt und sich um das Obdach und die Aufsicht seines Kindes gekümmert.
Viviane legte mir ihre Hand auf die Schulter. „Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Colby. Komm, wir bringen dein Gepäck ins Haus.“
Ich nickte Grandma zu. Sie schien meinen Unmut zu spüren und versuchte mir deshalb umso mehr das Gefühl zu geben, willkommen zu sein.
Im Grunde mochte ich Grandma, auch wenn wir sie kaum sahen. Sie verreiste häufig und weil Mum und sie kein inniges Verhältnis miteinander pflegten, beschränkten sich die Treffen, wenn überhaupt, auf Geburts- und Feiertage. Ich glaube, tief in ihrem Herzen konnte Mum Viviane nicht verzeihen, dass sie niemals die Möglichkeit hatte, ihren Vater kennen zu lernen.
Dennoch waren Grandma und ich uns sehr ähnlich, wie ich bald herausfinden würde. Inzwischen weiß ich, dass sie der einzige Mensch in meiner Familie war, der mich je verstanden hat.
Im Inneren des Hauses war es angenehm kühl. Die Jalousien an den Fenstern waren fast vollständig heruntergezogen und nur vereinzelte, dünne Sonnen-strahlen traten zwischen den Spalten hindurch.
Es wirkte auf seltsame weise wunderschön und unheimlich. Meine Augen brauchten einen Moment, bis sie sich an das Dunkel gewöhnt hatten.
Der Eingangsbereich des Hauses war mit zahlreichen Souvenirs aus den unterschiedlichen Ländern, in denen Grandma einmal gewesen war, geschmückt. Im Wohnzimmer, so wusste ich, befand sich eine große Weltkarte, auf der sie mit kleinen roten Pins die Orte markiert hatte, zu denen sie während einer ihrer Reisen gelangt war. Bei unserem letzten Besuch vor etwa einem halben Jahr gab es nur noch wenige Stellen auf der Karte, die keine rote Signatur besaßen.
Viviane ging die Treppe hinauf. An der Wand hingen hölzerne Masken, die furcht einflößende Grimassen machten. Ich betrachtete sie voller Faszination.
„Sie stammen aus Haiti“, verriet Viviane, als sie vom oberen Ende der Treppe zu mir zurücksah. „Die Masken schützen das Haus vor dem Bösen.“
„Dem Bösen?“, fragte ich und folgte ihr die letzten Stufen hinauf.
„Ganz genau.“ Viviane beugte sich zu mir herab und strich mir über den Kopf. „Siehst du die unterschiedlichen Mimen? Jede Maske hält eine andere Form des Bösen ab.“
Ich konnte ihr nicht ganz folgen und fragte mich, ob sie wirklich die Wahrheit spricht. „Das heißt, das Böse wechselt sein Aussehen?“
„So kann man es nennen.“
„Die Masken beschützen uns also?“
Viviane nickte. „Hier wird dir nichts passieren.“
Auf merkwürdige Weise fühlte ich mich plötzlich geborgen. Viviane nahm meine Hand und führte mich den Flur hinab zu einer offenen Tür.
„Das wird dein Zimmer für die nächsten Wochen sein. Ich hoffe, es gefällt dir. Mein eigenes liegt am anderen Ende des Flurs.“
Es war das erste Mal, das ich an diesem Tag lächeln musste. Das Zimmer war größer als mein eigenes zuhause. An der Mitte der hinteren Wand befand sich ein riesiges Bett. Es lud förmlich dazu ein, sich hineinzuwerfen oder wild darauf herum zu springen. Gleich daneben stand ein Schreibtisch aus Nussbaumholz. Die Oberfläche glänzte noch im Halbdunkel. Der antik aussehende, tiefe Kleiderschrank zur linken Seite des Betts bot sich als gutes Versteck an. Ein kleiner Ort, den ich als geheime Zuflucht nutzen konnte. Ich hätte ihn gerne bei mir zuhause gewusst.
Auf einem Regal an der Wand waren einige Bücher aufgereiht. Ich stellte meinen Koffer ab und musterte die Rücken.
„Ich habe eine Auswahl getroffen, von denen ich glaube, sie werden dir gefallen. Unten im Wohnzimmer sind noch viele andere. Du darfst sie dir nachher gerne einmal ansehen.“
Ich schaute mir den bunten Wandschmuck zu allen Seiten des Zimmers an.
Die Bilder zeigten das Meer, große Felder mit violetten Blumen und das Portrait eines Cafés, das auch gut aus dem 19. Jahrhundert hätte stammen können.
„Hast du sie alle selbst gemalt?“, fragte ich.
Viviane lächelte. „Sie sind nach meinem Aufenthalt in Frankreich entstanden. Ich kann dir später davon erzählen.“
Oberhalb der Tür hing ein Windspiel aus dünnen Holzstäben, das mich dazu verführen wollte, seinem Klang zu lauschen.
„Am besten, du richtest dich zuerst einmal ein. Lass dir ruhig Zeit, bis alles so ist, dass du dich richtig wohl fühlst. Ich bin unten auf der Veranda und male an meinem Bild weiter. Wenn du etwas brauchst, rufst du, ja?“
Ich nickte und sah zu Boden. Meine Hände umklammerten noch immer den Griff des Koffers.
„Grandma“, sagte ich, als Viviane bereits auf dem Weg zur Treppe war. Sie hielt inne und wandte sich zu mir.
„Danke.“
Viviane kam noch einmal in das Zimmer und beugte sich zu mir nieder.
„Colby, ich bin sehr froh, dass du hier bist. Wir finden endlich Gelegenheit, uns besser kennen zu lernen.“
In der nächsten Stunde breitete ich den Inhalt meines Koffers im Zimmer aus und verstaute ihn in dem riesigen Schrank. Ich hatte kaum Spielsachen mitgenommen, denn eigentlich war es mein Ziel, die Wochen bei Grandma schrecklich zu finden. Vivianes liebe, wenn auch ungewöhnliche Art machte dies jedoch bereits jetzt unbeschreiblich schwierig.
Allein mein Stofftier, ein Nashorn namens Pubuh, hatte ich eingepackt. Durch die Reise im Koffer sah er etwas mitgenommen aus. Ich drückte ihn kurz an mich, stupste meine Nase an sein Horn und setzte ihn auf das Bett.
Auf dem Boden des Koffers kam ein eingerahmtes Foto hervor, das Mum, Dad, Sam und mich gemeinsam bei einem Ausflug in den Bergen zeigte. Wir posierten auf einer Klippe und winkten in die Kamera. Ich war damals sieben Jahre alt, Sam war neun. Es stand sonst auf meinem Nachttisch.
Mit diesem Foto bewahrte ich mir die Erinnerung an einen Tag, an dem wir alle glücklich waren.
Ich entschied mich, das Bild im Koffer zu lassen. Es war inzwischen ohnehin nur eine Illusion. Die Familie auf dem Foto gab es nicht mehr.
Ich schloss den Deckel des Koffers und verstaute ihn unter dem Bett.
Dann ging ich zur Tür hinüber, nahm Anlauf und sprang auf das riesige Bett.
Die Matratze und die Bettwäsche waren herrlich weich. Ich hatte das Gefühl, ich würde ich in einer Wolke liegen. Einige Zeit schaute ich zur Decke hinauf, während meine Gedanken noch einmal die Autofahrt durchstreiften.
Dad und Sam würden sicherlich viel Spaß zusammen haben. Baseball verband sie. Für mich war da kein Platz.
Dann glitt ich nach und nach in einen tiefen Schlaf.
Als ich wieder aufwachte, hatte ich jedes Zeitgefühl verloren. Da ich keine Armbanduhr trug, konnte ich nicht sagen, wie lange ich geschlafen hatte.
Ich streckte mich und gähnte, um die Überreste meiner Müdigkeit zu vertreiben.
Der Klang einzelner, leiser Töne war zu hören. Ein Lufthauch musste dem Windspiel über der Tür eine Melodie entlockt haben. Ich stand auf und betrachtete die dünnen Holzstäbe.
Plötzlich beschlich mich ein seltsames Gefühl. An meinen Armen zog sich eine Gänsehaut hinauf und meine Nackenhaare stellten sich.
Ich war nicht alleine.
Hinter mir, in der dunkelsten Ecke des Zimmers, war jemand. Ich konnte es spüren.
Angst beschlich mich. Mein Mund war völlig trocken und mein Herz begann wild gegen meine Brust zu hämmern. Ich konzentrierte mich und hörte den Fremden atmen.
Wie lange mochte er schon hier sein?
Hatte er mich die ganze Zeit, während ich geschlafen hatte, beobachtet?
Was wollte er hier und wo war Grandma?
Das Windspiel ertönte erneut und riss mich aus meinen Gedanken. Ich zuckte zusammen, verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Boden.
Es dauerte einen Augenblick, bis ich das Zittern meiner Arme bändigen und mich aufrichten konnte. Die Präsenz des Fremden war nun ganz deutlich, so als strecke er seine Hände nach mir aus.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und wollte endlich sehen, wer sich in das Zimmer geschlichen hatte. Ruckartig drehte ich mich um.
Aber dort war niemand. Ich war völlig alleine.
Viviane kam hinein und fragte mit besorgtem Unterton, was geschehen sei. Sie habe in der Küche das Abendessen vorbereitet und einen dumpfen Knall gehört.
Ich sah noch einmal in die Ecke, in der ich den Fremden vermutet hatte.
„Colby, ist alles in Ordnung?“
Jemand musste dort gewesen sein. Ich war mir sicher.
„Colby?“
„Ich bin aus dem Bett gestürzt“, behauptete ich.
Viviane fragte, ob ich mich verletzt habe. Ich versicherte, dass mir nichts fehle, doch mein Gesicht verriet die Irritation, die mich gerade beschlich.
„Lass uns nach unten gehen. Wir können gleich essen. Du musst sicherlich großen Hunger haben“, versuchte mich Grandma zu beruhigen.
Als wir aus dem Zimmer gingen, erklang das Windspiel.
2
Nach dem Abendessen gingen wir in den Garten, der direkt an den See angrenzte. Die Luft roch nach frisch gemähtem Gras und Flieder.
Viviane deutete auf einen Schuppen.
„Mein Atelier kennst du ja?“, fragte sie.
„Du hast es Sam und mir bei unserem letzten Besuch gezeigt“, erinnerte ich sie.
Viviane nickte. „Richtig. Verzeih, es ist nur schon eine Weile her.“
Wir schlenderten zu einem Steg, auf dem zwei Korbstühle standen. Ein Ruderboot war mit einem Tau an dem äußersten Pfosten des Stegs angebunden und schaukelte sanft in den ruhigen Bewegungen des Wassers. Die Sonne machte sich daran, hinter den Bäumen auf der anderen Seite des Sees zu versinken und tauchte die Wasseroberfläche in einen goldenen Glanz.
Wir setzten uns in die Korbstühle und schauten einigen Schwänen zu, wie sie ihre Bahnen zogen.
„Grandma, warum lebst du alleine hier draußen?“, fragte ich.
Viviane lächelte. „Für mich gibt es keinen schöneren Ort auf der Welt.“
„Wenn du bei uns in der Stadt wohnen würdest, könnten wir uns viel häufiger sehen“, wandte ich ein.
„Das stimmt. Und es tut mir auch weh, dass ich dich und Sam so selten sehe. Aber ich bin niemand, der in der Stadt glücklich werden könnte.“
„Weshalb nicht?“
„Schau dir die Schwäne an. Sie leben auch auf Feldern und Wiesen, aber nur hier am See können sie schwimmen. Und so geht es mir. Nur hier kann ich malen. Nur hier kann ich atmen.“
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Wie so oft kam es mir vor, als spreche sie in Rätseln, die es für mich erst noch zu lösen gilt.
„Ich bin viel gereist. Es hätte mich nach Italien, Kenia oder Alaska verschlagen können. Aber dies ist der Ort, der mein Zuhause wurde. So etwas sucht man sich nicht aus. Es ist vielmehr ein Gefühl, das dir sagt: Bleib hier und du wirst glücklich werden.“
„Wo kann ich glücklich werden?“, wollte ich wissen.
Viviane nahm meine Hand und drückte sie fest. „Diese Frage kann niemand außer dir selbst beantworten.“
Wir sahen wieder hinüber zu den Schwänen, die im Schilf des Ufers verschwanden. Die Wipfel der Bäume verdeckten nun die Sonne und spendeten einen angenehmen Schatten.
„Manchmal ist es kein bestimmter Ort, den wir unser Zuhause nennen. Manchmal ist es ein Mensch, bei dem wir uns zuhause fühlen. Und dann ist es völlig egal, wo wir leben, solange wir nur bei dieser einen Person sind.“
Vivianes Augen schimmerten glasig. Ich hatte das Gefühl, sie spreche über etwas, das ihr selbst widerfahren war.
„Dann muss ich diesen Menschen finden“, schlussfolgerte ich.
Grandma antwortete mir nichts.
Gegen zehn Uhr wurde ich müde. Wir kehrten zurück ins Haus und Viviane zeigte mir das Bad, wo ich mich bettfertig machte.
In meinem Zimmer beschlich mich erneut das seltsame Gefühl, nicht alleine zu sein. Es war nicht mehr so stark wie zuvor, vielmehr wie das Echo einer lauten Stimme. Ich schaute zu der Stelle, an der ich die Anwesenheit des Fremden verspürt hatte.
Viviane legte mir die Hände auf meine Schultern. „Soll ich dir noch eine Geschichte vorlesen?“
Ich lehnte ab und entschied, lieber gleich schlafen zu wollen.
Grandma schlug das Leintuch zurück und ich konnte in das Bett klettern. Ich tastete nach Pubuh und drückte das Nashorn fest an mich.
„Ich wünsche dir eine gute Nacht“, sagte Viviane und gab mir einen Kuss auf die Stirn.
Sie ging zur Tür und löschte das Licht.
„Kannst du die Tür offen lassen?“, fragte ich, als Viviane sie gerade schließen wollte.
Grandma wirkte auf einmal sehr ernst. Sie lehnte ihren Kopf gegen den Türrahmen und musterte mich mit ihren smaragdgrünen Augen.
„Colby, du bist hier sicher.“
Sie schien bemerkt zu haben, wie nervös ich war. Sollte ich ihr von dem unheimlichen Erlebnis am Abend erzählen? Würde sie mich verstehen können, wenn ich es selbst kaum begriff? Auf keinen Fall wollte ich, dass sie dachte, ich fühle mich nicht wohl und erfinde eine Geschichte, um hier schleunigst wieder weg zu kommen.
„Ich weiß nicht, wovor du Angst hast, aber dir wird nichts passieren. Vertrau mir, ja?“, fügte sie nach einer Weile hinzu, als meine Antwort ausblieb.
Dann ließ sie mich alleine und ich hörte, wie sie mit leisen Schritten die Treppe hinab ging.
Ich schaute zur Decke und wartete darauf, dass sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Ein heißes Kribbeln durchlief meinen Körper. Ich lauschte angespannt. Würde ich es mitbekommen, falls der Fremde sich erneut in das Zimmer schlich? Noch wollte ich nicht glauben, mir alles eingebildet zu haben, auch wenn ein Hirngespinst bedeuten würde, dass meine Angst tatsächlich unbegründet war.
Nach und nach verloren sich meine Sinne in der Müdigkeit, die sich in meinem Körper ausbreitete und ich schlief ein.
Ich sah meinen Dad und Sam. Sie liefen Hand in Hand.
Ich rief ihnen zu und bat sie, auf mich zu warten. Dad drehte sich kurz zu mir um und lächelte. Dann gingen er und Sam weiter. Je lauter ich sie anflehte, endlich stehen zu bleiben, desto weiter entfernten sie sich von mir. Ich rannte so schnell es mir nur möglich war und doch war ich nicht schnell genug. Meine Beine begannen zu schmerzen, bis ich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen konnte. Ich musste anhalten und rang nach Luft.
Dad und Sam wurden zu zwei schemenhaften Wesen, die sich nach und nach auflösten. Als nichts mehr von ihnen zu sehen war, wurde mir bewusst, dass ich sie verloren hatte.
Obwohl ich bei ihnen sein wollte, konnte ich sie nicht erreichen.
Und ihnen schien es völlig egal zu sein, was aus mir wird.
Da riss ich die Augen auf und mein Körper zuckte unweigerlich zusammen.
Es dauerte einen Augenblick, bis ich begriff, dass es ein Albtraum war. Und doch konnte ich den Gedanken, Dad und Sam könnten mich für immer verlassen haben, nicht loswerden.
Wie spät war es? Ich dachte, nur einen Moment weggetreten gewesen zu sein, aber etwas hatte sich verändert. Im Haus herrschte völlige Stille.
Ich stieg aus meinem Bett und ging in den Flur. Eine Wanduhr verriet mir, dass es bereits kurz nach Mitternacht war.
Die Tür zu Vivianes Schlafzimmer war angelehnt und durch den schmalen Spalt konnte ich sehen, wie meine Grandma schlief.
Der Vollmond warf sein gespenstisches Licht durch das große Fenster neben ihrem Nachttisch. Mit dem fahlen Schein wanderten auch die Schatten der Rotorblätter eines großen Deckenventilators in gleichmäßigen Bewegungen über das Bett. Die Balkontür war geöffnet und ließ die warme Nachtluft herein. Ich betrachtete die Szenerie einen Augenblick und entschied mich, zurück in mein Zimmer zu gehen.
Als ich am Türrahmen ankam, blieb ich wie angewurzelt stehen.
Ich spürte die Anwesenheit des Fremden.
Er war hier, in meinem Zimmer.
Wieder stand er in der dunkelsten Ecke. Ich versuchte seine Konturen zu erkennen, doch meine Augen vermochten nichts in der Finsternis zu sehen.
Meine Hände suchten die Wand nach dem Lichtschalter ab. Einen kurzen Moment später fand ich ihn. Ich konzentrierte mich auf den Atem des Fremden. Ich konnte ihn deutlich hören. Er war so laut, das befinde er sich direkt neben mir.
Meine Finger zitterten, aber mein Entschluss stand fest. Ich würde nicht wegrennen oder um Hilfe rufen. Ich wollte das Gesicht des Fremden sehen, dem es wieder auf mysteriöse Weise gelungen war, unbemerkt in mein Zimmer zu gelangen.
Ich drückte den Schalter und das warme Licht der Lampe durchfuhr den Raum. Ich glaubte, das Überraschungsmoment auf meiner Seite zu haben. Doch ich hatte mich getäuscht, wie mir schlagartig bewusst wurde.
Meine Augen weiteten sich, unfähig zu verstehen, was sie sahen.
Das Zimmer war leer. Niemand war hier.
Mit langsamen Schritten ging ich zur Seite hinüber, an der ich den Fremden vermutet hatte. Neben den Bildern, die ich bereits bei meiner Ankunft betrachtet hatte, sah ich nun, dass hier ein viertes Gemälde hing. Es zeigte ein Pier, auf dem ein Mann mit Ballonmütze stand. Sein Blick folgte einem Segelboot, das hinaus aufs offene Meer glitt, der untergehenden Sonne entgegen.
Ich musterte jede Stelle des Bildes. Im Hintergrund wurde der Ozean auf verschwommene Weise eins mit dem Himmel. Nur die glutrote Sonne markierte die Grenze zwischen Firmament und Meer.
Etwas schreckte mich auf. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, der Mann mit der Ballonmütze sah mich an. Hatten die Augen, welche dem Boot folgten, zu mir herübergesehen? Nein, so etwas war unmöglich.
Ich löschte das Licht und kroch zurück in mein Bett. Soeben hatte ich den Beweis erhalten, dass niemand in meinem Zimmer auf mich lauerte. Viviane hatte Recht, ich brauchte keine Angst zu haben.
Ich zog das Leintuch an mich, denn trotz der Hitze des Tages fror ich nun etwas.
Von wem ich auch vermutete, dass er sich in meinem Zimmer versteckt hielt, war nicht mehr als ein übler Streich meiner Phantasie.
Ich schwor mir, dass ich, solange ich hier war, nicht mehr darüber nachdenken wollte.
Es sollte ein naives Versprechen sein, das ich mir gab.
3
Fresh food daily ist eine regionale Supermarktkette mit insgesamt 25 Filialen. Der Name steht für hervorragende Qualität zu fairen Preisen. Zumindest ist das die Behauptung der Werbebanner und TV-Spots.
Walter Tachman, der inzwischen reich gewordene Firmeninhaber, hat dies zum Slogan seines Unternehmens gemacht und sich damit penetrant in das Gedächtnis der Kunden geschlichen. Nicht nur auf den Einkaufstüten- und wägen, sondern auch auf der Arbeitskleidung der Mitarbeiter ist die Phrase in abwechselnd gelben und grünen Buchstaben aufgestickt. So auch auf meiner Schürze und dem linken Ärmel meines Hemdes.
Seit fast zehn Jahren arbeite ich in einer der Filialen und bin für den Bereich Konserven zuständig.
Es ist erstaunlich, was es bereits alles in Dosen gibt: Thunfisch, Sellerie, Mais, Bohnen oder Aprikosen.
„Damit der Kunde nicht den Überblick verliert, bist du, Colby, zur Stelle", so Douglas Meyer, der hiesige Filialleiter. Er glaubt, mich dadurch motivieren und mir das Gefühl geben zu können, einen höheren Sinn in meiner Arbeit zu sehen.
Douglas steht voll und ganz hinter Walter Tachmans Firmenideal und ist jedes Jahr von neuem darum bemüht, die Auszeichnung für den besten Supermarkt zu bekommen. Fünfmal ist es Douglas bereits gelungen.
Ich bin gerade damit beschäftigt, eine Palette Maisdosen im Regal zu verstauen, als mich Aaron anspricht. Er kümmert sich um die Haushaltswaren. Aaron erzählt, dass er, Mark von der Fleischtheke und Promille-Jack, der die Regale im Spirituosenbereich auffüllt, heute nach Feierabend zusammen noch einen’ trinken gehen. Vielleicht möchte ich auch mit? Ich danke Aaron für das Angebot, lehne es aber ab.
Er lächelt kurz und schüttelt den Kopf. „Es ist jedes Mal das Gleiche mit dir, Colby. Irgendwann fragen wir dich nicht mehr, weil du sowieso nie Zeit hast.“
Ich ignoriere seine Äußerung. „Ich wünsche euch viel Spaß“, antworte ich, während ich meinen Hubwagen zurück in Richtung Lager steuere.
Es ist nicht so, dass ich keine Lust habe, den Feierabend mit meinen Kollegen zu verbringen. Sie sind nett zu mir und wir verstehen uns, auch wenn ich weiß, dass sie mich für komisch halten.
Aber heute Abend kann ich nicht. So wie jeden Mittwoch jeder Woche im ganzen Jahr.
Als meine Schicht endet, gehe ich in den Personalraum, ziehe mich um und verstaue Hemd und Schürze in meinem Spind. Ich hänge mir meine große Tragetasche um und laufe zurück in den Supermarkt. Aus meinem Geldbeutel krame ich einen Zettel, auf dem ich einige Dinge vermerkt habe, die ich einkaufen muss. Da ich inzwischen den Inhalt jedes Regals im Supermarkt auswendig kenne, dauert es nur zehn Minuten, bis ich alles beisammen habe.
An der Kasse sitzt Sandra. Sie ist die neugierigste Person, die ich kenne und eine derjenigen, die mir den Namen Crazy-Colby verliehen haben. Während sie meine Einkäufe über den Scanner zieht, fragt sie mich, ob ich heute Abend noch Besuch kriege.
„Ich gehe nachher zu meinem Dad. Die Sachen sind für ihn.“ Ich hoffe damit, ihren Drang, über mein Leben Bescheid wissen zu wollen, etwas befriedigt zu haben.
Jetzt schaut sie mich gelangweilt an. Offensichtlich hätte sie gerne gehört, dass ich eine hübsche Frau zu mir eingeladen habe, um sie mit einem leckeren Essen zu verführen.
Nachdem ich die beiden Papiertüten im Kofferraum meines Wagens, einem alten Audi aus dem Baujahr 98’, verstaut habe, fahre ich los.
Ich brauche etwa zwanzig Minuten, bis ich die Einfahrt zu meinem früheren Zuhause erreiche. Als ich die Stelle bei Fresh food daily bekommen habe, bin ich ausgezogen. Heute überlege ich des Öfteren, ob es nicht besser gewesen wäre, bei meinem Dad zu bleiben.
Vielleicht hätten sich die Dinge anders entwickelt.
Vielleicht hätte ich ihm helfen können.
Ich steige aus und werfe einen Blick in den Briefkasten. Neben Reklame befinden sich auch zwei Rechnungen für Strom und Wasser in der Post.
Ich klemme mir die Briefe unter einen Arm und ziehe die Einkäufe aus dem Auto hervor. Mit dem Ellbogen senke ich den Kofferraumdeckel, bevor ich die beiden prall gefüllten Tüten die wenigen Stufen hinauf zur Haustür balanciere.
Mit einem Auge fällt mir auf, dass der Rasen dringend gemäht werden muss.
An meinem Schlüsselbund hängt der Generalschlüssel für das ganze Haus. Allerdings brauche ich ihn nicht, denn Dad hat wieder einmal vergessen, abzuschließen.
Ich öffne die Tür und werde von einem Schwall verbrauchter Luft begrüßt. Reflexartig verziehe ich das Gesicht. Bereits im Flur höre ich, dass der Fernseher läuft. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und rufe nach Dad. Er gibt mir keine Antwort.
Die meisten Jalousien sind herabgelassen, so als könnten sie das Haus vor der Außenwelt abschirmen.
In der Küche stelle ich die Einkäufe ab und reiße einige Fenster auf. Mein Blick streift die Spüle und ich staune, wie viel dreckiges Geschirr eine einzige Person innerhalb von drei Tagen verursachen kann.
Im Wohnzimmer beginnt Dad zu lachen. Er hat einen zufriedenen Unterton in seiner Stimme, während er mit sich selbst diskutiert. Ich warte einen Moment, dann bin ich bereit, zu ihm zu gehen.
Von der Küche gelangt man durch eine mit Glaselementen gestaltete Verbindungstür direkt ins Wohnzimmer. Als mich Dad bemerkt, nippt er an seiner Bierdose. Um den Sessel, in dem er es sich in Unterhemd und Jogginghose bequem gemacht hat, liegen unzählige zusammengeknüllte Dosen. Dad ist unrasiert und riecht nach Schweiß.
Sein Blick hängt voller Freude an der Bildröhre. Er sieht sich eine Video-aufnahme an.
„Das beste Spiel der Saison. Sam war das Zünglein an der Waage. Er ist mein Junge. Sam ist mein Junge.“
Ich setze mich neben Dad und schiebe einen Stapel aus leeren Pizzaschachteln beiseite.
„Die Highschool kann froh sein, so einen Spieler zu haben. Er wird das Team zum Sieg führen. Sam.“
In Dads Augen schimmern Tränen, nur weiß ich nicht, ob sie in Freude oder Verbitterung ihre Quelle haben.
„Ich werde uns etwas kochen“, sage ich nach einer Weile.
Dad sieht zu mir herüber und nimmt einen großen Schluck Bier.
„Du kannst Stolz darauf sein, Sam als deinen Bruder zu haben.“
„Das bin ich“, antworte ich nach einer Weile.
Dads Miene verfinstert sich. Seine Augenbrauen ziehen sich in Richtung seiner Nase zusammen, die Stirn liegt in unzähligen Falten. Es sind die deutlichsten Zeichen dafür, dass er wütend wird.
„Du bist ein Versager, Colby. Du kannst nichts. Sam hat so viel Talent. Er sollte an deiner Stelle bei mir sein!“ Dad schreit mich an. Ich lasse die Beschimpfungen über mich ergehen, denn gleich wird er anfangen, zu weinen.
Es ist jedes Mal dasselbe.
„Wieso ist Sam nicht hier? Wieso?“ Dad wirft die Bierdose gegen die Wand und vergräbt das Gesicht in seinen Händen.
Ich stehe auf und möchte zurück in die Küche.
„Colby, leg mir eine… eine andere…Kassette ein. Bitte.“
Ich wechsle das Band und wähle Dads Lieblingsspiel. Es war die letzte Meisterschaft, bevor Sam aufs College ging. Dad erkennt sie sofort und ein Lächeln legt sich über sein betrunkenes Gesicht.
Ich schaue eine Weile zu. Die Menschen auf der Tribüne feuern Sam an. An der Körperhaltung meines Bruders ist seine Anspannung deutlich zu erkennen. Noch weiß er nicht, dass der Sieg in diesem Spiel seiner Mannschaft den Weg zum Meistertitel ebnen wird.
„Das ist mein Junge.“
4
Die nächsten Tage verbrachte ich damit, das Haus und die Landschaft um den See zu erkunden. Nahe am Wasser führte ein Kiesweg zwischen den Bäumen hindurch. Die Hitze war unter dem Schatten der hoch gewachsenen Eichen leichter zu ertragen und so genoss ich die gemeinsamen Spaziergänge mit Grandma.
Viviane zeigte mir eine flache Stelle am Ufer, über die man einen leichten Einstieg ins kühle Nass fand. Sie warnte mich jedoch davor, nicht hinauszuschwimmen. Der See sei sehr tief und für unerfahrene Schwimmer nicht geeignet. Ich versprach ihr, vorsichtig zu sein.
„Wenn du magst, fahren wir bald einmal in die Stadt und ich zeige dir den Wochenmarkt“, schlug mir Grandma am späten Nachmittag vor.
Wir saßen auf der Veranda und aßen Kirschkuchen. Viviane hatte ihn mit den Kirschen aus ihrem Garten gebacken. Ich glaubte, in jeder Frucht die unzähligen Sonnenstrahlen zu schmecken, die sie hatten reifen lassen.
„Klingt gut“, sagte ich und streckte meinen Teller nach einem nächsten Stück Kuchen aus.
Im Haus begann das Telefon zu klingeln. Viviane entschuldigte sich und verschwand. Mir fiel auf, dass Grandma selten angerufen wurde. Seit ich hier war, hatte sie auch keinen Besuch empfangen. Ich fragte mich, ob sie sich manchmal einsam fühlt.
Im Vergleich zu den letzten Tagen wehte ein milder Wind und am Himmel tummelten sich vereinzelte, weiße Wolken. Waren dies Vorboten eines Gewitters? Soweit ich wusste, sprach der Wetterbericht keine Unwetterwarnungen aus.
Mein Blick fiel auf Grandmas Skizzenblock, der neben einer Schachtel Kohlestifte auf einem Stuhl am Tisch lag.
Ich stellte meinen Teller beiseite und schlug den Block auf. Es waren nur wenige Skizzen enthalten. Die meisten Seiten waren unbenutzt.
Ein Bild schien jedoch fast fertig.
Viviane hatte eine Frau gemalt, die mit traurigem Blick an der Tür eines Hauses stand und ein kleines Mädchen an der Hand hielt. Ihre Augen schienen jemandem zu folgen, der dabei war, sie zu verlassen. Je länger ich die Zeichnung betrachtete, desto intensiver beschlich mich das Gefühl, dieser in Kohle festgehaltene Moment war wirklich geschehen.
Ich blätterte auf eine leere Seite und griff nach der Kohle. Die dünnen Stifte lagen seltsam zerbrechlich in der Hand. Daumen und Zeigefinger färbten sich schwarz, als ich die Zeichenkohle dazwischen rieb.
Ich wollte mein Glück versuchen und selbst eine Skizze anfertigen. Meine Grundschullehrerin, Mrs. Kramer, hatte schon mehrfach behauptet, ich besäße Talent im Umgang mit Papier und Farbe. Mum und Dad interessierte dies nicht wirklich.
Mum war fort.
Dad hatte Sam.
Ich entschied mich, die Trauerweide neben der Veranda zu zeichnen. Ich hielt es für eine angemessene Herausforderung, ein Abbild des Baumes auf dem Papier zu schaffen und begann mit dem Stamm. Ich konzentrierte mich auf das Muster des Holzes, das aus unzähligen schmalen Linien geformt war. Sie begannen am Boden und verschwanden im Dickicht des Blätterdachs, das sich wie ein Lampenschirm um den Stamm spannte.
Fuhr ich mit der Hand über die gezogenen Striche auf dem Papier, so verschwammen diese leicht. Ich erkannte schnell den Reiz, der das Zeichnen mit Kohle ausmacht. Das Spiel von Licht und Schatten kann auf diese Weise mit Leichtigkeit dargestellt werden.
Je länger ich damit beschäftigt war, die Konturen des Baumes auf das Papier zu übertragen, desto mehr vergaß ich die Zeit. Meine Umgebung verschwamm. Es gab nur noch den Skizzenblock und das Motiv vor meinen Augen.
Meine Hände wanderten immer schneller und der Kohlestift wurde zusehends kleiner.
Als mich Viviane ansprach, zuckte ich erschrocken zusammen. Sie stand an der Haustür und schien mich bereits eine Weile dabei beobachtet zu haben, wie ich zeichnete. Ihre Augen musterten mich vorsichtig. Sie wirkte ungewohnt streng.
„Tut mir Leid. Ich hätte dich fragen sollen“, entschuldigte ich mich. Vielleicht war sie sauer, dass ich ihren Skizzenblock benutzt hatte?
Sie kam auf mich zu und zog mir den Block aus den Händen. Mein Gesicht wurde rot. Ich schämte mich und wäre am liebsten in den Schrank meines Zimmers gekrochen.
Vivianes Blick prüfte meine Zeichnung.
„Das ist eine hervorragende Arbeit. Ich wusste… ich wusste nicht, dass du so… so begabt bist.“
Jetzt überraschte sie mich. Grandma setzte sich an den Tisch, den Skizzenblock fest umklammert.
„Warum habe ich es nicht schon vorher bemerkt?“ Sie schien sich selbst zu tadeln.
Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte und sah betrübt auf meinen Kuchenteller.
„Hast du schon einmal probiert, mit Acryl- oder Ölfarbe zu malen?“, fragte sie mich nach einer Weile.
Ich schüttelte den Kopf. Gandma legte mir ihre Hand behutsam auf den Unterarm. Erleichtert erkannte ich, dass sie nicht wütend war.
„Willst du es einmal versuchen? Wir könnten in mein Atelier gehen.“
„Wirklich? Ich darf in deinem Atelier malen?“
Viviane lächelte über die Begeisterung in meinen Augen. „Aber natürlich.“
Wir saßen noch eine Weile beisammen auf der Veranda und Grandma verriet mir, dass sie selbst etwa in meinem Alter gewesen sein musste, als sie sich für die Malerei zu interessieren begann. „Ich habe viel üben müssen, bis ich mit Pinsel und Farbe richtig umgehen konnte. Aber ich glaube, du bist ein Naturtalent.“
Sie nahm ihren letzten Schluck Kaffee und machte sich daran, dass Geschirr zu stapeln und in die Küche zu tragen.
„Wasch dir noch geschwind deine Hände, Schatz“, sagte sie, bevor sie ihm Haus verschwand. Ich sah an mir hinab und bemerkte erst jetzt, wie schwarz meine Finger waren.
An der Haustür drehte ich noch einmal um. Ich wollte zuerst meine fertige Zeichnung ansehen. Grandma hatte mir den Block aus der Hand gezogen, bevor ich das Bild hatte betrachten können.
Als ich das Blatt aufschlug, lief mir ein Schauer über den Rücken. Mein Herz klopfte schneller und ich unterdrückte das Gefühl, laut aufzuschreien. Ich musste mich setzen.
„Das kann nicht sein“, flüsterte ich. Mein Verstand wehrte sich zu begreifen, was ich sah.
Auf dem Block war nicht die Trauerweide zu sehen. Der Baum, den ich gezeichnet glaubte, war nicht da.
Stattdessen sah ich Vivianes Garten und die beiden Korbstühle am Ufer des Sees. Ich hatte jenen Abend am Tag meiner Ankunft gemalt, als wir uns im Garten den Sonnenuntergang ansahen. Die Skizze wirkte so echt wie eine Fotoaufnahme.
Eilig durchsuchte ich den Skizzenblock nach der Trauerweide, aber sie war verschwunden.
Sollte ich Grandma erzählen, dass dieses Bild nicht von mir stammt? Und das ich vor einigen Tagen geglaubt hatte, von einem Fremden in meinem Zimmer beobachtet zu werden?
Sicherlich würde sie mich für verrückt halten.
Ich legte den Block auf den Tisch und entschied mich, zu schweigen. Dann ging ich ins Haus, bereit das Unerklärliche zu verdrängen, was mir widerfuhr.
Heute weiß ich, dass dies der erste Moment war, an dem sie mich benutzten.
Meine Bestimmung begann sich zu erfüllen.
5
Ich besuche meinen Dad zwei bis drei Mal die Woche und sehe nach dem Rechten. Er kümmert sich weder um das Haus noch um den Garten. Es obliegt mir dafür zu sorgen, dass er nicht in einem riesigen Mülleimer lebt.
Ich koche ihm eine warme Mahlzeit.
Bezahle die Rechnungen.
Wasche seine Wäsche.
Er verbringt seine Tage damit, Videoaufnahmen über Sams Baseballkarriere anzusehen. Dad hat jedes Spiel, jeden Sieg aufgezeichnet.
Sams Erfolge erinnern ihn an eine glückliche Zeit. Er und sein ältester Sohn waren damals ein Herz und eine Seele. Darum hält er an diesen Erinnerungen so sehr fest. Mehr noch, inzwischen bestimmen sie Dads Leben. Er verleugnet, was in den letzten Jahren passiert ist. Für ihn ist Sam immer noch der ambitionierte, junge Sportler, für den es nur eine Leidenschaft gibt.
Nach dem Abendessen verabschiede ich mich von Dad, der bereits in eine andere Aufnahme vertieft ist. Als ich gehe, schließe ich die Tür hinter mir ab. Jedes Mal, wenn ich an meinem Wagen stehe, schaue ich noch einmal zurück. Dieses Haus war einmal mein Zuhause. Ein Wunsch in meinem Herzen gewinnt für kurze Zeit die Oberhand über die Realität: Wenn ich wieder herkomme, empfängt mich Dad und erklärt, dass er das Geschehene akzeptiere. Er habe sich lange genug in seine eigene Welt geflüchtet. Er möchte wieder in der Gegenwart leben. Und er wisse, dass er auf mich zählen kann.
Aber so wird es nicht sein. Dad wehrt sich gegen die Wahrheit und ich kann nichts tun.
Es ist kurz nach halb acht.
Der Grund, weshalb ich mittwochs niemals mit meinen Kollegen nach Feierabend ein Bier trinken gehen kann. Heute verspäte ich mich etwas.
Das weiß gestrichene Gebäude mit der großen Parkanlage ist bereits von weitem gut zu erkennen. Es liegt am Ende einer Straße, die mit Villen der Wohlhabenden dieser Stadt gesäumt ist. Die Vorgärten sind gepflegt und unterstreichen den Prunk der Immobilien.
Ich ordne mich in einer Parklücke in der Nähe des Haupteingangs ein. Als ich hineingehe, kommen mir zwei der weiß gekleideten Mitarbeiter entgegen. Sie steuern einen Aschenbecher am Eingangsportal an.
Der mir bekannte sterile Geruch erfüllt die Luft. Ich laufe die wenigen Schritte hinüber zum Fahrstuhl und fahre hinauf in die vierte Etage.
Am Empfang sitzt Ashley. Sie ist meistens hier, wenn ich am Mittwochabend herkomme. Ab und zu reden wir beide miteinander. Ich bilde mir inzwischen sogar ein, sie etwas zu kennen.
„Hallo Colby“, begrüßt sie mich freundlich.
„Hallo Ashley. Kann ich zu ihm?“
Ashley schaut mich betroffen an.
„Ist etwas passiert?“, frage ich wie aus der Pistole geschossen. Ich werde nervös.
„Nein, keine Sorge“, beruhigt sie mich. „Aber Sie sollten wissen, dass er heute keinen guten Tag hat. Es ist schlimmer als sonst.“
„Okay. Danke.“ Ich nicke und steuere eilig den Gang an, der rechts vom Empfang abzweigt.
„Warten Sie, ich komme mit Ihnen.“ Ashley schließt zu mir auf. Meine Augen fixieren die Tür mit der Nummer 418.
„Es tut mir Leid. Vielleicht wäre es besser, wenn ich Sie das nächste Mal vorher anrufe.“
„Nein, es ist in Ordnung. Ich komme jeden Mittwoch hierher. Das bin ich ihm schuldig.“
Ashley erwidert nichts. Als wir an der Tür angelangt sind, stellt sie sich vor mich.
„Wenn ich etwas für Sie tun kann, dann lassen Sie es mich wissen.“
Ich nicke. Wir bleiben einen Augenblick schweigend nebeneinander stehen, bis Ashley zum Empfang zurückkehrt. Meine Hände legen sich zitternd auf den Türknauf. Ich lausche, aber ich kann nichts hören. In dem Zimmer ist es völlig still.
Ich öffne die Tür und trete ein.
Es brennt keine einzige Lampe. Der Raum liegt im Halbdunkel der angebrochenen Nacht. Nur der matte Schein der Straßenlaternen dringt durch das große Fenster auf der gegenüberliegenden Seite herein.
Sam sitzt auf der Fensterbank und schaut hinaus. Er trägt einen dunkelblauen Pyjama und darüber einen ebenfalls blauen Bademantel. Sein dichtes, dunkelbraunes Haar fällt ihm tief ins Gesicht. Die Arme um den Körper geschlungen, wiegt er sich langsam hin und her.
Leise schließe ich die Tür hinter mir.
„Hi Sam, ich bin’s“, begrüße ich ihn einen Moment später. Er dreht sich kurz zu mir um, dann widmet er sich wieder der Straße.
Ich setze mich zu ihm auf die Fensterbank. Er schaut demonstrativ zur Seite.
„Es tut mir Leid, dass ich dich so spät besuche. Aber ich hatte noch…etwas zu erledigen.“ Ich erzähle ihm nie, dass ich bei Dad war. Ein Gefühl sagt mir, es würde Sam nur aufwühlen. Sie haben sich seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen. Genauer gesagt, seit dem Tag, an dem Sam hier her kam.
„Wie geht es dir?“
Sam bleibt stumm. Er zieht seine Beine näher zu sich und stützt sein Kinn auf den Knien ab.
„Letzte Woche hast du mir von deinem Freund Mike berichtet und dass ihr im Gemeinschaftsraum zusammen mit Ashley und Will Karten gespielt habt.“ Nach zwei Jahren fällt es mir nicht mehr schwer, ein Gesprächsthema zu finden. Meistens knüpfe ich an die wenigen Dinge an, die mir Sam erzählt. So erhalte ich zumindest einen kurzen Augenblick seiner Aufmerksamkeit.
Aber dieses Mal reagiert er nicht. Ashley hat Recht. Heute hat mein Bruder keinen guten Tag.
„Ich nehme mir bald ein paar Tage frei und besuche vielleicht Onkel Steve“, versuche ich es erneut.
Sams Augen weiten sich und er sieht mich wie ein in die Enge getriebenes Raubtier an. Er zittert am ganzen Körper.
„Was hast du? Bitte sprich mit mir.“ Ich möchte ihm meine Hand auf den Arm legen, weil ich glaube, die Berührung könnte ihn beruhigen.
Da springt er auf, rennt aus dem Zimmer und brüllt „Ich bin nicht verrückt!“
Für einen Augenblick bin ich so perplex, dass ich gar nicht weiß, was ich tun soll.
Ich folge ihm so schnell es mir möglich ist. Zu meiner Überraschung wartet er auf dem Gang.
„Willst du mir etwas zeigen?“, frage ich ihn.
„Ich bin nicht verrückt.“ Sam rennt weiter und es strengt mich an, mit ihm mitzuhalten. Sein Körper ist kräftig und flink. Er ist noch immer in ausgezeichneter Form.
Sam führt mich in den Gemeinschaftsraum. Zu dieser Uhrzeit sitzen hier keine Bewohner. Die meisten sind in ihren Zimmern und hängen, wie auch Sam zuvor, ihren verworrenen Gedanken nach.
Wir bleiben vor einem riesigen Aquarell stehen. Es zeigt die Anstalt, portraitiert von einer Stelle im Garten. Im Fordergrund blüht eine Reihe von Blumen und in den Fensterreihen im Erdgeschoss spiegelt sich das Sonnenlicht wider.
Ein Ort der Ruhe und des Vertrauens.
Die Konstante für jene, deren Leben sich im Wahnsinn wiegt.
Sam tritt nahe an mich heran und flüstert mir etwas zu. „Ich bin nicht verrückt. Schau es dir an, Colby. Schau es dir ganz genau an.“
Mir wird bewusst, was Sam plant. Warum er mich hierher gebracht hat.
„Lass uns zurück in dein Zimmer gehen“, wende ich ein.
„Nein, du schaust dir das Bild an! Sie müssen es verstehen.“ Zorn liegt in seinen Worten.
„Das werde ich nicht, Sam.“ Ich möchte ihn am Arm nehmen. Er schlägt meine Hand beiseite und hält sie im selben Moment fest.
„Lass mich bitte los.“
„Erst wenn du dir das Bild ansiehst!“
Tränen steigen mir in die Augen.
„Sam, bitte!“ Auf einmal bin ich wieder sein kleiner, schwacher Bruder. Er hat die Oberhand.
Ich schaue zur Seite und halte nach einem Pfleger Ausschau. Doch niemand ist zu sehen.
Sam verpasst mir eine Ohrfeige. „Ich bin nicht verrückt!“ Er knurrt und fletscht die Zähne. Schließlich presst er mir die Hand in den Nacken und zieht mein Gesicht in Richtung des Bildes. Ich habe keine andere Wahl, als mir das Aquarell anzusehen.
Vor meinen Augen beginnen die Farben und Konturen zu verschwimmen. Die Blumen verlieren ihre Blütenblätter und an der Fassade des Hauses entstehen Risse. Aus der Mitte breitet sich Finsternis aus, bis die Leinwand tintenschwarz schimmert.
Inmitten der Dunkelheit zeichnet sich die Silhouette eines Gesichts ab. Es ist ein Mann, dessen Augen weit aus den Höhlen treten und der verzweifelt um Hilfe schreit. Sein Körper wird sichtbar. Er trägt eine Zwangsweste und wird von zwei Männern an eine Bank geschnallt. Sein Mund wird mit Klebeband versiegelt. Die Schreie ersticken. Der Körper des Geknebelten beginnt heftig zu zucken. Die Panik in seinen Gesichtszügen wird immer größer.
Die Männer reißen ihm das Hemd auf und befestigen mehrere Elektroden an seiner Brust. Eine weitere Person tritt hinzu. Sie gibt den Übrigen Anweisungen und zählt mit ihren Fingern einen Countdown. Am Ende durchfährt den Gefesselten einen Stromstoß. Er ist so stark, dass ich die Schmerzen an meinem eigenen Körper spüre.
Ich schreie laut auf. Schweiß tritt mir auf die Stirn und mein Herz hämmert wild gegen meine Brust.
Plötzlich löst sich der Druck an meinem Nacken und ich sinke erschöpft zu Boden. Ich wische mir über die Augen und sehe wieder die Anstalt und den Garten auf der Leinwand.
Sam wird von zwei Pflegern festgehalten. Er tritt wild um sich und versucht, aus dem Griff zu entkommen.
„Ich bin nicht verrückt!“, brüllt mein Bruder aus tiefster Kehle. Dann fängt er laut an zu lachen. „Sag es ihnen, Colby. Sie müssen es alle erfahren.“
Ein weiterer Pfleger kommt angerannt. In seiner Hand hält er eine Spritze, deren Nadel sich einen Augenblick später in Sams Arm bohrt. Wie von Zauberhand verfliegt seine Rage und er sinkt müde zusammen.
Ashley betritt den Gemeinschaftsraum. „Colby, ist Ihnen etwas passiert?“ Besorgt kniet sie neben mir nieder.
„Mir geht es gut“, behaupte ich.
Die Pfleger tragen Sam zurück in sein Zimmer und ich komme mit Ashleys Hilfe wieder auf die Beine.
„Sam hat den ganzen Tag über behauptet, Sie wären mit Abstand genauso verrückt wie er.“
„Er…er wird sich doch wieder beruhigen?“
Ashley scheint überrascht von meiner Frage zu sein. Sicherlich versteht sie nicht, weshalb ich mir Sorgen um Sam mache, nachdem er mich so drangsaliert hat.
„Jeder Tag ist anders. Morgen haben sich die Wogen in Sams Welt wieder geglättet.“ Ashleys Worte spenden mir etwas Trost.
Als wir das Gemeinschaftszimmer verlassen, werfe ich noch einmal einen Blick auf das Bild. Die Konturen verändern sich erneut, doch dieses Mal wende ich mich rechtzeitig ab.
Was ich gesehen habe, erinnert mich an meine Entscheidung. An die Gründe, warum ich sie getroffen habe.
Ich werde nie wieder malen. Mich nie wieder der Schönheit eines Bildes widmen.
Es ist keine Gabe. Es ist ein Fluch.
6
Mit dem langen, bronzefarbenen Schlüssel in ihrer Hand öffnete Viviane das Holztor des Schuppens. Ich spähte hinein, konnte aber aufgrund der Dämmerung nichts erkennen.
„Einen kleinen Moment“, sagte Viviane und tastete die Wand zur rechten Seite des Eingangs ab. Sekunden später erhellte der angenehme Schein einer Lampe das Atelier. Es erinnerte mich an das Mondlicht einer Sommernacht.
„Als ich das Haus vor gut fünfzehn Jahren gekauft habe, wurden hier noch Gartengeräte und Werkzeug aufbewahrt“, verriet Grandma, während ich mich umsah. Im vorderen Teil standen Leinwände, Farbeimer und einige Kisten, während in der Nähe zweier großer Fenster die Staffelei thronte. Die Wände waren ähnlich wie im Haus geschmückt. Ein Speer, dessen dunkle Spitze mehrere, bunte Federn zierten, wurde durch zwei Eisenringe an der Wand gehalten. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein ovalförmiger Teppich. Das Muster der Webarbeit glich einer Sonne, deren Zentrum im Licht fahl schimmerte. Als ich zurück zur Tür sah, entdeckte ich oberhalb des Rahmens eine der mir bereits bekannten, unheimlichen Masken.
Mich beschlich das Gefühl, eine tropische Welt betreten zu haben und meine kindliche Phantasie malte sich aus, dass sich irgendwo in dem Schuppen die exotischsten Tiere verstecken.
Viviane lief zur Staffelei hinüber und zog eine weiße Leinwand hervor. Mit schnellen Handgriffen richtete sie Pinsel und eine Farbpalette.
Während ich ihr zusah, dachte ich an die Skizze, die am Nachmittag auf rätselhafte Weise entstanden war und Anspannung breitete sich erneut in mir aus.
Ich war nach wie vor davon überzeugt, dass dieses Bild unmöglich von mir stammte. Ich hatte mich auf die Trauerweide konzentriert und zu keiner Zeit an den Garten gedacht. Wie konnte so etwas also passieren?
Ich überlegte, wenn ich hier nun erneut male, würde das gleiche wieder geschehen?
Viviane winkte mich zu sich an die Leinwand heran und auf einmal verflog meine Nervosität. Sobald Grandma in meiner Nähe war, fühlte ich mich sicher.
Sie reichte mir einen Pinsel und die Palette, auf der sie glänzende Farbtupfer in nahezu allen Tönen des Regenbogens aufgetragen hatte.
„Du darfst dir ein Motiv aussuchen. Was möchtest du gerne malen?“
Ich überlegte einen Augenblick, konnte mich aber nicht entscheiden. Was sollte das erste Bild werden, das ich mit Ölfarbe auf einer Leinwand festhalten wollte?
„Ich weiß es nicht, es ist so schwer.“
„Schließ deine Augen und vertrau deinem Gefühl. Das erste, was du sehen wirst, ist es wert, dir Portrait zu stehen.“
„Ich probier es“, stimmte ich zu. Ich schloss die Augen und fand zunächst nichts außer Dunkelheit. „Ich sehe gar nichts“, sagte ich besorgt.
Grandma kniete zu mir nieder und legte mir ihre Hände auf die Schultern.
„Hab ein wenig Geduld“, flüsterte sie.
Ein merkwürdiges Gefühl brachte meine Haut zum Kribbeln. Plötzlich erhellte etwas die Finsternis vor meinen Augen und ich durchstreifte den Wald entlang des Sees. Ich stand an der Stelle, von der mir Viviane verraten hatte, sie ermögliche einem einen leichten Einstieg ins Wasser. Es war am frühen Abend und die Sonne tauchte die Wasseroberfläche in rotgoldenen Glanz. Das Bild vor meinem geistigen Auge war so intensiv – so real –, dass ich glaubte, ich könne tatsächlich in das Wasser steigen.
Ich öffnete die Augen und lächelte. „Ich weiß, was ich malen möchte.“ Viviane trat hinter mich und umschlang meine Hand mit der ihren.
„Mit welcher Farbe möchtest du beginnen?“
„Blau“, antwortete ich.
Gemeinsam tunkten wir den Pinsel vorsichtig in den blauen Farbklecks auf der Palette. Grandma führte mir vor, wie ich die flüssige Farbe am besten an den Borsten halten konnte und ich sah ihr fasziniert zu. Dann lies sie meine Hand los.
„Die Leinwand gehört dir.“
Ich suchte mir einen Punkt aus dem Bild in meiner Vorstellung und führte den Pinsel auf die weiße Fläche. Behutsam zog ich die Konturen des Sees auf der Leinwand nach. Zu meiner Überraschung war es wesentlich leichter, als ich erwartet hatte.
Viviane schien bemerkt zu haben, wie viel Spaß mir das Malen bereitete. „Probier dich ruhig aus“, ermutigte sie mich.
Ich konzentrierte mich und wählte den nächsten Farbton, mit dem ich das Portrait des Sees fortführen wollte. Ich nahm ein anderes Blau und lies es mit dem ersten eins werden. Je länger ich malte, desto deutlicher sah ich das Bild des Sees vor mir. In meiner Phantasie hatte es längst die Leinwand bedeckt und alles, was ich zu tun hatte, war mit den Farben meiner Palette die Fläche auszufüllen. Wie auch am Nachmittag begann ich um mich herum alles zu vergessen. Für mich gab es nur diese Leinwand, den Pinsel und die Farben.
Das Bild war noch längst nicht fertig, als mich eine Berührung an meinem Arm aufschreckte.
„Es ist spät, Colby. du solltest jetzt schlafen gehen.“ Grandma stand neben mir und hatte sich eine dünne Decke um die Schultern gelegt.
Sichtlich irritiert schaute ich mich um. Ich konnte nicht abschätzen, wie lange ich schon vor der Staffelei stand. Auf einmal spürte ich große Müdigkeit, die sich wie ein Lauffeuer in mir auszubreiten begann. Die Kraftquelle, welche mich wach gehalten hatte, war plötzlich versiegt.
„Ist gut“, antwortete ich zwischen einem kurzen Gähnen und wollte den Pinsel und die Palette beiseite legen.
Da spürte ich erneut ein seltsames Kribbeln in mir. Etwas schien mich davon abhalten zu wollen, das Malen zu beenden. Ich brachte es nicht fertig, mein Handwerkszeug auf den Tisch zu legen.
„Wir können morgen weiter machen“, sagte Viviane.
Meine Hände waren wie erstarrt, während sich mein Blick an die Leinwand heftete. Mir war, als befände ich mich in dem Bild. Die Sonne schien von dem orangefarbenen Abendhimmel und tauchte das Land in eine trockene Hitze. Ich stand an dem See und schritt langsam in das angenehme, kühle Wasser hinein. Ich ging so lange weiter, bis ich keinen Boden mehr unter den Füßen fand und schwimmen musste. Das Ufer geriet immer mehr in Entfernung und plötzlich wurde mir bewusst, welches Ziel ich ansteuerte. Inmitten des Sees hielt ich inne.
Vor die Sonne schob sich eine große, aufbauschende Wolke und dunkelte das Licht auf unheimliche Weise ab. Als ich zurück zum Ufer schwimmen wollte, spürte ich etwas an meinen Füßen. Es fühlte sich wie die Berührung einer Hand an, die sich langsam um meinen Knöchel schloss. Ich schaute unter die Wasseroberfläche und im selben Moment ergriff mich Panik. Unter mir befand sich eine schneeweiß schimmernde Gestalt. Ich begann wild mit den Beinen zu strampeln, doch hielt die Gestalt mich mit eisernem Griff fest. Die Hände wanderten weiter an meinem Körper hinauf, bis sie sich in meinen Schultern verhakten. Ich wollte um Hilfe schreien, brachte aber keinen einzigen Laut hervor.
Ein Ruck zog mich unter Wasser. Ich blickte in das leichenblasse Gesicht eines jungen Mädchens, das mich mit ihren weit aufgerissenen Augen förmlich durchbohrte. Ihre langen, dunklen Haare wirkten wie ein Vorhang aus schwarzem Samt, der sich im Wasser sachte wiegte. Ich spürte, wie die restliche Luft aus meinen Lungen wich und versuchte, mit allen Mitteln zurück zur Oberfläche zu gelangen. Aber das Mädchen besaß eine unglaubliche Kraft und hielt mich davon ab, aufzutauchen. Ich konnte mich nicht wehren, so sehr ich mich auch bemühte und gemeinsam sanken wir hinab in die Tiefe des Sees.
„Colby!“ brachte mich Grandmas besorgte Stimme zurück in den Schuppen. Sie hatte mir den Pinsel und die Palette aus den Händen genommen und sah mich besorgt an. „Um Himmels Willen, was hast du denn?“
Ich schaffte es nicht, ruhig zu atmen. Meine Lungen brannten und gierten förmlich nach Luft.
Vivianes Hände stülpten mir eine Plastiktüte vor den Mund. „Atme hier rein“, sagte sie mit entschlossener Stimme, während sie mir die Hände auf die Schultern legte. Ich folgte ihren Anweisungen und nur einen Augenblick später klang das Brennen in meinem Hals ab.
„Es tut mir leid“, beteuerte ich nach einer Weile und sank auf meine Knie. „Alles wird gut“, flüsterte Grandma und umarmte mich fest. Ich war davon überzeugt, dass sie genauso wenig wie ich selbst verstand, was mit mir passiert war. Hätte ich in diesem Moment den Ausdruck in ihren Augen deuten können, so wäre mir klar geworden, wie sehr ich mich täuschte.
7
Mitte der Achtziger begann Doktor Wyatt Fisher ein Experiment. Fisher war davon überzeugt, dass psychische Störungen durch einen Ausgleich an physischem Leid behandelt werden können. Der Körper, ja das ganze Wesen des Patienten würde so wieder zu seinem inneren Gleichgewicht finden, das in Folge von erlittenen Traumata geschädigt ist.
Seine Position als einer der führenden Neurologen in der St. Grace-Anstalt für psychisch Kranke gewährte Fisher die Möglichkeit, ausreichend Probanden zu finden. Der Arzt überzeugte zahlreiche Angehörige der Erkrankten und begann mit dem Zuspruch der Familien, seine Schmerztherapie zu erproben.
Etwa zehn Monate später zeigte sich, dass Fishers Methoden ohne Erfolg blieben und er dadurch zusehends in die Kritik geriet. Das Ansehen der Anstalt verschlechterte sich und die Leitung ordnete an, die Testreihen zu beenden. Fisher widersetzte sich dieser Anweisung und führte seine Versuche heimlich fort.
Hauptbestandteil der Therapie war der Einsatz von Elektroschocks. Mit jeder weiteren Behandlung steigerte er das Schmerzpotential, das die Patienten erleiden sollten. Erst als ein gewisser Francis J. Osman während der Behandlung starb, erkannte Fisher, dass er mit seinen Methoden die Grenzen jeder Moral überschritten hatte. Am 17.10.1989 wurden der Leichnam des Mediziners am Ufer eines Flusses und wenig später die erschreckende Dokumentation seiner Studie gefunden. Auf der letzten Seite seiner Arbeit war ein handschriftlicher Vermerk.
Ich habe mein Recht zu leben verwirkt.
Ich schließe das Internetportal des städtischen Zeitungsarchivs und reibe mir die müden Augen. Die Recherche bestätigt meine Vermutung, dass in der Anstalt schlimme Dinge geschehen sind. Was mir für einen Augenblick beim Betrachten des Bildes im Aufenthaltsraum zu Teil wurde, war die Leidensgeschichte von Francis J. Osman. Offensichtlich gibt er der Anstalt die Schuld, dass so viele Menschen leiden mussten und niemand etwas gegen Fishers Experimente unternommen hatte. Ich habe als einziger Francis’ Klageruf verstanden und fühle Bitterkeit darüber in mir aufsteigen, ihm nicht helfen zu können.
„Es tut mir Leid“, flüstere ich, während mein Laptop herunterfährt.
Ich stehe auf und setze mich auf meine Couch im Wohnzimmer. Inzwischen ist es kurz nach Mitternacht und ich schalte den Fernseher an, um mir die Spätnachrichten anzuschauen.
Ich sehe andere schreckliche Ereignisse, gegen die ich auch nichts unternehmen kann. Die Meldungen helfen mir, Francis’ Schicksal als ein Teil des Leids zu verstehen, das niemand bestimmt war, aufzuhalten. Und doch durchkreist meine Gedanken die Frage, ob ich zumindest dazu fähig wäre, seiner ruhelosen Seele Erlösung zu schenken.
Ich kenne Vivianes Antwort hierauf. Aber meine Grandma nannte auch die Dinge, die mir zu Teil werden, eine Gabe. Und deshalb zweifle ich, etwas bewirken zu können.
Ich wünschte, du wärst hier bei mir, Grandma.
Nach den Kurzmeldungen aus aller Welt wechseln die Nachrichten zu einem lokalen Thema. Noch immer fehlt von der fünfzehnjährigen Alice Amstritch jede Spur. Das Mädchen wurde vor neun Tagen vermisst gemeldet und bisher blieben die Ermittlungsarbeiten der Polizei erfolglos. Jeder Hinweis, dem die Beamten nachgegangen sind, entpuppte sich als eine Sackgasse.
Alices Eltern haben inzwischen gemeinsam mit zahlreichen Bekannten, Nachbarn und anderen Freiwilligen eigene Suchtrupps gebildet. Jake Amstritch spricht mit feuchten Augen in die Kamera und versichert allen Zuschauern und sich selbst, dass er und seine Frau Lauren nicht eher ruhen werden, bis sie ihre Tochter wieder in den Armen halten. An seinem Gesichtsausdruck ist zu erkennen, dass die Möglichkeit, Alice könnte bereits tot sein, noch nicht herangezogen wurde. Der Wunsch, das eigene Kind zu retten, behält die Oberhand.
Es ist das zweite spurlose Verschwinden innerhalb des letzten halben Jahres, bei dem eine junge Schülerin wie vom Erdboden verschluckt bleibt. Auch bei Denise Gallard gab es weder ein Lebenszeichen noch eine Leiche. Stattdessen sind die Angehörigen und Freunde zwischen Hoffnung und Angst gefangen.
Die Hoffnung, dass sie lebt und gefunden wird.
Die Angst, sie nie mehr wieder zu sehen.
Ich glaube, diese Ungewissheit über das Schicksal des eigenen Kindes ist die Größte der Qualen.
Alices Verschwinden weckt bei mir Erinnerungen. Ich spüre, wie sich in meinem Körper eine eisige Kälte ausbreitet. Mein Herz, so meine ich, wird zu einem leblosen Klumpen, den ich mir am liebsten aus der Brust reißen würde.
Ich fahre mir mit dem Handrücken über die feuchten Augen und versuche, jede weitere Träne zu unterdrücken.
Die Uhr über dem Fernsehen zeigt, dass es zwanzig Minuten nach Mitternacht ist. Ich bin mir sicher, dass ich keinen Schlaf finden werde. Zu viele Dinge halten mich davon ab.
Dads immer stärker werdendes Verdrängen der Realität.
Sams Wutausbruch in der Klinik.
Francis’ erlittene Qualen.
Und Alices und Denises rätselhaftes Verschwinden.
Ich entschließe mich, für einen Drink meine Wohnung zu verlassen und hoffe, das betäubende Brennen eines Whiskeys wird mir etwas Zerstreuung verschaffen. Ich greife nach einer Trainingsjacke, verstecke meine zerzausten Haare unter eine Kappe mit dem Fresh Food Daily - Firmenlogo und laufe etwa zwanzig Minuten, bis ich das Nomansland, eine Kneipe in einer Seitenstraße des Stadtzentrums, erreiche.
Die Gäste, die hier an Tischen und Tresen sitzen, teilen sich die gleiche Sehn-sucht. Sie wollen bei einem Drink ihre eigenen, trüben Gedanken ignorieren und für ein paar Stunden aus dem Alltag entfliehen.
Das Innere der Kneipe liegt in angenehmem Halbdunkel. Nur wenige Lampen und vereinzelt aufgestellte Kerzen durchbrechen mit ihrem Schein die tröstliche, wenn auch melancholische Stimmung. Aus kleinen Lautsprechern an der Decke ist Kurt Cobain zu hören. Es ist die bekannte Aufnahme eines Unpluggedkonzerts seiner Band Nirvana.





























