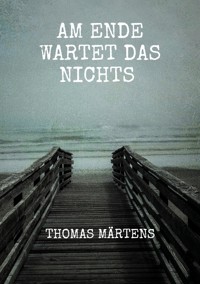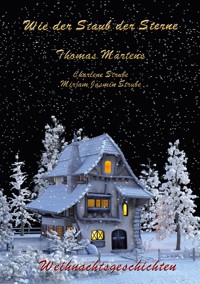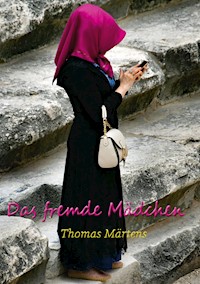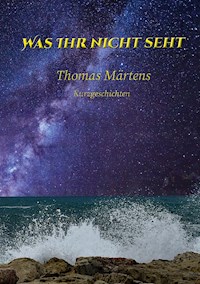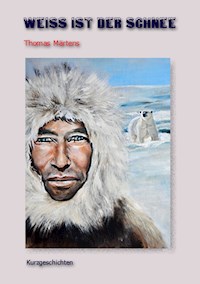Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Echo beleuchtet die äußerst spannende und ereignisreiche Entwicklungsgeschichte eines ganz normalen Jungen, der im Hamburg der 60iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts behütet aufwächst und später doch zum Mörder wird. Freddy Borrmann selbst erzählt mit aufrichtigen Worten und absolut schonungslos ohne Vorbehalte von seinen Ansichten, Überzeugungen, Erfahrungen und Erlebnissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlungsstränge in der nachfolgenden Geschichte sind fiktiv. Auch die Personen wurden frei erfunden. Ähnlichkeiten oder tatsächliche Übereinstimmungen mit lebenden oder bereits verstorbenen Menschen wären rein zufällig und waren zu keiner Zeit beabsichtigt. Auch die Handlungsorte sind zum großen Teil frei erfunden
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Textbeginn
Vita des Autors Thomas Märtens
Veröffentlichungen
Beteiligung an Anthologien der Autoren im Netzwerk
Beteiligung Anthologie des Literaturzirkels Peine
Kontakt mit dem Autor
Vorwort
Freddy Borrmann wächst auf dem Kiez im Hamburg der späten fünfziger Jahre es vergangenen Jahrhunderts auf und erlebt mit seiner Mutter in verschwiegener Zweisamkeit eine durchaus behütete Kindheit. Das ist zumindest dann der Fall, wenn sein Vater als Matrose auf den Schiffen dieser Welt unterwegs ist und durch Abwesenheit glänzt. In den wenigen Tagen im Jahr, in denen er jeweils unangemeldet, in der Regel völlig besoffen und höchst aggressiv in der ehelichen Wohnung aufkreuzt und das raue, gewalttätige Leben eines Seefahrers der damaligen Zeit im Gepäck mit sich trägt, ändert sich die häusliche Stille allerdings. Immer wieder schlägt er völlig unerwartet aus einer üblen Laune heraus auf seine Frau ein und vergreift sich später auch an seinem größer werdenden Sohn, als dieser irgendwann beginnt, sich schützend vor seine Mutter zu stellen.
Genau wie die Ausbrüche seines Vaters prägen den jungen Freddy auch seine häusliche Umgebung nahe der Reeperbahn, die unausweichlichen sozialen Konflikte in der Schule und später die am Arbeitsplatz. Es sind die Erbanlagen seines Vaters, die einfach in ihm wohnen und ihn immer weiter auf die Schattenseiten des Lebens abdriften lassen, bis er sich zuletzt dazu hinreißen lässt, einem Menschen das Leben zu nehmen. Allerdings trägt er auch die guten Gene seiner Mutter in sich und versucht, sein Leben wieder auf festen und gedeihlichen Boden zu stellen. Die Begegnung mit der überaus hübschen Enkeltochter seines Chefs könnte für ihn der alles rettende Anker sein.
Das Echo beleuchtet die äußerst spannende und ereignisreiche Entwicklungsgeschichte eines ganz normalen Jungen, der zum Mörder wird. Freddy Borrmann selbst erzählt mit aufrichtigen Worten und absolut schonungslos ohne Vorbehalte von seinen Motivationen, Ansichten, Überzeugungen, Erfahrungen und Erlebnissen. Er überlässt es den geneigten Leserinnen und Lesern, sich ein Urteil über sein nicht völlig weggeworfenes Leben zu bilden.
Nichts ändert sich, wenn Du es nicht selbst veränderst. Das betrifft alles, was in Dir ist, was Du denkst und fühlst, wie Du die Dinge siehst und jenes, was Dich umgibt. Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir niemand, denn zuletzt – so habe ich es häufig auch selbst erfahren müssen - ist alles eine Frage der Selbstachtung, was Du Dir gefallen lässt und wie lange es dauert, dass Du Dich gegen die Widerstände erhebst. Doch mach es Dir klar. Du musst zuweilen ganz sicher vor allem Deine inneren Grenzen weit zurück lassen, über gefährlich tiefe Abgründe springen und Dinge tun, die nie in Deinem Kopf waren, an die Du bislang nicht einmal in Deinen schlimmsten Träumen gedacht hast und die trotzdem getan werden müssen. Auch wenn Du dafür gesteinigt wirst oder man Dich jagt wie ein wildes Tier. Tust Du es nicht, bleibst Du immer der gleiche, folgst in einem Hamsterrad einer Endlosschleife oder schleppst Dich im Krebsgang durchs Leben. Monoton, berechenbar, uniform, ein Herdentier. Du allein hast die Wahl. Mach Dir aber bewusst, dass Du mit den aus Deinem Handeln resultierenden Folgen für alle Zeit zurechtzukommen hast. Es gibt danach kein zurück mehr. Es geht einzig um die Frage, was Du siehst, wenn Du in den Spiegel blickst.
Ich, Freddy Borrmann, bin ein Mörder. Ich habe einem anderen Menschen das Leben genommen, ihn massakriert, ins Jenseits geschickt, sein Lebenslicht ganz einfach ausgelöscht. Ich war und bin weder böse noch habgierig oder gewalttätig. Ich bin auch kein schlechter Mensch, zumindest nicht im humanistischen Sinne. In der rechtlichen Betrachtung meines Daseins allerdings käme ich allerdings schon zu einem völlig anderen Ergebnis. Die Buchstaben der geltenden Gesetze sprechen diesbezüglich eine zweifellos klare Sprache.
Zu meiner persönlichen Rechtfertigung muss ich sagen, dass es mir niemals zuvor in den Sinn gekommen war, etwas derart Schreckliches zu tun. Ich geriet ganz einfach nur an einem bestimmten Punkt meines Lebens in eine Situation, die mich in ein finsteres Nichts stürzte. Zuletzt hatte ich überhaupt keine andere Wahl, etwas anderes zu tun als genau das, was ich schließlich tat. Damit ich auch richtig verstanden werde. Ich bitte hier keinesfalls um Verständnis oder Nachsicht, denn es gibt auch aus meiner Sicht keine ethische Rechtfertigung für mein grausames Verhalten. Ein Mord ist und bleibt ein Mord und es ist vollkommen recht, dass eine solche Tat vor dem Gesetz nicht verjährt. Moralisch würde ich da aus meiner (und nur aus meiner) Sicht allerdings nicht ganz so rigoros urteilen. Ich erwähnte es schon, dass ich so handeln musste. Zumindest aus meinem damaligen Blickwinkel. Es ging mir ausschließlich darum, weiterhin mit Selbstachtung, die etwas sehr Bestimmendes und Wichtiges in meinem Leben war und ist, in den Spiegel sehen zu können und mir das einzugestehen, wovon so viele Menschen reden, aber nicht wirklich etwas wissen wollen, nämlich die Wahrheit. Und die Wahrheit ist das, was ich zuvor hinsichtlich meines Handelns bereits sagte. Vor der Tatbegehung hatte ich mich intensiv damit auseinandergesetzt und während der langen Planungs- und Vorbereitungsphase ein wiederholt heftiges Schaudern über meine Absicht empfunden, denn ich musste tatsächlich meine inneren Grenzen überwinden. Unschwer zu erkennen, dass in mir sowohl eine Seele lebt als auch ein Herz schlägt. Ich hatte mich vor der Tatausführung immer wieder und unaufhörlich gefragt, wie der Moment des Tötens wohl sein und wie sich das Auslöschen eines Lebens anfühlen würde, was allerdings für das Opfer aus verständlichen Gründen um einiges unangenehmer sein sollte. Unmittelbar vor der Tat war ich sogar ziemlich unruhig und nervös, musste aber zuletzt feststellen, dass die eigentliche Handlung recht simple, geradezu anspruchslos war, wie im Verlauf meiner Geschichte zu erfahren sein wird. Trotzdem. Alles um mich herum erschien in diesen Sekunden undurchsichtig, nebulös hinter einem Schleier versteckt, war nicht bestimmbar. Ich bewegte mich geradezu wie ferngesteuert. Auf jeden Fall bin ich kein Killer im eigentlichen Sinn. In mir tobten damals wie heute auch keine krankhaften Triebe. Ich habe seinerzeit einfach das Unausweichliche getan, weil es keinen anderen Weg gab, meine Selbstachtung wiederzuerlangen. Dabei unterscheide ich mich grundsätzlich von normalen, emphatischen Menschen, in deren Welt das Töten allenfalls des Abends im Fernsehen vorkommt und die in ihrer vermeintlich gerechten und aufgeklärten Welt vielleicht mehr als der zweifelhaften Überzeugung verfallen sind, zu einer solchen Tat überhaupt nicht fähig zu sein. Doch meine ich, dass ein derart rohes Verhalten bei den meisten Menschen lediglich eine Frage der Motivation ist. In unserer evolutionären Entwicklung sind wir meiner Überzeugung nach gerade einen Schritt weiter als ein Tier. Nichts ist es meiner Meinung nach mit der goldenen Krone der Schöpfung, denn im evolutionären Sinn sind auch wir lediglich ein weiterer ihrer unendlichen Versuche.
Man Stelle sich nur für einen Moment vor, ein Sexualstraftäter hätte der eigenen Ehefrau, dem Ehemann oder dem Kind etwas sehr Schlimmes angetan und beobachte sich selbst ganz genau. Bei dem ein oder der anderen wird die Sache mit der Empathie sicherlich bald ein Stück weit ins Wanken geraten. Und wenn man dem vielleicht körperlich offenkundig unterlegenen Täter allein im Dunkeln auf der Straße begegnet, während unstillbare Wut und dumpfer Schmerz die Seele aufwühlt. Was wäre dann? Wie war das doch gleich? Mitgefühl? Empathie? Ich wäre mir da bei vielen Artgenossen in einer solchen Extremsituation nicht mehr ganz so sicher.
Grundsätzlich, so ist es der modernen Hirnforschung zu entnehmen, scheint es so zu sein, dass die Spiegelneuronen die Basis für Mitgefühl, Kultur, Religion und ähnliches sind. Bei mir haben diese Dinger damals einfach nur versagt, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Ich habe lediglich einen Menschen mit Bedacht vorsätzlich und gnadenlos erledigt. Wiederholen würde ich so etwas nicht, denn es ist hinterher nicht mehr weit her mit dem Seelenheil. Das Bewusstsein meldet sich sehr bald zurück, die erwähnten Neuronen nehmen ihre Arbeit wieder auf und das Gewissen vermittelt ein Gefühl der Erbärmlichkeit, der Widerwärtigkeit, der Endgültigkeit und der Schuld. Mich plagen seitdem innerlich noch immer grimmig wütende Geister. Ich glaube auch nicht, dass das jemals vorbei sein wird. Bis an das Ende meiner Tage werde ich damit Leben müssen. Doch sagte ich bereits, dass es sein musste. Auch für mich war alles lediglich eine Frage der Motivation. Jetzt kommt man mir als Christ wahrscheinlich mit dem fünften Gebot um die Ecke. Ich weiß und wusste natürlich, dass ich nicht töten soll, aber was ist damit wirklich gemeint. Wenn ich eine Mücke erschlage, töte ich auch.
Bedeutet dieses Gebot im engeren Sinne vielleicht, dass ich nicht morden soll? Mord setzt juristisch gesehen niedere Beweggründe voraus. Davon steht im erwähnten Gebot aber nichts. Und überhaupt. Für wen gilt das im Besonderen? Hat schon mal jemand an die Kreuzzüge des Mittelalters gedacht, an die vielen Menschen, die im Namen des Kreuzes ihr Leben hergeben mussten, weil sie anderer Meinung waren oder an etwas Anderes glaubten? Auch die vermeintlich gute Sache rechtfertigt doch das Töten nicht! Kriege ziehen sich wie ein roter Faden bis heute durch die Geschichte der Menschheit und werden es sicherlich auch künftig tun. Dazu mag ich einfach nichts mehr sagen. Der Mensch an sich ist hässlich, feige und gemein. Seine Kreativität erreicht ungeahnte Höhen wenn es darum geht Möglichkeiten zu erfinden, nicht nur seinem Nächsten das Leben zu nehmen. Doch habe ich überhaupt noch das Recht, derartiges festzustellen?
Sei es drum. Ich finde, unser Geist ist ein Paradoxon. Ein Beispiel. Einerseits sind wir Erdlinge intelligent genug, Atombomben zu bauen und auf der anderen Seite tatsächlich so dumm, das auch zu tun und sie zuletzt sogar auf andere Städte zu werfen, um viele unschuldige Menschen in den Tod zu schicken. Mit einem Anteil von mehreren Prozentpunkten riskieren wir dabei sogar, dass sich die Erdatmosphäre entzündet und unser Globus völlig abbrennt. Jegliches Leben auf unserer Erde würde in sehr kurzer Zeit erlöschen. War und ist es wirklich Gottes Wille, uns mit den kosmischen Kräften herumspielen zu lassen?
Ich bin jedenfalls nicht gläubig. Von daher hätte mich auch das fünfte Gebot nicht aufhalten können, falls ich überhaupt daran gedacht hätte. Sobald ich irgendwann einmal auf der anderen Seite des Himmels ankomme, werde ich wohl erfahren, wer mich zur Rechenschaft ziehen wird. Aber eines kann ich jetzt schon mit Gewissheit sagen. Dort werde ich ganz bestimmt nicht allein vor der großen Tür eines himmlischen Richters oder Richterin stehen und töten kann man mich auch nicht mehr, denn tot bin ich dann ja schon.
Doch was also sollen meine Worte nun bedeuten, warum erzähle ich das alles und was will ich damit sagen?
Ich möchte einfach nur klar machen, womit man es hier zu tun hat. Ich kann es drehen, wie ich will. Ich bin und bleibe ein Mörder. Und das ist es, was man zu diesem Zeitpunkt wissen muss. Allerdings ist meine Geschichte mit all ihren vielschichtigen Hinter- und Abgründen zu komplex, als dass sie dem geneigten Leser oder der ebenso geneigten Leserin mit nur wenigen Worten verständlich gemacht werden könnte. Von daher schreibe ich hier alles auf, was sich in meinem Leben zugetragen hat, denn zuletzt ist es mir einfach egal, wie andere Menschen mein Handeln bewerten. Ich bin meinen Weg, für den ich im Nachhinein und leider viel zu spät doch andere Möglichkeiten als das Töten erkannt hatte, konsequent zu Ende gegangen, habe alles ertragen und hingenommen, was es zu ertragen und hinzunehmen gab.
Nachdenklich stehe ich mit hochgezogenen Schultern und die Hände tief in den Taschen vergraben in meinen längst aus der Mode gekommenen Klamotten mit hochgeschlagenem Kragen des reichlich abgewetzten Gabardinemantels, bei den erstaunlicherweise einmal menschenleeren Landungsbrücken in Hamburg. Das alte Museumsschiff Rickmer Rickmers liegt ein Stück weit links und ich lasse meinen Blick langsam über die Norderelbe schweifen. Ich liebe den Hafen bereits seit meiner frühen Kindheit, den Blick hinüber nach Steinwerder, die Speicherstadt, den Hansakai, den Geruch des trüben Wassers, das gierige Schreien der scheinbar ewig hungrigen Möwen, die alten Schlepper mit ihren beruhigend tuckernden Dieselmotoren, die so vielfältigen anderen Geräusche und den stummen Ruf der weiten Meere, der sich ganz langsam mit dem Nebel geräuschlos die Elbe heraufschleicht. Der Vorhafen wird gerade von den ersten dicken Schwaden eingehüllt. Zusehends dämpft die weiße Pampe, wie wir den kalten Novembernebel als Kinder immer genannt hatten, das seltsame maritime Hafenkonzert, bis zuletzt alles wirkt, als wäre es in Watte gehüllt. Blass sind bald nur noch die Schiffssilhouetten und auch die Krananlagen auf der anderen Elbseite zu erkennen. Nicht nur die gerade noch sichtbaren Positionslichter der letzten vorbeifahrenden, inzwischen menschenleeren Barkassen, sondern auch die vielen Beleuchtungsanlagen auf den Frachtern und den Werften geben dieser sonderbaren Szenerie in der aufkommenden Abenddämmerung etwas gespenstisches.
Mein Blick klebt wie so oft an den Betriebsanlagen von Blohm & Voss und wie immer, wenn ich mich auf meinen langen Spaziergängen an wechselnden Standorten der blauen Stunde hingebe, gehen mir lebhafte Erinnerungen meiner lange zurückliegenden Kindheit und Jugend durch den Kopf.
Auf der Werft hatte ich als junger Bengel zu Arbeiten angefangen und schon damals - wenn ich Zeit dazu hatte - von der anderen Hafenseite nach St. Pauli herüber geschaut. Mag sein, dass es von dort drüben bis zu den Landungsbrücken tatsächlich nur einige hundert Meter sind, doch für mich scheint die Entfernung weitaus größer, denn zwischen meinem damaligen Aussichtspunkt und dem heutigen Standort liegt ein großer Teil meines wirklich ereignisreichen und spannenden Lebens, das neunzehnhundert fünfzig in St. Pauli begann.
Meine Mutter, eine bildhübsche, liebevolle junge Frau und ich bewohnten damals in einer Nebenstraße nahe der Reeperbahn eine kleine zweieinhalb Zimmer Wohnung. Obwohl, ganz richtig ist das nicht, denn einen Vater hatte ich auch. Der fuhr aber zur See und war die meiste Zeit des Jahres irgendwo in der weiten Welt unterwegs. Die wenigen Wochen, in denen er sich gelegentlich zu Hause blicken ließ, habe ich jedoch in denkbar schlechter Erinnerung. Als ich alt genug war, die ersten Fragen zu stellen und ständig wissen wollte, wo Vaters Schiff gerade die Meere befuhr, saßen Mama und ich an unserem runden Tisch in der Mitte des kleinen und mit viel Liebe eingerichteten Wohnzimmers. Wir zwei lehnten lange und innig schwatzend über einem dicken Atlas und ich lauschte mit gespitzten Ohren dem warmen Singsang, den wunderbaren, geradezu bildhaften Beschreibungen meiner Mutter. Damals heizten wir noch mit Kohle und ich genoss in den dunklen Wintermonaten die wohlige Atmosphäre in unserem äußerst sauberen, gemütlichen Kleinod. Des Abends, wenn ich zu Bett gebracht wurde, las mir Mama nur allzu gern Gedichte von Joachim Ringelnatz vor, die ich so früh in meinem Leben noch nicht recht verstand. Da sie aber meiner Mutter zu gefallen schienen, mochte ich die Reime natürlich auch. Ich erinnere mich noch gut, dass in dem Buch in einem bestimmten Gedichtzyklus die Rede von einem ziemlich abstrusen und chaotischen Seemann namens Kuddel Daddeldu war, über den sich Mama immer wieder köstlich amüsierte. Ich glaube, dass ich ihr eine große Freude machte, als ich unseren kleinen Kater, den sie mir einmal aus dem Tierheim mitgebracht hatte, ganz einfach Kuddel nannte. Dieser kleine graue Räuber unterstützte unsere familiäre Stille nach Kräften, in dem er praktisch erst einmal nichts tat, wohl aber die Wohnung kurzerhand nach seinem Einzug zu der Seinen machte. Den ganzen Tag über schlief er an den unmöglichsten Plätzen, beispielsweise auf dem kleinen Regal über dem Küchenherd, bequem seine Augen schloss, Ruhe und tiefe Ausgeglichenheit versprühte dabei seine Ohren jedoch immer auf Hab-Acht-Stellung hielt. Was dieser schnurrende Halunke allerdings des nachts, wenn er durch die dunklen Hinterhöfe von St. Pauli schlich anstellte, habe ich trotz aller Neugier nie herausbekommen. Es war mir einfach unmöglich, ihm zu folgen. Versucht hatte ich es später schon, aber der Kerl bemerkte mich immer und jedes Mal schüttelte er mich gekonnt ab.
Ich lernte also zeitig sehr viel über Geografie und so für viele Monate auf uns allein gestellt, wuchs über die Jahre ein äußerst enges Band zwischen Mutter und Sohn.
Irgendwann aber kam der Alte nach Hause. Wie aus dem Nichts öffnete sich ohne Vorankündigung mit mächtigem Krachen die Tür. In langem Mantel und seinen Südwester auf dem Kopf, schob er eine Woge derben Geruchs aus Dieselöl und ordentlich Fusel durch die Tür. Breitbeinig stand er da, sagte zunächst keinen Ton und musterte uns grimmig. Ein mürrisch missmutiger Blick und dann kam auch schon der erste Vorwurf in noch etwas verhaltenem Ton.
»Werde ich nicht mal im Hafen von meiner Familie abgeholt?«
»Aber wir wussten überhaupt nicht, dass Du heute kommst«, antwortete meine Mutter, in dem sie erschrocken aufstand und - als hätte man in ihr einen Hebel umgelegt - in der Speisekammer herumzukramen begann, um sogleich verschiedene Nahrungsmittel auf dem Tisch auszubreiten und meinen Vater zu bedienen.
Ihr warmherziges Wesen verschwand unversehens hinter einer fremdartigen Fassade, was mich auf der Stelle ängstlich werden ließ.
»Habe ich doch aber gesagt, als ich abfuhr!«
»Dann tut es mir leid. Das muss ich überhört oder vergessen haben«, war die schuldbewusste Antwort.
Es bedarf keiner besonderen Erklärung, dass mein Vater in Wahrheit nie etwas von Abfahrt oder Wiederkehr erzählt hatte. Das tat er nämlich nie. Er kam und verschwand, wie es ihm gefiel. Nicht nur, wenn er auf große Fahrt ging, sondern auch während seiner Anwesenheit in unserer für drei Leute viel zu kleinen Wohnung.
»Was ist das denn für einer«, raunte Vater, als er das erste Mal den kleinen Kater bemerkte.
»Das ist Kuddel. Mein neuer Freund«, meldete ich mich energisch zu Wort.
»Von Wegen. Dem ziehe ich Sonntag das Fell ab und dann kommt er in den Backofen!«
Die Worte blieben mir im Hals stecken und hilflos blickte ich meine Mutter flehend an.
»Mach Dir keine Sorgen, mein großer. Das sind nur Papas Seemannsscherze«, gab sie mir zur Antwort und strich beruhigend über meinen Kopf.
»Beim Klabautermann. Du musst mal mit mir zu den Indianern kommen. Die essen sogar ihre Hunde«, frotzelte der Alte und machte mir weiter Angst.
Bald quasselte er – angetrunken wie er war – von ganz anderen Dingen und ich war froh, dass er die Katze aus dem Visier verloren zu haben schien. Mutter versorgte ihn mit warmem Essen, dann verlangte er nach Schnaps und Bier und zuletzt wurde ich ziemlich barsch angefahren, sofort unter Deck und in die Koje zu gehen, was ich auch ziemlich verängstigt tat. Kuddel folgte mir auf leisen Sohlen und in meiner kleinen Kammer verbargen wir uns unter meinem Bettzeug, ohne uns zu rühren. An diesem Tag war es nichts mit verrückten Geschichten aus Mutters Ringelnatzbuch von diesen seltsamen Hochseekühen, die sich unter Wasser mit ihren Hufen melken konnten und Schnurrbarthaaren, die irgendwo am Kattegat im Meer herumschwammen. Während des ganzen Abends pöbelte Vater, inzwischen vermutlich stark betrunken, wiederholt und lautstark mit ziemlich schlimmen Worten und irgendwann zu vorgerückter Stunde wurde es endlich still in der Wohnung. Ich meinte, später noch seltsame, schwer zu beschreibende Geräusche aus dem Zimmer meiner Eltern gehört zu haben, schlief aber sehr bald ein und träumte schlecht.
Meine sonst so schönen Jungenträume von den Abenteuern der großen weiten Welt, die auf mich warteten, verschwanden in den Tagen der Anwesenheit meines Vaters in pechschwarzem Nichts. Die Angst um meine Mutter und Kuddel beherrschte mich, bestimmte meine immer wüster werdenden Träume und führte zuletzt zu schweren Gewaltausbrüchen eines schwarzen Titanen aus der Unterwelt, den ich den Mann im Schatten nannte, der von einem anhaltenden bösen, dröhnenden Echo begleitet wurde. Dieses Wesen hatte keinen Namen und auch kein Gesicht. Es war immer nur schemenhaft zu erkennen und hielt sich ausschließlich im Halblicht auf.
Auch wenn ich im Schlaf als Retter der Welt und schwer bewaffneter, großer Kämpfer unterwegs war, war dieses Unwesen nie zu fassen, nicht zu besiegen und das Echo nicht zu lokalisieren. Genau das machte mich stutzig und verfolgte mich oftmals auch nach dem Aufwachen noch.
Durch diese Träume aufgewühlt, fand ich nie richtig zur Ruhe, war ständig unausgeschlafen, missgelaunt und passte auch in der Schule überhaupt nicht mehr auf. Das änderte sich in dieser Phase meines Lebens immer erst dann, wenn mein Vater wieder die Anker lichtete und für unbestimmte Zeit auf See verschwand.
Bald erholte ich mich und war schnell wieder der kleine Junge, der ich sein wollte. Meine Mutter erklärte mir später, wie unsere Träume entstehen und was sie bedeuten. Ich erfuhr etwas von meinem Unterbewusstsein, dass unsere Erlebnisse des Tages im Schlaf verarbeitet und dass ich in dem Schattenmann mit seinem undefinierbaren Echo eine Projektion meines Vaters erlebe.
»Du musst aber keine Angst haben. Das sind alles nur Träume. Die tauchen auf und verschwinden auch wieder.«
Am Morgen drauf wirkte meine Mutter fremdartig, geradezu wie ausgewechselt und sehr verstört. Das machte mir zusätzlich Angst. Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt noch keinen Reim darauf machen können, was mein Vater während der Nacht alles mit ihr angestellt hatte, aber etwas Gutes war es offensichtlich nicht gewesen. Was sich im elterlichen Schlafzimmer regelmäßig abgespielt hatte, erfuhr ich erst einige Jahre später. Um so weniger konnte ich es mir dann erklären, warum Mutter ihn nicht einfach verlassen hatte. Gefragt habe ich sie aber nie.
Als ich noch ein kleiner Kerl war, traute sich der Alte nicht, mich zu schlagen. Sehr viel größer aber war ich auch nicht, als ich die erste Ohrfeige bekam. Was ich falsches gesagt oder getan hatte, weiß ich heute nicht mehr. Es war ganz sicher nur eine Nichtigkeit, denn einen gravierenden Anlass benötigte Vater nie, um aus der Haut zu fahren. Erinnerlich ist mir aber, dass Mutter sich schützend vor mich stellte und aus diesem Grund gleich mit geohrfeigt wurde. Anschließend krachte die Wohnungstür zu und mein Vater versackte für einige Zeit auf dem Kiez. Er soff ohne Ende, schlief bei Nutten, prügelte sich mit Zuhältern und verschwand eines Tages ohne ein Wort, ließ aber - und wenigstens das kann man zu seiner Ehrenrettung anführen - einen recht ordentlichen Batzen seiner Heuer zurück, sodass wir weder Hunger leiden noch frieren mussten.
Wenn er sich mal mit seinem Sohn beschäftigte, war er in diesen Jahren eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann nahm er mich wie ein guter Vater an die Hand, wir ging in den Hafen, er zeigte und erklärte mir alle Schiffe, fütterte mich mit reichlich Krabbenbrötchen und zuletzt waren wir auf einer Barkasse für ungefähr zwei Stunden quer durch den Hafen unterwegs.
Später spannte er mich häufig in seine undurchsichtigen Unternehmungen ein. Meine Penne hielt er ohnehin für Unsinn, sodass ich in diesen Tagen eine Menge Unterricht versäumte.
»Aber der Junge muss doch etwas lernen, damit aus ihm einmal etwas werden kann«, gab Mutter klagend und besorgt zu verstehen.
Sie wusste nur zu genau, dass ihr Veto nichts half. Was sie sagte, wollte Vater überhaupt nicht hören.
»Was der Junge fürs Leben braucht, bringe ich ihm schon bei«, polterte er laut vor sich hin, in dem er mich bei der Hand nahm und wir die Wohnung verließen.
In den folgenden Tagen lernte ich auf der Reeperbahn und ihren fragwürdigen Nebenstraßen viele düstere Typen kennen und war mir sicher, dass sie durchweg auf der Davidswache, dem Polizeirevier auf der Reeperbahn, einschlägig bekannt waren. Vater verkaufte ihnen in den dunkelsten Ecken irgendwelche kleine Tüten, hatte am Ende des Tages ein paar dicke Rollen Geldscheine in der Tasche, zeigte mir, wie man Leute beim Bezahlen übers Ohr haute und woran er Betrüger schon auf den ersten Blick von weitem erkannte. Für den Moment fand ich das sehr spannend, machte mir aber wegen der versäumten Schultage ernsthafte Sorgen hinsichtlich der nächsten Klassenarbeiten. Trotzdem. So einiges, was mir der Alte beibrachte, half mir in meinem späteren Leben tatsächlich weiter.
Als er irgendwann wieder auf See war, kehrte die warmherzige Vertrautheit zwischen Mutter und Sohn nicht sofort zurück. Erst Tage später, nachdem sich die Angst gelegt hatte und die Wut über den Budenzauber in den Hintergrund getreten war, breitete sich wieder das liebevolle Miteinander in unserer Wohnung aus. Wir lebten für die folgenden Monate eine sehr glückliche und freie Zwei- beziehungsweise Dreisamkeit, denn auch Kuddel gab wieder Lebenszeichen von sich.
Der erste eigene und sehr schmerzhafte Kontakt mit der väterlichen Gewalttätigkeit allerdings hatte sich viel zu früh und unauslöschlich in meiner kleinen Seele eingenistet.
Das verrucht sündige Leben der Reeperbahn war auch für uns Kinder vom Kiez damals allgegenwärtig und so spielte ich mit meinen Freunden anfangs auf den Hinterhöfen zumeist Fußball. Natürlich HSV gegen Bayern München, wobei die Hamburger immer haushoch gewannen. Da wir allein noch nicht bis zum Hafen durften, trieben wir uns häufig bei den Damen auf der Reeperbahn herum, obwohl uns auch das untersagt war. Doch was machen kleine Jungs am liebsten? Genau. Was man ihnen verboten hat! Und das war unglaublich interessant, denn dort sahen wir Frauen aus allen Herrenländern. Als ich das erste Mal eine mit ganz dunkler Haut sah, blieb ich zunächst erschrocken stehen. Da sie mir aber freundlich lächelnd zuwinkte, sich sogleich zu mir herabbeugte, etwas in einer für meine Kinderohren ganz komischen Sprache zuflüsterte und mir dabei ein leckeres Bonbon zusteckte, fand ich sie recht nett. Ich hatte also auf spielerische Weise gelernt, dass die Menschen sehr unterschiedlich aussehen können, aber aus diesem Grund keineswegs anders oder schlecht waren. Meine unbewusst erste Lehrstunde in Sachen Toleranz und Weltoffenheit. Mag man vielleicht zu Recht behaupten, dass Kinder nicht in solch einer Gegend aufwachsen sollten. Es hatte aber durchaus auch sein Gutes, wie ich finde. Außerdem war es, wie es war. Wir wurden in dieser Umgebung groß. Warum viele der Damen zu allen Tageszeiten auf der Straße herumstanden, konnten wir uns damals jedoch nicht recht erklären. Auch unsere Eltern ließen unsere neugierig bohrenden Fragen unbeantwortet und halfen uns da kein Stück weiter. Das machte aber nichts, denn nett waren sie eigentlich alle. Ganz oft durften wir bei denen, die in der Herbertstraße in Wohnungen hinter großen Fenstern saßen, eintreten, bekamen eine Tasse Schokolade und anschließend so manches liebe Wort mit auf den Weg. Zu Beginn war ich sehr erstaunt, dass sie fast überhaupt keine richtige Kleidung trugen und hatte mich mit meinem Freund Fietje darüber unterhalten.
»Kannst Du Dir das erklären?«
»Klar. Da drinnen ist es ganz einfach viel zu warm. Merkst Du ja, wenn wir bei Tante Eva Kakao trinken. Diese Hitze ist doch mit Rock und Schürze kaum zu ertragen!«
»Ach so. Das kann schon sein. Ob die nicht arbeiten müssen?«
»Warum sollten sie?«
»Na, die sitzen doch nur den ganzen Tag herum und rauchen Zigaretten!«
»Ich denke, die haben einen Mann, der arbeitet und die passen auf die Wohnung auf. Vielleicht sind dafür die großen Fenster. Damit sie auch alles sehen können. Aber genau weiß ich das auch nicht. Hauptsache, wir kommen auf unsere Kosten und bekommen ein paar Kekse!«
»Das mit dem Aufpassen könnte stimmen, denn da gingen ja viele Männer die Straße entlang und schauten ziemlich interessiert in die Fenster. Verdächtig ist das schon!«
In dem Fietje weiterging, blieb ich noch einen Moment stehen, beobachtete die Szenerie auf der Herbertstraße prüfend und machte mich dann ebenfalls auf.
»Wir haben zu Hause kleine Fenster!«, war mein letztes Wort zu diesem Thema und schon rannten wir wieder davon.
Als ich sechs Jahre alt war, begann meine Schulzeit. Zu Ostern wurde ich in der Katholischen Schule Altona eingeschult und hatte anfangs großen Spaß am Lernen. Die Schule liegt in einem Stadtteil, der schon damals von erheblicher Jugendkriminalität geprägt war. Man hat sich zwar immer redlich darum bemüht, die Kinder katholisch-christlich zu erziehen und sie an die Kirche in der Gemeinde heranzuführen, doch waren die Zeiten damals auch für uns Kinder nicht sehr einfach. Waren die ersten Jahre noch spannend und ich ein wirklich guter Schüler, änderte sich unser Auftreten, als wir etwa die sechste Klasse besuchten. Es war geradezu unausweichlich, dass auch ich in erste Streitereien und Prügeleien hineingezogen wurde und mir zum Kummer meiner Mutter, die mich zu einem anständigen Jungen erziehen wollte, so manchen Verweis einhandelte. Wie alle wurde auch ich gerade in dieser Zeit von meiner Umgebung, von meinen Mitschülern beeinflusst und geprägt. Wir hatten die gleichen Interessen, ärgerten uns bald über die Lehrer, den ganzen Schulbetrieb, den trockenen Unterricht und kämpften mit unserer pubertären Gedanken- und unserer noch reichlich naiven Empfindungswelt. Von daher waren wir Leidensgenossen, schlossen enge Freundschaften, hatten aber auch dieselben Feinde. Auf dem Schulhof war der positive mütterliche Einfluss praktisch nicht mehr existent. Ich hätte vieles besser wissen, kritischer hinterfragen können und müssen. Das war von Anfang an ein wichtiges Anliegen meiner Mutter, doch hier galt der kollektive Gruppenzwang. Zusammenstehen, einer für alle und alle für einen.
Alles begann, als ich eines Tages in einer Pause auf unserem Schulhof sah, wie mein Freund Fietje von einem kräftigen Jungen, der bereits die achte Klasse besuchte, ins Gesicht geschlagen wurde. Ich wusste nicht, aus welchem Grund, doch das war für mich auch bedeutungslos. Mein Beschützerinstinkt hatte sich schon in der Vergangenheit gemeldet, wenn mein Vater mal wieder zu Hause aufgekreuzt und nicht sehr zimperlich mit meiner Mutter umgegangen war. Damals hatte ich aber keine Chance, den Helden zu spielen. Der Alte war viel zu stark. In der Schule war das anders. Ich war größer und mutiger geworden, auch wenn mir der prügelnde Blödmann offensichtlich überlegen war. Wutendbrand rannte ich auf ihn zu und drosch ihm unversehens meine Faust ins Gesicht.
»Lass meinen Freund in Ruhe, Du dämlicher Affe«, schrie ich ihm entgegen.
Er war aber nur für einen Moment überrascht, hielt sich kurz nach meinem rechten Haken das linke Auge, das ich gut getroffen hatte und verprügelte mich nach Strich und Faden. Das Theater beim Schulrektor ließ ich später über mich ergehen, ergab mich meinen körperlichen Schmerzen, nahm die Strafarbeiten entgegen und ging mittags mit Fietje nach Hause.
»Das fand ich toll, dass Du mir geholfen hast«, sagte er, als wir unseren Heimweg über die Reeperbahn einschlugen.
»Tut es dolle weh?«, wollte er dann wissen.
»Ja. Das zwirbelt ganz schön. Die Rippen haben auch richtig was abbekommen!«
»Kann ich denn etwas für Dich tun?«
»Neee. Das wird schon vergehen!«
»Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut gehabt hätte«, sagte Fietje nach einer kleinen Pause.
»Schiss hatte ich auch vor dem riesigen Kerl, aber soll ich tatenlos zusehen, wenn mein bester Freund verprügelt wird. Nein. Das wäre schlimmer, als die Schmerzen«, antwortete ich und war mir sicher, dass sich mein Vater vor lauter Stolz ob meines rechten Hakens und den großen Mut, einen mir deutlich überlegenen Gegner angegriffen zu haben, über seinen Sohn erst mal ordentlich besoffen hätte.
»Mein lieber Junge. Ich habe immer gehofft, dass Du nicht so bist, aber es scheint, als hättest Du doch eine Menge von Deinem Vater geerbt. Wenn Du so weiter machst, kommst Du bestimmt einmal auf die schiefe Bahn«, mahnte mich Mutter eindringlich, als ich nach Hause kam und ihr den Vorfall schilderte.
»Aber was hätte ich denn tun sollen?«
»Nachdenken. So, wie ich es Dir beigebracht habe!«
»Wie soll man in dem Moment noch überlegen. Das ging viel zu schnell!«
»Ihr hättet den Jungen später bei der Schulleitung melden können!«
»Das hätte Fietje auch nicht geholfen«, war meine Antwort.
Ich blieb schweigend bei meiner inneren Überzeugung, alles richtig gemacht zu haben. Meine Erklärungsversuche, dass ich doch nur meinem Freund helfen wollte und musste, ließ Mutter nicht gelten.
»Gewalt ist einfach kein Weg. Es gibt immer eine andere Möglichkeit«, stutzte sie mich in einem Ton zurecht, den ich bei ihr noch nie gehört hatte.
Was mich allerdings anhaltend nachdenklich stimmte, war ihr Vergleich mit meinem Vater und dass ich viel von ihm in mir trug. Das durfte einfach nicht sein. Ich wollte niemals so ein schlechter und rabiater Mensch werden, der jedem an die Gurgel ging, der ihm quer kam oder ihm einfach nur nicht passte.
Trotzdem hatten diese Schulhofhauerei und Mutters mahnende Worte doch erheblichen Einfluss auf mein künftiges Leben, wie später noch zu lesen sein wird. Häufig dachte ich später darüber nach, wie sehr ich meines Vaters Art ablehnte und wie ungern ich in seine Fußstapfen treten wollte. Klar. Es gab später noch weitere Prügeleien nicht nur in der Schule. Allerdings habe ich mich immer nur daran beteiligt, wenn jemand Hilfe brauchte, unterlegen war oder zu Unrecht angegriffen wurde. Sobald einer aus anderen Gründen Streit mit mir suchte, beherzigte ich Mutters Worte, drehte mich ab und ließ mich auch Feigling oder sonst wie nennen. Anfangs belasteten mich diese Beschimpfungen, doch lernte ich, damit umzugehen und gelangte zu der Erkenntnis, dass ich glücklicherweise auch sehr viel von meiner Mutter mitbekommen hatte.