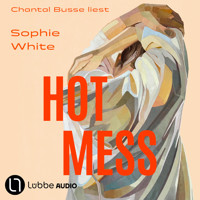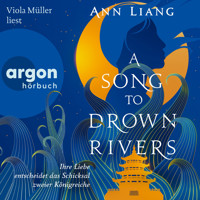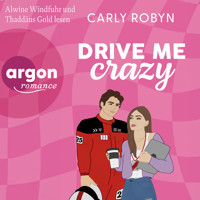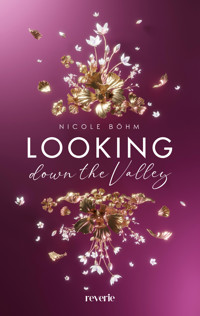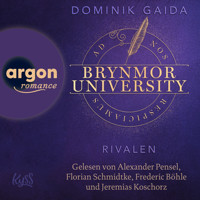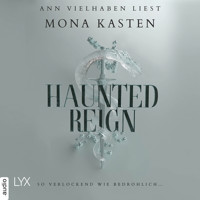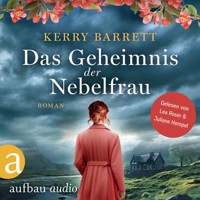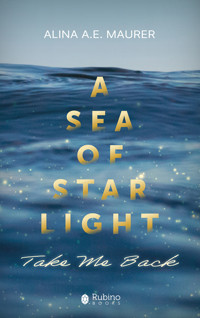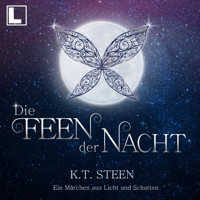Das erste Königspaar von Rumänien Carol I. und Elisabeta E-Book
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva Fürstlich Wiedisches Archiv
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Blickt man auf die Regentschaft des ersten rumänischen Königspaars zurück, so kann Carol I. (1866-1881 Fürst, 1881-1914 König von Rumänien) und Elisabeth/Elisabeta (1869-1881 Fürstin, 1881-1914 Königin von Rumänien) durchaus ein erfolgreiches Wirken bescheinigt werden. Ihnen war es zu einem Großteil zu verdanken, dass sich Rumänien bis 1914 zu einem politisch relativ stabilen und angesehenen Land in Südosteuropa und allgemein in Europa entwickelt hatte. Das bedeutete allerdings nicht, dass die Herrschaft von Carol I., dessen Regierungsantritt 1866 eher einem Überraschungscoup glich und gegen den Willen der meisten Großmächte erfolgte, ohne Krisen verlaufen wäre - so stand Carol I. beispielsweise 1871 kurz vor dem völligen Scheitern. Die Überwindung dieser Krise durch die Klärung politischer Zuständigkeiten und seine Heirat mit Elisabeth zu Wied im November 1869 bildeten die Voraussetzungen dafür, dass Carol I. überhaupt mit einer Dynastiegründung beginnen konnte, deren Legitimierung sich auch in Repräsentations- und Symbolformen niederschlug, die Bezug nahmen auf die rumänische Gesellschaft mit ihren kulturell und religiös tradierten Vorstellungen hinsichtlich der fürstlichen Macht. Der vorliegende Band macht die Anforderungen und Probleme der rumänischen Monarchie und ihre Integrationsleistung in der rumänischen Gesellschaft sichtbar, wobei insbesondere die repräsentativ-symbolische Ebene mit ihrer legitimatorischen Funktion unter Einbeziehung des Selbstverständnisses des Herrscherpaars analysiert wird. Die Mehrzahl der Beiträge stammt von rumänischen Forscherinnen und Forschern, die wichtige Ergebnisse zur Einordnung der rumänischen Monarchie beisteuern und somit auch einen Überblick über die in Rumänien geleistete Forschungsarbeit geben. Die Herausgeberinnen messen diesem Aspekt einen wichtigen Stellenwert bei, da sie die rumänische Forschung einem deutschen Publikum zugänglich machen und zu einem bilateralen Wissenschaftsaustausch beitragen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Repräsentations- und SymbolformenvonHerrschaftsausübungbeiCarol I. und Elisabeta von Rumänien (Einleitung)
Blicktman am Ende der Herrschaftszeit des ersten rumänischen Königspaars im Jahr 1914 auf sein Werk zurück, so kann Carol I. (1866-1881 Fürst, 1881-1914 König von Rumänien) und Elisabeth/Elisabeta (1869-1881 Fürstin, 1881-1914 Königin von Rumänien) durchaus ein erfolgreiches Wirken bescheinigt werden,war es ihnen doch zu einem großen Teil zu verdanken, dass sich Rumänienzu einem politisch relativ stabilen und angesehenen Land in Südosteuropa und allgemein in Europaentwickelt hatte. Vergleicht man die benachbarten Länder mit einer ausländischen Dynastie, so fällt die rumänische Bilanz noch positiver aus. Allein in Rumänien gab es keinen Dynastiewechsel: in Griechenland scheiterten zuerst die Wittelsbacher, in Bulgarien Alexander von Battenberg, bevor mit Georg I. aus dem HauseSchleswig-Holstein-Glücksburg, einer Nebenlinie des dänischen Königshauses,in Griechenland und mit Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha-Koháry in Bulgarien die jeweilige Dynastie sich durchsetzen konnte. Das bedeutete allerdings nicht, dass die Herrschaft von Carol I., dessen Regierungsantritt 1866 eher einem Überraschungscoup glich und gegen den Willen der meisten Großmächte erfolgte, ohne Krisen verlief, wobei Carol I. 1871 ebenfalls kurz vor dem Scheitern stand. Die Berufung ausländischer Fürsten auf die Throne der sich neu konstituierenden Staaten Südosteuropas–mit Ausnahme von Serbien und Montenegro – brachte demnach für beide Seiten: das Land und den Monarchen, ein hohes Risiko des Scheiterns mit sich. Dabei waren ausländische Dynastien in Europa weit verbreitet und bedeuteten kein besonderes Phänomen, doch im Fall Südosteuropa fielen Staats- und Nationsbildung mit der Errichtung neuer Institutionen zusammen, die über keine Traditions- oder Loyalitätsbindungen verfügten. Man griff daher auf das normative Regelwerk einer verfassungslegitimierten Ordnung zurück, auf deren Basis der neue oder neuformierte Staat organisiert wurde. Damit wurden Umfang, Funktionen und Arbeitsweise politischer Institutionen definiert, wobei man sich an dem westeuropäischen Vorbild einer konstitutionellen Monarchie orientierte. Diese hatte sich Mitte des 19. Jahrhunderts in den Monarchien Europas, abgesehen von Russland und dem Osmanischen Reich, als Regierungs- und Herrschaftsform durchgesetzt. Damit einhergegangen war ein Strukturwandel der Monarchie, bei dem es nach inneren Konflikten über die Austarierung von Machtansprüchen zwischen Krone (Exekutive und Legislative) und Parlament (Legislative) in vielen Fällen zu einer Machtverlagerung kam, die dem Monarchen zwar wichtige Mitspracherechte weiterhin einräumte, wo aber seine Herrschaftsausübung auf einer symbolisch-repräsentativen Ebene immer wichtiger wurde, um die nationale Einheit und Unabhängigkeit zuverkörpern.[1]Auch im Fall Rumänien konnte sich Carol I. erst nach der schweren Staatskrise 1870/71 etablieren, nachdem er politische Verantwortung an die Eliten abgegeben hatte und als Integrationsfaktor mit einer neutralen Vermittler- und Schiedsrichterfunktion die politische Stabilisierung des Landes ermöglichte.[2]
Die Überwindung dieser Krise mit der Klärung politischer Zuständigkeiten undVerantwortlichkeiten der Staatsorgane und seine Heirat mit Elisabeth von Wied im November 1869 bildeten die Voraussetzungen, dass Carol I. überhaupt mit einer Dynastiegründung beginnen konnte, deren Legitimierung sich auch in Repräsentations- und Symbolformen niederschlug, die Bezug nahmen auf die rumänische Gesellschaft mit ihren kulturell und religiös tradierten Vorstellungen hinsichtlich der fürstlichen Macht. Diese Symbolkonfiguration von Herrschaft stellte einen weiteren, wichtigen Aspekt der Integration der neuen Dynastie in die rumänische Gesellschaft dar, die von beiden Seiten, sowohl dem Monarchen als auch vom Land erfolgen musste. Hier zeigte sich eine gewisse Ambivalenz. Einerseits fehlte dem neuen Fürsten eine traditional-dynastische Verbindung und Loyalität im Land, auf die die meisten Monarchen in Europa zurückgreifen konnten, zum andern war die Institution des Fürsten als solche in den rumänischen Fürstentümern erhalten geblieben, stellte also keine Neuerung dar, diesmal im Unterschied zu den südosteuropäischen Nachbarländern, deren Selbständigkeit im Zuge der osmanischen Eroberung seit dem Mittelalter verloren gegangen war. Allerdings hatte sich gerade der rumänische Fürstenthron als Quelle ständiger Instabilität durch Einflussnahme auswärtiger Mächte, vor allem Russlands und natürlich auch der Pforte als Suzeränitätsmacht, und die Intrigen der Großbojaren erwiesen, was eine akzeptierte Nachfolgeordnung seit dem Ende der Fanariotenzeit 1821 immer wieder verhinderte. Durch eine ausländische Erbmonarchie sollte eine innen- und außenpolitische Sicherung des Staates erreicht werden, deren Ziel auch in der vollständigen Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich bestand, das 1877/78 erreicht wurde.
Als Fürst konnte sich Carol I. demnach auf die traditionelle Akzeptanz des Fürstenamts berufen, die zusätzlich durch ein Plebiszit verstärkt wurde, das ihm eine nationale Legitimation verlieh. Doch er selbst musste den Thron mit seiner Person und Dynastie verbinden und in Politik und Gesellschaft verankern. Auch hierin gab es zwei Aspekte. Auf der einen Seite galt er zusammen mit der neuen Verfassungsordnung von 1866 als Repräsentant eines aufstrebenden Staates, der sich der (west)europäischen Entwicklung mit seinen Institutionen anschloss und als gleichberechtigt anerkannt werden wollte, zum andern musste sich der Fürst mit seiner Dynastie in eine als national bewertete rumänische Tradition integrieren, was sich vor allem auf einer symbolischen und repräsentativen Ebene vollzog. Auf dieser Ebene musste eine Traditionslinie befolgt werden, die sich historisch auf die Kontinuität anerkannter nationaler Topoi (zum Beispiel römisch-lateinischer Ursprung, Selbstständigkeit der Fürstentümer) und Persönlichkeiten (Stefan der Große, Michael der Tapfere) berief, ebenso die religiöse Dimension der Orthodoxie berücksichtigte, andererseits musste aber auch das Neue der Herrschafthervorgehoben, der Bruch mit demals rückständig und kulturell negativ eingestuften orientalisch-osmanischenErbevollzogen werden, um die moderne, europäische Dimension einer Monarchie mit ihren zeitgemäßenRepräsentationsformen sichtbar zu machen.[3]
Diese Anforderungen und Probleme der rumänischen Monarchie machen die Beiträge des vorliegenden Bandes sichtbar, der die Integrationsleistung der Monarchie in die rumänische Gesellschaft aus einer multiperspektivischen Sichtweise zum Thema hat. Dabei geht es besonders um die repräsentativ-symbolische Ebene mit ihrer legitimatorischen Funktion, wobei das Selbstverständnis des Herrscherpaares mit einbezogen wird. Gleich im ersten Beitrag von Ruxanda Beldiman wird dieser Aspekt bei der Sommerresidenz Schloss Pelesch untersucht, dereine besondere Bedeutung zukam, da sieals Wiege der rumänischen Dynastie konzipiert wurde, wie Beldiman zu Beginn feststellt. Anhand von drei Zeremonien der Grundsteinlegung, des Richtfestes und der offiziellen Einweihung des Schlosses arbeitet sie die symbolischen Bedeutungen heraus, die sich mit diesem Bau für den Fürsten/König und das Land verbanden. Obwohl aus Privatmitteln von Carol I. erbaut, besaß das Schloss eine wichtige öffentliche politische wie repräsentative Funktion nach innen wie nach außen, was sich in seinem Architekturprogramm widerspiegelte. Beldiman kann daran auch die architektonische Hybridität des Schlosses aufzeigen, wo sich verschiedene deutsche und rumänische Elemente und Symbole vermischten, die auf die Persönlichkeit des Königs mit dem Stolz auf seine Vorfahren und auf sein politisches Programm in Rumänien verweisen.
In eine ähnliche Richtung bewegt sich auch der zweite Beitrag von Macrina Oproiu, die detailliert auf das umfangreiche Bild- und Figurenprogramm und seine Symbolik im Schloss Pelesch eingeht. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den sakralen Elementen, die in verschiedenen Objekten und Architekturbestandteilen zu finden sind. Dass Herrschaft immer auchmit dem Numinosen verbunden ist, läßt sich demnach auch im Schloss Pelesch und im Verständnis seines Bauherrn wiederfinden. Dieser sakrale Aspekt tritt in dem Aufsatz von Carmen Tănăsoiu noch stärker in den Vordergrund, in dem es um das Herrscherbild desFürstenpaars in kirchlichen und weltlichen Darstellungen geht. In diesem Fall konnte sich das königliche Paar in die Tradition von Votivbildernrumänischer Fürsten in Kirchen stellen, die die enge Verbindung der orthodoxen Religion mit der weltlichen Macht aufzeigten. Die Beachtung der religiösen Bräuche und Rituale der orthodoxen Staatskirche war für den gläubigen Katholiken Carol von Anfang an Bestandteil seiner Herrschaftspraxis, während sein großes Interesse für die Restaurierung kirchlicher Baudenkmäler sich mit der Stifterpraxis der mittelalterlichen Fürsten vergleichen ließ. Einen herausragenden Platz nahm dabei die berühmte Klosterkirche von Curtea de Argeşein, auf deren Restaurierungsarbeiten Tănăsoiu im Detail eingeht, da diese Kirche als Grablegungsstätte der rumänischen Könige vorgesehen war und daher ein besonderes Symbol einer dynastischen Erinnerungskultur darstellte. Die Art der Darstellungen sagt viel über das Selbstverständnis der eigenen Rolle des Königspaars aus, wobei sich auch hier verschiedene Stile und Kulturauffassungen westeuropäischer deutscher und rumänischer Provenienz vermischten.
Während bei der symbolisch-repräsentativen Verkörperung des Königtums im öffentlichen Raum vor allem die Vorstellungen des Königs zum Tragen kamen, steht in den folgenden zwei Beiträgen die Rolle von Königin Elisabeth im Vordergrund. Wenn allgemein der Einfluss der Königin auf die Tagespolitik als gering eingeschätzt wird, bedeutet das nicht, dass sie keine klaren politischen Ansichten und Vorstellungen besaß und diese auch vertreten konnte. Aufgrund ihrer Kinderlosigkeit nach dem Tod der Tochter Maria 1874 befand sich Elisabeth in einer schwierigen Lage, da sie ihre Hauptaufgabe, die Sicherung der Dynastie, nicht erfüllen konnte. Sie suchte daher nach anderen Wegen, die Dynastie zu unterstützen, was sich besonders in ihrem literarischen Werk und karitativen Engagement niederschlug.[4]Silvia Irina Zimmermann analysiert in ihrem Artikel das Bild des Königs, das Elisabeth in ihren Werken von ihm zeichnet. Die dargestellten positiven Eigenschaften als siegreicher Feldherr, Bauherr, weiser König und als Lebenspartner sieht die Autorin als prodynastischen Beitrag der Königin mit legitimatorischem Charakter, da König Carol mit seinem unermüdlichen Wirken für das Wohl des Landes als idealerHerrscherfür die Rumänen vermittelt wird.In diesem Zusammenhang geht die Autorin auch der in der Sekundärliteratur häufig anzutreffenden Behauptung einer republikanischen Einstellung von Königin Elisabeth nach, die aber, wie Zimmermann mit Textbelegen nachweisen kann, oft auf einer mangelnden Kontextualisierung und ungenauen bibliographischen Angaben beruht.
Währendsichdie literarischen Werke Elisabeths an die Öffentlichkeitrichteten, um Rumänien und sein Herrscherpaar publikumswirksam bekannt zu machen, stehen in dem Beitrag von Sorin Cristescu zwei lange Privatbriefe von Elisabeth an ihren Mann aus dem Jahre 1891 im Mittelpunkt. Eingebettet in eine generelle Erörterung über die Bedeutung der Privatkorrespondenz des Königspaars für das Verständnis der rumänischen Geschichte während dieses Zeitraums, geben diese Briefe von Elisabeth interessante Aufschlüsse über ihre Vorstellungen und Gedanken hinsichtlich der Zukunft der Dynastie.Geschrieben in einer schweren Lebenskrise, ausgelöst durch das Scheitern ihrer Pläne einer Verheiratung des Thronfolgers Ferdinand, des Neffen von Carol I., mit einer ihrerLieblingshoffräuleins, Elena Văcărescu, offenbaren sie, wie gefährdet Elisabeth die Dynastie in Rumänien hielt und dabei ihre eigenen Ängste auf diese übertrug. Es handelt sich um Schlüsseltexte hinsichtlich ihrer eigenen Stellung, ihrer Ansichten von Moral und Politik, wobei sie gehofft hatte, durch eine von ihr eingefädelte Heirat mit einer einheimischen Bojarentochter die Dynastie zu stärken und damit auch ihr eigenes Ansehenzu hebenund ihren Einfluss zu sichern. In dieser, von Elisabeth ausgelösten sogenanntenVăcărescu-Affäre verbanden sich eine tiefe persönliche Krise, eine Ehekrise, eine dynastische und eine politische Krise, die zu ihrem dreijährigen Exil aus Rumänien führte und die dann durch die beschleunigte und standesgemäße Heirat des Thronfolgers mitder Prinzessin Maria von Edinburgh, die sowohl eine Enkelin von Königin Victoria als auch vom russischen Kaiser Alexander II. war, gelöst wurde. Diese Krise verdeutlichte, wie sehr Elisabeth unter der Kinderlosigkeit litt, die ihr in der rumänischen Politik und Gesellschaft schadete, aber auch, dass sie den Zweck und die Ratio einer ausländischen Dynastie nicht verstanden hatte und in anderen Kategorien als der der Staatsräson dachte. Damit stieß sie sowohl auf den einhelligen Widerstand der rumänischen Elite als auch auf den der Bündnispartner Deutschland und Österreich-Ungarn, die sich in dieser Affäre mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. auf höchster Ebene ebenfalls einschalteten. Die Văcărescu-Affäre war daher keine Privataffäre, sondern zeigteden hohenStellenwert der rumänischen Monarchie für die Innen- und Außenpolitik auf.
Einen anderen persönlichen Bereich untersucht Adriana Christina Maziliu in ihrem Beitrag über die Privatfinanzen des Herrscherpaars, der auf einer Quellenarbeit von Dokumenten der Hofhaltung beruht. Durch die Auflistung verschiedener Posten entsteht so ein Bild über die persönliche Lebensführung und Ausgabenpolitik, wobei Maziliu das oft noch gängige Bild von einem „geizigen König“ und einem „distanzierten Verhältnis zwischen den Ehepartnern“ korrigiert und zu einem gegenteiligen Ergebnis kommt.
Einen Blick auf die Anfangszeit der Herrschaft Carols I. und das Verhältnis zwischen ihm und der politischen Elite wirft Liviu Brătescu. Dabei beleuchtet er die Anstrengungen derführendenPolitiker, den Fürstenmit Hilfe von religiösen Zeremonien, historischen Referenzgrößenund besonders festlichen Inszenierungen von Feierlichkeiten in die rumänische Gesellschaft zu integrieren und ein dynastisches Gefühl entstehen zu lassen. Dieses geschah auch im Hinblick auf die Bewahrung der Einheit des Landes, da in der Moldau die Unzufriedenheit über die Vernachlässigung dieses Landesteils nach der Vereinigung 1859/61 im Wachsen begriffen war. Dem Fürsten bescheinigt Brătescu, dass er seine Aufgabe als konstitutioneller Fürst richtig verstanden und entsprechend gehandelt habe.
Der letzte Beitrag von Nicolae-Şerban Tanaşoca nimmt in der Buchthematik einen etwas gesonderten Platz ein, da er sich, beruhend auf der Quellenbasis eines bisher unveröffentlichten Briefwechsels zwischen aromunischen Führern, mit der aromunischen Frage und ihren Implikationen für den Balkan und für die rumänische Politik in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts befasst. Hier werden teilweise neue Erkenntnisse über die Aktionen der aromunischen nationalen Bewegung und ihre Zusammenarbeit mit der albanischen Nationalbewegung vermittelt hinsichtlich der Schaffung einesAutonomiegebiets innerhalb des Osmanischen Reichs. Auch wenn der König nicht im Zentrum dieser Abhandlung steht, geht aus dem Briefwechsel klar hervor, dass Carol I. über dieses Problem stets informiert wurde und damit bestens vertraut war. Deutlich wird aber auch, dass sich die Forderungen der Aromunen der rumänischen Politik im Konfliktfall unterzuordnen hatten, zumal sie finanziell von Bukarest abhängig waren. Die aromunische Frage als wichtiger Bestandteil der rumänischen Balkanpolitik, die vor allem das Verhältnis zu Griechenland und dem Osmanischen Reich betraf, fiel in den Bereich der Außen- und Militärpolitik, die Carol vorrangig als seine Handlungsdomänen ansah. So bestätigt sich auch in diesem Bereich, dass er die Fäden der Außenpolitik in der Hand behielt, in der erallgemeineinen behutsamen Kurs verfolgte, der den Sicherheitsinteressen Rumäniens Rechnung trug.
Den Beiträgen ist insgesamt gemeinsam, dass sie viel von den Vorstellungen und dem Selbstverständnis des Herrscherpaars vermitteln und aufzeigen, wie dieses vom rumänischen Milieu beeinflusst wurde, in dem sich seine Integration vollzog, es andererseits aber von anderen Erfahrungen und kulturellen Vorstellungen aus dem deutschen Raum geprägt war und diese mit in die Ausgestaltung seiner Herrschaft einbrachte. Gerade die Symbol- und Repräsentationsdarstellungen machen die Aneignung des fremden Kulturkreises, die für die Legitimation der Herrschaft erforderlich war, und die Verbindungdes Neuen mit der herkunftsbedingten Vorstellungswelt und Mentalität sichtbar. Die ständig zu leistende Aufgabe von Anpassung, Identitätsbewahrung und neuer Identitäts(er)findung in ihrem Beruf als Herrscherpaar spiegelte in gewisser Weise die Lage ihres Landes wieder, das ebenfalls seinen Weg zwischen Tradition und Moderne, zwischen Ost und West, finden musste und auf der Suche nach seiner Identität war.[5]Sicher ist, dass das aus deutschen Fürstenfamilien stammende rumänische Königspaar diesen Wegals Wegbereitermitging.
Die Mehrzahl der Artikelstammtvon rumänischen Forschernund Forscherinnen unterschiedlicher Fachrichtungen, die jetzt mit ihren Untersuchungen wichtige Ergebnisse zur Einordnung der rumänischen Monarchie beisteuern und somit auch einen Überblick über die in Rumänien geleistete Forschungsarbeit geben. Die Herausgeberinnen messen diesem Aspekt einen wichtigen Stellenwert bei, da sie die rumänische Forschung einem deutschen Publikum zugänglich machen und zu einem bilateralen Wissenschaftsaustausch beitragen möchten. Das rumänische Königspaar bildet in dieser Hinsicht einen idealen Untersuchungsgegenstand, von dem beide Seiten voneinander profitieren können.
Die Herausgeberinnen haben sich bemüht, bei den Übersetzungen der rumänischen Beiträge möglichst authentisch den Ursprungstext wiederzugeben bei gleichzeitiger Verständlichkeit der Übertragung ins Deutsche. Dabei mussten manchmal Kompromisse gefunden werden, die vielleicht nicht immer beiden Ansprüchen gerecht werden konnten.
Zum Schluss möchten sich die Herausgeberinnen bei allen Mitwirkenden und Unterstützern dieses Buchprojekts herzlich bedanken, insbesondere bei den Autorinnen und Autoren für die gute Zusammenarbeit, bei Kai-Otto Zimmermann für das aufmerksame Korrekturlesen und bei Christian Schön und Valerie Lange vom ibidem-Verlag für die Drucklegung dieses dritten Bandes der Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva des Fürstlich Wiedischen Archivs.
Silvia Irina ZimmermannundEdda Binder-Iijima
Mannheim/Göttingen/Heidelberg,im Februar 2015
[1]Kirsch, Martin: Die Funktionalisierung des Monarchen im 19. Jahrhundert im europäischen Vergleich, in: Themenportal Europäische Geschichte (2007), URL:http://www.europa.clio-online.de/2007/Article=238(abgerufen am 15.02.2015).
[2]Binder-Iijima, Edda: Die Institutionalisierung der rumänischen Monarchie unter Carol I. 1866-1881, München: Oldenbourg Verlag 2003; hier Kapitel 3, S. 131-257.
[3]Zu diesem Aspekt: Binder-Iijima, Edda: Europäische Integration durch Hofkultur: die Höfe Bukarest, Sinaia, Sigmaringen und Neuwied und ihre Vermittlungs- und Repräsentationsfunktionen, in: Binder-Iijima, Edda/Löwe, Heinz-Dietrich/Volkmer, Gerald (Hg.): Die Hohenzollern in Rumänien 1866-1947. Eine monarchische Herrschaftsordnung im europäischen Kontext, Köln u.a.: Böhlau Verlag 2010, S. 99-121.
[4]Siehe dazu die entsprechenden Beiträge in dem Band: Zimmermann, Silvia Irina/ Binder-Iijima, Edda (Hg.): „Ich werde noch vieles anbahnen“. Carmen Sylva, die Schriftstellerin understeKöniginvon Rumänienim Kontext ihrer Zeit, Stuttgart: ibidem Verlag,2015.
[5]Siehe dazu den anregenden Essay von Keith Hitchins: Romaniaof the Kings, in: Binder-Iijima/Löwe/Volkmer (Hg.): Die Hohenzollern in Rumänien 1866-1947, S. 11-19.
I. Symbolisches Bildprogramm
Ruxanda Beldimann: Symbolischer Wert und offizielle Funktion desSchlosses Pelesch. Diehistorische VorgehensweisevonKönig Carol I.und der Beitrag der Königin und Dichterin Carmen Sylva
[König Carol] „brachte seinen ganzen Hof mit sich nach Sinaia und betrieb auch hier mit dem in der Hauptstadt geübten Arbeitseifer die politischen und militärischen Angelegenheiten des Landes, erteilte Audienzen, hielt wichtige Sitzungen ab.“[1]
Parallel zu seinem architektonischen und künstlerischenUnternehmenvollzog der königliche Bauherr Carol I. für Schloss Pelesch in programmatischer Weise eine Reihe von symbolischen Akten, die in öffentlich-festlichen Zeremonien an mittelalterliche Bräuche und Riten erinnern (z. B. die Grundsteinlegung, die Einweihung des Bauwerks etc.) und die aus heutiger Sicht als historistisch bezeichnet werden. Sie zeigen, dass Carol I. für sein Bauwerk wiederholt auf die Geschichte der Hohenzollernverwies und dass er Parallelen und Brückenschläge zu seiner Wahlheimat herzustellen suchte. Im Folgenden sollen diese Tendenzen näher untersucht und erklärtwerden.[2]
Im Jahr 1875, kurz vor derGrundsteinlegung des Schlosses, erklärte Fürst Carol in einem Brief an seinen Vater seine Vorstellungen über den Bau des Schlosses in Sinaia und das symbolische und ideologisch-politische Konzept:
„Die Großartigkeit des Baues macht im ganzen Lande einen vortrefflichen Eindruck, und jeder freut sich darüber, weil er darin eine Garantie für die Stetigkeit des Regimes sieht. Jetzt schon nennt man es ‚Königsschloss‘ – was es auch eines Tages werden kann! – Möge es vor allem die Wiege unserer Dynastie werden, denn ohne diese ist die Zukunft des Landes nicht gesichert!“[3]
Das Bauwerk war von Anfang an als Wiege der rumänischen Dynastie und alsihr Gründungssymbolkonzipiert worden,dessen Bedeutung sich der Bauherr als Gründer bewusstwar. Und deshalb wurde Schloss Pelesch nach der Schönheitsauffassung und dem Geschmack Carols I. errichtet und mit der Symbolik der Gründung ausgestattet – und nicht das Königspalais in Bukarest, dessen Architektur der Ausdruck einer französischen Welt war, mit der sich der Königwenigeridentifizierte.
Die jahrhundertealte Tradition des Fürstenhauses Hohenzollern setzte die Kenntnis der alten Bräuche und deshistorisch-ideellen RepräsentationswertsvonHerrschaftsarchitekturvoraus. Die alten Burgen der Adligen, die Jahrhunderte überdauert hatten und deren Eigentümer zahlreiche, hauptsächlich militärische Tugenden aufwiesen, symbolisierten im 19. Jahrhundert die Weitergabe alter Wertvorstellungen von der Ehre sowie die Auffassung von einer familiären und nationalen Zugehörigkeit. Bei der Errichtung neuer Bauwerke bewirkte die romantische Begeisterung für das Mittelalter eineRückbesinnungauf die alten Bräuche, wie zum Beispiel auf das Ritual einer Grundsteinlegung.
Das symbolische Programm der Residenz im politischen Kontext Rumäniens
Carol I. betrachtete seine Mission in Rumänien als einen zivilisatorischen Akt und als eine Pflicht, die er gegenüber der rumänischen Nation, die ihn ins Land gerufen hatte, erfüllen sollte. Er war der Auffassung, dass die Balkanvölker sich nicht ohne Vorbilder aus dem Western, und insbesondere ohne das deutsche Beispiel, entwickeln konnten. Dass ein Hohenzollern eine solche Pflicht auf sich genommen hatte, war für Carol von hoher Bedeutung: für die Nation, die ihn zum Fürsten gewählt hatte, musste er ein Vorbild sein, sowohl durch seine Person als auch in der Funktion eines Vertreters des sogenannten zivilisatorischen Deutschtums. Das von ihm errichtete Schloss Pelesch erhielt durch ihn den Symbolwert der Modernisierung Rumäniens durch die Orientierung an Modellen der deutschen Kultur. Shona Kallestrup bezeichnet die Haltung des Königs zur Nation,über die er herrscht, als eine „willing invitation“ (einebereitwillig befolgteEinladung).[4]Die britische Forscherin vergleicht die Vorgehensweise des rumänischen Fürsten mit der seinesVerwandten, Kaiser Wilhelm II.,gegenüber dem Elsaß undkommt zu dem Schluss, dass die beiden Hohenzollern unterschiedliche Ansichten besaßen und auf eine jeweils andere Art die Einführung der Werte deutscher Zivilisation propagierten. Das Modell Carols I. wird von den Rumänen als gewinnbringend akzeptiert. Der deutsche Kaiser dagegen will das Gefühl der Zugehörigkeit zu Deutschland und zum Kaiserreich in den nach dem deutsch-französischen Krieg annektierten Gebieten mit Gewalt, in einer aggressiven Manier erzwingen. Die Lage in den beiden Gebieten, Rumänien und Elsaß, kann man demnach nur aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit vergleichen. Des Weiteren hebt Kallestrup hervor, dass die politische Klasse in Rumänienwie auchdie rumänische Gesellschaft von den Vorteilen der konstitutionellen Monarchie und vonihrerErfüllung der nationalen Erwartungen überzeugt war.In diesem Fall bedeutete die einzige Lösung, einen fremden Prinzen (Carol I.) auf den Thron zu setzen. Die nationalenZielekonnten zu diesem Zeitpunkt in einer noch „unreifen“ Gesellschaft nicht aus eigener Kraft erreicht werden.
Die Nachricht Carols an seinen Vater im Jahr 1875 und kurz vor der Grundsteinlegung des Schlosses drückt jedoch vor allem ein persönliches politisches Anliegen aus. Die häufigenRegierungswechseltrübten seine ersten Herrschaftsjahre in Rumänien, und die Unruhen erreichten einen Höhepunkt bei einer antideutschen Kundgebung anlässlich der Siegesfeier der Deutschen über Frankreich. Der Fürst war infolgedessen der Überzeugung, dass seine Mission in Rumänien gescheitert war.
Doch seinWeggangaus Rumänien hätte nicht bloß eine Abdankungbedeutet, sondern zugleich den Verlust aller Privilegien in der Außenpolitik, die der rumänische Staat mittlerweile gewonnen hatte und die den persönlichen Beziehungen Carols und seiner Eigenschaft als Repräsentant eines Fürstenhauses von Weltrang zu verdanken waren. Seine Zugehörigkeit zur preußischenKönigsfamilie und vermutlich auch seine Kühnheit als deutscher Prinz, den Thron eines osmanischen Vasallenstaates anzunehmen, bewirkten, dass er bei der Zeremonie der Ernennung durch den Sultan gemäß seines Ranges als deutscher Adliger behandelt wurde und nichtnach demüblichen osmanischen Protokollfür die rumänischenFürsten. Carol selbst betrachtete diese Geste als einen ersten Schritt hin zur Errichtung eines nationalen unabhängigen Staates Rumänien.
Doch zunächst zeigte die geringe Stabilitätdespolitischen SystemsRumäniens, dass eine noch ungenügend entwickelte Gesellschaft die ersten Schritte in Richtung einer Demokratie machte. Die Einführung der Demokratie bedeutete eine Modernisierung in der Politik sowie in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und wurde effektiv durchgesetzt, nachdem die staatliche Unabhängigkeit gewonnen worden war. In diesem Kontext ist der Wunsch Carols I. zu verstehen, dass Schloss Pelesch ein Symbol für die Wiege der rumänischen Dynastie werden sollte und in gleichem Maße auch für die politische Stabilität, die erinseiner Person zu verkörpern wünschte.
Platzierung des Schlosses, symbolische Bezüge
DieWahl desBauplatzesin einer Landschaft ohne historisches Gedächtnis ist nicht ohne Bedeutung.[5]Der gewählte Ort befand sich in einer Landschaft, in der die Natur von Menschenhand unberührt geblieben war. Der einzige Bau in der Nähe war das einige hundert Meter weiter gelegene Kloster Sinaia.[6]Und so, wie der neue Fürst eine neue Epoche in Rumänien einleitete, markierte auch die Wahl des Ortes für den Schlossbau „einen Neubeginn“. Zu diesem Zweck war nur ein Ort geeignet, der nicht bereits von einem anderen historischen Zeugnis, wie zum Beispiel durch Ruinen, geprägt war. Dieses war umso wichtiger, als sich herausstellte, dass die Errichtung des Bausnicht leicht zu bewerkstelligen war. Die technischenProbleme, die sich im Laufe der Jahre auf der Baustelle zeigten, schienen den Schwierigkeiten Rumäniens zu gleichen auf dem Weg hin zu einem demokratischen, wohlhabenden Staat und mit einem festgefügten politischen Lebensgebäude.
Mit dem zukünftigen fürstlichen Bau konkurrierte kein weiteres Bauwerk in der Umgebung. Die Stadt Sinaia, die ab 1880 auf Wunsch Carols I. am Fuß des Berges gebaut werden sollte, lag weit genug entfernt,so dasseinzig das Schloss die Landschaft dominieren konnte.
Ein weiterer politisch-ideologischer Aspekt muss noch erwähnt werden: Das Gelände, auf dem das Schloss errichtet werden sollte, war nur 30 km von der Grenze zu Österreich-Ungarn entfernt. Auf die Frage, warum er diese grenznahe Lage gewählt hatte, sollderKönig geantwortet haben, er glaube nicht an die Endgültigkeit dieser Grenze. Rückblickend deutete AlexandruTzigara-Samurcaş[7]den weitsichtigen Gedanken Carols folgendermaßen: „[…] heute[8]erhebt sich sein stolzes Schloss Pelesch aus der Herzmitte des gesamten Rumäniens, genau so wie er es in seinen kühnen Träumen für sein Königreich vorgesehen hatte“.[9]
Das historistische Zeremoniell: die Grundsteinlegungam 10. August 1875,das Richtfestam 6. August 1881, die offizielle Einweihung des Schlossesam7. Oktober 1883.
Obwohl das Gelände und das Schloss der Privatbesitz des Königs waren, wurde die Grundsteinlegungals Feier mit öffentlichem Charakterveranstaltet. An dem Ereignis nahmen Vertreter der wichtigsten Institutionen des Staates teil, darunterderMetropolitprimasund StaatspräsidentCalinic Miclescu, Dimitrie Ghica, derPräsidentderAbgeordnetenkammerund Vorsitzendedes Stiftungsverbands öffentlicher Krankenhäuser[10]undPremierminister Lascăr Catargiu.Der Metropolitprimas trug ein Te Deum vor, und danach ertönte dieNationalhymne, was dem Ereignis einen national-symbolischen Charakter verlieh, denn auf Wunsch Carols I. sollte diesesEreignis nicht bloßeine mondäne Veranstaltung, sondern eine offizielle sein. Das Ereignis wurde in der Literatur von Bachelin, Falke und Carmen Sylva[11]beschrieben.
DieZeremonie enthielt einige symbolische Gesten des(1875 noch) Fürstenpaares als Auftraggeber des Bauwerks. In den Grundstein des Schlosses wurden die Gründungsurkunde, 100 Münzen mit dem eingeprägten Porträt Carols I. sowie ein Gedicht Carmen Sylvas beigefügt, mit denen auf den Beitrag desHerrscherpaares an der Errichtung der neuen Residenz hingewiesen wurde.
Das alte mittelalterliche Ritual der Grundsteinlegung hatte unverändert bis ins 19. Jahrhundert überdauert und wurde vor allem in Deutschland geschätzt, wo die Begeisterung für das Mittelalter und die historistischeNeo-Renaissance den Zeitgeschmack prägten. Für Carol und Elisabeth, deren Familien auf eine jahrhundertelange Tradition von Bauherren zurückblickten, bedeutete die Weiterführung dieser alten Bräuchehingegeneine Pflicht.
Die Urkunde der Grundsteinlegung wurde vor allen Anwesenden bei dem Fest von Dimitrie Ghica, dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Stiftungsverbandes der öffentlichen Krankenhäuser, vorgelesen.Diese Geste hatte nach Carols Wunsch eine symbolische Bedeutung, denn das neue Schloss sollte somit den Staatsinstitutionen gleichgestellt werden und zu einer der wichtigsten privaten Stiftungen im Land gehören (die zugleich die Eigentümerin des Schlossgeländes war). Die Urkunde wurde „[dans] le style et selon la formule traditionelle du pays“ (nach den Gepflogenheiten des Landes [Rumänien] verfasst), wie Léo Bachelin[12]erwähnt, und damit gewann die Errichtung[13]des Schlossbaus eine historische, soziale und kulturelle Bedeutung.
Bezeichend ist auch die Erwähnung des Klosters Sinaia in dem Gründungsdokument, womit die historische Beziehung zwischen der Klosterarchitektur des Stifters Cantacuzino aus dem 18. Jahrhundert und der des neuen Bauwerks Schloss Peleschvon Carol I.unterstrichen und eine historische Kontinuität hervorgehoben wurde. Das Kloster erhielt eine großzügige Unterstützung desHerrscherpaares für die Restaurierungsarbeiten an der alten Kirche, so dass auch hier die Fortführung der alten Stiftertätigkeit des Fürsten Cantacuzino gemäß der Tradition in der Walachei offensichtlich werden sollte. Bekannt ist gleichermaßen das Engagement Carols I. bei der Restaurierung weiterer alter Denkmäler[14]im Land, wobei sich dieseHandlungsweisebei den meisten Herrschern und europäischen Dynastien jener Zeit wiederfindet. Die symbolische Verbindung zwischen dem Klosterkomplex, wodas Fürstenpaar die Sommer in denJahren 1872 bis 1883 verbrachte,und dem neuen symbolträchtigen Bauwerk der Dynastie ist nicht nur geographischer undemotionalerArt, sondern hat auch die Funktion, Carol I. in die Tradition der rumänischen Stifterfürsten der Walachei und der Moldau einzugliedern.
Ein zweites Dokument, das für das Ereignis der Grundsteinlegung verfasst wurde, enthielt die Auflistung der Baumaterialien für das Schloss sowie die Kosten und die Namen der Mitwirkenden (beginnend mit dem Hauptarchitekten Wilhelm von Doderer und dem Baustellenleiter Architekt Johannes Schultz,bishin zur Liste aller Bauarbeiter).[15]
Auch durch seineGrößesollte derSchlosskomplexin gleicher Weise imponieren wie durch seine Funktion. Neben dem Schlossbauwarenweitere Nebenbautengeplant:ein Wirtschaftsgebäude, eine Wache, Ställe, ein Waschhaus, ein Elektrizitätshaus etc. Die Residenz sollte dem Namen Hohenzollern und der historischen Persönlichkeit, die davon träumte, Herrscher eines Königreichs zu werden, alle Ehre machen. Diese großartige Vision verrät den Ehrgeiz des Bauherrn, und 1881 wurde das Schloss tatsächlich ein Königsschloss, ein Residenzbau, der durch seine künstlerische Qualität, seine Großartigkeit sowie durch sein Überdauern der Zeit auch zu einem Symbol Rumäniens wurde.
Zu diesem Zweck wurden die besten Bautechniken angewandt, und die Fundamente bestehen aus mehreren tiefen Betonschichten.[16]Der Entschluss des Bauherrn folgte somit demselben visionären Gedanken: es sollten hauptsächlich rumänische Baumaterialien verwendet werden, vor allem aus dem Prahova-Tal und aus der Umgebung des Peleschbaches: Stein, Holz undMarmor.Nur was im Land nicht gewonnen oder hergestellt werden konnte (z.B. Eisen),wurdeimportiert. Im Zuge der Bildung und Förderung des nationalen Handwerks war Carol bestrebt, für die gesamte Baudauerin erster LinieHandwerker und Arbeiter aus dem Land einzustellen, die sich neben den ausländischen weiterbilden konnten. Dies wird auch in dem Gründungsdokument wie folgt erwähnt: „Unser Wunsch ist, dass die Maurer und Tischler rumänische Handwerker sind.“[17]
Die Geldmünzen für den Grundstein des Schlosses als Symbol der Unabhängigkeit des Staates[18]
Aufgrund der unterzeichneten Vereinbarungen mit der osmanischen Pfortebesaßen die Vereinigten Donaufürstentümer nicht das Recht derMünzprägung. Die Kontroversen in den Jahren 1872-1876 hinsichtlich der Souveränität Rumäniens gegenüberdem Osmanischen Reichveranlassten die rumänische Regierung, die HerstellungvonGeldmünzen mit dem Porträt Carols I. in Belgien in Auftrag zu geben, wobei das Porträt des Fürsten vom MünzgraveurWilhelm Kullrich aus Berlin stammte. Die Präsenz des Fürstenbildes auf der Münze hatte selbstverständlich die Bedeutung der staatlichen Souveränität. Aus den wenigen Informationen über diese ersten Münzen in den Monografien zum Schloss weiß man, dass die Porträtseite das Bild Carols I. mit Koteletten zeigte und dass es sich beim Auftrag um eine kleine Stückzahl handelte.[19]Die Historikerin Carmen Tănăsoiu zitiert aus dem Buch von Aurelian Răuţă:Modern Romanian coins(1867-1966)die erwähnenswerte Information, dass die 100 Goldmünzen,die in den Grundstein des Schlosses gelegt wurden, aus der ersten Prägung von 1868stammen, die in der rumänischenstaatlichenMünze[20]in Bukarest angefertigt und vom Osmanischen Reich und von Österreich-Ungarn moniert wurde. Der Avers mit dem Porträt des Fürsten enthielt zusätzlich die Inschrift „Carol I. Fürst der Rumänen“[21], auf dem Reverssind Wappen undWert der rumänischen Währung(20 Lei in Gold) abgebildet.[22]Insgesamt versinnbildlichten diese Elemente die Legitimation der neuen Herrschaft und drückten die Autonomie des Landes gegenüber Istanbul aus.[23]
Nach Meinung von Shona Kallestrup richteten sich diese Münzen provokativgegendas Osmanische Reich.[24]Möglicherweise entsprach es der Intentiondes Fürsten Carol, dass diese erste rumänische Geldprägung in den Grundstein seines Bauwerks gelegt wurde, um somit Schloss Pelesch den Statusdes Besonderen zu verleihen, denn das Bauwerk des Fürsten wurde somit zum Träger des Wunsches in der rumänischen Gesellschaft nach staatlicher Unabhängigkeit.
Das Widmungsgedicht Carmen Sylvas an Schloss Pelesch
Das dritte Symbolelement von dokumentarischem Wert, das mit in den Grundstein des Schlosses eingemauert wurde, das GedichtIn den Grundstein von Castel Pelesch, ist das Werk der Fürstin Elisabeth.
Der mittelalterlichen Tradition in einer historistischen Manier folgend, übernahm die Schlossherrin die für sie selbstverständliche Rolle der Schöpferin eines literarisch-sagenhaften Kontextes und stellte sich somit gleichermaßen als Mit-Bauherrin und als Dichterin dar. Das siebenstrophige Gedicht wurde 1913 in dem BandSchloss Pelesch und seine Bewohner[25]von Paul Lindenberg veröffentlicht, später jedoch, in weiteren Monographien zum Schloss, nicht mehr erwähnt. In Carmen Sylvas Versen wird die Landschaft im Pelesch-Tal erwähnt, um besonders auf die Auseinandersetzung zwischen der Naturgewalt und dem menschlichen Gestaltungswillen hinzuweisen. Die letzte Strophe enthält den Wunschspruch bei der Grundsteinlegung des Schlosses:
„Es fallen die Gedanken
Wie Blätter ab vom Baum
Sie schweben und sie schwanken
Vorüber wie ein Traum.
Sie haben sich als Lieder
Ans Tageslicht gewagt,
Es hat der Sturm sie nieder
Vom Haupte mir gejagt.
Und aus der Tiefe quellen
Mit immer neuer Macht,
Hervor die Liederwellen
Vom Wald erlebt, erdacht.
Mit Beben losgerungen
Aus dunklem Felsenspalt,
Sind sie zu Tag gedrungen,
Verklungen und verhallt.
Ein Lichtgedanke eilet
Herab vom Himmelssaal,
Und wo er nur verweilet,
Da bleibt ein Sonnenstrahl.
Gleich leuchtend, ob entsendet
Vom Auf-, vom Untergang,
Gleich tröstend, ob verwendet
Zum Beten, zum Gesang.
All die Gedanken schließe
In unsern Bau ich ein,
Daß Geistessaat entsprieße
Aus diesem ersten Stein.“[26]
Das Ritual der Grundsteinlegung, ein Zeremoniell nach mittelalterlicher Tradition[27]
Das Fürstenpaar Carol I. und Elisabeth trug Maurerschürzen und legte mit der Kelle symbolisch Mörtel auf denGrundstein, der dann an die vorgesehene Stelle gesetztwurde. Der Fürst klopfte drei Mal auf den Stein („trois coups sacramentels“, wie Bachelin erzählt[28]) und sprach: „Möge dieses Schloß sich vom Grunde aus erheben und glücklich vollendetwerden, um dereinst die Wiege meiner und des Landes Dynastie zu sein.“[29]Fürstin Elisabeth vollzog dasselbe Ritual. Dann präsentierte das 9. Bataillon der Gebirgsjäger dieGewehre, und die Fanfaren spielten dieNationalhymne.
Auf die Bedeutung des Ereignisses weist Lindenberg ausdrücklich hin, dass mit dem FestaktdesTages10./22.August 1875[30]eine neue Bindung zwischen dem Fürstenpaar und der rumänischen Nation vollzogen wurde, denn Carol I. wurde hiermit als Landeseigentümer und zukünftiger Schlosseigner gefeiert. Durch das Zeremoniell der Grundsteinlegung war der fremde Prinz somit ein Landsmann geworden und der Besitzer eines Schlosses, das er als ein Symbol für die Unabhängigkeit und das zukünftige Königreich Rumänien betrachtete.[31]
Die Verbindung deutscher und rumänischer Elemente galt als selbstverständlich und symbolisch für das, was Carol I. und sein Schlossbau in Sinaia in Bezug zum rumänischen Staat darstellten.
Das Richtfest am 6. August 1881 und das Weiheglas
Drei Jahre nach derUnabhängigkeitRumäniens, am 6. August 1881, wurde das Richtfest des Schlosses Pelesch gefeiert.[32]Carol hatteeigentlichgewünscht, dass die Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Erhebung des Landes zum Königreich(14./26. März 1881)beendet seinsollten. Symbolisch betrachtet, spiegeln beide Ereignisse dasselbe: mit der Erhebung zum Königreich erhielten Carol I. und Rumänien einen höheren Status und die europäische Anerkennung der Unabhängigkeit des Staates. Dieser Erfolg war nicht nur die Folge einer stetigen diplomatischen Arbeit zugunsten des Landes, sondern der Titel entsprach auch der Würde eines Hohenzollern.
Obwohl die Arbeiten an dem Bau erst zwei Jahre später beendet werden sollten, stellte das Richtfest im Jahr 1881 einen entsprechend bedeutenden Meilenstein dar. Bei dieserZeremonie warf der Zimmermeister das Weiheglas, aus dem vermutlich vorher der König Wein getrunken hatte,von derTurmspitze hinunter.
Alte mittelalterliche Bräuche der westeuropäischen Kultur wurden somit durch das Königspaar nach Rumänien gebracht und dortdem historistischen Zeitgeistgemäßübernommen. Bei diesem Anlass wurdeein Gedicht mit Segenswünschen für das Schloss vorgetragen, das auf den königlichen Rang seines Erbauers in seiner neuen Heimat hinweisen sollte.[33]Schloss Pelesch wurde hiermit der Stammburg der Hohenzollern und Schloss Sigmaringen gleichgestellt.
Lindenberg schildert dieses Ereignis, erwähnt jedoch nicht den Dichter des Gedichts. Vermutlich war es die königliche Dichterin Carmen Sylva.Das Gedichtwurdevom bauleitenden Ingenieur, vermutlich Johannes Schultz, vorgetragen.[34]
Auch dieser Festakt war, ähnlich wie die Grundsteinlegung, mehr als eine bloße Feierlichkeit. Er bedeutete die Begegnung einiger Bräuche aus der ländlichen Bevölkerung Rumäniens mit ähnlichen Bräuchen aus Westeuropa. In seinem Tagebuch skizzierteCarol I. das Geschehen folgendermaßen: „Samstag, 6. August/ 25. Juli: […] Um 5 Uhr auf der Baustelle. Feiern des letzten Stuhlpfostens am Dachstuhl im Hauptturm. Musik, alles geschmückt. Rede. Alle Arbeiten unterbrochen. Im Turm. Schultz mit dem Orden der Rumänischen Krone 2. Klasse dekoriert.“[35]In Vergleich zu den anderen Festakten, der Grundsteinlegung und der offiziellen Einweihung im Jahr 1883, fand dieses Ereignis in einem kleineren Kreis statt.
Die offizielle Einweihung vonSchloss Pelesch am7. Oktober 1883
Ein an symbolischen Gesten reichhaltiges Programm wurde anlässlich der offiziellen Einweihung des Schlosses am 7. Oktober 1883 dargeboten. Ab diesem Zeitpunktlautetdie Benennung des Bauwerks in den öffentlichen Dokumenten „Castel Peleş“.
Das Schloss in Privatbesitzerhieltim Laufeder Jahre einen öffentlichen Charakter, vonwoaus das Landauch regiert wurde. Dies erklärt auch die Anwesenheit von höchstenRegierungs- undStaatsbeamtenbei der Einweihung des Schlosses:alle Minister außer dem Ministerpräsidenten Ion C. Brătianu, die Präsidenten des Senats (D. Ghica) und der Kammer (C. A. Rosetti), die Generalität und nicht zuletzt das Abspielen der Nationalhymne.Der König sprach: „Dies Schloss habeich erbaut als ein sichtbares Zeichen, dass die Dynastie, die durch den Volkswillen erwählt worden ist, nun in diesem schönen Lande Wurzel gefasst hat, und dass wir mit Liebe die Liebe unseres Volkes erwidern, indem wir das vollste Vertrauen zu der Zukunft unseres teueren Vaterlandes haben. Eine heilige Pflicht ist es für mich und zugleich die Erfüllung eines tiefen Herzenswunsches, dieses erste Glas voll rumänischen Weines in diesem unserem Hause zu Ehren und zum Wohle Rumäniens zu erheben. Es lebe Rumänien!“[36]
Das Ereignis, das auch im Tagebuch[37]des Königs festgehalten wird, beendte einen Zyklus von Festakten, die mit der Zeremonie der Grundsteinlegung begonnen hatte. Dieses Ereignis, wie auch jenesder Grundsteinlegung imJahr 1875, gingüber den Kontext einerrein festlichenVeranstaltung hinaus:Es wies auf eineneue Herrschafthin, und das neueSchloss, einarchitektonisches Kunstwerk,das eines Königs würdig war, spiegeltemit den Mitteln der Kunst die politische und zivilisatorische Mission, die Carol im Jahr 1866 angetreten hatte, wider.
Das religiöse Zeremoniell wurde nach dem Ritus der orthodoxen Kirche,deroffiziellenKirche in Rumänien laut der Landesverfassung,durchgeführt, geleitet vom Metropolitenprimas, seinem Vikar und dem obersten Priester des Klosters Sinaia. Dieanwesenden kirchlichen Vertreter, die die Vergangenheit und die Bräuche des Landes symbolisierten, waren somit zumzweiten Mal bei einem Festakt imSchloss Pelesch anwesend.
Die Einweihungsurkunde war vom König entworfen und von der Königin auf ein Pergamentblatt gemalt worden.[38]Die Urkunde erinnert an mittelalterlicheHandschriften,an Missale.Zwei rechteckige Ornamentrahmenumfassen das mittlere Textfeld:der äußereRahmenist schmaler und mit kleinen Edelweißblütengeschmückt, der innere reichlich verziert mit geometrisch stilisierten Blumenmotiven.Der äußere Dekorrahmen enthältzwei Verse, jeweils links und rechts vom mittleren Textfeld platziert.Des Weiterenfügte Carmen Sylva in dem mittleren Textfeldeine Skizzevon SchlossPelesch aus der Westansichthinzu.[39]
So wie es der Brauch verlangte, prägte man eine Gedenkmünze, die die Bedeutung des Schlosses hervorheben sollte, wofürwiederWilhelm Kullrich als Münzgraveurgewähltworden war.[40]Jakob von Falke und Léo Bachelin verwendeten die Bildmotive der Medaille als Buchillustration am Anfang und am Ende ihrer Monografien über das Schloss.
Zu derselben Kategorie der dynastischen Symbole des Bauwerks, die in Europa bekannt gemacht werden sollten, gehörte auch die Schmiedeeisenkunst des Haupttores zum Schloss. Es handelt sich hier um eine Auftragsarbeit der Werkstätten Pulz aus Berlin, in zweifacher Anfertigung hergestellt, wobei ein Exemplar für das Berliner Museum für Kunsthandwerk bestimmt war: „Dem Berliner Gewerbe Museum habe ich eine Schloss Garnitur von einer der reichgeschnitzten Thüren hier geschenkt“[41],wieKönig Carol I.dokumentierte.Das Werk war ein bemerkenswertes Stück Schmiedeeisenkunst[42]und das Museum, dem die Schenkung des Königs von Rumänien galt, war eines der bedeutendsten dieser Art in Europa und zugleich eine Stiftung der Hohenzollern.
Schloss Pelesch und die Symbolik der Staatsunabhängigkeit
Die Bezeichnung „Königsschloss“, die Carol I. bei der Einweihung des Bauwerkes benutzte, war kein beiläufiger poetischer Ausdruck. Bemerkenswerterweise wünschte der König, dass der große Waffensaal des Schlosses, der 1903 erbaut und bis 1906 eingerichtet wurde, zugleich eine Gedenkstätte an die 1878 gewonnene Unabhängigkeit[43]Rumäniens sein sollte.
Das Verhalten des Fürsten auf dem Schlachtfeld und der Sieg der rumänischen Armee über das Osmanische Reichim russisch-türkischen Krieg von 1877-1878änderten die öffentliche Meinung über Carol I. sowohl in Rumänien als auch in Europa. Soerklärt sich auch sein Entschluss, Schloss Pelesch mit einer Reihe vonKriegssymbolen auszustatten. Der Grund für einen Waffensaal in einem Schlossmuss hier nicht weiter erläutert werden, wohl aber bedarf die Tatsache, dass er den Saal mit Trophäen aus dem Unabhängigkeitskriegausstatteteund dass er1877erbeutetetürkische Fahnen und Kanonen neben historischen Waffen aus den europäischen Werkstätten des 15.-16. Jahrhunderts und seiner gesamten Waffensammlung stellte, näherer Erläuterung.Ein letztes Stück, das Tor der Festung von Widin, ergänzte die Erinnerung an den Unabhängigkeitskrieg neben den anderen erbeuteten Trophäen von Nikopolis, Plevna, Widin etc.[44]
Der Raum erscheint wie ein Brückenschlag von den Kreuzzügen gegen die Osmanen (der von 1396, an dem auch Mitglieder des Fürstenhauses Zollern sowie der Fürst der Walachei Mircea der Alte teilnahmen, hatte mit einer vernichtenden Niederlage der Christen bei Nikopolis geendet) bis zum Sieg von 1877 über die Osmanen und der Erringung der Unabhängigkeit Rumäniens. Ein Vorfahre König Carols I., Friedrich von Zollern,[45]hatte an der Schlacht von Nikopolis teilgenommen, und 480 Jahre später führte Karl von Hohenzollern [Carol I. von Rumänien] die russisch-rumänische Armee zum Sieg über das Osmanische Reich.Um diese Symmetrie zu betonen, die zum zentralen Thema des Waffensaales wurde, bestellte Carol im Jahr 1904 beim Berliner Bildhauer Paul Telge[46]ein Bronzerelief mit der Darstellung der Schlacht bei Nikopolis,in der drei historische Gestalten zu identifizieren sind: Kaiser Sigismund von Luxemburg, Friedrich von Zollern und der rumänische Fürst Mircea der Alte. Im selben Jahr hielt König Carol I. in der Aula der Rumänischen Akademie einen Vortrag mit dem Titel „Nikopolis 1396-1877-1902”[47], in dem er von der Tradition seiner Vorfahren und deren militärischen Leistungen sprach. Die Decke des Waffensaales in Schloss Pelesch ist nichtzufälligmit Tafeln, dieWappen undWahlsprüchealler Linien der Hohenzollernfamiliedarstellen,geschmückt,denn damit wird auf die militärische Vergangenheit und auf die Herkunft des Königs von Rumänien ausdrücklich hingewiesen.
Die Ahnengalerie
Die Ahnengalerie stellte ebenfalls ein symbolisch-politisches Programm dar, mit derder König seine Residenz in Sinaia ausstattete.[48]Allem voran bedeutete diese Galerie ein Verpflanzen seiner Wurzeln in den Boden der Wahlheimat, ein Hinweis, der sowohl imSchloss Pelesch als auch im Königspalais in Bukarest zu finden ist. Des Weiteren bezeugte die Galerie das Alter der Familie der Zollern-Grafenund der Hohenzollern-Fürsten (das älteste Datum zu einem Porträt ist das Jahr 948). Und nicht zuletzt erinnerte die Galerie an die militärische und die ununterbrochene politische Tradition des Hauses Hohenzollern, an seine ruhmreiche Vergangenheit, an Werte, die durch Porträts von heldenhaften Ahnen aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit verkörpert wurden. Die Verbindung zur Geschichte der neuen Heimat stellten zweiGlasfensterin der Hauptachse der Ehrentreppe dar: Dargestellt waren hier die Fürsten Stefan der Große und Michael der Tapfere, die beide sinnbildlich für den Kampfumdie Unabhängigkeit der Rumänen stehen.[49]
Schloss Pelesch als Aufbewahrungsort des Kronschatzes
Eine weitere Bedeutung,die dem Schloss Pelesch (und nicht dem Königspalais in Bukarest) verliehen wurde, war die als Aufbewahrungsort des Kronschatzes. Dieser befand sich in einem Nebenraum des Waffensaales,in unmittelbarer Nähe zum Arbeitszimmer des Königs. In einer Vitrine[50]wurde hier die KronevonKönig Carol I. von Rumänien aufbewahrt, die aus dem Stahl einer Kanone von Plevna angefertigt worden war und ein Symbol der Unabhängigkeit des Staates darstellte. Die Vitrine enthielt auch die Orden und Auszeichnungen, die der Herrscher erhalten hatte, sowie Miniaturporträts von Familienmitgliedern des Hauses Hohenzollern.
Die Repräsentationsfunktion. Schloss Pelesch als Ort politischer Entscheidungen und alsKommunikationsortgesellschaftlichen Lebens
Obwohl das Schloss auch eine Sommerresidenz war, spieltedieFreizeit[51]für Carol I. keine besondere Rolle. Das gesamte symbolische Bildprogramm des Schlosses wurde von einer Reihe wesentlicher Funktionen unterstützt, die das Schloss in seiner Rolle für die Repräsentation, als Ort politischer Entscheidung und alskulturellen, gesellschaftlichen Begegnungsortdefinierten. In den Monaten Mai bis November wurde Sinaia die zweite Hauptstadt des Landes.[52]Hier fanden zahlreiche politische Ereignisse statt, die für Rumänien wichtig warenmit dem König als Hauptakteur.[53]
Die Repräsentationsfunktion spiegelte sich in dem Architekturprogramm insbesondere des Hochparterres,abereigentlichauchdes ganzen Bauwerks[54]wider und war ein wesentlicher kulturpolitischer Bestandteil beiVeranstaltungen undBesuchen ausländischer Staatsvertreter und Kronprinzen.[55]
In der ersten Bauphase umfasste das Gebäude folgende Repräsentationsräume,die auf Wunsch des Auftraggebers später vom Architekten Liman teilweise umgebaut wurden: die Ehrentreppe, an deren Wänden die Ahnengalerieverlief,der Empfangssalon (auch „deutscher Salon“ genannt, der in der zweiten Umbauphasezum Florentiner Saal umfunktioniert und dem mit den Thronstühlen einneuerSymbolcharakter verliehen wurde) sowie der Musiksalon, das Speisezimmer, das Arbeitszimmer des Königs,der auch die FunktioneinesEmpfangsraumes hatte, das königliche Theaterundder Maurische Saal (von 1892).[56]
In den Fluren entlang der Ehrenhalle wurden nach 1906 mehrere Büsten römischer Kaiser aufgestellt, darunter auch Trajan und Cäsar. Es handelte sich um Marmorkopien nach antiken Originalen aus dem Vatikan,derenAufstellung auf Säulen dem Beispiel in anderen westeuropäischen Schlössernfolgte. König Carol I. akzeptierte den Vergleich seines Bildes mit einem einzigen römischen Kaiser (als Vorfahre des rumänischen Volkes) und zwar mit Trajan, so wie dies die Ikonographie zur Jubiläumsausstellung von 1906 zeigte.[57]
ImJahr 1911 erhielt der zentrale Raum, „die wunderbare Ehrenhalle, die an die Herrlichkeit der Paläste der Rothschild-Familie in Wien erinnert“[58], die hauptsächliche Funktion der Repräsentation, zu der die Bildnisse der Ah