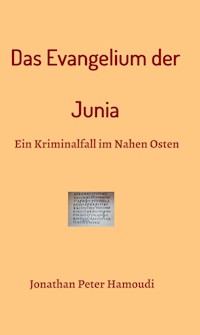
3,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein alter Lehrer findet ein altes Manuskript, angeblich ein apokryphes Evangelium, das viele Jahre vor den biblischen Evangelien verfasst wurde, und zwar von einer Frau aus dem Kreis der Apostel. Ist es echt oder eine geniale Fälschung? Der Finder geht in den Nahen Osten, um die Übersetzung vor Ort zu ergänzen und zu überprüfen. Kontakte zu Israelis und Palästinensern lassen die Aktualität des Textes in ungeahnter Weise erleben. Der alte Lehrer erlebt den grausamen Alltag des Nahen Ostens. Fundamentalisten aller Couleur wollen verhindern, dass dieser Text veröffentlicht wird. Mehrere Menschen werden umgebracht, weil man versucht, alle zum Schweigen zu bringen, die das Manuskript kennen könnten. Doch das Evangelium wird veröffentlicht. Darin wird Jesus als normaler Mensch erlebt, der sich von Gott beauftragt gesehen hat als Knecht Gottes. Er war verheiratet und hat auch Frauen als Apostel berufen. Er war bereit, mit den Menschen und für die Menschen zu leiden, bis zum Tod. Aber die Sache Jesu ging und geht weiter. Denn Jesus lebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jonathan Peter Hamoudi
Das Evangelium der Junia
Ein Kriminalfall im Nahen Osten
© 2017 Jonathan Peter Hamoudi
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Tel. +49 (0) 28484250
ISBN
Paperback:
978-3-7439-8333-5
Hardcover:
978-3-7439-8334-2
e-Book:
978-3-7439-8335-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Die Entdeckung des Evangeliums
Das Evangelium der Junia
Namen der Personen und Orte im Evangelium
Nachwort und Dank
Vorwort
Es ist sicher sinnvoll, zuerst den Bericht über die Entdeckung und die Veröffentlichung des Evangeliums der Junia, Apostelin und Jüngerin Jesu, zu lesen. Dieser Bericht enthält wesentliche Teile des Evangeliums.
Anschließend ist es sicher gewinnbringend, das ganze Evangelium fortlaufend zu lesen, samt Anmerkungen, und dazu die Liste der Namen zu Hilfe zu nehmen.
Für andere ist es sicher reizvoll, zunächst das wiedergefundene Evangelium zu lesen, um dann hinterher den Bericht über die Auffindung und Publizierung zu lesen.
Die Entdeckung des Evangeliums
1. Kapitel: Das Manuskript des Fluchs
Dr. Matthias Achtnich, ein gebildeter Mann und kritischer Zeitgenosse, Doktor der Philologie und Lateinlehrer im Ruhestand, hielt sich für so aufgeklärt, dass er Vorstellungen von Teufeln und Dämonen, von Besessenheit und Visionen strikt ablehnte. Nach langen Jahren als Lehrer an einem Gymnasium wusste er mit Sicherheit, dass der Fluch eines Pharao oder der Segen eines Abraham in der heutigen Zeit nichts bedeuten und nichts bewirken konnte. Das wusste er, bis er eben wieder einmal auf einen alten Text stieß.
"Seit einigen Monaten lebte Junia, die Apostelin, nun in Kefarnahum in der Nähe ihrer Kinder, die inzwischen erwachsen waren und sie schon dreimal zur Großmutter gemacht hatten. Sie war dort inzwischen eine Stütze der christlichen Gemeinde, leitete oft den Gottesdienst und wurde immer wieder gebeten, aus dem Schatz ihrer Erinnerungen an Jeschua den Messias, den lebendigen Knecht Gottes, zu erzählen. Und deshalb war es für sie selbstverständlich gewesen, alles festzuhalten für den Apostel Paulus.
Junia war mehrere Monate damit beschäftigt gewesen, die Berichte zusammenzustellen, mit ihren eigenen Erinnerungen zu vergleichen, mit Brüdern und Schwestern zu besprechen, bis dann die ganze Geschichte des Jeschua von Nazareth auf den Papyrusblättern stand, so wie sie sich nach
ihrer Erinnerung abgespielt hatte. Es war nicht billig gewesen, dem Schreiber Epaphroditus einen so langen Text zu diktieren.
Jetzt erst konnten wir, Schuschanna und ich, Elischabeth, uns mit ihr auf den Weg machen, um den Apostel Paulus in Jerusalem zu treffen. Die Reise von Kefarnahum bis Jericho war mühsam, aber in vier Tagen geschafft. Wir wollten dann noch einen Umweg über Bethlehem machen, denn Schuschanna, die mit Junia und mir unterwegs war, wollte dort ihren Bruder besuchen.
Wir blieben also eine Nacht in Bethlehem. Es war dann am Morgen des Ostersonntags im dritten Jahre des Kaisers Nero, als wir uns von Bethlehem aus auf den Weg nach Jeruschalajim machten.
Doch beim Grab der Rahel sollte unsere Reise grausam beendet werden, ohne dass wir den Apostel Paulus treffen konnten.
Junia hatte gerade zu mi zu mir gesagt: „Liebe Elischabeth, du bist ja noch jung. Ich bin schon alt. Ich bin ein wenig müde. Lass uns doch im Schatten des Grabmals ein wenig rasten.“
Wir hatten uns gerade hingesetzt und ein Stück Brot ausgepackt. Da kamen zwei Männer auf schnellen Pferden herangeritten. Ohne ein Wort zu sagen, griffen sie uns an. Es waren sicher Räuber. Vermuteten sie, wir Frauen mit unserer guten Kleidung hätten Schätze bei uns? Oder hatte sich Junia schon bei wichtigen Männern in Jerusalem unbeliebt gemacht, als sie anfing, Nachrichten über Jeschua zu sammeln, um den Bericht über Jeschua zu schreiben?
Wir zwei, Schuschanna und ich, konnten uns hinter einem Felsen beim Grabmal verstecken, aber Junia kam nur bis zum Vorraum des Heiligtums; es gelang ihr gerade noch, die Kupferdose mit dem Papyrus in eine Ritze im Boden zu schieben. Da waren die Männer schon über ihr, sie schlugen sie nieder und durchsuchten sie, sogar ihren toten Körper tasteten sie ab, aber offenbar fanden sie nichts Wertvolles bei ihr - die Kupferdose mit dem Papyrus war inzwischen vom Staub bedeckt.
Wir beiden liefen dann ganz schnell davon, voll Angst, selber getötet zu werden. Wir gingen nach Jerusalem, um den Brüdern und Schwestern vom Tod der Schwester zu berichten.
Inzwischen hatten reisende Kaufleute den Leichnam entdeckt und die tote Junia zuerst nach Bethlehem und dann nach Jerusalem gebracht.
Am Abend trafen einige Jünger des Herrn im Haus der alten Maria, der Mutter unseres Herrn, ein. Auch der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn, war dabei. Viele weinten mit uns. Wir beteten für Junia und dankten dem Herrn dafür, dass sie ihm mit ihren Gaben so treu gedient hatte. Besonders traurig war natürlich Simon Petrus, der nicht nur eine Mitapostelin, sondern seine geliebte Jochgenossin verloren hatte.
Jakobus aber sprach mit ernster Miene: „Liebe Schwestern und Brüder, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Junia wollte die gute Ordnung Gottes zerstören. Uns Männer hat der Herr berufen und gesandt. Sie hat sich erdreistet und wollte selber Gemeinden führen und predigen. Sie wollte sogar ihre Erinnerungen aufschreiben, was wir so nicht annehmen konnten. Nun hat Gottes Urteil sie getroffen. Der Bericht, von dem sie geredet hat, ist verschwunden; er war nicht bei ihr. Er muss auch verschwunden bleiben, für immer! Der Herr verfluche den Menschen, der versuchen sollte, einen solchen Bericht zu behalten oder weiterzugeben! Ein solcher Mensch soll dem Satan übergeben werden, zu ewigem Verderben!“
Schuschanna hielt sich die Hand vor den Mund, als sie das hörte. Woher wusste Jakobus, dass die Mörder den Bericht nicht gefunden hatten? Wie konnte er vermuten, dass Junia das Manuskript bei sich hatte?
Mir ging es ähnlich. Ich fürchtete mich vor Jakobus und seinen Helfern. Voller Entsetzen standen wir auf, Schuschanna und ich, und verließen die Versammlung weinend.
Nie wieder haben wir von unserer Schwester Junia und ihrem Bericht gehört. Die Kupferdose mit der Schriftrolle blieb verschwunden. Der Apostel Jakobus war zufrieden. Doch der Apostel Paulus wartete bis zu seinem Tod vergeblich auf die Erinnerungen der Junia.
Der Fluch des Jakobus – war das eine der vielen Legenden aus der Anfangszeit der christlichen Kirche oder eine der zahllosen Fälschungen des Mittelalters?
Dr. Achtnich glaubte selbstverständlich nicht an einen solchen Fluch. Wie sollte ein solcher Satz nach Jahrtausenden Wirkung zeigen, gleichgültig, ob er von einem Apostel oder einem Pharao oder einem Priester des Altertums stammte? Und doch, Jahre später, als das alte Dokument (oder eine Fälschung?) aufgetaucht war, als im Zusammenhang mit diesem Manuskript Morddrohungen ausgesprochen wurden, und mehr noch, als mindestens sechs Menschen zu Tode gekommen waren, da war es für Matthias Achtnich mit der Ruhe dahin. Sollte doch etwas dran sein an dem alten Fluch? Aber das war, wie gesagt, Jahre später. Damals war es nur wissenschaftliches Interesse, was ihn bewegte.
Im Herbst 2004 fand sich in der Zeitschrift für Studien des Neuen Testaments (StNT) ein Artikel, der sich mit dem alten Manuskript beschäftigte, in dem vom Tod einer Apostelin Junia die Rede war. Der Artikel fiel Dr. Matthias Achtnich auf, denn ausgerechnet diesen Text hatte Achtnich als junger Student an einem Seminar zu spätgriechischen Texten lesen und übersetzen müssen. Das war zu Beginn der Sechzigerjahre. Achtnich hatte ein Jahr vorher in Heidelberg sein Studium begonnen, Altphilologie und damals noch Evangelische Theologie. Der Theologie hatte er dann bald den Rücken gekehrt. Es gab einfach zu viele Fragen und Zweifel.
Der Papyrus war kurz zuvor aufgetaucht, auf dunklen Kanälen in eine Versteigerung geraten. Und jetzt war dieser apokryphe Text wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Und mit ihm der Fluch des Apostels Jakobus!
Das Manuskript hatte inzwischen die wissenschaftliche Bezeichnung TAe III B 21 erhalten. Man musste ja dem Ding einen Namen geben. Sicher verwahrt liegt es in Münster im Institut für Neutestamentliche Textforschung, jahrelang war es nicht beachtet worden. Dieses Institut hat Kopien von nahezu allen Handschriften des Neuen Testaments, aber auch von den übrigen Texten aus jener Zeit, die nicht in die offizielle Liste der autorisierten Bibel aufgenommen worden waren.
Der Artikel, der jetzt veröffentlicht wurde (StNT 2004, S. 218ff.), stammte von Dr. Martin Kuhn, einem jüdischen Historiker. Auch in seinen Augen war diese Mitteilung historisch absolut wertlos. Sie ließe höchstens etwas über Legenden und Vorstellungen des 5. oder 6. nachchristlichen Jahrhunderts erkennen. Hintergrund sei, so Professor Kuhn, die wachsende Feindschaft der offiziellen Kirche gegenüber den Juden und auch gegenüber den Judenchristen, die die Verbindung zu den Synagogengemeinden nicht aufgeben wollten.
Achtnich hatte dem Autor geschrieben und gefragt, ob er denn tatsächlich davon überzeugt sei, dass hinter dieser „Legende“ keine historische Erinnerung stecke. Ob nicht doch eine Frau in der Anfangszeit des Christentums ein Evangelium geschrieben habe. Aber er hatte keine Antwort erhalten.
2. Der Fund des Manuskripts
Dr. Matthias Achtnich hatte vor seiner Pensionierung an einem Gymnasium in Nürnberg vor allem Latein unterrichtet und für dein paar ganz Eifrige auch eine Arbeitsgemeinschaft für Griechisch eingerichtet. Jetzt hatte er viel Zeit. So fuhr er mit seiner Frau im Jahr 2005 auf eine Studien- und Pilgerreise ins Heilige Land, nicht zum ersten Mal. Den Artikel und seine Anfrage nahm er mit. Es könnte ja sein, dass er mit dem alten Professor in Jerusalem Kontakt aufnehmen könnte.
Es waren meist Lehrer und Lehrerinnen im Ruhestand, zwei alte Pfarrer und ein paar ältere Fräuleins, die sich für diese Studien- und Pilgerreise angemeldet hatten. Diesmal wollte er auch wieder das Rahelgrab besuchen, die legendäre Grabstätte der Lieblingsfrau des Patriarchen Jakob. Von diesem Ort war ja in dem alten Manuskript die Rede. Deshalb schlug er vor:
„Könnten wir nicht mit dem Bus nach Bethlehem fahren? Wir sollten doch auch die Geburtskirche und die Hirtenfelder besuchen. Und auf dem Markt in Bethlehem könnten wir noch ein paar Andenken kaufen, eine Krippe oder ein Palästinensertuch. Was meint ihr?“
Achtnich wollte sich dann selbständig machen und zum Rahelgrab laufen.
Bevor die anderen Mitglieder der Reisegruppe antworten konnten, entschied der israelische Reiseleiter: „Es ist heute zu gefährlich, nach Bethlehem hinaus zu fahren. Wir müssten damit rechnen, dass die Palästinenser wieder Steine werfen oder gar Molotow-Cocktails, wie vor einigen Monaten. Ich übernehme nicht die Verantwortung für einen solchen Ausflug. Wir bleiben bei unserem ursprünglichen Programm und besuchen die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem.“
Achtnich kümmerte sich nicht um diese Warnung, sondern setzte sich von der Reisegruppe nach dem Mittagessen für den Nachmittag ab, um mit dem Bus Richtung Bethlehem zu fahren. Seine Frau verstand ihn gut. Sie kannte ihn und wusste, dass er immer wieder ein paar Stunden oder Tage allein sein wollte. Sie blieb bei der Gruppe, die Jad Vashem, die Gedenkstätte in Jerusalem besuchte.
Es fiel ihm nicht leicht, das Rahelgrab zu finden, obwohl er es doch kannte. Er wusste, es liegt an der Straße von Jerusalem nach Bethlehem. Schließlich stand er vor dem, was noch übrig war von dem Grabmal. Es hatte schon wochenlang nicht mehr geregnet. Deshalb war nicht nur die Straße voller Staub, sondern auch das Gelände rechts und links von der Straße war nur eine graubraune Wüste mit ein paar vertrockneten Gräsern. Ein paar einsame Büsche und ein oder zwei Bäume kümmerten traurig vor sich hin. Und mittendrin das Rahelgrab. Aber was er vorfand, war kein altes Heiligtum, sondern nur eine Ruine, vergessen, verlassen.
Als der Lehrer die Kapelle im Jahr 1996 zum ersten Mal besucht hatte, da war es ein kleines fast quadratisches Häuschen, keine zehn Meter Seitenlänge, mit einer zu hohen Kuppel; davor ein Vorraum, zu dem fünf Stufen hinauf führten. Nur zwei winzige Fenster erhellten diesen Vorraum notdürftig. Damals waren jüdische und muslimische Frauen dorthin gepilgert, wenn ihr Kinderwunsch nicht in Erfüllung ging. Doch jetzt war diese uralte Grabstätte wieder einmal zerstört. Das kleine Gebäude war seit dem 4. Jahrhundert bekannt, immer wieder war es zerstört worden, immer wieder wurde es aufgebaut.
Langsam ging er um die Reste der Kapelle herum und stieg über die Trümmer, traurig und empört über diese sinnlose Zerstörung.
Die Gedenkstätte selbst war ganz in Trümmern; nur vom Vorraum standen noch Mauerreste. Er stieg über die Reste des Türrahmens in den kleinen Raum, wo man früher die Schuhe abgestellt hatte. Da entdeckte er, dass in der hinteren Ecke eine Steinplatte des Bodens zerbrochen war. Ein wenig schief lagen die Stücke im Staub und gaben den Blick in eine kleine dunkle Gruft frei. Darunter war nicht das Grab der Rahel, sondern eine winzige Kammer, kaum einen halben Quadratmeter Grundfläche und höchstens 30 cm tief. Da waren wohl ursprünglich, vor langer Zeit, nach jüdischem Brauch alte Handschriften bestattet worden, die unbrauchbar geworden waren. Oder waren es Erinnerungsstücke an einen muslimischen Lehrer, der hier verehrt wurde?
Vorsichtig schob er die zerbrochene Platte ein wenig beiseite. Wäre es nicht herrlich, irgendetwas Altes hier zu finden, wie es schon immer sein Traum gewesen war? Vielleicht hatten die Archäologen oder die Grabräuber ein Fetzelchen eines Manuskripts oder eine kleine Tonscherbe oder eine alte Münze übersehen. Aber er fand nur Dreck und Sand in der kleinen Nische. Mit bloßen Händen holte er den Staub der Jahrhunderte heraus. Inzwischen war er selber voller Staub, auch seine Kleider, Hemd und Hose und Sandalen, alles war voller Dreck.
Natürlich schien die Kammer leer. Trotzdem ließ er nicht locker. Er kniete nieder und wühlte im Staub, bis die Fugen der Steine überall zu sehen waren. Es war ja niemand in der Nähe, der unangenehme Fragen gestellt hätte. Die israelischen Soldaten waren heute weit weg, ausnahmsweise.
Da plötzlich war er wie elektrisiert: An einer Stelle hinten in der Ecke war ein Stein etwas höher als die anderen, kaum einen Zentimeter. Er passte nicht ganz. Der Stein ließ sich herausnehmen, mit Hilfe des Hotelschlüssels. Und darunter war ein kleines Versteck, Platz für einen kleinen Schatz.
Da lag doch tatsächlich eine schmale Dose aus Kupferblech, versiegelt und fest verschlossen, geschützt durch Staub und Dreck. Er schaute den Fund voller Ehrfurcht an. Sollte diese Dose tatsächlich alt sein oder hatte sich jemand einen Scherz erlaubt? Hatte dieser Gegenstand Jahrhunderte und Kriege und Grabschändungen heil überstanden? Übersehen. Vergessen. Versteckt im Staub. Niemand war in der Nähe, als Dr. Achtnich den Fund nun in aller Eile unter sein Unterhemd schob. Sein buntes Hemd ließ er jetzt locker über den Gürtel hängen.
Natürlich hätte er das nicht tun dürfen. Er wusste, dass es streng verboten war, irgendwelche alten Gegenstände einfach mitzunehmen. War er jetzt auch ein Grabräuber? Aber die Versuchung war zu groß. Das war doch schon immer sein Traum gewesen, ein altes Manuskript zu finden, möglichst einen unbekannten Text. Was mochte diese Kupferdose enthalten?
Er klopfte sich den Staub von den Kleidern, so gut es ging, und wanderte dann zu Fuß wieder nach Bethlehem zurück, gemächlich, um sich zu beruhigen
Erst im Hotelzimmer – wie üblich wohnte die Gruppe im arabischen Teil von Jerusalem im Hotel Capitol in der Nähe des Herodestores - traute er sich, den Fund genauer zu betrachten. Er hatte das Zimmer abgeschlossen, die Vorhänge zugezogen und am Empfang gesagt, er wolle nicht gestört werden, nach dem anstrengenden Tag. Seine Frau war mit der Gruppe immer noch unterwegs in Jerusalem oder vielleicht schon irgendwo beim Abendessen.
Dem alten Lehrer zitterten ein wenig die Hände, als er sich daran machte, die Dose anzuschauen. Der Puls ging erheblich schneller, schon fast bedrohlich. Aber das hatte wohl nichts mit seinem etwas überhöhten Blutdruck zu tun.
Die Kupferdose war tatsächlich noch heil und fast unbeschädigt, nur ein wenig zusammengedrückt, voller Grünspan und Dreck, aber noch immer dicht verschlossen.
Achtnich wagte es, ganz vorsichtig die Kupferdose zu öffnen. Behutsam reinigte er die Kapsel und lockerte mit einer Nadel zuerst und dann mit einem kleinen Obstmesser den Deckel von der eigentlichen Dose. Langsam zog er die beiden Teile auseinander, um sie ja nicht zu beschädigen. Eine Schriftrolle aus Papyrus fand er, etwa 12 cm hoch, in sehr gutem Zustand, eng beschrieben mit etwa 8 cm breiten Spalten, mit griechischen Großbuchstaben, ohne Trennung von Wörtern, ohne Punkt und Komma, ohne Satzzeichen.
Ganz gespannt entzifferte er die Titelzeilen:
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣΤΟ ΥΙΗΣΟ ΥΑΓΕΓΡΑΜ ΜΕΝΕΙΣ ΥΠΟΙΟ ΥΝΙΑΙΟΑΝΝΑΜΑ ΘΗ ΤΡΙΑΚΑΙΑΠΟΣΤΟΛΗΤΟΥΜΕΣΣΙΑΙΗ ΣΟΥΑΤΩΠΑΥΛΟΣΥΝΑΠΟΣΤΟΛΟ·
Es war mühsam genug, diese Buchstabenreihe zu verstehen und zu übersetzen. Wie lange war es her, seit er das versucht hatte. Aber es gelang ihm doch. Und nach etwa zwei Stunden hatte er das Ergebnis vor sich auf ein Blatt Papier notiert, die Übersetzung der ersten paar Zeilen, nach mehreren Versuchen nun ohne durchgestrichene und korrigierte Wörter:
Erinnerungen an Jeschua, wie es Junia Johanna, Jüngerin und Apostelin des Maschiach Jeschua aufgeschrieben hat, für Paulus, den Mitapostel.
Du hattest mich gebeten, lieber Bruder Paulus, für dich aufzuschreiben, was ich noch von dem weiß, was unser Freund und Rabbi Jeschua von Nazareth gesagt und getan hat. Als wir damals in Antiochia in Syrien im Gefängnis waren mit Andronikus, unserem Freund und Mitbruder im Apostelamt, hatten wir viele Tage Zeit, darüber zu reden, was Jeschua getan und gesagt hat.
Dr. Achtnich kam ins Grübeln und Zweifeln: Sollte es eine Apostelin Junia oder Johanna gegeben haben, die ihre Erinnerungen an Jesus, also eine Art Evangelium, aufgeschrieben hat? Er war so gut wie sicher, dass der Text diesen Eindruck erwecken wollte. Deshalb war er unheimlich aufgeregt und wollte endlich wissen, was diese Junia geschrieben hat.
Aber zuerst einmal verschloss er das Manuskript wieder in der Kupferdose, denn er durfte doch nicht einfach diesen Fund für sich behalten. Er versteckte den Schatz zwischen seinen verschwitzten Hemden und den dreckigen Hosen und wartete darauf, dass die Gruppe ins Hotel zurückkäme.
Was sollte er seiner Frau sagen? Sollte er sie einweihen und ihre Vorwürfe in Kauf nehmen? Sollte er es verschweigen und so tun, als sei es in Bethlehem langweilig und trostlos gewesen?
Er blieb im Hotelzimmer sitzen, versuchte in einem Buch zu lesen, das über die Archäologie der biblischen Welt informierte, aber es gelang ihm nicht, sich zu konzentrieren. Auf einen gemeinsamen Abend bei einem Glas Karmelwein mit der Reisegruppe hatte er auch keine Lust.
Als dann am späten Abend seine Frau Angelika, Ärztin im Ruhestand, nach oben kam, begrüßte er sie herzlich. Sie schaute ihn kritisch an, offenbar war er immer noch blass und irgendwie abwesend.
„Sag mal, Matthias, ist irgendetwas passiert in Bethlehem? Du bist so anders. Geht es dir nicht gut?“
Natürlich musste sie unbedingt seinen Puls fühlen und seinen Blutdruck messen. Nein, die Stirn war nicht heiß, die Hände waren trocken wie auch sonst.
„Gab es irgendwelche Zwischenfälle heute Nachmittag? Ich mache mir Sorgen!“ Sie ließ nicht locker. Aber Matthias Achtnich brummelte nur: „Es ist schon alles in Ordnung; vielleicht war der Kaffee zu stark, den ich in Bethlehem getrunken habe. Oder es war zu heiß dort.“
Die Spannung ließ sich den ganzen Abend über nicht ausräumen, denn Matthias Achtnich war nicht oder noch nicht bereit, mit seiner Frau über den Fund zu reden.
Die restlichen zwei Tage der Studienreise hindurch hatte er Angst, er könnte das alte Stück verlieren, oder es könnte jemand in das Hotelzimmer eindringen. Deshalb hatte er die Rolle mit seinem Restgeld im Safe in seinem Hotelzimmer eingeschlossen. Doch er war immer in Sorge, seine Frau oder sonst jemand aus der Gruppe könnte unangenehme Fragen stellen.
Für die anderen Mitglieder der Reisegruppe war er kaum ansprechbar Die wunderten sich nur, wie wenig Begeiste-rung er entwickelte in Jerusalem und in Jericho. Der Mitreisende auf dem Sitz neben ihm im Bus, ein Arzt aus Fürth, fragte ihn auf der Fahrt nach Qumran: „Sag mal, du bist so anders geworden. Geht es dir nicht gut? Bist du krank? Hast du etwas Falsches gegessen oder irgendeinen Saft getrunken? Oder hast du dich in eine Palästinenserin verliebt?“
Dr. Achtnich beruhigte ihn: „Ich bin nur etwas müde von der Hitze, aber sonst geht es mir gut, sehr gut sogar.“
Daraufhin ließ er ihn in Ruhe. Die anderen Mitreisenden auch.
Er konnte sich kaum noch erinnern, welche heiligen Stätten sie noch besuchten. Das spielte für ihn auch kaum noch eine Rolle.
Der alte Lehrer hatte vorher schon geplant, nicht mit der Reisegruppe nach Deutschland zurück zu fahren, sondern noch eine Woche im Heiligen Land zu bleiben, allein. Das war auch mit seiner Frau und seinen Kindern so abgespro-chen worden. So hatte er Zeit und die nötige Ruhe, um den Fund genauer anzuschauen.
Achtnich fragte sich jetzt natürlich: Sollte die merkwürdige Notiz, die bislang als absolut unglaubwürdige Legende abgetan worden war, doch irgendwie stimmen? Natürlich interessierte ihn das alte Manuskript, aber musste er den Fluch des Jakobus ernst nehmen? Der alte Lehrer lehnte jeden Aberglauben ab, und so lachte er nur leise vor sich hin: „Was soll ein derartiger Quatsch: Unheilsprophetie, Verfluchung! Und die soll noch nach Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden noch Wirkung zeigen? Undenkbar!“.
3. Das Manuskript wird entziffert
Als seine Frau mit der Gruppe abgereist war, machte er sich an die Arbeit. Zeile um Zeile übertrug er die ersten Spalten des griechischen Textes. Oft hatte er Mühe, in der Buchstabenschlange vernünftige Wörter zu entdecken. Und die dann zu verstehen und zu übersetzen. Dieser erste Entwurf einer Übersetzung hatte sicher einige Fehler; manchmal waren es nur Vermutungen, die er niederschrieb. Er übersetzte, so gut es eben ging.
Bald wurde ihm klar, dass er es in den paar Tagen, die ihm in Jerusalem blieben, nie schaffen würde, den ganzen Text zu übertragen.
Außerdem fehlten Fachbücher, Wörterbücher und Grammatiken; doch er traute sich nicht, mit dem Fund in eine Bibliothek zu gehen oder gar das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes um Hilfe zu bitten.
Oft stieß er auf unbekannte, vermutlich aramäische oder hebräische Wörter, manchmal in griechischer Umschrift, manchmal mit hebräischen Buchstaben, oder er stolperte über merkwürdige Abkürzungen oder Symbole, die ihm unbekannt waren. Die Namen folgten nicht der bekannten griechischen Fassung oder der Vulgata-Tradition, sondern wurden in einer aramäischen Fassung wiedergegeben, manchmal mit griechischen, selten mit hebräischen Buchstaben. Das war ihm sehr schnell aufgefallen.
Achtnich versuchte zu verstehen, was er las; der Text machte ihn immer neugieriger. Er freute sich darauf, das ganze Evangelium vor sich zu haben.
Aber er kam einfach nicht weiter. So begnügte er sich damit, den ganzen Text des Manuskripts zusammen mit der vorläufigen Übersetzung der ersten Spalten in der deutschen Botschaft zu scannen und verschlüsselt an eine neue e-mail-Adresse zu senden.
Der Lehrer wollte alles zunächst einmal unter Verschluss halten. Er war ja immer noch voller Zweifel, ob diese paar Seiten alt und echt waren.
Trotzdem faszinierte ihn der Inhalt. Sollte das tatsächlich die Wahrheit sein? So schnell konnte er als Philologe seine Bedenken nicht wegschieben.
Er las noch einmal die paar Seiten des Textes, die er übertragen hatte:
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣΤΟ ΥΙΗΣΟ ΥΑΓΕΓΡΑΜ ΜΕΝΕΙΣ ΥΠΟΙΟ ΥΝΙΑΙΟΑΝΝΑΜΑ ΘΗ ΤΡΙΑΚΑΙΑΠΟΣΤΟΛΗΤΟΥΜΕΣΣΙΑΙΗ ΣΟΥΑΤΩΠΑΥΛΟΣΥΝΑΠΟΣΤΟΛΟ·
Erinnerungen an Jeschua, wie es Junia Johanna, Jüngerin und Apostelin des Maschiach Jeschua aufgeschrieben hat, für Paulus, den Mitapostel.
Du hattest mich gebeten, lieber Bruder Paulus, für dich aufzuschreiben, was ich noch von dem weiß, was unser Freund und Rabbi Jeschua von Nazareth gesagt und getan hat. Als wir damals in Antiochia in Syrien im Gefängnis waren mit Andronikus, unserem Freund und Mitbruder im Apostelamt, hatten wir viele Tage Zeit, darüber zu reden, was Jeschua getan und gesagt hatte.
Ich denke oft noch an den Streit in der Gemeinde von Antiochia in Syrien. Es kam dort zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dir und dem Apostel Kepha oder Petrus, dem Missionar Barnabo sowie dem Jochanan Markus, seinem Neffen. Du erinnerst dich sicher an das, was dort geschehen ist.
Ich weiß es noch gut. Du warst mit Barnabo und Jochanan Markus zurückgekehrt von eurer ersten großen Reise. Ihr wart ausgezogen, um den Juden in Asia die Gute Nachricht von Jeschua, dem gesalbten Knecht Gottes, zu verkünden. Am Sonntag versammelten wir uns zur Gemeindeversammlung im Haus des Barnabo, um euren Bericht zu hören. Es war am Abend nach Sonnenuntergang. Lucius betete am Anfang einen Psalm des Dawid. Sodann erinnerte er an das Gleichnis, das Jeschua einmal erzählt hatte, von dem Bauern, der Getreide sät: Ein paar Körner fallen ins dornige Gebüsch, wo nichts geerntet werden kann, so hatte Jeschua gesagt; andere Körner fallen auf die dünne Krume, die den steinigen Untergrund deckt, der nichts wachsen lässt; wieder andere Körner fallen auf den Streifen Land, der immer wieder als Fußweg von Menschen hart getreten wird, wenn sie unterwegs sind; doch manche Körner fallen auf guten Boden.
So hatte Jeschua von der Verkündigung des Gottesreiches gesprochen: Damit muss jeder rechnen, der Gottes Wahrheit weitersagt, mit so verschiedenen Wirkungen, Jeschua der Prophet wie auch seine Apostel und Missionare.
Ist das nicht beruhigend, fügte Lucius hinzu, dass Jeschua selber auch nicht immer Glauben und Gehorsam fand?
Das klang wenig glaubwürdig, dass dem Apostel Paulus in Erinnerung gerufen werden sollte, was er selbst wenige Jahre vorher erlebt hatte. Dr. Achtnich war nicht überzeugt, dass er ein altes Manuskript vor sich hatte. Das alles war doch schlecht erfunden. Aber der Hobbyarchäologe las weiter, doch gespannt, was da alles zusammengeschrieben worden war.
Dann hast du davon erzählt, was euch auf der Insel Zypern und in einigen Städten im Süden von Asia widerfahren ist; auch euch begegneten Menschen, die eurer Predigt glaubten. Viele ließen sich taufen in einem Bach oder einem See. Denn auch Jeschua hatte sich taufen lassen im Jordan; er hat dann uns befohlen, Menschen zu taufen, die zu ihm und seiner Gemeinde gehören wollten. .Aber da waren andere, die sich abwandten, feindlich oder enttäuscht; wieder andere zögerten, manche wollten die neue Lehre annehmen, aber doch nicht von ihrem alten Glauben und ihrem früheren Leben ablassen. Sie wollten eine Entscheidung vermeiden, die ihr Leben verändern würde.
Später am Abend feierten wir das Liebesmahl in der Erinnerung an Jeschua. Ich war froh, dass du mich bei diesem Fest der Gemeinde aufgefordert hast, der Versammlung der Gläubigen vorzustehen. Im Gebet dankte ich Gott für alles: die Erinnerung an Jeschua, die Lieder und Gebete, die Berichte von so vielen Schwestern und Brüdern. Stundenlang saßen wir zusammen; wir aßen und tranken miteinander, wir teilten, was jeder mitgebracht hatte; alle wurden satt; einige der Frauen tanzten, wie damals der König Dawid vor der heiligen Lade des Bundes.
Wir alle wunderten uns darüber, wie Menschen, die in der Welt wichtig sind, neben Hafenarbeitern saßen, Apostel neben Huren, Rabbiner neben Sklavinnen, Frauen aus angesehenen Familien neben ganz armen Männern. Da gab es keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen, zwischen Armen und Reichen, zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Frommen und Zweiflern; alle waren Schwestern und Brüder Jeschuas. Wir erlebten, dass Jeschua für uns und für alle gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt.
Bei diesem Liebesmahl hast du, lieber Bruder Paulus, gefragt: "Ist Jeschua der Maschiach, der Christos, der gesalbte König Gottes für sein Volk Jisrael?"
Es war uns allen klar, dass Jeschua das Reich Israel in seiner alten Größe, von dem wir träumten, nicht wiederhergestellt hat. Er wollte es auch nicht wiederherstellen. Aber war er König für Jisrael?
Alle schwiegen zuerst einmal. Du nahmst du noch einmal das Wort und sprachst: „Nein, er war nicht ein König! Er wollte nicht das Reich des Dawid wieder herstellen. Darüber besteht Einigkeit zwischen uns. Aber ist er der Gesalbte des Ewigen?“
Wir wurden still und dachten an unseren Rabbi. Ich wusste von Mirjam aus Migdal, dass sie Jeschua gesalbt hatte. Gesalbt zum Dienst als ebed jahwe, als leidender Knecht Gottes. Also war und ist er der Gesalbte des Herrn.
Als mir das klar wurde, antwortete ich dir ganz laut: "Ja, ich weiß, dass Jeschua der Gesalbte Gottes ist, gesalbt zum Leiden und Sterben. Ja, er ist der gesalbte Knecht des Ewigen und deshalb auch der Maschiach Gottes."
Da überlegte Lucius: „Wenn Jeschua der Maschiach, der Christos ist, dann sind doch wir als seine Freunde die Nachfolger des Gesalbten, dann sind wir Christianer, hoi Christianoi. Dann sind wir Christen, alle: Juden und Nichtjuden, wir gehören alle zu Gottes Volk als Freunde des Maschiach Jeschua. Hallelujah!"
„Wir sind Christen“, wie der Jubel der himmlischen Heerscharen klang dieses Wort in der Versammlung. Der Name wurde aufgenommen als Ehrentitel für alle, die durch Jeschua zum Volk Gottes gehören, in allen Gemeinden.
Man hat sich oft gewundert, wann die Bezeichnung „Christen“ aufgekommen ist und warum man die Anhänger dieser Religionsgemeinschaft nicht „Jesuaner“ genannt hat. Offenbar wollte man damals bewusst ein Bekenntnis zu Jesus dem Christus oder dem Messias ausdrücken. Die Christen in Antiochia, eine gemischte Gruppe aus ehemaligen Juden und ehemaligen Nichtjuden, mussten unbedingt eine Bezeichnung finden, die von allen akzeptiert werden konnte. Und diese Bezeichnung hat sich dann durchgesetzt.
Während wir miteinander feierten, kam ganz unerwartet mein geliebter Mann, der Apostel Kepha, der die Gemeinde in Antiochia besuchen wollte.
Das klang immer phantastischer: Junia – die Ehefrau des Petrus? Dass der Apostel verheiratet war, ist bekannt aus Briefen des Paulus. Dass er seine Ehefrau zumindest am Anfang auf seine Missionsreisen mitgenommen hat, wird auch erwähnt. Aber dass seine Ehefrau dann mit Paulus im Gefängnis saß und dann ein Evangelium geschrieben hat, ist doch nicht glaubhaft!
Und kann das der historischen Wahrheit entsprechen, dass eine Frau die Leitung eines Eucharistiegottesdienstes übernehmen konnte? Selbst wenn es die Ehefrau eines Apostels war? Oder gewesen sein soll? Die Zweifel des Lehrers wurden immer stärker. Warum hat dann die Kirche bis ins 21. Jahrhundert Frauen von der Leitung einer Gemeinde, einer Kirche oder auch nur eines Gottesdienstes ausgeschlossen? Warum trugen nur alte Männer Verantwortung in dieser Glaubensgemeinschaft, wenn in den ersten Jahren Frauen Leitungsämter übernehmen konnten? Oder sollte doch die Fraktion der Hardliner mit Erfolg versucht haben, diese Wahrheit zu unterdrücken? Rätsel über Rätsel!
Dr. Achtnich las weiter:
Weißt du noch, wie sehr er sich freute über die festliche Gemeindeversammlung und über unsere Gemeinschaft im Glauben, und wie gern er mitgefeiert hat. Ich war sehr froh, ihn nahe bei mir zu haben, und bat ihn, neben mir Platz zu nehmen. Ich erzählte ihm, was die drei Missionare berichtet hatten, und er freute sich mit uns und dankte Gott für den Glauben so vieler Menschen. Über den Namen „Christen“ war er nicht froh, denn für ihn waren die Menschen, die an Jeschua den Maschiach glaubten, immer noch Teil des Volkes Gottes und nicht eine neue Gemeinde.
Der Höhepunkt dieser frohen Feier war das Herrenmahl als Erinnerung an das letzte Mahl des Jeschua mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Ich lud die Gemeinde ein, an den letzten Abend Jeschuas zu denken. Er hatte davon gesprochen, dass er freiwillig den Tod auf sich nehmen würde, aus Liebe zu allen Menschen, um den Weg des Leidens bis zum bitteren Ende mitzugehen; ich erinnerte daran, wie er Brot und Wein geteilt hatte, Zeichen dafür, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit allen Menschen zuteilwürde.
Wir waren uns gewiss, dass er nicht tot geblieben ist, sondern lebt. In Brot und Wein hat er uns sichtbare Zeichen dafür gegeben, dass er unter uns ist, unsichtbar, und dass wir alle zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde, gehören.
So hatte er gesprochen, als er zum letzten Mal mit uns gefeiert hat: „Nehmt und esst, denn das ist mein Leib!“ Und dabei hat er auf uns alle gezeigt, auf seine Jüngerinnen und Jünger.
Die Darstellung wurde immer spannender. Der Text legte Wert darauf, dass es keine Transsubstantiation geben könnte, weil bei der Eucharistie Brot und Wein nur Hilfen zur Erinnerung und Ausdruck der Gemeinschaft seien, mehr nicht.
Als wir schon lange in die Nacht hinein gefeiert hatten, ging noch einmal die Tür auf, und zwei ernst blickende Männer in traditionellen jüdischen Gewändern betraten den Raum; ich kannte sie nicht. Deshalb baten wir sie, dass sie sich vorstellten, und so erfuhren wir, dass es zwei Rabbiner waren, Jitzchak und Ben Elieser, die den Apostel Jaakov in der Gemeinde von Jeruschalajim unterstützten. Zwei Rabbiner, die an Jeschua den Maschiach glaubten. Kepha war ihnen früher einmal in Jeruschalajim begegnet. Aber er hatte sie nicht wieder erkannt. Er begrüßte sie und lud sie ein, mit uns zu feiern: "Wir danken dem Herrn, dass auch ihr gekommen seid, die Schwestern und Brüder in Antiochia zu besuchen. Feiert mit uns das Mahl Jeschuas des Maschiach."
Da blickten die beiden Rabbiner noch ernsthafter und sagten: "Wir sehen hier Menschen, die offensichtlich nicht aus Jisrael, aus Gottes erwähltem Volk, stammen; wie kannst du, ein Jude, mit ihnen an einem Tisch feiern? Und wir sehen, dass eine Frau den Gottesdienst leitet; wie kannst du so die gute Ordnung Gottes zerbrechen? Weißt du nicht, dass die Frauen schweigen sollen in der Gemeindeversammlung? Hat nicht Gott nur Männer als seine Jünger, als Apostel, als Priester und Propheten oder Gemeindeleiter berufen? Wir sehen, dass Sklaven bei Tisch sitzen anstatt zu dienen, wie es ihr rechter Platz und Gottes Wille wäre. Darunter auch ein Mann aus den Nachkommen des verfluchten Ham. Und wir sehen, dass einige Frauen mitfeiern, deren Kleider und ihr Parfum darauf schließen lassen, dass sie immer noch Huren sind. Habt ihr denn Gottes Gebote vergessen? Meint ihr denn, ihr hättet den Willen Gottes besser verstanden als wir?"
Da wurde es unruhig in der Versammlung. Der Apostel Kepha schaute mich unsicher an und gab mir ein Zeichen, damit ich ihm die Leitung des Gottesdienstes überlasse. Ich sollte mich nach hinten setzen, meinte er. Aber ich wusste, dass es im Sinne des Jeschua war, wie wir Gottesdienst feiern, und deshalb blieb ich sitzen. Da schüttelte Kepha den Kopf, traurig und zornig, er sagte kein Wort zu mir, sondern stand auf und ging mit den beiden Rabbinern aus dem Saal; und nach ihm standen auch Barnabo und Jochanan Markus auf. Barnabo sagte noch: „Wir dürfen die Brüder aus Jeruschalajim doch nicht so aus der Gemeinschaft ausschließen!" und verließ die Versammlung.
Es gab also doch diese Fraktion, die Frauen von der Leitung der Kirche und der Verantwortung ausschließen wollte. Eine Fraktion angeblich angeführt von Jakobus, einem der Brüder von Jesus. Es scheint, dass dieser Mann schon wenige Jahre nach Ostern die Leitung der Urkirche in Jerusalem übernommen hatte, wie auch immer.
Also von Einmütigkeit und Harmonie in der Urkirche, nur wenige Jahre oder Jahrzehnte nach Ostern, konnte nach diesem Bericht, wenn er denn die Fakten richtig wiedergab, keine Rede sein. Spannend war diese Darstellung allemal, vor allem, weil sie das Leben der ersten Christen so ohne Verklärung darstellte.
Als wir noch überlegten, was wir tun sollten, da bist du, lieber Paulus, aufgestanden; im Herzen erregt und sehr zornig bist du den Männern nachgegangen und hast gerufen: "Ihr Männer, liebe Brüder, kommt zurück, wir müssen über diese Frage reden."
Zögernd und missmutig kamen die zwei Rabbiner mit dem Apostel Kepha, mit Barnabo und Jochanan Markus zurück. Aus dem Liebesmahl wurde jetzt der erste große Streit unter uns Christen. Aber es kam anders, als die Boten aus Jeruschalajim gehofft hatten. Denn du kamst nach vorne und begannst zu reden.
Zuerst hast du die Gemeinde in Antiochia angeredet und gesagt:
"Liebe Schwestern und Brüder, ihr seid alle Gottes Kinder und Brüder und Schwestern des Jeschua durch den Glauben an Jeschua, und da ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Jude und Nichtjude, zwischen Freien und Sklaven, zwischen Menschen, die als ehrbar in der Welt gelten, und euch, die ihr verachtet seid. Deshalb feiern wir miteinander als Schwestern und Brüder Jeschuas. Deshalb gibt es nur eine Gemeinde des Jeschua in Antiochia, zu der alle gehören, die an Jeschua den gesalbten Knecht Gottes glauben. Wir sitzen alle an einem Tisch, weil wir alle zusammengehören. Wenn der Apostel Kepha zu Gast ist, ist er unser Bruder und gehört dazu. Wenn der Missionar Barnabo hier ist, gehört er dazu. Wenn die Mitarbeiter des Apostels Jaakov bei uns sind, gehören sie dazu. Aber auch Simeon, der afrikanische Sklave, gehört dazu, und unsere Brüder, die Hafenarbeiter, und unsere Schwestern, die Huren gehören dazu, alle, die von Jeschua auf den neuen Weg gerufen wurden und diesen neuen Weg gehen."
Und dann wandtest du dich an Kepha, voll Liebe, aber auch voller Zorn. Also hast du gesprochen:
"Du, lieber Bruder Kepha, bist gekommen und hast mit uns gefeiert, du hast mit uns gegessen und getrunken, du hast mit uns gebetet und gesungen, an einem Tisch mit Junia, deiner Jochgenossin, unserer Schwester im Dienst des Herrn, und mit Barnabo und mit Simeon, dem schwarzen Sklaven. Aber dann plötzlich hast du die Gemeinschaft verlassen, weil du lieber für den Apostel Jaakov und seine Freunde sein wolltest, die die Gebote des jüdischen Volkes auf alle Menschen übertragen wollen, die an Jeschua glauben. Du willst eins sein mit Männern, denen die Gemeinschaft mit anderen Juden wichtiger ist als die Gemeinschaft mit Nichtjuden, die den neuen Weg, den Weg Jeschuas, gehen.
Lieber Bruder Kepha, das eine oder das andere ist Heuchelei und Lüge. Willst du alle hier zwingen, nach jüdischen Vorschriften zu leben, damit unsere Brüder in Jeruschalajim gut angesehen sind beim Sanhedrin und den jüdischen Schriftgelehrten und Priestern? Oder bist du bereit, uns alle als Gemeinde des Jeschua und als Teil des Volkes Gottes anzuerkennen und zu lieben?
Wir glauben, dass Jeschua jeden berufen hat, dass Jeschua uns durch Gottes Geist zurüstet zu Diensten und Ämtern, deshalb versuchen wir, zu erkennen, wozu jeder von Gott berufen ist. Bist du bereit, mit uns Gottes Berufungen anzuerkennen, so wie es ihm gefällt: die einen als Apostel und Apostelinnen, andere als Prediger oder Gemeindeleiterinnen, wieder andere als Rabbiner und Schriftgelehrte oder als Diakoninnen und Sängerinnen? Oder darf Gott nur Männer berufen, weil im Judentum nur Männer das Priesteramt ausüben durften oder weil in der römischen Verwaltung nur Männer vom Kaiser als Statthalter und Verwaltungsbeamte eingesetzt werden? Sag mir, lieber Kepha, was ist deine Antwort im Geist des Jeschua?"
So hatte sich also der Paulus durchgesetzt gegen die Fraktion des Jakobus, der die Christen als innerjüdische Sekte aufbauen wollte. Der die alten Reinheitsvorschriften und sonstigen Gebote für alle Christen verbindlich vorschreiben wollte und der vor allem Frauen von Leitungsaufgaben fernhalten wollte. Was wäre aus der Kirche geworden, wenn sich Jakobus durchgesetzt hätte? Oder hat er sich doch durchgesetzt?
Dr. Achtnich fragte sich, ob diese Erinnerung an die Gemeindeversammlung in Antiochia unbedingt so ausführlich berichtet werden musste – in einem Text, der für Paulus bestimmt war. Was sollte das Ganze? War Paulus schon senil, als Junia das Evangelium schrieb? Oder war der ganze Bericht doch für einen erweiterten Leserkreis bestimmt? Nur dann machte dieses ausführliche erste Kapitel Sinn. Aber nur dann! Der alte Lehrer hatte nicht geringe Zweifel, ob das Manuskript nicht doch eine späte Fälschung war.
Aber er las weiter.
Da wurde Kepha ganz beschämt und sagte zu dir und zur ganzen Gemeinde:
"Liebe Schwestern und Brüder, mein Bruder Paulus hat Recht. Wir gehören alle zu Jeschua dem Maschiach, so wie wir seinen Ruf gehört haben, als Juden oder Nichtjuden, als Männer oder Frauen. Ich danke euch, dass ihr mich in eure Gemeinschaft aufgenommen habt, in die Gemeinschaft des Jeschua. Bitte vergebt mir, dass ich für kurze Zeit die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes vergessen und verleugnet habe. Deshalb bin ich dankbar dafür, dass meine geliebte Jochgenossin und Ehefrau, die Apostelin Junia, beauftragt wurde von euch, diese Feier zu leiten. Denn Gott hat sie zur Apostelin berufen und mit seinem Geist erfüllt."
Und Kepha setzte sich wieder neben mich. Barnabo aber und Jochanan Markus aber gingen mit den beiden Rabbinern wieder hinaus. Sie kehrten unverzüglich nach Jeruschalajim zurück, um dem Apostel Jaakov Bericht zu erstatten.
Dem alten Lehrer kam natürlich jetzt das Papier über den Tod der Junia in den Sinn; denn da wurde ja unverblümt dem Apostel Jakobus der Vorwurf gemacht, er sei zumindest glücklich über den Tod dieser Frau gewesen, wenn er nicht sogar diesen Mord veranlasst hatte.
Als wir an diesem Abend über Jeschua redeten, wie er gelebt und was er gelehrt hatte, wurde dir bewusst, wie wenig du von Jeschua wusstest, von seinem Leben, seinen Predigten, seinen Gleichnissen und von seinen Begegnungen mit den ganz verschiedenen Menschen. Du wurdest sehr traurig darüber. Und du hast mich gefragt: „Kannst du mir helfen, Jeschua besser zu verstehen? Kannst du nicht für mich in einem Bericht festhalten, was du über das Leben Jeschuas, unseres Herrn, weißt?“
Deshalb habe ich es übernommen, meine Erinnerungen aufzuschreiben.
4. Zurück in Deutschland
Achtnich war ganz stolz, dass er so weit gekommen war mit der Übersetzung. Bei der Bank Leumi in der Jerusalemer Neustadt mietete er einen kleinen Banksafe und schloss den Fund ein. Er fragte sich, ob er den Schatz jemals wiedersehen würde. Diese Sorge ließ ihn lange nicht los.
Nach drei Wochen Israel und Palästina flog der alte Lehrer wieder zurück nach Deutschland, mit der Kopie des Manuskripts und der vorläufigen Übersetzung einiger Kapitel in der Tasche.
Endlich wieder zuhause in Nürnberg.
„Grüß Gott, mein Liebster! Wie schön, dass du wieder da bist! Du warst einfach zu lange weg!“ so wurde Achtnich von seiner Frau Angelika begrüßt, mit heißen Küssen. Obwohl sie nur eine gute Woche getrennt waren und obwohl er fast jeden Tag telefoniert oder eine kurze Mitteilung per e-mail geschickt und auch Fotos angehängt hatte. Aber das zählte nicht. Natürlich war er froh, dass sie ihn vermisst hatte.
Sie schaute ihn fragend an. Aber sagte nichts, zunächst einmal.Doch nach dem Abendessen kam es zur großen Auseinandersetzung. Angelika Achtnich setzte sich ihrem Mann gegenüber an den abgeräumten Tisch, füllte sich und ihm noch einmal ein Glas Wein ein und schaute ihn mit großen Augen an: „Du bist so anders in letzter Zeit. Du bist so weit weg von mir. Irgendetwas steht zwischen uns. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will jetzt wissen, was mit dir los ist.“
Es blieb Herrn Achtnich nichts anderes übrig, als seiner Frau die ganze Geschichte zu beichten: „Ich habe einen Schatz gefunden. Aber nicht so einen Schatz, wie du mir unterstellt hast. Als ich da in Bethlehem war, bin ich noch zum Grab der Rahel gegangen. Da war ich ganz allein, kein Mensch war da. Auch keine israelischen Soldaten waren in der Nähe. Dann habe ich in den Ruinen herum gestöbert. Und ich habe dort im Dreck ein Manuskript gefunden, das vielleicht uralt ist. Ein Manuskript in einer Kupferdose. Es vermittelt den Anschein, als sei es ein apokryphes Evangelium, das von einer Frau aus dem Jüngerkreis Jesu geschrieben wurde, bevor sie ermordet wurde. Aber der Mord wird in einem anderen apokryphen Text erzählt. Jetzt bin ich dabei, das Ganze zu übersetzen.“
„Und was willst du dann mit dem Fund machen? Willst du womöglich das Manuskript, das du gestohlen hast, behalten?“
„Nein, aber ich gebe es dem rechtmäßigen Eigentümer erst zurück, wenn ich einmal weiß, wem es gehört. Aber darum kümmere ich mich erst, wenn ich alles übersetzt habe.
Dann kann ich es vielleicht veröffentlichen. Das wäre doch was, wenn ich das publizieren könnte!“
„Ach du alter Träumer! Meinst du, du kriegst das fertig?
„Die ersten Kapitel habe ich schon übersetzt. Ich drucke dir gern die paar Seiten aus. Aber bitte, du gibst sie niemandem zu lesen. Und du sagst keinem etwas von meinem Fund!“
„Versprochen!“
Und sie gab ihm einen dicken Kuss.
„Ich dachte schon, du hättest dich verliebt im Heiligen Land, vielleicht in eine kleine Palästinenserin. Ich bin ja so beruhigt!“
Er genoss die Tage mit ihr zuhause, er traf seine Kinder und Enkel; er war immer wieder in seinem Garten. Doch an seinen Schatz ging er vorerst nicht.
5. Besuche in Synagogen und Moscheen
Am Freitagabend der folgenden Woche nahm er wieder einmal am Gottesdienst der jüdischen Gemeinde teil. Man kannte den alten Lehrer dort schon und begrüßte ihn herzlich. Er war so lange im christlich-jüdischen Dialog tätig gewesen, dass er den Inhalt mancher Psalmen, Gebete und Lesungen kannte, auch wenn er den hebräischen Text immer noch nicht Wort für Wort verstand. Immerhin konnte er mitlesen und mitsprechen und sich als Teil dieser Gemeinschaft erleben.
Nach dem Gottesdienst gab es noch ein paar Informationen, meist auf Russisch, selten auf Deutsch, über das Gemeindeleben und die Angebote in Nürnberg. Und es wurde zu Spenden aufgerufen für den Jüdischen Nationalfonds, der in Israel die menschenleere Wüste blühen lässt und die Hügel wieder grünt, so wurde gesagt. Ist oder war Israel tatsächlich eine Wüste, die zum Blühen gebracht werden muss, eine öde Steppe, ein leeres Land?
Dass die Millionen Bäume auf den Ruinen palästinensischer Dörfer oder auf platt gemachten muslimischen Friedhöfen gepflanzt und die Gärten auf den Äckern palästinensischer Bauern angelegt wurden und werden, wurde nicht gesagt. Achtnich schwieg, aber er schämte sich, dass er so feige war und nichts sagte. Diese russischen Juden wissen ja nichts von der Situation in Israel, sagte er sich – zu seiner eigenen Entschuldigung.
Nachdenklich und irgendwie verärgert ging er nach Hause.
Einige Wochen später nahm Dr. Achtnich am Freitagsgebet der arabisch und deutsch sprachigen Moscheegemeinde in Nürnberg teil, in der die Freitagspredigt zuerst auf Arabisch, dann auf Deutsch gehalten wird. Oft sind hier Nordafrikaner und Araber anzutreffen, aber auch die ganz wenigen deutschen Konvertiten. Genauer gesagt: es waren dann meist junge deutsche Frauen, die ihren muslimischen Männern zuliebe konvertiert waren. Auch hier war er kein Unbekannter.
Diesmal waren es vor allem Palästinenser, Ärzte, Studenten und Assistenten, die schon längere Zeit hier waren und ausgezeichnet deutsch sprachen. Es ging in den hitzigen Diskussionen, die nach dem Freitagsgebet auf Deutsch geführt werden, vor allem um die Angriffe der Israelis auf den Gazastreifen und die Einschränkungen und Schikanen im Westjordanland und Ostjerusalem. Natürlich waren sich alle Palästinenser einig, dass solche Angriffe auf das palästinensische Gebiet zu verurteilen sind, weil sie so vielen Zivilpersonen Leid, Verwundungen, den Verlust von Hab und Gut, wenn nicht gar den Tod gebracht haben.
„Was meinst du dazu, als Deutscher, als Nichtmuslim?“ so wurde Achtnich gefragt. Er hatte damit gerechnet, dass er wieder einmal zu dieser leidvollen Frage Stellung nehmen sollte.
Ganz spontan kam ihm der Spendenaufruf in der jüdischen Gemeinde in den Sinn, den er erst vor wenigen Wochen gehört hatte. Die Geschichtsverfälschung hatte ihn geärgert.
"Ich bin mit euch weitgehend einer Meinung: der Einmarsch und die wiederholten Angriffe der Israelis im Gazastreifen, aber auch die Zerstörungen und Verhaftungen im Westjordanland, im Jordangraben und im Negev sind illegal, und die Tötung so vieler Zivilisten widerspricht allen Konventionen der Vereinten Nationen. Es ist ein Verbrechen, so viele Menschen einzusperren in diesem kleinen Streifen Land."
„Und was sagst du zu den zionistischen Siedlungen in Ostjerusalem und im Westjordanland?“
"Ich finde den Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Hebron skandalös. Ein großes Unrecht! Und die Enteignung von Häusern und Grundstücken in Ostjerusalem mag zwar formal korrekt sein. Denn die meisten Häuser sind ohne Genehmigung durch die israelischen Behörden gebaut. Aber das ist bei Häusern israelischer Eigentümer nicht anders. Die dürfen bleiben. Und doch ist diese Enteignung und die Vertreibung der palästinensischen Familien eine Schande für einen Staat, der sich demokratisch nennt. Und dass der jüdische Staat Israel einen großen Teil Palästinas widerrechtlich besetzt hält, dass Zionisten in der Nakba Hunderte oder Tausende von Dörfern zerstört und die Bewohner umgebracht oder vertrieben haben, ist doch ein Skandal. Alle Resolutionen der UNO, die Israel aufforderten, die Flüchtlinge heimkehren zu lassen oder zu entschädigen, wurden von Israel missachtet.“
Achtnich hatte das schon oft erwähnt. Aber die muslimischen Freunde wollten das halt immer wieder hören.
„Müssten die Zionisten und ihr Staat nicht bestraft werden?“
„Ich frage mich: Geht es euch um Gerechtigkeit oder geht es um Rache? Ich bin davon überzeugt, dass die Juden, die in der Nazi-Zeit verfolgt wurden und überlebten, und dass die Nachkommen der umgebrachten oder verfolgten Juden das Recht haben, im Frieden zu leben, im Land Abrahams und Isaaks. Aber auch die Palästinenser im Nahen Osten haben das Recht, in Frieden und Gerechtigkeit zu leben. Eine Zukunft für beide Völker setzt voraus, dass Israel eine
Sicherheitsgarantie für seine Existenz im Nahen Osten erhält, aber ebenso müssen die Palästinenser eine Sicherheitsgarantie für Freiheit, Gerechtigkeit und Unabhängigkeit in einem eigenen Staat bekommen. Früher glaubte ich noch, Juden und Palästinenser könnten miteinander in einem gemeinsamen Staat oder in einer Staatenunion leben, in Frieden und Gerechtigkeit. Diese Hoffnung habe ich leider aufgeben müssen. Aber wie soll dann die Zukunft der Menschen in diesem kleinen Land aussehen? Ich weiß es nicht!"
Die Muslime in Nürnberg fühlten sich verstanden. Harmonisch ging das Treffen zu Ende. Dr. Achtnich ging in Ruhe nach Hause. Ob er vom Verfassungsschutz oder anderen Geheimdiensten beobachtet wurde, beschäftigte ihn nicht weiter. Dass sein Briefverkehr und seine Kontakte im Internet überwacht wurden, war ihm schon lange bewusst. Ändern konnte er es nicht. Sicher hatten auch die Amerikaner ein gewisses Interesse an seinen Beziehungen zu Juden und Muslimen, vor allem im Nahen Osten.
6. Lektüre der nächsten Kapitel
Erst Wochen später konnte sich Matthias Achtnich wieder an die alte Handschrift machen. Er hatte sich inzwischen Lexika und Grammatiken besorgt, um den Text besser zu verstehen.
Es wurde ihm immer klarer, dass da tatsächlich ein unbekanntes Evangelium vor ihm lag, ein alter Text oder ein Bericht, der so verfasst wurde, als sei er ein altes Dokument. Wann der Text geschrieben wurde, ob es eine Abschrift war oder gar das Original, oder ob es eine gut gemachte Fälschung war, das konnte er natürlich nicht beurteilen.
Das Manuskript schien vollständig zu sein; denn nicht nur die Titelzeile, sondern auch die üblichen Grüße am Schluss waren mit dabei.
Am Anfang hieß es:
„Erinnerungen an Jeschua, wie es Junia Johanna, Jüngerin und Apostelin des Messias Jeschua aufgeschrieben hat, für Paulus, den Mitapostel.
Du hattest mich gebeten, lieber Bruder Paulus, für dich aufzuschreiben, was ich noch von dem weiß, was unser Freund und Rabbi Jeschua von Nazareth gesagt und getan hat, was wir mit ihm erlebt haben. Als wir damals in Antiochia in Syrien im Gefängnis waren mit Andronikus, unserem Freund und Mitbruder im Apostelamt, hatten wir viele Tage Zeit, darüber zu reden, was Jesus getan und gesagt hatte.
Als uns beiden klar wurde, wie wenig du von unserem Rabbi und Freund Jeschua wusstest, von seinem Leben und seiner Lehre, hast du mich gebeten, meine Erinnerungen aufzuschreiben.
Der Schluss lautete, wie es üblich war bei christlichen Briefen der frühen Zeit:
Mit meiner ungelenken Hand füge ich meinen Gruß an dich, lieber Bruder Saul, an. Ich danke meinem Bruder Epaphroditus, dass er so viel Geduld hatte, meinen Bericht schön zu schreiben. Der Friede von Jeschua, dem lebendigen Knecht Gottes, sei mit dir. Hallelujah!
Dr. Achtnich hatte den Eindruck, dass er einen vollständigen Text vor sich hatte. Doch er wusste immer noch nicht, wie alt das Manuskript war, ob es tatsächlich aus dem 1. Jahrhundert stammte, oder ob es viel später geschrieben wurde, so als sei es ein alter Text.
Der alte Lehrer beschäftigte sich weiter intensiv mit dem Manuskript und versuchte zu verstehen, was da gesagt oder angedeutet war.
Es war eine mühsame Arbeit, den ganzen Papyrus zu verstehen und zu übersetzen. Aber die Arbeit war spannend und begeisterte ihn immer mehr.
Dr. Achtnich konnte nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Denn er wollte auch Zeit haben für seine Frau und die große Familie. Jetzt war immer noch Garten einiges zu tun; die Enkelkinder kamen zu Besuch. Gemeindegruppen und die Volkshochschule baten um Vorträge über Israel und Palästina.
Dieses angebliche Evangelium faszinierte ihn und weckte in ihm Zweifel, weil es das Leben Jesu so nüchtern und sachlich darstellte, das Leben eines beeindruckenden Menschen, in manchen Aspekten anders, als er es kannte.
Junia berichtet von der Kindheit und Jugend Jesu, allerdings nicht aus eigener Anschauung, sondern davon, was andere ihr berichtet hatten.
Jeschua aus Nazareth war ein frommer Jude, von der Gruppe der Pharisäer. Er war geboren im 20. oder 21. Jahr des Kaisers Augustus, als Erstgeborener des Josef und seiner jungen Ehefrau Mirjam in Nazareth.
Es war nicht die Geburt eines Königssohnes in einem Palast, sondern die einsame Geburt eines Kindes, das von Anfang nicht zu den Reichen gehörte.
Manche behaupten jetzt, Jeschua sei in Bethlehem geboren, wie Dawid, der große König Gottes für Jisrael. Das ist eine schöne Legende. Ich aber weiß, dass er in Nazareth im Galil geboren ist; er hat sich immer als Galiläer gefühlt, solange er lebte; und immer wieder wurde er der Nazarener genannt, noch am Kreuz. Und sagte nicht einer der Männer, als er zu Jeschua geführt wurde und sein Jünger wurde: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen?“
Die Ersten, die den Eltern die üblichen Segenswünsche sagten, waren wohl arabische Beduinen, also Menschen, die wir für gottlose und unredliche Leute halten. Sie gehörten gar nicht zum Volk Jisrael, sondern waren Nachkommen Jismaels.
Es wird von ihnen erzählt, sie hätten eine göttliche Offenbarung gehabt. Sie hätten eine Stimme vom Himmel gehört: „Euch ist heute der Retter der Welt geboren, der wahre König Gottes, der Herr; er wird König sein in Zion, der Stadt Dawids.“
Ich habe große Zweifel, ob diese Geschichte so stimmt. Solche Legenden gibt es über viele angeblich oder tatsächlich bedeutende Männer.
„Retter der Welt“. Ich bin gewiss, dass Jeschua diesen Ehrentitel des römischen Kaisers für sich nie in Anspruch genommen hat. Vielleicht haben Freunde von ihm diesen Titel gewählt, um zu beschreiben, wie groß er ist, aber das war sicher erst später. Jeschua hat sich nie als König für Jisrael oder gar für die ganze Welt hat gesehen.
Und auch Mirjam, seine Mutter, hat diese Legende später nie erwähnt; offenbar hat sie nie etwas Ähnliches gedacht.
Jeschua war der Erstgeborene. Miriam und Josef hatten später noch weitere Kinder. Kennen wir nicht seine Brüder Jaakov, Juda, Schimon und Joses und seine Schwestern Ester und Sara? Zwei oder drei Kinder von Miriam und Josef sind gestorben, als sie nur wenige Tage oder Wochen alt waren. Das ist das Los aller Frauen, dass sie Kinder verlieren.
Ein Dogma von einer Jungfrauengeburt hat in dieser Darstellung keinen Platz. Leibliche Brüder und Schwestern von Jesus, also Kinder von Maria und Josef, werden erwähnt, ganz selbstverständlich. Der Bericht stellt auch klar, dass die Bezeichnung „Sohn Gottes“ ein Ehrentitel war und dass sie nichts, absolut nichts über seine Natur aussagen wollte.
Der alte Lehrer erinnerte sich an ein Gespräch mit einem muslimischen Imam. Da ging es auch um Jesus. „Das kann doch nicht sein, dass Gott einen Sohn hat. Das können wir doch nicht glauben. Erkläre mir einmal, was für dich Isa bedeutet!“ Dr. Achtnich hatte damals geantwortet: „Ich als Christ glaube, dass Jesus Mensch war, der erste Sohn von Maria und Josef. Aber, wie Paulus sagt: Gott hat ihn nach seinem Tod zu neuem Leben erweckt; und jetzt ist Jesus Mittler zwischen Gott und uns Menschen; deshalb kann ich Jesus auch anrufen.“ Der Muslim dachte lange über diese Antwort nach und meinte dann: „Jetzt verstehe ich, was du denkst und glaubst. Ich kann das nachvollziehen. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir von Muslime über Isa den Sohn der Maria sagen. Auch wenn wir glauben, dass Maryam Jungfrau war, als sie Isa gebar. Ich danke dir für deine Offenheit.“ Doch zurück zum Manuskript.
Als Knecht und Sohn Gottes wurde er zum Volk Jisrael gesandt, von Gott selbst. So war schon Dawid in den Gebeten Jisraels ein Sohn Gottes genannt worden; so wurde später Schlomoh Gottes Sohn genannt, als König in Jisrael, den Gott selbst erwählt und bestätigt hatte. Wurden nicht in Gebeten und Psalmen alle Kinder Jisraels Söhne und Töchter Gottes genannt.
Im Manuskript wird dann angedeutet, Jesus habe zunächst wie sein Vater als Bauhandwerker in Sepphoris gearbeitet. Der Vater war wohl noch nicht alt, als er starb. Junia erwähnt, man habe sich erzählt, Josef sei wohl als Galiläer verdächtig gewesen. Er sei nach Ägypten geflohen, um dort mit seiner Familie in Sicherheit zu sein. Spielte die Erzählung von der Flucht nach Ägypten darauf an? Später sei er vermutlich als angeblicher galiläischer Aufrührer getötet worden.
Jesus habe sich, so wird in dem Evangelium berichtet, eines Tages plötzlich von seiner Mutter verabschiedet.
Jeschua war sechzehn oder siebzehn Jahre alt, da trat er eines Abends vor seine Mutter Mirjam und seinen Bruder Jaakov. Er erhob seine Stimme und sprach: "Ich habe euch
etwas Wichtiges zu sagen: Ich werde euch und Nazareth verlassen, denn ich will Rabbi werden.“
Schweren Herzens, aber im Vertrauen auf den Ewigen ließ Mirjam ihren erstgeborenen Sohn ziehen. Jeschua verließ sie am nächsten Morgen, ganz in der Frühe. Miriam, die Witwe, war sehr traurig, als sie ihren ersten Sohn zum Abschied segnete. Sie hat ihn dann viele Jahre nicht gesehen.
Jeschua ging zunächst nach Jeruschalajim, um Schüler bei dem Rabbi Nikdemon zu werden. Fünf Jahre hörte er mit anderen Jüngern dem weisen, gütigen Rabbi zu. Immer besser verstand er Gottes heilige Worte in der Thora und in den Propheten. Er beschäftigte sich mit der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und mit der Erwartung des Gerichtes. Aber vor allem sprach Nikdemon über Gottes Gebote, die in der Thora gegeben sind.
Nikdemon erklärte: „Wie der Berg der Offenbarung geschützt werden sollte durch einen Zaun, als Mosche die Gebote empfing, so wird auch Gottes Wille geschützt durch zusätzliche Gebote und Verbote, durch die die Lehrer Israels einen Zaun errichten um die Gebote, die Gott selbst für alle Zeiten gegeben hat. So sollen die Menschen geschützt werden vor Gelegenheiten zur Sünde. So versuchen wir, Gottes heiligen Willen zu erfüllen und Gottes heiliges Volk zu sein“.
Ihr kennt das Gebot: „Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.“ Deshalb sage ich euch: ihr sollt überhaupt keine Frau anschauen, damit ihr nicht in Versuchung fallt.
Wenn zusätzlich zu den Geboten, die in der Bibel überliefert sind, noch weitere Gebote befolgt werden sollen, dann ist das Leben doch immer und überall reglementiert und unfrei. Und wer kennt denn alle Gebote? Wird das die
Aufgabe der Rabbiner sein, als Hirten oder Wachhunde über die unbedarfte Herde zu wachen?
Jeschua begegnete auch Rabbi Gamliel, der dich, lieber Paulus, dann später unterwiesen hat. Er sprach auch oft mit anderen Rabbinern und Schriftgelehrten. Er wurde ein strenger Pharisäer.
Wie einige andere fromme Juden zog er sich nach fünf Jahren in die Wüste am Toten Meer zurück. Dort lebten Männer und Frauen in der Einsamkeit, als Schwestern und Brüder vom gemeinsamen Leben in Qumran. Diese Frauen und Männer lebten abgesondert von der sündigen Welt, um in der Wüste noch besser Gottes Willen erkennen und tun zu können. In dieser Gemeinschaft wollte Jeschua Gott nahe sein und seinen Willen besser kennen.
Es wird ja bis heute darüber gerätselt, ob Jesus Kontakt zu den Essenern, zu der Gemeinschaft in Qumran am Toten Meer hatte. Offenbar kannte der Schreiber oder die Schreiberin dieses Manuskripts diese Vermutung und hielt sie für wahr. Das heißt aber nur, dass schon vor Jahrhunderten darüber geredet wurde, mehr nicht.
Er hatte auch erfahren: diese Gemeinschaft hatte die größte Bibliothek im jüdischen Land, größer noch als die Bibliothek des Tempels. Denn unsere Schriftgelehrten hatten viele Bücher und Schriftrollen aus der Bibliothek des Tempels in der Wüste in Sicherheit gebracht, als König Herodes, der Edomiter, den neuen Tempel bauen ließ. Und dort sind die Schriften geblieben, bis heute. Alle heiligen Schriften waren dort gesammelt und aufbewahrt: die Thora, die Propheten und die Schriften, in vielen Handschriften; dazu Gedanken heiliger Männer zu den alten
Schriften. In Qumran wurden aber auch viele nicht anerkannte Schriften von Propheten und Heiligen gesammelt. Und viele Sammlungen von Gebeten und Liedern waren in diesem Kloster zu finden. Ein unschätzbarer Reichtum der jüdischen Überlieferung war zusammengetragen, aber auch viele Schriften der griechischen Weisen, der Philosophen, die Gott gesucht hatten.
Jeschua war oft in der großen Bibliothek. Er las nicht nur in der Thora und den Schriften, sondern auch in den Büchern der Väter. Er durfte auch in den Büchern der Schriftgelehrten lesen, die sich von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer abgesondert hatten.
Jesus habe sich berufen gewusst, in die Gemeinschaft am Toten Meer zu gehen. Er wollte, so sagte er seinen Freunden, ganz nach den Geboten Gottes leben, wie sie überliefert wurden. Das lässt darauf schließen, dass er schon vorher lesen und schreiben konnte.
Junia deutet an, er habe in der kleinen Synagoge, einer Höhle in Nazareth, die heiligen Schriften studiert, schon in jungen Jahren. Eine richtige Synagoge, also ein Haus mit Gebetsraum und Mikweh, also mit einem Bad für die rituellen Waschungen, hat es damals in Nazareth nicht gegeben.





























