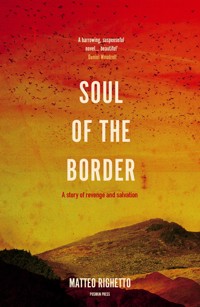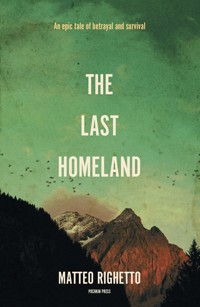5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großes Abenteuer in den Dolomiten und eine berührende Vater-Sohn-Geschichte
Seit dem Tod seiner Mutter vor zwei Jahren hat der zwölfjährige Domenico ein hartes Leben: Sein Vater, ein Tischler, ist schweigsam und ungesellig wie ein Luchs geworden und interessiert sich nicht einmal für die glänzenden schulischen Leistungen seines Sohnes. Dieser findet Trost nur in der Natur, an den Bächen und Wasserfällen der Dolomiten.
An einem Herbstmorgen im Jahr 1963 eröffnet Pietro, der Vater, seinem Sohn, dass er heute nicht zur Schule gehen soll: Sie werden für einige Tage in die Berge gehen - mit Proviant und zwei alten Gewehren. Im Laufe des mühevollen Aufstiegs erfährt der Junge, dass Pietro eine Wette eingegangen ist: Ausgerechnet er, der Außenseiter im Dorf, hat versprochen, den Bären zu erlegen, der in dieser Gegend seit einigen Wochen Bienenstöcke zermalmt, Hirsche und Rehe reißt. Auf ein solches Abenteuer hat Domenico schon lange gewartet. Dass es ihn an seine Grenzen führt, wird rasch deutlich. Zugleich spürt er im Laufe der abenteuerlichen Jagd eine wundersame Wandlung seines Vaters: Unter dessen rauer Schale bricht ein zugänglicherer, viel emotionaler Mensch hervor, als Domenico je für möglich gehalten hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Der 12-jährige Domenico lebt seit dem Tod seiner Mutter vor zwei Jahren alleine mit seinem Vater Pietro in den Dolomiten. Am liebsten fängt er Forellen an einem Wildbach. Beim Angeln vergisst er seinen Kummer, der vor allem daraus erwächst, dass sein Vater abweisend, kühl und wie verstummt ist. Pietro Sieff ist Tischler, bekommt aber kaum noch Aufträge, und es nützt Domenico wenig, dass er auf der Schule in Agordo, zu der er täglich mit dem Schulbus fährt, gut ist, die Lehrerin ihn fördert. Denn der Vater wird ihn nicht auf eine höhere Schule geben, sondern zeitig Geld verdienen lassen. Nachmittags muss Domenico ihm immer Holzscheite stapeln. Und dann ist da noch die hübsche Maria, die er auf den Busfahrten anhimmelt, die ihn aber gar nicht beachtet.
In dem Dorf am Fluss Codalonga haben sie jetzt ein neues Thema: ein furchterregender Bär, der Bienenkörbe zermalmt, Tiere reißt und von monströser Größe zu sein scheint. Sogar in der Schule reden sie davon. Der Bär ist auch das Thema in der Kneipe Posta, wo Pietro sich betrinkt. Jetzt ist es schon Oktober, man rätselt, ob der Bär in den Winterschlaf gehen werde, und überbietet sich an Schreckensgeschichten. Es wird Zeit, dass jemand ihn zur Strecke bringe, aber das traue sich niemand zu.
Ausgerechnet Pietro Sieff meldet sich. Er will den Bär zu Strecke bringen und geht dafür eine Wette ein.
Der Autor
Matteo Righetto, wurde 1972 geboren und lebt in Padua. Er ist Dozent für Literatur. »Das Fell des Bären« (Originaltitel: »La pelle dell’orse«) ist sein erster Roman, dem in Italien bereits zwei weitere folgten.
MATTEO RIGHETTO
Das
Fell
des
Bären
ROMAN
Aus dem Italienischen
von Bruno Genzler
BLESSING
Originaltitel: La pelle dell’orso
Originalverlag: Guanda Editore, Parma.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2013 by Matteo Righetto
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-21840-9V002
www.blessing-verlag.de
Für meine Töchter Maria und Lucia
Das ist heute nur einer von den
vielen Tagen, die noch kommen werden.
Aber das, was du heute tust, kann für die
kommenden Tage entscheidend sein.
Ernest Hemingway
Wem die Stunde schlägt
1
Vorsichtig strich Domenico sich mit der Handfläche über die rechte Wange. Er passte auf, dass er keinen Druck auf den Bluterguss ausübte, um den herum noch die Abdrücke kräftiger Finger zu sehen waren. Der Schmerz von gestern war heute nur noch ein lästiges Jucken. Das Schlimmste war also überstanden. Aber Gelegenheiten, sich weitere Ohrfeigen einzufangen, gab es genug. Damit musste er rechnen, ebenso wie mit der sehr viel ernsteren Gefahr, auf diesen entsetzlichen Bären zu stoßen, der jetzt in aller Munde und in ihrer Gegend schon so etwas wie ein Mythos geworden war. Doch vor dem hatte er keine Angst. Obwohl ihn alle davor warnten, sich allein zum Fluss aufzumachen, ließ Domenico sich dieses Vergnügen nicht nehmen.
Er hockte auf einem Felsblock aus hellem Gestein und ließ die Beine über das Wasser baumeln. In einer Hand hielt er einen Kanten Schwarzbrot, den er hin und wieder zum Mund führte, um davon abzubeißen, in der anderen seine Angel. Allerdings nicht so eine, wie man sie im Geschäft unten im Tal kaufen konnte, nein, es handelte sich um eine Birkenrute, an deren oberem Ende, gewissenhaft verknotet, eine Schnur befestigt war, mit einem alten, halb verrosteten Angelhaken daran. Einfach, aber äußerst wirkungsvoll. Immerhin hatte er es mit dieser behelfsmäßigen Konstruktion noch jedes Mal geschafft, einen Haufen Forellen aus dem Wasser zu ziehen.
Einige Meter unterhalb des mächtigen Felsblocks aus Dolomit, auf dem er saß, hatte sich der Fluss eine Ausbuchtung mit dunkelblauem Wasser gegraben, sehr tief und mindestens so groß wie eine Kuh auf der Weide. Ein idealer Lebensraum für die Forellen.
Eigentlich angelte Domenico nie zweimal an derselben Stelle, aber vor einiger Zeit hatte er herausgefunden, dass es hier von Fischen nur so wimmelte, sodass er sein Vergnügen bequemer haben konnte. Allerdings war es mit der Bequemlichkeit so eine Sache, wenn man mit dem Hintern auf einem scharfkantigen Felsen saß.
Auch heute versuchte der Junge sein Glück wieder an dieser Stelle. Und während er so dasaß und angelte, wiegte er sich in den immer gleichen Tagträumen: Er stellte sich vor, Großes zu schaffen, ein außergewöhnliches Leben zu führen, träumte davon, tausenderlei Abenteuer zu bestehen und Heldentaten zu vollbringen, die mit seinem täglichen Trott rein gar nichts zu tun hatten. Wie gern wäre er etwa dieser Tom Sawyer gewesen, von dem ihnen die Italienischlehrerin in der Schule schon häufiger erzählt hatte. Doch sobald er wieder auf dem Planeten Erde gelandet war, musste er sich eingestehen, dass die Aussichten auf ein richtiges Abenteuer in seinem Leben verschwindend gering waren.
Verdrossen biss er noch einmal von seinem Brotkanten ab. Eigentlich knabberte er nur, um länger davon zu haben. Dann warf er die Angelschnur mit der aufgespießten Kugel aus gelber Polenta am Haken aus und schaute sich um, als sehe er das alles, was er vor Augen hatte, zum ersten Mal.
2
Er liebte den Herbst, der die Wälder in leuchtende Gemälde verwandelte. Obwohl er einem Winter vorausging, der hoch in den Bergen kein Ende zu nehmen schien, war und blieb er seine liebste Jahreszeit.
Manche Herbsttage kamen Domenico geradezu überwältigend schön vor, und schon früher hatte er häufiger überlegt, dass dieses Himmelsblau und diese in alle möglichen Rot-, Braun- und Gelbtöne gekleideten Wälder nur Zauberei sein konnten, das Werk der mazaròl und salvanèl, jener Kobolde und Geister, die in den Bergen wohnten.
Einmal hatte er davon reden hören, dass es in den Städten im Tal ganz anders sei, dass es dort keinen Unterschied zwischen Herbst und Winter gebe, beide Jahreszeiten seien gleich grau und verregnet und versänken im Nebel, ein trauriges Bild, das er sich kaum vorstellen konnte.
Hier in den Bergen hingegen hatte jede Jahreszeit ihre besonderen Farben, jeder Monat seine eigenen Gerüche, jeder Tag einen anderen Himmel.
Domenico biss noch einmal von dem alten Brot ab, lockerte kauend ein klein wenig die Angelschnur, legte den Kanten zu Boden und strich sich die Haare zurück, die ihm in die Stirn gefallen waren. Für sein Alter war er recht klein und dünn, und sein glattes Haar erinnerte an Rabengefieder. Die Sommersprossen und Fältchen links und rechts der Augen hatte er von seiner Mutter geerbt. Sein Blick war wach und offen, und doch schien sich, der Mondscheibe bei Neumond ähnlich, dahinter in seinem Gesicht noch etwas anderes, etwas Geheimnisvolles und Melancholisches zu verbergen.
Er wünschte sich, schnell erwachsen zu werden. Und stark. Denn im Moment fühlte er sich fast noch wie ein Kind. Er war ja auch erst zwölf, wusste jedoch für sein Alter bereits sehr viel und war weit unabhängiger als irgendein Junge aus der Stadt. Er war aufgeweckt und pfiffig, zugleich schüchtern und in sich gekehrt. Er lernte eifrig, würde gern nach der Mittelstufe bis zum Abitur weiter die Schule besuchen, aber er ahnte schon, dass sein Vater ihm das niemals gestatten würde. Domenico liebte es, allein zu sein und seinen Gedanken nachzuhängen. Ja, er war ein Träumer, und oft reichte ein Windhauch, eine neue Wolkenformation am Himmel, ein Rascheln in den Blättern, um seine Fantasie in Gang zu setzen. Doch fehlte ihm auch manches, vor allem die Zuneigung von Menschen, die ihm nahestanden.
Der Junge betrachtete die Lärchen, Buchen und Eichen ringsum, die wie gemalt aussahen.
Er hob den Blick und erspähte weit, weit über sich, in Richtung der Gipfel der Averaugruppe, einen mächtigen Adler, der auf Nahrungssuche seine Kreise zog. Unwillkürlich lächelte der Junge und überlegte, dass die größten Tiere der Bergwelt eine ganz besondere Ausstrahlung besaßen, etwas Magisches, Feierliches wie die Pfingstprozession oder die gesungene Christmette am Weihnachtsabend. Adler, Wölfe, Hirsche, Bären. Diese Tiere wussten instinktiv, dass sie etwas Majestätisches hatten, das sie aus dem Kreis der anderen hervorhob. Einen Bären allerdings hatte er selbst noch nie gesehen, ganz zu schweigen von diesem Ungeheuer, von dem jetzt alle redeten.
3
An diesem Tag war er eine Stunde später als gewöhnlich aus der Schule heimgekehrt, weil der Bus, der die Strecke von Agordo bis Colle Santa Lucia hinauffuhr, einen Platten hatte.
Als er das Haus betrat, war sein Vater nicht da, und so hatte Domenico nur seine Mappe auf der hölzernen Ofenbank abgelegt und begonnen, einige seiner Pflichten zu erledigen. Denn so klar der Himmel auch war, wurde die Sonne jetzt mit jedem Tag träger, sodass ihm nicht mehr als eine Stunde für seinen Ausflug zum Fluss blieb.
Er wusch Kohl, schnippelte grüne Bohnen und weichte Graupen ein, um daraus am Abend eine Suppe zu kochen; er putzte die Schuhe, die sein Vater sonntags trug. Schließlich ging er in den kleinen Stall hinüber, um die Kuh zu striegeln und zu tränken. Sie hieß Isotta und diente vor allem dazu, den alten Holzkarren zu ziehen. Ein Auto oder auch nur ein Moped besaßen sie nicht.
Endlich konnte er seine Angelausrüstung zusammenpacken und sich eilig zum Ufer des Codalonga aufmachen.
Das Tosen des Wildwassers war laut und hatte doch etwas Sanftes und Beruhigendes.
Je näher er dem Fluss kam, der oben beim Monte Pore entsprang und einem anderen Wildwasser, dem Fiorentina, zuströmte, desto deutlicher spürte er dessen reißende Kraft.
Fast täglich suchte er diesen Ort auf, nur im Winter nicht, wenn alles hoch verschneit war, oder wenn sein Vater ihm Hausarrest verpasste oder befahl, sich im Stall oder auf dem Feld nützlich zu machen.
Nirgendwo fühlte Domenico sich so wohl wie am Wasser. Das Angeln bot ihm Gelegenheit, für sich zu sein, weit weg vom Zorn und den schwieligen, harten Händen seines Vaters Pietro. Dann warf er die Angelschnur aus, lauschte dem Rauschen des Flusses und ließ sich von den Bildern forttragen, die ihm durch den Kopf gingen und sein Herz bewegten. In diesen ersten Oktobertagen war das häufig die Erinnerung an seine Mutter, die zwei Jahre zuvor gestorben war, an ihren Duft, ihre Stimme. Oder sein schwieriges Verhältnis zum Vater. Seltener stellte er sich den Bären vor, von dem so viel gesprochen wurde. Schließlich war da noch Maria, das schönste Mädchen in Colle Santa Lucia, bei deren Anblick seine Herz jedes Mal einen Satz machte. Sie jedoch beachtete ihn nicht, vermutlich, weil er ein Jahr jünger war als sie.
Plötzlich spannte sich die Angelschnur, und Domenico schrak auf und begriff, dass eine Forelle angebissen hatte. Sogleich begann er, mit flüssigen, aber entschlossenen Bewegungen die Schnur langsam einzuholen, bis er den Haken aus dem Wasser und den Fisch an Land gezogen hatte. Es war eine schöne, große Forelle, die da an der Angel zappelte, die dritte an diesem 6. Oktober und wahrscheinlich die letzte. Die Dämmerung setzte ein, und es wurde Zeit, nach Hause zu gehen.
4
Bevor er diese letzte Forelle fing, auch bevor er den Adler erblickte und zum Flussufer lief, und sogar noch, bevor der Bus mit einen Platten zum Stehen gekommen war, hatte ihn die Italienischlehrerin Verben abgefragt.
Sie hatte alle Formen wissen wollen, die Konjunktive, das Konditional und selbst das Gerundium. Domenico beherrschte sie, bekam eine Eins und wurde mit einer Berührung seiner Lehrerin, die ihm über den Kopf strich, belohnt.
Während er auf seinen Platz zurückkehrte, hatte ein Klassenkamerad eine Hand vor den Mund gelegt und den anderen »dieser verdammte Streber« zugezischt. Domenico hatte das nicht weiter beachtet und war einfach weitergegangen, stolz und aufgewühlt, mehr noch wegen der Geste der Lehrerin als wegen der Note.
Diese Eins, das wusste er, interessierte niemanden, am allerwenigsten seinen Vater, einen Tischler, der kaum noch einen anständigen Auftrag erhielt, höchstens einmal den, ein simples Wandbrett aus Tannenholz zu schreinern. Scheinbar wartete Pietro nur darauf, dass sein Sohn vierzehn wurde, um ihn dann irgendwohin zum Arbeiten schicken zu können, damit er etwas Geld nach Hause brachte, das er dann im Wirtshaus Posta versaufen konnte.
Domenico erreichte seine Bank, setzte sich und schaute aus dem Fenster. Er erblickte die dunklen Wälder oberhalb von Agordo. Er dachte an seinen Vater und überlegte, wie sehr der sich seit Mamas Tod verändert hatte, wie hart er geworden war: nie eine Liebkosung, nie ein Lächeln oder ein aufmunterndes Wort, nur Zornausbrüche, Beschimpfungen, Ohrfeigen.
Als er sich wieder dem Unterricht zuwandte, stand die Lehrerin mit ausgebreiteten Armen da, als predige sie vor der Klasse, und sprach über die Bedürfnisse schutzloser, notleidender Menschen. Dazu gab sie einen Satz des neuen Papstes wider, der gerade erst im Sommer gewählt worden war. Sie sagte den Schülern auch, wie dieser Papst vorher geheißen hatte, obwohl das alle längst wussten. Der Priester wiederholte es in jeder Messe.
Anschließend erzählte sie ihnen begeistert von einem schwarzen Amerikaner, der vor einigen Wochen vor vielen tausend Menschen eine wichtige Rede gehalten und davon gesprochen habe, dass er einen großen Traum habe.
»Ich habe einen Traum! Ich habe einen Traum!«, rief die Lehrerin zweimal mit einem seltsamen Glanz in den Augen.
Auch Domenico hatte einen Traum: sich mit Maria anzufreunden und sie zum Fluss mitzunehmen, mit ihr in den Bergen zu klettern und bei Sonnenuntergang die enrosadira, die Rosafärbung der höchsten Dolomitengipfel, zu bewundern, ihr dabei in die Augen zu schauen, ihr langes, blondes Haar zu berühren, ihren Atem in seinem Gesicht zu spüren und ihre kühle Haut zu streicheln. An all das dachte er, als eine Frage ihn jäh aus seinen Tagträumen riss. Luigino aus Caprile, ein Junge mit rötlichem Haar, so struppig wie vor Wochen geerntetes Heu, stellte sie:
»Haben Sie eigentlich Angst vor dem Bären, Frau Lehrerin?«
Obwohl sie jung und noch recht unerfahren war, hätte die Lehrerin eigentlich auf solch unpassende, für Schüler dieses Alters jedoch typische Einwürfe gefasst sein müssen. Aber der gedankliche Sprung von Paul VI. und Martin Luther King zu einem wilden Tier überforderte sie.
»Angst vor dem Bären?!«, fragte sie mit großen Augen zurück.
»Ja, vor diesem Riesenbären, der hier bei uns in der Gegend gesehen wurde«, sagte Luigino mit einer Stimme, in der Ungeduld mitschwang.
Schlagartig kam Bewegung in die Klasse, als wären die Kinder plötzlich aus einer langen, lähmenden Trägheit erwacht.
»Genau!«, rief jetzt Giovanni Agostini, der aufgesprungen und im Gesicht purpurrot angelaufen war, »jeder, der ihn gesehen hat, erzählt, was für ein schreckliches Ungeheuer dieser Bär ist.«
Filippo Pallùa hob den Arm und schnippte mit den Fingern, um die Lehrerin auf sich aufmerksam zu machen, und verkündete, bevor ihm das Wort erteilt wurde: »Mein Opa sagt, dass der Bär direkt aus der Hölle kommt. Das Tier ist ein Teufel, sagt er.«
»Jetzt mal der Reihe nach, Kinder. Von was für einem Bären redet ihr denn da?«, fragte die Lehrerin.
Die Klasse verfiel in ungläubiges Schweigen.
»Wissen Sie das wirklich nicht?«, rief Pino schließlich, »von dem reden doch jetzt alle. Dieser Bär macht seit ein paar Wochen unsere Dörfer unsicher. In Cencenighe erzählen sie, dass sie so ein mächtiges Tier noch nie gesehen haben.«
»In Rucavà hat er einen Stall zertrümmert und zwei Kühe gerissen!«, warf Sandrino ein, ohne auch nur einmal Luft zu holen.
Bald war die allgemeine Erregung derart groß, dass die Lehrerin, wie zum Zeichen der Aufgabe, das Klassenbuch zuklappte und den Füllfederhalter aufs Pult legte.
»Und bei uns hat er alle Bienenstöcke zerstört und ist in viele Ställe eingebrochen und hat das Vieh getötet«, berichtete jetzt Gino, Domenicos Banknachbar, der aus demselben Dorf wie er kam. »Das stimmt doch, Menego, oder?«, suchte er dessen Bestätigung, indem er ihn mit dem Ellbogen anstieß.
Domenico öffnete langsam den Mund, und nachdem er begriffen hatte, dass alle ihn wartend anschauten, wandte er der Lehrerin den Blick zu und sagte; »Ja, das stimmt. Manche haben ihn ja flüchtig gesehen und sagen, dass er ein wahres Ungeheuer ist, ein Dämon, riesengroß, mit Narben am ganzen Leib und Augen so rot wie Feuer. Manche haben ihn auch nur gehört und sagen, dass sie zu Tode erschrocken waren, weil sich sein Brüllen so schauderhaft anhört, als käme es direkt aus der Hölle … Aber ich weiß nicht, ob ich das alles glauben soll.«
5
Mit einem alten Klappmesser schnitt Domenico den Forellen der Länge nach den Bauch auf, entfernte die Eingeweide und säuberte die Fische gründlich im eiskalten Flusswasser. Er warf sie zurück in den Eimer, den er von zu Hause mitgebracht hatte, und machte sich auf den Heimweg, über die schmale Schotterstraße, die von der Senke des Codalonga hinauf nach Posalz führte, einem höher gelegenen Teil des Dorfes Colle Santa Lucia. An dieser Stelle bot sich ein weiter Blick über das Fiorentina-Tal.
Tatsächlich bestand Posalz nur aus einigen wenigen Häusern, die meist einen winzigen Hühnerstall besaßen, einen kleinen Kuhstall und eine große Scheune. Die Bewohner fuhren gewöhnlich auf Holzwagen, die von einem Rind oder einem Maultier gezogen wurden, so wie auch Pietro Sieff und sein Sohn, die bei Bedarf ihre Kuh Isotta einspannen konnten. Meistens aber gingen die Menschen zu Fuß, auch wenn sie mehrmals am Tag nach Colle hinunter und dann wieder hinauf nach Posalz mussten.