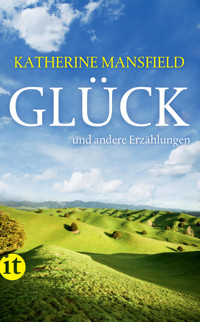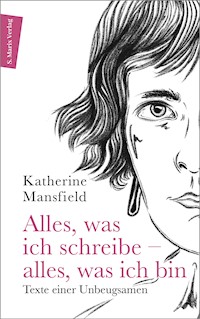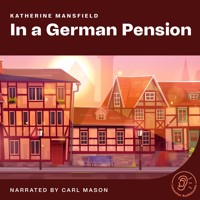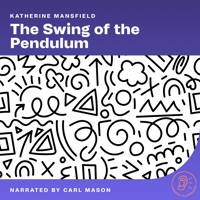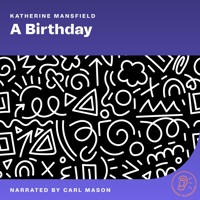1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In "Das Gartenfest und andere Geschichten" präsentiert Katherine Mansfield eine kunstvolle Sammlung von Erzählungen, die sich durch ihren impressionistischen Stil und die subtile Erkundung menschlicher Emotionen auszeichnen. Die Geschichten sind in einer Welt des frühen 20. Jahrhunderts verwurzelt und zeichnen sich durch eine präzise, oft poetische Sprache aus, die das Innere ihrer Protagonisten mit herausragender Sensibilität einfängt. Mansfield beleuchtet die Zerbrechlichkeit der menschlichen Beziehungen und die bittersüßen Nuancen des Alltagslebens, wobei sie den Leser in intime Momente zwischen den Charakteren zieht und dabei das Gefühl von Vergänglichkeit und die Traurigkeit des Unausgesprochenen einfängt. Katherine Mansfield, eine der bedeutendsten Stimmen der Moderne, war eine neuseeländische Schriftstellerin, die in London lebte und arbeitete. Ihre eigenen Erfahrungen, insbesondere in Bezug auf soziale Konventionen und das weibliche Leben, finden sich in ihren Werken wieder. Mansfield war oft in künstlerischen Kreisen aktiv und pflegte enge Beziehungen zu anderen Literaten, darunter Virginia Woolf, was ihr literarisches Schaffen und ihren Stil maßgeblich beeinflusste. "Das Gartenfest und andere Geschichten" ist nicht nur eine Einladung in die dichterische Welt von Mansfield, sondern auch eine tiefgründige Untersuchung der menschlichen Psyche und der Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen. Dieses Buch ist für Leser geeignet, die an feinsinnigen Charakterstudien und melancholischen Reflexionen über das Leben interessiert sind. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Gartenfest und andere Geschichten
Inhaltsverzeichnis
An der Bucht
I
Sehr früher Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und die gesamte Crescent Bay war unter einer weißen Meeresgischt verborgen. Die großen, mit Buschwerk bewachsenen Hügel im Hintergrund waren verschluckt. Man konnte nicht sehen, wo sie endeten und die Pferdekoppeln und Bungalows begannen. Die Sandstraße war verschwunden und die Koppeln und Bungalows auf der anderen Seite; es gab keine weißen Dünen mit rötlichem Gras dahinter; es gab keine Markierungen, die anzeigten, wo der Strand war und wo das Meer. Es hatte stark getaut. Das Gras war blau. Große Tropfen hingen an den Büschen und fielen einfach nicht; die silbrigen, flauschigen Toi-Toi hingen schlaff an ihren langen Stielen, und alle Ringelblumen und Nelken in den Bungalowgärten waren vor Nässe zur Erde gebeugt. Durchnässt waren die kalten Fuchsien, runde Perlen aus Tau lagen auf den flachen Kapuzinerkresseblättern. Es sah aus, als hätte sich das Meer in der Dunkelheit sanft gebäumt, als wäre eine riesige Welle gekommen und hätte gekräuselt, gekräuselt – wie weit? Wenn du mitten in der Nacht aufgewacht wärst, hättest du vielleicht einen großen Fisch sehen können, der ans Fenster klopfte und wieder verschwand ...
Ah-Aah! tönte das schläfrige Meer. Und aus dem Busch kam das Geräusch von kleinen Bächen, die schnell und leicht zwischen den glatten Steinen flossen, in farnbewachsene Becken strömten und wieder heraus; und da war das Plätschern großer Tropfen auf großen Blättern, und noch etwas anderes – was war es? – ein leises Rühren und Schütteln, das Knacken eines Zweigs und dann eine solche Stille, dass es schien, als würde jemand zuhören.
Um die Ecke der Crescent Bay, zwischen den aufgetürmten Massen von zerbrochenem Gestein, kam eine Schafherde getrippelt. Sie waren eng aneinander gekuschelt, eine kleine, sich hin- und herwälzende, wollige Masse, und ihre dünnen, staksigen Beine trabten schnell voran, als hätten sie Angst vor der Kälte und der Stille. Hinter ihnen lief ein alter Schäferhund mit nassen, sandbedeckten Pfoten und der Nase am Boden entlang, aber achtlos, als würde er an etwas anderes denken. Und dann erschien der Schäfer selbst in der felsigen Einfahrt. Er war ein hagerer, aufrechter alter Mann in einem Friesenmantel, der mit einem Netz aus winzigen Tropfen bedeckt war, mit Samthosen, die unter dem Knie gebunden waren, und einer hellwachen Mütze mit einem gefalteten blauen Taschentuch um den Rand. Eine Hand steckte in seinem Gürtel, die andere umfasste einen wunderschön glatten gelben Stock. Und während er ging und sich Zeit ließ, pfiff er leise vor sich hin, ein luftiges, fernes Flöten, das traurig und zärtlich klang. Der alte Hund vollführte ein oder zwei uralte Kapriolen, zog sich dann aber schamhaft zusammen und ging ein paar würdevolle Schritte an der Seite seines Herrn. Die Schafe rannten in kleinen, trippelnden Sprüngen vorwärts; sie begannen zu blöken, und gespenstische Herden antworteten ihnen aus dem Meer. „Mäh! Mäh!“ Eine Zeit lang schienen sie sich immer auf demselben Stück Boden aufzuhalten. Vor ihnen erstreckte sich die sandige Straße mit flachen Pfützen; auf beiden Seiten zeigten sich die gleichen durchnässten Büsche und die gleichen schattigen Zäune. Dann kam etwas Riesiges in Sicht; ein riesiger, struppiger Riese mit ausgestreckten Armen. Es war der große Gummibaum vor Frau Stubbs' Laden, und als sie vorbeikamen, roch es stark nach Eukalyptus. Und jetzt schimmerten große Lichtflecken im Nebel. Der Schäfer hörte auf zu pfeifen, rieb sich die rote Nase und den nassen Bart am nassen Ärmel und blickte mit zusammengekniffenen Augen in Richtung Meer. Die Sonne ging auf. Es war erstaunlich, wie schnell der Nebel dünner wurde, davonraste, sich von der flachen Ebene löste, sich vom Busch aufrollte und verschwunden war, als hätte er es eilig zu entkommen; große Windungen und Locken drängten und schoben sich gegenseitig, als die silbernen Strahlen breiter wurden. Der ferne Himmel – ein helles, reines Blau – wurde in den Pfützen vor Augen geführt, und die Tropfen, die an den Telegrafenmasten entlang schwammen, blitzten zu Lichtpunkten auf. Jetzt war das springende, glitzernde Meer so hell, dass es in den Augen schmerzte, es anzusehen. Der Schäfer zog eine Pfeife, deren Kopf so klein wie eine Eichel war, aus seiner Brusttasche, kramte nach einem Stück gesprenkeltem Tabak, schnitzte ein paar Späne ab und stopfte die Pfeife. Er war ein ernster, gut aussehender alter Mann. Als er sich anzündete und der blaue Rauch seinen Kopf umhüllte, schaute der Hund zu und sah stolz auf ihn.
„Mäh! Mäh!“ Die Schafe breiteten sich fächerförmig aus. Sie waren gerade erst aus der Sommerkolonie heraus, bevor sich der erste Schläfer umdrehte und seinen schläfrigen Kopf hob; ihr Schrei ertönte in den Träumen kleiner Kinder ... die ihre Arme hoben, um die süßen kleinen wolligen Lämmer des Schlafes herunterzuziehen und zu kuscheln. Dann tauchte der erste Bewohner auf: Es war die Katze der Burnells, Florrie, die wie immer viel zu früh auf dem Torpfosten saß und nach ihrem Milchmädchen Ausschau hielt. Als sie den alten Schäferhund sah, sprang sie schnell auf, krümmte den Rücken, zog den getigerten Kopf ein und schien ein wenig vornehm zu erschaudern. „Ugh! Was für ein grobes, abstoßendes Wesen!“, sagte Florrie. Aber der alte Schäferhund, der nicht aufblickte, wedelte an ihr vorbei und schwang seine Beine von einer Seite zur anderen. Nur eines seiner Ohren zuckte, um zu beweisen, dass er sie sah und für ein dummes junges Weibchen hielt.
Die morgendliche Brise wehte durch das Buschwerk und der Geruch von Blättern und nasser schwarzer Erde vermischte sich mit dem scharfen Geruch des Meeres. Myriaden von Vögeln sangen. Ein Stieglitz flog über den Kopf des Hirten und setzte sich auf die Spitze einer Palme, wo er sich der Sonne zuwandte und seine kleinen Brustfedern aufplusterte. Und nun waren sie an der Fischerhütte vorbeigekommen, an dem verkohlten kleinen Haus, in dem Leila, das Milchmädchen, mit ihrer alten Großmutter lebte. Die Schafe streiften über einen gelben Sumpf, und Wag, der Schäferhund, trottete hinterher, trieb sie zusammen und führte sie zu dem steileren, schmaleren Felspass, der aus der Crescent Bay heraus und in Richtung Daylight Cove führte. „Mäh! Mäh!“, ertönte der Ruf schwach, als sie die schnell trocknende Straße entlang schaukelten. Der Schäfer steckte seine Pfeife in die Brusttasche, sodass die kleine Schale heraushing. Und sofort begann das leise, luftige Pfeifen wieder. Wag lief auf einem Felsvorsprung etwas hinterher, das roch, und rannte angewidert wieder zurück. Dann drängten, schubsten und eilten die Schafe um die Kurve, und der Hirte folgte ihnen außer Sichtweite.
II
Ein paar Augenblicke später öffnete sich die Hintertür eines der Bungalows, und eine Gestalt in einem breit gestreiften Badeanzug stürzte über die Koppel, überwand den Zaun, eilte durch das Gras in die Mulde, kletterte den sandigen Hügel hinauf und rannte um sein Leben über die großen porösen Steine, über die kalten, nassen Kieselsteine, weiter auf den harten Sand, der wie Öl glänzte. Plitsch-Platsch! Plitsch-Platsch! Das Wasser sprudelte um seine Beine, als Stanley Burnell jubelnd hinauswatete. Wie immer der erste Mann im Ziel! Er hatte sie wieder alle geschlagen. Und er schwirrte hinunter, um seinen Kopf und Nacken unterzutauchen.
„Heil dir, Bruder! Heil dir, Du Mächtiger!“ Eine samtige Bassstimme dröhnte über das Wasser.
Heiliger Strohsack! Verdammt noch mal! Stanley blickte auf und sah einen dunklen Kopf weit draußen auf und ab bewegen und einen Arm heben. Es war Jonathan Trout – dort vor ihm! „Herrlicher Morgen!“, sang die Stimme.
„Ja, sehr gut!“, sagte Stanley kurz. Warum zum Teufel blieb der Kerl nicht in seinem Teil des Meeres? Warum musste er ausgerechnet hier auftauchen? Stanley gab einen Tritt, einen Ausfallschritt und schlug mit ausgestrecktem Arm zu. Aber Jonathan war ihm ebenbürtig. Er kam hoch, sein schwarzes Haar lag glatt auf seiner Stirn, sein kurzer Bart war glatt.
„Ich hatte letzte Nacht einen außergewöhnlichen Traum!“, rief er.
Was war nur mit dem Mann los? Diese Manie, sich unterhalten zu müssen, irritierte Stanley ungemein. Und es war immer dasselbe – immer irgendein Geschwätz über einen Traum, den er gehabt hatte, oder irgendeine verrückte Idee, die ihm gekommen war, oder irgendein Unsinn, den er gelesen hatte. Stanley drehte sich auf den Rücken und strampelte mit den Beinen, bis er ein lebender Wasserwirbel war. Aber selbst dann ... „Ich träumte, ich hänge über einer unglaublich hohen Klippe und schreie zu jemandem unten.“ Das würdest du auch! dachte Stanley. Er konnte nicht mehr ertragen. Er hörte auf zu planschen. „Schau mal, Trout“, sagte er, „ich bin heute Morgen ziemlich in Eile.“
„Was sagst du da?“ Jonathan war so überrascht – oder tat zumindest so –, dass er unter Wasser sank und dann wieder auftauchte und prustete.
„Ich will damit nur sagen“, sagte Stanley, „ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich will das hinter mich bringen. Ich bin in Eile. Ich muss heute Morgen arbeiten – verstehst du?“
Jonathan war schon weg, bevor Stanley fertig war. „Pass auf, mein Freund!“, sagte die Bassstimme sanft, und er glitt durch das Wasser, ohne dass es zu Wellen kam ... Aber verflucht sei der Kerl! Er hatte Stanley das Baden verdorben. Was für ein unpraktischer Idiot der Mann war! Stanley schwamm wieder aufs Meer hinaus und dann genauso schnell wieder hinein, und eilte den Strand hinauf. Er fühlte sich betrogen.
Jonathan blieb noch ein wenig im Wasser. Er ließ sich treiben, bewegte seine Hände sanft wie Flügel und ließ sich von der See wiegen. Es war seltsam, aber trotz allem mochte er Stanley Burnell. Zwar hatte er manchmal den teuflischen Wunsch, ihn zu ärgern, sich über ihn lustig zu machen, aber im Grunde tat ihm der Kerl leid. Es war etwas Erbärmliches in seiner Entschlossenheit, aus allem eine Aufgabe zu machen. Man konnte nicht umhin zu glauben, dass er eines Tages ertappt werden würde, und dann würde er einen gewaltigen Sturz erleiden! In diesem Moment hob eine riesige Welle Jonathan an, ritt an ihm vorbei und brach mit einem fröhlichen Geräusch am Strand. Was für eine Schönheit! Und jetzt kam eine weitere. So sollte man leben – sorglos, rücksichtslos, sich selbst verausgabend. Er stand auf und begann, zum Ufer zu waten, wobei er seine Zehen in den festen, faltigen Sand drückte. Die Dinge ruhig angehen lassen, nicht gegen das Auf und Ab des Lebens ankämpfen, sondern sich ihm hingeben – das war es, was nötig war. Es war diese Anspannung, die völlig falsch war. Leben – leben! Und der perfekte Morgen, so frisch und schön, im Licht badend, als würde er über seine eigene Schönheit lachen, schien zu flüstern: „Warum nicht?“
Aber jetzt, wo er aus dem Wasser kam, wurde Jonathan vor Kälte ganz blau. Er hatte überall Schmerzen; es war, als würde jemand das Blut aus ihm herauspressen. Und als er zitternd und mit angespannten Muskeln den Strand hinaufstapfte, spürte auch er, dass sein Bad verdorben war. Er war zu lange im Wasser geblieben.
III
Beryl war allein im Wohnzimmer, als Stanley in einem blauen Serge-Anzug, mit steifem Kragen und einer gepunkteten Krawatte erschien. Er sah fast unheimlich sauber und gebürstet aus; er wollte den Tag in der Stadt verbringen. Er ließ sich in seinen Stuhl fallen, holte seine Uhr heraus und legte sie neben seinen Teller.
„Ich habe nur fünfundzwanzig Minuten Zeit“, sagte er. „Könntest du nachsehen, ob der Haferbrei fertig ist, Beryl?“
„Mutter ist gerade losgegangen, um ihn zu holen“, sagte Beryl. Sie setzte sich an den Tisch und schenkte ihm Tee ein.
„Danke!“ Stanley nahm einen Schluck. „Hallo!“, sagte er mit erstaunter Stimme, „du hast den Zucker vergessen.“
„O, sorry!“ Aber selbst dann half Beryl ihm nicht; sie schob das Becken herüber. Was bedeutete das? Als Stanley sich selbst half, weiteten sich seine blauen Augen; sie schienen zu zittern. Er warf seiner Schwägerin einen kurzen Blick zu und lehnte sich zurück.
„Alles in Ordnung?“, fragte er achtlos und fingerte an seinem Kragen herum.
Beryls Kopf war gesenkt; sie drehte ihren Teller in den Fingern.
„Nichts“, sagte sie mit leiser Stimme. Dann blickte auch sie auf und lächelte Stanley an. „Warum sollte es etwas geben?“
„O! Meines Wissens nach gibt es überhaupt keinen Grund. Ich dachte, du schienst mir eher ...“
In diesem Moment öffnete sich die Tür und die drei kleinen Mädchen erschienen, jeweils mit einem Teller Haferbrei in der Hand. Sie waren alle gleich gekleidet, in blaue Pullover und Höschen; ihre braunen Beine waren nackt und jedes hatte seine Haare zu einem sogenannten Pferdeschwanz geflochten und hochgesteckt. Hinter ihnen kam Frau Fairfield mit dem Tablett.
„Vorsichtig, Kinder“, ermahnte sie sie. Aber sie waren sehr vorsichtig. Sie liebten es, Dinge tragen zu dürfen. „Habt ihr eurem Vater schon “Guten Morgen„ gesagt?“
„Ja, Oma.“ Sie setzten sich auf die Bank gegenüber von Stanley und Beryl.
„Guten Morgen, Stanley!“ Die alte Frau Fairfield gab ihm seinen Teller.
„Morgen, Mutter! Wie geht es dem Jungen?“
„Hervorragend! Er ist letzte Nacht nur einmal aufgewacht. Was für ein perfekter Morgen!“ Die alte Frau hielt inne, ihre Hand auf dem Brotlaib, und blickte aus der offenen Tür in den Garten. Das Meer rauschte. Durch das weit geöffnete Fenster strömte die Sonne auf die gelb gestrichenen Wände und den blanken Boden. Alles auf dem Tisch blitzte und glitzerte. In der Mitte stand eine alte Salatschüssel, die mit gelben und roten Kapuzinerkressen gefüllt war. Sie lächelte, und ein Ausdruck tiefer Zufriedenheit leuchtete in ihren Augen.
„Könntest du mir vielleicht eine Scheibe Brot abschneiden, Mutter?“, sagte Stanley. „Ich habe nur zwölfeinhalb Minuten, bevor der Bus kommt. Hat jemand dem Dienstmädchen meine Schuhe gegeben?“
„Ja, sie liegen bereit für dich.“ Frau Fairfield war ganz gelassen.
„Oh, Kezia! Warum bist du nur so ein unordentliches Kind!“, rief Beryl verzweifelt.
„Ich, Tante Beryl?“ Kezia starrte sie an. Was hatte sie jetzt wieder angestellt? Sie hatte nur einen Fluss in der Mitte ihres Breis gegraben, ihn gefüllt und aß nun die Ufer auf. Aber das tat sie jeden Morgen, und bisher hatte niemand etwas gesagt.
„Warum könnt ihr euer Essen nicht richtig essen wie Isabel und Lottie?“ Wie unfair Erwachsene doch sind!
„Aber Lottie macht immer eine schwimmende Insel, oder, Lottie?“
„Ich nicht“, sagte Isabel schlau. „Ich streue einfach Zucker darüber, gieße Milch darüber und esse es auf. Nur Babys spielen mit ihrem Essen.“
Stanley schob seinen Stuhl zurück und stand auf.
„Würdest du mir bitte diese Schuhe bringen, Mutter? Und Beryl, wenn du fertig bist, gehst du bitte zum Tor und hältst die Kutsche an. Lauf zu deiner Mutter, Isabel, und frag sie, wo meine Melone hingelegt wurde. Moment mal – habt ihr Kinder mit meinem Stock gespielt?“
„Nein, Vater!“
„Aber ich habe ihn hier hingelegt.“ Stanley begann zu toben. „Ich erinnere mich genau, dass ich ihn in diese Ecke gelegt habe. Wer hat ihn jetzt? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Seht genau hin! Der Stock muss gefunden werden.“
Sogar Alice, das Dienstmädchen, wurde in die Suche mit einbezogen. „Du hast ihn doch nicht etwa benutzt, um das Feuer in der Küche damit anzufachen?“
Stanley stürmte ins Schlafzimmer, wo Linda lag. „Das ist wirklich außergewöhnlich. Ich kann nicht einmal einen einzigen Gegenstand für mich behalten. Jetzt haben sie auch noch meinen Stock mitgenommen!“
„Stock, Schatz? Welcher Stock?“ Lindas Unbestimmtheit bei diesen Gelegenheiten konnte nicht echt sein, entschied Stanley. Würde niemand mit ihm Mitleid haben?
„Trainer! Trainer, Stanley!“, rief Beryls Stimme vom Tor aus.
Stanley winkte Linda mit dem Arm zu. „Keine Zeit, um auf Wiedersehen zu sagen!“, rief er. Und das meinte er als Strafe für sie.
Er schnappte sich seinen Bowler, stürmte aus dem Haus und rannte den Gartenweg hinunter. Ja, der Trainer wartete dort und Beryl beugte sich über das offene Tor und lachte jemanden an, als wäre nichts geschehen. Die Herzlosigkeit der Frauen! Die Art und Weise, wie sie es als selbstverständlich ansahen, dass es deine Aufgabe war, für sie zu schuften, während sie sich nicht einmal die Mühe machten, nach deinem Gehstock zu sehen, ob er noch da war. Kelly ließ die Peitsche über die Pferde gleiten.
„Auf Wiedersehen, Stanley“, rief Beryl liebenswürdig und fröhlich. Es war einfach, sich zu verabschieden! Und da stand sie, untätig, und hielt sich die Hand vor die Augen. Das Schlimmste war, dass Stanley sich auch verabschieden musste, um des Anscheins willen. Dann sah er, wie sie sich umdrehte, einen kleinen Sprung machte und zum Haus zurücklief. Sie war froh, ihn los zu sein!
Ja, sie war dankbar. Sie rannte ins Wohnzimmer und rief: „Er ist weg!“ Linda rief aus ihrem Zimmer: „Beryl! Ist Stanley weg?“ Die alte Frau Fairfield erschien und trug den Jungen in seinem kleinen Flanellhemd.
„Weg?“
„Weg!“
Oh, welche Erleichterung, was für einen Unterschied es machte, den Mann aus dem Haus zu haben. Ihre Stimmen hatten sich verändert, als sie einander zuriefen; sie klangen warm und liebevoll und als ob sie ein Geheimnis teilten. Beryl ging zum Tisch hinüber. „Trink noch eine Tasse Tee, Mutter. Er ist noch heiß.“ Sie wollte irgendwie die Tatsache feiern, dass sie jetzt tun konnten, was sie wollten. Es gab keinen Mann, der sie stören konnte; der ganze perfekte Tag gehörte ihnen.
„Nein, danke, Kind“, sagte die alte Frau Fairfield, aber die Art und Weise, wie sie den Jungen in diesem Moment hochhob und „a-goos-a-goos-a-ga!“ zu ihm sagte, bedeutete, dass sie genauso fühlte. Die kleinen Mädchen rannten wie Hühner, die aus dem Stall gelassen werden, auf die Koppel.
Sogar Alice, das Dienstmädchen, das in der Küche das Geschirr spülte, steckte sich an und benutzte das kostbare Wasser aus dem Tank auf vollkommen rücksichtslose Weise.
„Oh, diese Männer!“, sagte sie und tauchte die Teekanne in die Schüssel und hielt sie unter Wasser, auch nachdem sie aufgehört hatte zu sprudeln, als wäre auch sie ein Mann und Ertrinken zu gut für sie.
IV
„Warte auf mich, Isabel! Kezia, warte auf mich!“
Da war die arme kleine Lottie, die wieder zurückgelassen wurde, weil sie es so furchtbar schwer fand, allein über den Zaun zu klettern. Als sie auf der ersten Stufe stand, begannen ihre Knie zu zittern; sie hielt sich am Pfosten fest. Dann musste man ein Bein darüber setzen. Aber welches Bein? Sie konnte sich nie entscheiden. Und als sie es schließlich mit einer Art Verzweiflungsstampfen schaffte, ein Bein über den Zaun zu bekommen, war das Gefühl schrecklich. Sie war noch halb auf der Koppel und halb im Gras. Sie klammerte sich verzweifelt an den Pfosten und hob ihre Stimme. „Wartet auf mich!“
„Nein, warte nicht auf sie, Kezia!“, sagte Isabel. „Sie ist so ein kleines Dummerchen. Sie macht immer so viel Aufhebens. Komm schon!“ Und sie zerrte an Kezias Trikot. „Du kannst meinen Eimer benutzen, wenn du mitkommst“, sagte sie freundlich. „Er ist größer als deiner.“ Aber Kezia konnte Lottie nicht allein lassen. Sie rannte zu ihr zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Lottie sehr rot im Gesicht und atmete schwer.
„Hier, stell deinen anderen Fuß rüber“, sagte Kezia.
„Wohin?“
Lottie schaute von oben herab auf Kezia.
„Hier, wo meine Hand ist.“ Kezia tätschelte die Stelle.
„O, da meinst du also!“ Lottie seufzte tief und setzte den zweiten Fuß darüber.
„Jetzt dreh dich irgendwie um und setz dich und rutsche“, sagte Kezia.
„Aber es gibt nichts, worauf wir uns setzen können, Kezia“, sagte Lottie.
Schließlich schaffte sie es, und als sie drüben war, schüttelte sie sich und begann zu strahlen.
„Ich werde immer besser darin, über Zäune zu klettern, nicht wahr, Kezia?“
Lottie war sehr hoffnungsvoll.
Die rosa und die blaue Sonnenmütze folgten Isabels leuchtend roter Sonnenmütze den rutschigen Hügel hinauf. Oben angekommen, hielten sie inne, um zu entscheiden, wohin sie gehen wollten, und um einen Blick auf die zu werfen, die bereits dort waren. Von hinten gesehen, vor der Skyline stehend und hauptsächlich mit ihren Spaten gestikulierend, sahen sie aus wie winzige, verwirrte Entdecker.
Die ganze Familie von Samuel Josephs war bereits da, zusammen mit ihrer Hilfe, die auf einem Campingstuhl saß und mit einer Pfeife, die sie um den Hals trug, für Ordnung sorgte, sowie mit einem kleinen Stock, mit dem sie die Einsätze leitete. Die Samuel Josephs spielten nie allein oder leiteten ihr eigenes Spiel. Wenn sie es taten, endete es damit, dass die Jungen den Mädchen Wasser über den Hals gossen oder die Mädchen versuchten, kleine schwarze Krabben in die Taschen der Jungen zu stecken. Also entwarfen Frau S. J. und die arme „Hilfe“ jeden Morgen ein sogenanntes „Brogramm“, um sie „vor Missbrauch und Unfug zu bewahren“. Es gab nur Wettbewerbe, Rennen oder Rundenspiele. Alles begann mit einem durchdringenden Pfiff der „Hilfe“ und endete mit einem weiteren. Es gab sogar Preise – große, ziemlich schmutzige Papierpakete, die die „Hilfe“ mit einem säuerlichen Lächeln aus einem prall gefüllten Bastelset zog. Die Samuel Josephs kämpften ängstlich um die Preise und betrogen und zwickten sich gegenseitig in die Arme – sie waren alle Meister im Zwicken. Das einzige Mal, dass die Burnell-Kinder jemals mit ihnen spielten, hatte Kezia einen Preis bekommen, und als sie drei Zettelchen aufmachte, fand sie einen sehr kleinen rostigen Knopfhaken. Sie konnte nicht verstehen, warum sie so ein Aufhebens machten ...
Aber sie spielten nie mehr mit den Samuel Josephs oder gingen zu ihren Partys. Die Samuel Josephs gaben immer Kinderpartys in der Bucht und es gab immer das gleiche Essen. Ein großes Waschbecken mit sehr braunem Obstsalat, in vier Teile geschnittene Brötchen und ein Waschkrug voller etwas, das die Hilfe „Limmonadear“ nannte. Und abends ging man weg, mit halb abgerissenem Rüschenbesatz am Kleid oder mit etwas, das über die Vorderseite der durchbrochenen Schürze verschüttet worden war, und ließ die Samuel Josephs wie Wilde auf ihrem Rasen springen. Nein! Sie waren zu schrecklich.
Auf der anderen Seite des Strandes, nahe am Wasser, funkelten zwei kleine Jungen mit hochgekrempelten Hosenbeinen wie Spinnen. Der eine grub, der andere watete im Wasser und füllte einen kleinen Eimer. Es waren die Trout-Jungen Pip und Rags. Aber Pip war so sehr mit Graben beschäftigt und Rags mit Hilfe leisten, dass sie ihre kleinen Cousins erst sahen, als sie schon ganz nah waren.
„Schaut mal!“, sagte Pip. „Schaut mal, was ich entdeckt habe.“ Und er zeigte ihnen einen alten, nassen, zerquetscht aussehenden Stiefel. Die drei kleinen Mädchen starrten ihn an.
„Was hast du damit vor?“, fragte Kezia.
„Behalten, natürlich!“ Pip war sehr spöttisch. „Das ist ein Fundstück – siehst du?“
Ja, das sah Kezia. Trotzdem...
„Im Sand sind viele Dinge vergraben“, erklärte Pip. „Sie werden von Wracks aufgewirbelt. Schätze. Warum – du könntest finden ...“
„Aber warum muss Rags immer wieder Wasser nachgießen?“, fragte Lottie.
„O, das ist, um es zu befeuchten“, sagte Pip, „damit die Arbeit etwas leichter wird. Mach weiter so, Rags.“
Und der brave kleine Rags lief auf und ab und goss das Wasser ein, das braun wie Kakao wurde.
„Hier, soll ich dir zeigen, was ich gestern gefunden habe?“, sagte Pip geheimnisvoll und steckte seinen Spaten in den Sand. „Versprecht, es nicht zu verraten.“
Sie versprachen es.
„Versprochen, Hand aufs Herz.“
Die kleinen Mädchen sagten es.
Pip holte etwas aus seiner Tasche, rieb es lange auf der Vorderseite seines Trikots, hauchte es dann an und rieb es wieder.
„Jetzt dreht euch um!“, befahl er.
Sie drehten sich um.
„Alle schauen in die gleiche Richtung! Stillhalten! Jetzt!“
Und seine Hand öffnete sich; er hielt etwas ins Licht, das aufblitzte, das blinkte, das ein wunderschönes Grün hatte.
„Das ist ein Nemeral“, sagte Pip feierlich.
„Wirklich, Pip?“ Sogar Isabel war beeindruckt.
Das schöne grüne Ding schien in Pips Fingern zu tanzen. Tante Beryl hatte einen Nemeral in einem Ring, aber er war sehr klein. Dieser war so groß wie ein Stern und viel schöner.
V
Als der Morgen länger wurde, tauchten ganze Gruppen über den Sandhügeln auf und kamen zum Baden an den Strand. Es war üblich, dass die Frauen und Kinder der Sommerkolonie ab elf Uhr das Meer für sich allein hatten. Zuerst zogen sich die Frauen aus, zogen ihre Badekleider an und bedeckten ihre Köpfe mit hässlichen Kappen, die aussahen wie Schwammtaschen; dann wurden die Kinder ausgezogen. Der Strand war übersät mit kleinen Haufen von Kleidern und Schuhen; die großen Sommerhüte, mit Steinen beschwert, damit sie nicht weggeweht wurden, sahen aus wie riesige Muscheln. Es war seltsam, dass sogar das Meer anders zu klingen schien, wenn all diese springenden, lachenden Gestalten in die Wellen rannten. Die alte Frau Fairfield, in einem fliederfarbenen Baumwollkleid und mit einem schwarzen, unter dem Kinn zusammengebundenen Hut, versammelte ihre kleine Schar und machte sie fertig. Die kleinen Trout-Jungen zogen sich ihre Hemden über den Kopf, und schon sausten die fünf los, während ihre Oma mit einer Hand in ihrer Strickjacke saß und bereit war, den Wollknäuel herauszuholen, sobald sie sicher war, dass sie in Sicherheit waren.
Die festen, kompakten kleinen Mädchen waren nicht halb so mutig wie die zarten, zart aussehenden kleinen Jungen. Pip und Rags, die zitterten, sich hockten und sich das Wasser abklatschten, zögerten nie. Aber Isabel, die zwölf Züge schwimmen konnte, und Kezia, die fast acht Züge schwimmen konnte, folgten nur unter der strengen Bedingung, dass sie nicht nass gespritzt wurden. Lottie folgte überhaupt nicht. Sie ließ sich gerne gewähren und ging ihren eigenen Weg. Und dieser Weg bestand darin, sich mit gestreckten Beinen und zusammengepressten Knien an den Rand des Wassers zu setzen und mit den Armen vage Bewegungen zu machen, als würde sie erwarten, aufs Meer hinausgetrieben zu werden. Aber als eine größere Welle als sonst, eine alte, bärtige, auf sie zukam, sprang sie mit entsetztem Gesicht auf und floh wieder den Strand hinauf.
„Hier, Mutter, bewahre die für mich auf, ja?“
Zwei Ringe und eine dünne Goldkette fielen in den Schoß von Frau Fairfield.
„Ja, Liebes. Aber willst du nicht hier baden?“
„Nein-nein“, antwortete Beryl mit gedehnter Stimme. Sie klang vage. „Ich ziehe mich weiter unten aus. Ich werde mit Frau Harry Kember baden.“
„Sehr wohl.“ Aber Frau Fairfield verzog die Lippen. Sie missbilligte Frau Harry Kember. Beryl wusste das.
Arme alte Mutter, lächelte sie, während sie über die Steine glitt. Arme alte Mutter! Alt! Oh, was für eine Freude, was für ein Glück es war, jung zu sein ...
„Du siehst sehr zufrieden aus“, sagte Frau Harry Kember. Sie saß zusammengekauert auf den Steinen, die Arme um die Knie geschlungen, und rauchte.
„Was für ein schöner Tag“, sagte Beryl und lächelte zu ihr hinunter.
„Oh je!“ Frau Harry Kembers Stimme klang, als wüsste sie es besser. Aber ihre Stimme klang immer so, als wüsste sie etwas besser über dich als du selbst. Sie war eine lange, seltsam aussehende Frau mit schmalen Händen und Füßen. Auch ihr Gesicht war lang und schmal und sah erschöpft aus; selbst ihr heller, gekräuselter Pony sah ausgebrannt und verwelkt aus. Sie war die einzige Frau in Bay, die rauchte, und sie rauchte ununterbrochen, hielt die Zigarette zwischen den Lippen, während sie redete, und nahm sie erst heraus, wenn die Asche so lang war, dass man nicht verstehen konnte, warum sie nicht herunterfiel. Wenn sie nicht gerade Bridge spielte – sie spielte jeden Tag ihres Lebens Bridge –, verbrachte sie ihre Zeit damit, in der prallen Sonne zu liegen. Sie konnte jede Menge davon vertragen; sie hatte nie genug. Trotzdem schien sie nicht zu frieren. Ausgetrocknet, verwelkt, kalt lag sie ausgestreckt auf den Steinen wie ein Stück Treibholz. Die Frauen in der Bay hielten sie für sehr, sehr schnell. Ihre Uneitelkeit, ihr Slang, die Art, wie sie Männer behandelte, als wäre sie einer von ihnen, und die Tatsache, dass sie sich nicht die Bohne um ihr Haus kümmerte und die Bedienstete Gladys „Glänzende Augen“ nannte, war eine Schande. Von der Veranda aus rief Frau Kember mit ihrer gleichgültigen, müden Stimme: „Ach, Glänzende Augen, könntest du mir ein Taschentuch reichen, wenn ich eins habe, ja?“ Und Glänzende Augen, mit einer roten Schleife im Haar statt einer Mütze und weißen Schuhen, kam mit einem frechen Lächeln angerannt. Es war ein absoluter Skandal! Es stimmt, sie hatte keine Kinder und ihr Ehemann ... Hier wurden die Stimmen immer lauter und leidenschaftlicher. Wie konnte er sie nur heiraten? Wie konnte er nur, wie konnte er nur? Es muss natürlich am Geld gelegen haben, aber selbst dann!
Der Ehemann von Frau Kember war mindestens zehn Jahre jünger als sie und so unglaublich gutaussehend, dass er eher wie eine Maske oder die perfekte Illustration in einem amerikanischen Roman aussah als wie ein Mann. Schwarzes Haar, dunkelblaue Augen, rote Lippen, ein langsames, schläfriges Lächeln, ein guter Tennisspieler, ein perfekter Tänzer und dabei ein Rätsel. Harry Kember war wie ein Mann, der im Schlaf geht. Männer konnten ihn nicht ausstehen, sie brachten kein Wort aus ihm heraus; er ignorierte seine Frau genauso wie sie ihn. Wie lebte er? Natürlich gab es Geschichten, aber was für Geschichten! Sie konnten einfach nicht erzählt werden. Die Frauen, mit denen er gesehen worden war, die Orte, an denen er gesehen worden war ... aber nichts war jemals sicher, nichts war definitiv. Einige der Frauen in der Bay dachten insgeheim, dass er eines Tages einen Mord begehen würde. Ja, selbst als sie mit Frau Kember sprachen und das schreckliche Gebräu sahen, das sie trug, sahen sie sie, ausgestreckt, wie sie am Strand lag; aber kalt, blutig und immer noch mit einer Zigarette im Mundwinkel.
Frau Kember stand auf, gähnte, öffnete ihre Gürtelschnalle und zupfte an dem Band ihrer Bluse. Und Beryl streifte ihren Rock und ihr Trikot ab, stand in ihrem kurzen weißen Petticoat und ihrem Leibchen mit Schleifen an den Schultern auf.
„Ach du meine Güte“, sagte Frau Harry Kember, „was für eine kleine Schönheit du doch bist!“
„Nicht!“, sagte Beryl leise, aber als sie einen Strumpf und dann den anderen auszog, fühlte sie sich ein wenig schön.
„Meine Liebe – warum nicht?“, sagte Frau Harry Kember und stampfte auf ihren eigenen Petticoat. Wirklich – ihre Unterwäsche! Ein Paar blaue Baumwollunterhosen und ein Leinenmieder, das irgendwie an einen Kissenbezug erinnerte ... „Und du trägst keine Mieder, oder?“ Sie berührte Beryls Taille, und Beryl zuckte mit einem kleinen affektierten Schrei zurück. Dann sagte sie entschieden: „Niemals!“
„Glückliches kleines Geschöpf“, seufzte Frau Kember und öffnete ihren eigenen.
Beryl drehte ihr den Rücken zu und begann mit den komplizierten Bewegungen einer Person, die versucht, sich auszuziehen und gleichzeitig ihr Badeanzug anzuziehen.
„Ach, meine Liebe, lass dich nicht stören“, sagte Frau Harry Kember. „Warum schüchtern sein? Ich werde dich schon nicht auffressen. Ich werde nicht so schockiert sein wie diese anderen Dummchen.“ Und sie lachte auf eine seltsame, wiehernde Art und verzog das Gesicht zu den anderen Frauen hin.
Aber Beryl war schüchtern. Sie zog sich nie vor anderen aus. War das albern? Frau Harry Kember gab ihr das Gefühl, dass es albern war, ja sogar etwas, wofür man sich schämen musste. Warum sollte man schüchtern sein? Sie warf ihrer Freundin einen kurzen Blick zu, die so kühn in ihrem zerrissenen Hemd stand und sich eine neue Zigarette anzündete; und ein schnelles, kühnes, böses Gefühl stieg in ihrer Brust auf. Sie zog sich lachend das schlaffe, sich sandig anfühlende Badeanzug an, der noch nicht ganz trocken war, und befestigte die verdrehten Knöpfe.
„So ist es besser“, sagte Frau Harry Kember. Sie gingen gemeinsam den Strand entlang. „Es ist wirklich eine Sünde, dass du Kleidung trägst, meine Liebe. Irgendwann muss dir das mal jemand sagen.“
Das Wasser war ziemlich warm. Es hatte dieses wunderbare transparente Blau, das mit Silber gesprenkelt war, aber der Sand am Boden sah golden aus; wenn man mit den Zehen strampelte, stieg eine kleine Wolke aus Goldstaub auf. Jetzt erreichten die Wellen gerade ihre Brust. Beryl stand da, die Arme ausgestreckt, und schaute hinaus, und bei jeder Welle machte sie einen kleinen Sprung, so dass es schien, als wäre es die Welle, die sie so sanft anhob.