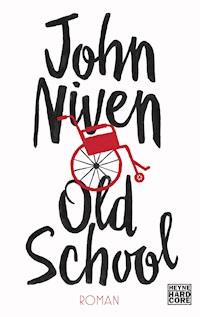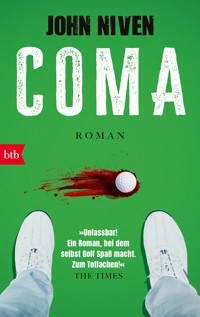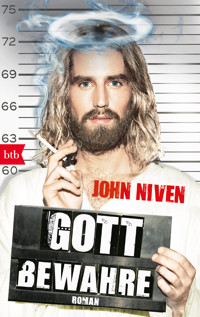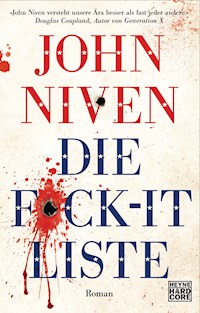2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die kalte Hand des Bösen
Die meisten Menschen können ihre Rachefantasien kontrollieren. Aber es gibt einige, bei denen die Gier nach Rache grenzenlos ist. Einen solchen Fall erzählt John Niven in »Das Gebot der Rache«. Mit seinem neuen aufsehenerregenden Roman beweist der Kultautor seine Meisterschaft auch im Bereich des schonungslosen Thrillers und nimmt den Leser mit auf eine Reise, die er nie wieder vergessen wird.
Donald Miller führt ein Leben, von dem man nur träumen kann. Mit seiner wohlhabenden Frau Sammy und seinem kleinen Sohn Walt bewohnt er ein luxuriöses Anwesen in der kanadischen Provinz. Donald kennt keine Geldsorgen, er liebt seine Familie, er ist umgeben von netten Leuten. Doch mit einem Schlag zerbricht diese heile Welt ... Als er seinen abgeschlachteten Hund findet, ahnt Donald, dass etwas in sein Leben getreten ist, das ihn für immer zeichnen wird. Seine bösen Vorahnungen werden schnell zur bitteren Wahrheit. Während eines Schneesturms wird Sammy entführt. Kurz darauf findet man ihren brutal zugerichteten Leichnam. Mit der Präzision eines Uhrwerks zieht sich eine namenlose Bedrohung um Donald zusammen: Er gerät zusammen mit seinem Sohn in die Gewalt eines Feindes, der scheinbar jede Menschlichkeit hinter sich gelassen hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
JOHN NIVEN
Aus dem Englischenvon Stephan Glietsch
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelCOLD HANDSbei William Heinemann, Random House, London
Copyright © 2012 by John NivenCopyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHRedaktion: Thomas BrillSatz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN: 978-3-641-09742-4www.heyne-hardcore.de
Für Linda, meine Schwester.Eine wahre Frau.
»Hätt’ ich auch deine Brüder hier, ihr LebenUnd deines wär’ nicht Rache mir genug.Ja, grüb’ ich deiner Ahnen Gräber aufUnd hängt’ in Ketten auf die faulen Särge,Mir gäb’s nicht Ruh’ noch Lind’rung meiner Wut.«
Heinrich der VI., 3. Teil
Prolog
Coldwater, Florida, Gegenwart
Es ist warm hier in Coldwater.
Wenn man, wie die meisten von uns Schotten, Schottland und England als eigenständige Nationen betrachtet, habe ich bisher in vier verschiedenen Ländern gelebt. Aber hier ist es zum ersten Mal warm. Die Wärme soll gut sein für das, was von meinem Bein noch übrig ist.
Florida ist eine einzige lange Einkaufsmeile: endlose Straßen, gesäumt von riesigen Parkplätzen, gerahmt von Schnellrestaurants und Drogerien, die mit ihren Gängen voller Zahnbürsten, Wänden aus Shampoo-Flaschen und unzähligen Mundwassersorten größer sind als selbst die größten Supermärkte an den Orten meiner Kindheit. Alle hundert Meter grinst ein Colonel Sanders oder Ronald McDonald auf einen herab. Nicht gerade der Ort, den ich mir einst zum Leben erträumt habe. Aber als ich vor etwas über einem Jahr hier ankam, war mir das ziemlich egal.
Meine Psychologin Dr. Tan ist der Meinung, es würde mir vielleicht ganz guttun, alles niederzuschreiben – jetzt, wo sich das Ganze bald zum zweiten Mal jährt. Ich müsste es ja niemandem zeigen, sondern nur zu Papier bringen.
Sie hofft, es würde mir dabei helfen, »bestimmte Abschnitte« zu rekonstruieren, an denen ich bei unseren Sitzungen arbeiten wollte. »Immerhin«, sagte sie, »waren Sie ja mal Autor, nicht wahr?« Dieser Satz rang mir ein schiefes Lächeln ab.
Ich sitze am Schreibtisch des kleinen Büros, das ich mir im Erdgeschoss eingerichtet habe. Eigentlich komme ich nur zum Lesen hierher. Das Haus ist im Kolonialstil gehalten. Es ist lichtdurchflutet und geräumig, die Möbel sind überwiegend aus hellem Eichenholz. Aus meinem Fenster blicke ich in den üppigen Garten und auf den kleinen, ovalen Pool. Ich kann die Azaleen und das Meer riechen. Cora, die Haushälterin, kommt jeden Tag, um zu kochen und aufzuräumen. Sie ist schwarz, klein, drahtig und immer gut gelaunt.
Ich schreibe mit einem Füllfederhalter, da meine rechte Hand beim Tippen immer noch zu sehr schmerzt. Sie ist von einer monströsen Narbe entstellt, die rot wird, wenn ich eine Faust balle, und sich langsam weiß färbt, wenn ich sie wieder öffne. Ich bin erst dreiundvierzig, fühle mich aber so alt, wie ich aussehe. Als hätte ich tatsächlich zwei Leben gleichzeitig geführt. Mein Haar ist an den Schläfen von grauen Strähnen durchzogen. Meine Tränensäcke verkünden meinen Schlafmangel so anschaulich, dass ich es fast als Kompliment begreife, wenn wieder mal ein Taxifahrer sagt, ich sähe müde aus. Aufgrund der mangelnden Bewegung habe ich in den letzten zwei Jahren an Bauch und Hüfte kräftig zugelegt. Als ich mich neulich in der Badewanne nach dem Wasserhahn streckte, war ich von der Anstrengung ganz kurzatmig.
Dr. Tan sagte zwar, ich bräuchte es niemandem zu zeigen, aber für irgendwen muss ich es doch schreiben. Man schreibt immer für irgendwen. Für wen schreibe ich also? Wer ist mein idealer Leser? Walt? Sammy? Craig Docherty vielleicht? Seltsamerweise habe ich das Gefühl, es ist für sie. Für Gill. Weil ich es ihr schulde. Doch wo fange ich an? Was war das auslösende Ereignis? (Voller Wehmut erinnere ich mich an die Leitfäden zum Drehbuchschreiben – Raymond G. Frensham, Syd Field, Denny Flinn – und die Widmungen darin: »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Donnie. In Liebe, S xXx PS: Du schaffst das!« Relikte aus besseren Tagen.) Vermutlich wäre Schottland ein guter Ausgangspunkt. Aber den ganz großen Schritt, all diese Jahre zurückzublicken, wage ich momentan einfach noch nicht. Besser, ich fange mit jenen Ereignissen an, die zu dieser Nacht führten. Was dann wohl hieße, mit dem Hund zu beginnen.
Genau. Beginnen wir mit dem Hund.
1
Saskatchewan, Kanada, zwei Jahre zuvor
»Daddy, ich kann Herby nicht finden.«
Mit einer dampfenden Kaffeetasse stand ich auf der Terrasse vor unserem Haus. Ich steckte das Handy zurück in die Tasche und drehte mich nach Walt um, der seine Augen mit erhobener Hand gegen die vom Schnee reflektierte, gleißende Sonne schützte. Er trug seine mit Pelz abgesetzte, beigefarbene Daunenjacke. Auf seinem blauen Ralph-Lauren-Schal leuchtete ein kleiner, gestickter Teddybär. Seine Handschuhe baumelten von seinen Ärmeln wie Gehängte – Geisterfäustchen, im Novemberwind pendelnde Wiedergänger seiner kleinen Hände. Walts dichter teefarbener Pony fiel ihm in die Augen. Mein Sohn, der bald neun Jahre alt werden sollte, hat Gott sei Dank das Haar seiner Mutter geerbt, fein und seidig, von Natur aus anmutig gescheitelt. Nicht die trockene schottische Stahlwolle wie auf dem Kopf seines Vaters. Nur die Farbe ist ein Amalgam aus meiner – schwarz wie verbrannter Toast – und dem Honigblond seiner Mutter.
»Er wird schon irgendwo in der Nähe sein, Walt«, sagte ich. Der Schnee knirschte wie Styropor unter meinen Stiefeln, als ich auf ihn zuging. »Vermutlich ist er bei einem der Nachbarn.«
Womit ich alles andere als aufrichtig war, denn ich hatte sowohl die Franklins als auch Irene Kramer angerufen. Herby, unser karamellfarbener Labrador, war definitiv bei keinem von ihnen. Ich war keineswegs so optimistisch, wie ich Walt glauben machen wollte. Obwohl Herby schon früher bei verschiedenen Gelegenheiten davongelaufen war (»Saskatchewan ist so flach«, witzelten die Einheimischen, »wenn einem der Hund wegläuft, kann man ihm tagelang dabei zusehen«) und durchaus die Möglichkeit bestand, dass er sich irgendwo auf dem zwei Hektar großen Grundstück herumtrieb, war er noch nie zu dieser Jahreszeit verschwunden. Der kanadische Winter war noch nicht angebrochen – die Temperatur lag knapp über dem Gefrierpunkt –, aber die Wettervorhersage ließ für die kommenden Wochen das Schlimmste befürchten. Schon bald erwarteten uns die ersten Minusgrade, und wenn mit Einbruch des richtigen Winters die Blizzards kamen, konnte die Temperatur sogar bis auf fünfzehn oder zwanzig Grad unter null fallen.
»Das hat Mommy auch gesagt«, sagte Walt. Hinter ihm konnte ich durch die Glastür sehen, wie Sammy in der großen Küche ihre Kaffeetasse ausspülte, penibel wie immer. »Aber was ist, wenn …?«
Der entscheidende Grund für Sammy, das Haus genau hier zu bauen, war die Aussicht von der Terrasse gewesen: Von der Hügelkuppe aus blickte man hinunter ins Tal und in der Ferne auf den Lake Ire, einen silbrig glitzernden Spiegel mit einem Rahmen aus Pinien. Das Franklin-Anwesen und Irenes Haus befanden sich anderthalb Meilen zur Rechten. Das alte Farmhaus der Bennets, unserer nächsten Nachbarn, lag eine halbe Meile links von uns.
Doch weit und breit war kein Hund zu erkennen. Wenn ich jetzt zurückdenke, versucht meine Erinnerung, dem Bild etwas hinzuzufügen: schwarze Schatten am Himmel, Krähen, die am Ende unserer Wiese, in der Nähe der Tamora Road, der Hauptroute in die Stadt, über etwas kreisen. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ich das damals wirklich gesehen habe.
Ich bugsierte Walt durch die gläserne Schiebetür in der Fensterfront entlang der riesigen Küche zurück ins Warme, wo uns heimeliger Frühstücksduft empfing: Es roch nach Toast, Kaffee und Haferflocken, von denen Sammy gerade eine Schüssel leerte, während sie zu dem kleinen Flachbildfernseher über der Kochinsel in der Mitte des Raumes hinaufblickte. Sie hockte an einer Ecke des Tisches aus unbehandeltem Eichenholz, die Beine an den Knöcheln übereinandergeschlagen. Sammy war zwar drei Jahre älter als ich, sah aber um einiges jünger aus, was ich gerne meinen elenden schottischen Genen zuschrieb. Mir ist wohl bewusst, dass man vor allem dann sein Erbgut verantwortlich macht – Klischee oder nicht –, wenn man die Schuld eigentlich bei sich selbst sucht. Sammy war keine Schönheit im klassischen Sinne und konnte einem ohne zu zögern ihre vermeintlichen größten Makel aufzählen: Sie hatte vorstehende Zähne, ein Merkmal, das sie rührend zu verbergen versuchte, indem sie die Hand vor den Mund hielt, wenn sie – was sie häufig tat – spontan lachen musste. Da waren leichte Spuren von Akne-Narben und die verästelten Furchen auf ihrer Stirn, wenn sie sich konzentrierte oder ärgerte. Mit gut einsachtzig war sie sogar ein paar Zentimeter größer als ich und empfand sich als schlaksig. Als Teenager hatte sie, um das zu kaschieren, eine leicht gekrümmte, vornübergebeugte Haltung entwickelt, in die sie immer noch gelegentlich verfiel. Früher war sie eine leidenschaftliche Sportlerin gewesen – in der Schule hatte sie Netball und Lacrosse gespielt – und sah auch jetzt noch athletisch-burschikos aus. Beim Tennis im Urlaub, im Klub von Alarbus oder auf dem Platz ihrer Eltern war ich für sie kein ernst zu nehmender Gegner: Elegant ging sie in Position, hielt kurz inne, bevor sie zum Schlag ausholte, und scheuchte mich dann mit ihrem Topspin die Grundlinie entlang, bis ich schließlich erschöpft aufgab.
An diesem Morgen in der Küche glänzten ihre Lippen vom Honig auf ihren Haferflocken. Das Haar hatte sie zu einem kurzen Pferdeschwanz zurückgebunden. Sie trug einen dunkelgrauen Wollanzug zu einem schwarzen Pullover mit V-Ausschnitt – ein Ensemble vom peppigeren Teil ihrer Businessgarderobe. Ich besaß keine Geschäftskleidung. Mein Arbeitsplatz war unser Zuhause, wo ich mich in Bademantel oder Freizeitklamotten vor dem Fernseher oder dem Laptop hinlümmelte.
»Hör dir dieses verlogene Arschloch an«, sagte Sammy und nickte Richtung Bildschirm, wo gerade irgendein Politiker interviewt wurde.
»Mommy hat geflucht.« Walts Bemerkung war eine reine Feststellung, völlig wertfrei.
»Du siehst gut aus. Hast du ein Meeting heute?«
»Ein Geschäftsessen mit Anzeigenkunden. Scheißnervig.«
»Schon wieder«, kommentierte Walt.
»Hast du was rausgefunden?«, fragte Sammy mit gerunzelter Stirn. Sie hatte mein Telefonat auf der Terrasse beobachtet. Ich schüttelte den Kopf.
»Was rausgefunden?«, fragte Walt.
»Brauchen wir noch irgendwas?« Ich ignorierte Walt und öffnete den Kühlschrank, eine mannshohe Kühl-Gefrier-Kombination mit glänzenden Türen aus gebürstetem Edelstahl. »Ich fahre heute Nachmittag in die Stadt. Ich dachte, ich kaufe etwas Fisch, besorg was fürs Abendessen und …«
»Wir haben noch Entenbrust«, sagte Sammy, während sie den Mantel überzog. »Und im Schrank ist noch Wildreis. Wär doch ganz lecker.« Sammy, ganz die Herausgeberin, immer alles im Blick.
»Was rausgefunden?«, fragte Walt erneut.
»Haben sie im Wetterbericht gesagt, ob die Straßen frei sind?«
»Alles bestens. Du und deine übertriebene Sorge, Donnie.«
Sie hatte recht. Fünfzehn Jahre lebte ich nun schon hier, und es machte mich immer noch fassungslos, dass die Kanadier bei einem Wetter Auto fuhren, das in Großbritannien die Armee mobilisiert hätte.
»Was denn rausgefunden?«, fragte Walt zum dritten Mal.
»Gar nichts! Himmel, Walt, wenn …« Ich versuchte, mich zu beherrschen. »Hör mal, vielleicht ist Herby ja irgendwo im Haus und hält ein kleines Nickerchen. Ich seh mich noch mal um, wenn du in der Schule bist, okay?«
»Er wird schon wieder auftauchen, Schatz«, beruhigte ihn Sammy. »Komm her …« Die Autoschlüssel in der Hand, kniete sie sich hin, um ihn zu umarmen.
»Genau«, sagte ich und erwiderte hinter Walts Rücken ihren besorgten Blick.
»Also gut, Männer. Ich sehe euch dann heute Abend«, sagte Sammy und stand auf. »Und denk dran, Donnie. Wir brauchen die Kritik heute Mittag.«
»Geht klar, Chefin.«
Sie gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange und flüsterte dabei: »Überprüf die Nebengebäude und ruf bitte noch mal alle Nachbarn an, ja?«
Ich nickte, drehte mich zu Walt und klatschte in die Hände. »Dann mal los, Soldat. Auf in den Kampf, sonst verpassen wir noch den Bus.«
Rückblickend erscheint mir gerade das Alltägliche dieses Morgens – wir drei in der Küche, mit unseren kleinen Abschiedsritualen, Instruktionen für den Tag, halb verspeisten Buttertoasts – als das pure Glück.
2
Walt und ich winkten Sammys anthrazitfarbenem Range Rover hinterher, bis dieser hinter dem Pinienhain am Ende der Zufahrt verschwand. Dann gingen wir wie immer den kleinen Pfad hinunter, der am Waldrand entlang der Grenze zum Grundstück der Franklins verlief – eine Abkürzung zur Bushaltestelle an der Tamora Road. Mit unseren Schnürstiefeln stapften wir knirschend durch den knöcheltiefen Schnee, und unser Atem kondensierte zu dichten Wölkchen in der kristallklaren Luft, die so kalt war, dass sie die Lunge mit Hunderten von Nadelstichen zu traktieren schien. Walts heiße, kleine Hand lag in meiner, und vor uns erstreckten sich die Schneewehen bis zum Horizont.
Auch mich hatte es hierhergeweht. Erst von Schottland nach England, dann nach Toronto und schließlich bis nach Saskatchewan. Immer weiter nach Norden und Westen hatte es mich getrieben, immer weiter weg von meiner Heimat. Mit einer Ausdehnung von über 300000 Quadratkilometern, aber nur einer Million Einwohnern beherbergt Saskatchewan in etwa so viele Menschen wie Birmingham, jedoch verteilt auf ein Gebiet, das doppelt so groß ist wie Großbritannien. Bewegt man sich von Regina oder Moose Jaw nach Süden, landet man schon bald auf amerikanischem Boden in Montana oder North Dakota. Nach Norden hin, über den Prince-Albert-Nationalpark hinaus, erreicht man die glitzernden Eislandschaften der Northwest Territories, den subarktischen Teil des Landes, wo mit minus 57 Grad die kälteste Temperatur Kanadas gemessen wurde.
»Land des lebendigen Himmels« steht in Saskatchewan auf den Nummernschildern. Mir schien der Himmel weniger lebendig als endlos zu sein. Unter ihm fühlte ich mich winzig und irrelevant, wie Plankton, wie Krill in diesem abgrundtiefen Atlantischen Ozean, der mich nun von zu Hause trennte. In den ersten Jahren, bevor ich schließlich Sammy kennenlernte, fuhr ich im Sommer manchmal in meinem alten Nissan aus Regina raus und über Land nach Norden in Richtung Saskatoon. Dort hielt ich irgendwo am Straßenrand, parkte auf dem staubigen Seitenstreifen und legte mich auf die Motorhaube in den lauen Chinook-Wind. Umgeben von Weizenfeldern oder Viehweiden blickte ich zu den vorbeiziehenden Wolken hinauf und folgte ihnen in Gedanken weiter nordwärts, wo die Felder, das Vieh und der Chinook-Wind allmählich verschwanden und der leeren Weite der Northwest Territories wichen. Dahinter Grönland. Die Arktis. Lemminge, Moschusochsen und Karibus. Der Nordpol. Permafrost. Einsamkeit.
Ich lag einfach nur da – die Wölbung der Motorhaube im Rücken, die Wärme des Blechs unter meinem Hemd – und blickte nach Norden.
Später erzählte mir Sammy von den Inuit, den furchterregenden Stämmen jener Krieger und Jäger, deren Heimat die Tundra war. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie dort ein Leben unbehelligt von der Zivilisation geführt. Dann tauchten wir auf und brachten ihnen das, was wir immer bringen: Alkohol, Drogen und Fernsehen. Heute leben die meisten der verbliebenen Inuit in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Sie hausen in Sozialbauten, und die einzigen Kämpfe, die ihre Krieger jetzt noch führen, gelten ihren Depressionen, ihrem Alkoholismus und ihrer Drogenabhängigkeit.
Laut Sammy glaubten die Inuit einst, Selbstmord würde die Seele reinigen und sie auf ihre Reise ins Jenseits vorbereiten. Die Alten, die für den Stamm zur Belastung geworden waren, baten deshalb häufig darum, sich das Leben nehmen zu dürfen. Sie mussten dreimal fragen, und die Familienmitglieder konnten versuchen, sie davon abzubringen. Doch wenn sie das dritte Mal fragten, durfte ihrer Bitte nicht mehr widersprochen werden. Sie drehten ihre Kleidung auf links, schafften ihre Besitztümer herbei, damit sie zerstört wurden, und erhängten sich vor aller Augen. Ich habe oft versucht, mir diese dritte Konversation vorzustellen. Den Gesichtsausdruck eines Menschen, wenn dessen Mutter oder Vater mit solch einer Bitte an ihn herantritt. Wie er zuhört, mit geneigtem Kopf, in dem Bewusstsein, nun einwilligen zu müssen.
Ich bemerkte, dass Walt an meiner Hand zog, offenbar in Erwartung einer Antwort. »Was ist denn, Walt?«
»Dad, ich hab dich gefragt, ob du schreiben wirst, dass der Film gut war …«
Walt hatte gerade erst begonnen, mit »Dad« zu experimentieren. Ich war erschüttert, wie sehr ich mich herabgesetzt fühlte, wenn er mich so nannte. Wie erwachsen ihn diese drei Buchstaben machten und wie alt sie mich erscheinen ließen. Welchen Verlust an Unschuld sie darstellten. Ich vermisste »Daddy«. Seine Mutter war für ihn immer noch »Mommy«.
»Ja, ich glaube schon.«
»Hat er dir wirklich gefallen?« Walt sprach von dem Film, den wir uns am Abend zuvor auf DVD angesehen hatten und den ich für die Zeitung besprechen sollte: eine 100-Millionen-Dollar teure Aneinanderreihung von Kampfszenen, Unglaubwürdigkeiten und hölzernen Dialogen. Er war begeistert davon, bis auf die letzte Schlacht, die er offensichtlich als ein wenig traumatisch empfand.
»Nein, Walt, nicht wirklich.«
Ich dachte über den Film nach, über seinen widerwärtig grellen Farb-Overkill, darüber, wie er jeden Zentimeter der Leinwand bis zum Bersten ausfüllte. Über das grausame, schablonenhafte Spiel der Darsteller, die dumpfe Rahmenhandlung. »Also«, sagte ich, »ich schätze, ich mochte die Charaktere nicht besonders.« Ich erinnere mich, dass ich den Arm um Walt legte, um ihn ein paar vereiste Stufen hinaufzuführen. Da ist es dir zum ersten Mal aufgefallen. Aus dem Augenwinkel. Der farbige Klecks. Die Vögel.
»Aber«, sagte Walt und sah mich immer noch fragend an, »warum willst du dann schreiben, dass er gut ist?«
»Na ja …« Wie erklärt man einem Achtjährigen die Lügen und Kompromisse der Erwachsenenwelt? Der Regina Advertiser, die Zeitung, für die ich schrieb und die seine Mutter herausgab, ist im Grunde ein beschissenes Anzeigen- und Lokalnachrichtenblatt. Die Artikel der Zeitung haben starken Regionalbezug, es sind Storys über Hockeyteams, lokalpolitische Begebenheiten und persönliche Schicksale. Am Tag von Obamas Wahl war der Aufmacher eine Story über ein großes staatliches Förderprogramm für Viehbauern, und die Schlagzeile NEUER US-PRÄSIDENT! schmückte einen viertelseitigen Kasten rechts unten. Wie sollte ich ihm erklären, dass die Zeitung auf das Wohlwollen der Studio-Pressebüros angewiesen war, die uns mit Rezensionsexemplaren der DVDs und Trips zu den Pressevorführungen in Calgary und Toronto versorgten? Die mir gelegentlich Telefon-Interviews mit drittklassigen Filmsternchen organisierten, deren Niederschriften dann zu hysterischen »Filmstar spricht exklusiv mit dem Advertiser!«-Artikeln aufgebauscht wurden, die schamlos jeden Film anpriesen, den der Star gerade bewarb? Dass, kurz gesagt, der Advertiser nicht die New York Times und ich alles andere als ein Starkritiker auf der Höhe seiner Schaffenskraft war?
»Mommys Zeitung druckt eigentlich über gar keinen Film schlechte Kritiken.«
Er dachte einen Moment darüber nach. »Dann lügst du also?«
»Es sind keine besonders großen Lügen, Walt.«
»Hat dir denn die Stelle nicht gefallen, wo …«
Walt redete weiter, den Blick auf seine Füße gerichtet, aber ich hörte schon nicht mehr zu.
Etwas Rotes leuchtete im Schnee, ungefähr zwanzig Meter links von mir. Drumherum stolzierten weihevoll drei Krähen, die schwarzen Schwingen wie Arme steif hinter dem Rücken verschränkt.
»Und dann die Stelle, als sie den Angriff auf …«
Noch hatte Walt nichts gesehen. Wir waren jetzt fast an der Straße, und ich erkannte Jan Franklins graublauen BMW. Zusammen mit ihren beiden Jungs, Ted und Andy, saß sie im Wagen und wartete auf den Bus, der just in diesem Moment die Tamora Road heraufkam. Strahlendgelb schälte er sich aus dem endlosen Weiß heraus.
»Los, komm schon, Walt!«, rief ich. »Da ist der Bus!« Ich hob ihn hoch und drückte ihn an meine Brust, sodass sein Gesicht in meinem Hals vergraben war, weg von dem roten Fleck im Schnee. Walt gluckste vor Vergnügen, als ich auf die Bushaltestelle zurannte. Ted und Andy stiegen nun aus dem Auto aus. Ich setzte Walt ab und drückte ihm einen Kuss auf die Wange – während der Bus zum Stehen kam, lief er bereits seinen Freunden entgegen. Von dem Sprint ganz außer Puste, hob ich die Hand zum Gruß, als Jan davonfuhr. Ich konnte Walt gerade noch ein atemloses »Bis später!« zurufen, da schloss sich auch schon die Tür hinter ihm.
Ich wartete einen Moment und winkte dem Bus hinterher, bevor ich mich auf den Rückweg machte. Die Krähen erhoben sich gemächlich in die Luft, als ich mich ihnen näherte, und ließen sich dann in einiger Entfernung nieder, um mich zu beobachten.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien. Unser Hund lag rücklings in seinem eigenen Blut. Dort, wo es im Schnee versickert war, hatte es diesen rosa gefärbt. Herbys haarloser Bauch war von den Genitalien bis zur Schnauze aufgeschlitzt, das Tier regelrecht ausgeweidet worden.
Die Wunde sah aus, als hätte sie jemand aufgestemmt: Aus dem aufgebrochenen Brustkorb ragten die Rippen wie die Pfeifen einer grotesken Orgel in die Höhe. Die Eingeweide waren aus der Bauchhöhle gerissen und ergossen sich in den Schnee. Beim Anblick von Herbys Kopf biss ich mir in den Handschuh, um die aufsteigende Übelkeit und die Tränen zu unterdrücken. Die Augenhöhlen waren schwarz, leer und blutumrandet – die Krähen hatten ganze Arbeit geleistet –, und seine Kiefer zu einem grimmigen, gequälten Fletschen erstarrt. Seine Zunge hing an einigen wenigen Sehnen zwischen den Zähnen heraus, als hätte er sie sich im Todeskampf abgebissen. Ich torkelte, meine zitternden Beine gaben nach, und ich kniete mich in den Schnee.
Urplötzlich bewegte sich der Hund, sein linkes Hinterbein fing an zu zucken und zu treten. Zu Tode erschrocken kroch ich rückwärts.
Der Kopf einer Ratte schob sich oberhalb der Genitalien aus dem Schlitz im Bauch. Blut tropfte von ihren Schnurrhaaren, als sie sich im Sonnenlicht schüttelte. Rasend vor Wut trat ich mit dem Stiefel nach ihr, doch sie tat einen gewaltigen Satz, wieselte davon und hinterließ eine klebrige, rote Spur.
Ich rollte mich herum und gab meinen gesamten Mageninhalt von mir, Toast und Kaffee, der erst in meiner Kehle brannte und mir dann aus der Nase spritzte, um schmutzig braune Löcher in den Schnee zu schmelzen. Punkte und Sternchen tanzten vor meinen Augen – und mit dem sauren Geschmack des Erbrochenen, dem Anblick des blutgetränkten Schnees, stieg eine seit Ewigkeiten verschüttete Erinnerung in mir auf.
3
Wir befinden uns auf einer Lichtung im Wald, unser Eimer ist voller Frösche und Kröten. Es sind Dutzende, aus dem Teich oben in Fox Gate. Sie winden sich in dem blauen Plastikeimer, krabbeln übereinander, springen hoch, versuchen zu entkommen. Winzige Frösche, nicht größer als ein Daumen, und aufgeschwemmte, schmierige Kröten von der Größe einer Männerfaust. Tommy wirft sie Richtung Banny, der mit angewinkeltem Bein – wie ein Baseballspieler – sein Vierkantholz schwingt. Immer wieder schlägt er ins Leere, und wir drei machen uns vor Lachen fast in die Hose, als die verwirrten Tiere mit ausgestreckten Beinen durch die Luft fliegen, ihre Silhouetten dunkle Sterne vor dem hellen Sommerhimmel.
»Verdammter Mist!«, schimpft Banny. »Schmeiß sie nicht so fest!« Und Tommy tut ihm den Gefallen. Eine der größten, fettesten Kröten fliegt in sanftem Bogen direkt in Bannys Schlagweite. Dessen Knüppel saust herab und trifft. Als die Kröte zerplatzt, geht ein Regen aus zerfetzten Organen auf mich nieder, bespritzt mein Gesicht mit stinkendem Blut und Gedärm. Tommy und Banny johlen auf, während ich blinzelnd auf die Knie gehe und mich auf den warmen Waldboden übergebe.
Wieder halbwegs bei Atem, hebe ich den Kopf und sehe nur einen Meter entfernt die Überreste der Kröte, Kopf und Vorderbeine, die sich immer noch bewegen. Als ich erneut würgen muss, höre ich die anderen im Hintergrund lachen. Tommy sagt: »Oh, verdammt! Hast du das gesehen? Die arme Sau hat sich ja die Seele aus dem Leib gekotzt!« Und Banny feixt: »O Mann, das darf ja nicht wahr sein! Was für’n beschissenes Weichei!«
»Ihre frühesten Grausamkeiten«, heißt es später in einem Bericht, »verübten sie an Tieren.«
4
Nachdem ich Herbys grausam verstümmelte Überreste in eine grüne Abdeckplane gepackt und im Poolhaus unter frischem Schnee deponiert hatte, damit Walt sie nicht sah, wenn er nach Hause kam, ging ich unter die Dusche. Während mein Blut unter dem warmen Wasser kribbelnd in meine ausgekühlten Extremitäten zurückkehrte, ging mir immer wieder diese eine Frage durch den Kopf: Wer oder was ist zu so etwas fähig?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!