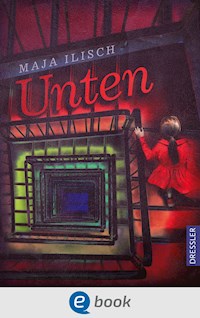14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Gestrandet im Nebelreich, scheint die Lage für Prinz Tymur aussichtslos. Nun da die Zauberin Ililiané tot ist, gibt es niemanden mehr, der die Rückkehr des Dämonenfürsten verhindern kann. Von Misstrauen zerrüttet machen sich die Gefährten auf eine Wanderung ohne Aussicht auf Wiederkehr. Schon als Kind war Prinz Tymur fasziniert von den Heldengeschichten um seinen Ahn Damar, der vor tausend Jahren das Land von den Dämonen befreite, dabei aber seine fünf Weggefährten tötete. Doch Tymurs Versuche, dem bewunderten Vorfahren nachzueifern, münden in eine Katastrophe. Fern der Heimat, ohne Aussicht auf Rückkehr, versucht er, die Kontrolle zu behalten – über seine Freunde, vor allem aber über sich selbst. Und während Tymurs Verhalten immer unberechenbarer wird, drohen Bündnisse und Freundschaften zu zerbrechen. Auf der Flucht strandet die Gruppe in einem geheimnisvollen Tal, das den Schlüssel zur Macht der Dämonen verspricht. Aber die wahren Antworten liegen in der Vergangenheit, und selbst der größte aller Helden ist am Ende nicht das, was er scheint … Stimmen zum Buch "Ein echter Pageturner – ich freue mich schon auf die Fortsetzung." Angelika Herzog, Andromeda Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Ähnliche
MAJA ILISCH
DAS GEFÄLSCHTE HERZ
DIE NERAVAL-SAGE 2
KLETT-COTTA
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur
erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
Unter Verwendung einer Illustration von © Max Meinzold, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98239-8
E-Book: ISBN 978-3-608-11638-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Umschlag
Impressum
PROLOG
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
SIEBZEHNTES KAPITEL
ACHTZEHNTES KAPITEL
Danksagung
Autoreninfo
Für Malinche Weil sie es kann – und zwar nackt.
O villain, villain, smiling, damned villain! My tables! – Meet it is I set it down That one may smile, and smile, and be a villain.
O Schurke, lächelnder, verdammter Schurke! Schreibtafel her, ich muß mir’s niederschreiben, Daß einer lächeln kann und immer lächeln Und doch ein Schurke sein.
William Shakespeare: Hamlet Deutsche Übersetzung von August Wilhelm v. Schlegel
PROLOG
Manchmal, im Traum, war er Damar. Nicht Damar, der Held, Damar mit dem silbernen Schwert, Damar der Dämonentöter, sondern Damar, das Kind. Es waren keine schönen Träume.
Tymur wusste nicht, wo sie herkamen. Natürlich, es war in seinem Blut, er war Damars direkter Nachfahre, und da konnte er schon den einen oder anderen Traum geerbt haben. Aber Tymur wusste zu viel über Blut, um das zu glauben. Blut war rot, ob es nun seines war oder Damars, es war seidig zwischen den Fingern und ein bisschen schmierig, und wenn es trocknete, fing es an zu kleben: Ein Tropfen schmeckte süß, doch zehn drehten einem den Magen um, und es träumte nicht. Blut war nur Blut.
Seine Brüder waren anders. Sie und Tymur waren von einem Vater und einer Mutter, jedoch nicht von einem Wesen. Wenn Tymurs Brüder träumten, dann vielleicht von großen Heldentaten. Von schönen Frauen. Von anderen Dingen, die Tymur nicht im geringsten interessierten. Es lagen zu viele Jahre zwischen ihnen, und zu viele Welten. Als seine Brüder klein waren, hatten sie einander. Vjasam, Sandor, Antal, Davron, alle zwei Jahre einer, und dann nichts, acht lange Jahre nichts, bis Tymur kam, den sie nicht kannten und nicht wollten, nicht zum Spielkameraden und noch weniger zum Bruder.
Sicherlich gab es noch andere Menschen in der Burg als nur diese vier, bloß keine Kinder, und obwohl Tymur den einen oder anderen Erwachsenen fand, der bereit war, sich mit ihm abzugeben, war es nicht das Gleiche. Sein einziger Freund, der Einzige, der ihn verstand, war Damar.
Tymur war nicht dumm. Er wusste, dass Damar seit tausend Jahren tot war und gestorben als alter Mann, doch für ihn war er wirklich, lebte irgendwo in einer Ecke von Tymurs Kopf, wo sie sich unterhalten konnten und gemeinsam Abenteuer erlebten und einander hatten. Tymur hätte diese Freundschaft nicht teurer erkaufen können als mit seinen Träumen. Tymur mochte mit Damar spielen. Aber er mochte nicht Damar sein.
Einsam waren sie, alle beide. Aber während Tymurs Sorgen sich darum drehten, dass er keinen Spielgefährten fand, hatte Damar ganz andere Probleme, als man ihn in die Berge führte und dort zurückließ, ein Geschenk, damit die Dämonen sein Tal ein weiteres Jahr lang verschonten.
Es waren harte Zeiten, doch davon verstand Damar nicht viel. Nach seiner Zeit im Tempel wusste er vielleicht noch, was Hunger war, auf diese ferne, kühle Art, wie er sich auch an seine Familie erinnerte: etwas, das lang vergangen war und das er niemals wiedersehen würde. »So ein hübsches Kind«, hatte der Priester gesagt. »Zierlicher Körper, ebenmäßiger Bau – er wird dem Tal Ehre machen.« Das wusste Damar noch. Dann ging alles so schnell – eben noch war er da, dann trug der fremde Mann ihn davon. Seine Eltern weinten, doch sie weinten ohne ihn, und Damar lernte schnell, sie nicht zu vermissen.
Er war wichtig. Alles drehte sich um ihn. Die Priester kleideten ihn in seltsame steife Gewänder, deren Wert er nicht begriff und die ihm nichts bedeuteten, man konnte darin nicht spielen und nicht arbeiten, doch weder das eine noch das andere hatte einen Platz in Damars neuem Leben. Das Essen war gut und reichlich, sie gaben ihm Fleisch zu essen und süßes Brot, und er vergaß so schnell, wie sie es haben wollten.
Manchmal erzählten sie ihm von den Dämonen.
Die Dämonen kamen aus den Bergen. Woher genau, das wusste niemand. Die Männer, die mit ihren Speeren und Hacken auszogen, um sie zu finden, kamen unverrichteter Dinge zurück, wenn überhaupt. In den Bergen war Nebel, der niemals wich; es gab Schluchten, deren Grund kein Mensch je gesehen hatte, und Höhlen, die durfte niemand betreten, und jeder wusste, dort lebten die Dämonen. Solange sie dort blieben, war alles gut, sie durften ja Dämonen sein, so viel sie wollten, wenn sie die Menschen nur in Frieden ließen. Aber eben das taten sie nicht.
Wo sie einmal waren, da blieben sie auch. Sie unterwarfen die Menschen mit Gewalt und hießen sie schuften, bis Blut floss; niemand, noch nicht einmal Kinder, war vor ihnen sicher … Doch es gab Orte, die blieben von den Dämonen verschont. Nicht, weil sie Widerstand leisteten – das Schicksal der anderen hatte sie gelehrt, was aus dem wurde, der zur Waffe griff –, sondern weil sie gehorchten, weil sie den Dämonen gaben, was diese am meisten begehrten.
So geschah es in dem Tal, aus dem Damar stammte. Es ging den Menschen dort nicht besser als anderswo, die Böden waren karg, das Wetter feucht und kalt, und reich wurde dort niemand – aber die Menschen waren frei, sie durften aufrecht gehen, und niemand hob die Peitsche gegen sie als ihre Landesherren, und das waren Menschen wie sie.
Damar wusste nicht, wie viel Zeit zwischen dem Tag lag, als er in den Tempel gekommen war, und dem Tag, als es in die Berge ging. Tatsächlich war es nicht mehr als ein Jahr – die Dämonen wollten nicht lang warten müssen auf ihre Geschenke. Ein Jahr nur, und doch eine andere Welt. Damar trug seine Verantwortung mit Stolz. Die Hoffnung eines ganzen Tales lag auf ihm, und er würde sein Bestes tun, den Dämonen zu gefallen.
Drei Kinder wurden an diesem Tag in die Berge geführt. Das eine Mädchen, Donza, war schon groß, mit langem Haar, das sie zum Zopf gebunden trug wie die Frauen, und insgeheim fragte sich Damar, wie die Dämonen reagieren würden, wenn sie sich Kinder wünschten und dann jemanden bekamen, der schon so groß war. Die andere, Raya, war dafür noch kleiner als Damar, und manchmal weinte sie nach ihren Eltern, bis die Männer ihr Schlafmilch gaben und sie wieder still war. Auch Damar bekam jeden Tag diese Milch, er mochte sie nicht, sie schmeckte bitter, aber weil er der Größere war und tapferer als die Kleine, verzog er keine Miene. Er hatte keinen Grund zum Klagen und klagte darum auch nicht, nicht einmal, als alle drei in die schönsten und reichsten Gewänder gekleidet wurden und sich zusammen mit den beiden Hohepriestern auf den langen und beschwerlichen Weg in die Berge machten.
Die Priester stiegen jedes Jahr auf diesen Berg. Doch die Kinder waren müde, ihre Beine taten weh und waren schwer, und der Wind blies ihnen kalt in die Ärmel und um die Füße. Damar beneidete Raya um ihre bestickte Haube, mit der sie wenigstens warme Ohren hatte, selbst wenn nur kleine Mädchen so etwas trugen, und erinnerte sich ein bisschen an dicke Wollstrümpfe und an eine Frau, die sie ihm übergezogen hatte; vielleicht war das seine Mutter gewesen, doch es waren die Füßlinge, die er in diesem Moment vermisste, nicht die Menschen. Er trug nur leichte Sandalen, sie waren schön und sahen aus wie geflochtenes Gold, aber er fühlte jeden Stein unter den dünnen Sohlen und stolperte mehr, als dass er ging. Wenn sie nur eine Pause hätten machen dürfen, eine einzige nur, eine kurze …
Doch die Priester waren unerbittlich. Sie trieben die Kinder voran und sprachen dabei nicht, kein Wort. Und wenn eines der Kinder versuchte, etwas zu sagen oder auch nur zu quengeln, reichte ein scharfer Blick, um es zum Schweigen zu bringen.
Damar kniff die Lippen zusammen. All seine Kraft brauchte er, um auf den Beinen zu bleiben und nicht hinzufallen vor lauter Erschöpfung. Er kämpfte mit den Tränen. Als hätte jemand den Schleier weggerissen, der sein letztes Jahr in ein wohliges, nebliges Grau gehüllt hatte, brach plötzlich eine kalte Wirklichkeit über ihn herein, und er verstand, dass er von diesem Berg nie wieder hinuntersteigen würde.
Je näher sie dem Gipfel kamen, desto mehr verschwand die Welt im Nebel, und die Kälte legte sich Damar auf die Haut und kroch in die Knochen, bis seine Glieder taub wurden und die Schmerzen einer matten Gleichgültigkeit wichen. Vom Tal war nichts mehr zu sehen, und alles, was Damar einmal gekannt hatte, war nicht mehr.
Als sie endlich den höchsten Gipfel erreicht hatten, jenseits des Nebels, nah am Himmel und fern der Welt, fielen Damar beinahe die Augen zu. Er begriff noch halb, dass dieser Ort offenbar von Menschenhand geschaffen worden war: Dort führten Treppenstufen hin, und Treppen sollte es im Gebirge nicht geben. Doch es war ihm egal.
»Ihr wart sehr tapfer, Kinder«, sagte einer der Hohepriester. »Der Weg war hart und beschwerlich, aber ihr habt ihn gemeistert, und seht nur, an was für einem schönen, friedlichen Ort wir nun angekommen sind.«
»Und was wird nun?«, fragte Donza. Als Älteste war sie auch die Erste, die Widerworte gab, die sich nicht in ihr Schicksal fügen mochte, und da sie die Kleine das letzte Stück auf ihren Schultern getragen hatte, musste es nun auch ihr Recht sein, Fragen zu stellen.
»Ihr seid am Ziel«, antwortete der Hohepriester. »Fürchtet euch nicht. Ihr werdet erwartet.«
»Wir legen unser Schicksal und das des ganzen Tals in eure Hände«, sprach der andere. »Ihr seid unsere Hoffnung, unsere Stütze, unser Leben. Denkt immer daran.«
»Aber – was tun wir hier?«, fragte Donza. Die kalte Luft in den Bergen hatte sie wach gemacht und widerspenstig.
»Ihr werdet warten«, sagte der Priester. »Nur warten. Es ist bald vorbei.«
»Seht ihr dort die steinernen Throne?«, fragte der andere. »Dort werdet ihr sitzen. Wir bleiben bei euch. Habt keine Angst.«
Aber Angst war für Damar so fern wie der Rest der Welt. Er wollte sich ausruhen, sonst nichts mehr, nur noch ausruhen … Wie er die letzten Schritte hin zu dem Thron schaffte, der aus dem Gestein gehauen war, wusste er nicht mehr. Der Sitz war hoch, mehr für einen Erwachsenen als für ein Kind. Wie aus der Ferne hörte er die Stimmen der Männer.
»Hier, trinkt das, es treibt euch die Kälte aus den Knochen.«
Im Halbschlaf spürte Damar, wie man ihm eine tönerne Flasche in die Hände drückte, doch es gelang ihm nicht einmal mehr, sie zum Mund zu führen.
»Was ist das?«, fragte Donza. »Noch mehr Schlafmilch?« In ihrer Stimme lag Widerstreben, aber keine Rebellion – sie verstand vielleicht besser als sie alle, was sie erwartete, aber ebenso auch, warum es sein musste.
»Nein, trinkt es nur, es ist Nektar.«
Die Kinder hatten keinen Grund, den Priestern nicht zu glauben. Die Männer waren immer gut zu ihnen gewesen, nicht warm und nicht herzlich, aber gut. Damar nippte vorsichtig von der Flüssigkeit, und wirklich, es war keine bittere Milch, sondern süß und etwas klebrig – nicht das, was seinen Durst gestillt hätte, aber besser als nichts. Er blickte zu den beiden Mädchen hin und nahm noch einen Schluck. Es brannte in seinem Rachen, doch es wärmte ihn auch.
»Trinkt alles aus«, sagte der Priester. »Es ist so kalt hier oben – das Warten wird zu lang, wenn ihr friert.«
Aber Damar war längst jenseits des Punktes, wo ihn die Kälte gestört hätte. Den nächsten Schluck brachte er schon nicht mehr hinunter. Er fühlte noch, wie ihm der dickflüssige Saft aus dem Mund tropfte, dann kippte ihm schwer und müde der Kopf vornüber.
Als Damar die Augen wieder öffnete, wusste er nicht, ob er geschlafen hatte, und nicht, ob geträumt. Sein Kopf war wie mit Wolle vollgestopft, Arme und Beine stachen wie von heißen Nadeln durchbohrt, aber er wusste, dass er nicht länger dort sitzen bleiben durfte. Es war bitterlich kalt, ein schneidender Wind wehte, und das machte ihn wach. Die Füße wollten ihn kaum tragen, er schwankte und fiel hin und rappelte sich auf, aber ebenso, wie er sich zwingen konnte, die Augen offenzuhalten, gelang es ihm endlich, zu stehen, mit der Hand an der steinernen Lehne abgestützt.
Von den Priestern war nichts mehr zu sehen, doch die beiden Mädchen waren noch da. Donza und Raya saßen auf ihren Thronen, ganz still und in sich zusammengesunken. Donzas Kopf hing ihr so tief auf die Brust, dass nur ihr glattes schwarzes Haar ihn noch anschaute und der Scheitel ihr Haupt in zwei Teile zu spalten schien. Rayas Kopf verschwand fast unter ihrem Häubchen, und ihr Gesicht lag im Schatten. Fast war Damar froh darüber.
Er zögerte lange, ehe er sie berührte, vorsichtig, an der Schulter, dann schüttelte er sie. Aber Raya wachte nicht auf, und Donza auch nicht, und ihre Körper fühlten sich seltsam an unter Damars taubgefrorenen Fingern. Er wollte schreien, doch dafür fehlte ihm die Kraft, der Mund klebte ihm zusammen, und er war so schwach, dass er kaum einen Laut herausbrachte.
Ihm war schwindelig, und wieder strauchelte er, als er vorwärtsstolperte, er wusste nicht, wohin, er stürzte, und der Schmerz in Händen und Knien stach so heiß, dass Damar glaubte, sich daran wärmen zu können. Jeder Schritt wurde zum Kampf. Etwas stimmte nicht. Wenn die Dämonen da gewesen waren – wenn sie anstelle der Kinder die Priester mitgenommen hatten …
Langsam begriff Damar, dass er allein war, so allein, wie ein Mensch nur jemals sein konnte, verlassen von allem Leben und der Welt. Dann wusste er nichts mehr.
Als Damar das nächste Mal erwachte, brauchte er lange, um zu begreifen, dass er in einem Bett lag. Wie er dort hingekommen war, konnte er nicht sagen, und auch nicht, was für ein Ort das war. Eine Decke lag über seinem Körper, hauchdünn und so leicht wie Spinnfaden, doch es war warm darunter, so warm, dass er nie wieder aufstehen wollte. Damars Hände und Füße stachen und brannten und kribbelten, aber zuletzt hatte er sie gar nicht mehr gefühlt – dann sollten sie sich jetzt ruhig freuen dürfen, dass noch Leben in ihnen war. Er war froh, dort zu liegen, draußen war die Welt kalt, hier hatte er es warm, und ruhig, und friedlich …
Damar döste vor sich hin, doch er träumte nicht – er genoss es, dass ein Teil von ihm wach blieb, dass er in seinem Kopf spazieren gehen konnte und dabei nur sich selbst gehörte. So oft war er von der bitteren Milch in tiefen, gehorsamen Schlaf gefallen, dass er beinahe nicht mehr wusste, wie es war, einfach nur zu schlafen. Als ihm eine fremde Hand leicht über die Stirn strich, kühl wie ein Windhauch, lächelte Damar im Halbschlaf. Die Berührung war seltsam vertraut, und er begriff, dass er sie oft gespürt haben musste in den letzten Tagen. Damar schlug die Augen auf. An seiner Seite, halb über ihn gebeugt, saß eine fremde Frau. Und Damar wusste sofort, dass sie kein Mensch war.
Ihr Gesicht war so blass, als ob die ganze Welt ohne Farbe wäre, und unter der durchscheinenden Haut bewegte sich etwas wie lebendiger Nebel, es pulsierte im Rhythmus ihres Atems. Sie hatte große Augen, die gleichzeitig schwarz waren und hellblau, schwarz war ihre Tiefe, und das Blau lag darüber wie schillerndes Eis, alles so lebendig, dass es in ihrer Nähe keinen Tod geben konnte. Ihre Haare waren fein wie Spinnweb, als würden sie verschwinden, wenn man sie nur berührte, und sofort verspürte Damar den unwiderstehlichen Drang, seine Hand danach auszustrecken. Diese Frau war so anders als die Menschen in seinem Tal mit ihrem dicken schwarzen Haar und der braunen Haut, und sie war so wunderschön – und dann verstand Damar, dass sie ein Dämon sein musste. Er lächelte bei der Vorstellung. Er war in die Berge gekommen als Geschenk für die Dämonen, und die Dämonen hatten es angenommen.
»Da lächelst du«, sagte die Frau. »Da bist du also endlich aufgewacht.« Ihre Stimme klang freundlich und so sanft, dass Damar nichts mehr von dem glauben konnte, was er über die Dämonen gehört hatte.
Er lächelte noch etwas mehr und versuchte zu nicken. »Wo bin ich?«, fragte sein Mund, ohne dass Damar wusste, wo die Wörter herkamen oder wie hinaus, seine Zunge fühlte sich fremd an, und so klang es dann auch, lahm und langsam.
»Du bist jenseits des Nebels«, sagte die Frau. »Die Menschen haben dich auf dem Berg zurückgelassen.«
Jetzt gelang es Damar zu nicken. »Ein Geschenk«, brachte er hervor. »Für die Dämonen.«
Sie sollte sich darüber freuen, doch ihr Gesicht wurde hart und ihre Stimme bitter. »Wir sind keine Dämonen«, sagte sie. »Die Dämonen leben nicht in diesen Bergen, nur wir. Aber deine Menschen – sie denken, dass wir die Dämonen sind, und tun selbst Schreckliches, Jahr für Jahr.«
Damar verstand nicht. Wenn sie kein Dämon war und kein Mensch, was dann?
»Wir sind Alfeyn«, sagte die Frau. »Die Menschen verstehen das nicht. Sie denken, jeder, der nicht ist wie sie, muss ein Dämon sein. Wir sind die Alfeyn, wir tun niemandem etwas zuleide, und kein Mensch muss uns Opfer bringen. Und doch kommen sie jedes Jahr aufs Neue. Unschuldige Menschenkinder, zurückgelassen zum Sterben, betäubt, damit sie nicht fliehen können, bevor die Kälte ihnen das Leben nimmt.«
Damar verstand immer noch nicht. Er musste lange bei den Alfeyn bleiben, ehe er auch nur beginnen konnte zu begreifen. Aber an jenem Tag, unter der tröstenden Decke, ging es nicht ums Verstehen. Es ging nur darum, dass Damar lebte.
»Du bist der Erste, den wir retten konnten«, sagte die Frau. »Wir versuchen es in jedem Jahr, und in jedem Jahr kommen wir zu spät – wir dürfen uns nicht blicken lassen, wir müssen warten, bis die Menschen wieder fort sind, die Angst hat ihre Herzen verhärtet, dass sie am Ende böser geworden sind als die Dämonen selbst. Jedes Jahr finden wir drei tote Kinder, aber in diesem Jahr waren es nur zwei.«
Damar lächelte bei sich. Er war etwas Besonderes. Das hatte man ihm so oft gesagt, dass er schon daran gewöhnt war. »Und was kommt jetzt?«, fragte er.
»Es ist nicht an mir, das zu entscheiden«, sagte die Frau. »Wir hatten noch nie ein lebendes Menschenkind. Möchtest du hierbleiben?«
Das war das erste Mal überhaupt, dass jemand Damar fragte, was er wollte. Und darum sagte er Ja.
Niemand wusste genau, wie lange Damar bei den Alfeyn blieb. Er selbst hatte nie gelernt, die Jahre zu zählen, und selbst wenn, so vergingen sie hinter dem Nebel anders als bei den Menschen. Später, nach Damars Tod, meinten manche, dass die Wunde, die La-Esh-Amon-Ris Schwert ihm geschlagen hatte, ihn in Wirklichkeit nicht schneller altern ließ, sondern nur jene Zeit von ihm zurückforderte, welche ihm die Alfeyn geborgt hatten. Für sein Volk war er gestorben, lange bevor er aus den Bergen zurückkehrte, und auch Damar konnte sich an keinen Namen, kein Gesicht mehr erinnern als die der beiden Mädchen.
Aber die Zeiten hatten sich nicht geändert, die Menschen waren, was sie waren, nur Damar, von Gestalt ein junger Mann, gehörte nicht mehr zu ihnen. Er hatte den größten Teil seines Lebens bei den Alfeyn verbracht, er trug ihre Kleider und führte ihre Waffen, doch er verstand, dass er dort nicht bleiben konnte. Eine Unruhe griff nach ihm, die Erinnerung an ein altes Unrecht ließ ihn nicht mehr los, und ihn quälte das Wissen, dass mit jedem neuen Jahr Kinder in die Berge geführt und dort zurückgelassen wurden, um zu sterben.
Damar hasste nicht die Menschen und nicht die Dämonen, wie die Alfeyn war er ohne Hass, doch er wollte dem Sterben ein Ende setzen, und damit die Menschenopfer aufhörten, mussten erst die Dämonen in ihr Reich zurückgetrieben werden. Und darum, nur darum, zog Damar aus, um La-Esh-Amon-Ri, Fürst der Dämonen, zu besiegen. Er wollte kein Held werden, kein König, kein Weltenretter. Aber er tat, was getan werden musste.
Und Tymur? Was hatte das Leben für ihn geplant? Er wusste es nicht. Wenn es ihm erging wie Damar, wenn jemand kam, um ihn den Dämonen zum Geschenk zu machen – er konnte sich nicht vorstellen, dass die ihn dann haben wollten. Oder sonst jemand. Sein Vater … Natürlich, der war ein alter Mann, er wollte sich nicht um ein Kind kümmern müssen, sondern seinen Studien widmen, bloß, so viel Aufmerksamkeit brauchte Tymur doch gar nicht. Er wollte nur ab und an wissen, dass es gut war, dass es ihn gab. Aber er war, was er war, überflüssig. Er musste das Beste daraus machen.
Zumindest hatte er Damar.
Die alten Geschichten von Damar und den Alfeyn hatte Tymur so oft gehört und gelesen, dass er wirklich glauben konnte, Damar selbst hätte sie ihm erzählt. Doch das, was ihn dabei am meisten interessierte, stand in keinem der Bücher geschrieben: Was wurde aus den Kindern, die in den eiskalten Bergen starben?
Eines war klar, auf dem Berggipfel blieben sie nicht. Die Priester hätten sonst spätestens im folgenden Jahr die Überreste gefunden, und dann hätten sie zwei und zwei zusammengezählt und gemerkt, dass die Dämonen ihre Geschenke nicht abholten, und ihnen keine mehr gebracht. Natürlich, dann wäre Damar auch nie ausgezogen, um den Erzdämon zu besiegen, und vielleicht hätten die Menschen dann für alle Ewigkeit Sklaven der Dämonen bleiben müssen – aber immerhin, es wären ein paar Kinder weniger in den Bergen erfroren.
Was also geschah mit ihnen? Kamen am Ende doch noch die Dämonen, um sie abzuholen? Oder nahmen die Alfeyn sie mit und begruben sie? Es musste wirklich sehr kalt dort oben sein … Tymur hatte einmal einen toten Vogel beobachten können, der im Winter auf seinem Fenstersims lag und einfach nicht verwesen wollte, aber an dem war natürlich viel weniger dran als an einem ganzen Kind, und so sehr Tymur auch danach suchen mochte, er fand nichts Größeres. Doch das Prinzip verstand er: Die Körper froren ganz und gar steif. Und dann waren diese toten Kinder nichts, was man einfach so durch die Gegend tragen wollte. Begraben? Wo denn, wenn es dort so kalt war, dass alles gefror? Dann konnte man auch kein Loch ausheben, erst recht nicht für fremde Leute, die man einem einfach vor die Haustür gesetzt hatte – aber wenn Tymur nach diesen Dingen fragte, erntete er nur Kopfschütteln. Seine Brüder verdrehten ihre Augen und meinten, er sei wohl nicht ganz richtig im Kopf. Und sein Vater, der jedes Buch gelesen haben musste, das es auf der Welt gab, sagte nur: »Das tut doch überhaupt nichts zur Sache!«
Und ob das etwas zur Sache tat! Verriet es nicht sehr viel über die Alfeyn, was sie mit steifgefrorenen Kindern taten? Was, zum Beispiel, wenn sie die in Wirklichkeit aufaßen? Das war etwas Wichtiges, ganz und gar, aber je mehr Tymur spürte, dass er etwas Großem auf der Spur war, desto einsamer wurde er darüber.
»Beschreib mir noch mal genau, wie die Mädchen sich angefühlt haben!«, sagte er zu Damar. Er wusste, dass Damar nicht wirklich bei ihm war, natürlich, Tymur war weder dumm noch verrückt. Aber wenn ihm sowieso niemand antworten wollte, dann konnte er auch gleich denjenigen fragen, der sich von allen am besten auskannte.
»Sie haben sich kalt angefühlt«, antwortete Damar.
»Aber deine Hände waren doch selbst ganz kalt! Fühlt sich dann nicht alles kalt an?«
Damar antwortete nicht, weil Tymur sich selbst ausgetrickst hatte. So genau er seine Träume auch kannte, blieben die Dinge dort doch unberührbar. »Wenn sie warm gewesen wären«, sagte Damar schließlich, »hätte ich das doch erst recht merken müssen.«
»Und was waren sie, außer kalt?«
»Sie waren ganz fest. Nicht wie Haut oder Fleisch. Als wären sie aus Stein.«
Tymur nickte. So in der Art hatte er sich das auch schon gedacht. Aber vorstellen allein reichte ihm nicht, er musste es einmal selbst erleben, dann hatte er keinen Grund mehr, davon zu träumen – aber wo sollte er den Berg hernehmen, die Kinder, die Alfeyn? So gerne Tymur einmal seine Brüder oder zumindest ein oder zwei davon auf einem einsamen Felsen ausgesetzt hätte, wusste er doch, dass es dafür Ärger geben würde. Und so blieb ihm nur eine Testperson, um diese Fragen endgültig aus der Welt zu räumen: Tymur selbst.
Das Gebirge war weit weg, zumindest das Gebirge, aus dem Damar stammte und wo die Alfeyn lebten. Aber warum in die Ferne schweifen? Tymur brauchte nur einen einzigen Berg, und den hatte er schon: Seine Vorfahren hatten ihre Burg darauf erbaut. Und wenn Tymur oben auf den Zinnen stand und es Winter war und so richtig kalt, dann war er nur noch einen Schritt von Damar entfernt, und von den Alfeyn.
Eigentlich war es nur ein Spiel. So vieles war ein Spiel, und Tymur fragte nicht nach Gefahr. Im Zweifelsfall war er hinterher schlauer. Nur der Winter fehlte noch. Im Sommer konnte er sich zwischen die Zinnen setzen, so viel er wollte, es würde sicherlich keinen Alfeyn heranlocken. Aber im Winter, wenn es richtig kalt war …
Tymur schüttelte den Kopf. Das mit den Alfeyn, das konnte er vergessen. Und gleichzeitig selbst erfrieren und schauen, ob er vor oder nach dem Tod steiffror, das ging auch nicht – all das verstand er durchaus. Und trotzdem war die Neugier zu groß und die Frage, ob ihn überhaupt jemand vermissen würde. Der Winter kam bestimmt.
Eigentlich machte es keinen großen Unterschied. Auf Burg Neraval war es auch im Sommer kalt, grau und zugig, und egal welches Wetter war, Tymur musste drinnen spielen. Wenn er raus wollte, stellte man ihm Leibwächter an die Seite, nur für den Fall, dass jemand auf die Idee käme, ihn zu entführen oder umzubringen oder zu benutzen, um in die Burg einzufallen und mit der Schriftrolle zu türmen. Es gab keine schlechteren Spielgefährten als Leibwächter. So spielte Tymur lieber unbeaufsichtigt in den Fluren und Gewölben der Burg, die groß genug war, um jeden Tag ein neues Geheimnis preiszugeben. Der oberste Turm und das unterste Verlies, all das gehörte zu Tymurs Reich, und er brauchte es mit niemandem zu teilen.
Der Winter kam und mit ihm der Schnee, und es war Tymur nicht kalt genug. Er wollte einen schneidenden Wind, der um die Mauern pfiff, so kalt, dass die Lippe nicht mehr wusste, wo die Nasenspitze war. So kalt, wie es Tymur in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen war, so kalt, dass man davon erfrieren musste.
»War das Wetter so wie jetzt?«, fragte er Damar, als sie am Fenster standen und hinausspähten.
»Noch ein bisschen kälter«, sagte Damar, und das hieß, sie mussten weiter warten. Jeden Tag sagte er das, und Tymur begriff, dass es wieder Frühling sein würde, ehe Damar das Wetter passend fand, und die Wahrheit war, dass Tymur vielleicht doch ein bisschen Angst davor hatte – so ein ungewohntes Ding, Angst: Außerhalb seiner Träume kannte Tymur nichts, das sich zu fürchten gelohnt hätte. Und nachdem er das einmal durchschaut hatte, beschloss er selbst, dass es jetzt doch kalt genug war für sein Experiment. Wie schnell erfror man, wenn man in seinen besten Sachen auf einem Berggipfel saß? Fror der Körper erst steif, und dann starb man, oder war es umgekehrt? Das musste Tymur herausfinden.
Und wenn es schiefgehen sollte – dann war alles Damars Idee gewesen.
Vielleicht hatten sie wirklich das gleiche Blut. Vielleicht war es verzaubert, Blut, das nicht gefrieren wollte. Es erstaunte Tymur, er konnte sich nicht vorstellen, dass ausgerechnet er wärmer sein sollte als andere Menschen, aber etwas Besonderes zu sein, das gefiel ihm. Zwar kamen diesmal keine Alfeyn, um ihn mitzunehmen, Tymur musste auf seine eigenen Leute warten, als er nicht mehr aufstehen konnte, weil er fast festgefroren war an der steinernen Zinne, auf der er saß wie auf einem Thron, aber er starb nicht.
Tymur mochte die Vorstellung, dass jeder andere an seiner Stelle erfroren wäre. Er lebte, und es fühlte sich gut an. Es war immer egal gewesen, ob es Tymur gab oder nicht, aber plötzlich hatte alles einen Sinn. Er fühlte Leben in sich, je weniger von ihm übrig war, nur noch eine Handvoll Seele, und es war gut. Er machte etwas aus, und wenn es nur für ihn selbst war. Er lebte.
Er beobachtete die Wolken von Atem, die aus seinem Mund kamen, und je länger er saß und je kälter er wurde, desto weniger wolkte es, bis die Luft in ihm und die Luft um ihn gleich kalt waren oder gleich warm – vielleicht wärmte er den Winter im gleichen Maß, wie der Winter ihn kühlte, aber der Winter antwortete ihm nicht. Niemand antwortete ihm. Selbst Damar verstummte, als sie dort oben auf der Zinne saßen und warteten.
Und als Tymur dann irgendwann gefunden wurde, ausgerechnet von seinem Bruder Vjasam – Tymur hatte vergessen, die Tür zum Turm richtig zu schließen –, als sie ihn hinuntertrugen, halb erfroren, aber nur halb, da war er allein. Damar war fort. Und er kam auch nicht wieder. Noch nicht einmal in Tymurs Träumen.
ERSTES KAPITEL
Auf der anderen Seite der Welt starb eine Frau.
Es war nicht wirklich die andere Seite der Welt. Nur ein Türrahmen, nur ein Schritt trennte Kevron von dem Raum, dem Mord und dem Mörder, aber dieser Durchgang war versperrt von einer ebenso unsichtbaren wie undurchdringlichen Barriere, und Kevron hätte darüber nicht froher sein können. So war alles weit weg, unerreichbar, unberührbar, selbst der gellende, entsetzte Schrei erreichte seine Ohren wie aus weiter Ferne, und Kevron stand da, gelähmt, und schaute zu.
Tymur und Ililiané. So ein kurzer Augenblick nur. Eine Bewegung, so schnell, dass der Blick ihr nicht folgen konnte. Ein Griff, der nur der Schriftrolle hätte gelten dürfen. Ein Dolch, der im fahlen Licht silbern funkelte. Dann ein Stoß, so zielsicher, als wäre er nicht der erste seiner Art, sondern der tausendste, und eine Hand im schwarzen Handschuh, die rasch und geübt den Dolch wieder aus dem Herzen der Frau zog. Ililiané stand noch einen Moment lang auf ihren Füßen, dann sackte sie in sich zusammen und fiel zu Boden. Blut begann zu fließen, dunkelrotes Blut, das erst abwartete, als überlegte es noch, und dann aus der Wunde quoll, auf das Kleid, auf die Frau, auf den Steinboden. Rotes Blut wie das eines Menschen …
In Kevrons Ohren hallte ein Echo lang vergangener Worte, gesprochen von den allerersten Alfeyn, die sie getroffen hatten, bevor die zu etwas Gewöhnlichem wurden und sie selbst, die Menschen, nur noch eine Laune der Natur waren: »Wir bluten nicht.« Aber diese Frau war eine Alfeyn, von ihrer schlanken, hochgewachsenen Gestalt bis hin zu der nebelgrauen Haut, und wenn das kein Blut sein sollte, was die Welt um sie herum so rot färbte, dann wusste es Kevron auch nicht mehr.
Er starrte auf die Gestalt am Boden, er hoffte und flehte, dass sie noch am Leben war, dass er sich alles nur eingebildet hatte. Doch es war keine Regung mehr in ihr, und die Wolken unter der Haut hörten auf zu ziehen. Ihre Farbe war nicht mehr das Grau des Himmels, sondern das Grau des Steins, leblos und tot, und das Blut quoll nicht weiter, wo kein Herz mehr schlug, um es hinauszuzwingen. Alfeyn konnten nicht bluten, Alfeyn konnten nicht sterben, doch hier lag Ililiané, die vieltausendjährige, unsterbliche Zauberin, und war tot.
Kevron konnte den Blick nicht von ihr abwenden – nein, er wollte es nicht. Nur sie ansehen, nicht Tymur, Tymur mit dem Dolch in der Hand und dem Blut an den Händen und dem Lächeln im Gesicht … Da war es wieder, das Bild, das ihn heimgesucht hatte, jahrelang: Kaynor, wie er die Tür öffnet, nichtsahnend; der Dolch, der sein Herz durchstößt, schnell und tödlich, und ein Mörder, der sich eilig entfernt, von keinem Menschen gesehen … Seit vier Jahren hatte Kevron dieses Bild im Kopf, immer, ob er wollte oder nicht, er konnte sich betäuben, bis er nur noch Sterne sah, das Bild kam immer zurück, sein Bruder auf der einen Seite, ein dunkler Schatten auf der anderen. Bis jetzt. Jetzt hatte dieser Schatten ein Gesicht. Tymurs. Es half nichts, Kevron musste hinsehen, Kay war nicht hier, ein anderer Mord, eine andere Zeit – und in dem Moment begriff Kevron, dass es nicht Ililiané war, die er hatte schreien hören. Es war Tymur.
Dann schrie Tymur wieder. »Was geschieht mit mir?« Nicht wie ein Mörder. Wie ein Kind, ein kleines, verängstigtes Kind. Der Dolch, einstmals silbern, jetzt rot bis zum Schaft, entglitt seinen Händen und fiel zu Boden, und dieses Klirren war es, das Kevron zurückrief in seinen eigenen Verstand und seine eigene Wirklichkeit. »Was tue ich hier?«
Tymur griff sich an den Kopf mit beiden Händen, er ging in die Knie, bäumte sich verzweifelt auf und blickte sich um, mit so großen und leeren Augen, als könne er selbst am allerwenigsten glauben, was um ihn herum geschah. Und aus der verzerrten Fratze, die Kevron eben noch verfolgt hatte, aus dem schwarzen Mann, der Kaynor getötet hatte und der nun hinter Kevrons Leben her war, wurde wieder Tymur Damarel, Prinz, Jüngling und, vor allem, Freund – ein Freund, der Kevron gerade mehr brauchte als alles andere.
Die Angst in Kevrons Hirn wich kühler Berechnung, klar, ruhig, scharf. Enidin tat schon, was sie konnte, war so in ihren Zauber vertieft, in den Versuch, ein Loch in die unsichtbare Wand zu machen, dass sie, mit etwas Glück, noch nicht einmal mitbekommen hatte, was auf der anderen Seite geschah. Und Lorcan, sonst der Erste, wenn es darum ging, Tymur beizustehen, lag hinter Kevron am Boden in seinem Blut, und wenn er noch bei Bewusstsein war, war das schon viel. Blieb nur Kevron.
»Enid«, sagte er laut. »Wie weit bist du?«
Enidin nickte mit zusammengekniffenen Lippen, und Kevron entging nicht, wie sehr sie zitterte. »Was … was war das?«, fragte sie mit brüchiger Stimme.
»Schau nicht hin«, sagte Kevron. »Schau nur auf dein Werk, und behalt die Nerven. Alles wird gut. Dein Portal ist das Einzige, was es gibt, alles andere –«
»Sie ist tot, nicht wahr?«, flüsterte Enidin. »Sie ist tot, Ililiané ist tot!«
»Das ist sie.« Kevron nickte. »Denk nicht darüber nach, du kannst nichts für sie tun. Aber für uns, und für Tymur.« Er hörte sich reden und glaubte selbst nicht, was er da sagte. Für Tymur? Für? Hatte er den Verstand verloren? »Sobald du eine Öffnung hast, die groß genug ist, dass sich da ein Mensch durchquetschen kann, hörst du auf und sagst mir Bescheid, ja?«
»Aber sie ist tot …«
Kevron zuckte die Hand, fast hätte er Enidin ins Gesicht geschlagen, um sie zur Besinnung zu bringen, doch er riss sich zusammen. Sie war so gut wie fertig mit dem Portal, ein Schlag hätte alles zunichte gemacht, und vor allem war Kevron kein Schläger. Enidin musste zurechtkommen. Kevron kannte keinen Menschen, der so von seiner Vernunft bestimmt wurde wie sie. Sie sollte sich freuen, dass sie etwas zu tun hatte. Kevron hingegen …
»Lorcan!«, rief er und packte den Mann, von dem er nicht mal wusste, ob der noch bei Bewusstsein war, bei der Schulter. Irgendwas tun. Irgendwas. »Kannst du mich hören?«
Sehr langsam nickte Lorcan. Sein Atem ging rasselnd, und sein Gesicht war kalkweiß und kalt. Kevron zog sich die Jacke aus und breitete sie über Lorcans Körper, diese Jacke, die ihm selbst immer viel zu groß gewesen war und die sich danach sehnte, endlich wieder einem besseren Mann dienen zu dürfen. Nur ein Zeichen und vielleicht etwas Wärme.
Lorcan schüttelte den Kopf, so langsam, wie er genickt hatte, und presste die Arme enger an den Körper. »Es geht schon …«, brachte er hervor.
»Du bist die Treppen allein raufgekommen«, sagte Kevron. »Meinst du, die schaffst du auch wieder runter? Nicht sofort, aber nachher? Ich kann dich stützen, bloß zum Tragen bist du mir zu schwer.«
»Geht schon«, wiederholte Lorcan. Der Schweiß stand ihm im Gesicht, er zitterte am ganzen Körper, doch er kämpfte sich hoch, versuchte, sich an der Wand hinter ihm aufzurichten, und wenn es sein Stolz war, der ihm die Kraft dafür verlieh, hielt Kevron besser sein Maul und ließ ihn in Ruhe.
»Ich bin so weit«, sagte Enidin heiser. Auch sie sah aus, als könnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Kevron schämte sich fast, dass es ihm noch so gut ging. Aber sie hatte es geschafft. Dort, im Durchgang, klaffte eine Öffnung in der Welt, einfach so. Sie war nicht besonders groß, kein Vergleich zu dem Portal, durch das Enidin sie nach Ailadredan geführt hatte oder aus dem Dämonenwald, aber immerhin, das Loch war da. Seine glitzernden Ränder waren ausgefranst, als könnten sie sich nicht entscheiden, zu welcher Welt sie gehörten. Dahinter lag die Turmstube, in ihr die tote Frau, und Tymur … Tymur war verschwunden.
Kevron schluckte, befürchtete schon das Schlimmste, und dann verstand er. Tymur war immer noch da. Er hockte unter Ililianés Schreibtisch, zusammengekauert, so weit weg von der Leiche, wie es irgendwie ging. Das Portal hing vor Kevron in der Luft, zitternd, schillernd, und wartete darauf, dass er hindurchstieg.
»Gut«, sagte Kevron mit trockenem Mund. »Jetzt tu, was ich dir sage, Enid. Geh die Treppe runter, langsam, nicht rennen, sonst fällst du noch. Zähl, bis du ungefähr fünfzig Stufen hast, und dann bleib stehen und warte. Hab keine Angst, aber bitte, geh die Treppe runter.«
Enidin blickte ihn an, als wäre sie ein Tier in der Falle, und jetzt, da sie ihre Arbeit getan hatte, gab es nichts mehr, das sie auf dieser Seite der Vernunft hielt. »Aber, ich …«, stammelte sie, »wenn ich jetzt … Ihr könnt nicht …«
Kevron schüttelte den Kopf und fragte sich, wo er diese Ruhe hernahm. »Enid«, sagte er und legte ihr die Hände auf die Schultern, ganz langsam. »Keine Angst. Keine Fragen. Dir wird nichts passieren. Vertrau mir, und tu ein einziges Mal, was ich dir sage.« In ihm brodelte es. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm blieb, wie lange dieses Portal halten sollte, das Enidin in eine Wirklichkeit geflochten hatte, die ihr fremd war, oder ob das, was auf der anderen Seite lauerte, es beim Lauern belassen würde, nun, da es einen Weg ins Freie gab. Aber gerade deswegen musste Enidin da weg. Damit zumindest einer von ihnen in Sicherheit war.
Endlich gehorchte die Magierin. Rückwärts, die Hand an der Wand, den Blick fest auf ihr Portal gerichtet, stieg sie die Treppe hinunter, vorsichtig, Stufe für Stufe, bis sie um die Biegung verschwunden war und nur der Hall ihrer Schritte verriet, dass sie brav weiterging. Wenn sie nun ganz hinunterlief, aus dem Turm hinaus, und den Alfeynsoldaten unten verriet, was oben geschehen war … Doch da verstummte der Hall auch schon. Enidin wartete. Kevron atmete auf. Am liebsten hätte er Lorcan auf dem gleichen Weg in Sicherheit gebracht, aber was nicht ging, das ging nicht. Keine Zeit mehr verlieren. Kevron hatte ein Portal – und keine Wahl, als es allein mit einem Dämon aufzunehmen.
Es war ein Versprechen, das er Tymur gegeben hatte, ein Versprechen, das darauf wartete, eingelöst zu werden.
»Tymur«, rief Kevron, »wenn du mich hören kannst: Bleib, wo du bist. Rühr dich nicht, ich komme jetzt zu dir rein.« Er bewunderte sich selbst für seine kühle Ruhe. Keine Droge der Welt hatte ihn jemals so gelassen gemacht wie in diesem Moment, wo sowieso alles zu spät war. Tymur nickte, dann griff er wieder an seine Stirn, rang mit sich oder dem unsichtbaren Feind, der sich seines Körpers bemächtigt hatte und ihn nicht mehr hergeben wollte.
Einen letzten Augenblick zögerte Kevron. Da drin war entweder ein Tymur, der ein kaltblütiger Mörder war und sich jetzt gut zu verstellen wusste, oder ein nicht minder kaltblütiger Dämon. »Ich komme jetzt rein«, sagte Kevron noch einmal.
Das Portal hing vor ihm in der Luft, gerade groß genug, um hindurchzuschlüpfen, doch seine Ränder sahen so gefährlich aus, dass er sie lieber nicht berühren wollte. Vorsichtig führte Kevron seine Hand in die Nähe der unscharfen, zitternden Linie und zog sie gleich wieder weg. Seine Fingerspitzen begannen zu summen und wurden taub. Das Gefühl verflog schnell, zum Glück, aber damit war klar, er durfte da wirklich nicht drankommen. Kevron war kein Artist, und so geschickt seine Finger auch waren, er konnte nicht einmal reiten. Da war eine Öffnung mitten in der Luft, vielleicht zwei Ellen im Durchmesser, und Kevron hatte keine Ahnung, wie er da durchkommen sollte.
Ein geschickter Gaukler spränge mit einem Hechtsprung, Arme und Kopf voraus, hindurch. Kevron musste es deutlich weniger elegant versuchen, mit dem linken Fuß zuvorderst. Das Bein hoch anwinkeln, dann war das schon mal durch – nur, wenn er jetzt das andere Bein entlastete, saß ihm der ausgefranste Rand der Wirklichkeit mitten im Schritt …
Kevron hielt die Luft an und rührte sich nicht. Wer sollte ihm helfen? Lorcan, den die Anstrengung buchstäblich zerreißen konnte, oder lieber Tymur mit seinem Dämon? Irgendwann musste Kevron auch mal selbst etwas riskieren. Er schob das Bein mit ausgestrecktem Fuß noch weiter durch die Öffnung, streckte den linken Arm hinterher, dann den Kopf, es ging besser als gedacht, und Tymur hatte unterm Tisch wenigstens etwas zu lachen. Den rechten Arm am Rumpf vorbei auf die andere Seite zu bringen war schwieriger, schon war er taub von oben bis unten, und es wurde nicht leichter davon, dass Kevron aus gewohnter Feigheit beide Augen zusammenkniff – dann stieß er sich vom Boden ab, hing einen Augenblick zwischen den Welten, und war drüben.
Kevron landete unsanft auf der Seite. Fluchend rappelte er sich auf … Jetzt, wo es zu spät war zum Weglaufen, rutschte ihm das Herz in die Hose. »Ich bin gleich bei dir, Tym«, sagte er und zwang seine Stimme, nicht zu zittern. Eines nach dem anderen. Wenn Ililiané noch lebte, wenn es irgendwie möglich war, sie zu retten … Die Zauberin war ihre einzige Hoffnung – nicht mehr wegen der Frage, ob La-Esh-Amon-Ri noch in die Schriftrolle eingeschlossen war, das hatte sich wohl von selbst beantwortet, aber um ihn aus Tymur wieder hinauszubekommen.
Kevron wollte lieber glauben, dass Ililiané noch lebte. Er war noch nie einer Leiche so nah gewesen: Kevron hatte einige Ehrfurcht vor den Toten, und wahrscheinlich konnte man »Ehr« dabei sogar weglassen. Aber jetzt, wo etwas davon abhing, mehr als nur ein Leben, ging er auf die Knie und rutschte an die vielleicht doch noch nicht ganz tote Alfeyn heran. Seine Hände zitterten angesichts all dieses Blutes. Es war seltsam, dass ein erwachsener Mann, der ohne mit der Wimper zu zucken einem toten Hund die Haut abziehen konnte, weiche Knie bekam, sobald es um Menschen ging.
Aber das hier war kein Mensch, daran konnte er sich festhalten. Auch wenn sie so, wie sie da lag, aussah wie eine normale Frau, war Ililiané doch eine Alfeyn. Moralisch irgendwo zwischen Mensch und Hund … Kevron musste seinen Verstand dazu zwingen, aber es half. Kein Mensch. Er konnte das tausendmal wiederholen. Es wurde davon nicht besser. Es machte ihm nur weniger aus.
Dann, vorsichtig, berührte er Ililiané. Er fühlte kein Leben. Erst am Hals, dann wälzte er sie auf die Seite, um über dem Herzen nach einem Puls zu tasten. Ihm fehlte der Vergleich. Er hatte nie auch nur einen lebenden Alfeyn berührt. Hatten die überhaupt einen Puls? Ililianés Haut war kalt, kälter, als sie in der kurzen Zeit seit ihrem Tod geworden sein konnte. Auch dem Blut, das an Kevrons Händen klebte, fehlte die Wärme.
Es gab nichts daran zu rütteln, sie war tot. Was war leichter zu glauben? Dass Tymur Damarel mit einem Lächeln auf den Lippen einen verborgenen Dolch zog und eine Frau abstach – oder dass es nichts als einen Stich ins Herz brauchte, um die mächtigste und bedeutendste Zauberin, die jemals gelebt hatte, umzubringen? Vielleicht war das ihr großes Geheimnis, der Grund, warum sie sich von dem Rest der Welt und ihrem eigenen Volk zurückgezogen hatte: Wer gab schon gerne zu, sterblich zu sein?
Kevron konnte nichts mehr für sie tun. Tot war tot. Alles, was ihm noch blieb, war, mit seinem Schnupftuch so viel wie möglich von dem vergossenen Blut aufzuwischen. Er brauchte einen Moment, um selbst zu verstehen, was er da tat: Der Fälscher in ihm übernahm die Kontrolle. Er verwischte Spuren. Ililianés Blut … Das Blut, das Tymur, nachdem er sich in den Arm geschnitten hatte, so großzügig auf den Fußboden hatte tropfen lassen … Wenn sie den Tag überleben wollten, dann durfte niemand wissen, was Tymur getan hatte, am wenigsten die Soldaten, die unten mit ihren Schwertern vor der Tür warteten. Lieber ein Tymur mit einem Dolch als neun Alfeyn mit Krummschwertern …
»Tymur«, sagte Kevron, jedes Wort ein Kampf. »Wenn du mich hören kannst, wenn du gerade du selbst bist, komm und hilf mir.«
»Mir ist nicht zu helfen«, sagte Tymur dumpf und rührte sich nicht.
»Nicht dir«, erwiderte Kevron, und es ging schon besser, »mir. Ich kann sie allein nicht hochheben.« Ililiané durfte nicht da liegen bleiben, mitten auf dem Boden und so offensichtlich tot wie nur was. Wenn sie hingegen in dem Sessel saß, mit dem Rücken zur Tür … Kevron dachte so schnell, dass er selbst kaum hinterherkam. Lorcan war verwundet. Gut. Alles Blut, das jetzt an Tymur klebte, an Hose, Ärmeln, Händen – wie sollte jemand auf die Idee kommen, dass das Alfeynblut war, wenn sie einen heftig blutenden Menschen dabeihatten? Wenn sie den Verwundeten gemeinsam hinunterschafften, bekam Tymur genug von Lorcans Blut ab, dass niemand mehr einen Unterschied auch nur riechen konnte. »Komm und hilf mir!«, wiederholte Kevron. »Dafür bringe ich dich hier raus, du hast mein Wort.«
Jetzt, endlich, kam Leben in Tymur. »Ich kann nicht!«, stieß er hervor. »Komm nicht näher!«
Kevron blieb so ruhig, wie man es auch gegenüber einem tollwütigen Hund bleiben musste. »Tym, ich bin dein Freund, ich bin hier, um dir zu helfen.«
»Komm nicht näher!«, fauchte Tymur wieder und drehte sich weg, drückte sich so eng gegen das Tischbein, als wollte er darin verschwinden. »Sonst – sonst bring ich dich auch noch um!« Er drohte nicht, er hatte Angst. »Ich habe Ililiané umgebracht, was, wenn es wieder passiert?«
»Du bringst mich nicht um.« Kevrons Blick suchte Tymurs. »Du hast keinen Grund dafür.«
»Ich hatte eben auch keinen Grund!« Tymurs Stimme wurde immer jünger, kläglicher, verzweifelter.
Kevron zischte durch die Zähne. Er war auf einen mordlüsternen Tymur eingerichtet, nicht auf einen weinerlichen. Es war nicht verwunderlich, dass Tymur außer sich war und halb von Sinnen, aber wenn Kevron sich zusammenreißen konnte, dann musste das für Tymur erst recht gelten.
»Schieb mir den Dolch rüber«, sagte Kevron. »Grund oder nicht, ohne Waffe kannst du mir nichts tun.«
»Und wenn … wenn ich irgendwo noch einen versteckt habe, von dem ich nichts weiß?«
»Dann kann ich mich zumindest verteidigen.« Sie wussten beide, dass Kevron mit Waffen so hilflos war wie ohne.
Tymur zögerte noch eine Ewigkeit, dann schlitterte sein Dolch über den Steinboden. Die Spannung schien von dem Prinzen abzufallen, und sein erleichterter Seufzer musste bis unten zu hören sein: Weil er einen Dummen gefunden hatte, der ihm die Mordwaffe abnahm? Oder nur, weil er froh war, das blutbefleckte Ding los zu sein? Kevron nahm den Dolch und verfluchte sich, seine Sachen bei Lorcan gelassen zu haben. Einen Moment lang war er unschlüssig, dann wischte er das Blut von der Klinge und schob sich den Dolch hinter den Gürtel, verwegen wie ein Straßenräuber, unschuldig wie ein Mörder.
»Gut«, sagte er, und: »danke«, und traute sich selbst endlich zu Tymur hin. Den Prinzen auf die Füße bringen – die Leiche in den Sessel bugsieren – und dann zusehen, dass sie wegkamen. In seinem Kopf überschlug sich alles. Wenn er versuchte, den Dämon in Tymur zu ignorieren, blieb der ein Mörder. Ignorierte er aber den Mörder, hatte er immer noch einen Dämon übrig. Trotzdem trat er zu Tymur hin und legte ihm eine Hand auf die Schulter, ganz egal, wen er damit erreichte.
Zumindest Tymurs Schulter fühlte sich auch nicht anders an als früher, und er fuhr auch nicht herum, um seine Zähne in Kevrons Hals zu schlagen. Er sah aus wie immer, aber war das nicht das eigentlich Tückische an Dämonen?
»Komm jetzt«, sagte Kevron. »Hilf mir mit der Zauberin, und ich bringe dich hier raus.«
»Und wäre das eine kluge Idee?«, fragte Tymur leise und ohne Ironie. »Warum willst du nicht die Welt vor mir in Sicherheit bringen?«
»Weil du mein Freund bist«, erwiderte Kevron. »Und weil ich dir mein Wort gegeben habe, und es ist besser, daran erinnere ich dich als du mich.«
»Ich verstehe dich nicht.« Tymur schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie du mir noch vertrauen kannst – ich kann es doch nicht einmal mehr selbst. Ich weiß nicht, wie mir geschieht, eben noch stehe ich vor Ililiané und will ihr die Schriftrolle zeigen, und dann …«
»Später«, sagte Kevron. »Ich will keine Erklärungen hören und keine Entschuldigung. Ich habe mich entschieden, dir zu vertrauen. Nichts von dem, was du jetzt sagst, kann etwas daran ändern.« Es war die schwerste Entscheidung in Kevrons Leben, die weitreichendste, und die schnellste. Kevron wollte leben. Und wenn er dem Prinzen jetzt nicht mehr vertraute, würde die Angst ihn umbringen, noch bevor Tymur das tun konnte.
Tymur nickte. Niemand konnte sagen, was gerade in seinem Kopf vorging, wahrscheinlich noch nicht einmal er selbst. Aber endlich half er Kevron mit der toten Zauberin, die trotz Kevrons Bemühungen eine prachtvolle Blutlache am Boden hinterlassen hatte.
»Wir bräuchten eine Scheuerbürste«, murmelte Kevron. »Und einen Eimer heißes Wasser.« In dem Moment wünschte er sich den alten Tymur zurück, der ihn schief ansehen und eine Bemerkung machen würde wie: ›Ich hätte nicht erwartet, dass ausgerechnet du etwas vom Putzen verstehst‹. »Oder einen Teppich, den wir hier drüberlegen könnten.« Er zwinkerte. »Wandteppich, schnell!« Es war egal. Wenn sie einmal hier weg waren, würden sie niemals wieder zurückkommen. Und die Alfeyn hatten Ililiané fast tausend Jahre lang in Ruhe gelassen – da mussten sie die Leiche nicht ausgerechnet jetzt entdecken, und ohne Damars Blut kamen die sowieso nicht in den Turm. Aber wenn Kevron einen Funken Ehre im Leib hatte, war es seine Berufsehre. Er arbeitete entweder gar nicht oder gründlich.
»Wenn du wissen willst, warum ich dir helfe«, sagte er leise, »es geht hier nicht nur um dich und mich. Du bist nicht irgendwer, und Ililiané war auch nicht irgendwer. Wenn rauskommt, was du getan hast … Ich will nicht, dass diese Kerle mit ihren Krummschwertern in Neraval einfallen und als Vergeltung alles abschlachten, was sich bewegt. Wir haben genug am Hals mit den Dämonen. Ich will nicht auch noch einen Krieg mit den Alfeyn.«
Tymur nickte. »Da sind wir schon zu zweit«, antwortete er, und endlich klang er wieder wie der, den Kevron kannte. »Aber was hast du vor? Was sollen wir tun?«
»Wir haben zwei Möglichkeiten«, sagte Kevron. »Theoretisch.« Jetzt waren sie wieder Komplizen, wie damals, als Kevron die Schriftrolle gefälscht hatte. »Entweder, wir gehen da runter und sagen den Soldaten, dass Ililiané nicht da war und wir nichts gefunden haben. Oder wir sagen, sie war schon tot, als wir angekommen sind, bloß, dafür waren wir zu lang hier oben, dafür ist das Blut zu frisch. Aber das andere – das müssen sie uns abkaufen.«
»Also gut.« Tymur atmete durch. »Danke. Für dein Vertrauen, für alles. Ich weiß nicht, wie ich dir das jemals zurückzahlen kann …«
»Ich bin der Letzte, einen Sack voll Geld abzulehnen.« Kevron grinste. »Weißt du doch. Aber darum können wir uns später kümmern, jetzt geht es hier erst mal raus. Was macht dein Arm, blutet der noch? Gut. Hast du dich gerade unter Kontrolle? Oder soll ich das Reden übernehmen?«
»Ich kriege das hin«, sagte Tymur. »Es wäre wenig glaubwürdig, wenn plötzlich du der Wortführer bist.« Endlich, der alte Tymur. Und solange Enidins Portal noch hielt, sollten sie zusehen, dass sie wieder zurückkamen. In der Turmstube gab es nichts mehr zu tun. Das Blut auf dem Boden war verschwunden unter einem Teppich, der eigentlich an der Wand hängen sollte. Ob die Tote im Sessel mit den Jahren verwesen würde, ob das Blut verblasste oder auch hier alles von den Fliegen gefressen wurde, das wollte Kevron gerade gar nicht wissen. Nur hinaus, zurück in die Stadt, und dann weitersehen. Lorcan durchbringen. Und, noch wichtiger als alles andere, irgendwo Alkohol auftreiben.
Durch das Portal zurückzukommen war deutlich einfacher als der Hinweg. Diesmal wusste Kevron, worauf er achten musste, und sie konnten einander helfen. Der Dämon hielt Kevron für nützlich genug, um leben zu dürfen, und auf der Basis konnten sie jetzt zusammenarbeiten.
Jugend und Eleganz waren auf der Seite des Prinzen, und Tymur schlüpfte durch Enidins Portal, als hätte er im Leben nichts anderes getan. Das Loch hatte lange genug gehalten. Wenn es jetzt wieder verblasste, gab es keine Beweise mehr, dass sie jemals in der Turmstube gewesen waren. Noch hing es in der Luft, zerbrechlich und zittrig wie im ersten Moment und doch erstaunlich haltbar, aber darüber wollte sich Kevron gerade keinen Kopf machen.
»Da wären wir, Lorcan«, sagte er und atmete durch. »Lorcan?« Er wusste nicht, wie viel Zeit sie in der Turmstube vertrödelt hatten, aber es war Zeit, die Lorcan nicht hatte, und während sie Ililianés Blut aufgewischt hatten, war Lorcans offenbar weiter geflossen. Als Kevron ihn jetzt anredete, reagierte er nicht, seine Augen waren irgendwo zwischen offen und geschlossen, und es war keine Regung mehr darin.
»Lorcan!«, schrie Kevron und schüttelte ihn. »Hörst du mich?« Seine Hände zitterten, als er nach dem Puls fühlen wollte, und er konnte nicht sicher sein, ob das, was er fühlte, nun Lorcans Herzschlag war oder nur seine eigene Nervosität. »Sag was, irgendwas!«
Tymur schob ihn zur Seite, ein ruhiger, gefasster Tymur, der wieder Herr der Lage war. »Lass mich ran«, sagte er sanft, zog einen Handschuh aus und fühlte Lorcans Puls und Atem. »Den kriegen wir durch«, sagte er. »Verdammt, ich will gar nicht wissen, wie viel Blut heute für mich und durch mich vergossen worden ist, aber eines sage ich euch, Lorcan stirbt nicht.« Er strich dem Mann über das zerfurchte, schweißnasse Gesicht – so viel Wärme lag in dieser Geste, so viel Zuneigung, so viel Mitgefühl, dass nur schwer vorstellbar war, wie diese Hand eben noch gemordet haben konnte.
Dann beugte sich Tymur über Lorcan und flüsterte ihm ins Ohr, dass es Kevron nur gerade eben noch hören konnte. »Mein Freund«, sagte Tymur. »Nicht mein Wächter, nicht mein Beschützer – mein Freund. Du hast mir so viel versprochen in den Jahren, die wir uns kennen, und alles davon hast du gehalten. Jetzt verspreche ich dir etwas: Du wirst nicht sterben, nicht heute und nicht morgen und nicht an dieser Wunde. Das schwöre ich dir, bei meinem Leben.«
Es mochte Einbildung sein, aber es war fast so, als träte bei diesen Worten ein kleines Lächeln in Lorcans Gesicht. Tymur nahm die Jacke von Lorcans Körper und gab sie Kevron zurück. »Hier, das war ein netter Gedanke, aber er braucht sie nicht halb so dringend wie du. Wenn wir ihn tragen, schaffst du das?« Alles, was in der Turmstube geschehen war, schien vergessen. Es gab nur noch Lorcan und sein Leben in Tymurs Händen.
Kevron zischte durch die Zähne. Lorcan in die Mitte zu nehmen, ihn unterzuhaken und halb zu tragen, halb zu schleifen, das traute er sich noch zu. So hatten sie ihn auch das letzte Stück nach oben bekommen. Aber da konnte Lorcan zumindest noch mithelfen, und wer aufwärts fiel, der nahm keinen großen Schaden. Wenn es hingegen abwärts ging … »Ich versuche es«, sagte Kevron. »Ich geb mein Bestes. Aber wenn seine Wunden dabei noch weiter aufreißen …«
»Wir haben keine Wahl«, sagte Tymur bitter. »Es ist meine Schuld, ich hätte niemals, niemals zulassen dürfen, dass er hier hochsteigt, er hätte sich unten ausruhen müssen, aber ich …« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist – war ich da noch ich selbst? Oder war das schon der … der andere?«
»Später«, knurrte Kevron. »Wir haben keine Zeit für Schuldzuweisungen und den ganzen Scheiß. Sehen wir zu, dass wir Lorcan heile runterbekommen. So heile wie irgendwie möglich, heißt das.« Die Jacke war nass von Blut. Kevron zog sie über, um die Hände für Lorcan frei zu haben, aber er brachte es nicht über sich, sie zu schließen. Dass Lorcans Verwundung jetzt Tymur den Hals retten sollte und Kevrons gleich mit – Kevron war sich sicher, das hätte Lorcan stolz gemacht. Aber das war eine schwache Entschuldigung.
Mit vereinten Kräften hoben sie Lorcan hoch, und Tymur versuchte, ihn sich auf den Rücken zu laden. Es war das Einfachste, wenn sie sich abwechselten und dabei Lorcan so fest und sicher hielten, wie es ging. So konnte Tymur nur langsam Stufe um Stufe nehmen, rückwärts, damit Lorcans Beine nicht hinter ihm herschleiften. Vorsichtig tastete er sich abwärts, während Kevron aufpasste, dass Tymur nicht danebentrat. Wie hoch war der Turm? Auf dem Weg hinauf hatte Kevron die Stufen gezählt, aber irgendwann aufgegeben. Jetzt schienen es unendlich viele zu sein.
Wenigstens hatte Enidin auf sie gewartet. Die Magierin hockte auf der Treppe und weinte. Sie bot einen kläglichen Anblick, aber keinen, mit dem Kevron sich jetzt lange aufhalten mochte. »Steh auf«, sagte er nur, »und komm mit runter. Es ist alles in Ordnung.« So glatt ging ihm das über die Lippen, während hinter ihm ein Mann, der ein Mörder war oder ein Dämon oder beides, einen blutenden, bewusstlosen Menschen die Treppe hinuntertrug. Die Hände, mit denen Lorcan so lange versucht hatte, das Blut am Fließen zu hindern, hingen jetzt vor Tymurs Brust, und an der Seite rann wieder das Blut herunter und tropfte auf die steinernen Stufen.
Enidin widersprach nicht, sprang nur auf die Füße und nickte, angestrengt bemüht, nicht zu Tymur hinzuschauen. »Kann ich etwas tun?«
Kevron wollte schon den Kopf schütteln, aber dann besann er sich eines Besseren. Enidin war größer als er, vielleicht sogar größer als Tymur – natürlich konnte sie helfen. »Wir wechseln uns ab beim Tragen«, sagte er. »Wenn es geht, kannst du gleich mit anpacken.«
So schleppten sie Lorcan die Stufen hinunter, und der Turm schien mit jedem Schritt zu wachsen. Jetzt, ausgerechnet, hätten sie die Stärke des Dämonenfürsten brauchen können, aber wenn der wirklich in Tymur saß, behielt er doch seine Kraft für sich. Sonst musste man einen Turm bezwingen, indem man hinaufstieg, nun kämpften sie sich Stufe für Stufe nach unten, mit zusammengebissenen Zähnen und bitterem Bangen, wenn sie den Bewusstlosen von einem Rücken auf den anderen luden – aber irgendwie kamen sie tatsächlich unten an, lebendig, alle vier.
Die letzten Stufen waren die einfachsten, gleich hatten sie es geschafft, und dort warteten die Alfeyn mit ihrem Hauptmann, das waren Soldaten, die würden schon wissen, wie sie eine Wunde versorgen konnten. Alfeyn bluteten ja doch …
Sie standen rechts und links der Klamm, wie zuvor Ililianés Steinerne Wächter, mit ihrem Hauptmann direkt vor der Tür. Tymur hatte ihnen befohlen, den Turm zu bewachen, und das taten sie auch, gehorchten aufs Wort, brave Krieger, die sie waren. Als Kevron und Tymur Lorcan ins Freie schleppten und die blutbefleckte Enidin vorauslief, begriffen die Alfeyn sofort, dass etwas nicht stimmte – nur was wirklich passiert war, davon hatten sie keine Ahnung und würden es auch niemals erfahren.
»Schnell!«, rief Tymur. »Er verblutet! Er braucht Hilfe!« Dass Lorcan die schon gebraucht hätte, bevor es auch nur an den Aufstieg ging, sollten die Alfeyn noch wissen. Tymurs Stimme zitterte vor Angst oder Anstrengung. »Bitte, ich kann ihn nicht mehr halten!«
»Lasst ihn zu Boden gleiten«, sagte der Hauptmann. »Vorsichtig. Ich werde mir die Wunde ansehen.«
Kevron versuchte zu helfen, aber schon damit, Lorcan die Rüstung auszuziehen, war er überfordert. Er hatte keine Ahnung, wie man in so ein Kettenhemd hineinkam – natürlich hatte Lorcan es nachts ausgezogen, aber dann stand der so unerträglich früh auf, dass Kevron nie etwas davon mitbekam: Zog man das über den Kopf, wie ein Leibchen? Wie bekamen sie Lorcan hinaus, ohne ihm noch unnötig wehzutun? Deutlich war zu erkennen, wo die Waffe die Kettenglieder durchtrennt hatte wie ein warmes Messer, das durch Butter fährt. So eine eindrucksvolle Rüstung, und doch wirkungslos.