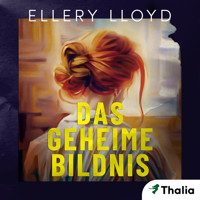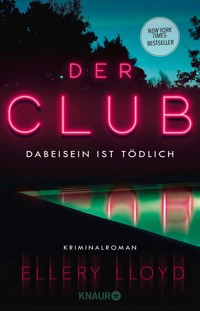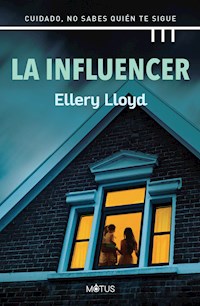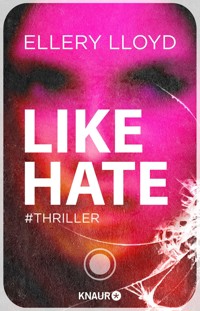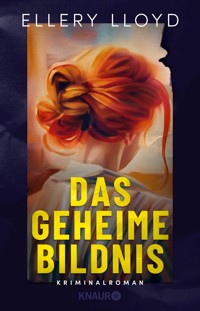
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Manche Frauen lassen sich nicht aus der Geschichte streichen … Ellery Lloyds raffinierter, hoch spannender Roman »Das geheime Bildnis« erzählt eine wendungsreiche Story voller Rätsel, die ein Jahrhundert durchziehen. Es geht um tödliche Familiengeheimnisse, Liebe – und Kunst. Paris, 1938: Hierher hat sich die begabte junge Malerin und reiche Erbin Juliette Willoughby vor ihrer Familie geflüchtet, zusammen mit ihrem 20 Jahre älteren verheirateten Geliebten. Als beide bei einem Brand ums Leben kommen, verbrennt auch Juliettes Meisterwerk, das surrealistische Gemälde Selbstporträt als Sphinx. Cambridge, 1991: Die Kunst-Studenten Caroline und Patrick stoßen auf Hinweise, dass Juliettes Tod kein Unfall war, und kommen sich dabei näher. Es scheint, als hätten die aristokratischen Willoughbys bis heute etwas zu verbergen … Dubai, heute: Patrick, mittlerweile Kunsthändler wie sein Vater, fädelt ein sensationelles Geschäft ein. Eine überraschend aufgetauchte zweite Version von Selbstporträt als Sphinx wird für einen märchenhaften Betrag verkauft. Am nächsten Tag wird Patrick wegen Mordes verhaftet: Sein ältester Freund – der letzte Erbe der Willoughbys – wurde mit aufgeschnittener Kehle gefunden. Auf der Tatwaffe, dem zerbrochenen Stil eines Champagnerglases, sind Patricks Fingerabdrücke. Enthält Juliettes Gemälde den Schlüssel zu den tödlichen Geheimnissen ihrer Familie? Vielschichtiger Kriminalroman zum Miträtseln um die dunklen Geheimnisse der High Society Mit »Das geheime Bildnis« liefert das Autoren-Paar Ellery Lloyd ein Meisterwerk intelligenten Thrills: »[…] voller Liebe, Spannung, Familiengeheimnisse, Ägyptologie, Surrealismus und Korruption. Vor allem aber ist es ein Buch über Frauen. Ein herrliches Puzzlespiel von einem Roman!« Kirkus Reviews Entdecken Sie auch die herrlich bissigen Thriller von Ellery Llloyd: - Like / Hate - Der Club. Dabeisein ist tödlich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ellery Lloyd
Das geheime Bildnis
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Paris, 1938: Bei einem Brand kommen die begabte junge Malerin Juliette Willoughby und ihr verheirateter Geliebter ums Leben. Mit Juliette verbrennt ihr Meisterwerk, das surrealistische Gemälde Self Portrait as a Sphinx.
Cambridge, 1991: Die Kunststudenten Caroline und Patrick stoßen auf Hinweise, dass Juliettes Tod kein Unfall war. Und dass die aristokratischen Willoughbys bis heute etwas zu verbergen haben.
Dubai, heute: Patrick, mittlerweile Kunsthändler, verkauft eine zweite Version von Self Portrait as a Sphinx für einen sensationellen Betrag. Am nächsten Tag wird er wegen Mordes an seinem ältesten Freund verhaftet, dem letzten Erben der Willoughbys.
Enthält Juliettes Gemälde den Schlüssel zu den tödlichen Geheimnissen ihrer Familie?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Prolog
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Zweiter Teil
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Dritter Teil
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Vierter Teil
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Epilog
Dank
Vorbemerkung
Mit Ausnahme der fiktiven Figuren Juliette Willoughby, Oskar Erlich und Austen Willoughby handelt es sich bei sämtlichen Künstlerinnen und Künstlern, die in diesem Roman erwähnt werden und/oder vorkommen, um reale historische Persönlichkeiten.
Prolog
Zeit, anzufangen.
Ich stehe in einer Galerie in Dubai auf einem Podium. An der Wand hinter mir ein Gemälde. Es ist kein großes Bild – 76 mal 53 Zentimeter, um genau zu sein. Es ist auch keine sonderlich große Galerie – wir befinden uns im geräumigsten ihrer drei Bereiche, einem weiß getünchten Raum ungefähr von der Größe eines Klassenzimmers. Vor mir sind ein paar Reihen Klappstühle aufgestellt, wo Reporter sitzen. Mit einem Journalisten vom Telegraph und dem Gulf News-Podcast-Team bin ich bereits bekannt gemacht worden. Mehrere Pressefotografen lassen ihre Blitze zucken. Hinter den Stuhlreihen haben sich zwei Fernseh-Crews aufgebaut, eine von einem regionalen arabischen Sender, eine von BBC News.
Neben mir auf dem Podium steht der Eigentümer der Galerie, Patrick Lambert. Er hat die Pressekonferenz organisiert.
»Dr. Caroline Cooper«, sagt er gerade, »ist Fellow am Pembroke College und Professorin für moderne Kunst an der Universität Cambridge. Ihr Spezialgebiet ist der Surrealismus der Dreißigerjahre, ihr besonderes Augenmerk gilt surrealistischer Kunst von Frauen, namentlich dem Werk der britischen Malerin Juliette Willoughby.«
Patrick zählt meine Publikationen auf, verweist vor allem auf meine 1998 erschienene Biografie von Juliette Willoughby, die erste, die je geschrieben wurde, und immer noch – wie er hervorhebt – die gültige Darstellung von Leben, Werk und frühem Tod der Künstlerin. Er erwähnt auch, wie lange wir beide einander schon kennen. Einige Zuhörer lächeln wissend.
Das Bild hinter uns trägt den Titel Selbstporträt als Sphinx. Juliette Willoughby malte es – einundzwanzig Jahre alt – im Winter 1937/38, und gezeigt wurde es erstmals auf der großen Exposition internationale du surréalisme 1938 in Paris, dem Höhepunkt der surrealistischen Bewegung. Jahrzehntelang war es verschollen, galt als zerstört. Gestern Abend ist es verkauft worden. Hier. Für 42 Millionen Pfund.
»Danke, Patrick«, sage ich, während er sich in die erste Reihe setzt. Er zwinkert mir zu, ich verkneife mir ein Lächeln.
Ich bin gebeten worden, mich kurz zu fassen: Fünf Minuten habe ich, um den Surrealismus, seinen historischen Kontext und die ihm zugrunde liegende Philosophie zu erläutern. Um zu erklären, warum dieses Kunstwerk so bedeutend ist, warum ich es für echt halte und warum ich bereit bin, für diese Meinung meine fachliche Reputation in die Waagschale zu werfen. Um die Geschichte der Künstlerin und dieses Bildes zu erzählen, zu beschreiben, wie es verloren ging und wie es wiedergefunden wurde – zweimal.
Es ist eine Geschichte, die an einem feuchten Herbstvormittag 1991 in Cambridge beginnt, bei unserer ersten Besprechung mit Alice Long über unsere wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, wo Patrick und ich auf die Spur gesetzt wurden, die uns schließlich zu Juliettes verschollenem Meisterwerk führen sollte.
Es ist eine Geschichte, die an einem Winterabend 1937 in Paris beginnt, als eine weggelaufene britische Erbin in dem kalten, engen Atelier am Montmartre, das sie sich mit ihrem Geliebten, einem berühmten Maler, teilte, die Arbeit an einem der bemerkenswertesten Bilder der Zeit begann.
Es ist, schätze ich, auch die Geschichte von Patrick und mir. Wie wir uns ineinander verliebten. Wie ein Gemälde uns zusammenführte, dann auseinanderbrachte und nun anscheinend wieder vereint hat.
Mir ist klar, dass höchstens dreißig Sekunden von dem, was ich sage, es ins Fernsehen schaffen werden, ein oder zwei Sätze in die Zeitungen. In den Schlagzeilen wird die Summe stehen, die für das Bild gezahlt worden ist, dazu der Name der Person, die es erworben hat.
Aber im Grunde gibt es ohnehin nur eines, was ich den Anwesenden sagen möchte: Schaut hin. Schaut es an. Fast hätte ich gesagt: Schaut sie an. Denn das Erste, was man wahrnimmt, ist sie. Die beherrschende Figur im Zentrum des Gemäldes. Die wilde rötlich braune Mähne. Die eisblauen Augen. Ihr Ausdruck: herausfordernd, furchtlos. Dann registriert man, dass ihre Brüste nicht bedeckt sind. Dann sieht man, dass es sechs sind, angeordnet wie die Zitzen einer Katze. Dann sieht man, dass sie auch Katzenbeine hat, Katzenschenkel, Fell mit Schildpattzeichnung. Scharfe Klauen. Und man beginnt sich zu fragen, was es wohl zu bedeuten hat, wenn sich jemand als Sphinx porträtiert. Als diese Sphinx.
Erst wenn man nahe herangeht, erfasst man die ganze Raffinesse des Bildes, sieht man die Menschen und Kreaturen rings um die zentrale Sphinx, alle mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, sich der Gegenwart der anderen anscheinend nicht bewusst, das Ganze in einer Szenerie, die halb verwilderter englischer Garten ist und halb Dschungel. Jede neue Gruppe, die man ausmacht, lädt dazu ein, sich zu fragen, welche Geschichte sie wohl alle miteinander erzählen, und während immer neue Muster und Echos aufscheinen und immer neue Rätsel zutage treten, kann die Verwirrung, die man anfänglich empfunden hat, vergehen, sich vielleicht aber auch steigern.
Das Rätsel, auf dessen Lösung die Journalisten hier lauern, ist natürlich viel schlichter: Wie kann es sein, dass dieses Bild überhaupt existiert? Die Antwort lautet: Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich an seine Echtheit glaube, und das bedeutet, dass wir alles, was wir über Juliette Willoughby, ihr Leben und ihr Werk, zu wissen meinten, hinterfragen müssen.
Aber mir bleibt nicht die Zeit, irgendetwas von all dem zu sagen. Ich habe die Anwesenden kaum begrüßt, da entsteht an der Tür Unruhe – drei Nachzügler poltern herein und wiederholen in einem fort auf Arabisch eine Frage. Jemand dreht sich um und bedeutet ihnen, leise zu sein. Ich will eben sagen, dass es vorn noch freie Plätze gibt, da erkenne ich, dass sie Uniform tragen: kakifarbene Hemden und Hosen, die Hosenbeine in glänzende schwarze Stiefel gestopft, schräg sitzende Barette mit goldenem Abzeichen. Eine Mitarbeiterin der Galerie zeigt auf Patrick, und die drei bewegen sich nach vorn, zu uns. Ich bin abgelenkt, spreche aber weiter über das Bild. Patrick erhebt sich stirnrunzelnd und geht auf die Männer zu. Die Fotografen knipsen, die Fernsehkameras laufen.
Halten für die Nachwelt und ein globales Publikum fest, wie Patrick Lambert wegen Mordes festgenommen wird.
Erster Teil
Das Tagebuch
Können Sie angeben, welches die wichtigste Begegnung Ihres Lebens war? – Bis zu welchem Grad hatten Sie und haben Sie auch jetzt noch den Eindruck, daß in dieser Begegnung etwas Zufälliges oder etwas Notwendiges lag?
André Breton, L’Amour fou,1937, deutsch von Friedhelm Kemp
1. Kapitel
Ach du Scheiße. Das war mein erster Gedanke, als ich durch eine metertiefe Pfütze pflügte, in die Elm Lane einbog und durch die Windschutzscheibe eine triefende Gestalt ausmachte, der die blonden Locken klatschnass über den Rücken hingen. Das würde peinlich werden.
Caroline Cooper.
Es bestand kaum ein Zweifel, dass wir dasselbe Ziel hatten – warum sonst sollte sie bei diesem Wetter eine Straße am Stadtrand von Cambridge entlangspazieren? Mein Studienmentor hatte erwähnt, dass die Supervisionsgespräche zu den Abschlussarbeiten in diesem letzten Jahr immer à deux stattfänden. Das sei hoffentlich kein Problem, hatte er gesagt, und ich hatte versichert, das sei es nicht, und vage auf eine attraktive weibliche Supervisionspartnerin gehofft. Ich hätte mal besser hoffen sollen, dass es nicht eine war, mit der ich bereits geschlafen hatte.
An einer Einfahrt blieb sie stehen und sah sich um, suchte vermutlich nach einer Hausnummer. Ich verlangsamte, bis der MG förmlich kroch. Selbst regendurchweicht sah sie umwerfend aus. Ich checkte mein Gesicht im Rückspiegel. Caroline Cooper. Der unwahrscheinlichste aller Fälle.
Wir hatten zweimal miteinander geschlafen, damals, gleich zu Anfang unseres ersten Jahrs. Einmal nach einer Party und dann ein paar Wochen später noch mal, nachdem wir einander leicht beschwipst bei einem College-Ball über den Weg gelaufen waren. Das erste Mal in ihrem Zimmer mit der Lichterkette rund um den Spiegel und dem Frida-Kahlo-Poster an der Wand. Ich erinnerte mich an das schmale Bett, daran, wie ich nachts aufgewacht war und dringend pinkeln musste, sie aber nicht wecken, den Zauber nicht brechen wollte, unsere Beine waren ineinander verschlungen, ihr Kopf lag auf meiner Brust.
Das zweite Mal waren wir Händchen haltend auf verschlungenen Wegen zu meinem Zimmer spaziert und hier und da in einem Türbogen stehen geblieben, um uns zu küssen. Die halbe Nacht waren wir aufgeblieben und hatten geredet, aus angeschlagenen Bechern billigen Weißwein getrunken, am offenen Fenster geraucht und auf den mondbeschienenen Innenhof hinuntergeschaut. Wir redeten über Cambridge, ihre ersten Eindrücke. Über Kunst und Künstler. Ich erzählte ihr Geschichten über meinen Vater und übers Internatsleben. Ohne Frage gab es eine gegenseitige Anziehung. Und ich hatte das Gefühl, es entstünde eine echte Verbindung zwischen uns, als wäre dies der Anfang von etwas wirklich Aufregendem.
Und dann passierte … nichts. Ich hinterließ eine Nachricht in ihrem College-Postfach. Keine Antwort. Ich hielt in den Vorlesungen nach ihr Ausschau, aber sie gewöhnte sich an, den Hörsaal erst in letzter Minute zu betreten, sich einen Platz auf der gegenüberliegenden Seite zu suchen und am Ende sofort hinauszuschlüpfen.
Wieder und wieder ging ich diese zweite Nacht im Geiste durch, versuchte zu verstehen, was ich falsch gemacht hatte. Hatte ich etwas Blödes gesagt? Ich war damals wahrscheinlich ein ziemlicher Angeber, wollte Eindruck schinden, mir ein Image als Cambridge-Typ zulegen. Fuhr in diesem albernen Sportwagen herum. Ließ den Privatschul-Boy raushängen. Verwuscheltes Haar, affiger Tonfall …
Es wurde schnell klar, dass ich zwar einen Funken zwischen uns gespürt haben mochte, Caroline aber nicht. Ein paarmal hatte sie sogar die Straßenseite gewechselt, um mir aus dem Weg zu gehen. Wenn wir einander in den Fluren der Kunstgeschichtsfakultät begegneten oder sie mir durch Zufall in der Bibliothek gegenübersaß, war ein knappes Nicken das Äußerste, was von ihr kam. Und egal, wie sehr man jemanden mag – irgendwann hat man’s kapiert.
Ich hupte kurz, und Caroline blickte auf. Sie erkannte mein Auto – natürlich, wie viele Studenten fuhren schon mit einem MG-Cabrio in Cambridge herum – und rang sich ein nicht sehr überzeugendes Lächeln ab. Ich hielt an und ließ das Fenster herunter. Dies war eine Situation, in der wir einander schlicht nicht mehr ignorieren konnten.
»Ich nehme an, wir suchen dasselbe Haus«, sagte ich.
»Das hier ist es, glaube ich«, gab sie zurück. »Nummer 32?«
»Ja, die Adresse hat Dr. Bailey mir genannt.«
Das Haus passte jedenfalls. Entweder wohnten hier Akademiker, oder es stand leer. Dem Dach fehlten einige Ziegel. Im Erdgeschoss waren die Vorhänge zugezogen. Aus einer durchhängenden Regenrinne wuchs eine Art Busch. Caroline drückte den Klingelknopf. Es tat sich nichts.
»Hast du richtig …?«, fragte ich.
Sie forderte mich auf, es selbst zu versuchen. Es war nicht klar, ob dieser Klingelknopf überhaupt mit irgendetwas verbunden war. Zunächst verhalten, dann entschlossener klopfte ich an die Tür. Caroline trat ein, zwei Schritte zurück, um zu den oberen Fenstern hinaufzuschauen.
»Kein Licht«, sagte sie. »Meinst du, sie hat es vergessen?«
»Kann sein. Sie ist ja wohl nicht mehr die Jüngste. Hast du je von ihr gehört? Alice Long?«
Ich jedenfalls nicht, wobei es in der Unibibliothek drei Bücher von ihr gab – eins über Man Ray, eins über Brassaï und eins über die Geschichte des Fotojournalismus. Laut der Vita in diesem dritten Buch, erschienen 1980, war sie selbst Pressefotografin gewesen, hatte für Time und Vogue gearbeitet. Und das Autorenfoto hinten im Buch zeigte, dass sie auch schon vor zehn Jahren ziemlich alt gewesen war.
»Vielleicht hört sie uns nicht«, sagte ich. »Soll ich nach hinten gehen und über den Zaun rufen, was meinst du?«
»Herrgott«, murmelte Caroline hinter mir. »Wer ist die Frau überhaupt? Sie gehört nicht zur Fakultät, sie ist an keinem College. Warum betreut sie die Abschlussarbeiten? Vielleicht beschwere ich mich. Dieses Projekt ist für unseren Abschluss ziemlich wichtig.«
Ich verstand ihre Sorge. Sie hatte bereits im ersten Studienjahr deutlich gemacht, wie ernst sie ihr Studium nahm und was sie am Ende erreichen wollte: ein Leben als Wissenschaftlerin, lehrend und schreibend. Es fiel mir nicht schwer, sie mir als coole junge Akademikerin vorzustellen, vermutlich mit Lederjacke und knallrotem Lippenstift, eine Quelle der Inspiration für ihre Studentinnen. Wie ein richtiger Blödmann hatte ich versucht, sie zu beeindrucken, indem ich meine eigenen Karrierepläne vor ihr ausbreitete: einen erstklassigen Abschluss zu machen, einen Job bei Sotheby’s zu ergattern und mit dreißig die erste eigene Galerie in Mayfair zu haben. Ich muss wie ein eingebildeter, überprivilegierter Idiot geklungen haben, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen: Ich war achtzehn. Damals posaunte ich manches heraus, was ich später für mich zu behalten gelernt habe.
Letztlich war es aber so: Wenn wir an eine miese Betreuerin geraten waren und sich das ungünstig auf unsere Abschlussnote auswirkte, konnten wir uns beide von unserem jeweiligen Traum verabschieden.
Mit lautem Quietschen wurde drinnen ein Riegel zurückgeschoben. Bis die Tür dann wirklich aufging, dauerte es noch mal ein paar Minuten, denn offenbar mussten erst mehrere weitere Schlösser umständlich geöffnet werden.
»Hallo!«, rief ich, in verbindlichem Ton, wie ich hoffte. »Wir sind Patrick und Caroline. Studenten der Kunstgeschichte. Von der Universität.«
Das Gesicht, das im Türspalt erschien, war faltig und bleich, auf dem Kopf türmte sich wirres weißes Haar. Alice Long trug ein braunes Kleid mit Faltenrock und graue Kniestrümpfe. Stirnrunzelnd musterte sie uns. Sie war noch älter, als ich sie mir vorgestellt hatte.
»Sie sind spät dran«, sagte sie streng.
»Tut mir leid«, erwiderte ich. »Wir haben schon ein paarmal geklopft …«
Beim Eintreten prüfte ich in einem angelaufenen kleinen Wandspiegel meine Frisur. Alice Long schlurfte voraus und verschwand, offenbar in der Erwartung, dass wir ihr folgen würden, durch eine offen stehende Tür. Vage nahm ich einen Perserläufer wahr, schmutzig-dunkel, ziemlich abgewetzt. An der Wand hingen gerahmte, von einer dicken Staubschicht überzogene Schwarz-Weiß-Fotos.
Ich ließ Caroline den Vortritt.
»Bitte«, sagte Alice Long und wies auf ein kleines Sofa mit hohen Seitenlehnen – streng genommen war es eher ein größerer Sessel. »Setzen Sie sich.«
Sie selbst ließ sich auf einem Holzstuhl nieder, direkt neben einem Tisch voller Bücherstapel, während Caroline und ich zögernd Platz nahmen, peinlich darauf bedacht, uns nicht zu nahe zu kommen. Die Stores an den Fenstern waren zugezogen; Licht spendete vor allem eine Glühbirne, die nackt von der Decke hing.
»Also, Patrick«, begann Alice Long übergangslos, »Sie interessieren sich für den Surrealismus?«
»Sehr«, beeilte ich mich zu sagen und beugte mich vor, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Ich wollte einen guten Eindruck machen. »Mich fasziniert die Unerschrockenheit, mit der die surrealistische Kunst die inneren Zusammenhänge des Denkens erforscht. Dass sie jegliche Konformität verweigert und sich das Mythische und Traumartige zu eigen macht. Viele eindringliche, auf den ersten Blick rein beliebige Szenen und Motive scheinen direkt dem Unbewussten entsprungen.«
Alice Long lächelte schwach und sah mich durchdringend an.
»Alle reden von Dalí und Magritte«, fuhr ich fort, »aber der Maler, der die Bewegung in meinen Augen am besten verkörpert, ist Oskar Erlich.«
Damit hatte sie ganz offensichtlich nicht gerechnet. Leicht erstaunt hob sie eine Augenbraue und bedeutete mir, weiterzureden.
»Jedenfalls möchte ich mich in meiner Dissertation auf die Exposition internationale du surréalisme 1938 in Paris konzentrieren. Es war die letzte große Ausstellung vor dem Krieg, ein riesiges Medienspektakel, alle Künstler der Bewegung waren dabei: Erlich, Picasso, Man Ray, Miró …«
Alice Long winkte kurz ab, als wollte sie sagen, das weiß ich alles.
»Ich will untersuchen, wie die Ausstellung organisiert worden ist«, erklärte ich. »Wie sie der Öffentlichkeit präsentiert wurde, welche Auswirkungen sie in kultureller Hinsicht hatte.«
Das nahm sie mit einem nachdenklichen Stirnrunzeln zur Kenntnis. »Da haben Sie sich ein möglicherweise interessantes Thema vorgenommen. Allerdings müssen Rahmen und Argumentation noch entwickelt werden.«
»Oh, unbedingt«, sagte ich etwas kleinlaut. Möglicherweise interessant? Möglicherweise?
Nun drehte Alice Long ihren Stuhl etwas, um sich Caroline zuzuwenden und sie zu fragen, woran sie arbeitete. Caroline räusperte sich, zog ihr Notizbuch hervor und begann etwas vorzulesen. Schnell war klar, dass sie sich weitaus gründlicher vorbereitet hatte als ich. Sie erklärte, sie habe vor, die Sphinx in der surrealistischen Kunst zu untersuchen. Dazu hatte sie sich Notizen zu den verschiedenen Arten von Sphingen gemacht, Königsdarstellungen und Fabelwesen, griechische und ägyptische, männliche und weibliche, mit Flügeln oder ohne. Sie hob hervor, dass wir das Wort Sphinx unterschiedslos für Geschöpfe verwendeten, die in Wahrheit sehr verschieden seien, je nachdem, ob sie der griechischen oder der ägyptischen Mythologie entstammten, und nichts miteinander zu tun hätten. »Heißt es nicht ›der Sphinx‹? Maskulinum?«, warf ich besserwisserisch ein. »Ja, bei den ägyptischen Statuen mit Männerkopf«, erwiderte Caroline. »Die griechische Sphinx ist weiblich.« Dann wandte sie sich an Alice Long und sagte abschließend: »So weit bin ich bislang gekommen. Sphinxmäßig.«
Alice Long – interessiert, ja enthusiastisch, viel lebhafter als während meines Vortrags – fragte, über welche Werke speziell Caroline schreiben wolle. Caroline nannte Max Ernsts Une semaine de bonté, Dalís Drei Sphinxe von Bikini, Leonor Finis Kleine Einsiedler-Sphinx …
»Was ist mit Juliette Willoughbys Selbstporträt als Sphinx?«, fragte Alice Long.
»Ja, natürlich«, antwortete Caroline sofort, doch es war ein leises Zögern zu hören.
Wenn das die Richtung sei, die sie verfolgen wolle, fuhr Alice Long fort, solle sie sich mit dem Willoughby-Nachlass beschäftigen. »Das ist eine Sammlung ägyptologischen Materials, die früher im Besitz der Familie Willoughby war und nun im Museum für Archäologie und Anthropologie verwahrt wird. Hier in Cambridge«, ergänzte sie, als sie Carolines verwirrte Miene sah. Caroline schrieb sich das auf und warf mir einen vielsagenden Blick zu. Ich schnitt ein ratloses Gesicht.
Juliette Willoughby? Der Willoughby-Nachlass? War das ernst gemeint? Wie die meisten, die sich für die Surrealisten interessierten, wusste ich über Juliette Willoughby nur zwei Dinge, in erster Linie, dass sie die Geliebte von Oskar Erlich gewesen war. In sämtlichen Erlich-Biografien waren diese Liebesgeschichte und ihr tragisches Ende ein großes Thema.
Das musste eine Art Test sein. Und wenn es das nicht war, fand ich wirklich, wir sollten mit den Studienmentoren, die uns diese Betreuerin zugewiesen hatten, ein ernstes Wort reden. Nach Carolines Miene zu urteilen, dachte sie genau das Gleiche. Ich hob die Hand.
»Mr Lambert?«, fragte Alice Long knapp.
»Besteht nicht für jeden, der über Juliette Willoughby schreiben will, ein gewisses Problem?«, fragte ich. Denn es gab nur eine weitere Sache, die allgemein über die Künstlerin und ihr Werk bekannt war. »Ihre Bilder existieren nicht mehr«, fügte ich hinzu. »Kein einziges. Alles, was sie an der Kunstakademie gemacht hatte, ist verloren gegangen, als sie England 1936 verließ und nach Paris ging. Selbstporträt als Sphinx, das einzige Gemälde, das sie jemals öffentlich ausgestellt hat, ist im Katalog der Exposition von 1938 aufgeführt und findet in ein paar Kritiken Erwähnung, aber das war’s dann auch. Kein Foto davon hat überlebt, keine von ihren Zeichnungen oder Vorstudien, und das Bild selbst ist bei einem Brand 1938 in Paris zerstört worden.«
Bei demselben nie aufgeklärten Brand, in dem auch Juliette Willoughby und Oskar Erlich ums Leben kamen.
Philophobie. Das ist der Fachbegriff. Für die Angst, sich zu verlieben. Die chronische Angst, sich zu verlieben. Damals wusste ich noch nicht mal, dass es dafür einen Namen gibt, aber die Symptome waren mir, dank Patrick Lambert, bestens bekannt: Panikattacken, Schwindel, Übelkeit, das Gefühl, dass sich einem die Kehle zuschnürt und man gleich ohnmächtig wird. Und das jedes Mal, wenn man an eine bestimmte Person denkt, beziehungsweise daran, wie sehr man diese Person mag.
Schon bei meiner ersten Begegnung mit Patrick war ich hingerissen. Die dunklen Locken, die leicht verschleierten grünen Augen, das schiefe Grinsen, das unweigerlich ein Grübchen in die Wange zauberte. Er war witzig. Klug. Anders als viele andere Jungs, die ich in Cambridge kennengelernt hatte, hörte er, wenn er einen was fragte, bei der Antwort wirklich zu.
Als wir das zweite Mal miteinander schliefen, waren wir beide ziemlich betrunken. Wir küssten uns auf der Tanzfläche. Wir küssten uns auf dem Innenhof des Colleges. Wir küssten uns in seinem Zimmer, konnten die Finger nicht voneinander lassen, und dann saßen wir, nackt in Bettlaken gewickelt, da und redeten und lachten, stundenlang. Er erzählte, wie es gewesen war, mit sieben Jahren ins Internat geschickt zu werden, plötzlich unter lauter größeren, selbstbewussten Jungen zurechtkommen zu müssen und schreckliches Heimweh zu haben. Ich hörte aufmerksam zu und lenkte von Fragen nach meiner eigenen Kindheit unauffällig ab.
Irgendwann stieß er mich mit der nackten Schulter an und sagte lässig: »Hey, ich mag dich wirklich!«
»Ich mag dich auch wirklich«, erwiderte ich wahrheitsgemäß, auch wenn ich gleichzeitig spürte, wie ich mich versteifte und sich mein Magen zusammenzog. So oft hatte ich meine Großmutter darüber reden hören, was meine Mutter für ein außergewöhnliches, fröhliches junges Mädchen gewesen war. Dass sie großartig gemalt und gezeichnet und viele Wettbewerbe gewonnen hatte. Dass sie zahllose Freunde gehabt hatte, voller Pläne und Hoffnungen gewesen war – bis sie meinem Vater begegnete. Und ich hatte mir selbst das Versprechen gegeben, dass ich niemandem je erlauben würde, sich zwischen mich und meine Ziele zu drängen. Egal, wie sehr ich jemanden mochte. Egal, wie verwuschelt jemandes Locken waren und was für attraktive Grübchen er hatte.
Vielleicht hätte ich mich geschickter anstellen und versuchen können, Patrick das alles zu erklären. Aber wo hätte ich anfangen sollen? Wie hätte ich etwas erklären können, das ich noch nicht einmal benennen konnte?
Selbst jetzt fällt es mir noch schwer, den Gefühlstumult zu beschreiben, den ich erlebte, das siedend heiße Wechselbad von Verlegenheit und Panik, Entsetzen und Glückseligkeit, als Patricks Auto vor Alice Longs Haus hielt und mir dämmerte, dass wir uns nun ein ganzes Jahr lang regelmäßig hier treffen würden. Einen großen Teil dieser ersten, eine Stunde dauernden Sitzung verbrachte ich mit Grübeleien darüber, wie ich es höflich ablehnen konnte, auf dem Rückweg bei ihm mitzufahren. Und dann kamen wir raus und sahen das Wetter.
Das Nieseln hatte sich zu einem Wolkenbruch ausgewachsen. Patrick stand vor mir auf der Veranda und mühte sich vergebens ab, seinen Schirm so zu halten, dass er uns beiden Schutz bot.
»Kann ich dich mitnehmen?«, fragte er.
»Ach, also …« Ich zögerte und dachte daran, wie lange ich auf dem Herweg auf einen Bus gewartet hatte.
»Na dann – auf drei«, sagte Patrick, und wir rannten los, versuchten uns unter dem Regenschirm im Gleichschritt, während zwischen uns seine Tasche auf und ab hüpfte.
Ich hatte noch nie in einem Sportwagen gesessen und war auf diese intime Nähe nicht vorbereitet. Jedes Mal, wenn er schaltete, streifte seine Hand mein Knie. Wie schon während der Supervision versuchte ich, nicht an das letzte Mal zu denken, als wir einander körperlich so nahe gewesen waren.
Als wir uns dem Stadtzentrum näherten, war der Regen noch heftiger geworden, er trommelte auf die Windschutzscheibe und das Dach. An einer roten Ampel wandte Patrick sich mir zu und sah mich ernst an.
»Und? Was hältst du von Alice Long?«
»Na ja, sie ist auf jeden Fall … besonders.«
»Das ist eine Untertreibung.«
»Irgendwie finde ich sie auch … toll? Was sie alles über Juliette Willoughby erzählt hat?«
Es hatte im Lauf der vergangenen drei Jahre, in Vorlesungen, in Seminaren Momente gegeben, da hatte ich das Gefühl gehabt, dass die Achse meiner Welt ein wenig kippte und sich verschob. Dass Dinge, die ich mein Leben lang unhinterfragt hingenommen hatte, plötzlich in ihre Einzelteile zerfielen, die sich entweder perfekt wieder zusammensetzen ließen oder aber sich ganz auflösten. Wenn etwas, das jedermann als gegeben voraussetzte, plötzlich nicht mehr das Ende einer Diskussion darstellte, sondern den Ausgangspunkt einer viel wichtigeren. War Juliettes Meisterwerk verloren gegangen? Vielleicht, hatte Alice Long eingeräumt. Aber was bedeutet verloren überhaupt? Warum verloren? Von wem? Sind Sie zufrieden damit – bei der Frage hatte sie mich mit ihrem Blick durchbohrt –, das einfach so zu akzeptieren? Es war André Breton, der Surrealismuspapst höchstselbst, gewesen, der Juliette Willoughbys Selbstporträt als Sphinx für die Ausstellung ausgewählt hatte. Zeitgenössische Kritiker hätten ihr Talent mit dem von Salvador Dalí und Max Ernst verglichen, hatte Alice Long in mahnendem Ton ausgeführt. Warum nicht diese Kritiken, die Briefe und Tagebücher aus Juliettes Pariser Kreis noch einmal durchforsten? Irgendwo musste ihr Werk doch Erwähnung finden. Verloren? Pff! Vieles gilt nur deshalb als verloren, weil niemand sich die Mühe gemacht hat, danach zu suchen.
Das klang nach einer Herausforderung. Es klang nach einer Lebensaufgabe. Ich musste an meine Mutter denken und ihren Traum, Künstlerin zu werden, und an die vielen anderen übersehenen, unterschätzten Frauen, die es im Lauf der Jahrhunderte gegeben hatte.
Patrick hatte das alles offenbar nicht ganz so inspirierend gefunden.
Quietschend fuhren die Scheibenwischer hin und her. Patrick dachte eine Weile nach. »Von Oskar Erlichs Werk ist bei diesem Brand immerhin auch viel verloren gegangen«, sagte er schließlich.
»Das ist es doch, was Alice Long meint! Von seinem Werk ist viel verloren gegangen, aber es hat auch vieles überdauert, weil er praktisch während seiner ganzen Laufbahn bejubelt und gesammelt worden ist. Und es wurden Bücher über ihn geschrieben. In denen Juliette nur am Rande erwähnt wird, schon gar nicht, dass sie eine eigenständige Künstlerin war.«
Die Ampel sprang auf Grün, und wir schossen los, mitten durch eine riesige Pfütze, sodass ein Student in orangeroter Regenjacke von Kopf bis Fuß nass gespritzt wurde. Im Rückspiegel sah ich, wie er sich schüttelte und uns nachstarrte. Ich drehte mich um und formte mit dem Mund ein »Entschuldigung«.
»Da wären wir.« Patrick setzte den Blinker, während er schon quer über die Straße zog. »Das Museum für Archäologie und Anthropologie.«
Es war an der Zeit, mit offenen Karten zu spielen. »Weißt du etwas über diesen Willoughby-Nachlass, Patrick? Kannst du dir vorstellen, was Alice Long meint, was ich da finden soll?«
Er lächelte. »Ein bisschen was weiß ich«, sagte er, eine Hand locker auf dem Lenkrad. Die andere umschloss den Schaltknüppel, jederzeit bereit, den Gang einzulegen. »Hast du mal was über die Geschichte von Juliettes Familie gelesen?«
»Wenig. Ich weiß, dass die Willoughbys wohlhabend waren. Ihr Vater, Cyril, war Parlamentsabgeordneter, oder?«
»Und ein großer Sammler ägyptischer Artefakte. Er hat einen ganzen Flügel seines Hauses damit angefüllt. Allem Anschein nach ein ziemlicher Exzentriker, und in seinen letzten Jahren eher ein Einsiedler. Begraben ist er in Longhurst Hall, dem Familienanwesen, in einem Mausoleum, das er selbst in Auftrag gegeben hat. Angeblich eine maßstabsgerechte Nachbildung der Djoser-Pyramide in Sakkara. Das ist die älteste bekannte ägyptische Pyramide.«
»Also will Alice Long, dass ich herausfinde, ob Juliettes Interesse an Sphingen einen persönlichen Hintergrund hatte?«
»Könnte sein, und in dem Fall wäre der Willoughby-Nachlass mit Sicherheit ein guter Ausgangspunkt. Nach Juliettes Tod sind Longhurst Hall und Willoughbys Sammlung komplett an seinen jüngsten Bruder Austen gegangen, den Onkel von Juliette. Der hat das Haus behalten, das ägyptische Zeug aber bei der Universität Cambridge abgeladen.«
»Und so ist es hierhergekommen?« Ich zeigte auf das große Backsteingebäude, vor dem Patrick mit Warnblinker in der zweiten Reihe hielt.
»Genau. Wie es der Zufall will, war mein Vater mit Austens Sohn Philip in Cambridge. Und ich war mit dessen Sohn Harry in der Schule.«
Natürlich warst du das, dachte ich. Selbst nach drei Jahren an dieser Uni fand ich es immer noch erstaunlich, wie oft und wie beiläufig Leute wie Patrick solche Bemerkungen fallen ließen. Dass sein Vater mit dem Cousin von Juliette Willoughby in Cambridge gewesen war. Und er selbst mit dessen Sohn in der Schule. Oder meine Freundin Athena, die mir mitten in einer Picasso-Vorlesung erzählte, sie sei ziemlich sicher, dass das Gemälde, das gerade an die Wand projiziert wurde, irgendwann mal ihrem Vater gehört hatte. Oder dieser Typ in einem Tutorium im zweiten Studienjahr, von dem sich herausstellte, dass sein Onkel das Standardwerk zu dem Thema verfasst hatte, das in der Woche dran war (Flämischer Manierismus im frühen sechzehnten Jahrhundert). Es war eine kleine Welt, und sie schien mir von der, in der ich aufgewachsen war, sehr weit entfernt.
»Die Sache ist nur«, fuhr Patrick fort, »nicht einmal Philip und Harry können erklären, weshalb. Die Familie hat nie versucht, das ganze Zeug, das Cyril über Jahrzehnte angehäuft hatte, zu verkaufen. Obwohl es wahrscheinlich ein Vermögen wert war. Sie haben es einfach weggegeben. Und wenn man die Willoughbys kennt und weiß, wie sie hinter dem Geld her sind …«
Von hinten kam ein Wagen und versuchte sich unter lautem Hupen an uns vorbeizuquetschen.
»Ist ja gut, reg dich ab, Mann«, murmelte Patrick über die Schulter und wandte sich wieder mir zu. »Es heißt, die Willoughbys hätten das ganze Zeug loswerden wollen, weil – na ja, diese Familie hatte einfach jede Menge Pech. In diesem Haus sind seltsame und ungute Dinge passiert.«
»Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, sie hätten geglaubt, dass auf der Sammlung ein Fluch liegt?«, fragte ich.
Er zuckte theatralisch die Achseln. Ich öffnete die Beifahrertür und stieg aus.
Patrick ließ sein Fenster herunter. »Ich will nur sagen …«, dann verfiel er in einen heiseren, knarrenden Tonfall, sodass er klang wie eine Horrorfilmparodie, »…sei auf der Hut, Caroline!«
Dann grinste er, zwinkerte mir zu, ließ den Motor an und düste davon. Ich registrierte ein leichtes Kribbeln in der Magengrube und stellte fest, dass ich von Patrick Lambert immer noch ein bisschen hingerissen war.
Fünf Stunden später waren mein Verlangen, über Juliette Willoughby zu arbeiten, und meine Begeisterung, mit Alice Long zu arbeiten, mehr oder weniger versiegt. In der Bibliothek war es stickig und still. Hinter den Fenstern wurde aus einem dämmrigen Herbstnachmittag schnell tiefdunkle Nacht.
Soweit ich das überschaute, war der Willoughby-Nachlass das reinste Chaos. Als Erstes hatte die Bibliothekarin – eine ältere Frau mit verblüffend blauen Augen und einer leicht argwöhnischen Art – gefragt, welchen Teil des Nachlasses ich sehen wollte. Ich muss ziemlich dumm dreingeschaut haben, jedenfalls erklärte sie mir, der Nachlass sei in drei Gruppen sortiert: die Artefakte, von denen einige oben im Museum ausgestellt waren; die zahlreichen Papyri (sehr empfindlich, einsehbar nur unter Vorlage einer Sondergenehmigung); und die zweiundsiebzig Kartons mit allgemeinem, unsortiertem Material, unbeschriftet und undatiert. In der Annahme, dass etwas Relevantes zu Juliette und ihrem Interesse an Sphingen am ehesten dort zu finden sein würde, bat ich also fürs Erste um diese unsortierten Ephemera.
Möglicherweise war das ein Fehler gewesen.
Es hatte den Anschein, als enthielten die Kartons alles, was sich jemals in Cyril Willoughbys Arbeitszimmer befunden hatte. Alte Briefe. Notizbücher voller Hieroglyphen. Schreibpapier aus dem Shepheard’s Hotel in Kairo. Einen Karton nach dem anderen holte die Bibliothekarin aus den Eingeweiden des Gebäudes hervor. Einen nach dem anderen ging ich durch, wobei ich versuchte, wie eine Person zu wirken, die genau weiß, was sie tut. Die Bibliothekarin teilte mir mit, es sei ein neuer Archivar eingestellt worden, ein Doktorand, der die Aufgabe habe, Ordnung in diesen Bestand zu bringen. Sein Name sei Sam Fadel, falls ich Fragen hätte, solle ich mich an ihn wenden.
Nach fünf Stunden und neunzehn Kartons war ich reichlich frustriert, redete mir aber gut zu: Wenn ich es schaffte, alle Kartons durchzusehen, würde ich Alice Long zumindest sagen können, ich hätte getan, was in meiner Macht stand. Also nahm ich mir die nächste zerbeulte Pappkiste vor, holte alles, was sie enthielt, heraus und breitete es auf dem Schreibtisch aus. Noch mehr Briefe. Rechnungen. Noch mehr Notizbücher. Dann fiel mir ein zerfledderter Umschlag auf, M. et Mme. Cyril Willoughby, stand in verschlungener Schrift darauf. Er war schwerer, als ich erwartet hatte, und weitaus interessanter als alles, was mir bis dahin untergekommen war.
Ich öffnete ihn vorsichtig mit dem Daumen, drehte ihn um, und eine dünne Goldkette glitt heraus – eine Halskette mit Anhänger. Bei dem Anhänger handelte es sich um ein Oval aus gehämmertem Gold, etwa fünf Zentimeter lang. Auf der einen Seite war ein kunstvoll stilisiertes Auge eingeätzt, mit einer geschwungenen Linie als Braue darüber und vom Augenwinkel weggehend eine Linie mit einem Schnörkel am Ende.
Außerdem ertastete ich in dem Umschlag zwei Objekte, die sich anfühlten wie Bücher. Eines hatte eine raue Oberfläche, ich zog es als Erstes heraus. Es war ein marineblauer britischer Pass mit dem königlichen Wappen als Prägedruck auf dem Umschlag. In der ovalen Aussparung unten stand von Hand und in Großbuchstaben »Miss Juliette Willoughby«.
Ich schlug ihn auf und sah das Foto. Ein wirklich außergewöhnliches Gesicht. Hellwache, weit offene kühle Augen, breite, geschwungene Brauen, volle, leicht zusammengepresste Lippen. Eine junge Frau mit einem Schleier aus hellen Sommersprossen. Die Lockenmähne füllte das Bild aus bis zum Rand. Ich blätterte weiter und fand Juliettes Unterschrift sowie zwei Stempel, einen für Rom (1935) und einen für Paris (1936). Das Objekt machte mir noch einmal klar, dass sie ein echter, lebendiger Mensch gewesen war, wie ich. Mit diesem Pass, hatte sie sich vielleicht vorgestellt, würde sie die ganze Welt bereisen können, und stattdessen …
Mir zitterten die Hände, als ich den Pass weglegte und ein Notizbuch aus dem Umschlag zog. Abgegriffen, brüchig. Auf den unlinierten Seiten datierte Eintragungen, aber auch Skizzen und Vorstudien. Kohlezeichnungen von einer Sphinx, einzelne Linien von den Fingern der Künstlerin verwischt, damit Augen, Lippen und Mähne der Kreatur mehr Kontur bekamen. Kunstvolle Bleistiftkompositionen, immer wieder die gleichen Figuren in immer anderen Szenen. Auf den Rückseiten Farbkleckse, dazu jeweils eine Nummer und ein Kommentar, leider kaum zu entziffern. Und zwischen den Zeichnungen längere Textpassagen in einer krakeligen, schwer lesbaren Handschrift.
Auf dem Vorsatzblatt waren mit Tinte die Initialen »J.W.« sowie eine Pariser Adresse vermerkt.
Ich fuhr die Buchstaben mit dem Finger nach. Die Bögen, die Schwünge.
J.W.
Juliette Willoughby.
Sehr vorsichtig, ängstlich darauf bedacht, dass das alte Papier nicht einriss oder zerfiel, blätterte ich weiter bis zum ersten Eintrag. 11. November 1937, stand da. Es ist fast Mitternacht. Ich schreibe dies im Bett …
Donnerstag, 11. November. Es ist fast Mitternacht. Ich schreibe dies im Bett. Es ist kalt, und ich habe alle Decken über mich gezogen, die es hier gibt. Meine Zehen in Oskars dicken Wollsocken sind Eisklumpen. Das letzte Feuerholz hebe ich auf für morgen früh, jetzt glimmen die Scheite im Ofen nur noch schwach und sinken mit einem leisen Knacken dann und wann zusammen.
Die Wohnung, die Oskar und ich gemietet haben, befindet sich ganz oben in einem Haus mit fünf Etagen. Es muss einmal herrschaftlich gewesen sein. Jetzt ist es furchtbar heruntergekommen. Immer wieder passiert es, dass man die Treppe hochsteigt und einen Brocken Stuck auf dem Boden findet oder feststellt, dass im Geländer eine weitere Säule fehlt. Im Sommer ist es bei uns oben am heißesten, im Winter am kältesten. Solange die Rohrleitungen nicht einfrieren, gibt es in der Kochnische fließendes Wasser. Schlafzimmer und Atelier sind ein Raum, nicht eben groß, unterteilt durch einen Vorhang aus dem gleichen Stoff, den Oskar auch auf Holzrahmen spannt, damit wir Leinwände zum Malen haben.
Außer dem Bett (Eisen, uralt und unglaublich schwer) haben wir an Möbeln nur zwei Holzstühle und einen kleinen runden Tisch. Keinen Teppich. Bei dem kleinen Kanonenofen muss man sich sehr in Acht nehmen, dass man nicht dagegenkommt. Am Ende des Flurs gibt es ein Wasserklosett (sitzt man darauf, stößt man mit den Knien gegen die Tür). Unsere Fenster gehen auf einen Hof, aus dem zu jeder Tages- und Nachtzeit die Geräusche des ganzen Hauses heraufsteigen. Ein Hund bellt. Eine Frau schreit etwas. An den Wänden hängen Bilder, unsere eigenen und Geschenke von Malern aus unserem Kreis, außerdem Fotografien von der Stadt und unseren Freunden. Ich habe sie mit der kleinen Leica aufgenommen, die Oskar mir zum Geburtstag geschenkt hat.
Das Ganze scheint unendlich weit weg von Longhurst. Von der Welt meiner Kindheit.
Wir sind glücklich hier in Paris, Oskar und ich. Wahnsinnig glücklich, manchmal, und trotzdem … Führen wahrhaft glückliche Leute ein Tagebuch?, frage ich mich bisweilen. Wem erkläre ich mich auf diesen Seiten wirklich?
Ich sollte etwas zu Oskar schreiben.
Kennengelernt habe ich Oskar Erlich, als in den New Burlington Galleries in London die Eröffnung der ersten internationalen Surrealistenausstellung gefeiert wurde. Das war im Juni 1936. Er stand vor einem seiner Bilder, Der Traum des jungen Mädchens – ein dünnes, verloren wirkendes rothaariges Wesen in durchscheinendem Gewand, dem Betrachter den Rücken zukehrend, das schmale, blasse Gesicht mit dem rätselhaften Ausdruck nur in einem verzierten Spiegel zu sehen. Oskar war umringt von Herren mit Notizbuch und Damen mit Hut, alle umschmeichelten ihn, baten ihn, den Surrealismus zu erklären, fragten, was es heiße, Surrealist zu sein. Ich stand an der Tür herum, hoffte, dass mich kein allzu langweiliger oder schrecklicher Mensch ansprechen würde, und wartete darauf, dass die Freundin, die mich zu dem Fest eingeladen hatte, von der Toilette zurückkam.
Dann trafen sich unsere Blicke.
Oskar sagt, er wird nie vergessen, wie ich seinen Blick aufgefangen und erwidert habe, dass ich so direkt und selbstbewusst quer durch den Saal auf ihn zugegangen bin und mich ihm vorgestellt habe. »Guten Abend«, sagte ich und streckte ihm die Hand hin. »Mein Name ist Juliette Willoughby, ich bin Künstlerin.«
Es mag dreist geklungen haben, aber im Innern zitterte ich. Ich sah – oder meinte zu sehen –, dass überall in dem großen Raum Leute zu mir herüberstarrten, vielsagende Blicke wechselten, sich fragten, wer ich denn sei, woher ich die Frechheit nähme, einfach so hinzugehen und mich dem Liebling des Abends zu präsentieren. Diese Frage stelle ich mir seitdem selbst immer wieder. Wahrscheinlich hat es mir geholfen, an Oskars Bildern zu sehen, dass er einen bestimmten Typ bevorzugt und dass ich diesem Typ genau entspreche.
Den ganzen Abend redeten Oskar und ich miteinander – meine Freundin war so verärgert, dass sie irgendwann davonrauschte und in unser Quartier zurückkehrte –, und am nächsten Tag trafen wir uns an einem Kaffeekiosk im St. James’s Park wieder. Während wir um die Fontäne herumspazierten und uns die Bilder ansahen, die dort am Geländer lehnten und zum Verkauf angeboten wurden, erzählte er mir von seiner Jugend in Düsseldorf, seiner Studentenzeit in Paris, den heftigen Auseinandersetzungen mit seinen Eltern, weil er beschlossen hatte, das Medizinstudium aufzugeben und ein großer Maler zu werden. Ich wiederum erzählte ihm von meinem Londoner Leben, meinem Unterricht an der Slade School of Fine Art, davon, wie enttäuschend ich meine Lehrer fand.
Wie heroisch und wie närrisch das alles aussieht, wenn man es so hinschreibt. Dass zwei Menschen einen Augenblick lang ein starkes Verbundensein fühlen und sofort ihr ganzes bisheriges Leben aufs Spiel setzen; zwei Menschen, die einander in einem Saal sehen und eine große Anziehung empfinden. Die einander keine vierundzwanzig Stunden kennen und eine Entscheidung treffen, die ihrer beider Leben auf den Kopf stellt. Und das Seltsamste war, dass es mir gar nicht seltsam vorkam, als er mich am Ende des Tages fragte, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm nach Paris zu gehen.
Und dort wo zu wohnen?, fragte ich. Und bei mir zu wohnen, sagte er. Und was zu tun?, fragte ich. Da lächelte er nur, so als sei die Antwort doch klar, und sagte: zu malen. Ich hätte das lächerlich finden sollen, absurd. Aber in dem Moment hätte ich nur eins absurd gefunden, nämlich abzulehnen.
Wie mein Vater reagieren würde, darüber machte ich mir keine Illusionen. Ich wusste, es würde ein harter Bruch sein, ein endgültiger Bruch. Keine Hochzeit in der kleinen Kapelle auf Longhurst, kein Fest im Park am See. Vergebung, eine Versöhnung würde es nicht geben. Dass ich mich in einen Künstler verliebt hatte, wäre schon schlimm genug gewesen. Aber in einen ausländischen Künstler, einen Deutschen! Undenkbar. Umso mehr, wenn dieser Künstler mehr als doppelt so alt war wie ich und noch mit einer anderen verheiratet.
Ich erklärte Oskar, dass sie nicht vorgewarnt werden durften. Sie würden nur einen Brief bekommen, in dem stand, dass ich in Sicherheit sei, dass ich verliebt sei, dass sie nicht versuchen sollten, mich aufzustöbern, und dass sie nie wieder von mir hören würden.
Ich habe den Brief einer Freundin übergeben, ihr aber nicht gesagt, was darin stand, sondern sie nur gebeten, ihn ein, zwei Tage später aufzugeben. Es war mein Abschied von meinem alten Leben, auf Nimmerwiedersehen.
Alle meine Skizzenbücher, all die Leinwände, die in meinem Zimmer an der Wand lehnten, die vielen schrecklichen, blutarmen Arbeiten, die ich in der Slade angefertigt hatte, warf ich in die Mülltonnen hinter dem Gebäude. Meine Farben und Pinsel packte ich ein – ein Sortiment, das bei regelmäßigen Besuchen in Covent Garden von meinem Onkel Austen für viel Geld wieder aufgefüllt wurde –, dazu einige wenige Kleidungsstücke und den Reisepass, den ich mir für die öde, enttäuschende Rom-Reise zugelegt hatte, wo ich mit Heerscharen anderer Besucher durch die Vatikanischen Museen getrottet war. Dann verließ ich mein Zimmer, fuhr allein mit der Untergrundbahn zum Bahnhof Charing Cross und verschwand.
Kaum zu glauben, dass seit meiner Ankunft hier in Paris schon über ein Jahr vergangen ist. Manchmal träume ich so lebhaft von dieser Reise, dass ich meine, wenn ich die Augen aufschlage, finde ich mich auf dem Bahnhof wieder, wo es von Menschen wimmelt und schrecklicher Lärm herrscht, in dem Zug mit den überfüllten Waggons oder später am Fähranleger, wo ich ängstlich nach dem richtigen Schiff suche. Und dann höre ich das Klicken, mit dem die Kabinentür hinter uns zufällt, und mit einem Schlag wird mir bewusst, was wir da eigentlich tun.
Wir wachten früh auf, Oskar und ich, und gingen an Deck, um in der Morgendämmerung einen ersten Blick auf Frankreich zu erhaschen. Wie wir es verabredet hatten, taten wir in der Schlange vor der Passkontrolle so, als wären wir einander fremd. Tief in meinem Innern fürchtete ich, nein, war ich davon überzeugt, dass irgendwer uns aufhalten würde. Die Polizei? Ein Privatdetektiv? Mein Vater persönlich? Ich wusste es nicht.
Es war später Nachmittag, die Stadt hinter dem schmutzigen Fenster ein Schleier aus verwischten Lichtern, als der Zug von der Fähre langsamer wurde und wir in den Gare du Nord einliefen. Ab und zu drehte ich demonstrativ den falschen Ehering, den Oskar mir bei einem Pfandleiher in Holborn gekauft hatte, am Finger.
Paris! Ich konnte es nicht glauben. Es war alles so einfach. Im Grunde fand ich es erschreckend, dass diese Freiheit immer so in Reichweite gewesen war, dass ich nur danach hätte zu greifen brauchen.
»Siehst du?«, sagte Oskar im Taxi, das Licht einer Straßenlaterne fiel genau auf den Schwung seiner Lippen. »Ich hab dir ja gesagt, es wird alles gut gehen.« Ich lächelte zurück und drückte seine Hand. Und ich gab mir Mühe, mir nicht den Zorn meines Vaters vorzustellen, die Bestürzung meiner Mutter, sondern versuchte, mir das Selbstvertrauen zu bewahren, das mich im Augenblick der ersten Begegnung mit Oskar durchdrungen hatte. Ich fragte mich, ob ihm je in den Sinn gekommen war, dass ich noch Jungfrau sein könnte, dass ich zum ersten Mal die Nacht mit einem Mann verbringen würde.
Und ich war mir nur allzu gewärtig, dass das nur eins der vielen Dinge war, die er von mir nicht wusste.
2. Kapitel
Als ich am Tag nach unserer ersten Sitzung bei Alice Long von der Vormittagsvorlesung in mein College-Zimmer zurückkam, fand ich einen Zettel unter der Tür. Mein Vater hatte angerufen, und jemand hatte eine Nachricht für mich aufgeschrieben: dass Dad auf dem Rückweg aus East Anglia durch die Stadt käme und mich um eins im Browns zum Mittagessen erwarte. Ich sah auf die Uhr. Es war Viertel vor eins.
Das war typisch für meinen Vater. Unangekündigt aufzutauchen. Zu erwarten, dass ich alles stehen und liegen ließ, um mich mit ihm zu treffen.
Als Kind hatte ich meinen Vater vergöttert. Er sah gut aus. Er hatte Stil (die Autos, die Maßanzüge, der silberne Flachmann mit eingraviertem Monogramm). Er war immer charmant, hatte zu allem eine wohlüberlegte Meinung (Wein, Kunst, Londoner Restaurants). Außerdem war er, wie sich herausstellte, ein Frauenheld und Schürzenjäger und komplett unzuverlässig.
Schon während wir zu unserem Tisch geführt wurden, fing mein Vater an, mit der Kellnerin zu flirten, nur um einen besseren Tisch für uns herauszuschinden. Ich seufzte stumm. Auch davon hatte ich Caroline erzählt, von seinem Drang, immer einen Tisch am Fenster zu ergattern, einen besseren Tisch, den besten Tisch. Ein Theater, das ich jedes Mal über mich ergehen lassen musste, wenn wir zusammen essen gingen. Es war eine Gelegenheit, seine unschlagbaren Überredungskünste vorzuführen. Ein sicherer Weg, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Am Ende saßen wir – zu zweit – an einem Tisch für sechs Personen am Fenster, mit Blick auf die Trumpington Street.
Das Erste, wonach er fragte, als wir Platz genommen und Getränke bestellt hatten, war der Wagen. Er laufe doch wohl ordentlich, oder? Ich ginge hoffentlich pfleglich damit um. Läuft wie eine Eins, sagte ich. Wird jede Woche gewachst. Er war ein wichtiges Symbol für unsere Beziehung, dieser Wagen. Mein Vater hatte ihn an dem Tag gekauft, an dem ich den Brief mit meiner Zulassung in Cambridge bekommen hatte. Einerseits eine extravagant großzügige Geste, die er sich, wie ich vermutete, eigentlich nicht leisten konnte, andererseits extrem nervig. Immer musste ich einen sicheren Parkplatz suchen. Wenn es kalt war, wusste ich morgens nie, ob er anspringen würde. Überhaupt an einem Ort, an dem ich zu Fuß nirgendwohin länger brauchte als zehn Minuten, ein Auto zu haben! Als ich Caroline mein Leid klagte, hatte sie gefragt, warum ich das Ding nicht einfach verkaufte. Sie hatte vollkommen recht. Und sie kannte meinen Vater nicht.
Als Nächstes fragte er, wie es mit dem Studium laufe. Er wollte alles über meine Abschlussarbeit und über meine Betreuerin wissen. Alice Long gegenüber hatte ich das nicht erwähnt, aber im Grunde war es mein Vater gewesen – selbst Kunsthändler –, der mich auf die Surrealisten gebracht hatte, als er mich vor ein paar Jahren zur Oskar-Erlich-Retrospektive in London mitgenommen hatte. Es war seine Idee gewesen, die Pariser Surrealistenausstellung von 1938 könnte ein interessantes Thema für eine Arbeit sein. Außerdem hatte er mir geraten, mein Thema auch unter dem Karriereaspekt zu sehen, als eine Chance, mich als Spezialist auf einem Gebiet der Kunstgeschichte zu etablieren, mit dem sich sonst kaum jemand beschäftigte.
Während der Vorspeise erläuterte er, warum er in East Anglia gewesen war (eine Haushaltsauflösung in der Nähe von Norwich – er hatte im Auftrag der Hinterbliebenen eine Reihe von Objekten evaluiert, damit nichts versehentlich zum Schleuderpreis verkauft wurde, und falls doch, dann jedenfalls an ihn). Auf dem Rückweg hatte er in Longhurst vorbeigeschaut und Philip Willoughby einen Besuch abgestattet. Auch Philip hatte ihn gebeten, ein paar Sachen zu schätzen. Wie üblich, wenn er in Longhurst war, hatte er im Grünen Zimmer geschlafen, in dem Harrys Mutter jetzt, in einer Art seltsamer Tradition, auch mich immer unterbrachte. Das war so recht nach dem Geschmack meines Vaters, solche Geschichten liebte er und ließ sie gern in die Konversation einfließen.
Unsere Treffen folgten immer einem bestimmten Protokoll. Er fragte nach meiner Mutter, ich fragte nach seiner aktuellen Freundin (immer der gleiche Typ – normalerweise –, geschiedene Blondine mit Cabrio und einer Boutique irgendwo in den Cotswolds). Er erzählte etwas von der Arbeit, eine Geschichte, in der er bei irgendeiner Frage recht gehabt und jemand anders falschgelegen hatte, und dann (mit einem Glas Wein intus) nahm er mich in die Zange, ob ich aus Cambridge auch das Beste machte, mich in den richtigen Kreisen bewegte, die richtigen Leute kennenlernte.
Ein- oder zweimal hatte er tatsächlich genau diese Formulierung gebraucht: die richtigen Kreise. »Meinst du vornehme Leute?«, hatte ich gefragt. »Oder einfach reiche Leute?«
»Ich meine Leute, die dir im Leben weiterhelfen können«, hatte er erwidert. »Vor allem, wenn es dir ernst damit ist, beruflich in meine Richtung zu gehen. Leute, die Kunst besitzen, Leute, die Kunst kaufen.«
Während wir auf den Hauptgang warteten, fragte er, ob ich zur Feier von Harry Willoughbys Einundzwanzigstem nach Longhurst eingeladen sei.
Nach Harry erkundigte er sich jedes Mal, wenn wir uns trafen, nie dagegen nach meinen neuen Freunden, deren Namen sich zu merken er sich standhaft weigerte. Immer war es Harry, über den er alles wissen wollte. Ob wir uns oft sähen. Ob wir noch so eng miteinander seien. Ob er eine Freundin habe. Auf diese letzte Frage lautete die Antwort stets nein, denn ich bin in meinem Leben nie jemandem begegnet, der sich so auf seine anstehende politische Laufbahn konzentriert hätte wie Harry, nie jemandem, der sich weniger für romantische Verwicklungen aller Art interessierte. Manchmal kam es einem so vor, als hätte Harry überhaupt nur Freunde, weil er dachte, dass ein künftiger Premierminister so etwas haben müsse.
»Natürlich bin ich eingeladen«, sagte ich. Alles andere wäre auch peinlich gewesen, wenn man bedachte, wie lange ich Harry schon kannte, dass unsere Väter miteinander in Verbindung standen und wir im selben College waren.
Erst ganz am Ende des Essens rückte mein Vater damit heraus, dass er mich um einen Gefallen bitten wollte. Beim Dessert hatte ich ihm erzählt, dass ich vorhatte, in der folgenden Woche nach London zu fahren und in der Witt Library des Courtauld Institute ein paar Dinge einzusehen – Alice Long hatte mich darauf hingewiesen, dass sich im dortigen großen Bestand an Ausstellungskatalogen und Zeitungsausschnitten vielleicht etwas Nützliches zur Surrealistenausstellung von 1938 finden ließe.
»In der Witt?«, wiederholte er. Das sei ja günstig. Philip Willoughby wolle nämlich ein paar Gemälde verkaufen und habe ihn gebeten, die Provenienz zu klären – wem die Bilder wann gehört hatten, wer sie wo gekauft hatte –, also die ganzen Papiere zu finden, die so wichtig waren, wenn es darum ging, die Echtheit eines Kunstwerks nachzuweisen.
Mit ihrem Archiv von Millionen Fotografien, Reproduktionen und Zeitungsausschnitten, die das Werk Zehntausender Künstler und Künstlerinnen dokumentieren, ist die Witt Library für Kunsthändler eine ebenso wertvolle Informationsquelle wie für Wissenschaftler – wenn man sich erst mal in ihr etwas kompliziertes Katalogsystem eingefuchst hat. Für die Zwecke meines Vaters waren besonders die Fotos in den Beständen hilfreich, die von Mitarbeitern der Bibliothek aufgenommen worden waren, die man von den Zwanzigerjahren bis in die Siebziger regelmäßig mit Kameras auf eine Tour durch die großen Häuser Englands schickte, um die dortigen Kunstsammlungen zu dokumentieren: Cliveden. Longleat. Longhurst.
Das hieß, es gab eine einfache Möglichkeit, wasserdicht nachzuweisen, dass ein bestimmtes Bild im Jahr 1961 im Besitz der Willoughbys gewesen war, als die Bibliothekare mit ihren Kameras vorbeikamen. Der Nachteil war, dass jemand es auf sich nehmen musste, sich durch die unzähligen, mit grünem Stoff bespannten Mappen voller unsortierter, körniger Schwarz-Weiß-Fotos zu wühlen, um eins zu finden, auf dem die fraglichen Gemälde zu sehen waren.
Ob ich vielleicht, fragte mein Vater, wenn ich in der Witt Library sei, kurz ein paar Sachen für ihn prüfen könnte? Er würde mir aufschreiben, wonach ich schauen sollte, die Titel der Bilder, die Daten.
»Natürlich«, hörte ich mich sagen.
»Kann durchaus sein, dass ein kleines Honorar für dich herausspringt.«
»Gut«, sagte ich. »Wenn ich sowieso dort bin.«
Nein zu sagen wäre kleinlich gewesen. Schließlich hatte er viel für mich getan. Er war derjenige, der das Essen zahlte. Der meine Schulgebühren bezahlt hatte, auch in der Zeit, als die Geschäfte nicht so gut gingen. Ich hatte Chancen im Leben bekommen, die ihm nicht vergönnt gewesen waren. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Wahrscheinlich würde es mich höchstens zwei Stunden kosten.
Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn mein Vater wenigstens ab und zu mal so ohne Vorankündigung vorbeigekommen wäre, ohne dass er mich um einen Gefallen bitten wollte.
Als wir zu seinem Wagen gingen, Seite an Seite über einen Teppich aus nassem Laub auf dem Bürgersteig, fragte er, ob ich schon aufgeregt sei wegen abends.
»Wegen abends?«, fragte ich, als wüsste ich nicht, was er meinte.
»Wegen deiner Investitur«, sagte er, grinste und gab mir einen leichten Knuff in die Seite. »Bei der Osiris Society.«
Ah. Zufälligerweise zwei Dinge, an die ich lieber nicht denken wollte.
So weit meine Erinnerung zurückreichte, redete mein Vater von der Osiris Society. Von ihren berühmten Dinners. Ihren legendären Streichen. Wie wichtig es sei, dass ich, wenn ich in Cambridge auf die Uni ging (nie falls), aufgefordert wurde beizutreten. Das Gütesiegel gesellschaftlicher Anerkennung: der lächerliche Ring am kleinen Finger.
Es war der erste Donnerstag im Monat und damit das erste Dinner im Michaelmas-Trimester, der Abend, an dem traditionell neue Mitglieder eingeführt wurden. Da es immer nur dreizehn gab, galt das als eine Ehre. Als ich meinem Vater die Prägedruck-Einladung gezeigt hatte, unterzeichnet von Harry als Präsident der Gesellschaft, war mir seine Begeisterung beinahe grotesk vorgekommen.
»Ich bin mir gar nicht sicher«, sagte ich, »ob das wirklich was für mich ist.«
Was ich denn da redete, fragte er.
Eine solche Chance schlage man nicht aus. Wenn ich wirklich nicht in der Lage sei, zu erkennen, welche beruflichen Vorteile solche Kontakte jemandem bescheren könnten, der eine Karriere als Kunsthändler anstrebte, sollte ich vielleicht in Erwägung ziehen, meinen Lebensunterhalt auf andere Weise zu verdienen.
Da hatte er wahrscheinlich recht.
Als rotziger Teenager hatte ich mich einmal darüber ausgelassen, dass er nie zum Mitglied berufen worden war, obwohl sein enger Freund Philip doch während ihrer Studentenzeit die Präsidentschaft innehatte. Wie sehr ihn das gewurmt haben muss. Wie sehr es wohl immer noch an ihm nagte. Am Ende des Tages sei es doch so, hatte ich – kalt, unbarmherzig, rundum genervt von ihm und mit der Absicht, ihn zu verletzen – gesagt, egal, wie sehr er sich einschleimte, wie angestrengt er versuchte, sich neu zu erfinden, von diesen Leuten würde niemand je vergessen, dass er nur ein Gesamtschultyp aus Südlondon war, aufgewachsen in einer Sozialwohnung.
Er hatte einen Monat lang nicht mit mir gesprochen.
»Bist du nervös wegen der Investitur?«, fragte er.
Die Wahrheit war, ich fürchtete mich davor. Meine gesamte bisherige Zeit in Cambridge hatte ich suffselige Rüpelabende, wie mir nun einer bevorstand, bewusst gemieden. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, hatte Harrys Cousin Freddie – ein notorischer Witzbold und wie Harry seit dem ersten Cambridge-Trimester Mitglied von Osiris – versucht, mir möglichst große Angst einzujagen, indem er sich in Andeutungen erging, was alles dazugehörte. Ich hatte es mir immer vorgestellt wie eine Mischung aus der Aufnahme in einen Rugbyclub und dem Initiationsritus bei den Freimaurern. Wie sich herausstellen sollte, war es weitaus schlimmer.
Vor einer Woche hatte Harry mir mitgeteilt, was ich zu der Zeremonie mitbringen sollte. Er hatte sich mit mir in einem Pub gleich beim College verabredet, und als ich dort aufkreuzte, saß an einem Tisch neben dem Kamin die halbe Osiris Society versammelt; wenn sie das Glas hoben, blinkte an ihrem kleinen Finger der Osiris-Siegelring. Freddie Talbot. Ivo Strang. Benjy Taylor. Arno von Westernhagen. Eric Lam. Der hübsche Hugo de Hauteville – Hugo de Hotville nannten ihn einige Kommilitoninnen. Allesamt die Sorte Leute, wie mein Vater sie sich so dringend als meine Bekannten wünschte: reich, ehrgeizig, mit guten Verbindungen. Einige verkörperten diesen Typus in geradezu absurdem Ausmaß. Arno von Westernhagen – groß, braun gebrannt, begeisterter Skifahrer und noch eifrigerer Rugbyspieler – war tatsächlich ein deutscher Graf. Er war auf einer englischen Schule gewesen, hatte die Sommer aber immer im Schloss seiner Familie in Bayern verbracht.
Ich bot an, eine Runde auszugeben, und betete, als sie alle nickten, dass ich genügend Bares für elf Lager und eine Diet Coke mit Eis und Zitrone bei mir hatte. Letztere war für Arno von Westernhagen, der auf ärztlichen Rat hin gerade nicht trank, denn er hatte sich ein paar Wochen zuvor beim Rugby eine Kopfverletzung zugezogen. »Ich war zehn Minuten komplett weg«, hörte ich ihn Hugo und Benjy erzählen. »An dem Abend waren wir mit der Mannschaft auf ein paar Bier unterwegs, und dann hatte ich einen verdammten Anfall. Der Arzt sagt, ein halbes Jahr kein Alk.«
Harry folgte mir an die Bar und drückte mir einen Umschlag in die Hand.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Instruktionen.«
Als ich den Umschlag öffnen wollte, schüttelte er den Kopf und meinte, das solle ich erst zu Hause tun. Also trank ich mein Bier, entschuldigte mich dann und verzog mich, um in den Umschlag zu schauen. Auf dem Zettel, den er enthielt, standen vier Worte in Harrys seltsam kindlicher Handschrift. Als ich ging, war Freddie mit Eric Lam und Arno von Westernhagen draußen und rauchte. Er warf einen Blick auf den Zettel in meiner Hand.
»Bring ein Tier mit?«, sagte ich ungläubig. »Was soll das heißen, ein Tier mitbringen? Ein lebendes Tier? Ein totes Tier? Was für ein Tier denn?«
»Das liegt ganz bei dir, Patrick. Wir mussten das alle. Was war’s bei dir noch mal, Eric? Ein Fasan?« Freddie grinste.
Eric nickte. »Konnte meinen Vater dazu bewegen, mir per Post einen zu schicken.«
»Und du, Arno, hattest ein Kaninchen, wenn ich mich recht entsinne«, fuhr Freddie genüsslich fort.
Arno bejahte das. Da er nicht trinken durfte, schien er umso mehr zu rauchen – er drückte eine Zigarette aus, dass die Funken stoben, und zündete sich sofort eine neue an.
»Mit Fell und allem«, ergänzte er. »Ich hab es tiefgefroren bei einem Laden gekauft, der Futter für Schlangen anbietet.«
Sie lachten alle, aber ich konnte beim besten Willen nicht erkennen, ob Freddie Witze machte oder nicht.
»Wir haben uns diesen Scheiß nicht ausgedacht. Steht alles in den Regeln. Die Zeremonie bei der Investitur ist seit den Anfängen der Society immer die gleiche«, sagte er achselzuckend.
Ich starrte ihn mit hartem Blick an. »Und was werde ich damit machen müssen? Mit diesem Tier?«
Sein Grinsen wurde noch breiter. »Ich fürchte, das kann ich dir nicht sagen, Patrick.«
»Warum nicht? Steht das auch in den Regeln?«
Freddie schüttelte den Kopf. »Nein, gar nicht, darüber steht in den Regeln nichts. Ich will nur, dass es eine Überraschung bleibt.«
Bis zur letzten Minute der Öffnungszeit blieb ich und las in Juliettes Tagebuch, so vertieft in die Seiten vor mir, dass ich gar nicht mitbekam, wie der Raum sich leerte. Am Ende waren nur noch die Bibliothekarin und ich im Gebäude, und jemand mit einem Wischmopp.
Diese Tagebucheinträge zu lesen war schwindelerregend, der reinste Sog.
Juliettes Geschichte. In ihren eigenen Worten. In ihrer Handschrift (schön, aber äußerst schwer zu entziffern), mit ihren Illustrationen am Rand, manchmal auch über eine ganze Seite. Tintenkleckse aus einem Füllfederhalter, die kunstvoll erweitert und in dahintreibende Wolken verwandelt worden waren, Wasserfarbenwellen und Landschaftsumrisse, gekonnte Kohleskizzen der Objekte, Orte und Menschen, die sie beschrieb. Hatte das alles wirklich die ganzen Jahre hier am Grunde dieses Kartons geschlummert?
Wenn ich nicht durch sei mit dem, was ich mir ansehen wollte, mahnte die Bibliothekarin sanft, könne ich den Karton einfach an die Seite schieben und am nächsten Morgen weitermachen, sobald sie um neun öffneten. Ich blickte zu der Uhr an der Wand, es war fünf vor sieben. Die Reinigungskraft war fertig mit Wischen und begann die Lampen auszumachen.
Ich schlief schlecht, und mitten in der Nacht befiel mich kurz Panik. Was, wenn ich am nächsten Morgen in die Bibliothek kam und der Karton war nicht mehr da? Oder wenn ich ihn öffnete und das Tagebuch fehlte?
Zehn vor neun am nächsten Morgen stand ich, meinen Notizblock umklammernd, vor der Tür und wartete, dass die Bibliothek öffnete. Dann arbeitete ich den Vormittag ohne Pause durch, transkribierte mühsam, brütete stirnrunzelnd über durchgestrichenen Sätzen und unentzifferbaren Wörtern. Schließlich gewann ich den Kampf mit Juliettes Tinteneskapaden und erreichte das Ende dieses langen ersten Eintrags. In der Eingangshalle der Bibliothek gab es ein Münztelefon. Ich rief bei meiner Freundin Athena an, um zu fragen, ob wir uns in unserem College-Speisesaal zum Mittagessen treffen könnten. Ich musste unbedingt mit jemandem über all das sprechen. Und ich hatte einen Mordshunger.