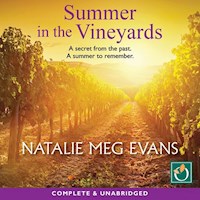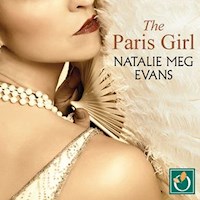9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1940: Cora Masson, die Tochter eines cholerischen Hutverkäufers, arbeitet schlecht bezahlt in einer Hutmacherei in London. Als sie den Kunsthändler Dietrich kennenlernt, sieht sie ihre Chance gekommen und geht mit ihm nach Paris, in die Stadt ihrer Träume. Fortan macht sie sich als Coralie de Lirac unter falscher adeliger Identität einen Namen in der Modewelt. Doch als die Nazis in Frankreich einfallen, scheint ihr Geschäft ruiniert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DAS BUCH
Paris 1940. Cora Masson, die Tochter eines cholerischen Hutverkäufers, arbeitet schlecht bezahlt in einer Hutmacherei in London. Als sie den Kunsthändler Dietrich kennenlernt, sieht sie ihre Chance gekommen und geht mit ihm nach Paris, der Stadt ihrer Träume. Fortan macht sie sich als Coralie de Lirac unter falscher adeliger Identität einen Namen in der Modewelt. Als die Nazis in Frankreich einfallen, scheint ihr Geschäft ruiniert. Nur die Fürsprache eines einflussreichen Liebhabers kann ihr dabei helfen, ihre Existenz zu retten …
DIE AUTORIN
Natalie Meg Evans gab einst ihren Platz an der Kunstakademie auf, um einem Londoner Experimentiertheater beizutreten. Sie verbrachte dort fünf Jahre und schrieb in dieser Zeit auch eigene Theaterstücke und Sketche. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann im ländlichen Norden von Suffolk, umgeben von ihren Hunden und Pferden.
LIEFERBARE TITEL
Die Kleiderdiebin
NATALIE MEG EVANS
DAS
GEHEIMNIS
DER
Hutmacherin
ROMAN
Aus dem Englischen
von Stefanie Fahrner
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
The Milliner’s Secret bei Quercus.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Taschenbucherstausgabe 12/2016
Copyright © 2015 by Natalie Meg Evans
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angelika Lieke
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-19465-9V001
www.heyne.de
Meiner Schwester Anna gewidmet
Paris, Samstag, 13. Juli 1940
In jeder Stadt hätte man sich nach ihnen umgedreht. Nackte Schultern, neckische kleine Hüte und Hochsteckfrisuren. Die erste, eine Blondine Mitte dreißig, schwebte in einer Wolke aus Sex-Appeal über die Tanzfläche. Die zweite, eine jüngere Blondine, durchquerte den Raum, als befürchte sie, der Boden sei voller Giftschlangen. Die dritte, eine Rothaarige, folgte ihr wie eine Schlafwandlerin.
Die Band spielte eine Hot-Jazz-Version der Marseillaise, so laut, dass die Flaschen auf der Theke hüpften. »Sie wissen doch, dass dieses Lied verboten ist, oder?« Die jüngere Blondine – sie hieß Coralie de Lirac – blickte unsicher zur Bühne hinüber. »Keiner tanzt.«
»Dafür ist es auch noch viel zu früh«, erwiderte die Ältere. »Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, zur Teatime in den Nachtklub zu gehen.«
Einen Monat zuvor, nur Stunden, nachdem sie in Paris einmarschiert waren, hatten die Deutschen die Uhren an die Berliner Zeit angeglichen und eine Ausgangssperre verhängt, die die Menschen praktisch in ihren Wohnungen festsetzte. Als die Besatzer jedoch begriffen, dass sie dadurch ganz Paris lahmlegten, verlängerten sie die Ausgangserlaubnis bis Mitternacht. Brach man nicht rechtzeitig auf, war man gezwungen, an Ort und Stelle – wo immer das sein mochte – bis zum nächsten Morgen um fünf auszuharren. Tja, die Nazis hatten Frankreich nicht besetzt, um es seinen Einwohnern möglichst angenehm zu machen, dachte Coralie. »Kommt, wir nehmen uns einen Tisch«, schlug sie vor. »Keinen Blickkontakt mit Männern unter neunzig. Una? Konzentrier dich auf den Job.«
»Na klar. Auch, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Frosch küssen müssen, bevor wir finden, wonach wir suchen. Tilly, meine Liebe, krieg jetzt keinen Schreck.« Una McBride legte der rothaarigen Freundin, die bei dem Wort »Frosch« zusammengezuckt war, den Arm um die Schulter. »Coralie und ich kümmern uns um diese kleinen Feinheiten. Na ja, oder eher Unfeinheiten, um bei der Wahrheit zu bleiben.« Aus Unas lang gezogenen Vokalen konnte man heraushören, dass sie Amerikanerin war.
Coralie deutete auf einen Tisch. »Da drüben. Los jetzt, sonst halten die uns womöglich für die Nachtklub-Show.« Sie waren jedoch noch nicht weit gekommen, als der Inhaber des Klubs sie entdeckte und zu einem anderen Tisch geleitete, der sich näher an der Band und der Bar befand. Der Mann war noch jung und hatte eine Figur wie ein Preisboxer. Er trug einen weißen Smoking und eine Rose im Knopfloch.
»Mesdames, ich bin entzückt. Willkommen im Rose Noire.« Nacheinander küsste er ihnen die Hand, verharrte aber ein wenig länger bei Coralie. »Mademoiselle de Lirac, Sie waren viel zu lange fort.«
»Wie schmeichelhaft, dass Ihnen das aufgefallen ist.« Coralie setzte sich auf den Stuhl, den er ihr heranzog, und nestelte am Verschluss ihres Armbandes herum, um sein Lächeln nicht erwidern zu müssen. Im Sommer 1937, als sie das Rose Noire zum ersten Mal besucht hatte, war Serge Martel eine glanzvolle Persönlichkeit gewesen, voller Charme, begierig, seiner Kundschaft selbst den ausgefallensten Wunsch zu erfüllen. Als sie aber erfuhr, dass er wegen eines tätlichen Angriffs auf eine seiner Sängerinnen festgenommen und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden war, war sie schockiert. Achtzehn Monate hatte er abgesessen. Wie er es angestellt hatte, so früh entlassen zu werden – oder wer für ihn die Gefängnistür geschmiert hatte –, wusste niemand. Auf jeden Fall hatte er etwas Ungewohntes und Beunruhigendes an sich. Coralie versuchte, Blickkontakt zu Una herzustellen, aber ihre Freundin war gerade damit beschäftigt, die Kundschaft prüfend zu beäugen.
Martel schnippte mit den Fingern und rief einen älteren Ober herbei, der ein Tablett mit Champagner trug. »Schnell, schnell, Mann. Hier sitzen durstige Damen.«
Der Ober gab zurück: »Monsieur, wäre ich jünger und schneller, wäre ich in der Armee!« Dennoch beschleunigte er seine Schritte.
Félix Peyron füllte drei Gläser mit Lanson-Jahrgangschampagner. Coralie bemerkte, dass seine Hände dabei zitterten. Er war eine Legende des Boulevard de Clichy, aber der Schock der Niederlage und der Besatzung hatte ihn rapide altern lassen. Man sah seinen Manschetten für gewöhnlich an, dass er sie mit Talkumpuder behandelte, aber an jenem Abend wirkten sie ein wenig gelblich neben Martels Smoking. Wie bekam Martel diesen Smoking nur so weiß?, fragte sie sich. In letzter Zeit war es leichter, in den Himmel zu kommen, als Waschsoda aufzutreiben, und die Wäschereien waren mit der Wäsche ihrer deutschen Kunden vollauf ausgelastet. Paris war nicht bombardiert worden, so wie Warschau oder Rotterdam, aber es mangelte dennoch an allem: an Nahrung, an Benzin und an Hoffnung. Jedenfalls für Normalsterbliche. Coralie zählte die feldgrauen Uniformen im Klub und die Mützen mit dem silbernen Adler, die auf den besten Tischen herumlagen, und zog ihre eigenen Schlüsse, was Serge Martels rosige Finanzlage anging.
Félix stellte die Flasche in den Eiskühler, trat einen Schritt zurück und verbeugte sich. »Mesdames, willkommen im Rose Noire, denn Schönheit ist hier immer gern gesehen.«
»Ach, Félix, Sie alter Charmeur.« Una nahm ihr Glas in die Hand. »Auf Sie müssen wir aufpassen, das sehe ich genau.«
Jetzt geht das wieder los, dachte Coralie. Una machte allem, was Hosen trug, schöne Augen, auch wenn ihre Hauptaufmerksamkeit gerade der Bühne galt. Ganz besonders dem Zigeunergeiger, dessen verschwitzte Locken sein halbes Gesicht bedeckten. Sein Hemd war ihm auf einer Seite von der Schulter gerutscht.
»Die Vagabonds sind heute Abend gut in Form«, sagte Coralie leise, um Unas Reaktion zu testen.
»Nicht wahr? Aber sie sollten lieber bei Jazzstücken bleiben. Damit, dass sie den Takt der Marseillaise verändern, legen sie niemanden rein.« Una schickte stürmische Kusshände Richtung Bühne, und der Geiger unterbrach sein Spiel und sandte ihr eine Kusshand zurück. Gedämpfter Applaus füllte den Raum. Sie erweckten Aufmerksamkeit, besonders die der Frauen. Coralie bemerkte eine, die eine Seidenblume von ihrer Abendtasche abnahm und sich ins Haar steckte, als fühlte sie sich nicht gut genug angezogen im Vergleich zu ihnen.
Félix zündete die Kerze auf ihrem Tisch an und kicherte. »Die Leute kriegen mit, dass sich hier eine Liebesgeschichte anbahnt.«
»Nein, mein Herr, es sind unsere Hüte, die allen die Schau stehlen.« Una tippte sich an den Miniatur-Gainsborough, den sie über dem Ohr festgesteckt hatte, und fuhr vorsichtig durch seine bunten Blümchen und Federn. »Ich habe dir ja gesagt, dass diese süßen kleinen Dinger einschlagen werden wie eine Bombe«, sagte sie zu Coralie.
»Nein, ich war diejenige, die das prophezeit hat. Ich wünschte, du würdest aufhören, mir meine Ideen zu klauen.«
»Ups.« Una nahm einen großen Schluck Champagner. »Ich vergesse immer, dass ich nur die Muse bin und nicht die Hutmacherin. Nächste Woche werden unsere Hüte jedenfalls in aller Munde sein. Vor deinem Laden werden sich Schlangen bilden bis runter zum Fluss.«
Coralie wartete darauf, dass Félix ihren Tisch verließ. »Wenn wir nächste Woche überhaupt noch da sind. Tilly?« Die Freundin starrte misstrauisch in ihr Glas, fast als argwöhnte sie, zwischen den Bläschen würde Blausäure aufsteigen.
»Trink aus, oder stell das Glas wieder ab. Die Leute glauben ja, du müsstest dich vor irgendwas fürchten«, bemerkte Una.
»Muss ich das denn nicht?«
»Na ja, versuch wenigstens, es nicht zu zeigen.«
»Ich glaube, da verlangst du zu viel von ihr, Una«, warf Coralie ein.
»Welche Wahl hat sie denn schon? Wir können nicht riskieren, sie mit nach Hause zu nehmen, weil unsere Wohnungen alle beobachtet werden. Ihre einzige Chance ist, sich über die Grenze in die freie Zone durchzuschlagen und von da aus weiterzufahren. Aber den Weg mit dem Zug kann sie vergessen, denk nur an den Fahrkartenschalter, ganz zu schweigen von den Polizeikontrollen.«
Una hatte recht. Ottilia musste fort aus Paris, und ihre einzige Hoffnung war, einen Platz in einem Auto zu ergattern. Jetzt mussten sie sich durch Charme erschleichen, was sie auf dem Polizeirevier nicht bekommen konnten: eine Reiseerlaubnis, ausgestellt auf ihren Namen.
Una nahm eine Chesterfield-Zigarette aus einem eleganten Etui, den Blick weiter auf die Bühne gerichtet, wo die Vagabonds die letzten Takte der Marseillaise spielten. »Steh auf und klatsch, wenn sie fertig sind«, verlangte sie von Coralie.
»Warum schwenken wir nicht gleich die französische Flagge, wenn wir schon dabei sind? Dann werden wir alle verhaftet und können im Gefängnis weiterfeiern. Ich habe noch nie so viele deutsche Offiziere auf einem Haufen gesehen. Ich dachte, die können Jazz nicht leiden.«
»Dein deutscher Freund war recht angetan vom Jazz.«
»Er ist anders.« Finger weg!, schien Coralies Ton zu sagen. »Wir sollten gar nicht hier sein. Die Stammgäste könnten uns erkennen.«
»Uns schon, aber doch nicht Tilly. Und außerdem, da wo ich herkomme, gibt es ein Sprichwort: Wenn du dich im Senf verstecken willst, zieh was Gelbes an.«
»Wir stecken nicht im Senf, aber vielleicht in der Tinte.«
Una stand auf und klatschte, und Coralie tat es ihr widerstrebend nach. Die Vagabonds bedankten sich für den Applaus und zogen sich dann von der Bühne zurück. Ottilia schien in Trance verfallen zu sein. Als sie sich wieder gesetzt hatten, steckte Una eine Zigarette in ihre crèmefarbene Zigarettenspitze und ließ sich von einem Mann am Nebentisch Feuer geben. Sie blies ihm ein wenig Rauch entgegen. »Merci mille fois. Wir sehen uns.«
Als er sich wieder zurückgezogen hatte, flüsterte sie Coralie zu: »Schau jetzt nicht hin, aber siehst du diese Besatzungshelden an der Bar?«
»Wie denn, wenn ich nicht gucken darf?«
»Glaub mir, sie stehen dort. Ich bin mir sicher, dass sie uns auf die nächste Flasche Champagner einladen möchten. Sollen wir ein Gespräch anfangen?«
Coralie sah sich unauffällig um und spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Die Männer trugen schwarze Uniformen und SS-Abzeichen am Kragen. Sie mussten Unas Lächeln bemerkt haben, denn plötzlich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Coralie legte die Hand vor den Mund, damit ihr niemand von den Lippen lesen konnte, und raunte: »Die könnten von der Gestapo sein. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwas ist faul an denen.«
»Gestapo heißt doch Geheimpolizei, stimmt’s?« Una zündete eine zweite Zigarette an. »Ist ja nicht so wahnsinnig geheim, hier in Uniform rumzustehen und mit uns zu flirten. Reiß dich zusammen und gib die Tilly.«
Coralie schob Ottilia die Zigarette zwischen die Finger; sie waren eiskalt. Una hatte natürlich recht: Es war zu spät, den Plan noch zu ändern. Im Morgengrauen würde ein Auto losfahren, und Ottilia musste nur darin Platz nehmen. Versehen mit einem gefälschten Ausweis, Kleidern zum Wechseln sowie genügend Francs und Besatzungsgeld hatte sie gute Chancen, die spanische Grenze zu erreichen. Alles, was sie jetzt noch brauchten, war ein deutscher Offizier, der genügend Autorität hatte, um die Erlaubnis in Unas Handtasche zu unterzeichnen.
Alles, was sie brauchten …
Klagende Töne kündigten das zweite Set der Vagabonds an. Die Musiker trugen jetzt rote Seidenhemden mit Fledermausärmeln und engem Kummerbund. Arkady Erdös, der Bandleader, stimmte seine Violine und sah trotzig ins Publikum. Er hatte also die verbotene Marseillaise gespielt? Wen interessiert das schon?, schien sein Blick zu sagen.
Das Problem war, dass es durchaus jemanden interessieren würde, nämlich die regelwütigen Deutschen. Coralie flüsterte: »Weiß Arkady, dass er einen zusätzlichen Passagier mitnimmt?«
»O ja, und die anderen werden es spätestens dann merken, wenn sie sich zusammen ins Auto quetschen.«
Ottilia hatte sich die Zigarette zwischen die Lippen gesteckt und zog so fest daran, dass das Ende glühte. Coralie, die ihre übliche Vorsicht vergaß, schimpfte: »Du siehst aus wie eine Fabrikarbeiterin nach der Nachtschicht!« Sie griff in die perlenbestickte Handtasche ihrer Freundin, auf der Suche nach der zweiundzwanzigkarätigen Zigarettenspitze, die eigentlich keine kluge Wahl für den Abend gewesen war. Gerade hatte Coralie sie gefunden, da spürte sie einen Atemzug an der Schulter und erschrak. Die Zigarettenspitze purzelte aus der Tasche, zusammen mit einem hellbraunen Büchlein.
Das Blut gefror ihr in den Adern.
Serge Martel lächelte auf sie herab. »Meine Damen, einige der Herren vom Militär haben gefragt, ob sie sich zu Ihnen gesellen dürfen.«
»Richten Sie ihnen aus, dass sie es nicht dürfen.« Coralie legte die Hände über das Büchlein. »Heute ist reiner Mädchenabend.«
»Mademoiselle, Sie verstehen nicht«, sagte Martel mit einschmeichelnder Stimme. »Sie fragen zwar um Erlaubnis, rechnen aber nicht mit Zurückweisung. Was verstecken Sie da unter Ihrer Hand?«
»Nichts.«
Martel holte aus und schwenkte nur eine Sekunde danach das Büchlein. Es war ein Ausweis. So weit nicht unüblich. Sie alle besaßen einen, das war gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Ausweis aber enthüllte Ottilias wahre Identität; ihren echten Namen und ihr Herkunftsland. Sie hätte ihn gegen Ottilias Willen verbrennen sollen! Allein der Besitz des Ausweises genügte, um in lebensbedrohliche Schwierigkeiten zu kommen. Das betraf nicht nur Ottilia, sondern sie alle drei. Betont langsam sagte Coralie: »Monsieur Martel, bitte geben Sie ihn mir zurück.«
Martel hob in gespieltem Erstaunen eine Braue. Seine platinblonde Haarfarbe hatte er mit vielen der Offiziere an seinem Tisch gemeinsam, nicht jedoch die nüchterne Sachlichkeit. Sein Kapital war seine Umgänglichkeit, seine souveräne, sexy Art, mit Frauen zu reden. Martel lachte gern. Als er den Kopf drehte, sah Coralie, dass seine Nase schief war, ganz so, als hätte sie irgendwann einmal einen heftigen Schlag abbekommen. Vielleicht war das der Grund für die schummrige Beleuchtung in seinem Klub. Er war überaus eitel.
So beiläufig wie nur möglich sagte Coralie: »Sie wissen schon, dass Ausweise technisch gesehen Eigentum des Staates sind? Außerdem gehen sie niemanden etwas an.«
»Serge, mein Lieber, geben Sie ihn zurück.« Una blies den Rauch ihrer Zigarette aus. »Seien Sie nicht gemein.«
»Ich möchte doch nur einen winzigen Blick hineinwerfen, Madame. Aus reiner Neugier.«
»Neugierige Katzen verbrennen sich die Tatzen.« Vorsichtig drückte Una ihre Zigarette aus. »In diesem Ausweis befinden sich streng geheime Informationen. Sollten Sie Kenntnis davon erlangen, muss ich Sie töten.«
Schockiert blickte Coralie zu ihr hinüber.
»Streng geheime Informationen?«, wiederholte Martel.
»Ja.« Unas Kunstpause dauerte so lange, dass Coralie sie am liebsten vom Stuhl geschubst hätte. »In diesem Ausweis steht das Geburtsdatum unserer Freundin und damit auch ihr Alter. Zehn Jahre lang hat sie geschummelt, was das angeht. Wir wären also gezwungen, Sie auf die eine oder andere Art zum Schweigen zu bringen.«
»Sie wollen mich verhaften lassen?« Martels Blick fiel auf die schwarz uniformierten Männer drei Tische weiter. Als Coralie schon befürchtete, sie habe vergessen, wie man atmete, ließ Martel eine Lachsalve erschallen. »Wir spielen also Spielchen, Madame, aber Sie haben gewonnen. Voilà!« Er warf den Ausweis auf den Tisch, und als er gegen den Kerzenhalter fiel, klappte er auf und blieb geöffnet auf der Tischplatte liegen. Alle sahen das Bild einer ernsten Ottilia mit Seitenscheitel und dichten Locken über den Ohren.
Zeile für Zeile wurde das Geheimnis um Ottilia gelüftet. »Ottilia Johanna von Silberstrom. Geboren in Berlin am 19. Dezember 1909. Rotblondes Haar, hellbraune Augen. Beruf: keiner.« In der oberen rechten Ecke konnte man einen Stempel erkennen, der im Licht der Kerzenflamme blutrot erschien.
»Juif«, murmelte Martel. »Oder eher juive.«
Ottilia weinte. Una zog eine neue Zigarette aus ihrem Etui. Ihre Hand zitterte.
»Sie haben eine Jüdin in meinen Klub gebracht, Mademoiselle de Lirac? Sie setzen meine Lizenz, meinen Ruf, mein Leben aufs Spiel.«
Coralie hörte Ärger und noch etwas anderes aus seiner Stimme heraus, erkannte aber erst, was es war, als Martel mit Zeige- und Mittelfinger einer Hand auf den Ausweis zumarschierte. Er imitierte deutsche Stiefel. Selbst in seiner Wut konnte er der Gelegenheit für einen Witz nicht widerstehen. Coralie drückte ihre Handfläche auf den Ausweis; vielleicht konnte sie ihn ja mit ihrer Körperwärme schmelzen und zum Verschwinden bringen.
»Meine Damen? Dürfen wir stören?«
Als sie aufsah, standen drei Männer in tiefschwarzen Uniformen an ihrem Tisch. Unas »Besatzungshelden« hatten sich vorgewagt.
»Meine Damen?« Der deutsche Offizier schien irritiert von ihrem Schweigen. Er war der Ranghöchste, ging man von den drei Rauten an seinem Kragen aus. »Vorhin erweckten Sie den Eindruck …«
»Da haben Sie wohl etwas missverstanden.« Coralie ließ ihre Stimme möglichst schroff klingen.
»Sie möchten sich zu uns gesellen? Wie reizend!« Una erwachte zu neuem Leben, auch wenn sie sich anhörte, als sei sie gerade eine Treppe hinaufgestürmt. »Serge, mein Lieber, bringen Sie uns mehr Stühle. Lassen Sie die Herren nicht stehen.«
Martel machte eine ironische Verbeugung. Eine Minute später saßen die Herren am Tisch und plagten sich mit Höflichkeiten ab. Die ganze Zeit über starrte der ranghöchste Offizier auf Coralies Hand.
»Was verstecken Sie da, Fräulein?« Als Coralie ihn nur stumm ansah, blaffte er sie auf Deutsch an. Einer der anderen Offiziere streckte auffordernd die Hand aus.
Doch Serge Martel war schneller. Er riss den Ausweis an sich und schob ihn in Coralies Ausschnitt. »Meine Herren, ich habe die junge Dame gerade dafür gerügt, dass sie ihre carte d’identité aus der Handtasche hat fallen lassen. ›Ist die eigene Identität denn nicht der wertvollste Besitz?‹, habe ich sie gefragt.« In einer dramatischen Geste breitete er die Arme aus. Coralie war die Einzige, die seine Anspielung verstanden hatte. Ja, er spielte weiter seine Spielchen. »In diesen schwierigen Zeiten riskiert man nicht nur, dass die anderen missverstehen, wer man ist, sondern auch, wer man einmal war.« Ein Seitenblick auf Ottilia. »Habe ich recht, Mademoiselle de Lirac?«
Coralie schluckte. »Absolut.«
Der Offizier zuckte verständnislos mit den Achseln. Die Gefahr war an ihnen vorübergezogen.
Serge Martel war wieder in seinem Element und kündigte an, den besten Champagner an den Tisch zu schicken. »Eine Magnum, meine Herren, und dazu Austern von der Küste – auf Eis.« Er küsste geräuschvoll seine zusammengelegten Fingerspitzen. »Mit einer Mignonette-Sauce, die in ganz Paris berühmt ist. Sie werden mir doch die Ehre erweisen, eine Platte zusammen mit diesen schönen Damen zu genießen?«
Die Herren waren durchaus geneigt. Vor dem Krieg hätte man niemals Austern im Juli serviert, dachte Coralie. Aber die Besatzer waren ganz wild auf Pariser Luxus und verstanden nichts von den Feinheiten, die dazugehörten. Leuten wie Martel war das gleichgültig; sie verdienten daran. Martel stapfte davon. Die Offiziere stellten sich vor und nannten ihren Rang. Dann war Una an der Reihe. »Wie Sie schon wissen, sitzt zu meiner Rechten Mademoiselle de Lirac.«
Coralie rang sich ein Lächeln ab.
»Und hier ist Mademoiselle Dupont.«
Hatte Ottilia das begriffen? Ihr Nachname lautete jetzt Dupont. Coralie versetzte ihr einen sanften Rippenstoß. Ottilia riss die honigfarbenen Augen weit auf. »Guten Abend«, sagte sie. Auf Deutsch.
Una überspielte den Moment. »Sollen wir Ihnen auch unseren Rang nennen? Wir sind alle Häuptlinge. Wir haben nämlich Federn am Hut, sehen Sie?« Sie stupste ihr Hütchen neckisch an, und die Männer lachten. Die Begegnung mit einer echten Amerikanerin schienen sie überaus spannend zu finden. Die Vereinigten Staaten waren neutral, und Una war in Paris sicherer denn je.
Coralie fasste Ottilia am Handgelenk. »Auf die Damentoilette. Komm mit«, flüsterte sie. Der Ausweis, der an ihren Brüsten lag, musste sofort zerrissen und im Klo hinuntergespült werden. Außerdem musste sie Ottilia vor den Spiegel stellen und sie dazu bringen, ihren neuen Namen so oft zu wiederholen, bis es ihr in Fleisch und Blut übergegangen war. Und Martels Worte gingen ihr weiter im Kopf herum. »Auch, wer man einmal war.« Was wusste er über ihr eigenes Geheimnis?
Sie war nicht Coralie de Lirac. Sie stammte nicht aus gutem Hause oder aus Frankreich. Nicht einmal aus Belgien, wie ihre eigenen Papiere verkündeten. Ihre Herkunft war ein Geheimnis, das nur sie selbst und ein einziger anderer Mensch kannten. So hatte sie zumindest bislang gedacht.
Eins war ihr jedenfalls klar: Die Männer, die ihr gleich mit Martels überteuertem Champagner zuprosten würden, kannten nur einen Begriff für sie.
Feind.
I
1
Drei Jahre zuvor, im Süden Londons
Eine zielsichere Faust beförderte ihr Opfer in die Gosse.
»Das ist dafür, dass du Geld vor mir versteckt hast!« Jac Masson rang nach Luft. Der Schweiß tropfte ihm in den Schnurrbart, der so graublond war wie sein übriges Haar. Seine Tochter blickte benommen in den rauchverpesteten Himmel und wähnte sich einem blutrünstigen Löwen gegenüber. Jac hatte schon immer zu Gewalttätigkeiten geneigt, aber heute war er völlig außer sich. Das deutlichste Zeichen dafür war der plötzliche, starke Schmerz in ihren Augen.
»Steh auf, du faule pute, und geh zurück an die Arbeit!« Jac hob den Fuß, doch bevor er zutreten konnte, wurde er von den Fäusten eines jungen Mannes in Hemdsärmeln getroffen, der wild auf ihn einhämmerte. Beide gingen zu Boden, der junge Mann aber kam als Erster wieder auf die Beine. Mit geballten Fäusten lauerte er über Masson.
»Willst du dich mit mir anlegen, du hundsgemeiner Franzmann? Dann nimm es mit mir auf und lass Cora in Ruhe.«
»Franzmann?« Masson rappelte sich auf. Mit seinen fast einhundertneunzig Zentimetern warf er einen bedrohlichen Schatten. »Ich bin Belgier, kein Franzose. Halt dein Maul, wenn du den Unterschied nicht kennst.« Er grinste höhnisch beim Anblick der gegen ihn erhobenen Fäuste. »Nimm sie weg, du dürre irische Bohnenstange. Mit meiner Tochter mache ich, was ich will.«
Seine Tochter kroch derweil aus dem Rinnstein und griff nach seiner Weste, um sich daran hochzuziehen. Masson packte ihre Hand und verdrehte sie. »Mädchen, ich will am Wochenende deinen ganzen Verdienst, und ich werde jeden sixpence vor deinen Augen nachzählen. Marsch an die Arbeit!«
Er stapfte in Richtung der viel befahrenen Tooley Street davon, blieb aber noch einmal stehen, um einen Gegenstand auf die Straße zu werfen.
Der junge Mann, Donal Flynn, rannte los und hob den Gegenstand auf. Es war eine lederne Geldbörse. Missbilligend schnalzte er mit der Zunge und half Cora auf die Füße. »Bist du verletzt?«
»Mein Gesicht … Ich sehe sicher aus wie Joe Louis an einem schlechten Tag.«
»Selbst wenn du zwei Veilchen hättest, würdest du niemals einem Schwergewichtsboxer ähneln.«
Sie rang sich ein schmerzverzerrtes Lächeln ab. »Fliegengewicht, vielleicht?«
»Höchstens. Du hattest Glück, dass ich in der Nähe war, ich habe gerade eine Kiste in der Vorschule abgeliefert.« Mit dem Daumen deutete Donal auf die nahe gelegene Magdalen Street. Es war Mittag, und die lauten Schreie vom Spielplatz wehten über die Fabrikdächer herüber. »Ich habe gehört, wie er deinen Namen gebrüllt hat, da wusste ich, dass du in Schwierigkeiten bist.«
»So kann man es auch ausdrücken. Ich bin zu Boden gegangen wie ein nasser Sack.« Sie sah über ihre Schulter. »Schnell, gehen wir, falls er zurückkommt.«
»Er wird nicht zurückkommen, jedenfalls nicht, wenn er dort ist, wo er immer um diese Uhrzeit ist. Wie viel war in der Geldbörse?«
»Fünf Pfund. Er hat mich durch halb Bermondsey gejagt und mich nur deshalb erwischt, weil ich gestolpert bin. Als ich sie ihm nicht geben wollte, ist er auf mich losgegangen.«
»Er hat nicht das Recht dazu.«
»Er hat sehr wohl das Recht dazu, Donal. Er hat den härtesten Schlag weit und breit, und in seinen Augen reicht das.«
Cora Masson lehnte sich an Donals Schulter, während sie sich langsam erholte. Aus einer Wunde über ihrem Auge tropfte Blut und vermischte sich mit der Schmutzschicht auf ihren Wangen. Als sie die Röcke ihres Sommerkleids richtete, stöhnte sie auf. Der bedruckte Rayonstoff war über und über mit Dreck beschmiert, und da sie sich vor der Gerberei befanden, ahnte sie, woraus dieser Dreck bestand. »Keiner von den Fabrikarbeitern ist gekommen, um mir zu helfen. Wenn du meine Schreie gehört hast, müssen sie sie auch gehört haben.«
»Sie haben Angst. Man munkelt, dein Vater hätte einmal einen Mann mit den bloßen Händen auseinandergerissen.«
»Das stimmt auch. Manchmal erzählt er mir davon.« Sie schüttelte den Kopf, um das furchtbare Bild zu verscheuchen. »Ich sollte eigentlich längst auf dem Weg zum Derby sein.«
Donal lachte ungläubig auf. »Du glaubst doch nicht, dass er dir einen Tag beim Rennen gönnt? Das wäre ja ein Wunder.« Er blickte die Shand Street hinunter. Keine Spur von Jac Masson. Das Pub namens The Spotted Cow an der Tooley Street hatte ihn anscheinend in seinen Bann gezogen.
»Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich dort hinfahren wollte. Wer kann es ihm bloß verraten haben?« Cora nahm Donals Arm. »Bring mich einfach in die Bermondsey Street, dann schaffe ich den Rest schon alleine.«
»Zurück zur Arbeit?« Donal klang erleichtert.
»Zurück in die Fabrik. Die Busse sind vielleicht noch da. Wenn sie die Anwesenheitsliste durchgehen, merken sie, dass ich noch fehle. Außerdem vermissen sie mich beim Singen!« Sie stimmte eine Varieténummer an. »Du warst immer so lieb zu mir, jetzt bist du nur noch fies zu mir, jeden Abend schlägst du mich grün und blau!«
»Verausgabe dich lieber nicht so«, sagte Donal. »Ich kann dich stützen, aber nicht tragen. Und die Busse sind sicher nicht mehr da.«
Er hatte recht. Der Bordstein vor Coras Arbeitsplatz war übersät mit Zigarettenkippen und Bonbonpapieren. Außerdem lag dort eine einzelne Rose, die wohl von einem Sonntagsstrohhut abgefallen sein musste. Der Unrat zeugte von einer Menschenmenge, die über den Hof zu den wartenden Bussen gelaufen war. Die Hutfabrik brummte noch immer; aus ihren Schornsteinen quollen weiße Wolken, die sich gelbbraun färbten, als sie auf den üblichen Smog von Bermondsey trafen. Ihr typischer Geruch, Harz vermischt mit nassem Hund, war dank einer frischen Brise an jenem Tag weniger stechend als sonst. Als Cora sich das Innere der Fabrik vorstellte – die riesigen Maschinen, die rotierten, walzten, Luft ausbliesen –, wurde sie trübsinnig. Als wären noch mehr verflixte Hüte alles, was die Welt jetzt bräuchte!
Donal half Cora, zu einem Mäuerchen zu humpeln. Er kam besser mit ihrem Gewicht zurecht, als er behauptet hatte. Dabei war er nicht besonders muskulös, aber doch gut in Form, weil er sechs Tage die Woche die schweren Wäschekisten durch die Straßen schob. Und Cora war zwar groß – das war neben ihrer hellen Haut ein Hinweis darauf, von wem sie abstammte –, aber zierlich gebaut. Nachdem Donal sich davon überzeugt hatte, dass Cora alleine sitzen konnte, holte er den Karren, den er hatte stehen lassen.
Als er zurückkam, bat sie ihn um ihre Geldbörse.
Er reichte sie ihr. »Leider leer.«
»Irrtum.« Sie holte ein weißes Zettelchen heraus. Nummer 22 – das war sowohl ihr Geburtstag als auch ihr Alter. »Meine Glückszahl. Ich wusste, dass ich dieses Jahr bei der Tombola gewinne.«
Donal nickte. »Meine Schwestern waren ganz neidisch.«
»Das brauchen sie nicht mehr zu sein. So ist es manchmal im Leben: Da denkt man, man hat Glück, und dann stellt sich heraus, dass man bloß verscheißert worden ist …«
»Keine schlimmen Wörter, Cora.«
Es war der 2. Juni, der Tag des großen Pferderennens, das den Höhepunkt der Rennsaison markierte und ein besonderer Tag für jeden Londoner Bürger war. Seit dem frühen Morgen waren viele Busse, Züge und Privatfahrzeuge zur Rennbahn von Epsom aufgebrochen. Die Firma Pettrew & Lofthouse, Hutmacher von Rang und Namen und außerdem Coras Arbeitgeber, hatte einen Vorstand aus Methodisten, die solche Dinge wie Pferderennen missbilligten, ganz zu schweigen von Flirtereien zwischen Frauen und Männern. Aber auch sie konnten nichts gegen die Tradition unternehmen, nach der sich jedes Jahr einige Arbeiter den feiernden Menschen anschließen durften. In diesem Jahr – 1937, das Krönungsjahr und schon darum ein außergewöhnliches Jahr – hatte man sich darauf geeinigt, dass einhundert Arbeiter statt der gewöhnlich fünfzig fahren durften. Am vorigen Freitag war unter anderem das Los mit der Nummer 22 – Coras Los – aus Mr. Pettrews riesigem Zylinder gezogen worden.
»Einer der Busse hätte doch wirklich auf mich warten können.« Cora ließ ihr Los vom Wind davontragen. »Ich bin nur schnell nach Hause gerannt, um mich umzuziehen, da hat mich mein Dad überfallen.«
»Wo hattest du denn die fünf Pfund her?«
»Was glaubst du denn?« Seit Weihnachten hatte sie abends in der Wäscherei gearbeitet, die Donals Großmutter gehörte. Um sechs, gleich nach ihrer Schicht bei Pettrew & Lofthouse, war sie zum Haus der Flynns an der Ecke Tooley und Barnham Street gegangen, um noch zwei weitere Stunden zu schuften, bevor es Zeit war, ihrem Vater das Abendessen zu bereiten. »Zehn Stunden Maloche die Woche für ein paar Kröten, und dieser schreckliche Mann meint, ich werfe sie ihm in den Rachen?« Sie schleuderte die Geldbörse in den Hof der Hutfirma. »Fragst du dich manchmal auch, ob das Leben überhaupt lebenswert ist?«
»Hier.« Donal hielt ihr seine Mütze hin. »Wisch dir das Gesicht ab. Es macht nichts, wenn sie Blut abbekommt.«
»Hast du kein Taschentuch?«
»Das liegt zu Hause.«
»Und was ist das hier?« Cora schwenkte ein Tuch aus Leinen.
Donal steckte die Hände in die Jackentaschen und stöhnte. Er fiel immer wieder darauf herein, wenn sie ihn bestahl. »Wenn du vor fünfzig Jahren gelebt hättest, hätte man dich gehängt, Cora.«
»Nein. Ich wäre davongekommen. Dich hätten sie gehängt.«
Donal wurde oft für Coras jüngeren Bruder gehalten, dabei war er drei Jahre älter als sie. Und obwohl sie blond war und er dunkelhaarig, hatten sie doch eine gewisse Ähnlichkeit. »Verletzte Unschuld mit kitschigen blauen Augen«, sagte Cora immer.
Er sah zu, wie sie sich die Wange abputzte, und sagte: »Ich dachte, ich hätte dir beigebracht, wie man einem Fiesling eine reinhaut.«
»Das würde ich mich nie trauen.«
»Mein Dad schlägt niemals meine Schwestern, nur uns Jungs.«
»Mein Dad ist ein Gentleman. Gute Erziehung ist schließlich eine Sache der Fäuste.«
Donal dachte kurz über diese seltsame Aussage nach. Dann sagte er: »Dad hat meiner Schwester Sheila nie ein Haar gekrümmt, nicht mal, bevor sie Polizistin wurde. Sie ist ja sowieso schon eine halbe Heilige. Er droht Marion und Doreen immer Prügel an, wenn sie mit jungen Männern ausgehen, macht es aber nie wahr.«
Aus einem Fabrikhof auf der anderen Straßenseite kamen zwei Sportwagen geschossen, auf deren hinteren, offenen Sitzen Frauen saßen und ihre Hüte festhielten. Vor ihnen saßen Männer mit flachen Mützen und modischen Halstüchern. Noch ein Konvoi, der zum Rennen unterwegs war. Einer der Fahrgäste hielt einen Wimpel mit dem Text: »Bennetts Leim – der hält, was er verspricht.«
Cora spürte den blanken Neid in sich aufsteigen. Es musste fantastisch sein, sich ganz dem Augenblick hingeben zu dürfen. Niemals Ausreden erfinden zu müssen. Über den Motorenlärm hinweg schrie sie: »Ich hoffe, ihr bleibt an euren Sitzen kleben!«
»Wir sind diejenigen, die kleben geblieben sind«, sagte Donal traurig. »Wenigstens hattest du die Chance mitzufahren. Meine Großmutter hält nichts von Feiertagen, außer von kirchlichen. Und auch nur dann, wenn man den irischen Heiligen namens Patrick anbetet. Dann gewährt sie uns einen halben Urlaubstag, aber diese halben Tage werden auch jedes Jahr kürzer. Immer dieselben schmutzigen Straßen, immer derselbe schmutzige Fluss, das ist mein Leben.«
Cora blinzelte in den Himmel. Hinter dem Rauch konnte man etwas Blaues erahnen. »Wenn die Sonne auf die Rechtschaffenen scheint, kriegen wir den Regen ab.« Sie zupfte ihn am Arm. »Komm, wir fahren trotzdem.«
Aber nicht in einem zerrissenen Kleid. »Ich muss mir was von einer deiner Schwestern leihen«, sagte sie zu Donal. Über die Tooley Street gingen sie Richtung Barnham Street, wo sie beide an verschiedenen Enden wohnten. Donal musste seinen Karren in die Wäscherei zurückbringen und sich eine Jacke holen. »Wir schleichen uns rein und wieder raus«, bestimmte Cora. »Bis irgendjemand merkt, dass wir da waren, sitzen wir schon im Zug nach Epsom.«
Auf dem Weg zur Wäscherei merkte Donal an, dass sie beide völlig abgebrannt waren. Mit weniger als zehn Shilling konnte man nicht zum Rennen gehen. Und was das Ausleihen eines Kleids anging, war er sehr skeptisch, denn Marion und Doreen verteidigten ihre Sachen wie zwei Löwinnen. Sheila dagegen machte sich nichts aus Kleidern und zog sich auch außerhalb des Dienstes an wie eine Polizistin. »Ihre Kampfmontur willst du nicht mal im Traum tragen.« Er öffnete das Tor. »Wenn Granny uns sieht, frage ich sie, ob ich gehen darf. Ich kann sie nicht anlügen.«
»Dann schau eben, dass sie uns nicht sieht.« Cora folgte Donal in den Hof und duckte sich unter einer Wäscheleine hindurch, an der Männerunterwäsche hing. Es waren sicher dreißig Paar Unterhosen. Wahrscheinlich war gerade ein Schiff eingelaufen. Viele Kunden der Wäscherei waren nämlich Seemänner, die aus Hongkong, Indien oder der Südsee in die Stadt gekommen waren. Bermondsey war so ganz anders. Ein richtiggehend rückständiges Nest. Cora, die im Fenster des Wäschereigebäudes eine Bewegung wahrgenommen hatte, drängte Donal zur Eile. Warum musste der blöde Karren auch so quietschen? Zu spät.
Eine Frau in grüner Schürze kam aus dem Nebengebäude gelaufen. Sie hatte die Ärmel hochgekrempelt und die Haare am Hinterkopf so fest zusammengesteckt, dass ihre Augen leicht verengt wirkten. Immer, wenn Cora Granny Flynn sah, musste sie an eine Frühlingszwiebel denken.
Die alte Frau funkelte Donal böse an. »Du brauchst eine Stunde, um eine Ladung auszuliefern?«
Als sie Cora bemerkte, murmelte sie etwas Unverständliches. Die Kombination aus vielen Zahnlücken und einem untilgbaren Galway-Dialekt machte es den Menschen schwer, Granny zu verstehen, und das sogar in einem Viertel, in dem ein Drittel der Bevölkerung aus Irland eingewandert war.
Donal übersetzte: »Sie fragt, ob du hergekommen bist, um auszuhelfen.«
»Kommt nicht in die Tüte«, erwiderte Cora. »Ich hebe heute nichts Schwereres als meinen Wettabschnitt.«
»Ich könnte ein paar kräftige Hände zum Bügeln gebrauchen«, sagte Granny und ließ den Blick über Coras zerrissenen Ärmel und die Schrammen auf ihren Unterarmen wandern. »Selbst, wenn es zwei linke Hände sind.«
»Tut mir leid, Granny.« Hier hatte Cora ihre erste Stelle bekommen, und zwar mit vierzehn. An einem Freitag hatte sie die Schule abgeschlossen, am Montag darauf hatte sie schon am Waschzuber gestanden. Das Beste an Pettrew & Lofthouse war, dass sie sie aus den unendlich langen Waschtagen befreit hatten. Cora hatte nichts gegen Donals Großmutter und auch nichts gegen die anderen Frauen, aber die schwere Arbeit in der ständig feuchten Luft griff ihre Lunge an. Dazu waren ihre Hände durch die Waschlauge ganz rau geworden, und die Haut zwischen ihren Fingern war eingerissen und wollte nicht heilen.
Einmal hatte sie gefragt: »Warum soll ich mich so quälen, nur damit irgendwelche Mistkerle saubere Leintücher haben?«
Granny hatte sie am Ohr gezogen und geantwortet: »Weil du aus der Arbeiterklasse kommst. Das heißt, viel Arbeit und wenig Klasse.«
Am nächsten Tag war Cora zu Pettrew’s gegangen und hatte um ein Gespräch mit dem Personalchef gebeten. Die Arbeit am Fließband der Hutfabrik bedeutete nicht gerade einen Schritt nach oben auf der sozialen Leiter, aber immerhin verheilten ihre Wunden.
»Nicht gerade heute, aber sonst schwinge ich gern das Bügeleisen in Ihrer Wäscherei«, sagte Cora zu Granny. Immer schön höflich bleiben, ermahnte sie sich. Wer weiß, vielleicht brauchte sie bald wieder Geld. »Jetzt habe ich eine Verabredung mit den oberen Zehntausend.«
Granny kicherte. »Dann hast du dich wohl noch nicht im Spiegel betrachtet.«
Leise sagte Cora zu Donal: »Dieses grüne Kleid, das Sheila am St. Patrick’s Day anhatte, ist das noch irgendwo?«
Donal zuckte mit den Schultern, aber Cora war schon auf dem Weg ins Haupthaus. »Bevor sie vom Dienst kommt, hängt es schon wieder in ihrem Kleiderschrank. Sie wird nichts merken.«
Donal schloss die Tür hinter ihnen. »Natürlich wird sie es merken. Sheila weiß immer, wer den letzten Keks gegessen oder das Gasgeld verwettet hat. Sie würde dir jetzt empfehlen, zurück an die Arbeit zu gehen.«
»Donal, wenn du es jemals zu etwas bringen willst, hör auf, ständig das zu machen, was die anderen von dir wollen. Da draußen liegt die ganze Welt vor dir, und du hast ein Hirn im Kopf. In der Schule warst du der Beste im Rechnen. Und außerdem siehst du gut aus, wenn du nicht gerade auf deine eigenen Stiefelspitzen starrst.«
»Komm, ich sehe mal nach deinem Auge.« Er führte sie in die Küche. An den Wochenenden war es im Haus so laut wie im Zoo, aber jetzt waren die kleineren Kinder in der Schule und alle anderen bei der Arbeit. Donals Mutter war vor zwölf Jahren gestorben, im selben Jahr, in dem Coras Mutter fortgegangen war. Man erzählte sich, Molly Flynn sei an Erschöpfung gestorben, nach zehn Kindern und der anstrengenden Arbeit in der Wäscherei. Coras Mutter Florence Masson dagegen hatte ihre Höschen an einen Schiffsmast gehängt. Was eigentlich nur hieß, sie hatte sich mit einem Seemann davongemacht.
Das stimmte allerdings nicht ganz. Florence hatte England verlassen, zusammen mit einem Mann namens Timothy Cartland – er war Schauspieler, nicht Seemann. Gemeinsam wollten sie ihr Glück am Broadway in New York machen.
Donal tunkte ein Tuch in eine Schale mit kaltem Wasser und gab einen Tropfen Hamamelisextrakt dazu.
Cora sagte: »Ich habe gerade daran gedacht, dass meine Mutter auf den Tag genau seit zwölf Jahren weg ist. Wir sind zusammen zum Rennen gefahren, dann hat sie sich mit meinem Vater gestritten und ist wütend abgerauscht. Ich habe sie nie wieder gesehen.«
»Leg dir das Tuch aufs Auge. Ich schaue mal, ob der Herd an ist. Eine Tasse Tee würde dir guttun.«
Das Tuch brannte auf Coras Haut. Sie rief hinter Donal her: »Mum hat wahrscheinlich alles richtig gemacht. Erst zum Derby, dann fort auf Nimmerwiedersehen. Irgendwann mache ich es genauso. Ich besteige ein Schiff und fahre einfach los.« Zu spät merkte sie, dass Granny Flynn mitten auf der Küchentreppe stand.
»So, so, du willst also zur See fahren, Cora? Ich habe schon gehört, dass du eine Schwäche für Matrosen hast.«
Hinter der alten Frau tauchte Donal wieder auf. »Granny, lass das. So entstehen Gerüchte.«
»So entstehen auch andere Sachen. Außerdem kann ich in meinem eigenen Haus sagen, was ich will.« Granny kam in die Küche und nahm Cora das Tuch vom Gesicht. Sie stieß einen erstaunten Pfiff aus. »Das wird ja so dick wie ein Straußenei. In einer Stunde siehst du die Welt nur noch durch einen Schlitz. Ich nehme an, ihr wollt zum Rennen?« Als Cora nickte, schnaubte sie. »Und wo wollt ihr das Geld dafür hernehmen?«
Cora fuhr mit der Hand unter ihren Rock. Sie fingerte an ihrem Strumpfhalter herum, zog die Hand wieder hervor und wedelte triumphierend mit einigen Pfundscheinen. »Fünf Kröten, noch warm. Zähl sie nur, Donal.«
Das tat er. »Wo hast du die denn her?«
»Ich hab sie meinem Dad aus der Tasche gezogen.«
Granny sah schockiert aus. »Du bestiehlst deinen eigenen Vater?«
»Nur, weil er mich mit einem Boxsack verwechselt hat.«
»Hätte er dich dabei erwischt, hätte er dir den Kopf abgerissen. Und mir gleich dazu«, rief Donal.
Cora grinste. »Hat er aber nicht. Von diesen fünf Pfund machen wir uns den schönsten Tag unseres Lebens. Komm schon, Donal.«
Granny verschränkte die Arme. Das war die Verkörperung des Wortes »Nein«. »Cora Masson, du wirst deinem Vater das Geld zurückgeben. Alles, was dir gehört, ist rechtlich gesehen seins, und außerdem bist du ihm zu Gehorsam verpflichtet.«
Nachdenklich betrachtete Cora die alte Frau. Granny predigte gerne, besonders montags, kurz nachdem Father O’Brien ihr die Beichte abgenommen hatte. Gegen Ende der Woche nahm ihr religiöser Eifer dann wieder ab. »Sie haben leider unrecht. Ich bin nämlich schon über einundzwanzig. Und wenn Sie schon an mein Gewissen appellieren, sollten Sie Ihrem eigenen sagen, dass Donal einen halben Tag Urlaub wirklich verdient hat.« Sie schob sich eine Locke hinter das Ohr. Zugegeben, sie hätte allein fahren können, aber das hätte doch keinen Spaß gemacht. »Der Tag des Derbys ist wie der zweite St. Patrick’s Day. Sie werden mehr Iren beim Rennen finden als auf der Grünen Insel selbst.«
Granny stemmte die Fäuste in die Hüfte. »Ich brauche Donal hier. Es herrscht Hochbetrieb.«
»Es herrscht doch immer Hochbetrieb. Außerdem braucht er ein bisschen Sonne. Sehen Sie sich doch nur seine bleichen Wangen an. Was ist schon ein einziger Nachmittag?« Cora spürte, dass Granny ihren Widerstand langsam aufgab. »Vielleicht gewinnen wir ja beim Rennen und bringen ein Vermögen nach Hause. Dann könnten Sie in Rente gehen und ins schöne Penge oder nach Catford ziehen. Sie müssten nie wieder schmutzige Unterhosen waschen.«
Granny beugte sich zu ihr. »Glaubst du wirklich, du kannst diesem Viertel entrinnen, Mädchen?«
»Wieso denn nicht? Meine Mum hat das doch auch geschafft.«
»Das erzählt man sich, aber du bist wie wir alle. Du steckst hier fest wie ein Schuhnagel im Straßenpflaster.« Sie sah auf Coras ruinierte Strümpfe, dann auf ihre Schuhe. Der Absatz hatte sie daran gehindert, ihrem Vater davonzulaufen. »Eins muss man Florence Masson lassen, sie war immer blitzsauber. Sie hat sich sehr gepflegt und auf ihre Figur geachtet. Tja, so macht man das wohl als ehemalige Schauspielerin.« Granny sprach das Wort »Schauspielerin« aus, als wäre es ein unanständiges Fremdwort.
»Sie hat immer davon gesprochen, eines Tages wieder auf die Bühne zu gehen. Aber Sie haben recht. An dem Tag, als sie verschwand, weinte der Himmel, und sie war so schön wie eine Frühlingsblume.«
Grannys Antwort blieb an ihrem letzten gesunden Zahn hängen. Sie stapfte die Küchentreppe hinauf und zeigte mit dem Daumen auf Donal. »Dann fahr halt und nimm ihn mit. Er kann dich trösten, wenn du deinen letzten Penny verspielt hast.«
Sheila war das älteste Flynn-Mädchen und verdiente ihr eigenes Geld, darum hatte sie ein Zimmer für sich allein. Sie war keine Schönheit. Böse Zungen behaupteten, sie sei bloß deswegen zur Polizei gegangen, weil sie einen Mann nur kriegen konnte, indem sie ihn verhaftete. Cora hegte also keine großen Erwartungen, als sie vor Sheilas Kleiderschrank stand.
Abgeschlossen. Der Schlüssel lag jedoch oben auf dem Schrank.
»Dieses Versteck ist nicht besonders fantasievoll, Constable Flynn.«
Andererseits konnte Sheila sich wohl nicht vorstellen, dass jemand nach dem Schlüssel suchen würde, der so groß war wie sie selbst. Cora, die auf grobe Röcke und sackförmige Strickjacken gefasst war, erstarrte, als sie die prächtige Auswahl sah. Spitzenstolen und seidene Abendkleider, manche davon sogar mit Metallgarn bestickt. Eine Robe aus magentafarbenem Samt nahm gut ein Viertel des Platzes ein.
Die eingenähten Schilder stammten aus Londons besten Kaufhäusern: Harrods, Debenham & Freebody, Liberty. Das smaragdfarbene Kleid, das ganz am Ende der Kleiderstange hing, wirkte dagegen wie ein ärmlicher Verwandter.
Als Cora es überzog, wurde sie von einer Parfümwolke eingehüllt. So, so. Wenn sie Sheilas Lieblingsduft vorher hätte erraten sollen, hätte sie wohl auf Maiglöckchen oder Karbolseife getippt, nicht aber auf exotische Blumen und Gewürze.
Das grüne Kleid hatte gerüschte Ärmel, die an den Schultern weit waren und so die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den gegürteten Bund und die schlanke Hüftpartie lenkten. Cora drehte sich vor dem Spiegel der Frisierkommode. Nicht schlecht. Höchstens ein bisschen langweilig. Vielleicht eher eins der Kleider aus Kunstseide? Aber Donal ging nervös auf dem Treppenabsatz auf und ab und hielt nach seiner Schwester Ausschau, die möglicherweise plötzlich vor der Tür stehen würde. Darum nahm sich Cora bloß noch ein Paar Rayonstrümpfe und dazu crèmefarbene Häkelhandschuhe. Sie betrachtete ihr Spiegelbild. Waren in ihrem Gesicht irgendwelche Schuldgefühle zu erkennen? Nein, keine Spur. Sheila Flynn hatte genügend Kleider, um damit eine Revuetruppe auszustaffieren. Von dem Gehalt einer Polizistin? Nahm die heilige Sheila vielleicht Bestechungsgelder an? Oder bestahl sie Warenhäuser? »Cora, beeil dich!«, zischte Donal durch einen Spalt in der Tür.
Einen Hut. Ihren eigenen, einen billigen Strohhut mit künstlichen Kirschen, hatte sie bei der Flucht vor ihrem Vater verloren. Die Hüte von Pettrew’s konnte sie sich jedenfalls nicht leisten, und die Ausschussware wurde nicht verkauft, sondern geschreddert.
Noch ein weiterer Grund, mich nicht schuldig fühlen zu müssen, dachte Cora und angelte sich die graue und pinkfarbene Hutschachtel, die oben auf dem Kleiderschrank lag. Sie hätte jeden Betrag gewettet, dass es Sheila Flynn gewesen war, die sie verpetzt hatte. Sheila kam nach der Schicht oft in Jac Massons Werkstatt vorbei, wo sie gemeinsam eine Tasse Tee tranken und Jac ihr so manchen Tipp gab. Wer stahl Alteisen? Wer hatte sich gerade ein Kraftfahrzeug oder ein Paar Stiefel zugelegt, die er sich eigentlich nicht leisten konnte? Jac war Ausländer und hielt sich daher nicht an den Londoner Verhaltenskodex, der besagte, dass man sich lieber die Zunge abschnitt als jemanden bei der Polizei anzuschwärzen. Es ging das Gerücht, dass Jac und Sheila etwas miteinander laufen hatten … aber das konnte eigentlich nicht sein. Jac musste gut dreißig Jahre älter als Sheila sein. Nein, es war ein rein geschäftliches Verhältnis. Es ging um Tee und Informationen.
Zweifellos erzählte Sheila auch alle möglichen Dinge über Cora herum. Woher hätte Jac sonst von ihrem Glückslos und dem Bügelgeld wissen können? Cora, die sich mittlerweile ganz im Recht fühlte, öffnete die Hutschachtel und gab einen angeekelten Laut von sich. Der Haufen aus schwarzen Federn im Inneren ähnelte eher einer toten Krähe denn einem Hut. Sie nahm ihn dennoch aus der Schachtel und studierte das angeheftete Schild im Futter: La Passerinette, Paris.
Cora riss die Augen auf. Paris, das war der Ort ihrer Träume. Alle ihre Lieblingsfilme spielten dort, und manchmal, wenn das Leben gerade besonders anstrengend war, stellte sie sich vor, sie sei Jeanette MacDonald, die von Maurice Chevalier neue Kleider angemessen bekam und mit ihm im Duett »Isn’t It Romantic?« sang. Cora probierte den Hut auf und schob ihn so weit nach vorn, dass er ihr verletztes Auge bedeckte. Er hatte einen Netzschleier, der ihr bis zur Oberlippe reichte. Plötzlich kam ihr der Hut ganz hübsch vor. Gar nicht mehr wie eine tote Krähe, sondern vielmehr wie eine Fantasie aus schillernden Federn.
Als letzte Handlung nahm Cora sich eine Handtasche von einem Haken an der Tür. Sie war olivgrün und aus billigem Leder, aber sie brauchte eine Tasche, um ihren Gewinn darin nach Hause zu tragen.
Als der Zug aus dem Bahnhof London Bridge rollte, betrachtete Cora ihr Spiegelbild im Fenster des Dritte-Klasse-Abteils. Sie würde einen Preis für die geborgten Federn auf ihrem Kopf bezahlen müssen. So ging es schließlich immer aus.
Das Los mit der Nummer 22 war am Freitag während der Arbeitspause in der Kantine aus einem Hut gezogen worden. Die Firma Pettrew & Lofthouse war ein fortschrittliches Unternehmen, das seinen Arbeitern eine zwanzigminütige Pause während der langen zweiten Schicht gewährte. Es gab starken Tee aus riesigen Kannen, die ein bisschen an silberne Schwäne mit gebogenen Hälsen erinnerten. Dazu durfte man sich entweder ein Rosinenbrötchen oder ein Butterbrot nehmen. Als Coras Los gezogen wurde, ließ sie ihr Rosinenbrötchen halb aufgegessen liegen, schubste ihren Stuhl zur Seite und tanzte vor Freude einen Charleston. Diesen Tanz hatte sie von ihrer Mutter gelernt, und er schlummerte in ihren Füßen, immer bereit, bei der kleinsten Gelegenheit hervorzubrechen. Sie hüpfte und kickte, wirbelte mit den Händen, kurz, sie lieferte ihrem Publikum eine tolle Vorstellung. Selbst die kühlen Blicke des alten Pettrew und der anderen Direktoren konnten sie nicht bremsen.
»Los, Cora, zeig uns den Shimmy!«, riefen ihre Freundinnen, und sie hätte ihnen den Wunsch gern erfüllt, hätte sie nicht hinter sich das laute Räuspern ihrer Vorarbeiterin Miss McCullum vernommen. »Miss Masson?« Die Vorarbeiterin deutete mit dem Kopf auf die Tür.
In ihrem Büro sagte Miss McCullum vorwurfsvoll: »Cora, dieses Verhalten war höchst unpassend!«
»Ich weiß, Miss, aber mir war nach Feiern zumute.«
»Mag sein, aber bei Pettrew & Lofthouse achten wir die Werte unserer Gründer. Bei der Arbeit dürfen Sie gern in gedämpftem Ton singen. Aber eine Josephine-Baker-Imitation erwarte ich wirklich nicht von Ihnen!«
Cora entschuldigte sich zwar, dachte aber bei sich: Dann kennen Sie mich wohl nicht gut genug.
Es entstand ein kurzer Augenblick der Stille, während Miss McCullum überlegte. »Sie haben also einen Platz für den Ausflug zum Rennen gewonnen, aber sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie einen halben Tag Urlaub dafür opfern möchten?«
Cora blinzelte. So eine dumme Frage.
»Miss Lofthouse und ich, wir beobachten Sie schon eine Weile.«
Miss Lofthouse war die Schwester einer der Geschäftsführer und selbst Direktorin.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Cora misstrauisch.
»Wir betrachten Sie als Kandidatin für eine Beförderung, wie Sie vielleicht schon an der Gehaltserhöhung gemerkt haben, die wir Ihnen freiwillig gewährt haben.«
»Ach.« Letzten Monat hatte Cora vier zusätzliche Shilling in ihrer Lohntüte gefunden. Das war sicher gut gemeint, half ihr aber nicht so sehr, wie die Vorarbeiterin vielleicht glaubte. Neuigkeiten über Gehaltserhöhungen sickerten immer durch, und wer als Liebling der Geschäftsleitung galt, hatte keinen leichten Stand bei den Arbeitskollegen. Außerdem würde eine Beförderung nur bedeuten, dass sie zukünftig in den Gängen hin- und herlaufen, die Arbeit ihrer Freundinnen kontrollieren und ihre Fehler mit ausbaden musste. Das alles für ein wenig mehr Geld, von dem sie vermutlich ohnehin nichts sehen würde.
Miss McCullum fügte noch hinzu: »Das sage ich Ihnen jetzt im Vertrauen, Cora: Meine Stellung in der Damen-Filz-Verarbeitung wird vielleicht bald frei.« Sie zog eine Braue hoch, als erwarte sie eine Antwort darauf, aber Cora fiel keine ein. Alle wussten, dass die Vorarbeiterinnen mindestens Hutmacherlehrlinge sein mussten, geschult in der hohen Kunst des Blockens und der Feinbearbeitung. Pettrew & Lofthouse statteten Politiker, Lords und Ladys, ja sogar den Adel mit Kopfbedeckungen aus. Die Geschäftsführer waren allesamt Herren, die in einem Kraftfahrzeug mit Chauffeur zur Arbeit gefahren kamen – bis auf Miss Lucilla Lofthouse, die mit dem Fahrrad fuhr. Aber sie war früher eine Suffragette gewesen und wollte damit anscheinend ein Zeichen setzen. Die leitenden Angestellten bemühten sich um ein Oberklassen-Englisch und zogen sich entsprechend an. Miss McCullum etwa trug ein zigarrenbraunes Kostüm mit Spitzenkragen, und ihre Brille baumelte an einer dünnen Goldkette vor ihrer Brust. Wenn sie in den Werkraum kam, in dem Cora arbeitete, wurden alle still.
»Ich kenne mich doch bloß mit Damenfilz und Strohhüten aus«, platzte es aus Cora heraus. »Ich könnte niemals einen Hut ordentlich blocken, jedenfalls keinen, den irgendjemand später tragen möchte, denn ich bin total ungeschickt.« Sie hob die linke Hand. »In der Schule haben sie mich gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben, deswegen kann ich heute gar nichts richtig machen, nicht mal eine Kartoffel schälen. Ich habe noch nie mit Steifleinen oder Sisal gearbeitet, nicht mal mit Plüsch. Ich bin bloß Zuschneiderin. Ich tauge nicht zur Vorarbeiterin.«
»Da haben Sie ganz recht, dafür sind Sie noch viel zu unerfahren. Aber ich wollte gerade sagen, dass Miss Lofthouse und ich beschlossen haben, eine untergeordnete Position einzurichten, und zwar die einer Assistentin der Vorarbeiterin. Dafür halten wir Sie durchaus für geeignet. Sie würden dabei Praxiserfahrung sammeln können.«
Und was hatte das damit zu tun, dass sie zum Derby wollte? Diese Frage war Cora vermutlich vom Gesicht abzulesen, denn Miss McCullum sagte: »Einer zukünftigen Assistentin der Vorarbeiterin steht es nicht gut zu Gesicht, sich bei proletenhaften Vergnügungen blicken zu lassen. Sie sollten daher von einem solchen Vorhaben Abstand nehmen.«
Meinte sie das ernst? Die Aussicht auf eine Beförderung erschien Cora wie ein sehr kleines Marmeladenbrot, das die Vorarbeiterin von einer sehr langen Angelrute vor ihrem Kopf baumeln ließ, während das Derby bloß noch sechs Tage entfernt und gleichzeitig der schönste Tag des Jahres für Cora war. Miss McCullum gegenüber konnte sie natürlich nicht ehrlich sein, aber die Arbeit in der Hutfabrik war schrecklich langweilig. Immer dasselbe Ripsband, immer in Marineblau, Dunkelbraun oder Flaschengrün. Ganz selten einmal kam eine Rosette oder gar eine winzige Feder an einen Hut, aber die Modelle von Pettrew waren im Grunde genommen ziemlich langweilig. Zugegeben, sie waren elegant und langlebig, aber eben auch konservativ. Nun, das sollten sie ja auch sein.
»Miss McCullum, da draußen gibt es eine ganze Welt zu entdecken, mit wundervollen Farben. Ich möchte doch nur ein bisschen Urlaub haben, um sie mir anzusehen.«
Der Blick der Vorarbeiterin wurde kühl. Cora wusste nicht viel über Jean McCullum, nur, dass sie der Familie Lofthouse aus Schottland hierher gefolgt war, als diese die Firma von Pettrew übernommen hatte. Miss McCullum gehörte wie die Lofthouses den Methodisten an, was bedeutete, sie erhob niemals die Stimme oder bediente sich gar unbeherrschter Sprache; sie konnte aber eine ganze Predigt mit einem einzigen Blick übermitteln. Ihr braunes Kleid gab Cora das Gefühl, ihre eigene gelbe Strickjacke mit den roten Punkten sei vollkommen unangemessen.
»Cora, mit ›Urlaub‹ meinen Sie wohl ›Freiheit‹?«
»Was ist daran denn verkehrt?«
Miss McCullum schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Freiheit ist eine gute Sache, solange feste Regeln nicht angetastet werden. Genau das will ich Ihnen sagen. Nennen Sie mir eine andere seriöse Branche, in der es ein Mädchen wie Sie irgendwann zu einem Gehalt von zweihundert Pfund im Jahr schaffen kann. Das ist so viel, wie ein gut verdienender Mann nach Hause bringt. Geben Sie sich nicht mit einem Leben als schlecht bezahlte Arbeiterin zufrieden, Cora. Ergreifen Sie Ihre Chance.«
»Das tue ich doch.«
»Ich rede von den richtigen Chancen. Auch ich habe an der Werkbank angefangen. Miss Lofthouse ist eine von nur einer Handvoll weiblicher Direktoren in ganz London. Sie hat Hutmacherin gelernt. Und Sie könnten mit dreißig Vorarbeiterin sein. Ist das etwa nichts?«
Cora wusste es nicht. Dreißig, das schien noch ein ganzes Jahrhundert entfernt zu sein. Aber der Tag des Derbys war ganz nah. Ihr Blick fiel auf das Fenster, auf die Wolken am Himmel, den nicht einmal der Rauch aus den Fabrikschloten trüben konnte. Wer mochte schon Regeln, außer den Leuten, die sie gemacht hatten? Anscheinend hatte jeder eine Vorstellung davon, was Cora aus ihrem Leben machen sollte, und sie alle führten direkt durch das Fabriktor. Dabei wusste sie, dass Miss McCullum es nur gut mit ihr meinte. Sie wollte nicht undankbar erscheinen. Also sagte sie die Wahrheit. »Ich möchte mein Glück in Paris versuchen.«
»In Paris? Himmel, warum denn das?«
»Love Me Tonight.«
»Wie bitte?«
»Das ist ein Film. Sie müssen sich unbedingt auch Roberta mit Irene Dunne ansehen. Die Kleider, die Hüte … In Paris wäre ich im Himmel.«
»Filme sind nicht das echte Leben, Cora.«
»Oh, doch, Miss McCullum. Sie sind das echte Leben, nur eben das anderer Leute.«
»Wollen Sie wirklich das Leben anderer Leute leben?«
»Auf jeden Fall.«
Miss McCullum blinzelte. »Ich glaube, Sie haben das nicht ganz durchdacht, Liebes. Wenn Sie es wirklich nach Paris schaffen würden, was würden Sie dort denn machen?«
»Ich kann ein bisschen singen, und meine Tanzkünste haben Sie ja gesehen. Ich könnte auf die Bühne gehen, wie meine Mum.«
»Nein. Dafür sind Sie nicht dünn und hübsch genug.«
Cora wollte gerade protestieren und erklären, dass das auch Joan Crawford nicht abgehalten hatte, bremste sich dann aber. Dieses ganze Gerede von der Schauspielerei war in Wirklichkeit bloß eine Nebelkerze. Sie wusste gar nicht, was sie anfangen sollte mit ihrem Leben. Sie wusste bloß, dass sie nicht an der Werkbank alt werden oder einen Mann namens Albert oder Bill heiraten wollte, nur um den Fäusten ihres Vaters und der Fabriksirene zu entfliehen.
Jetzt, da der Zug nach Epsom durch New Cross, Forest Hill und Croydon dampfte, dachte Cora an das Gespräch mit Miss McCullum zurück und gab ihm einen anderen Schluss. »Es ist so: Ich will nicht bei Pettrew’s bleiben. Ich will nach Paris. Oder nach Timbuktu oder nach China. Egal, wohin, Miss McCullum. Aber ich habe leider nicht den Mut dazu. Ich bin ein Feigling. Wie Granny Flynn sagt: Ich stecke hier fest wie ein Schuhnagel im Straßenpflaster.«
Donal und Cora kauften Eintrittskarten für die öffentliche Tribüne. Sie hatten zwar nur Stehplätze, aber immerhin gute Sicht auf die Rennstrecke. Auf der gegenüberliegenden Seite lag The Hill, wo man keinen Eintritt bezahlen musste; dort tummelten sich viele Zuschauer zwischen Autos und offenen Doppeldeckerbussen. Die Sonne wurde von den Metallgeländern reflektiert und blendete, sodass Cora froh um den Schleier an ihrem Hut war. »Welches Rennen kommt jetzt?«, wollte sie von Donal wissen. Einige Jockeys galoppierten in den hinteren Bereich der Strecke.
Donal warf einen Blick auf seine Karte. »Die machen sich für das Rennen um halb drei bereit. Bis zum großen Rennen dauert es noch eine halbe Stunde.« Die Buchmacher wuselten aufgeregt herum, und die Tic-Tac-Men, deren Aufgabe es war, die Wettquoten per Winkzeichen anzuzeigen, waren voll ausgelastet. Die Quoten wurden laut ausgerufen, die Anfangspreise heraufgesetzt, auf der Tafel wieder ausgewischt und neu aufgeschrieben. Jedes Mal, wenn sich die Quote eines Pferds veränderte, ging ein Raunen durch die Menge. Cora hatte Donal zwei Pfund gegeben. Sie hatten sich ihre Fahrkarten und Tribünenplätze gekauft und noch ein paar Shilling für das Essen zurückbehalten. Alles andere setzte Cora auf ein einziges Pferd, das gewinnen würde.
»Hör zu, hier kommt mein Plan«, schrie sie Donal zu, als die Menge begeistert die Pferde des Halb-drei-Rennens begrüßte. »Du besorgst uns was zu essen und zu trinken, und ich mische mich unter die Leute. Ich werde herausfinden, welches Pferd der beste Außenseiter fürs Derby-Stakes-Rennen ist.«
»Ein Außenseiter? Meinst du wirklich?«
»Ich mag Außenseiter, Donal. Ich bin ja selber einer.«
Als Cora bei der Anzeigetafel angelangt war, donnerte das Halb-drei-Rennen gerade vorbei. Die Gewinner wurden ausgerufen, und die Zuschauer johlten wie verrückt. Noch eine Viertelstunde, dann würde man die Tafel blankwischen und die Pferde des Derby-Stakes-Rennens anschreiben. Sie las sich die Liste durch.
Cash Book und Perifox waren die Favoriten und standen bei sieben zu eins. Danach kamen Le Ksar und Goya II mit neun zu eins. Cora las sich die Namen laut vor. Welcher hatte diesen ganz besonderen Klang, den nur ein Gewinner besaß? Bei Nummer zehn horchte sie auf: Mid-day Sun. Sie spürte … nun, nicht gerade ein Kribbeln, aber irgendein Gefühl, dessen Ursprung sie nicht genau bestimmen konnte.
Mid-day Sun stand bei einhundert zu sieben, genau wie ein Fohlen namens Gainsborough Lass. Die Quoten waren hoch, die Gewinnaussichten niedrig. Sie suchte nach Donal, sah aber nur Männer und Frauen, die ihre Rennkarten studierten. Sie würde allein entscheiden müssen. Immer wieder blieb sie bei dem Namen Mid-day Sun hängen. Einhundert zu sieben – wenn er gewann. Bei einem Einsatz von zwei Pfund und zehn würde sie … – sie musste ihr Hirn anstrengen – … zwischen dreißig und vierzig Pfund gewinnen. Das war genug, um von ihrem Vater wegzukommen und sich eine Weile über Wasser halten zu können, bis ein besserer Job in Sicht war. Cora, hör auf, dir Hoffnungen zu machen, ermahnte sie sich selbst. Die Chance, dass Mid-day Sun das Derby gewann, war ungefähr so groß wie die Chance, dass ihr Vater mit einem großen Blumenstrauß und Fish and Chips zum Abendessen nach Hause kommen würde. Es gelang ihr trotzdem nicht, das aufgeregte Gefühl im Bauch zu verdrängen.
Ein Mann aus einer Gruppe vor ihr verkündete gerade, dass sein Favorit Perifox aus Kentucky kam und dass er den Boden gerne hart hatte. Kentucky … sagten die Reichen so zu Kent? Cora bohrte ihre Absätze in den Boden. Der fühlte sich ziemlich hart an. Und Mid-day Sun? Bevorzugte auch er harten Boden? Sie stampfte auf. Plötzlich schrie jemand auf! Sie drehte sich um und sah einen Mann im Cutaway. Er hüpfte auf einem Bein und hielt sich den Fuß. Sie machte einen Schritt auf ihn zu, bereit, seinen Zylinder aufzufangen, falls der zu Boden fiel. Wütend funkelte der Mann sie an. »Warum zum Teufel stapfen Sie mir auf den Fuß?«
»Um zu testen, ob der Boden hart ist oder nicht.«
»Ihr Absatz ist auf jeden Fall hart, das kann ich Ihnen versichern.«